Im dritten Teil meines Johannes-Blogs beschäftige ich mich mit den Kapiteln 13 bis 21 des Johannesevangeliums, wie es Hartwig Thyen und Klaus Wengst in ihren wissenschaftlichen Kommentaren und Ton Veerkamp in seiner befreiungstheologischen Lektüre betrachten. Inzwischen ist meine Kommentierung der drei Auslegungen des vierten Evangeliums beendet – und ich bin nach wie vor gespannt auf Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern!

Zum Johannes-Blog 1: „Der offenbare Messias“ (1,1 – 4,54)
Zum Johannes-Blog 2: „Der verborgene Messias“ (5,1 – 12,50)
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort zum Johannes-Blog 3
Vor dem Pascha: Jesu Fußwaschung und der Verrat des Judas (Johannes 13,1-30a)
Johannes 13,4-11: Jesus leistet seinen Schülern den Sklavendienst der Fußwaschung
Johannes 13,12-17: Jesu Gebot, einander die Füße zu waschen
Johannes 13,18-20: Vom Verrat als Erfüllung der Schrift und von der Aufnahme der Gesandten Jesu
Johannes 13,27-30: Judas zugleich als Hausgenosse und Verräter des Messias an den Widersacher
Es war aber Nacht: Die Abschiedsgespräche des Messias (Johannes 13,30b-17a)
Johannes 13,31-32: In der Nacht des Messias beginnt seine Ehre als Gottes Ehre
Johannes 13,33-35: Jesu neues Gebot der Solidarität für die zurückbleibenden Schüler
Johannes 13,36-38: Jesu Gespräch mit Petrus über seine Nachfolge und seine Verleugnung
Johannes 14,1: Auf Gott und Jesus vertrauen, damit das Herz nicht erschüttert wird
Johannes 14,2-3: Jesus geht hin, um den Seinen einen Ort auf Dauer zu gründen
Johannes 14,4-7: In Jesus als Weg, Treue und Leben ist der VATER zu erkennen
Johannes 14,8-15: Wer Jesus sieht, sieht den VATER und tut die Werke seiner agapē
Johannes 14,15-17: Die Inspiration der Treue als ein anderer Beistand, paraklētos
Johannes 14,18-21: Jesu zukünftige Gegenwart bei denen, die seine Gebote halten
Johannes 14,22-26: Wie sich Jesus seiner Schülerschaft zu erkennen gibt und nicht dem kosmos
Johannes 14,27-31: Jesu Kampfansage gegen den „Frieden“ der Weltordnung
Johannes 15,1: Jesus als der getreue Weinstock und sein VATER als der Winzer
Johannes 15,2-5: Das Fruchtbringen und die Reinigung der Reben am Weinstock
Johannes 15,6-8: Vom Nicht-Bleiben und Bleiben bei Jesus und dem Fruchtbringen zur Ehre des VATERS
Johannes 15,9-11: Standfest in der Liebe des VATERS bleiben und Freude erfahren
Johannes 15,12-17: Jesu Gebot der Solidarität für die von ihm erwählten Freunde
Johannes 15,18-21: Der Hass des kosmos und „ihre“ Verfolgung der aus dem kosmos Erwählten
Johannes 15,22-25: „Ihr“ unentschuldbarer und grundloser Hass gegen Jesus und seinen VATER
Johannes 15,26-27: Der Geist der Wahrheit und Jesu Schüler als seine Zeugen
Johannes 16,1-3: Die Gefahr, ohne den Schutz der Synagoge zu Fall zu kommen
Johannes 16,4-7: „Ihre“ Stunde, der Weggang Jesu und das Kommen des Parakleten
Johannes 16,20-22: Die bleibende Freude der Schüler Jesu in der Stunde der Frau
Johannes 16,29-32: Trotz ihres Vertrauens werden die Schüler Jesus allein lassen
Johannes 16,33: Der Friede des Messias und die Überwindung der Weltordnung
Es war aber Nacht: Das Gebet des Messias (Johannes 17,1-26)
Johannes 17,12: Jesu Bewahrung der Seinen im NAMEN außer dem Sohn des Verderbens
Johannes 17,17-19: Die Heiligung der in die Weltordnung Gesandten in der Treue
Johannes 17,25-26: Den VATER im NAMEN erkennen und aus seiner Solidarität leben
Es war aber Nacht: Verhaftung und Verhör des Messias (Johannes 18,1-28a)
Johannes 18,3: Judas als Anführer einer bewaffneten römisch-judäischen Truppe
Johannes 18,10-11: Jesus weist Simon Petrus zurecht, der zum Schwert greift
Johannes 18,25-27: Petrus verleugnet Jesus zwei weitere Male am Kohlenfeuer
Johannes 18,28a: Die Überführung Jesu von Kaiphas vor das Prätorium
Johannes 18,29-32: Zuständigkeitsgerangel zwischen Pilatus und Jesu Anklägern
Johannes 18,33-38a: Verhör Jesu durch Pilatus über Jesu Königtum der Treue
Johannes 19,4-5: Pilatus führt Jesus seinen Anklägern vor als „den Menschen“
Johannes 19,8-11: Die Furcht des Pilatus und die Frage, ob und woher er Macht hat
Rüsttag des Pascha: Jesus als der gekreuzigte König Israels (Johannes 19,14-42)
Johannes 19,23-24: Vier römische Soldaten teilen Jesu Kleider und werfen das Los über sein Gewand
„Tag eins“ der neuen Schöpfung (Johannes 20,1-29)
Johannes 20,3-10: Der Wettlauf von Petrus und dem anderen Schüler zu Jesu Grab
Johannes 20,24-25: Thomas will die Wundmale Jesu sehen und ertasten, um vertrauen zu können
Johannes 20,30-31: Einige Zeichen Jesu sind aufgeschrieben, „damit ihr vertraut“
Johannes 21,1-2: Jesus lässt sich am See von Tiberias öffentlich vor sieben seiner Schüler sehen
Johannes 21,14: Zum dritten Mal lässt sich Jesus von den Schülern öffentlich sehen
Johannes 21,19b-23: Die Nachfolge des Petrus und des Schülers, dem Jesus solidarisch verbunden war
↑ Geleitwort zum Johannes-Blog 3
Den zweiten Teil meines Johannes-Blogs habe ich heute, am 19. September 2022, beendet, um ihn wie den ersten nicht all zu lang werden zu lassen. Wiederum bitte ich alle allgemein einführenden Hinweise zum Johannes-Blog am Beginn des ersten Teils nachzulesen. Der dritte Teil startet sofort mit den Vorbemerkungen zum 13. Kapitel des Johannesevangeliums; die zugehörigen Anmerkungen werden fortlaufend ab der Nr. 937 weitergeführt.
↑ Vor dem Pascha: Jesu Fußwaschung und der Verrat des Judas (Johannes 13,1-30a)
[20. September 2022] Nachdem bereits drei Mal im Johannesevangelium die Nähe eines Passafestes erwähnt worden ist (2,13; 6,4; 11,55), erzählt der „dritte Teil“, nachdem Jesus sich aus seiner Lehrtätigkeit in die Verborgenheit zurückgezogen hat,„das große Pascha des Messias“. Angesichts der verheerenden Ausmaße der Versklavung unter die römische Weltordnung, mit der die judäische Führung kollaboriert, kann nicht sinnvoll ein Passafest als Fest der Befreiung gefeiert werden. Stattdessen ist nach Ton Veerkamp <937> der „Weggang des Messias“ als „der neue Auszug Israels“ zu begreifen. Paradoxerweise begreift Johannes „die Nacht des Abschieds des Messias von der messianischen Gemeinde und der Auslieferung des Messias in die Hände des Feindes durch die Führung Judäas“ als die Nacht des neuen Exodus aus dem Sklavenhaus Roms.
Bei der Unterteilung dieses dritten Teils in „fünf Abschnitte“ lässt sich Veerkamp wieder durch klare Hinweise des Evangelisten leiten; er sieht sie als „durch Zeitangaben voneinander getrennt“:
Vor dem Pascha, 13,1-30a
Es war Nacht, 13,30b-18,28a
Der erste Teil der Passionserzählung: Frühmorgens, 18,28b-19,13
Der zweite Teil der Passionserzählung: ˁErev Pascha, 19,14-42
Tag eins der Schabbatwoche, 20,1-31.
Alles, was in den ersten vier Abschnitten (Kapitel 13-19) erzählt wird, spielt sich innerhalb der Zeitspanne eines einziges Tages vom Vorabend bis zum Abend des Karfreitags ab. Damit
sind wir in der unmittelbaren Nähe des Paschafestes angelangt, am Vorabend der paraskeuē, des Vorbereitungstages für das Paschafest, den die Juden ˁerev pessach, aramäisch ˁerev pascha, nennen.“
Die Zeit vor dem ˁerev pascha ist in drei Abschnitte unterteilt: die Zeit des letzten Abendmahles (13,1-30a), die Nacht (13,30b-18.28a) und den frühen Morgen (18,28b-19,13). Man sieht, dass die Abschnitte der Nacht den Schwerpunkt darstellen. Dieses Zentrum ist umrahmt von zwei kürzeren Stücken: die Mahlzeit und Frühmorgens vor dem Sitz der römischen Behörde.
Inhaltlich sind nach Veerkamp die drei ersten Abschnitte kunstvoll aufeinander bezogen:
Das erste Stück zeigt, dass der Messias Herr genannt wird, aber der Sklave ist. Und das zweite Rahmenstück macht deutlich, dass der Messias König ist, aber ein völlig anderer König als alle anderen vor ihm und nach ihm. Nur als Sklave ist der Messias König.
Die lange Nacht zwischen dem Abend und dem frühen Morgen wird Jesus versuchen, das Wesen seiner Messianität und die Folgen für die Schüler zu erklären.
An ˁerev pascha selber, am Vorbereitungstag für das Passafest, wird der Messias gekreuzigt und ins Grab gelegt, aber am Sabbat, mit dem dieses Passafest beginnt, also am
Haupttag des Festes selber geschieht nichts; alles geschieht unmittelbar vor und nach dem Fest. Dieser Tag ist die große und entscheidende Leerstelle. Sie zeigt, dass die Theologie des Johannesevangeliums eine theologia negativa {Theologie der Verneinung} ist. Die „Übergabe der Inspiration“ ist das Wesen des Abschieds, 19,30. Die Annahme dieses Abschieds ist die „Annahme der Inspiration“, 20,22. Sie ermöglicht der Gemeinde ein messianisches Leben ohne Messias.
In diesem fünften Abschnitt des dritten Teils beginnen die Geschehnisse am frühen Morgen des Tages eins der neuen Woche und werden am Abend dieses Tages (20,19) bzw. acht Tage später (20,26) fortgesetzt. Diese beiden Zeitangaben versteht Veerkamp nicht als Signale für die Abgrenzung weiterer Textabschnitte.
Klaus Wengst (W389) fasst schon in der Überschrift, die er der mit Kapitel 13 beginnenden zweiten Hälfte des Johannesevangeliums gibt, seine diesbezügliche Interpretation zusammen: „Der ans Kreuz gehende Jesus gibt sich den Glaubenden als zu Gott Zurückkehrender zu verstehen und verheißt seine Gegenwart im Geist (13,1-20,29)“. In diesen Kapiteln soll also die „schärfste Anfrage“ beantwortet werden, „die von der jüdischen Umwelt gestellt“ und „innerhalb der Erzählung des Evangeliums in dessen erstem Teil zuletzt gebracht“ wurde:
Nach 12,34 sagten „die Leute“: „Wir haben aus der Tora gehört, dass der Gesalbte für immer bleibt. Wieso sagst du, dass der Menschensohn erhöht werden muss?“ Wie kann also derjenige der Messias sein, der am Kreuz so schrecklich hingerichtet worden ist? Diese Frage enthält noch eine weitere: <938> Wie kann man jemanden als Messias bekennen, der nicht da bzw. nicht mehr da ist, den diejenigen, die ihn bekennen, nicht sehen und anderen nicht vorweisen können, der folglich auch gar nicht tun kann, was man von einem Messias füglich erwarten darf?
Die Antwort auf diese Fragen erfolgt „nicht um Außenstehende zu überzeugen, sondern um die eigene Gruppe zu vergewissern, die von diesen Fragen angefochten wird.“ Dabei stellt Johannes in „den erzählenden Teilen in 13,1-30 und 18,1-19,42“ Jesu
Hinrichtung und das, was ihr am letzten Tag seines Lebens vorausging, so dar, dass die Leser- und Hörerschaft versteht: In diesem Geschehen kehrt Jesus in die Herrlichkeit des Vaters zurück; es geht nicht nur um eine bloße Hinrichtung, sondern um das Handeln des hier gegenwärtigen Gottes.
Das ist in Wengsts Augen die Antwort des Johannes auf die erste Frage, „wieso Jesus als am Kreuz Hingerichteter der Messias sein könne.“
Das zweite Problem, „dass dieser Messias nicht mehr anwesend ist, von anderen nicht gesehen werden und selbst nicht handeln kann“, beklagt Johannes in den „Abschiedsreden in 13,31-16,33“ und im „Gebet Jesu in Kap. 17“ nicht
als Mangel, sondern begreift sie als Bedingung der Möglichkeit für etwas Größeres: die Anwesenheit der heiligen Geisteskraft als der Stellvertreterin Jesu. Jesus ist „beim Vater“ – und eben damit ist er im Sinne der Ausweisbarkeit und Vorweisbarkeit nicht da, nicht präsent. Aber es gibt „Ersatz“ und mehr als Ersatz. Der Paraklet, die von Jesus in der Situation des Abschieds „herbeigerufene“ und dann von ihm als Erhöhtem gesandte heilige Geisteskraft, wird an den Messias erinnern, der da war. Die lebendige Erinnerung, die Gegenwart Jesu in der Kraft des Geistes, lässt die Glaubenden bei seinem Wort „bleiben und „die größeren Taten“ tun, die noch zu tun sind.
Schließlich geht Johannes im Kapitel 20,1-29 (W389f.)
auf beide Fragen zugleich ein. In den Erzählungen über das leere Grab Jesu und über seine Erscheinungen vor Mirjam aus Magdala und vor Schülern macht er deutlich, dass Jesus mit seiner Hinrichtung kein ein für alle Mal Toter – und also auch erledigter Messias – ist, sondern für immer lebt. Ebenso klar stellt er heraus, dass er jedoch nicht mehr in der Weise greifbar ist, wie er es vor seinem Tode war. Darüber hinaus gibt er Hinweise dafür, wie Jesus als Lebendiger begriffen werden kann.
Damit stimmt die Aufteilung dessen, was Veerkamp als den dritten Teil des Evangeliums begreift, bei Wengst nur im Blick auf den ersten und letzten Abschnitt überein. Den Mittelteil sieht er unterteilt in die Abschiedsreden und das Gebet Jesu einerseits und einen weiteren mit 18,1 beginnenden erzählenden Teil andererseits.
Inhaltlich fällt auf, dass Wengst die Kreuzigung Jesu im Sinne einer Rückkehr Jesu „in die Herrlichkeit des Vaters“ versteht, wodurch er ewiges Leben erhält und in der „Geisteskraft“ bei denen sein kann, die an ihn glauben. Veerkamp begreift das Aufsteigen Jesu zum VATER zwar auch im Sinne der „Übergabe der Inspiration“ an die messianische Gemeinde, aber er kehrt nicht einfach „in die Herrlichkeit des Vaters“ zurück, weil die „Herrlichkeit“ oder „Ehre“ des VATERS (doxa, kavod) erst zum Ziel gekommen ist, wenn das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker anbricht. Das ist bis heute nicht der Fall, aber durch die Kreuzigung des Messias ist nach Johannes jede grausam herrschende Weltordnung überwunden und entmachtet, so dass ein messianisches Leben in solidarischer Liebe möglich ist, um die kommende Weltzeit tätig zu erwarten.
Für Hartwig Thyen (T582) beginnt mit Johannes 13 der fünfte Akt des Evangeliums als ein „esoterisches Zwischenspiel der dramatischen Historie Jesu nach Johannes: Der lange Abschied Jesu von seinen Jüngern (13,1-17,26)“. Von einem „esoterischen Zwischenspiel“ spricht er deshalb, weil er
Bultmanns Bezeichnung von Joh 1-12 als die „Offenbarung Jesu vor der Welt“ und deren Unterscheidung von Joh 12-20 (!) als „Offenbarung Jesu vor der Gemeinde“ nicht zu folgen [vermag], weil der Prozeß Gottes mit der Welt nach dieser Episode ja nicht nur weitergeht, sondern seine Klimax überhaupt erst in Kap. 18f erreicht, wenn sich der Angeklagte, Verurteilte und Getötete endlich als der wahre Weltenrichter und Lebensstifter erweisen wird.
Zu Beginn der Auslegung dieses Aktes unterstreicht Thyen nochmals seine Ablehnung „der vielfältigen Bemühungen, in den Kapiteln 13-17 verschiedenartige Schichten und Stufen der Genese dieses großen Blocks aufzuweisen und deren mutmaßliche Quellen zu eruieren“ und nennt „auch hier denjenigen, dem wir die überlieferte Gestalt und Textfolge der fünf Kapitel verdanken, den vierten Evangelisten.“ Allerdings ist auch er zu dieser Einschätzung erst gelangt, nachdem er „einst (vergeblich) versucht“ hat, „der Lösung des ,johanneischen Rätsels‘ auf dem Wege einer literarkritisch fundierten redaktionsgeschichtlichen Interpretation des Evangeliums näher zu kommen“, denn „das gesamte Evangelium“ will, wie Segovia <939> meint (T582f.),
– mag es auch „das Endprodukt eines Prozesses der Anreicherung und Erweiterung“ sein – dennoch, als „ein künstlerisches und konzeptionelles Ganzes“ gelesen sein … Und das gilt zumal darum, weil wir erkannt haben, daß jegliche derartige „Theorie über einen solchen Prozess der Anreicherung und Erweiterung wenig Licht auf den gegenwärtigen Sinn der Rede wirft“. Darum können wir uns Segovias Worte über diesen Wechsel von einer redaktionsgeschichtlichen zu einer integrativen Perspektive der Johanneslektüre zu eigen machen und zu unserem Umgang mit dem Text mit Segovia erklären: „Mit diesem Wechsel von einer redaktionellen zu einer integrativen Perspektive hat sich ein weiterer Wechsel vollzogen, weg von der Vorstellung eines einzigen und objektiven Sinns im Text oder im Autor dieses Textes – eine allgemeine Voraussetzung des redaktionellen Ansatzes – hin zur Vorstellung von Sinn als einer Verhandlung zwischen Text und Leser. Mit einem solchen Wechsel würde ich nicht mehr den Anspruch erheben, die definitive Auslegung dieses Textes gegen all jene zu vertreten, die eine andere Auslegung vertreten. Ich versuche stattdessen, eine Auslegung zu bieten, die umfassend und überzeugend ist, die in gewisser Weise meinen eigenen sozialen Standort und meine ideologische Haltung als Leser und Ausleger widerspiegelt und die nicht als die einzige objektive und endgültige Möglichkeit, den Text zu lesen, dargestellt wird. Die Auslegung ist eine von mehreren solchen Auslegungen, und als solche biete ich sie meinen eigenen Lesern an.“
Mit dieser Haltung kann ich mich sehr gut anfreunden, indem ich in meinem Johannes-Blog ja drei verschiedene beeindruckende Lektüren des vierten Evangeliums in ein Gespräch miteinander zu verwickeln versuche, um ihre jeweiligen Stärken und Defizite auszuloten und die bislang in der akademischen Welt vollkommen außer Acht gelassene Johannes-Auslegung von Ton Veerkamp zu ihrem Recht kommen zu lassen.
↑ Johannes 13,1: Jesu Bewusstsein, dass in seiner Stunde des Weggangs zum VATER die Solidarität mit den Seinen zum Ziel kommt
13,1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus,
dass seine Stunde gekommen war,
dass er aus dieser Welt ginge zum Vater.
Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren,
so liebte er sie bis ans Ende.
[27. September 2022] Nach Klaus Wengst (W391) nimmt Johannes mit dem Vers 13,1 „den gesamten zweiten Teil seines Evangeliums in den Blick“, indem „er hier ‚die Stunde‘ erwähnt und als deren Inhalt und Ziel angibt, dass Jesus ‚aus dieser Welt zum Vater hinübergeht‘.“ Dabei weist er nochmals darauf hin, dass die
Zeitangabe „vor dem Pessachfest“ … präzis den Tag unmittelbar vor Pessach [meint] und damit zugleich den letzten Lebenstag Jesu. Das ergibt sich erst aus dem Fortgang des Evangeliums. Nach biblisch-jüdischem Verständnis beginnt der Tag mit dem Abend, dem Sonnenuntergang. Die abendliche Situation wird in 13,2 durch die Angabe des Mahles angezeigt. Das dafür gebrauchte griechische Wort bezeichnet die Hauptmahlzeit, die am späten Nachmittag bis frühen Abend eingenommen wurde. Dass es schon während dieses Mahles Jesu mit seinen Schülern Nacht war, zeigt sich in der weiteren Darstellung mehrfach. Bevor es dann wieder Abend wird und also das Pessachfest beginnt, ist Jesus schon gestorben und beigesetzt.
Das heißt (W393):
Alles Geschehen von 13,1 bis 19,42 – Fußwaschung und Verratsansage, Reden zu und mit den Schülern, Festnahme und Verhöre, Verurteilung und Kreuzigung, Tod und Grablegung – spielt an einem einzigen Tag, dem 14. Nissan, der demnach in diesem Jahr ein Freitag war, nach unserer Tageseinteilung von Donnerstagabend bis Freitagabend. Dieses Geschehen wird mit der einleitenden Zeitbestimmung eröffnet und kommt mit ihr in den Blick.
Indem Johannes „zuerst das Wissen Jesu“ über das auf ihn zukommende Geschehen feststellt, betont er, wie schon
an den anderen Stellen, an denen dieses Motiv begegnet (6,6.61.64; 18,4; 19,28), … dass Jesus nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert ist. Er befindet sich sozusagen immer auf der Höhe des Geschehens und wird von ihm nicht überrascht. Er weiß, was kommt und dass es so kommen muss. Interpretiert man dieses Motiv nicht isoliert für sich, sondern setzt es zur Situation der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde in Beziehung, dann geht es darum, sie dessen zu vergewissern, dass dieser Weg Jesu, der einem schlimmen Schicksal unterworfen zu sein scheint, doch ein Weg des Mitseins Gottes ist.
Im Wissen Jesu, „dass seine Stunde gekommen ist“, wird nun
vollends deutlich, dass diese Stunde mit seinem letzten Lebenstag zusammenfällt und also die Zeit seiner Passion und seines Todes bezeichnet. Es ist seine Stunde und nicht die Stunde derer, die ihn festnehmen und hinrichten, weil doch zugleich Gott darin sein Werk vollzieht. Das bringen Inhalt und Ziel dieser Stunde zum Ausdruck: „aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen“. Der Weg Jesu ans Kreuz führt ihn nicht ins Nichts, sondern zu dem, in dessen Auftrag er handelt.
Dieser „Weg Jesu“ wird vom Evangelisten „gerade hinsichtlich seiner letzten Etappe als Liebe zu den Seinen“ charakterisiert. Nach Wengst ist es „auffällig, dass hier zweimal von Jesu Liebe die Rede ist“; er schlägt vor, „dass der Nebensatz die dauernde Liebe Jesu zu den Seinen zum Ausdruck bringt – sein ganzes Wirken war nichts anderes als Liebe zu ihnen -, während der Hauptsatz ihre Vollendung am Ende betont.“ Dabei gibt Wengst die „griechische Wendung“ eis telos {wörtlich: auf das Ende bzw. Ziel hin} mit „vollends bis zuletzt“ wieder.
Wer sind Wengst zufolge die hier genannten „‚Seinen‘ als Gegenstand der Liebe Jesu“? Erzählt wird im Folgenden von Jesu Schülern (W394),
die – besonders deutlich in den Abschiedsreden – transparent werden für die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde. Wenn es von den Seinen heißt, dass sie „in der Welt“ sind, und von Jesus, dass er „aus der Welt“ zum Vater hinübergeht, klingt bereits im ersten Vers des zweiten Teils ein wesentliches in ihm verhandeltes Problem an, nämlich das der Abwesenheit Jesu. Aber ebenfalls klingt an, dass diese Abwesenheit nicht negativ verstanden werden darf, wenn denn der Weggang Jesu höchster Ausdruck seiner Liebe ist.
Indem dieser „erste Vers … sich also deutlich als Einleitung des zweiten Teils des Evangeliums zu erkennen“ gibt und zugleich „am Beginn der im unmittelbar Folgenden geschilderten Szene von der Fußwaschung“ steht, „mit der Jesus in Sklavenkleidung einen Liebesdienst an seinen Schülern vollzieht“, ist nach Wengst „schon hier klar, dass Johannes die Fußwaschung als Symbol für den als Manifestation der Liebe Gottes (vgl. 3,16) gedeuteten Tod Jesu versteht.“
Obwohl Hartwig Thyen (T583) die kompliziert aufgebaute „Satzperiode“ in den Versen 13,1-4, „die zudem in sich noch keineswegs abgeschlossen ist, sondern vielmehr unmittelbar in die Erzählung von der Fußwaschung überleitet“, als „überladen“ und „angesichts der bei Johannes gewohnten Diktion überraschend“ empfindet, weigert er sich auch hier, zu „literarkritischen Eingriffen“ Zuflucht zu nehmen, wie es Bultmann oder Becker tun, statt „diese nicht allein die Szene der Fußwaschung, sondern den gesamten Akt Joh 13-17 einleitende Periode gerade in ihrer Kohärenz stiftenden Komplexität zu verstehen.“ Dennoch sieht er auch (T584) ein „Wahrheitsmoment“ in „Bultmanns Beobachtung der großen Nähe von Joh 13,1-4 zum Gebet Jesu im 17. Kapitel“, nämlich
darin, daß diese beiden Texte tatsächlich nicht nur eng miteinander verwandt sind, sondern daß sie eine absichtsvolle Inclusio um die gesamte Szene des Abschieds bilden. Und daß gerade diese hochkomplexe Einleitung zum einen die Kohärenz zwischen den beiden Deutungen der Fußwaschung stiftet und zum anderen den Raum für das Liebesgebot der V. 34f freihält, sieht Becker ganz richtig.
Zur „Zeitangabe: pro de tēs heortēs tou pascha {vor dem Fest des Passa}“ meint Thyen wie Wengst, dass sie „sich auf den Abend (vgl. das ēn de nyx {es war Nacht} in V. 30) des vorletzten Tages von Jesu irdischem Leben beziehen“ muss:
Mit diesem Abend und Sonnenuntergang beginnt nach jüdischer Zeitrechnung der neue Tag. Noch in dieser Nacht wird Jesus verhaftet, zu Hannas geführt und früh am folgenden Morgen (18,28: ēn de prōï {es war frühmorgens}) an Pilatus ausgeliefert.
Da Thyen sich hier etwas unklar ausdrückt, hat mich das Wort vorletzter Tag und folgenden Morgen irritiert, weil zwischen der Verhaftung, die in der Nacht erfolgt, und dem frühen Morgen kein weiterer ganzer Tag vorausgesetzt wird. Aber später wird deutlich werden, dass auch Thyen wie Wengst davon ausgeht, dass hier der Vorabend des letzten Tages im Leben Jesu beschrieben wird. Denn aus seiner Auslegung von Vers 30 geht hervor, dass er die dort hereinbrechende Nacht als den Sonnenuntergang betrachtet, mit dem der Vorbereitungstag des Passa (unser Karfreitag) beginnt. Das heißt aber, dass in seinen Augen das Mahl mit dem Vollzug der Fußwaschung bereits vor Sonnenuntergang begonnen hatte, also am Ende des vorletzten Tages (unserem Gründonnerstag) im Leben Jesu. Seine scheinbar so akkurate Einteilung der letzten Lebenswoche Jesu (T548), auf die ich in seiner Einführung zum Kapitel Johannes 12 eingegangen war, erweist sich damit endgültig schlicht als falsch berechnet, denn ihr zufolge sollte das letzte Mahl Jesu am Dienstag, seine Abschiedsreden am Mittwoch und seine Gefangennahme am Donnerstag geschehen sein.
Überhaupt hat Thyen Schwierigkeiten damit, kalendarische Einzelheiten zutreffend auszudrücken, denn obwohl ihm jetzt klar ist (T584), dass mit dem Einbruch der Nacht während des letzten Mahles Jesus der Vorbereitungstag für das Passafest (die paraskeuē tou pascha) beginnt, also „dieser letzte Tag, an dem Jesus – in eben der Stunde, in der die Passalämmer im Tempelbezirk geschlachtet werden – als das ,Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt‘ (1,29) am Kreuz stirbt“, schreibt er im selben Satz, dass dieser „vierzehnte Nisan… in jenem Jahr auf einen Sabbat fiel (19,31…). Erst am Abend dieser paraskeuē, also nach dem Tode Jesu, findet das Passamahl mit dem geschlachteten Lamm als seinem Mittelpunkt statt.“ Das stimmt fast alles – nur fiel nicht schon der 14., sondern der 15. Nisan auf einen Sabbat, mit dem nach Johannes in diesem Jahr das Passafest begann, denn Jesus sollte ja ausdrücklich vor Beginn des Sabbat vom Kreuz abgenommen werden.
In den „idioi Jesu {seinen Eigenen}“ hat nach Thyen schon Ammonius von Alexandrien <940> wie in 1,11 „vornehmlich die Juden“ gesehen, aber da sie näher als solche bestimmt werden, „die in der Welt sind“, und weil „nichts und niemand ohne ihn geschaffen ist“ (vgl. 1,1ff) (T584f.),
sind weit über die Ioudaioi hinaus … auch ,alle Menschen, die in der Welt sind‘ die Seinen. Wie die Abschiedsszene insgesamt ein Text für alle potentiell des Lesens und/oder des Zuhörens Fähigen ist, so sollten seine Leser die Jünger, die da mit Jesus zu seinem letzten Mahl versammelt sind, als ihre und aller Menschen Repräsentanten begreifen und sie nicht als die Vertreter der sektiererischen In-Group einer vermeintlichen ,johanneischen Gemeinde‘ identifizieren. Und dementsprechend sollten sie sich – und sollten wir uns – die bei Johannes übergangene Frage nach dem ,Verräter‘ und/oder ,Verleugner‘ Jesu selbst stellen: „Herr bin ich‘s?“ (Mk 14,19 par).
Es ist zwar löblich, dass Thyen seine Einbeziehung der gesamten Menschenwelt in die „Seinen“ Jesu mit einer selbstkritischen Sicht von uns Christen verbindet, die sich als Teil dieser Menschenwelt von Jesus angesprochen fühlen. Aber bisher hatte Thyen es eher verneint, dass Jesus im Johannesevangelium sein Augenmerk bereits über Israel hinaus auf die Völkerwelt richtet.
Wie Wengst meint auch Thyen (T585), dass
die Wendung eis telos ēgapēsen autous {bis zur Vollendung liebte er sie} auf jenes tetelestai {es ist vollendet} des Sterbenden von 19,30 vorausweist und also in dem Doppelsinn von ,bis zuletzt‘ und ,bis zur Vollendung‘ gelesen sein will, <941> und daß in ihrem Licht die folgende Fußwaschung bereits als sēmeion {Zeichen} der Lebenshingabe Jesu begriffen sein will, hat schon Ammonius treffend beobachtet (s. o.).
Auch Ton Veerkamp <942> betont die außergewöhnliche Grammatik, derer sich Johannes in den ersten vier Versen von Kapitel 13 bedient, um auf das ihm wichtigste Thema zu sprechen zu kommen, nämlich der agapē Jesu, seiner „Solidarität“, die Jesus dann als neues Gebot auch von seinen Schülern fordern wird:
Das Stück beginnt mit einem monumentalen Satz, gebaut über zwei Brückenpfeiler, die beiden aktiven Partizipien eidōs, im Bewusstsein, und agapēsas, solidarisch, einerseits, und die Wiederholung des Partizips eidōs, im Bewusstsein, andererseits.
Dazwischen zwei sogenannte genitivi absoluti, eine grammatikalische Figur, die vollendete Tatsachen bezeichnet: Die Mahlzeit ist vorbei, der Feind hat sich eines Schülers bemächtigt.
Dieser Satz ist Vorsatz, der Hauptsatz beginnt in V.4: „steht er von der Mahlzeit auf …“
Der Vorsatz enthält in sehr konzentrierter Gestalt alle Themen, die in 13,1-17 zur Sprache kommen werden: das Bewusstsein und die Solidarität Jesu. Beide bestimmen die jetzt kommende Handlung. Jesus, der Herr und Lehrer, handelt als Sklave, damit niemand unter ihnen zum Herrn werden kann: das ist Solidarität. Dass es sich um Solidarität handelt, wird erst nach dem Bruch des Verrates benannt: die Worte agapē und agapan, Solidarität und solidarisch sein, hören wir zunächst im großen Vorsatz über das Bewusstsein Jesu und dann erst in 13,34, in der Nacht.
Dass Veerkamp die Worte agapē und agapan nicht einfach mit „Liebe“ und „lieben“ wiedergibt, sondern mit dem Begriffsfeld der „Solidarität“ umschreibt, ist uns schon seit seiner Auslegung von Johannes 3,16 vertraut; seine Differenzierung in der Übersetzung des Wortes kosmos einerseits mit „(Menschen-)Welt“, andererseits mit „Weltordnung“, kennen wir aus der Beschäftigung mit Johannes 1,10. Das sind aber noch nicht alle Besonderheiten seiner Übertragung von Johannes 13,1, die er mit Hilfe von vier Anmerkungen näher begründet:
13,1 Aber vor dem Paschafest,
im Bewusstsein,
dass seine Stunde gekommen war,
um aus dieser Weltordnung zum VATER hinzugehen,
kam die Solidarität Jesu,
der solidarisch mit den Seinen unter der Weltordnung war,
ans Ziel.
Die Übersetzung „vor“ dem Passafest scheint nichts Besonderes zu sein, da Veerkamp sie mit Wengst, Thyen und auch der Lutherbibel teilt. Veerkamp erläutert jedoch näher, dass dieses Wort in der Kirchengeschichte auch anders verstanden werden konnte (Anm. 401):
Pro mit Genitiv bedeutet sowohl „vor“ als auch „statt“. Die alte Kirche, vor allem im Westen, hat pro als „statt“ aufgefasst. Im sogenannten Quartodezimanerstreit, Ende des 2. Jh., wurde der Kampf um die Deutung des pro ausgefochten. <943>
Zwar hatte es Johannes nach Veerkamp noch nicht im Sinn, das jüdische Pascha durch ein christliches Osterfest zu ersetzen, wie es später verstanden wurde. Trotzdem ist es in seinen Augen verständlich, warum es entgegen der Absicht des Evangelisten zu einer solchen Entwicklung kam (Anm. 402):
Wir erinnern uns daran, dass Johannes distanzierend Pascha als „Pascha (das Fest) der Judäer“ bezeichnet hat: 2,13; 6,4; 11,55. Siebenmal kommt das Wort ohne diesen Bezug vor, darunter einmal mit dem Zusatz „Fest“, eben in 13,1. Pascha ist für Johannes und seine Gruppe nicht länger das Befreiungsfest, statt dessen die „Erhöhung“ des Messias, für die die Auslieferung durch Judas Iskariot die Voraussetzung ist. Die ungewöhnlich ausgedehnte und feierliche Einleitung (deipnou genemenou – tou diabolou ēdē beblētokos – eidōs {als Mahlzeit gehalten wurde – nachdem der Feind ins Herz gesetzt hatte – im Bewusstsein}) zeigt, wie im Text die entscheidende Wende vorbereitet wird. Das impliziert die Trennung der Synagoge und der Judäer von der Gruppe um Johannes: Die Judäer hatten keine Veranlassung, Pascha anders als das Israel konstituierende Fest der Befreiung von Pharao zu sehen. Pro de tēs heortēs tou pascha heißt daher: Vor dem Fest geschieht das, was nach Johannes dem Fest eine völlig neue Ausrichtung geben würde.
Weiter begründet Veerkamp seine Übersetzung des Partizips eidōs mit „im Bewusstsein“ (Anm. 403):
Das Verb eidenai (Partizip eidōs, Indikativ oida) bedeutet, dass ein Prozess des Erkennens (ginōskein) seinen Abschluss im Wissen gefunden hat und dass dieses Wissen zum Bestandteil des Bewusstseins geworden ist. Deswegen „Im Bewusstsein“; vgl. unten 13,17: ei oidate, „wenn ihr dessen bewusst seid“.
Und schließlich sieht Veerkamp in die Reihen der Seinen Jesu nicht einfach die gesamte Menschheit mit eingeschlossen, nur weil in 13,1 von tous idious tous en tō kosmō {wörtlich: den Seinen, denen in der Welt} die Rede ist (Anm. 404):
Wir übersetzen en tō kosmō mit: „unter der Weltordnung“. Es geht nicht um ein neutrales „in“, sondern um die Tatsache, dass die Weltordnung sie mit Hass bekämpft (15,18ff.; 17,11ff. usw.) und dass der Messias und die Schüler unter diesem Hass leiden.
Veerkamp geht also davon aus, dass die messianische Gruppe um Johannes eine allzu starke Ausrichtung auf eine Mission der Völkerwelt eher skeptisch beurteilt, in ihrem Interesse an einer Sammlung ganz Israels einschließlich Samarias und den Juden der Diaspora aber ausgerechnet bei den judäischen Juden auf erheblichen Widerstand stößt. Das führt zu einem immer stärkeren Verlust an Mitgliedern und zur Abschottung eines relativ engen Kreises von Anhängern Jesu von der Außenwelt „aus Furcht vor den Juden“ (Johannes 7,13; 19,38; 20,19). Erst im Schlusskapitel 21 wird bezeugt werden, dass sich johanneische Gruppierung dann doch der Hauptströmung der Messianisten anschließt, die in Petrus ihren geistlichen Oberhirten sieht.
In den Abschiedsreden Jesu, die mit Kapitel 13 beginnen, geht es jedenfalls zunächst um die Stärkung einer in die Defensive gedrängten Anhängerschaft Jesu. Zu diesem Zweck fasst Johannes in Vers 13,1 noch einmal zusammen, auf Grund welcher Voraussetzungen Jesus im Begriff steht, den Tod am römischen Kreuz auf sich zu nehmen:
Das Bewusstsein Jesu enthält vier Momente: Jesus weiß, dass seine Stunde gekommen ist, aus dieser Weltordnung wegzugehen zum VATER, dass seine Solidarität mit den Seinen ihr telos, ihr Ziel, erreicht hat und, nach der Erwähnung zweier vollendeter Tatsachen, weiß Jesus, dass ihm die ganze Macht übergeben wurde, weil sein ganzes Leben sich „von Gott her zu Gott hin“ bewegt. Diese vier Momente: die Stunde, das Ziel, die Macht und der Weg, fassen die ersten zwölf Kapitel unseres Textes zusammen. Aus diesem Wissen heraus handelt Jesus.
↑ Johannes 13,2-3: Ein Mahl ist geschehen, Judas unter den Einfluss des diabolos geraten, doch Jesus hat alles vom VATER empfangen
13,2 Und nach dem Abendessen
– als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot,
ins Herz gegeben hatte,
dass er ihn verriete;
13,3 Jesus aber wusste,
dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging – …
[29. September 2022] Zu den Versen 13,2-3 ist zunächst nochmals hervorzuheben, dass sie keinen vollständigen Satz bilden, sondern als komplexe grammatische Konstruktion den Vorsatz des in Vers 4 folgenden Hauptsatzes darstellen.
Die in Vers 2 angegebene (W391) „Situation des letzten Mahles Jesu mit seinen Schülern“ ist nach Klaus Wengst
unmittelbar relevant für diese Erzählung von der Fußwaschung, die Jesus an seinen Schülern vornimmt, und für die folgende Szene der Verratsansage. Für die sich daran anschließenden Abschiedsreden und das Gebet Jesu bildet sie nur noch den Hintergrund, kommt aber nicht mehr ausdrücklich zum Zuge.
Da „auch in den synoptischen Evangelien (Mt 26,20-29; Mk 14,17-25; Lk 22,14-23)“ von einem solchen letzten Mahl die Rede ist, währenddessen Jesus den Verrat des Judas ankündigt, setzt Wengst „einen literarischen Zusammenhang“ voraus, „der entweder indirekt überlieferungsgeschichtlich oder durch direkte literarische Benutzung bedingt ist.“ Johannes wandelt jedoch die ihm zur Verfügung stehenden Texte in auffälliger Weise ab:
Zum einen macht er aus dem „synoptischen … Pessachmahl“, aus dem heraus „die Eucharistie“ entsteht, ein Mahl, das schon „einen Tag vorher“ stattfindet. Am folgenden Abend des Passamahls wird Jesus schon tot sein, denn er stirbt nach Johannes bereits (W391f.)
zur Zeit der Schlachtung der Pessachlämmer (19,14; vgl. schon zu 1,29 und weiter 19,33.36). Welche Datierung „ursprünglicher“, was „historisch“ ist, gehört wieder zu den Fragen, die sich nicht zwingend entscheiden lassen. Daraus ist die Konsequenz zu ziehen, die jeweiligen Texte in ihrer je eigenen Intention wahrzunehmen und auszulegen.
Zum andern bietet Johannes anstelle „der Einsetzung der Eucharistie … die Erzählung von der Fußwaschung.“ Wengst zufolge ist es jedoch „ein unfrommer moderner Wunsch“, daraus „auf eine gegenüber den Sakramenten gleichgültige oder gar auf eine antisakramentale Haltung des Johannes zu schließen“, denn „Johannes hatte die Eucharistie schon in 6,51-58 im Zusammenhang der Rede Jesu vom Lebensbrot verortet.“ Er beruft sich dabei auf Wilckens, <944> der „in dem Aspekt der Teilhabe an Jesus eine sachliche Verbindung zwischen dem johanneischen Verständnis der Eucharistie und dem in 13,8 angegebenen Sinn der Fußwaschung“ erkennt und feststellt: „Antisakramentale Tendenzen gibt es erst in Kreisen moderner protestantischer Theologie“. Indem Johannes allerdings „die Eucharistie schon in Kap. 6 vorzieht und statt ihrer die Fußwaschung an dieser hervorgehobenen Stelle des letzten Mahles platziert“, setzt er auch nach Wengst „einen deutlich anderen Akzent“. In meinen Augen kann diese Akzentsetzung durchaus eine Kritik enthalten an der Eucharistie als einem bloßen Ritual, bei dem sowohl das Ziel der Ernährung ganz Israels, auf das Johannes in Kapitel 6 unter Rückgriff auf eucharistische Terminologie hingewiesen hatte, als auch die Eigenart der Nachfolge Jesu als in der solidarischen Liebe begründeter Sklavendienst außer Acht bleiben. Immerhin ist das einzige Brot, den Johannes beim letzten Abendmahl erwähnt, der Bissen, den Jesus seinem Verräter überreicht (13,26).
Unmittelbar nach der Erwähnung der Mahlsituation (W394)
erfolgt ein erster Vorblick auf die in V. 21-30 erzählte Verratsansage, was den Zusammenhang mit der Passion betont: „[…] nachdem es der Teufel dem Judas, Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben hatte, dass er ihn ausliefere“. Dass Judas Jesus ausliefern würde, hatte Johannes schon in 6,71 angemerkt, nachdem dieser von Jesus als ein „Teufel“ bezeichnet worden war. Die Unterschiedlichkeit der Vorstellungen – hier gibt es der Teufel Judas ins Herz, Jesus auszuliefern; dort gilt er aufgrund seiner Tat selbst als Teufel – zeigt an, dass es kaum darum geht, ein mythologisches Außen als Erklärung einer unbegreiflichen Untat einzuführen. Es soll vielmehr ein Ausdruck für eben dieses Unbegreifliche gefunden werden, dass jemand, den Jesus liebte und der doch auch noch die gleich erzählte Fußwaschung an sich erfahren hat, zur Festnahme Jesu verhilft, die zu seiner Hinrichtung führt.
Diese Deutung ist nicht abwegig, blendet aber Entscheidendes aus, da Wengst eine dritte Möglichkeit, nämlich die Rede vom diabolos als einem real-politischen Widersacher des Gottes Israels auf Rom bzw. auf den mit Rom kollaborierenden Schüler Jesu zu beziehen, nicht einmal in Erwägung zieht.
Indem Johannes in Vers 3 nach „dem Blick auf die anstehende Auslieferung Jesu … sogleich wieder dessen Wissen“ betont, „dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ginge“, drückt er aus, dass Jesus in allem, was ihm widerfahren wird, „alle Macht“ behält. Damit wird der „ganze Weg Jesu … als ein im Auftrag Gottes gegangener verstanden, gerade auch an seinem Ende, und dieses Ende als Rückkehr zum Auftraggeber begriffen.“ Auch (W395) in „der Auslieferung Jesu durch Judas“ führt also „niemand sonst als Gott sein Werk zu Ende.“
Nach Hartwig Thyen (T585) „erfährt der Leser“ erst „durch die knappe Notiz: kai deipnou ginomenou {wörtlich: beim geschehenden Mahl}…, daß Jesus hier mit seinen Jüngern zum letzten Mahl versammelt ist.“ Es gibt in ebenfalls „gewichtigen“ Handschriften statt ginomenou im Präsens auch
die Aoristform genomenou {nach dem geschehenen Mahl}. Da aber das Mahl, wie der Kontext ausweist, keineswegs schon vorüber, sondern noch im Gange ist, müßte man den Aorist als ingressiven {einen Beginn ausdrückenden} verstehen, so daß eine Entscheidung für eine der beiden Lesarten nicht gefällt zu werden braucht …
Auch nach Thyen soll wohl „nicht nur diese Mahlnotiz, sondern auch die ihr unmittelbar folgende Aussage, daß der Diabolos Judas, dem Sohn des lskarioten Simon, bereits den teuflischen Plan eingeflüstert habe (beblēkotos eis tēn kardian … Iouda {wörtlich: ins Herz des Judas geworfen habend}), Jesus auszuliefern, … den Leser an die synoptische Abendmahls-Szene“ erinnern. Den „Genitiv Iouda …, der kardia {Herz} näherbestimmt als das Herz des Judas, dessen Name emphatisch an den Schluß gestellt ist“, hält Thyen „mit der Mehrzahl der Handschriften anstelle des Nominativs Ioudas“ für die ursprüngliche Lesart, denn „zwischen dieser teuflischen Einflüsterung und dem leibhaftigen Einfahren des Teufels in Judas in V. 27“ ist „sicher absichtsvoll ein Spannungsbogen hergestellt“.
Zu Vers 3 schreibt Thyen, dass er „den Gedanken von V. 1 variierend wiederaufnimmt“ und dass
diese beiden Verse eine lnklusio um die Aussage des Erzählers über Judas als denjenigen, der Jesus „überliefern“ sollte. Dabei macht das wiederholte eidōs {in der Gewissheit} deutlich, daß zu Jesu Wissen um seine Stunde auch sein Wissen um diese Bestimmung des Judas gehört. Jetzt ist er gewiß, daß der Vater ihm alles in die Hände gelegt hat und daß es darum jetzt an ihm ist zu handeln, an ihm, der – von Gott ausgegangen – nun im Begriff ist, zu Gott zurückzukehren.
Ton Veerkamp <945> übersetzt die Verse 2 und 3 als den unmittelbaren Vorsatz des in Vers 4 folgenden Hauptsatzes folgendermaßen:
13,2 Und als Mahlzeit gehalten wurde
– nachdem es der Feind dem Judas, Sohn des Simon Iskariot,
schon ins Herz gesetzt hatte, ihn auszuliefern -,
13,3 im Bewusstsein also,
dass der VATER ihm alles in die Hände gegeben hat,
dass er von GOTT ausgegangen war und zu GOTT hinging:
Zur Erläuterung seiner Übersetzung merkt er an (Anm. 405), dass „Johannes … Jesus und seine Schüler kein Paschamahl halten“ lässt; vielmehr ist,
was ihm zufolge geschieht, der Akt der Fußwaschung (ein Beispiel für „die Seele einsetzen“, 13,37-38; 15,13) am Abend vor dem Schabbatabend und dem Gang zu Pilatus und nach Golgotha, … das neue Pascha am Tag der paraskeuē, der Vorbereitung des Passafestes; vgl. Johannes 19,14. Bei Johannes ist der Bruch zwischen beiden, dem Pascha der Judäer und dem Geschehen, das in Kapitel 13-20/21 erzählt wird, geradezu absolut.
Außerdem betont Veerkamp (Anm. 407), dass
[b]eide Teile von V.2 – über die Mahlzeit und über den Feind – … parallel konstruiert [sind], jeweils mit einem genitivus absolutus, der erste im Aorist, der zweite im Perfekt. Aktion und Gegenaktion, Solidarität und Verrat, werden miteinander verknüpft, und deswegen muss man parallel übersetzen.
Damit bevorzugt Veerkamp im Blick auf den „erste[n] Genitivus absolutus“ die Lesart der Handschriften, die statt des Präsens ginomenou den Aorist genomenou bieten und versteht diesen Aorist nicht wie Thyen im Sinne einer begonnenen und noch im Gange befindlichen, sondern einer bereits abgeschlossenen Handlung:
„als die Mahlzeit vorbei war“. Das Entscheidende geschieht also nach der Mahlzeit. … Das Wort deipnon, Mahlzeit, kommt bei Johannes viermal vor, einmal in 12,3, wo Maria die Füße des Messias salbte, zweimal hier und dann noch einmal in Galiläa, am Ufer des Sees, 21,20, wo aber auf diese Mahlzeit hier Bezug genommen wird.
Es gibt also nur zwei Mahlzeiten, die erste war das vorweggenommene Begräbnismahl, wo Lazarus anwesend war, Martha den messianischen Ehrendienst versah und Maria, „die salbte mit Balsam den Herrn und trocknete seine Füße mit ihren Haaren“ (11,2 und 12,3ff.), sechs Tage vor Pessach („Montag“); die zweite Mahlzeit war einen Tag vor ˁerev Pascha („Donnerstag“). Bezieht sich das deipnou genomenou auf die erste Mahlzeit?
Diese Frage Veerkamps hat mich irritiert, denn er setzt ja selbst voraus, dass die Fußwaschung anlässlich des zweiten Mahles geschieht, und dieses Mahl wird nach der Fußwaschung auch noch fortgesetzt, wie spätestens die Verse 23 und 26 zeigen. Allerdings ist der Beginn von Vers 2 tatsächlich so formuliert, dass auch ein Bezug auf das erste Mahl möglich ist. Darum setzt Veerkamp seine Ausführungen zu Recht folgendermaßen fort:
Die zweite Mahlzeit ist mit der ersten Mahlzeit verbunden. Nachdem die Mahlzeit geschehen war, wo Maria die Füße des Messias salbte, wird Judas ben Simon Iskariot die Armen ins Spiel bringen, um die Salbung zu diskreditieren. Nachdem diese Mahlzeit geschehen war, suchte Simon Petrus die Handlung Jesu an den Schülern, die Fußwaschung, zu verhindern, und Judas wird aufgefordert, Jesus und die Schüler zu verlassen. Auch hier werden die Bedürftigen (ptōchoi) erwähnt. Nach der ersten Mahlzeit wird Tod und Begräbnis des Messias vorweggenommen; nach der zweiten Mahlzeit wird das neue Gebot der Solidarität begründet. Nach der ersten Mahlzeit wird klargestellt, dass jetzt nicht die Stunde der Bedürftigen war, nach der zweiten Mahlzeit wird das neue Gebot der Solidarität unter den Schülern verkündet.
Zum Stichwort diabolos im „zweite[n] Genitivus absolutus: ‚Nachdem der Feind Judas ben Simon Iskariot ins Herz gesetzt hatte, ihn (Jesus) auszuliefern‘“, erinnert Veerkamp (Anm. 406) an seine Erläuterungen zu Johannes 8,44 und hebt hervor, dass das Wort „diabolos, ßatan, … bei Johannes nur in 8,44 und zweimal in Zusammenhang mit Judas Iskariot“ vorkommt:
Judas handelt im Auftrag des Feindes, des Satans, Diabolos, nicht eines bösen überirdischen Geistes, sondern einer bösen innerweltlichen Ordnung. Er handelt im Auftrag und als Handlanger Roms, wir sehen ihn hier, wir sehen ihn weggehen (13,30), wir sehen ihn wieder als Chef einer gemischten Truppe aus Polizei der judäischen Behörde und Soldaten des Feindes, 18,3. Wenn die Schrift das Wort ßatan benutzt, dann meint sie keine Dämonen; für diese hat sie andere Worte.
Nachdem Johannes als exakte Parallele nebeneinandergestellt hat, was nach dem Mahl geschehen wird und was Judas vorhat, unterstreicht er, bevor Jesus „die Füße der Schüler waschen wird“ nochmals sein „Bewusstsein“, in dem er die Fußwaschung vornehmen wird: „Er weiß, dass er derjenige ist, dem alle Macht übertragen wurde, wie dem bar enosch, dem MENSCHEN. Er ist von Gott ausgegangen, er kehrt zu ihm zurück“.
↑ Johannes 13,4-11: Jesus leistet seinen Schülern den Sklavendienst der Fußwaschung
13, 4 … da stand er vom Mahl auf,
legte seine Kleider ab
und nahm einen Schurz und umgürtete sich.
13,5 Danach goss er Wasser in ein Becken,
fing an, den Jüngern die Füße zu waschen
und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war.
13,6 Da kam er zu Simon Petrus;
der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße?
13,7 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht;
du wirst es aber hernach erfahren.
13,8 Da sprach Petrus zu ihm:
Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen!
Jesus antwortete ihm:
Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.
13,9 Spricht zu ihm Simon Petrus:
Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!
13,10 Spricht Jesus zu ihm:
Wer gewaschen ist, bedarf nichts,
als dass ihm die Füße gewaschen werden;
er ist vielmehr ganz rein.
Und ihr seid rein, aber nicht alle.
13,11 Denn er wusste, wer ihn verraten würde;
darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.
[30. September 2022] Nach der hochkomplizierten Einführung (W395) in „die Mahlsituation“ erzählt Johannes Klaus Wengst zufolge
ebenso einfach wie ausführlich, dass Jesus seinen Schülern die Füße wäscht. Bei der Fußwaschung handelt es sich um eine in der Antike verbreitete Sitte. Am geläufigsten ist die Gästen erwiesene Fußwaschung, die in der Regel von Sklavinnen und Sklaven durchgeführt wird.
Dazu zitiert Wengst einige „jüdisch-rabbinische Texte“. <946> Beispielsweise wird geschildert, dass „eine Sklavin dem heimkehrenden Hausherrn und seinem ihn begleitenden Gast die Füße“ wäscht. Nach einer anderen Stelle
soll der hebräische Sklave diesen Dienst und einige andere Dienste nicht verrichten: „Sechs Jahre soll er dienen (Ex 21,2). Ich könnte verstehen: jede Arbeit im Wortsinn. Die Belehrung (der Schrift) sagt (Lev 25,39): Du sollst dich seiner nicht zum Sklavendienst bedienen. Von daher haben sie (die Weisen) gesagt: ‚Er soll ihm nicht seine Füße waschen.“
Es kommt aber auch vor, dass „andere Personen … von sich aus diesen Dienst übernehmen“:
„Die Mutter des Rabbi Jischmael kam und klagte über ihn bei unseren Lehrern. Sie sprach zu ihnen: ,Scheltet Jischmael, meinen Sohn, weil er mich nicht in Ehren hält!‘ In jener Stunde wurden die Gesichter unserer Lehrer blass. Sie sagten: ,Ist es möglich, dass Rabbi Jischmael seine Eltern nicht in Ehren hält?‘ Sie sprachen zu ihr: ,Was hat er dir getan? Sie sprach: ,Wenn er aus dem Lehrhaus kommt, will ich ihm die Füße waschen und davon trinken; aber er lässt mich nicht.‘ Sie sprachen zu ihm: ,Weil das ihr Wille ist, ist das ihre Ehre‘“.
Obwohl also die „Fußwaschung … in der Regel Sklavendienst“ war, konnte sie
auch von anderen übernommen werden, um derjenigen Person, der dieser Dienst erwiesen wurde, besondere Verehrung, Achtung und Liebe zum Ausdruck zu bringen. Hier ist es Jesus, „der Herr und der Lehrer“, der seinen Schülern die Füße wäscht. Gerade er, über den soeben gesagt wurde, dass er von Gott gekommen ist, dass er aus dieser Welt zum Vater zurückkehrt, gerade er, der eigentlich so Hoheitsvolle, verrichtet diesen Sklavendienst. Dass er eine Sklavenrolle übernimmt, kommt darin besonders markant zum Ausdruck, dass er seine Kleidung ablegt und sich mit einem Leinentuch umgürtet und damit wie ein Sklave gekleidet ist. So kommt hier zur Darstellung, was einleitend gesagt wurde: Jesus liebt die Seinen. Zugleich wird deutlich, dass diese Liebe dienende Liebe ist, nicht huldvoll von oben gewährte Gunst eines Potentaten.
Wie schon in seiner Auslegung des Eselchens, das sich Jesus beim Einzug in Jerusalem als Reittier erwählt, betont Wengst auch zum Sklavendienst Jesu (W396), dass in ihm „Gott … in der Niedrigkeit“ erscheint, „und zwar in der Niedrigkeit dienender und sich hingebender Liebe.“ Zugleich macht Johannes (W395), indem er „die Erzählung von der Fußwaschung in den Rahmen ‚seiner Stunde‘ stellt, die die Stunde der Passion und des Todes ist, … die Fußwaschung zum prägnanten Symbol des als endgültigen Liebeserweis verstandenen Todes Jesu.“
In diesem Zusammenhang weist Wengst (W396) „auf eine jüdische Tradition“ <947> hin, „nach der Gott in der Rolle eines Sklaven an Israel handelt“:
BemR 16,27 vergleicht Gott mit einem Menschen, der sich einen Sklaven kauft. So erwarb sich Gott Israel; „denn mir gehören die Kinder Israels als Sklaven“ (Lev 25,55). Aber statt dass sie für Gott Sklavendienste verrichten, tut es Gott für sie. Das wird an drei Beispielen aufgezeigt. ShemR 25,6 beschreibt Gottes Selbsterniedrigung in Liebe zu Israel. Innerhalb einer Reihe von Taten Gottes, die das zeigen, heißt es: „Bei Fleisch und Blut wäscht der Sklave seinen Herrn; aber beim Heiligen, gesegnet er, verhält es sich nicht so, vielmehr (Ez 16,9): Ich habe dich mit Wasser gewaschen. Bei Fleisch und Blut kleidet der Sklave seinen Herrn an; aber beim Heiligen, gesegnet er, verhält es sich nicht so, vielmehr (Ez 16,10): Ich habe dich mit bunt Gewirktem angekleidet. Bei Fleisch und Blut zieht der Sklave seinem Herrn die Schuhe an; aber beim Heiligen gesegnet er, verhält es sich nicht so, vielmehr (Ez 16,10): Ich habe dir Schuhe aus Tachaschfell angezogen. Bei Fleisch und Blut trägt der Sklave seinen Herrn; aber beim Heiligen gesegnet er, verhält es sich nicht so, vielmehr (Ex 19,4): Ich habe euch auf Adlerflügeln getragen. Bei Fleisch und Blut schläft der Herr und sein Sklave steht bei ihm; aber beim Heiligen, gesegnet er, verhält es sich nicht so, vielmehr bewacht der Heilige, gesegnet er, Israel, denn es ist gesagt (Ps 121,4): Nicht schlummert noch schläft der Wächter Israels.“
Indem Petrus als ein im Johannesevangelium nicht unwichtiger Schüler mit den Worten (Vers 6): „Herr, du willst mir die Füße waschen?!“ gegen Jesu „niedrigen Sklavendienst“ protestiert, der „gültigen Maßstäben und Vorstellungen“ zuwiderläuft, zeigt sich nach Wengst,
dass der Trennungsstrich zwischen Gemeinde und Welt so klar doch nicht zu verlaufen scheint. Das eigentliche Problem der Gemeinde ist nicht die Welt außerhalb ihrer, sondern die Welt in ihr, dass sie sich ihre Maßstäbe immer wieder nicht von ihrem Herrn, sondern von außen vorgeben lässt.
Wieder einmal setzt Wengst eine Definition von kosmos, „Welt“, voraus, die nicht ganz im Einklang mit anderen von ihm bisher gegebenen Definitionen steht. Hier scheint er die „Welt“ mit ihren Maßstäben in einem recht allgemein verstandenen Gegensatz zur messianischen Gemeinde zu sehen, wobei diese weltlichen Maßstäbe auch in die Gemeinde hineinreichen. An anderer Stelle meinte er jedoch die „Welt“ als die Völkerwelt verstehen zu können, in die Johannes die Botschaft von Jesus über Israel hinaus hineintragen wolle. Diese Welt, ton kosmon touton, im Gegensatz zum Leben der kommenden Weltzeit, zōēn aiōnion, befreiungstheologisch als die zu überwindende römische Weltordnung zu begreifen, bleibt bei Wengst dagegen außerhalb seines Blickfelds.
Mit seiner Antwort (Vers 7): „Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber nach all dem wirst du es erkennen“, bestätigt Jesus, dass sich die Fußwaschung auf seinen Tod bezieht (W396f.), denn ein
späteres Verstehen war bisher im Evangelium schon dreimal in den Blick gekommen und gleich an der ersten Stelle, in 2,22 (vgl. weiter 8,28; 12,16), als Zeit des ‚Danach‘ ausdrücklich die Zeit nach Jesu Tod und Auferweckung genannt worden. … Wenn Simon Petrus in der Zeit davor das Handeln Jesu nicht verstehen kann, dann ist damit gesagt, dass es kein wirkliches Verstehen Jesu gibt abgesehen von seinem Tod am Kreuz und vom Auferweckungszeugnis der Gemeinde. So hat der niedrige Sklavendienst der Fußwaschung, den Jesus hier an seinen Schülern vollzieht, seine Entsprechung in seinem niedrigen Sklaventod am Kreuz und qualifiziert diesen Tod als Tat dienender und sich hingebender Liebe.
Auch (W397) Petrus‘ noch „energischer“ vertretenes Beharren auf seinem Widerstand gegen die Fußwaschung mit den Worten (Vers 8): „Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen!“ begreift Wengst von den in die Gemeinde hineinwirkenden weltlichen Maßstäben her:
Die Welt, auch die Welt in der Gemeinde und gerade sie, lässt sich ihre Maßstäbe so leicht nicht nehmen, sondern hält entschieden an ihnen fest. Gegenüber der erneuten Einrede des Petrus konstatiert Jesus: „Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Platz bei mir“. Simon Petrus hat nur dann einen Platz bei Jesus, bleibt nur dann in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn Jesus auch tatsächlich ausführt, was er zu tun im Begriffe ist. Dabei dürfte hier weniger an die in der erwähnten Situation vorgestellte Fußwaschung gedacht sein als vielmehr an das, was sie symbolisiert: den Gang Jesu ans Kreuz. Das zeigt sich an der Formulierung: „Wenn ich dich nicht wasche“. Hier ist schon die in Jesu Tod gründende Zusage der Sündenvergebung im Blick, wie V. 10 deutlich macht.
Hier frage ich mich, ob Wengst nicht allzu glatt die Vorstellung des sühnenden Kreuzestodes Jesu in die Symbolik der Fußwaschung einträgt und dadurch den Aspekt der freiwilligen Selbstversklavung gegenüber einem Ritual der Reinigung von Sünden zurücktreten lässt.
Petrus jedenfalls hat nach Wengst zwar „verstanden, dass Jesus an ihm handeln muss, soll er in Gemeinschaft mit ihm bleiben“, aber „seine Reaktion“ in Vers 9
zeigt auch, dass er dennoch nicht verstanden hat, wie er ja auch nach V. 7 noch gar nicht verstehen kann: „Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf!“
In dieser Aussage sieht Wengst den Anspruch auf eine Sonderbehandlung ausgedrückt:
Simon Petrus will also mehr, verlangt von Jesus einen größeren Liebeserweis, als die anderen ihn erhalten. Es ist gewiss kein Zufall, dass Johannes den in der Tradition besonders hervorgehobenen Schüler diese Forderung erheben lässt.
Indem Jesus in Vers 10 diesen Anspruch mit dem Hinweis auf die Reinheit aller Schüler zurückweist, wird Wengst zufolge „eine antihierarchische Spitze erkennbar. Jesus stellt Simon Petrus in die geschwisterliche Gleichheit seiner Schülerschaft, in der es kein Mehr oder Weniger des von Jesus Empfangenen gibt.“ Wenn in diesem Gesprächsgang aber wirklich eine Absage an jede Hierarchie unter den Schülern enthalten sein sollte, wäre zu fragen, warum in Johannes 21 dem Petrus dann doch die Führungsrolle des Hirten der messianischen Gemeinde übertragen wird. Ist er für diese Aufgabe erst geeignet, nachdem er in der Verleugnung Jesu versagt und die Vergebung des Auferstandenen empfangen hat?
Was die Formulierung der Antwort Jesu betrifft, hält Wengst die Kurzfassung, die nur „von wenigen Handschriften geboten“ wird, für ursprünglich (W397f.):
„Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein.“ … Die Masse der Handschriften hat bei „waschen“ zusätzlich: „außer die Füße“. So entspricht es unmittelbar der mit dem Bild vom Baden hervorgerufenen Vorstellung: „[…] wer gebadet hat, (empfindet) zunächst nur noch das Bedürfnis wiederholter Reinigung der Füsse […], die schon beim Aussteigen aus dem Wasser und dann durch das Wandeln auf der Erde verunreinigt werden“. <948> Von daher wird als Deutung gewonnen: „Die Fußwaschung vollendet die Reinigung im Bad. So ist es auch bei den Jüngern: ,Sie sind rein‘; es fehlt nur noch die Fußwaschung.“ Demgegenüber ist mit Barrett festzustellen: „V. 8b macht die Annahme unmöglich, das, was Jesus gerade getan hat, als etwas Gewöhnliches zu betrachten; es ist von fundamentaler Bedeutung und unaufgebbar – d. h., es handelt sich nicht um eine sekundäre ,Waschung‘, die einem ,Bad‘ als Initiation unterzuordnen wäre.“ Das aber heißt: Der Kontext verlangt zwingend die Annahme, dass der Kurztext ursprünglich ist.
An dieser Stelle erläutert Wengst (W398) seine zuvor gegebene Deutung näher, die durch die Fußwaschung bewirkte Reinheit vom „durch Jesu Tod bewirkten Aspekt der Sündenvergebung“ her zu begreifen:
Das Gemeinte löst sich vom konkret Erzählten, wenn Jesus davon spricht, dass kein weiteres Waschen nötig hat, wer gebadet ist. Schließlich hat er im Vorangehenden seine Schüler nicht gebadet, sondern ihnen lediglich die Füße gewaschen. Dennoch ist damit alles Notwendige geschehen. So kann nur geredet werden, wenn unter der Fußwaschung mehr verstanden ist als der bloße Akt des Waschens, wenn sie Symbol des Todes Jesu am Kreuz ist. Nur so bewirkt sie ganze Reinheit. Deshalb spricht Johannes jetzt vom Gebadetsein, das weiteres Waschen überflüssig macht. … Hier gibt es kein Mehr, sondern nur die volle und bedingungslose Zusage: Ihr seid rein! Euch ist vergeben! Für den aus der Retrospektive schreibenden Evangelisten ist in der hier erzählten Fußwaschung das schon da, was sie symbolisiert.
Die Einschränkung der Zusage Jesu, die sich an „alle Schüler“ richtet: „Und ihr seid rein“ durch den Zusatz: „Aber nicht alle“, wird in Vers 11 von Johannes folgendermaßen begründet: „Denn er kannte den, der ihn ausliefern würde. Deshalb sprach er: Nicht alle seid ihr rein.“ Den „Sinn dieser einschränkenden Aussage im Zusammenhang“ versteht Wengst nicht als eine Einschränkung der „Zusage als solche[r]“, denn Jesus ist und bleibt „nach 1,29 ‚das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt‘“. Aber jetzt wird „nach der Zusage das Moment der Annahme ins Spiel gebracht“ und
herausgestellt, dass die Zusage sich nur da konkret verwirklicht, wo sie auch angenommen und ihr im Lebensvollzug entsprochen wird. Dieses Moment wird hier negativ durch den Blick auf den eingebracht, der Jesus ausliefern wird, der sich sozusagen mit seiner Tat gegen die zugesagte Reinheit sperrt. Dass die Platzierung des Verratsmotivs an dieser Stelle noch eine weitere Funktion erfüllt, wird sich später zeigen.
Genauer als Wengst betrachtet Hartwig Thyen (T585) die Art, wie Jesus nach Johannes in Vers 4 das „Wissen um seine Stunde“ der Rückkehr zu Gott in konkretes Handeln umsetzt:
Dazu erhebt er sich von dem Mahle, legt seine Kleider ab und schürzt sich, wie ein zu solchem Dienst bestimmter Sklave, mit einem Leinentuch. Da die Fußwaschung, wie wir sehen werden, als Symbol der Lebenshingabe Jesu für die Seinen verstanden sein will, ist es sicher nicht zufällig, daß hier das Ablegen der Kleider durch das Verbum tithenai {setzen, legen, stellen} ausgedrückt wird, das in Joh 10,11.15.17f die Lebenshingabe Jesu bezeichnet hatte, und für ihr erneutes Anlegen – wie in 10,17f für das vollmächtige Wiederergreifen seines Lebens – die Wendung elaben ta himatia autou {er nahm seine Kleider} (V. 12).
Nach Thyen liest sich das, was
Jesus hier an seinen Jüngern tut, … wie die Erfüllung des Makarismus {der Seligpreisung} von Lk 12,37: „Selig sind die Knechte, die ihr Herr bei seiner Heimkehr wachend findet. Amen, ich sage euch: hoti perizōsetai kai anaklinei autous kai parelthōn diakonēsei autois {Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen}.“
Da außerdem auch diese Szene „mit den synoptischen Abendmahlstexten“ spielt, müssen Thyen zufolge „in den hier mit Jesus versammelten Jüngern die Zwölf“ gesehen werden, woraus er „im Vorgriff auf das Intermezzo zwischen Petrus und ,dem Jünger, den Jesus liebte‘ (V. 23-30)“ den Schluss zieht, „daß dieser geliebte Jünger nur einer dieser Zwölf sein kann“.
Zur Eigenart der hier von Jesus vorbereiteten Fußwaschung hebt Thyen hervor:
Bei der Erörterung der seltsamen „Waschung“ der Füße Jesu durch die bethanische Schwester Maria hatten wir bereits darauf hingewiesen, daß eine derartige Waschung nur der Füße während eines Mahles nicht als ritueller Akt, sondern – wie die entsprechende Fußwaschung Jesu durch die Sünderin von Lk 7,36ff – nur als ein außergewöhnlicher Liebesdienst begriffen werden kann. Mit den Worten eis telos ēgapēsen autous {bis zur Vollendung liebte er sie} hatte der Erzähler diesen Liebeserweis Jesu den Seinen gegenüber ja bereits angekündigt. Wenn dabei die Wendung eis telos {bis zur Vollendung} zugleich vorausweist auf das definitive tetelestai {es ist vollendet} von 19,30, so deutet sich auch darin schon an, daß diese Fußwaschung, ohne daß sie ausdrücklich so benannt wäre, als ein sēmeion {Zeichen} verstanden sein will, das hinweist auf die Lebenshingabe Jesu für den kosmos {die Welt}.
Auch bei Thyen fällt hier wieder einmal auf, dass er bestimmte Deutungen einer Handlung wie der Fußwaschung einander gegenüberstellt, von denen er sich für eine entscheidet und die andere ausschließt, dabei aber andere mögliche Deutungen gar nicht erst erwähnt, etwa die Fußwaschung als Symbol für eine radikale Praxis der agapē als einer Solidarität, die bis zur freiwilligen Selbstversklavung dessen geht, der an sich das Recht hätte, andere als Sklaven für sich arbeiten zu lassen.
Obwohl Thyen die Fußwaschung nicht als rituellen Akt einstufen wollte, weist er doch darauf hin, dass das im Neuen Testament nur hier in Vers 5 verwendete und „von niptō (waschen) abgeleitete Nomen niptēr“ mit „vorangestellte[m] Artikel (ton niptēra)“ anzeigt, „daß eine derartige Schüssel für rituelle Waschungen zur normalen Ausstattung eines jüdischen Speisezimmers gehört.“
Die Wendung ērxato niptein {er begann zu waschen} versteht Thyen so, dass Jesus „wohl ganz wörtlich“ genommen damit begann,
seinen Jüngern, einem nach dem anderen, die Füße zu waschen. Als Petrus dann an die Reihe kommt {Vers 6}, weist der es entschieden von sich, sich von seinem ,Herrn‘ die Füße waschen zu lassen und eröffnet damit einen Dialog, der die gesamte Szene erschließen wird. Schon seine Anrede Jesu als kyrios markiert den Widerstand des Petrus. Er weigert sich, seinen ,Herrn‘ in der ungebührlichen Rolle eines Sklaven, ja man könnte sagen, eines heidnischen Sklaven sehen zu müssen. Denn der Dienst, den Gästen die Füße zu waschen, der freilich – anders als hier – stets schon beim Betreten des Hause und vor der Mahlzeit zu verrichten war, galt als so entwürdigend, daß selbst ein jüdischer Sklave nicht damit beauftragt werden durfte …
Zum Beleg dafür verweist Thyen unter anderem auf oben bereits von Wengst angeführte rabbinische Texte. Und er fügt hinzu (T588), dass das in dem Satz sy mou nipteis tous podas? {wörtlich: Du mir wäschst die Füße?} „der Nennung der Füße emphatisch vorangestellte mou (meine Füße) … die Situation“ verdeutlicht:
Petrus ist nicht bereit, seinen Herrn in der Rolle eines verachteten Sklaven zu akzeptieren. Dieser Dialog ist eine bemerkenswerte Variante der auf Jesu Leidensweissagung folgenden Replik des Petrus, der Jesus anfuhr und erklärte: hileōs soi, kyrie; ou mē estai soi touto {Gott bewahre dich, Herr; das widerfahre dir nur nicht} (Mt 16,22)! Der Unterschied besteht darin, daß die in der synoptischen Leidensweissagung von Jesus selbst klar ausgesprochene Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens hier einstweilen noch im Symbol der Fußwaschung verborgen ist.
Von dieser Verborgenheit redet Jesus in Vers 7 dann auch ausdrücklich:
Was in Joh 2,21f nicht die Jünger, sondern aus dem Munde des Erzählers nur dessen Zuhörer/Leser erfuhren, nämlich daß Jesus da von dem „Tempel seines Leibes“ geredet hatte und daß die Jünger das erst begriffen, als sie es im Licht des Ostermorgens erinnerten, das sagt Jesus Petrus und mit ihm den Jüngern nun durch das Symbol der Fußwaschung: „Was ich dir hier tue, das begreifst du jetzt noch nicht, du wirst es aber danach (meta tauta) erkennen“ (V. 7).
Anders als Wengst spekuliert Thyen hier nicht über antihierarchische Andeutungen des Evangelisten, vielmehr weist er darauf hin, dass dieser es liebt, „um des dramatischen Effektes seiner Erzählung willen Einzelne, die er bei ihrem Namen nennt, zu Sprechern zu machen.“ Daher gilt „das hier zu Petrus Gesagte den Jüngern insgesamt“, was sich vollends im Übergang zur Anrede aller Schüler in Vers 10 zeigen wird.
Nachdem Petrus in Vers 8 „seinen Einwand dagegen, daß Jesus ihm die Füße waschen will“, noch einmal verschärft, einerseits „durch den Gebrauch von ou mē, der stärksten Form der Verneinung“, und andererseits „durch die emphatische Betonung, daß das in Ewigkeit nicht geschehen dürfe (eis ton aiōna)“,
muß er sich von Jesus sagen lassen, „Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du nicht Teil mit mir“ (ouk echeis meros met‘ emou). Mit meros gibt die LXX das hebräische cheleq wieder, das der Bezeichnung von Israels Erbbesitz in dem ihm von Gott verheißenen und gegebenen Land dient. Wie der parallelismus membrorum in 2Sam 20,1 zeigt – ouk estin hymin meris en Dauid oude klēronomia hēmin en tō hyiō Iessai {Wir haben kein Teil an David noch Erbe am Sohn Isais} – sind meris bzw. meros und klēronomia häufig nahezu synonym; vgl. Jes 57,6. Eine bemerkenswerte Steigerung erfährt das Lexem meris, wenn JHWH Aaron als dem Vertreter der levitischen Priesterschaft erklärt, diese solle keinen Erbbesitz an dem Land und keinen Anteil in der Mitte der Stämme haben, vielmehr solle gelten: egō meris sou kai klēronomia sou en mesō tōn hyiōn Israēl {ICH bin dein Anteil und dein Erbteil inmitten der Israeliten} (Num 18,20; vgl. Dtn 12,12; 14,27). Mehr und mehr ist dieses priesterliche Privileg, daß JHWH selbst Erbteil des Frommen ist, zum Besitz des gesamten Volkes geworden und meros zur Bezeichnung des Lebens der zukünftigen Welt.
Indem in Jesu Antwort „vom Waschen allein der Füße nicht mehr die Rede ist“, kommt Thyen zufolge „die Fußwaschung einem Vollbad“ gleich, „das die völlige Reinheit bewirkt (V. 10)“. Außerdem (T588f.) „gibt nicht einfach der Ritus einer Fußwaschung Teil an Jesus, sondern allein der Umstand, daß Jesus ihn vollzieht: ‚Wenn ich dich nicht wasche‘.“
Das Thema der Teilhabe am Leben der zukünftigen Welt (T589) war nach Thyen bereits in Lukas 22,14-30 als dem „Prätext“ der „Mahlsituation unserer Szene“ von Jesus angesprochen worden:
Wie nach ihm Johannes hat hier schon Lukas das letzte Mahl Jesu mit einer Abschiedsrede verbunden, an deren Ende der scheidende Jesus seinen Jüngern verheißt, daß sie an seinem Tisch in seinem Reiche essen und trinken werden und auf Thronen sitzen sollen, die zwölf Stämme Israels zu richten (V. 30). Bei Johannes ist echein meros met‘ emou {Teil haben mit mir} wohl solche Teilhabe an dem ewigen Leben, das der Sohn wie sein Vater „in sich selbst“ hat (vgl. 5,26).
Indem Petrus, der „an diesem Leben natürlich teilhaben“ will, „nun überschwenglich“ fordert (Vers 9): „Herr, dann aber nicht allein die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt!“, fällt er nach Thyen „ins andere Extrem“ und begreift „den symbolischen Modus der Handlung Jesu immer noch nicht“, sondern
hält das, was da an ihm geschieht, für eine Art levitischer Reinigung. Darum muß Jesus ihm nun erklären {Vers 10}: Wer (so wie ich euch das jetzt tue) gewaschen ist, der bedarf keinerlei weiteren Waschung mehr, er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein; freilich nicht alle.
Auch Thyen hält also wie Wengst „die Wendung ei mē tous podas {außer [der Waschung] der Füße} für die sinnstörende sekundäre Glosse eines Abschreibers“, obwohl sie (T587) „von der Masse der Handschriften bezeugt“ wird. Zur Begründung verweist er auf Rudolf Bultmanns <949> in dieser Hinsicht überzeugende Ausführungen:
Liest man nämlich den Text mit den Worten ei mē tous podas {außer die Füße}, „so redet V. 10 von zwei Waschungen, einer vorausgehenden, umfassenden, dem Vollbad, und einer folgenden, partiellen, der Fußwaschung. Die erste wäre die entscheidende, die zweite, wenngleich noch notwendig, so doch zweiten Ranges. Das entspricht nicht dem Pathos von V. 8f, wonach die Fußwaschung als das schlechthin Entscheidende erscheint. Und was wäre mit den beiden Waschungen gemeint? Nach der zumeist vertretenen Auslegung geht das louesthai {Waschen} auf die Taufe als ,Generalreinigung‘, die Fußwaschung auf das Herrenmahl, das die unvermeidlichen neuen Sünden vergibt. … Aber es ist doch grotesk, daß das Herrenmahl durch die Fußwaschung abgebildet sein soll, zumal da doch die Situation des Mahles gegeben war!“
Aber selbst wenn man die Fußwaschung nicht in Verbindung mit dem Herrenmahl bringen, sondern als „Symbol der Taufe“ verstehen will,
wendet Bultmann [358] überzeugend ein, „daß in ihnen zwei notwendige Reinigungen unterschieden werden“. Dagegen heiße es jedoch „von dem leloumenos {dem Gewaschenen}, daß er ganz rein sei (katharos holos), und wenn nach dem louesthai {Waschen} noch eine Fußwaschung nötig ist, so ist der Gebadete eben nicht ganz rein. Es folgt m.E. zwingend, daß das ei mē tous podas {außer die Füße} ein schlechter Zusatz ist …“.
Thyen fügt hinzu (T589), dass in seinen Augen auch die parallele Verwendung von louesthai und nipsasthai {Waschen} als ein Beispiel der johanneischen Vorliebe für gleichbedeutende Worte zu betrachten ist.
Dass nach den Schlussworten Jesu in Vers 10 all‘ ouchi pantes {aber nicht alle} rein sind, „kommentiert der allwissende Erzähler Jesu“ in Vers 11 mit den Worten:
„Denn er kannte den ja, der ihn ausliefern sollte. Darum hatte er gesagt: Ihr seid nicht alle rein“. Mit dieser Bemerkung versetzt er seine Leser in eine – den unwissenden Jüngern der Erzählung gegenüber – ausgesprochen privilegierte Position: „Solche Information dient nur dazu, die Wirkung der Geste Jesu zu verstärken. Die Empfänger dieser Fußwaschung, einer symbolischen Handlung, die die grenzenlose Liebe Jesu zu den Seinen offenbart, sind unwissende Jünger, von denen er weiß, dass einer ihn verraten wird.“ <950> Zugleich soll Jesu Wendung all‘ ouchi pantes {aber nicht alle} die Jünger wohl dazu veranlassen – ohne daß das eigens expliziert werden müßte, wie in den synoptischen Prätexten -, daß jeder von ihnen sich fragen muß: Bin ich es etwa?
Erst nach seiner Auslegung der Verse 12 und 13 wird Thyen noch seine Auffassung darlegen, dass (T592)
unsere gesamte Fußwaschungsszene samt der sie rahmenden Ankündigung der Auslieferung Jesu durch Judas und seiner Verleugnung durch Petrus als ein intertextuelles Spiel mit Lk 22 und als die Dramatisierung des da nur Gesagten durch Jesu hier erzähltes konkretes Tun begriffen sein will…
Damit greift Thyen auf das „längst vergessene Urteil von H. J. Holtzmann <951>“ zurück,
der die gesamte Fußwaschungserzählung als eine fiktionale Bildung des Evangelisten begriffen und das Vorliegen einer johanneischen Sondertradition bestritten hatte. Vielmehr habe Johannes hier Lk 22,24-27 so „in Szene, (gesetzt, daß) er zunächst das entsprechende Wort Lk 12,37 (Selig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet; denn er wird sich schürzen und sie zu Tische legen und herantreten und ihnen dienen) zur Beschreibung der Handlung (4-5), das andere aber zur 13-16 nachgeschickten Erklärung derselben verwendet“ habe. Darüberhinaus dürfte es, wie schon zu Joh 12,1ff beobachtet, wiederum die als Liebeserweis gedeutete Waschung der Füße Jesu durch jene stadtbekannte Sünderin von Lk 7,36ff gewesen sein, die Johannes zu dem ungewöhnlichen Akt der Fußwaschung inspiriert hat.
Indem Thyen also die Erzählung von der Fußwaschung vor dem Hintergrund des Lukasevangeliums als dem „auch dem Leser geläufigen Prätext“ interpretiert, ist er wie Wengst der Überzeugung, dass Johannes nicht etwa dem Ritual des Abendmahls kritisch gegenüberstehen würde; vielmehr bietet er eine neue Deutung der Eucharistie:
Wie Johannes in 6,51ff die eucharistische Sprache gebraucht hatte, um Jesu reales Menschsein und die Hingabe seines Fleisches für das Leben der Welt zu unterstreichen, die durch Brot und Kelch der Eucharistie als bleibende Realität bezeugt wird, so gilt für die Ersetzung der Abendmahls-Institution durch die Fußwaschung, daß Johannes damit sein Verständnis der Eucharistie und ihre Einsetzung durch Jesu Sterben für die Seinen zur Sprache bringt …
Nach Ton Veerkamp <952> geschieht das Außergewöhnliche, das Jesus ab Vers 4 unternimmt, ausdrücklich in seinem
„Bewusstsein …, dass er derjenige ist, dem alle Macht übertragen wurde…, in diesem Bewusstsein legt er sein Gewand ab und nimmt eine Schürze, die Bekleidung eines Haussklaven. Die Handlung der Fußwaschung an den Gästen eines Gastmahles war eine Obliegenheit der Haussklaven. Diese Rolle übernimmt Jesus, zum Entsetzen des Schülers Simon Petrus.
Anders als Wengst nimmt Veerkamp in der kritischen Darstellung des Petrus keine antihierarchische Tendenz wahr; vielmehr ist sie gerade dadurch bedingt, dass diesem Schüler eine entscheidende Führungsrolle innerhalb der messianischen Bewegung zukommt:
Warum gerade er? Waren die anderen nicht entsetzt? Selbstverständlich, denn sogar ein Sklave israelitischer Herkunft ist nicht verpflichtet, seinem Herrn die Füße zu waschen. <953> Jesus handelt wie Abigail, die zu David sagte, 1 Samuel 25,41: „Da ist deine Magd als Sklavin, um die Füße der Sklaven meines Herrn zu waschen.“ Jesus handelt wie die Sklavin Abigail. Das Entsetzen Simons wird hervorgehoben, weil er die Führung der Messianisten verkörpert. Johannes schiebt mit Absicht dem Simon die Rolle zu, sich dem Ansinnen Jesu zu widersetzen. Jesus weiß: wenn er Simon nicht dazubringt, sich dieser Tat Jesu zu fügen, steht dessen künftige Rolle als „Hirte“ und so das Ganze auf dem Spiel; Simon (also die messianische Bewegung) hätte sonst keinen Anteil an ihm.
An dieser Stelle hätte ich es spannend gefunden, Ton Veerkamp zu fragen, wie er dieses Verständnis des Anteils am Messias zu Thyens Ausführungen über das Stichwort meros im Sinne des Erbteils Israels und des Lebens der zukünftigen Welt in Beziehung setzen würde. Vermutlich hielte er beides insofern für identisch, als die Ehre des Gottes Israels und seines Messias im Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker besteht. Wer an Jesus Anteil hat, der durch seinen Tod am Kreuz die römische Weltordnung überwindet, gewinnt zugleich Anteil am Leben der kommenden Weltzeit, das mit diesem Sieg anbrechen kann.
Interessant ist, dass Veerkamp in Anm. 409 zu seiner Übersetzung von Johannes 13,8 aus dem Jahr 2005 die Wendung ouk echeis meros met‘ emou {hast du keinen Anteil an mir} noch mit folgender Bibelstelle in Verbindung gebracht hat:
ˀen cheleq ˁimakh, ouk estin meris meta sou, „er hat kein Teil mit dir“, Deuteronomium 14,27; es geht um den Leviten, der kein Eigentum und kein Teil neben den grundbesitzenden Großfamilien hat, der eine Person minderen Rechts und darum wie Waisen und Witwen besonders schutzbedürftig ist. Jesus sagt, dass Simon im Königtum des Messias „keinen Teil neben dem Messias haben wird“, also eine Person minderen Rechts wie der Levit sein wird, wenn er sich nicht die Füße waschen lässt und an seinen Brüdern nicht entsprechend handelt.
Weder in seiner Auslegung der Stelle im Jahr 2007 noch in seiner neuen Übersetzung im Jahr 2015 greift er darauf zurück. Tatsächlich wäre es von 4. Mose 18,20 her – einer Stelle, auf die Thyen oben hingewiesen hat – angemessener, den Leviten nicht als minderprivilegiert zu betrachten, sondern umgekehrt als denjenigen, der Anteil am NAMEN selbst hat. Dann könnte Jesus derjenige sein, der den vollkommensten Anteil am NAMEN hat und daher nicht nur auf jeden irdischen Besitz verzichten, sondern sogar sein Leben hingeben kann. Und wer sich von Jesus die Füße waschen lässt, gewinnt mit seinem Anteil an Jesus zugleich Anteil am NAMEN und damit Anteil am Leben der kommenden Weltzeit.
Die Forderung des Simon Petrus, Jesus „solle ihm auch die Hände und den Kopf waschen“, findet Veerkamp
merkwürdig, denn in der Schrift ist vom Waschen des Kopfes nie die Rede, wohl aber vom Waschen der Hände; letzteres hat auf alle Fälle mit dem Gebot der Reinheit zu tun. Jesus solle ihm jene Körperteile waschen, die durch Kleidung nicht bedeckt sind, also Füße, Hände, Kopf.
Jesus greift das auf, indem er das Wort „baden“ benutzt. Wer gebadet hat, ist rein. Sie haben gebadet, sie sind durch das Tauchbad der Worte des Messias gegangen. Das Ansinnen Simons ist daher unsinnig, er hat gebadet, seine Füße, Hände und sein Kopf sind „gebadet“. Die Waschung, die Jesus hier vornimmt, dient nicht der Reinigung. Nur einer ist unrein, der Handlanger Roms.
↑ Johannes 13,12-17: Jesu Gebot, einander die Füße zu waschen
13,12 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte,
nahm er seine Kleider
und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen:
Wisst ihr, was ich euch getan habe?
13,13 Ihr nennt mich Meister und Herr
und sagt es mit Recht, denn ich bin‘s auch.
13,14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,
so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen.
13,15 Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben,
damit ihr tut, wie ich euch getan habe.
13,16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Der Knecht ist nicht größer als sein Herr
und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat.
13,17 Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr‘s tut.
[1. Oktober 2022] Zu Vers 12 weist Klaus Wengst darauf hin, dass nun auf das in den Versen 4-5 „erzählte Handeln“ Jesu nun „in genauer Entsprechung“ Bezug genommen wird (W398f.):
„Nachdem er nun ihre Füße gewaschen, seine Kleider genommen und sich wieder zu Tisch gelegt hatte“, stellt Jesus die überraschende Frage: „Erkennt ihr, was ich euch getan habe?“ Konnte doch nach V. 7 Simon Petrus „jetzt“ gar nicht verstehen. Aber die Leser- und Hörerschaft sollte schon beim Lesen und Hören und nicht erst später verstehen. Dort, wo Johannes indirekt seine eigene Deutung gab, war sie den Schülern zeitlich voraus; hier, wo Jesus in der Erzählung eine direkte Deutung gibt, ist sie ihnen sozusagen gleichzeitig. Sie soll beide Deutungen vernehmen. Dass Johannes Hinweise gibt, sie einander zuzuordnen, wird noch deutlich werden.
Indem Jesus in Vers 13 (W399) „die eigene Stellung gegenüber seinen Schülern“ mit den Worten hervorhebt: „Ihr nennt mich Lehrer und Herr und sagt es zu Recht; denn ich bin es“, weist er zugleich auf „das Besondere und Ungewöhnliche seines gerade erzählten Handelns“ hin. Daraus zieht er in den Versen 14-15 die Schlussfolgerung:
„Wenn nun ich euch die Füße gewaschen habe, der Herr und der Lehrer, seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen.“ … Dabei geht es keineswegs speziell um die Fußwaschung; sie hat nur exemplarischen Charakter. „Ein Beispiel nämlich habe ich euch gegeben, damit, was ich euch getan habe, auch ihr tut.“ Intendiert ist ein Tun entsprechend dem hier exemplarisch dargestellten Tun Jesu. Sein Vorbild weist die Schüler ein in den gegenseitigen Dienst gleicher Geschwister.
Wer allerdings meint (Anm. 21), dass Jesus einen Ritus habe einsetzen wollen wie den „Brauch …, dass der Papst jeden Gründonnerstag zwölf Personen die Füße wäscht“, unterliegt nach Wengst folgenden „drei Missverständnissen“:
1. Die Fußwaschung, die zur Entstehungszeit des Textes lebendige Sitte war, ist hier zu einem Ausnahmeritus erstarrt. 2. Die bloß rituelle Nachahmung verkennt den exemplarischen Charakter, den diese Handlung im Johannesevangelium hat. 3. Dass einer die Rolle Jesu nachahmt, wird dem vom Text intendierten Einander nicht gerecht. Jesu Vorbild macht seine Schüler zu Gleichen, die in gegenseitigen Dienst entlassen werden.
Was (W399) Jesus anschließend in Vers 16 ausspricht: „Kein Sklave ist größer als sein Herr und kein Gesandter ist größer als der, der ihn geschickt hat“, nennt Wengst eine „Selbstverständlichkeit“, mit der (W400) „die zuvor ausgesprochene Verpflichtung“ unterstrichen wird. Zur nächsten Parallele dieses Verses (W399) in Matthäus 10,24: „Ein Schüler steht nicht über dem Lehrer noch ein Sklave über seinem Herrn“, meint Wengst:
Es ist auffällig, dass diese matthäische Fassung mit den Zusammenstellungen von Schüler und Lehrer sowie Sklave und Herr genau der Hervorhebung von „Herr und Lehrer“ in Joh 13,13f. entsprechen würde. In Joh 13,16 aber steht statt der Verbindung von Schüler und Lehrer die von Gesandtem und Auftraggeber. Das spricht dagegen, dass Johannes den Spruch aus dem Matthäusevangelium übernommen hat.
Diese Aussage ist allerdings kaum überzeugend, da Johannes ja schon oft bewiesen hat, dass er mit Textvorlagen sowohl aus der jüdischen Schrift wie aus den synoptischen Evangelien sehr frei umgehen kann. Er kann also durchaus auf Matthäus zurückgegriffen und das Zitat auf seine Weise umgestaltet haben. In diesem Sinne nehme ich auch Bauers <954> Einschätzung auf, der Wengst zufolge schreibt: „Durch diese andere Terminologie ‚entfernt sich Jo(hannes) von den synoptischen Stellen und nähert sich dem Midrasch‘.“
Mit folgender Seligpreisung schließt Jesus in Vers 17 den Gesprächsgang ab, der mit seiner Frage in Vers 12 begonnen hatte: „Wenn ihr das wisst: Glücklich seid ihr, wenn ihr es tut!“ Inzwischen hat er ihnen die Erkenntnis vermittelt, „was er ihnen mit der Fußwaschung getan hat … und ihnen deutlich gemacht, dass sie keinen Grund haben, deren Konsequenz zu verweigern.“
Inhaltlich wirft Wengst an dieser Stelle die Frage auf, in welcher Beziehung „diese auf das Handeln bezogene und also bedingte Seligpreisung“ zur „unbedingten Zusage von V 10 – ihr seid rein“ steht. Stehen beide einfach „unverbunden“ nebeneinander „oder gar in Konkurrenz und Spannung“ zueinander? Seine Antwort lautet:
Die ethische Ausdeutung der Fußwaschung Jesu und deren Verständnis als Symbol seines Todes am Kreuz gehören komplementär zusammen. Das von der Schülerschaft erwartete Handeln gründet in Jesu Handeln, das ihnen zugute erfolgt. Hinzu kommt nun die Beobachtung, dass Johannes die Zielaussagen beider Deutungen, die unbedingte Zusage und die bedingte Seligpreisung, dadurch bewusst einander zuordnet, dass er ihnen mit der Aufnahme des Verratsmotivs jeweils eine genau parallele Fortsetzung gibt. Er will damit die beiden Deutungen im Zusammenhang miteinander verstanden wissen: Die unbedingte Zusage, die aufgrund des Todes Jesu am Kreuz erfolgt, hat auf Seiten der angesprochenen Menschen ihre konkrete Wirklichkeit in einem ihr entsprechenden Handeln. Und umgekehrt: Wer entsprechend dem Tun Jesu handelt, lässt sich damit auf die Wirklichkeit Gottes selbst ein, die sich im Kreuz Jesu als Liebe erwiesen hat.
Zum Problem (T589), dass Jesus nach Beendigung der Fußwaschung in Vers 12 „mit der Frage: ‚Begreift ihr, was ich euch getan habe?‘, eine neue und anscheinend ganz andersartige Deutung der Fußwaschung als die zuvor im Gespräch mit Petrus implizierte“ gibt, betont Hartwig Thyen zunächst (T590), dass sich
das geheimnisvolle meta tauta {danach} und die Teilhabe am Erbteil Jesu (echein meros met‘ emou {Teil haben mit mir}) … nicht auf dieses neue Gespräch nach der Beendigung der Fußwaschung beziehen [kann], sondern nur auf die Zeit nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, die er als seine selbsteigene Tat in dem sēmeion {Zeichen} der Fußwaschung soeben vorabgebildet hat, auf die Zeit also, da der heilige Geist die Jünger in die ganze Wahrheit führen wird.
Damit unterstreicht er seine Überzeugung, dass „man nicht nur die in den Kapiteln 1-11 erzählten und ausdrücklich so benannten Wundertaten Jesu sēmeia nennen“ darf, sondern „seinen gesamten Weg, seine Person und sein Geschick als sēmeion begreifen“ muss, was ihm zufolge Sandra Schneiders <955> besonders treffend erklärt:
„Wenn die Zeichen das sind, was Jesus getan hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, damit seine Jünger an ihn glauben (Joh 2,11), dann muß auch sein Ostergeheimnis, in dem er vollständig verherrlicht wird … und seine Jünger zum Glauben kommen und erkennen, wer er wirklich ist …, zu den Zeichen gezählt werden. Im Folgenden wird die Fußwaschung als das Zeichen par excellence betrachtet, d. h. als ein Werk Jesu, das den Sinn des Heils offenbart, wie ihn das vierte Evangelium versteht und darstellt. Die symbolische Offenbarung der Tat der Fußwaschung wird im Text neu versinnbildlicht. Mit anderen Worten: Das Zeichen, das für die ersten Jünger Jesu getan wurde, wird durch die Aufnahme in das Evangelium zu einem Zeichen für alle, die mit Verständnis lesen können. Das bedeutet, die Fußwaschung ist kein Ereignis, das eine einzige, eindeutige Bedeutung hat, die mit der Intention des vierten Evangelisten und/oder dem Verständnis seiner ursprünglichen Zuhörerschaft übereinstimmt, sondern sie ist ein Symbol, das unaufhörlich zur Reflexion anregt und ein immer tieferes Verständnis des Heils hervorbringt, das es symbolisiert, wenn der Horizont des Textes mit den verschiedenen Horizonten der Generationen von Lesern verschmilzt“.
Nachdem das klargestellt ist, betont Thyen (T591), dass „Jesu neue Frage: ‚Begreift ihr, was ich euch getan habe?‘, weder als ein Bruch in der Erzählung und als ein lndiz dafür angesehen werden“ darf, „daß jetzt ein anderer die Feder führte, noch als vorzeitige Auflösung des geheimnisvollen meta tauta {danach} von V. 7“. Vielmehr eröffnet Jesus, beginnend mit Vers 13,
einen für die Jünger durchaus schon jetzt begreiflichen, wenn auch nur partiellen Aspekt der Bedeutung der Fußwaschung, die sich ihnen erst meta tauta {danach}, nämlich im Licht des Ostermorgens, in ihrer ganzen Wahrheit bruchlos erschließen wird … Denn Jesu Jünger haben ja soeben am eigenen Leibe erlebt, daß der, den sie zu Recht ihren Lehrer und Herrn nennen (kai kalōs legete: eimi gar {und das habt ihr recht gesagt, denn der bin ich}: V. 13), sich scheinbar „erniedrigt“ und ihnen den Liebesdienst der Fußwaschung erwiesen hat. Auch wenn sie wie ihr Sprecher Petrus noch nicht begreifen, daß dieses in seiner „Freundschaft“ wurzelnde Tun Jesu (15,12ff) ein sēmeion {Zeichen} war für die Hingabe seines Fleisches für das Leben der Welt, können sie es doch jetzt schon als einen elementaren Akt seiner liebenden Zuwendung verstehen und darin ein Zeichen dafür erkennen, daß er sich für sie verantwortlich weiß und gerade damit sein wahres kyrios-Sein {Herr-Sein} bestätigt und sein Königtum ausübt, das nicht von dieser Welt ist (18,36).
An dieser Stelle kann ich Thyen nur aus vollem Herzen zustimmen, wenn er hervorhebt (T591f.):
Das Thema der Liebe Jesu und sein darin begründetes ,neues Gebot‘ (13,34f), sowie seine Explikation dieses Gebots durch 15,12ff sind also keinesfalls sekundäre Moralisierungen des christologischen Symbols der Fußwaschung, sondern sie bringen vielmehr zum Vorschein, was Jesu ungewöhnliches Tun bedeutete. Sie begründen, daß eben das, was Petrus zuvor befürchtet und weit von sich gewiesen hatte, nämlich daß Jesu Verhalten die gesamte Weltordnung von Herrschaft und Knechtschaft, von Subjekt und Objekt außer Kraft setze, tatsächlich die Absicht dieses Herrn war (vgl. dazu Mk 10,35-45 / Mt 20,20-28 / Lk 22,24-27).
Besonders spricht mich in diesen Sätzen seine Formulierung über die „Weltordnung“ an, mit der er natürlich nicht dasselbe meint wie Ton Veerkamp, aber dennoch sehr ähnliche Perspektiven eröffnet: Muss sich die Außerkraftsetzung „von Herrschaft und Knechtschaft“ im Kontext des Johannesevangeliums nicht ganz konkret auf die Überwindung der real existierenden Versklavung unter die römische Weltordnung beziehen?
In eine andere Richtung scheint jedoch folgender Satz Thyens zu weisen (T592):
Wir haben oben absichtsvoll von Jesu ,scheinbarer Erniedrigung‘ gesprochen, weil ebenso wie der geforderte Dienst der Kinder für die Eltern, der Ehefrau für den Mann, der Untergebenen für die Herrschenden usw. auch die Erniedrigung der Herrschenden zum Wohle ihrer Untergebenen, Klienten oder Patienten den ontologischen Primat der Herrschaft der Einen über die Anderen nicht zu brechen vermag.
Was will Thyen hier ausdrücken? Gehört der unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen „geforderte Dienst“ untergebener für die ihnen übergeordneten Menschen zu ihrer unabänderlichen ontologisch-wesensmäßigen Bestimmung und kann dementsprechend auch eine freiwillige „Erniedrigung“ dieser „Herrschenden zum Wohle ihrer Untergebenen“ nicht die Aufhebung einer unterdrückenden Herrschaftsform zum Ziel haben? Die von Thyen unter Bezug auf Wenzler und Lévinas <956> hinzugefügte Begründung trägt in meinen Augen wenig zum Verständnis bei, sondern erhöht meine Verwirrung:
Denn „das ontologisch ergreifende – nicht das ethisch antwortende – Verstehen des Anderen ist ihm gegenüber Gewalt, weil es gerade die Anderheit des Anderen auslöscht, sich unterwirft, im extremen Fall dadurch, daß es den Anderen tötet“. Daß und wie diese ontologisch ergreifende Gewalt am Anderen, an dem ,Einander‘ des Neuen Gebots Jesu und an seiner Freundesliebe, scheitern muß, und wie damit die Rolle einer Ersten Philosophie von der Ontologie übergeht auf die Ethik, zeigt Lévinas in ,Die Zeit und der Andere‘…
Da Thyen an anderer Stelle <957> genau dasselbe Zitat von Wenzler in einem Zusammenhang anführt, in dem es nicht um gesellschaftliche Unter- und Überordnung geht, sondern um die Unterordnung Jesu unter Gott gegenüber einer mit der ethischen Kategorie der Liebe ausgedrückten wechselseitigen Beziehung Jesu zu Gott, geht es ihm wohl auch hier weniger um gesellschaftspolitische Fragestellungen als um die bereits mehrfach von ihm angesprochene Frage, wie das Einssein Jesu mit dem Vater zu denken ist:
Gott, den Jesus ,mein Vater‘ nennt, ist weder das ,Sein‘ noch ein höchster ,Seiender‘, demgegenüber man von ,Subordination‘ {Unterordnung} sprechen könnte. Jesu Verhältnis zu diesem Vater ist vielmehr ein solches der wechselseitigen Liebe und hat seinen Ort deshalb ,jenseits des Seins und anders als Sein geschieht‘ (Lévinas). Biblisch ist das Verhältnis Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott ein unabdingbar ethisches. Und den Primat der Ethik vor aller Ontologie hat Lévinas in zahlreichen Untersuchungen eindrucksvoll vor Augen gestellt. … Daß und warum im Philosophieren von Lévinas die Rolle einer Ersten Philosophie von der Ontologie auf die Ethik übergeht, hat L. Wenzler in seinem lesenswerten ,Nachwort‘ zu Lévinas Untersuchung, ,Die Zeit und der Andere‘ klar begründet. Er formuliert da u.a.: „Der Primat der Ontologie, das heißt der Erfassung und Konstitution der Wirklichkeit durch das transzendentale Bewußtsein oder – in der Fundamentalontologie Heideggers – durch das Seinkönnen des Daseins, scheint universal und unerschütterlich zu sein. Mit einer Ausnahme: der Andere widersetzt sich dem Verstandenwerden in den Kategorien des Seins. Dem Anderen gegenüber erscheint das Verstehen und Ergreifen im Licht des Seins als ein Akt der Gewalt. Das ontologisch ergreifende – nicht das ethisch antwortende – Verstehen des Anderen ist ihm gegenüber Gewalt, weil es gerade die Anderheit des Anderen auslöscht, sich unterwirft, im extremen Fall dadurch, daß es den Anderen tötet“.
Wenn ich das ansatzweise richtig verstehe, mag Thyen ausdrücken wollen, dass Jesus gerade in der Selbstversklavung durch den Akt der Fußwaschung seinen Jüngern die Liebe erweist, durch die er als ihr Herr mit Gott dem Vater eins ist. Jesu Einheit mit dem Vater in irgendeiner Weise als seinsmäßige Wesenheit erfassen zu wollen, versucht dagegen, Jesus und/oder dem Vater Gewalt anzutun, sie dem eigenen Verstehen zu unterwerfen, statt auf ihre Liebe mit eigener Liebe – im ethisch-verantwortlichen Handeln – zu antworten.
In den Versen 14-15 vertauscht Jesus Thyen zufolge (T593) die
Folge von ,Lehrer‘ und ,Herr‘, indem er erklärt: Wenn nun ich euch die Füße gewaschen habe, der ich doch ho kyrios kai ho didaskalos {der Herr und der Lehrer} bin, dann müßt ihr erst recht auch einander die Füße waschen. Denn damit habe ich für euch ein Exempel statuiert: hypodeigma gar edōka hymin {denn ich habe euch ein Vorbild gegeben}.
Unter Rückgriff auf verschiedene Stellen vor allem aus den Makkabäerbüchern, auf die Culpepper <958> aufmerksam gemacht hat, sieht Thyen durch das Wort hypodeigma eine enge Verbindung der „Fußwaschung mit dem Tod Jesu“ gegeben; es „fordert von den Jüngern die Bereitschaft, für einander zu sterben (vgl. 15,13; 16,2; 21,19):
Das Lexem hypodeigma begegnet bei Johannes nur hier; es fehlt in den synoptischen Evangelien und kommt in der LXX sowie im übrigen NT nur je fünf mal vor, nämlich in Ez 42,15; Sir 44,16; 2Makk 6,28.31; 4Makk 17,23 und Hebr 4,11; 8,5; 9,23; Jak 5,10 und 2Petr 2,6. Man muß das Nomen statt durch Beispiel (Exemplum), wohl treffender durch Urbild (Exemplar) wiedergeben. In diesem Sinne ist Henoch, an dem Gott Wohlgefallen hatte und der darum ,entrückt wurde“, für alle folgenden Generationen das hypodeigma metanoias (Sir 44,16); noch gewichtiger in unserem Zusammenhang sind aber die drei Belege aus den Makkabäerbüchern, auf die Culpepper aufmerksam gemacht hat, wo das Martyrium des alten Eleazar als das hypodeigma gennaion eines schönen Todes für die ehrwürdigen und heiligen Gesetze bezeichnet wird (2Makk 6,28); und durch dieses Sterben hinterließ er nicht nur der Jugend, sondern der Mehrheit seines ganzen Volkes ein hypodeigma gennaiotētos kai mnēmosynon aretēs {Vorbild edler Gesinnung und Denkmal der Tugend} (ebd. V. 31). Und das Martyrium der Mutter und ihrer sieben toratreuen Söhne wird {4. Makkabäer 17,21-22} als antipsychon (Ersatzleistung) für die Sünden des Volkes bezeichnet: kai dia tou haimatos tōn eusebōn ekeinōn kai tou hilastēriou tou thanatou autōn hē theia pronoia ton Israēl prokakōthenta diesōsen {Und durch das Blut dieser Frommen und ihren Tod als Sühneopfer bewahrte die göttliche Vorsehung Israel, das zuvor misshandelt worden war}. Selbst der grausame Tyrann Antiochus ist von der Mannhaftigkeit dieser Märtyrer derart beeindruckt, daß er ihre Standhaftigkeit öffentlich als hypodeigma für seine eigenen Soldaten ausrufen ließ (4Makk 17,21ff).
Schon Calvin <959> hat daher
die seit dem dritten oder vierten Jahrhundert jährlich in der Liturgie des Gründonnerstags vollzogene „theatermäßige Fußwaschung“ als ein groteskes Mißverständnis kritisiert und dazu erklärt: „Mit dieser nichtigen Zeremonie meinen sie, ihre Pflicht getan zu haben. Ihre Brüder danach zu verachten, daraus machen sie sich kein Gewissen. Sicherlich aber befiehlt Christus hier keine jährlich zu wiederholende Handlung, sondern heißt uns, das ganze Leben bereit (zu) sein den Brüdern die Füße zu waschen“.
Was Vers 16 betrifft, geht Thyen (T594) nur auf das einleitende „doppelten Amen“ mit folgenden Worten ein:
Von den insgesamt 24 Vorkommen des doppelten Amen erscheint die Wendung nach unserem V. 16 in den V. 20, 21 und 38 ebenso wie im Rest des gesamten Aktes, nämlich in 14,12; 16,20 und 16,23 jeweils noch drei weitere Male. Simoens <960> hat diese amēn-amēn-Worte als gewichtige Elemente der Gliederung von Joh 13,1-17,25 erwiesen. Wir behandeln nach seinem Vorschlag darum die V. 18-20 als einen Abschnitt eigenen Rechts.
Nur nebenbei sei bemerkt, dass das doppelte Amen sogar 25mal im Johannesevangelium auftaucht. Ob und in welcher Weise seine siebenmalige Verwendung während der Abschiedsreden Jesu sich auf deren Gliederung auswirken, wird sich zeigen. An dieser Stelle finde ich es seltsam (T593), dass Thyen die feierliche Einleitung in keinster Weise auf den Inhalt von Vers 16b bezieht {Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, und ein Gesandter ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat}, sondern nur auf Vers 17. Dabei stellt er die dort geäußerte bedingte Seligpreisung nicht wie Wengst der in Vers 10 vorausgesetzten Reinheit der Jünger gegenüber, sondern ihrem Wissen um ihr „Jüngerverhältnis“ (T593f.):
Mit dem genuin johanneischen doppelten Amen, das nie einen neuen Abschnitt eröffnet, sondern stets auf zuvor Gesagtes und/oder Getanes zurückweist und es resümiert und mit der unter die Bedingung ihres Wissens und ihres daraus folgenden Tuns gestellten Seligpreisung der Jünger beschließt Jesus die Erläuterung dessen, was er mit seiner Fußwaschung an ihnen getan hat: ei tauta oidate, makarioi este ean poiēte auta {Wenn ihr das wißt: Selig seid ihr, wenn ihr danach handelt} (V. 17 mit der Wiederaufnahme des ginōskete {begreift ihr} von V. 12 durch oidate {ihr wisst}). Wie das wechselseitige Bedingungsverhältnis von Glauben und Erkennen in 6,69 u. ö., so ist auch hier die Konstellation von Wissen und Tun nicht deren scharfe Gegenüberstellung. Die Seligpreisung der wissenden Jünger ist nicht die Mahnung, das gewußte Jüngerverhältnis nun auch im Tun der Liebe zu verwirklichen. <961> Vielmehr liegt die Pointe dieses Makarismus {Seligpreisung} darin, „daß er auf überraschend selbstverständliche Weise ein Wissen vorstellt, das gar nicht ohne Tun existiert. Und damit stellt er ein Tun vor, das einzig im Rahmen dieses Wissens selbstverständlich wird“ <962>. Das Tun ist bleibend auf dieses Wissen angewiesen und lebt von ihm, läßt es nicht hinter sich zurückbleiben, sondern vertieft es ständig. „Dieses Wissen ist zur Signatur seines Seins (nämlich des Seins dessen, dem Jesus die Füße gewaschen hat) geworden, und würde er sich in seinem Tun darüber erheben wollen, so würde er sich seiner Lebensgrundlage berauben“.
Nach Ton Veerkamp <963> hatte Jesus in Vers 10 geklärt, dass die „Fußwaschung … etwas anderes“ ist als ein Reinigungsritus. Worum es wirklich geht, das muss Jesus in den Versen 12-17 erklären:
Die Schüler verhalten sich zu Jesus, zum Herrn und Lehrer, wie die Schüler eines Rabbis sich zum Rabbi verhalten. Die Rolle könnte Jesus in diesem Kreis für sich beanspruchen: „eimi gar, denn ich bin es“, nämlich Herr und Lehrer. Er ist aber der Sklave (doulos, ˁeved).
In recht knappen Worten beschreibt Veerkamp die Konsequenz, die sich aus dieser Haltung des Messias ergibt:
Die Schlussfolgerung ist keine religiöse, etwa: „Weil Gott (der Messias) die Menschen liebt und ihnen dient, so sollen sie Gott (den Messias) lieben und ihm dienen.“ Im Gegenteil: Wenn sich der „wie-Gott“ (hyios theou {wörtlich: Sohn Gottes}) zum Sklaven (doulos) dieser Menschen macht, müssen diese Menschen untereinander Sklaven füreinander sein: aus der Vertikale (ich für euch) folgt die Horizontale (ihr füreinander); in der Sprache Bonhoeffers hieße das „Proexistenz“. Das Verhältnis Gottes zum Messias und des Messias zu den Schülern ist strikt exemplarisch: „Wie Gott zu mir, wie ich zu euch, so ihr untereinander.“ Es gibt bei Johannes keine universelle Nächstenliebe, und es gibt bei ihm erst recht keine Religion.
Zum letzten Satz frage ich mich allerdings, ob Veerkamp hier nicht zumindest näher erläutern müsste, was genau er meint.
Dass das Liebesgebot bei Johannes nicht als „universelle Nächstenliebe“ zu verstehen sein soll, mag sich zunächst auf seine Zurückhaltung gegenüber einer generellen Völkermission beziehen, dann aber auch auf die faktische Zurückgezogenheit der Schüler Jesu hinter verschlossenen Türen aus Furcht vor den Judäern. Ist aber eine Überwindung der herrschenden Weltordnung durch das Gebot der agapē Jesu, der solidarischen Liebe, wie sie Johannes Veerkamp zufolge vorschwebt, denkbar, ohne das diese über den Schülerkreis und am Ende auch über das in der messianischen Gemeinde versammelte Israel hinausgreift?
Dass er außerdem Religion als Liebe zu Gott definiert und im Johannesevangelium eine solche Liebe zu Gott nicht gefordert sieht, halte ich für zu kurzgeschlossen. Auch eine „Proexistenz“ der von Gott herausgeforderten Menschen, die sich auf andere Menschen richtet, kann zumindest als religiös motiviert beschrieben werden. Tatsächlich wirkt sich hier ein Veerkampsches Ressentiment gegenüber einer religiös verstandenen Beziehung zu Gott aus, da es in seinen Augen genügt, „Gott“ als reinen Funktionsbegriff aufzufassen. <964> Ich selber halte seine Argumentation zwar für überzeugend, dass der biblische Gott nicht in eine Reihe mit den altorientalischen Unterdrückergöttern oder dem abstrakten Gott der Philosophen gestellt werden darf, sondern dass sein NAME ihn aus allem anderen, was Gott genannt wird, dadurch hervorhebt, dass er der befreiende und Recht schaffende Gott ist. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, dass zu diesem Gott, so unverfügbar er für uns Menschen auch ist, eine religiös zu beschreibende Beziehung aufgenommen werden kann. <965>
↑ Johannes 13,18-20: Vom Verrat als Erfüllung der Schrift und von der Aufnahme der Gesandten Jesu
13,18 Ich spreche nicht von euch allen;
ich weiß, welche ich erwählt habe.
Aber es muss die Schrift erfüllt werden (Psalm 41,10):
„Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen.“
13,19 Schon jetzt sage ich‘s euch, ehe es geschieht,
damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin.
13,20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde,
der nimmt mich auf;
wer aber mich aufnimmt,
der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
[3. Oktober 2022] Nach Klaus Wengst (W400) wäre die Einschränkung, die in Vers 18 „auf die Seligpreisung“ folgt: „Nicht über euch alle spreche ich“, hier „eigentlich überflüssig, da es sich ja um eine bedingte Seligpreisung handelt“. Es ist Johannes also wichtig, „eine Parallele zum Ende von V. 10 herzustellen.“ Außerdem tritt er dem offenbar gegen Jesus „zur Zeit des Evangelisten“ vorgebrachten Argument entgegen, dass „Jesus von einem seiner Schüler ausgeliefert wurde“, indem wie am Ende von Vers 10 auch hier „auf die Einschränkung … das Motiv des Wissens“ folgt: „Ich weiß, was für welche ich erwählt habe.“ Ebenso waren auch die „Auslieferung durch Judas und Jesu Wissen darum … in 6,64.70f miteinander verbunden“ (W400f.):
Jesus weiß schon vorher davon; sie erfolgt in Übereinstimmung mit der Schrift, ist also sozusagen vorgesehen. … Jesus wusste, was er tat, als er Judas erwählte. Das war kein Versehen, sondern Absicht. Was aber war diese Absicht bei der Wahl des Judas? „Es soll die Schrift ausgeführt werden.“ Dass aus dem engsten Schülerkreis heraus ausgeliefert wurde, ist ein dunkles und rätselhaftes Geschehen. Wenn Johannes es als schriftgemäß hinstellt, ist es damit nicht „erklärt“, ist Judas damit auch nicht zur Marionette gemacht. Aber die Lektüre der Schrift wird hier zur Hilfe, dieses dunkle Geschehen nicht für sich allein sehen zu müssen, sondern es mit Gott in Verbindung bringen zu können.
Indem Jesus das Verhalten des Judas mit Psalm 41,10 in Verbindung bringt: „Der mein Brot isst, hat seine Ferse gegen mich erhoben“, beruft er sich auf einen „Psalm Davids“:
So kann als Sprecher der Messias angesehen werden. Daher – so ist die Argumentation – widerlegt die Auslieferung durch Judas nicht den Anspruch, Jesus sei der Messias.
Der folgende Vers 19 wendet den Jesus bevorstehenden Verrat sogar ins Positive:
„Schon jetzt sage ich es euch, bevor es geschehen ist, damit ihr glaubt, wenn es geschieht: Ich bin‘s.“ Gewiss ist das eine Vorhersage, die Johannes aus der Retrospektive schreibt. Ihre entscheidende Intention wird an ihrem am Schluss angegebenen Ziel deutlich. In dem absoluten „Ich bin“ klingt das „Ich bin“ Gottes der biblischen Tradition so an, dass in Jesus der ihn sendende und beauftragende Gott als präsent erkannt werden kann. Dessen soll die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde vergewissert werden, dass ihr in und mit diesem Opfer der Auslieferung und der darauf folgenden Hinrichtung doch kein Geringerer als Gott selbst begegnet.
Statt nun unmittelbar „von der Ansage des Verrats“ zu erzählen, folgt zunächst der Vers 20, der die parallel aufgebauten Verszusammenhänge 13,10-16 und 13,17-20 als „Teil der nun vorliegenden Gesamtkomposition der Erzählung von der Fußwaschung“ abschließt, indem er
sich deutlich auf V. 16 zurückbezieht, sowohl formal durch die doppelte Amen-Einleitung als auch thematisch: „Amen, amen, ich sage euch: Wer aufnimmt, wen ich schicken werde, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich geschickt hat.“ Im Zeugnis seiner Schüler, die als Sklaven und Boten nicht größer sind als ihr Herr und Auftraggeber und sich daher dessen Vorbild verpflichtet wissen, im Zeugnis seiner Schüler, das das Zeugnis in der Kraft des Geistes ist (15,26f.), wird Jesus selbst angenommen und damit auch der, in dessen Auftrag er gehandelt hat.
Mit einem eindrücklichen Zitat von Martin Luther <966> unterstreicht Wengst die Tragweite dieses Jesuswortes:
„Gott redet in den heiligen Propheten und Gottesmännern. Da soll Gott und Mensch nicht metaphysisch von einander gesondert werden, sondern ich will den Einfältigen sagen: Dieser Mensch, Prophet, Apostel oder rechtschaffene Prediger ist die Stimme Gottes. Hier sollen die Hörer schließen: Jetzt höre ich nicht Petrus, Paulus oder sonst einen Menschen, sondern Gott selber höre ich reden, taufen, absolvieren. […] Also schließen wir einfältig: Gott wirkt durchs Wort oder überhaupt nicht, daß es ein Wagen und Werkzeug im Herzen ist“.
Hartwig Thyen zufolge (T594) wird in Vers 18 erneut
dem göttlichen Allwissen Jesu das Unwissen der Jünger gegenübergestellt. Er redet nicht von ihnen allen, weil er ebenso um seine Auslieferung an seine Feinde durch Judas wie um seine dreimalige Verleugnung durch Petrus weiß. Man muß die elliptische {Wesentliches auslassende} Wendung all‘ hina {aber damit} wohl so paraphrasieren: ,Aber ich habe meine Wahl – nämlich, wie einstweilen freilich allein der Erzähler und seine Zuhörer wissen, die Wahl des Judas – getroffen, damit so die Schrift erfüllt werde“…
Mit der von Jesus als „die Schrift“ zitierten Psalmstelle 41,10 hatte nach Thyen „schon sein Prätext Mk 14,18ff gespielt“. Zur Art und Weise des johanneischen Spiels mit diesem Schriftwort folgt Thyen weitgehend Maarten Menken <967> [137], der „einleuchtend begründet“, dass der Evangelist hier (T594f.)
nicht die LXX zitiert, sondern auf seine Weise den hebräischen Text übersetzt bzw. seinem Kontext dienstbar macht. Der HT {hebräische Text} lautet: ˀokhel lachmi higdil ˁalaj ˁaqev (… der mein Brot mit mir aß, hat seine Ferse gegen mich groß gemacht); in der LXX (Ps 40,10) heißt es: ho esthiōn artous mou, emegalynen ep‘ eme pternismon (… der meine Brote aß, hat seine Hinterlist gegen mich groß gemacht). Da trōgein {wörtlich: kauen} – aufgrund des parallelismus membrorum in 6,53f synonym mit phagein {essen} – ein johanneisches Vorzugswort ist und unsere Mahlszene zugleich absichtsvoll mit Joh 6 verknüpft, sieht Menken in dem Evangelisten selbst wohl zu Recht den Übersetzer des hebräischen Psalms.
Interessant ist nun, dass Menken zufolge der Psalmvers 41,10 zugleich eine ganz konkrete Verratsgeschichte der Königszeit Israels in Erinnerung ruft, was sich darin zeigt (T595), dass „Johannes das Verbum hagdil (groß machen) durch epēren (seinen Fuß erheben, mit Füßen treten) wiedergibt“. In „der jüdischen Exegese“ wurden nämlich
die Davidspsalmen (!) 41 und 55 im Lichte des Verrats des Königs David durch Ahitophel ausgelegt …. Als Ahitophel dem Absalom seinen Plan mitteilt, David in der Nacht zu überfallen und zu erschlagen, so daß alle seine Getreuen die Flucht ergreifen, erklärt er ihm – ähnlich wie Kaiaphas in Joh 11,47ff -: „Du trachtest ja nur nach dem Leben eines einzigen Mannes. Das ganze Volk aber wird dann endlich Frieden haben“ (2Sam 17,3). Weil Absalom Ahitophels Rat dann aber doch nicht befolgt, erhängt der sich selbst (ebd. V. 23) {, was} vermutlich Ursprung der entsprechenden Erzählung über das Ende des Judas in Mt 27,5; vgl. Act 1,18 [ist].
Weitere Parallelen sind in der Erwähnung des Baches Kidron und des Ölbergs zu erkennen:
Denn wie Jesus nach dem Zeugnis der Synoptiker (Mk 14,32 / Mt 26,36ff / Lk 22,40ff) in der Nacht des Verrats mit seinen Getreuen über den Kidron zieht und danach den Ölberg ersteigt, wo er Gott bittet, den Leidenskelch an ihm doch vorübergehen zu lassen, so überschreitet auch David den Kidron und betet auf dem Ölberg: „Herr mache doch die Anschläge Ahitophels zur Torheit“ (2Sam 15,31) {im Text von Thyen steht versehentlich 17,31}.
Hier ist allerdings anzumerken, dass die Synoptiker zwar den Ölberg, aber nicht den Kidron erwähnen, während bei Johannes der Bach Kidron eine Rolle spielt (18,1), aber nicht der Ölberg und auch kein Gebet Jesu um Verschonung vor dem Leiden.
Die Worte, durch die König David in 2. Samuel 18,28 „von der Niederlage seiner verräterischen Feinde“ erfährt: „Gelobt sei JHWH, dein Gott, der die Leute vernichtet hat, die ihre Hand erhoben haben gegen meinen Herrn, den König“, wurden
in der jüdischen Auslegungstradition als Analogon zu Ps 41,10 (LXX: Ps 40,10) betrachtet. Darum hält Menken es für legitim, daß der Evangelist das Großmachen (hagdil) des Psalmverses durch das Erheben (naßˀu) aus 2Sam 18,28 ersetzt habe. Die Wiedergabe des Psalmverses in 13,18 mache zudem die Verknüpfung mit unserer Mahlszene sehr viel deutlicher als es der LXX-Text getan hätte. Johannes habe diesen Text auch darum nicht gebrauchen können, weil seine Wendung vom Großmachen des pternismos {Betrug, Hinterlist} ein Moment hinterlistigen Betruges enthalte, das mit dem Allwissen Jesu unverträglich sei. Darum habe er auch die ersten Worte des Psalmverses, die den Verräter einen „Mann meines Friedens, dem ich vertraut habe“ nennen, auslassen müssen. Denn wer, wie Jesus, alle Dinge wisse, der könne seinem Verräter nicht vertrauen und schon gar nicht von ihm betrogen werden.
Weiter (T594) sieht Menken [123] wie auch die Herausgeber des griechischen Bibeltextes von Nestle/Aland in der handschriftlich weitaus besser bezeugten „Lesart met‘ emou {mit mir} eine sekundäre Angleichung des ursprünglichen mou {mein} an das ho esthiōn met‘ emou {der mit mir isst} von Mk 14,18“. Thyen dagegen erscheint es umgekehrt „sehr viel wahrscheinlicher, daß die Lesart ,mein Brot‘ eine sekundäre Anpassung an den Text der LXX ist“. Vielleicht ist diese Frage nicht zu entscheiden, zumal in Psalm 41,10 auch im hebräischen Text lachmi {mein Brot} steht.
In den Worten Jesu (T595) von Vers 19: „Ich sage euch das jetzt schon, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, hoti egō eimi {dass ICH BIN}“, werden Thyen zufolge
die beiden ,Deutungen‘ der Fußwaschung, die viele für miteinander inkompatibel erklären, hier noch einmal als voneinander unablösbare Momente fest miteinander verknüpft. Denn mit diesem Vers nimmt Jesus wieder auf, was er zuvor zu Petrus gesagt hatte, daß er nämlich sein Tun und Sagen erst meta tauta {danach} verstehen werde (V. 7). Daß ihnen in demjenigen, der ihnen soeben die Füße gewaschen hatte, kein geringerer nahe gekommen war als jener, der aus dem brennenden Dornbusch Mose gesagt hatte: ˀehjeh ˀascher ˀehjeh, ,Ich werde sein, wer immer ich sein werde‘, das werden sie erst „wenn es denn geschieht“ oder meta tauta erkennen und glauben …
Den „mit der Wendung amēn amēn legō hymin {Amen, Amen, ich sage euch}“ eingeleiteten Vers 20 sieht Thyen eng mit Vers 16 verknüpft (T595f.):
Mit den Worten, daß ein Apostel nicht größer sei als derjenige, der ihn gesandt hat, war – zumindest implizit – schon in V. 16f von einer Sendung anderer die Rede. Und da fast überall, wo dieses doppelte Amen erscheint, vertraute Tradition laut wird, dürfte das auch in V. 16f u. 20 der Fall sein. Weil sich das gewiß jedem Leser vertraute Lexem apostolos bei Johannes einzig in V. 16 findet, der ebenfalls durch das doppelte Amen ausgezeichnet ist, dürfte sich darin ein intertextuelles Spiel mit der matthäischen Aussendungsrede (vgl. Mt 10,24) verbergen. War in V. 16 noch allgemein von einem Apostel und demjenigen, der ihn gesandt hat, die Rede, so tritt jetzt Jesus als der Sendende noch deutlicher ins Blickfeld, wenn er mit dem beschwörenden doppelten Amen erklärt: „Wer einen aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat“ (vgl. Mt 10,40; Lk 10,16 sowie Mk 9,37 und Lk 9,48). Auch wenn in diesen synoptischen Texten das Thema der Einheit Jesu als des Sohnes mit seinem himmlischen Vater noch nicht derart reflektiert ist, wie bei Johannes, wo es in dem Satz gipfelt: „Ich und der Vater sind Eines“ (10,30), darf man in unserer Passage mit ihrem egō-eimi-{ICH-BIN-}Wort doch wohl einen authentischen Kommentar dieser Prätexte sehen.
Dass Johannes auf die Aussendung von Aposteln nur in diesen knappen Versen eingeht, hat nach Thyen damit zu tun, dass sie die Gabe des heiligen Geistes voraussetzt, mit dem Jesus seine Jünger erst nach seiner Auferstehung ausrüstet:
Johannes schweigt freilich über eine Jüngeraussendung zu Lebzeiten Jesu. Und auch wenn Jesus in seinem Gebet zum Vater erklärt: „Ich habe sie in die Welt gesandt“ (17,18), so spricht er da, ebenso wie zuvor schon in 16,33, doch bereits als der erhöhte Herr der Gezeiten. Denn die Aussendung der Jünger mit den Worten: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ erfolgt bei Johannes erst nachdem ihr auferstandener Herr sie mit dem heiligen Geist ausgerüstet und ihnen die Vollmacht verliehen hat, Sünden zu vergeben oder aber sie zu ,behalten‘ (20,19ff).
Kurz und bündig legt auch Ton Veerkamp <968> Johannes 13,18 von Psalm 41,10 her aus:
Nach dieser exemplarischen Tat Jesu kommt der dissonante Kontrapunkt: „Nicht über euch alle spreche ich.“ Der Text hält sich nicht lange bei psychologischen Erklärungsversuchen auf. Judas ist der Frevler der Psalmen, und er ist der, der Verbrechen am Volk begeht. Denn das „Ich“ der Psalmen steht immer auch für Israel.
Auch der Mann meines Friedens,
auf den ich mich verließ,
der mein Brot aß,
fällt hinterrücks über mich her.So heißt es im 41. Psalm (V.10). Johannes hat seine eigene griechische Version des Psalms. Statt „essen“ (ˀakhal, esthiein) hat er „kauen, nagen“ (trogein) wie in der Brotrede 6,54ff. Die Parallele ist gewollt: Judas war der, der das Fleisch des Messias kaute, das heißt, er war einer von denen, die trotz der skandalösen Redensarten des Messias in der Brotrede nicht weggegangen sind. Es heißt also nicht, dass er an einem christlichen Abendmahl teilgenommen hat und den Messias dann verriet; es heißt, dass er sich voll und ganz auf den Messias eingelassen hatte (sein Fleisch kauend, sein Blut trinkend). Der ist es, der den Messias den Römern und ihren Kollaborateuren ausliefert, Judas ben Simon Iskariot, der einmal das Fleisch des Messias kaute, sein Blut trank.
Anders als Wengst, der den Bezug auf die Schrift apologetisch deutet, also als Argument gegen den Vorwurf, als Messias hätte Jesus doch wissen müssen, wer ihn verraten würde, und auch anders als Thyen, demzufolge der johanneische Jesus so allwissend war, dass er keinesfalls vom Verrat des Judas hätte überrascht sein können, nimmt Veerkamp den Hintergrund des Psalms 41 ernst, der tatsächlich vom heimtückischen Verrat eines Freundes spricht, auf den sich David verlassen hat. Einer, der vertrauenswürdig schien, ist zum Frevler gegen Gott und das Volk Israel geworden.
Dem Psalm 41 entnimmt Veerkamp schließlich auch eine Idee, wie Johannes auf sein vielfach verwendetes doppeltes Amen im Munde Jesu gekommen sein könnte:
Der Psalm 41 endet mit einem zweifachen Amen: „Segne den NAMEN / den Gott Israels / von Weltzeit bis in Weltzeit / Amen und amen!“ Nachdem Jesus das ankündigt, was geschehen wird, bevor es geschieht, „damit ihr erkennt: ICH WERDE DASEIN“, greift er das zweifache Amen auf: „Amen, amen, sage ich euch.“ Auch hier wieder die Dialektik der Vertikalen und der Horizontalen: „Wer jemanden annimmt, den ich senden werde (einen messianisch inspirierten Menschen), nimmt mich, den Messias, an.“
↑ Johannes 13,21-26: Jesus ist erschüttert über den bevorstehenden Verrat und vertraut sich dem Schüler an, der an seinem Busen liegt
13,21 Als Jesus das gesagt hatte,
wurde er erregt im Geist
und bezeugte und sprach:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Einer unter euch wird mich verraten.
13,22 Da sahen sich die Jünger untereinander an,
und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete.
13,23 Es war aber einer unter seinen Jüngern,
der zu Tische lag an der Brust Jesu,
den hatte Jesus lieb.
13,24 Dem winkte Simon Petrus,
dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete.
13,25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu
und fragte ihn: Herr, wer ist‘s?
13,26 Jesus antwortete:
Der ist‘s, dem ich den Bissen eintauche und gebe.
Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein
und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot.
[16. Oktober 2022] Klaus Wengst zufolge (W402) nimmt Johannes „die Ansage des Verrats“ aus „den synoptischen Evangelien“ auf, aber – in „welcher Form auch immer“ ihm diese Tradition vorlag – „er hat sie eigenständig ausgestaltet“.
Mit den Worten (W403): „Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er im Innersten aufgewühlt“, hebt der Evangelist in Vers 21 zunächst Jesu „innere Erregung hervor“. Wie bereits in 11,33 und 12,27 sieht Wengst unter Berufung auf Blank <969>
„solche Erschütterung ,im Geist‘ bei Johannes immer [als] Anzeichen der Konfrontation Jesu mit den Unheilsmächten bzw. der Unheilsmacht schlechthin, dem Tod“. Wie in 12,27 ist er auch hier wieder mit dem eigenen Tod konfrontiert. Ihm geht er gleichwohl in Souveränität entgegen, indem er selbst das Geschehen vorantreibt, sozusagen die Fäden in der Hand hält. Das deutet Johannes gleich anschließend damit an, dass er die dann gegebene Ankündigung Jesu als ein Bezeugen charakterisiert. Ein Zeugnis bezieht sich auf einen geschehenen oder vorliegenden Tatbestand. Der Tatbestand, um den es hier geht, liegt in der erzählten Situation noch in der Zukunft. Dass die auf ihn bezogene Ankündigung Jesu dennoch als Zeugnis gilt, betont die Sicherheit ihres Eintreffens. Demgemäß agiert Jesus im Folgenden gleichsam als Regisseur in der Verwirklichung seiner eigenen Ankündigung.
Einerseits will der Evangelist damit „apologetisch … dem Vorwurf … begegnen, es könne nicht der Messias sein, wer seinen eigenen Verräter erwählt habe“, da „dieses finstere Geschehen doch auch zum Guten ausschlagen werde.“ Auf der anderen Seite bleibt für Jesus der „Verrat aus dem engsten Schülerkreis heraus … ein dunkles Geschehen, das ihn nicht unberührt und unverletzt lässt.“
Als Reaktion der Schüler erzählt Johannes nicht wie Matthäus und Markus von ihrer betroffenen Frage: „Bin ich‘s etwa?“, sondern es geht ihnen (Vers 22) „allein darum, ‚über wen er rede‘“, und diese „Frage, wer es sei“, wird vor ihrer Beantwortung „in einem Zwischenstück … noch zweimal gestellt“:
Dieses Zwischenstück führt [in Vers 23] eine Person ein, die bisher im Evangelium nicht aufgetreten ist: „Einer von seinen Schülern lag am Busen Jesu; den liebte Jesus.“ Der hier erwähnte Schüler erhält keinen Namen. Er bleibt auch an den weiteren Stellen namenlos, an denen er noch auftreten wird. Da Johannes eine Reihe von Schülern mit Namen benennt, sollte man es ernst nehmen, dass er diesen unbenannt lässt, und also nicht nach einem Namen suchen, sondern allein darauf achten, was er tatsächlich über ihn sagt.
Näher charakterisiert wird dieser Schüler dadurch (W404), dass er „am Busen Jesu“ liegt. Dazu erläutert Wengst (Anm. 32), dass sich bei
besonderen Mahlzeiten … auch im Land Israel die hellenistisch-römische Sitte verbreitet [hatte], zu Tisch zu liegen. … Man lag auf Polstern auf der linken Seite, gestützt auf den linken Arm, und konnte sich mit der rechten Hand bedienen. Die Polster, vor denen kleine Tische standen, bildeten ein Oval und waren in Zweier- oder Dreiergruppen angeordnet. In der Gruppe lagen die Polster, um sich besser bedienen zu können, etwas versetzt zueinander, so dass sich der Kopf des Vordermanns in Brusthöhe seines Hintermanns befand.
Bei Johannes deutet der Ausdruck (W404) „am Busen Jesu“ darauf hin, dass dieser Schüler „in derselben Relation zu Jesus“ wie „Jesus nach 1,18 zum Vater steht.“ Die „Beziehungsreihe von diesem Schüler zu Jesus und von Jesus zu Gott“ ist aber nach Wengst
dieselbe Reihe, die gerade erst in V. 20 angesprochen wurde – nur dass dort an der Stelle dieses einen Schülers stand, wen Jesus senden wird. An dieser Stelle sollen sich nach Ostern alle in der Gemeinde sehen. Denn Jesus wird die Geisteskraft, deren Zeugnis im Zeugnis seiner Schülerschaft erklingt (15,26f.), allen Schülern einhauchen (20,22). Von daher liegt es nahe, in diesem unbenannten Schüler den idealen Schüler zu erkennen, der zu Jesus in einem vertrauten und verstehenden Verhältnis steht. Mit ihm kann und soll sich jede und jeder in der Gemeinde identifizieren. Deshalb bleibt er namenlos und hält damit sozusagen den Platz frei für den je eigenen Namen.
Dass dieser Schüler im Evangelium erst so spät auftritt, erklärt Wengst damit, dass die „Stunde“ seines Auftretens „als Stunde der Verherrlichung Jesu auch die Verbindung herstellt zwischen der Zeit Jesu und der Zeit der Gemeinde, die ‚nach all dem‘ (13,7) lebt.“ Dazu beruft sich Wengst (Anm. 33) außerdem auf Ulrich Wilckens: <970>
„Er ist zwar ,einer von seinen Jüngern‘ (V. 23) […]. Aber durch sein Vertrautsein mit Jesus unterscheidet er sich zugleich von ihnen allen – so, wie diese sich nach Ostern in ihrer Vertrautheit mit ihrem verherrlichten Herrn aufgrund des Geistes von ihrer noch mangelnden Erkenntnis in der Zeit vor Ostern unterscheiden. […] (Er) ist also eine Symbolfigur in diesem Sinn: als Repräsentant der nachösterlichen Jüngerschaft im Kreise der Zwölf vor Ostern.“
An dieser Einschätzung stört mich die mangelnde Demut eines christlichen Glaubens, der sein besseres nachösterliches Wissen über Jesus allzu selbstgerecht zur Schau trägt und die Frage vermeidet, ob nicht gerade Christen den jüdischen Messias Jesus mit seinem Anliegen der Befreiung ganz Israels aus der Versklavung unter die herrschende Weltordnung vollkommen missverstanden haben könnten.
Dass „die weitere Charakterisierung“ dieses Schülers mit den Worten: „den liebte Jesus“, ihn als beispielhaften Schüler Jesu benennt, betont Wengst zu Recht, denn diese „Auszeichnung … gilt allen Schülern Jesu, wie Johannes in V. 1 außerordentlich stark hervorgehoben hat.“ Damit wendet er sich (Anm. 34) gegen Johannes Schneider, <971> der „ihn als ‚den Jünger, den Jesus (besonders) liebhat‘, bezeichnet“, was „schlicht eine Eintragung“ ist. „Überhaupt“ hält es Wengst für „irreführend und falsch, von ihm – wie im deutschen Sprachraum üblich – als ‚Lieblingsjünger‘ zu sprechen.“
In Vers 24 wird dieser Schüler durch den Evangelisten „in eigenartiger Weise“ dem Schüler Simon Petrus zugeordnet:
In 6,68f. repräsentierte Simon Petrus als Sprecher des Bekenntnisses die bei Jesus ausharrenden Zwölf. Bei der gerade erzählten Fußwaschung erwies er sich als unverständig. Jetzt fragt er Jesus nicht direkt, sondern bedeutet dem Schüler an Jesu Brust, „sich zu erkundigen, wer es sei, von dem er spreche“. Dass sich Simon Petrus hier auf solche Vermittlung angewiesen zeigt, stützt das eben gegebene Verständnis des Schülers an Jesu Brust als des idealen, des Jesus verstehenden Schülers. Die Abschiedsreden werden deutlich machen, dass es die allen verheißene Geisteskraft ist, die die Verbindung mit Jesus herstellt. Insofern kommt in dieser Zuordnung des in der Tradition hervorgehobenen Simon Petrus zu diesem Schüler auch eine antihierarchische Intention zum Zuge.
In der Tat könnte man, wie Wengst (Anm. 35) es etwas „etwas zugespitzt“ formuliert, „in dieser Darstellung die Ironie erkennen, dass der ‚Apostelfürst‘ den namenlosen ‚Jedermann‘ fragen muss.“
Dieser Schüler ist es nun (W405), der nach Vers 25 „nicht noch unausgesprochene Frage“ nun ausspricht: „Herr, wer ist‘s?“ Er tut es, indem er „sich, ‚wie er war‘, nämlich auf dem Polster vor dem Polster Jesu liegend, zu Jesus“ zurückwendet, wodurch nach Wengst (Anm. 36) „Nähe und Vertrautheit zum Ausdruck“ kommen und nicht angedeutet sein soll, „Jesus und der Schüler hätten leise miteinander gesprochen“. Vielmehr „setzt die Erzählung voraus, dass Jesus jetzt allen antwortet.“ Das tut er in Vers 26 mit den Worten:
„Der ist‘s, dem ich den Brocken eintauchen und geben werde.“ An dieser Stelle unterscheidet sich Johannes wieder charakteristisch von der synoptischen Fassung der Erzählung. Dort bleibt die Situation unbestimmt, insofern Jesus nur sagt, dass einer der Tischgenossen ihn ausliefern wird. Bei Johannes dagegen kündigt Jesus an, dass er den, nach dem gefragt wurde, selbst durch eine Geste beim Mahl kenntlich machen wird. Er führt auch sofort aus, was er gesagt hat: „Da tauchte er den Brocken ein, nahm ihn und gab ihn dem Judas, Sohn des Simon Iskariot.“ Damit macht Johannes deutlich, dass Jesus sozusagen Herr des Geschehens ist, dessen Opfer er sein wird.
Zwar weiß Wengst, dass die „leise Unterhaltung“ von vielen Exegeten „im Interesse eines vorstellungsmäßigen Ausgleichs mit V. 28f.“ vorausgesetzt wird, denn in diesen Versen zeigt sich, dass die anderen Schüler offenbar nicht wahrgenommen haben oder wahrhaben wollen, was Jesus über Judas gesagt hat. Aber Wengst meint, dass „der Evangelist … im Verfolg seiner Intention der Vorstellungskraft viel zumuten“ kann.
Hartwig Thyen (T597) beschränkt sich zu den Versen 21-22 auf wenige Bemerkungen. So erinnert er zu „Jesu ,Betrübtsein im Geist‘“ an das intertextuelle „Spiel mit dem Doppelpsalm 42/43“, und zur Ratlosigkeit der Jünger über seine Worte: „Einer von euch (nämlich von den hier Anwesenden) wird mich ausliefern“, betont er lediglich, dass „die Zuhörer/Leser, denen der Erzähler ja schon in Joh 6,71 und nun wieder in 13,2 verraten hatte, daß Judas derjenige sei, der Jesus ausliefern sollte, den immer noch ratlosen Jüngern gegenüber durch ihr Wissen überlegen“ bleiben.
Andere Gedanken als Wengst macht sich Thyen zu dem „Jünger, den Jesus liebte“, der mit diesem „sonderbaren Pseudonym“ in Vers 23 zum ersten Mal ausgezeichnet wird, obwohl dieser „- wie sich noch zeigen wird – von Anfang an unter ihnen war“:
Der Leser kennt ihn schon lange. Doch er weiß es noch nicht. Denn er soll erst ganz am Ende (21,24) erfahren, daß dieser geliebte Jünger der allwissende Erzähler der Geschichte Jesu ist, der ihn schon mit den ersten Sätzen des Prologs an die Hand genommen und ihn Schritt um Schritt geführt und eingewiesen hat in das Geheimnis des Heils, das mit Jesus in die Welt gekommen ist und sie von Grund auf verändert hat. Mit den Worten: „Bei Tisch lag einer seiner Jünger an der Brust Jesu, derjenige nämlich ,den Jesus liebte‘ (hon ēgapa ho Iēsous)“, wird der Leser hier nun zum ersten Mal auf die permanente Gegenwart dieses Jüngers aufmerksam gemacht.
Eindeutig muss dieser Jünger zu den Zwölf gehören, da nur sie „mit Petrus als ihrem Sprecher Jesus treu geblieben sind“, was aus 6,66ff. hervorgeht, und „beim letzten Mahl nur die Zwölf Jesu Tischgenossen waren“, was dem Leser „aus den synoptischen Prätexten geläufig“ ist. Die „intime Nähe eines der Zwölf zu Jesus beim letzten Mahl“ ist nach Thyen wie nach Wengst zwar aus den hellenistisch-römischen Tischsitten zu erklären, aber auch ihm zufolge erschließt sich „ein tieferer symbolischer Sinn“ auf Grund von Johannes 1,18 (T598), wo Jesus „als der Exeget des Vaters in das Evangelium eingeführt“ wurde, der am Busen des Vaters lag. Entsprechend
erscheint hier nun der geliebte Jünger als der Exeget Jesu. Seine Rolle als der implizite Erzähler der Geschichte Jesu setzt voraus, daß er von Anfang an (15,27) bis zum Ende unter dem Kreuz (19,25-27) und am leeren Grab Jesu (20,3ff) der authentische Zeuge all dessen gewesen ist, was Jesus getan und gesagt hat. Da dieser Erzähler aber ein Geschöpf des Autors und damit eine fiktionale Figur der Textwelt unseres Evangeliums ist, wobei wir auch dessen Evangelisten nur als seinen impliziten Autor kennen, weil der sich rückhaltlos in sein Werk und dessen Erzähler entäußert hat, kann ,authentischer Zeuge‘ natürlich nicht heißen, daß diese vom Evangelisten als der verläßliche Zeuge geschaffene literarische Figur ein historischer Augenzeuge gewesen wäre …
Zu Vers 24 begründet Thyen zunächst, warum er „das einzige Vorkommen eines Optativs bei Johannes“ in den Worten pythesthai tis an eiē peri hou legei {er möge doch herausfinden, wer das sei, von dem er rede} für die ursprüngliche Lesart der handschriftlichen Texte hält und nicht die abweichende Lesart kai legei autō: eipe tis estin {und er sagte ihm: sage, wer es ist}. Erstens bringt sie besser „das Geheimnistuerische des Vorgangs zum Ausdruck“ und zweitens findet
sich ebendieser Optativ eiē schon im Prätext Lk 22,23 …, mit dem Johannes hier ganz offenkundig spielt. Denn der Sache nach eröffnet Lukas die Mahlszene und das sich daran anschließende Symposion ganz ähnlich wie Johannes. Heißt es bei Lukas: kai hote egeneto hē hōra, anepesen ktl. {Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder usw.} (22,14), so lesen wir bei Johannes in dessen typischer Diktion: eidōs ho Iēsous hoti ēlthen autou hē hōra ktl. {wusste Jesus, dass seine Stunde nun gekommen war usw.} (13,1). Die Ankündigung der Verleugnung Jesu durch Petrus, die Markus und Matthäus auf dem Weg zum Ölberg und nach Gethsemane situieren (Mk 14,26ff; Mt. 26,30ff), hat Lukas ebenso wie Johannes, der ihm darin wohl folgt, seiner Abschiedsrede integriert (Lk 22,31ff).
Auch dass der geliebte Jünger außer unter dem Kreuz Jesu „hier und in allen folgenden Szenen“ mit Petrus an der Seite erscheint, kann nach einer Vermutung von Sabbe <972> auf eine Inspiration durch Lukas zurückgehen, da nur „bei Lukas – anstelle der beiden anonymen Jünger von Mk 14,13 – Petrus und Johannes als ein Paar auftreten (Lk 22,8)“.
Da erst ganz am Ende des Johannesevangeliums enthüllt werden wird (T599), dass der geliebte Jünger „der implizite Erzähler unseres Evangeliums ist“, muss man Thyen zufolge
von diesem Ende her den Blick nochmals auf den Anfang richten, nämlich auf den Umstand, daß dort einer der beiden ersten Jünger Jesu – ganz offenbar absichtsvoll – anonym geblieben war (s. o. zu 1,35ff). Da wurde erzählt, daß Johannes (der Täufer) diese beiden, die bis dahin seine Jünger gewesen waren, mit den Worten: „Siehe das Lamm Gottes“, in die Nachfolge Jesu eingewiesen und damit angefangen hatte, sein Wort einzulösen: „Er muß wachsen, ich aber abnehmen“ (3,30). Und wenn es da weiter hieß, der Eine der beiden, die auf des Johannes Botschaft hin Jesus ,nachgefolgt‘ und bei ihm ,geblieben‘ waren, sei Andreas, der Bruder des Simon Petrus, gewesen, der danach sogleich seinen Bruder Simon aufgesucht und ihn mit den Worten: „Wir haben den Messias gefunden!“ zu Jesus geführt hatte, zugleich aber über den Anderen dieser ,Wir‘ kein einziges Wort verlautet, dann ist hier offenbar absichtsvoll eine ,Leerstelle‘ gelassen, die den Leser auffordert, sie zu füllen. Er weiß aus den synoptischen Prätexten, daß da am Anfang neben dem Brüderpaar Andreas und Petrus noch ein zweites Paar von Brüdern war, das zu Nachfolgern Jesu wurde, nämlich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus (Mk 1,16-20 parr.). Und auch, wenn er das, wiederum absichtsvoll, erst Joh 21,2 ausspricht, weiß das natürlich auch der Erzähler. Darf der Leser diese Lücke also dadurch füllen, daß er sich denkt, der Andere müsse dann wohl Johannes gewesen sein, der danach ebenfalls seinen eigenen Bruder, nämlich Jakobus, aufgesucht und ihn zu Jesus geführt habe? So haben jedenfalls die Väter unser Evangelium gelesen.
Im Gegensatz zum „Urteil der Väter“ erscheint es Thyen jedoch (T599f.) als
unmöglich …, den historischen Zebedaiden und Apostel Johannes mit dem tatsächlichen Verfasser unseres Evangeliums zu identifizieren, denn ebenso wie sein Bruder Jakobus (vgl. Act 12,2), wenn auch nach Ausweis von Gal 2,9 nicht zur gleichen Zeit, dürfte der bereits als Märtyrer gestorben sein, noch ehe Markus sein Evangelium schrieb (Mk 10,35ff).
Dennoch ist nach Thyen (T600) „der Zebedaide Johannes – neben Petrus und Jakobus nach Mk 9,1ff parr. und 14,32 parr. einer der drei vertrautesten Jünger Jesu – wohl tatsächlich das Modell …, nach dem der Evangelist seinen fiktionalen Erzähler geschaffen und damit dem Märtyrer Johannes zugleich ein literarisches Denkmal gesetzt hat.“
Anders als Wengst geht Thyen davon aus, dass das in den Versen 25-26 von Johannes Erzählte nicht von allen Jüngern gehört worden sein kann. In Vers 25 wird durch das noch nähere Zurückneigen des geliebten Jüngers an die Brust Jesu (hier mit dem Synonym stēthos an Stelle von kolpos ausgedrückt) „das Geheimnisvolle des Vorgangs und die Intimität zwischen Jesus und seinem geliebten Jünger“ unterstrichen. Weiter muss der Letztere das ihm in Vers 26 „vertraulich Gesagte – ‚Es ist der, dem ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde‘ – für sich behalten haben“, und „die Pointe [kann] hier nicht die ,Entlarvung des Verräters‘ sein …, wie in den Prätexten Mk 14,17ff; Mt 26,20ff; Lk 22,21“, vielmehr liegt sie „in der Gabe des eingetunkten Bissens an Judas“. Das heißt, es ist „das zentrale Anliegen des Erzählers …, daß auch Judas am letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern Teil hatte.“
Gegenüber Spekulationen (T601) über den geliebten Schüler „als das allseits bekannte und beliebte ‚Schulhaupt‘ eines ,johanneischen Christentums‘“ oder Versuchen, diesen gegen die Autorität des Petrus auszuspielen, betont Thyen, dass es „in der Gemeinde derer, die einander lieben, wie Jesus sie geliebt hat“, darum geht, „den Anderen in seinem Anderssein zu respektieren: Petrus als den guten Hirten der Schafe Jesu und den geliebten Jünger als den Evangelisten und Erzähler der Geschichte Jesu und seiner Jünger.“
Und das muß dann wohl auch für Judas gelten, der dazu erwählt ist, Jesus auszuliefern. Wohl erklärt Jesus seinen Jüngern schon früh: ,Einer von euch ist ein Teufel‘ (6,70), was der Erzähler sogleich so kommentiert: ,Er sprach aber über Judas, Simons, des Iskarioten, Sohn …‘. Und wohl regt sich Judas scheinheilig auf, über Marias Verschwendung des kostbaren Nardenöls, dessen Erlös man besser den Armen gegeben hätte (12,4f), wozu der Erzähler wiederum bemerkt: ,Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen gelegen gewesen wäre, sondern weil er ein Dieb war, der Gelder aus der Reisekasse unterschlug, die er verwaltete‘ (12,6). Und wohl erfuhr der Leser in 13,2, daß der Teufel Judas bereits eingeflüstert habe, Jesus auszuliefern, und sogleich wird er erfahren, daß mit der Annahme des Bissens der Satan selbst in Judas einfuhr (V. 27; vgl. Lk 22,31). Dieses wenig schmeichelhafte Judasporträt hat in der alten Kirche, die schon früh alle notorischen Sünder strikt ausschloß von der Feier der heiligen Eucharistie, alsbald zum Streit darüber geführt, ob Jesus Judas mit dem eingetauchten Bissen des Brotes etwa an der eucharistischen Speise Anteil gegeben habe oder nicht…
Thyen meint „diese Frage nicht mit psychologischen Argumenten, sondern auf der Ebene der Lektüre des Textes“ entscheiden zu können, indem er sich auf Moloney <973> meint beruft. Bereits in der Ersetzung der Wendung ho esthiōn artous {der mein Brot aß} aus Psalm 41,10 durch ho trōgōn mou ton arton {der mein Brot kaute} zeigt sich in Vers 18 „eine absichtsvolle Verknüpfung mit 6,54ff“. Und indem er sich „auf das Brotwunder und dessen eucharistische Anklänge in allen vier Evangelien (Mk 6,41; 8,6; Mt 14,19; 15,36; Lk 9,16 und Joh 6,11) sowie auf die synoptischen und paulinischen Institutionsberichte des Herrenmahls (Mk 14,22; Mt 26,26; Lk 22,19; 1Kor 11,23)“ beruft, spricht sich Moloney außerdem dafür aus, dass die Wendung kai lambanei {und er nahm [den Bissen]} in V. 26“ ursprünglich ist.
Zu ihrer Auslassung in einer großen Zahl der Handschriften erklärt er einleuchtend: „Abschreiber konnten den Gedanken nicht ertragen, dass die Austeilung des Brotes durch Jesus an Judas eucharistische Züge haben könnte, und haben daher Worte gestrichen, die diese Assoziation klar zum Ausdruck brachten“. Sein Fazit lautet darum: „Wir können nun geltend machen, dass es genügend Hinweise im Text selbst gibt, um zu belegen, dass ein Unterthema des Mahls, die Gabe des Bissens und des neuen Gebots in V. 21-38, sich auf das Abendmahl bezieht, so wie ein Unterthema der Fußwaschung und der Gabe des Vorbilds in V. 1-17 auf die Taufe bezogen war. Der gesamte Abschnitt 13,1-38 verdeutlicht, dass Jesus die Qualität seiner Liebe – einer Liebe, die Gott bekannt macht – dadurch zeigt, dass er seine Jünger zu allen Zeiten erwählt, formt, aussendet und ernährt und sie in den Rhythmus seines eigenen, sich selbst hingebenden Lebens und Sterbens einbezieht. Im Rahmen eines Mahls, das als eucharistisch zu bezeichnen ist, gibt Jesu den Bissen der am meisten verachteten ‚Persönlichkeit‘ der Erzählung des Evangeliums: Judas!“
Damit erweist nach Moloney „gerade Jesu niemals ausbleibende Liebe zu derartigen Jüngern, die sogar den Archetyp des bösen Jüngers einschloß, … ihn als denjenigen, in dem sich Gottes Liebe zum kosmos vollende (3,16f).“
Zwar halte ich die Tatsache, dass nach Johannes das einzige beim letzten Mahl Jesu ausgeteilte Brot ausgerechnet Judas zugedacht war, für solche Gedanken anschlussfähig, zumal ich während meines Theologiestudiums gerade durch die Lektüre des Kapitels über die Rechtfertigung des Judas in Gollwitzers Buch „Krummes Holz – aufrechter Gang“ <974> entscheidende Anstöße für meine Bekehrung von einer Werkgerechtigkeit des Glaubens zu einem Vertrauen auf Gottes bedingungslose Liebe bekam. Ob eine solche Auslegung der ursprünglichen Absicht des Evangelisten gerecht wird, muss trotzdem offen bleiben, denn diese Bedingungslosigkeit darf nicht folgenlos bleiben, sondern ermöglicht verantwortliches Handeln im Sinne der Liebe Gottes und fordert es heraus. Daher kann Johannes auch eine rituelle Abendmahlspraxis kritisch hinterfragt haben, an der man sich beteiligt, ohne wirklich solidarisch mit Jesus zu sein und ihm nachzufolgen, sondern ihn stattdessen an seine Feinde auszuliefern.
Ton Veerkamp <975> betrachtet die johanneische Erzählung über Jesus, Judas und zwei weitere seiner Schüler als Ausdruck der Erschütterung des Messias über eine Korruption innerhalb seines Volkes, die sogar solidarische Verbundenheit untergräbt und über Leichen geht:
Johannes führt dann den Bruch in der Erzählung über Fußwaschung und Solidarität in einer gespenstischen Szene zu einem Höhepunkt bzw. in einen absoluten Tiefpunkt. Diese Brucherzählung führt von der Erschütterung Jesu etarachthē tō pneumati) in V.21 zum „es war aber Nacht“ in V.30b. Es beginnt mit dem zweifachen Amen von Psalm 41, diesmal ins Finstere gewendet: „Amen, amen sage ich euch: einer von euch wird mich ausliefern.“ Die vier handelnden Personen sind Jesus, Simon Petrus, der Lehrling, „dem Jesus solidarisch verbunden war“, und Judas ben Simon Iskariot. Die Erschütterung Jesu ist die gleiche wie die angesichts des Todes von Lazarus. Den Psalm der Erschütterung (42) betet er in 12,27: „Jetzt ist meine Seele erschüttert.“ Der Messias ist ganz und gar und zutiefst (tō pneumati) erschüttert angesichts der Korruption, der inneren Verwesung, die in diesem Volk herrschte. Lazarus war das verwesende Israel, Judas ben Simon Iskariot der von der Korruption angefressene Sohn seines Volkes.
Was den „sogenannten geliebten Schüler“ betrifft, ist Veerkamp mit Wengst einig, über seine Identität nicht unnötig zu grübeln, sondern ihn als den „exemplarische[n] Schüler“ zu sehen, allerdings nicht im Sinne der Verkörperung eines nachösterlichen Christentums, sondern eines neuen, durch den Messias belebten Volkes Israel:
Den Spekulationen über den Schüler, mit dem Jesus befreundet war, wollen wir nicht eine eigene hinzufügen. Der Text überliefert ihn anonym, und das sollten wir respektieren. Jedenfalls beginnt hier das merkwürdige Bündnis zwischen Simon Petrus und dem sogenannten geliebten Schüler. Der Schüler, dem Jesus solidarisch (ēgapa) oder in Freundschaft (ephilei) verbunden war, ist nicht unbedingt identisch mit Lazarus, dem Jesus ebenfalls in Freundschaft verbunden war (hon phileis, 11,3). Er ist der Schüler, der mit Jesus den ganzen Weg ging, vom Garten zum Gerichtshof des Großpriesters, vom Gerichtshof zum Kreuz, vom Kreuz zum geöffneten Grab, von diesem Grab zum Fischerboot, von wo er als einziger den Fremden als „den Herrn“ erkannte. Er ist der exemplarische Schüler, der immer bleiben wird, bis der Messias kommt, 21,22. Er ist die strukturale Transformation des Lazarus. Dieser war die exemplarische Konzentration des toten und zu belebenden Israels, der Schüler ist im Johannesevangelium die exemplarische Konzentration des lebenden Israels, der jüdischen – nicht christlichen! – messianischen Gemeinde.
Zur Frage, ob die Worte Jesu über den Verräter von allen Schülern vernehmbar waren, äußert sich Veerkamp ähnlich wie Thyen; er fügt allerdings eine Überlegung an, die den Verrat des Judas nicht nur mit Psalm 41,10, sondern auch mit Ruth 2,14 in Verbindung bringt:
Auf der Stufe der Erzählung bleibt der Verräter unbekannt; Jesus weiß es, vielleicht weiß es jener anonyme Schüler, alle anderen wissen es erst, wenn sie ihn im Garten jenseits des Baches Kidron wiedersehen werden. Jesus deutet es an, aber so, dass niemand erkennt, wer gemeint ist. Jesus gibt den eingetauchten Bissen dem Judas, und die Schüler nehmen an, er ziele auf die Erzählung über Ruth und nicht auf Psalm 41. Hier werden die Schriftstellen Psalm 41,10 und Ruth 2,14 erfüllt. Die zweite Stelle wird in ihr Gegenteil verkehrt, damit sie auf die erste hinweisen kann.
↑ Johannes 13,27-30: Judas zugleich als Hausgenosse und Verräter des Messias an den Widersacher
13,27 Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn.
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald!
13,28 Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte.
13,29 Denn einige meinten,
weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm:
Kaufe, was wir zum Fest nötig haben!,
oder dass er den Armen etwas geben sollte.
13,30 Als er nun den Bissen genommen hatte,
ging er alsbald hinaus.
Und es war Nacht.
[20. Oktober 2022] Nach Klaus Wengst (W405) „tritt noch stärker hervor“, dass Jesus im Johannesevangelium kein bloßes Opfer des Verrats durch Judas sein wird, indem er „geradezu als Regisseur der eigenen Auslieferung dargestellt“ wird (Vers 27):
„Und nach dem Brocken ging dann der Satan in ihn ein.“ Der von Jesus dem Judas gegebene Brocken wird zur Anweisung für den Satan, in diesen einzugehen. Genauso wirkt er, wenn er Judas dazu anhält, seinen Part im Drama nun zu übernehmen: „Was du tun willst, tu alsbald!“ Jesus weiß nicht nur im Voraus, was geschieht und nach der Schrift geschehen soll, sondern er ist auch der eigentlich Handelnde in diesem Geschehen, der es nicht ahnungslos erleidet, sondern es selbst bewirkt und vollzieht. Dass nach dem ersten Versteil der Satan in Judas eingeht und nach dem zweiten Judas zum Handeln aufgefordert wird, ist nicht gegeneinander auszuspielen, sondern gehört spannungsvoll zusammen.
Was in diesem Zusammenhang mit dem Hineingehen des Satans in Judas gemeint ist, deutet Wengst mit einem Zitat von Schnelle <976> an, demzufolge das von Judas „geplante Böse … ‚in der Gestalt des Satans als eine überindividuelle, widergöttliche Macht‘“ erscheint. Wengst hält sein Tun für „rätselhaft“, es
lässt sich nicht aus vordergründigen Motiven erklären… Aber das entnimmt ihn nicht aus seiner Verantwortung. In beiden ins Auge gefassten Aspekten der Auslieferung Jesu gilt jedoch Jesus selbst als der eigentlich Handelnde. Das ist wiederum nicht nur apologetisch zu verstehen, sondern es soll in erster Linie deutlich machen, dass in diesem Geschehen trotz allem dennoch Gottes Heilswille zum Zuge kommt.
Die Aufforderung Jesu (W406), Judas möge schnell „tun, was er zu tun im Begriff steht“, wird von den anderen Schülern nicht verstanden (Vers 28), vielmehr stellen sie „irrige Vermutungen an“ (Vers 29):
Wenn Johannes so seltsam darstellt, ist anzunehmen, dass er das mit Absicht tut. Mit dieser Darstellung macht er einmal mehr anschaulich, was er in 12,16 gesagt und in 13,6-10 an Simon Petrus gezeigt hat: Es gibt kein wirkliches Verstehen Jesu und seines Weges vor „all dem“. Auch das Geschehen, dass Jesus aus dem engsten Schülerkreis heraus ausgeliefert wurde, erschließt sich erst aus der österlichen Perspektive.
Judas aber reagiert unmittelbar auf Jesu Aufforderung (Vers 30):
„Nachdem der nun den Brocken genommen hatte, ging er sogleich hinaus.“ Wozu Jesus Judas angehalten hat, führt dieser sofort aus; er geht. Diese Feststellung, dass Judas weggeht, findet sich nicht in den entsprechenden Berichten der synoptischen Evangelien. Zwar wird sein Weggehen auch dort vorausgesetzt, aber nicht ausdrücklich erwähnt. Johannes vermerkt es, weil nach seiner Darstellung Jesus Judas aufgefordert hat, „alsbald“ zu tun, was er tun will; und so geht er „sogleich“. Johannes fügt hinzu: „Es war aber Nacht.“ Das ist zunächst eine chronologische Angabe. Sie hat aber zugleich symbolischen Charakter. Was Judas tut, ist eine finstere Tat; sie bleibt dunkel und rätselhaft.
Hartwig Thyen (T602) geht zu Vers 27 darauf ein, dass der „Prätext“ Lukas 22,3 „bereits vor der Feier des Passamahles und seiner Vorbereitung durch Petrus und Johannes“ vom Eingehen des Satans in Judas spricht, und betont wie Wengst, dass bei Johannes Jesus dennoch „der Herr des Geschehens“ bleibt, indem er Judas „in die Rolle einweist, zu der er erwählt ist und die er bei der Verherrlichung des Sohnes des Menschen zu spielen hat“.
Zur Aussage des Erzählers in Vers 28, dass „keiner von denen, die da zu Tisch lagen …, begriffen habe, zu welchem Zweck Jesus ihm das gesagt habe, vertritt Thyen die Auffassung, dass „der geliebte Jünger“ davon ausgenommen sein muss, und zwar nicht nur, weil man am Ende erfährt, dass dieser (T602f.)
von Anfang an immer schon der Erzähler war, der Teil hatte an dem Allwissen seines Herrn und seine Zuhörer durch dessen Geschichte geleitet hat, sondern schon aus dem unmittelbaren Kontext unseres Kapitels ist deutlich, daß von dem Mißverstehen der anderen nur einer erzählen kann, der weiß, was hier geschieht, weil sein Herr es ihm anvertraut hat (V. 26…). Er weiß sogar [Vers 29], was die anderen nur dachten, einige nämlich, daß Jesus Judas beauftragt habe, das Notwendige für das Passafest einzukaufen, und andere, daß er Almosen an die Armen verteilen solle, wie es Brauch war am Passafest.
Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Judas aus der Geschichte in Vers 30 (T603), „bis der Leser ihm am Ort der Verhaftung Jesu in 18,2 erneut begegnen wird“, geht Thyen folgendermaßen auf die daran angefügte Zeitangabe ein:
Kaum hat er den Bissen genommen, da ging er hinaus. Es war aber Nacht. Die Sonne ist untergegangen und damit ist der Tag der paraskeuē {Rüsttag} des Passa angebrochen: Der Tag an dem gleichzeitig mit dem Schlachten der Lämmer im Tempelbezirk Jesus als das ,Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt‘, durch die Kreuzigung getötet wird … Zugleich dürfte die Zeitangabe ,Es war aber Nacht‘, symbolische Obertöne haben. Wie am Anfang Nikodemus, der Lehrer Israels, aus der Nacht zu dem gekommen war, der das Licht der Welt ist (3,1ff), so geht Judas jetzt von ihm weg in die Nacht.
In den folgenden Versen 31-38 sieht Thyen nicht den Auftakt der Abschiedsreden Jesu, sondern mit Moloney (siehe Anm. 973)
den organischen und notwendigen Abschluß des 13. Kapitels, mit seinen beiden Szenen der Fußwaschung und der Gabe des eingetunkten Bissens an Judas. Denn zu den unverständigen Jüngern und Judas, der Jesus ausliefern sollte, gehört natürlich auch Petrus, der ihn dreimal verleugnen wird. Vor allem aber gehört neben der Gabe des hypodeigma {Vorbilds} (V. 15) die Gabe des ,neuen Gebots‘ (V. 34f) dazu. Mit dieser Gliederung widersprechen wir den meisten Auslegern, die in 13,31-38 die Eröffnung der sogenannten ,ersten Abschiedsrede‘ (Joh 13,31-14,31) sehen…
Ton Veerkamp <977> versteht die Bemerkung, dass im Augenblick von Jesu Gabe des Bissens an Judas
der Widersacher „einging“, [als] eine wahrhaft „satanische“ Verkehrung der Geste Jesu, die Judas ben Simon als Hausgenossen auszeichnet.
Damit nimmt Veerkamp Bezug auf die Art und Weise, in der die jüdische Bibel und die Synoptiker die Schlange oder den Satan als Widersacher des Gottes Israels darstellen, die Menschen durch listige Umdeutung von Worten Gottes zum Misstrauen gegen Gottes Güte zu verführen suchen. Hier ist es die von Veerkamp bereits erwähnte „Schriftstelle Ruth 2,14“, die Judas, indem er sich vom Widersacher des Gottes Israels beeinflussen und vereinnahmen lässt, in ihr Gegenteil verkehrt:
Ruth ist als Flüchtling aus Moab zum Hofbesitzer Boas aus Bethlehem gekommen und bat um Erlaubnis, nach der Ernte Gerste sammeln zu dürfen. Boas sagte zu Ruth zur Essenszeit:
„Tritt näher, du kannst vom Brot essen,
tauche deinen Bissen in die Sauertunke.“
Sie setzte sich neben die Schnitter,
er aber reichte ihr geröstetes Korn.
Sie aß, wurde satt, ließ noch übrig.Damit wurde Ruth von Boas als Hausgenossin angenommen. Indem Judas den eingetauchten Bissen annimmt, nimmt er die Anerkennung als Hausgenosse des Messias an und täuscht die Anwesenden. Er verbirgt vor den Anwesenden durch die Annahme der Anerkennung als Hausgenosse, dass er Jesus ausliefern wird. Er nimmt die Rolle an, die Rom – der Satan – ihm zuweist.
In den Versen 27b bis 30a bleibt nach Veerkamp für die Schüler offen, wer der Verräter sein wird. Besonderes Augenmerk richtet er auf das Wort euthys, „sofort“, das bei Johannes nicht zum letzten Mal vorkommen wird und von besonderer Bedeutung ist:
Jesus will, dass dieses Theater schnell ein Ende nimmt: „Was du zu tun hast“ – nämlich den Auftrag des Widersachers, Roms, ausführen – „das tue schnell.“ Johannes hält die Spannung aufrecht, indem er die Schüler rätseln lässt; von dem, was sich wirklich abspielt, ahnen sie nichts. „Sofort (euthys) ging er hinaus.“ Es ist das erste Mal, dass wir das Wort euthys bei Johannes hören. Noch zweimal werden wir dieses Wörtchen hören. Judas weiß, daß zugleich mit Jesu Stunde auch Judas‘ Stunde geschlagen hat: Er konnte nicht länger im „Hause des Herrn“ bleiben.
↑ Es war aber Nacht: Die Abschiedsgespräche des Messias (Johannes 13,30b-17a)
[21. Oktober 2022] Die Zeitangabe „Es war aber Nacht“ in Johannes 13,30b, die sofort nach dem Weggang des Judas hereinbricht, ist nach Ton Veerkamp <978> nicht einfach eine beiläufige Bemerkung, sondern sie markiert einen bedeutsamen Einschnitt im dritten Hauptteil des Evangeliums und ist die Überschrift für die gesamten Abschiedsreden Jesu, sein anschließendes Gebet und seine Verhaftung, bis er frühmorgens (18,28) zum Vertreter der römischen Weltordnung, Pilatus, gebracht wird:
Jetzt beginnt die Nacht des Messias. Die Lektüre unseres Textes bis zu diesem Punkt hat gezeigt, was Nacht bedeutete; es ist die Zeit ohne Messias, in der man den Gang nicht gehen kann, sondern „straucheln“ muss (11,10), in der „niemand wirken kann“, 9,5. Die Nacht Roms ohne den Messias ist das Ende aller Hoffnungen und aller Pläne. Aber diese Nacht ist die Nacht des Messias.
Johannes versucht, der Gruppe klarzumachen, dass auch die messianische Gemeinde in der Nacht lebt. Sie muss lernen zu entscheiden, ob ihre Nacht die Nacht des Messias ist – eine Nacht, in der ihr das messianische Licht scheint – oder ob ihre Nacht die Nacht Roms ist – dann kann sie wirklich nichts mehr machen. Wie lebt man ohne Messias in der messianischen Nacht? Auf diese Frage sucht Johannes in den sogenannten Abschiedsreden eine Antwort.
Weitere Angaben zur Gliederung des johanneischen Kapitels „Es war aber Nacht“ bei Veerkamp und zu den davon abweichenden Gliederungsvorstellungen der Autoren Wengst und Thyen finden sich in der Einleitung meines vorigen Abschnitts Vor dem Pascha: Jesu Fußwaschung und der Verrat des Judas (Johannes 13,1-30a).
↑ Johannes 13,31-32: In der Nacht des Messias beginnt seine Ehre als Gottes Ehre
13,31 Da Judas nun hinausgegangen war,
spricht Jesus:
Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht,
und Gott ist verherrlicht in ihm.
13,32 Ist Gott verherrlicht in ihm,
so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich
und wird ihn bald verherrlichen.
Klaus Wengst (W408) sieht in den Versen 30-31 einen deutlichen Einschnitt im Text des Evangeliums, den er als nicht so wesentlich einschätzt wie Ton Veerkamp:
Der Anfang von 13,31 nimmt die Mitteilung aus V. 30 auf, dass Judas hinausgegangen war. Das hebt die nun folgende Rede Jesu – von kurzen Fragen und Bemerkungen einzelner Schüler unterbrochen – von der vorangehenden Szene deutlich ab. Sie schließt mit der Ankündigung in 14,30, nicht mehr viel mit seinen Schülern zu reden, und mit der anschließenden Aufforderung an sie, aufzustehen und mit ihm wegzugehen. Die wiederholte Aufforderung, sich nicht erschrecken zu lassen (14,1.27), lässt die Gliederung der Rede erkennen. Sie umschließt deren Hauptteil (14,1-26), sodass 13,31-38 die Einleitung und 14,27-31 den Schluss bilden.
Inhaltlich geht es Wengst um die Frage, wie trotz der unabwendbaren „Trennung Jesu von seinen Schülern … seine Schüler dann seine Schüler bleiben“ können:
Die Fortsetzung der Rede Jesu wird zeigen, dass gerade sein Weggang Schülerschaft erst wirklich und bleibend ermöglicht. Darauf hatten schon in der Einleitung sowohl die Wiederaufnahme der Rede von der Verherrlichung (V. 31f.) hingewiesen als auch die Gabe des Vermächtnisses (V. 34f.). Das führt der Hauptteil der Rede aus, der die heilige Geisteskraft als Beistand verheißt. Sie wird sich als die Kraft des erinnernden Wieder-Holens erweisen. Nach der Darstellung des Evangeliums spricht Jesus hier in der Situation des letzten Zusammenseins mit seinen Schülern vor seinem Tod und blickt dabei auf sein Wirken zurück und auf die Zeit nach seinem Tod voraus. Johannes nimmt damit „die Gattung des literarischen Testaments“ auf. <979>
Dabei begreift Wengst „die den Hauptteil rahmende Mahnung, sich nicht erschrecken zu lassen und nicht zu verzagen, im Zusammenhang mit der Situation der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde“, die in ihrer „Angst und und Ängstlichkeit“ gesagt bekommt, dass Jesu „Weggang notwendig, ja heilvoll für sie ist“. Macht es sich Wengst aber nicht etwas zu einfach (W409), wenn er „[i]hre Furcht, ihre Trauer und Resignation“ als „anachronistisch“ bezeichnet, da ja „ihre Zeit, die jenseits der Situation des Abschieds Jesu liegt, bereits die Zeit seiner neuen Gegenwart ist“ und „der den Schülern verheißene Trost für ihre Gegenwart schon gilt“? Er würde dem widersprechen, indem er davon ausgeht, dass der gekreuzigte Jesus als Auferstandener auf neue Weise seiner Gemeinde beistehen wird:
Johannes will also seine Gemeinde nicht vertrösten, sondern ihr Trost zusprechen gerade in ihrer schwer erträglichen Gegenwart. Indem er ihr in Jesu Weggang den Grund ihrer Existenz aufweist, macht er ihr klar, dass ihr in und trotz aller Bedrängnis nicht Furcht und Klagen eigentümlich sind, sondern Friede und Freude.
Zur Begründung dafür gibt Wengst einen Überblick zum Inhalt des restlichen 13. Johanneskapitels und beginnt mit einem Verweis auf die beiden Eingangsverse 31 und 32 der Abschiedsreden Jesu, die breiter ausführen, „was die Stimme vom Himmel in 12,28 über die Verherrlichung des Namens Gottes gesagt hat“:
Sie erfolgt jetzt in der wechselseitigen Verherrlichung Gottes und des Menschensohnes. Damit ist die Dimension angegeben, innerhalb derer das durch den Tod am Kreuz erfolgende Weggehen Jesu zu verstehen ist, von dem er in V. 33 zu seinen Schülern in direkter Anrede spricht. Wie jeder Tod bedeutet auch dieser Tod einen definitiven Einschnitt. In dieser Situation gibt Jesus seinen Schülern als sein Vermächtnis das Gebot, einander zu lieben (V. 34f.). Dass er nicht mehr in der Weise da sein wird, in der er es war, und dass es also auch keine unmittelbare Nachfolge mehr geben kann, wird in V. 36-38 an der Person des Simon Petrus deutlich, der den Einsatz seines Lebens anbietet und dem Jesus dreimaliges Verleugnen ankündigt.
Dann geht Wengst noch einmal ausführlich auf die „grundsätzlichen Feststellungen“ ein, die in den Versen 31 und 32 „in fünf knappen Sätzen“ mit Hilfe von „Formen des Verbs ‚verherrlichen‘ gebildet werden“:
Die ersten beiden stehen im Aorist und sind im Passiv formuliert: „Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht worden und Gott ist durch ihn verherrlicht worden.“ Der dritte nimmt den zweiten in Form einer Voraussetzung auf, aus der – jetzt im Futur und Aktiv – der vierte folgt, den der fünfte mit bestimmter Pointierung wiederholt: „Wenn Gott durch ihn verherrlicht worden ist, wird auch Gott ihn durch sich verherrlichen und sogleich wird er ihn verherrlichen.“
Dabei bezieht Wengst das „betont am Beginn stehende ‚Jetzt‘“ zunächst „auf die erzählte Situation …, dass Judas hinausgegangen ist“ und dass damit „das von Jesus selbst initiierte Geschehen, das zu seinem Tod führt, nun unabänderlich seinen Lauf nimmt und schnell zu seinem Ziel führen wird.“ Das heißt, die „Verherrlichung“, von der hier gesprochen wird, geschieht im „Jetzt“ oder der „Stunde“, die sich „auf die Passion und den Tod Jesu“ beziehen. Dann aber fragt sich Wengst (W410), warum „davon im Aorist und im Futur gesprochen“ wird. „Warum steht neben dem ‚Jetzt‘ ein ‚Sogleich‘?“ Zur Erklärung beruft sich Wengst auf Jörg Frey. <980> Ihm zufolge
handelt es sich um einen Wechsel „von der nachösterlichen Retrospektive zum Standpunkt des auf seinen Tod zugehenden Jesus. Ein und dasselbe Geschehen wird, obwohl es auf der Erzählebene noch aussteht, aus der nachösterlichen Retrospektive als bereits vollendet erfaßt“. Johannes will in den Abschiedsreden sicher so gelesen werden, dass „nicht einfach der irdische Jesus vor seiner Passion, sondern zugleich immer auch der Erhöhte das Wort hat“.
Dennoch will Wengst nicht ausschließen, „dass beide Aspekte, der aoristische und der futurische, für beide Perspektiven gelten.“ Schon auf der Ebene der Erzählung
wird zugleich auf den bisherigen Weg Jesu, auf dem er schon nach 2,11 „seine Herrlichkeit offenbarte“, zurück und auf sein unmittelbar bevorstehendes Ende voraus geblickt, mit dem dieser Weg erst zu seinem Ziel kommt. Auf der Ebene der lesenden und hörenden Gemeinde liegt die Verherrlichung Jesu in dessen Tod am Kreuz zurück. Aber dieses Werk Jesu steht nicht isoliert für sich selbst, sondern es will „die größeren Taten“ der Glaubenden (14,12) – wie ja Jesus gleich anschließend in V. 34f. seinen Schülern sein Vermächtnis für ihr Tun und Verhalten hinterlässt.
Was nach Wengst mit Verherrlichung gemeint ist, spitzt er in folgenden Sätzen über Jesu Kreuzestod zu:
Jesus verherrlicht Gott, gibt ihm die Ehre, indem er seinen Weg in den Tod am Kreuz ganz und gar in Erfüllung des Willens Gottes geht (vgl. 10,18). Gott verherrlicht Jesus, indem er seine Ehre in dessen Kreuz sucht. Jesu Tod erhält dadurch sozusagen das Gewicht Gottes.
An dieser Stelle nimmt Wengst (Anm. 46) mit dem Stichwort „Gewicht“ nicht nur die „hinter dem griechischen Wort dóxa (‚Herrlichkeit‘, ‚Ehre‘, ‚Glanz‘) stehende“ Grundbedeutung des „hebräische[n] Wort[es] kavód“ auf, sondern er (W410) bezieht sich auch darauf, dass mit
der Rede von der wechselseitigen Verherrlichung Gottes und des Menschensohnes … hier wiederum auf Jesus zugespitzt [wird], was die biblisch-jüdische Tradition über die wechselseitige Verherrlichung Gottes und Israels aussagt. In Jes 49,3 heißt es in einer Anrede Gottes: „Mein Knecht bist du, Israel, durch dich will ich mich verherrlichen“ (vgl. 44,23). Am Ende einer längeren Wechselrede, in der die Israeliten und die heilige Geisteskraft einander Schriftzitate zurufen, steht: „Die Israeliten sprechen (Ps 89,18): ‚Ja, die Verherrlichung ihrer Macht bist Du usw.‘ Und die heilige Geisteskraft ruft aus und spricht vom Himmel (Jes 49,3): ‚Israel, durch dich will ich mich verherrlichen‘“. <981> … {Weiter} wird ein Gleichnis von einem, der eine Krone für den König machte, so gedeutet: „So sprach der Heilige, gesegnet er, zu Mose: ,Tu alles, was du vermagst, zum Ruhm, zur Größe und zur Herrlichkeit Israels!‘ Warum? Weil ich mich durch sie verherrlichen werde.“ Das wird mit Jes 49,3 begründet. Mose tut für Israel, dass er ihm Tora gibt; und so verherrlicht sich Gott durch einzelne Israeliten, indem diese sich an seinem Willen orientieren: „Wenn jemand die Tora liest und die Mischna lernt und den Schülern der Weisen dient und sein Umgang mit den Leuten taktvoll erfolgt, was sagen die Leute über ihn? ,Glücklich sein Vater, weil er ihn Tora gelehrt hat! Glücklich sein Lehrer, weil er ihn Tora gelehrt hat! […] Seht, wie angenehm sein Verhalten ist, wie gut gemacht seine Taten sind!‘ Über ihn sagt die Schrift (Jes 49,3): ‚Da sprach er zu mir: Mein Knecht bist du, Israel, durch dich will ich mich verherrlichen“.
Obwohl also Wengst durchaus über die Hintergründe der Verherrlichung oder Ehre des Gottes durch sein Volk Israel Bescheid weiß, bezieht er diese nicht konsequent darauf, dass es auch dem johanneischen Jesus in seinem messianischen Handeln zuallererst um das Leben der kommenden Weltzeit für Israel geht. Stattdessen sieht er das, was in den Schriften von Gottes Verhältnis zu Israel ausgesagt ist, ganz und gar auf die Person Jesu übertragen, ohne ernst zu nehmen, dass Jesus von Johannes nur in seiner Verkörperung Israels als des zweiten Isaak, des Einziggezeugten des VATERS, als der Messias des Gottes Israels bezeugt wird:
Der Beginn der Abschiedsrede stellt also das niedrige und elende Geschehen der Kreuzigung Jesu einmal mehr in die Dimension Gottes. Das bestimmt diese Rede im Ganzen.
Anders als Veerkamp und Wengst sieht Hartwig Thyen (T603) durch die Zeitangabe in Vers 30 oder den Weggang des Judas keinen tiefen Einschnitt zwischen den Versen 30 und 31 begründet:
Unmittelbar an V. 30 angeschlossen, durch das verknüpfende oun {nun} fest mit dem Vorausgehenden verbunden, und ohne daß Judas, wie es ein Neueinsatz doch erforderte, noch einmal namentlich genannt würde, sondern nur in der Wendung „als er nun hinausgegangen war“ zur Sprache kommt, erklärt Jesus nun: „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott hat sich verherrlicht in ihm. Hat Gott sich aber in ihm verherrlicht, dann wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen; und er wird ihn sogleich verherrlichen“.
In dieser von Thyen gegebenen Übersetzung der Verse 31 und 32 fällt auf, dass er die ersten beiden im Aorist stehenden Passivformen „trotz ihrer identischen Grapheme edoxasthē {wurde verherrlicht, geehrt} in verschiedener Weise übersetzt.“ Dazu beruft er sich auf eine „eingehende Studie von Caird <982>“ und führt aus (T603f.):
Wird nämlich vom ,Sohn des Menschen‘ im üblichen Passiv gesagt, daß er jetzt verherrlicht worden sei, so daß er als das passive Objekt der Aktivität eines anderen, nämlich Gottes, erscheint, so kann das ja nicht in gleicher Weise auch von Gott gesagt werden. Vielmehr muß das Passiv jetzt – wie häufig in der LXX, deren Übersetzer das reflexive Niphal nikhaved {sich verherrlichen} der hebräischen Bibel durch Passivformen von doxazesthai wiedergeben – als ein reflexives Intransitivum verstanden werden, so daß man V. 31 paraphrasieren kann: ,Jetzt ist der Sohn des Menschen dadurch verherrlicht, daß sich Gott in ihm verherrlicht hat‘. Auch darin, daß das en autō {in ihm} hier nicht instrumental, sondern ganz wörtlich lokal zu verstehen ist, folgen wir Caird [271], der seine eingehende Untersuchung des LXX-Sprachgebrauchs so resümiert: „Es scheint mir daher nur vernünftig zu sein, anzunehmen, dass ein Jude, der nach einem griechischen Wort suchte, um die Entfaltung einer großartigen Tätigkeit des Menschen oder Gottes auszudrücken, die in seiner hebräischen Muttersprache durch das niphal nikhaved ausgedrückt werden konnte, sich berechtigt gefühlt haben könnte, das Verb doxazesthai für diesen Zweck zu verwenden, in der Erwartung, dass sein griechischer Nachbar seine Bedeutung richtig erkennen würde. Wenn Johannes also Jesus die Worte ho Theos edoxasthē en autō {der Gott wurde in ihm verherrlicht} in den Mund legte, konnte er getrost davon ausgehen, dass seine Leser, ob Juden oder Griechen, verstehen würden, dass Gott seine Herrlichkeit in der Person des Menschensohns voll zur Geltung gebracht hatte“ [277].
Dass (T604) die zweite Verherrlichungsaussage von Vers 31 am Anfang von Vers 32 nicht von allen Handschriften als Voraussetzung des dortigen Bedingungssatzes aufgenommen wird, hält Thyen für eine versehentliche Auslassung, da „der Stufenparallelismus mit seiner Aufnahme des zuvor Gesagten in die Protasis {Voraussetzung} eines Bedingungssatzes … ein allzu deutliches Kennzeichen der individuellen Handschrift unseres Evangelisten“ ist.
Auch Thyen bezieht wie Wengst „das nyn {jetzt} von V. 31 auf den Weggang des Judas und auf Jesu Worte: ‚Was du tun willst, tue unverzüglich!‘ und damit auf die ,Stunde‘ der Kreuzigung Jesu.“ Entschieden wendet sich Thyen gegen die Auffassung von Barrett, <983> der in dem dreimaligen edoxasthē {wurde verherrlicht} „einen Anachronismus“ sieht und erklärt:
„Der wahre Schauplatz dieser Kapitel ist das Leben der Christen am Ende des 1. Jh.; aber von Zeit zu Zeit bringt Joh, der das Leben der Kirche in seiner eigenen Zeit an die Geschichte, auf welcher sie gründet, zu binden sucht, seine Erzählung zu einem Schauplatz zurück, der offensichtlich ursprünglich ist: die Nacht, in welcher Jesus verraten wurde“. In diesem Sinne soll der Evangelist mit den Aoristen edoxasthē {wurde verherrlicht} aus seiner eigenen Gegenwart auf die Verherrlichung Jesu durch Kreuz und Auferstehung zurückblicken, um dann mit dem Futurum doxasei {wird verherrlichen} von V. 32 Jesus selbst in seiner ,Stunde‘ wieder zu Wort kommen zu lassen.
Diese Interpretation ist für Thyen zum einen deswegen unmöglich, weil weder „das auf den Weggang des Judas bezogene nyn“ noch „das ausschließlich vom irdischen Jesus als Selbstbezeichnung gebrauchte Kryptogramm ,Der Sohn des Menschen‘ … in eine beliebige andere Zeit übertragbar“ ist.
Und zum anderen erzählt Johannes zwar aus seiner österlichen Perspektive und sieht insofern im irdischen Jesus immer schon den Auferstandenen, doch derartige Anachronismen, wie Barrett sie ihm unterstellt, leistet er sich u. E. an keiner Stelle.
Stattdessen enthält nach Thyen (T605) schon der in Vers 31 verwendete „Aorist ein futurisches Moment“, denn mit dem Weggang des Judas „in die Nacht“ ist er „nun unterwegs …, Jesu ,Erhöhung an das Kreuz‘ in Gang zu setzen“. Dass Johannes damit in zwei verschiedenen Formen auf die Zukunft verweist, sieht Thyen unter Berufung auf Burkett <984> als eine kunstvolle Möglichkeit, „hier zwei Momente der einen Verherrlichung des Sohnes des Menschen voneinander zu unterscheiden“:
„Der Grund für die Zeitform in diesem Kontext ist, dass sie es Jesus ermöglicht, zwischen zwei zukünftigen Momenten der Verherrlichung zu unterscheiden: Die Vergangenheitsformen in 31-32a beziehen sich auf einen, die Zukunftsformen in 32b auf einen anderen. Die Unterscheidung wäre unklar geworden, wenn für beide Ereignisse die Zukunftsform verwendet worden wäre. … Auf den ersten Moment der Verherrlichung am Kreuz wird ein zweiter folgen, in dem der Sohn vom Vater verherrlicht wird. … Diese zweite Verherrlichung wird kurz nach der Verherrlichung am Kreuz stattfinden, denn Gott wird ihn ‚kurz darauf‘ verherrlichen“.
Den Ursprung (T606) der „beiden bei Johannes mit der Rede vom ‚Sohn des Menschen‘ in dritter Person verbundenen und nahezu synonymen Passiva hypsōthēnai {erhöht werden} (3,14; 8,28; 12,32.34) und doxasthēnai {verherrlicht werden} (12,23; 13,31f)“ sieht Thyen in Jesaja 52,13: idou synēsei ho pais mou kai hypsōthēsetai kai doxasthēsetai sphodra ktl. {Siehe, meinem Knecht wird‘s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein usw.}:
Wie bei Jes 52,13ff steht die Verherrlichungsaussage auch in Joh 13 im Kontext der durch die Fußwaschung symbolisierten und durch den Weggang des Judas akut gewordenen stellvertretenden Lebenshingabe dort des Gottesknechts und hier des Sohnes des Menschen.
Die Aussage in Johannes 13,32 von der „künftigen Verherrlichung des Sohnes des Menschen in Gott selbst, die alsbald geschehen soll“, geht aber Thyen zufolge weit „über das bei Jesaja Gesagte hinaus“, denn in ihr „geht es ja – wie 17,4 explizieren wird – darum, daß der Vater seinen aufgefahrenen Sohn mit derjenigen doxa verherrlichen wird, die er, noch ehe die Welt geschaffen war, beim Vater hatte.“ Dazu verweist Thyen nochmals auf Burkett: <985>
„Nichts in Jes 52,13ff deutet jedoch darauf hin, dass der Gottesknecht zu einer früheren Herrlichkeit zurückkehrt. Die Vorstellung von der früheren Herrlichkeit des Menschensohns muss also eine andere Quelle haben. Eine solche Quelle findet sich in Jes 6,1ff, eine Stelle, auf die sich der Evangelist in Joh 12,37-41 bezieht. In der Vision von Jes 6 sieht der Prophet Jesaja Jahwe auf einem Thron, ‚hoch und erhaben‘, und der ‚Saum seines Gewands‘ (schulaw) füllt den Tempel aus. Die LXX übersetzt ‚Saum‘ mit ‚Herrlichkeit‘ (doxa) und versteht den Begriff als Hinweis auf die Pracht, mit der Jahwe bekleidet ist. Weitere ‚Herrlichkeit‘ im Sinne von ‚Lob‘ erfährt Jahwe von den Seraphim, die einander zurufen: ‚Erfüllt die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit‘. In dieser Vision wird Jahwe also sowohl ‚erhöht‘ als auch ‚verherrlicht‘. Indem er sich auf diese Vision bezieht, identifiziert der Evangelist ,Jahwe‘, die verherrlichte Gestalt, die Jesaja sah, als den präexistenten Sohn, der in Herrlichkeit regiert, und bemerkt, dass Jesaja ,seine [Jesu] Herrlichkeit‘ sah (12,41)“.
Damit verfolgt Thyen einen vollkommen anderen Weg der Interpretation der Ehre bzw. Herrlichkeit des Gottes Israels und seines Messias Jesus, als dies Wengst getan hat und erst recht Veerkamp tun wird. Statt Jesus in seiner Verkörperung des Volkes Israel als des zweiten Isaak zugleich denjenigen zu sehen, der den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert, und statt dementsprechend die Ehre sowohl Jesu als auch seines VATERS auf die Befreiung und das Leben Israels ausgerichtet zu beschreiben, versetzt Thyen Jesus praktisch in eine Existenz als Himmelswesen vor seiner Geburt und nach seinem Tod. Daraus, dass Jesus nach Johannes 1,18 an der Brust des Vaters und dessen einziger Ausleger ist, ergibt sich nämlich nach Thyen die Schlussfolgerung,
daß alle Erscheinungen Jahwes, von denen die hebräische Bibel berichtet, Erscheinungen nicht des Vaters, sondern des Sohnes waren. Er hat auf dem Sinai mit Mose geredet, wie mit einem Freund (Ex 33; Phil 2,11) und von ihm hat Mose geschrieben (Joh 5,46). Er ist Abraham bei der Terebinthe von Mamre erschienen (Gen 18; Joh 8,56ff). Im intertextuellen Spiel mit Zeph 3,8ff hatte Nathanael Jesus als den zum endzeitlichen Weiden seines Volkes in dessen Mitte erschienenen basileus tou Israēl {König von Israel} begrüßt (1,49 …). Und wie Nathanaels Bekenntnis zu dem in der Mitte seines Volkes erschienenen Gott (JHWH) die anfängliche Jüngerberufung vollendet, so erfährt diese in Joh 20 mit der Sendung der Jünger ihre glückliche Wiederholung, gipfelt in dem Bekenntnis des Thomas: ho kyrios mou kai ho theos mou {mein Herr und mein Gott} (20,28), und holt damit die Prologverse 1 und 18 ein: kai theos ēn ho logos {und Gott war das Wort}, und: monogenēs theos ho ōn eis ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato {der einziggeborene Gott, der an der Brust des Vaters ist, der hat ihn kund gemacht}.
Ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass der jüdische Messianist Johannes in dieser Weise zu interpretieren ist. Auch mit der Thyenschen Auffassung, dass der unbekannte Jesus vom bekannten Gott Israels her zu begreifen ist, stimmt diese Sichtweise nicht überein. Umgekehrt muss alles, was Johannes von der Ehre des Messias aussagt, von der Ehre des Gottes Israels her verstanden und damit auf das Leben der kommenden Weltzeit für Israel bezogen werden.
Dementsprechend gibt Ton Veerkamp <986> das Wort doxa, das üblicherweise mit „Verherrlichung“ übersetzt wird, mit dem Wort „Ehre“ wieder. Anders als Wengst und Thyen bezieht Veerkamp diese Ehre inhaltlich auf das, was den NAMEN des Gottes Israels ausmacht, nämlich seinen unbedingten Willen der Befreiung und des Lebens seines Volkes Israel:
Das Wort „Ehre“ (doxa, kavod, gloria) wird im Verlauf des Evangeliums zunehmend wichtig. Ab Kap. 11, der Erweckung des Lazarus, bis Kap. 17, dem Gebet des Messias, ist jene doxa, Ehre, ein Hauptthema. Die Ehre Gottes ist nicht wie die schnell beleidigte Ehre der Menschen. Die Ehre, kavod, eigentlich „Wucht“, ist sein Durchsetzungsvermögen bei der Verwirklichung seines „Projektes“ Israel.
Bei der Erweckung des Lazarus hörten wir, wie Krankheit und Tod dazu dienen, dass „der, der wie-Gott ist, geehrt wird“, und der Verzweiflung Marthas begegnet er mit dem Wort: „Wenn du vertraust, wirst du die Ehre Gottes sehen.“ Was am Grab des Lazarus geschieht, bedeutet: dass „die Ehre Gottes“ darin besteht, dass Israel lebt.
Immer wo von der Erschütterung Jesu berichtet wird (11,33; 12,27; 13,21), kommt die „Ehre Gottes“ ins Spiel. Der Messias betet: „VATER, ehre Deinen Namen.“ Die „Stimme vom Himmel“ erklärt: „Ich habe ihn geehrt, ja, um so mehr werde ich ihn ehren“ (12,28). Und hier, nach der erschütternden Erfahrung, dass einer der Zwölf den Messias verrät, sagt Jesus: „Jetzt wird bar enosch, der MENSCH geehrt werden; mit ihm wird Gott geehrt sein … und wird auch Gott ihn mit sich ehren und sofort (euthys) wird er ihn ehren.“
Was Jesus hier sagt, indem er ein zweites Mal das Wort euthys und im selben Atemzug fünfmal die doxa bzw. kavod Gottes und des Menschensohnes erwähnt, muss vorerst noch rätselhaft bleiben, denn wie soll der Mord am Messias das Leben Israels bewirken? Offenbar ist das genau die Frage, die der johanneische Jesus in den Abschiedsreden zu beantworten sucht:
Wir wissen, was die Ehre, die Wucht Gottes ist: dass Israel lebt. Das geschieht in dem Augenblick, wo das anscheinende Verhängnis durch den Verrat eingeleitet wird: Der Messias wird ermordet, Israel lebt! Das wird sofort Wirklichkeit, gleichzeitig mit dem Übergang von Judas ben Simon in die Reihen des Feindes. Wir können dies erst dann verstehen, wenn wir das Wort euthys ein drittes und letztes Mal hören werden, 19,34.
↑ Johannes 13,33-35: Jesu neues Gebot der Solidarität für die zurückbleibenden Schüler
13,33 Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch.
Ihr werdet mich suchen.
Und wie ich zu den Juden sagte,
sage ich jetzt auch zu euch:
Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen.
13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe,
damit auch ihr einander lieb habt.
13,35 Daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt.
[23. Oktober 2022] Nachdem geklärt ist (W410), dass die gesamte Abschiedsrede Jesu vor dem Hintergrund seiner bevorstehenden Erhöhung ans Kreuz zu begreifen ist, spricht Jesus in Vers 33 „die nun bevorstehende definitive Trennung von seinen Schülern an.“ Dazu betont Klaus Wengst, dass er nur „an dieser Stelle im Johannesevangelium … die Anrede ‚Kinder‘ gebraucht“, die (Anm. 47) nach „der rabbinischen Literatur“ geläufige „Anrede des Lehrers an seiner Schüler“. Indem Jesus seinen Schülern gegenüber feststellt (W411): „Noch eine kurze Zeit bin ich bei euch“, hebt er nicht „die noch bestehende Anwesenheit“ hervor, die „nur noch kurz sein“ wird, sondern
die Trennung und die Abwesenheit: „Ihr werdet mich suchen; und wie ich zu den Juden sagte, sage ich es jetzt auch euch: Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen.“ Jesus geht in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert. Dahin können weder seine Schüler noch andere mit ihm gehen. So wie er da war, wird er ihrem Suchen nicht mehr greifbar und begreifbar sein – nicht einmal als Toter.
Dazu beruft sich Wengst auf die Bemerkung von Barrett, <987> dass hier „auch eine Anspielung auf die ergebnislose Suche nach dem Leib Jesu zu Ostern vorliegen“ könnte.
Im Vergleich zu 7,33f. und 8,21 sagt Jesus „den Schülern nichts anderes als ‚den Juden‘“, ohne allerdings „die dort gemachten weiteren negativen Aussagen (‚und werdet mich nicht finden‘; ‚und werdet durch eure Sünden sterben‘)“ zu wiederholen, woraus für Wengst zu schlussfolgern ist, „dass für sie aus der Trennung von Jesus keine Beziehungslosigkeit folgen, sondern dass es eine Verbundenheit anderer Art geben wird.“
Mit Jesu Worten in Vers 34: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander liebt“, stellt er sogleich einen „wesentlichen Aspekt dieser Verbundenheit“ heraus. Dieses Gebot stellt „sein Vermächtnis“ dar, denn durch seinen Tod, in dem Gott „sein Gewicht in die Waagschale wirft“, vermacht er „seinen Schülern die Liebe Gottes“, von der bereits in 3,16 und 13,1 die Rede war. Es ist Wengst (Anm. 49) „völlig uneinsichtig, wieso an dieser Stelle immer wieder die literarkritische Schere gebraucht wird“, da die Verse 34 und 35 angeblich nicht in den Zusammenhang passen.
Zum Liebesgebot selbst weist Wengst zunächst darauf hin, dass Jesus nichts anderes von seinen Schülern fordert, als was „er selbst bis zur Hingabe seines Lebens erfüllt (vgl. 10,18; 12,49f.).“ Die zweimalige Formulierung, „einander zu lieben“, die „oft als bewusste Einschränkung der biblischen Nächstenliebe und der im Matthäus- und Lukasevangelium gebotenen Feindesliebe gedeutet“ wird, stellt Wengst in den Zusammenhang der Situation, dass die „Gruppe des Johannes“ in ihrer Zeit (W412) „von außen hart bedrängt“ wurde,
was im Innern eine Abfallbewegung zur Folge hatte. In diese Situation hinein lässt Johannes den scheidenden Jesus als sein Vermächtnis das Gebot sagen, einander zu lieben. Dieses Gebot erhält so den Charakter einer Aufforderung zur Solidarität, die für diese Gemeinde eine schlichte Notwendigkeit ist, will sie überleben, und zwar als Gemeinde überleben. Als Einzelne, unter Aufgabe der offenbaren Zugehörigkeit zur Gemeinde, hätten sich alle besser durchschlagen können, weil ihnen dann Nachteile erspart geblieben wären. Es ist damit deutlich, dass die Befolgung des Gebots, einander zu lieben, keineswegs einen Rückzug ins Konventikel bedeutet. Denn gerade wer dem Gebot nachkommt und so auch materiell Zugehörigkeit zu dieser Gruppe bekundet, setzt sich der Gefährdung aus. Deshalb belassen es nach 12,42 auch viele von den Ratsherren bei bloß heimlicher Sympathisantenschaft.
Weiter macht dieses Gebot auf diesem Hintergrund deutlich, dass es nicht bloß um Individual- und Situationsethik gehen kann, je und je erfolgendes liebendes Verhalten, das in der Begegnung des Einzelnen mit dem Nächsten immer wieder für die Zukunft offen sein lässt. Es geht vielmehr darum, dass sich die Liebe in einer bestimmten Sozialgestalt manifestiert, nämlich einer Gemeinde solidarischer Geschwister.
Als Problem empfindet Wengst die Frage, inwiefern „Johannes das den Schülern von Jesus gegebene Gebot, einander zu lieben, ein neues nennen“ kann, denn in „inhaltlicher Hinsicht ist es gegenüber dem biblischen Gebot, den Nächsten zu lieben (Lev 19,18), gewiss nicht neu“, da er in der „einander gebotenen Liebe“ einen „Aspekt der Nächstenliebe“ sieht, auch wenn Martin Luther <988> (Anm. 53) „das Neue als Abschaffung des Alten“ verstehen wollte:
„Ein neu Gebot – da hebt Christus mit einem Wort das ganze alte Testament auf“. Er denkt dabei besonders an das Israel spezifisch Gebotene: „Damit läßt er alles fahren, was Mose gebietet, Beschneidung und dgl.“. Das Liebesgebot wird von ihm auch in der Weise verabsolutiert, dass es alle anderen Gebote im Grunde überflüssig mache: „Ein jeder Fürst hat ein Wappenzeichen. Eine Stadt hat ihr Wappen, ein Mann hat sein Siegel. Christi Zeichen ist nichts andres als die Liebe. […] er setzt allein die Liebe zum Zeichen, also sind alle anderen Gesetze abgetan“.
Das Neue am „neuen Gebot“ sieht Wengst demgegenüber darin (W412f.), dass es zu verstehen ist
im Sinne endzeitlicher Verwirklichung im Gegenüber zur anderen Wirklichkeit der alten Welt – einer Verwirklichung, die in dem als Erweis der Liebe Gottes begriffenen Tod Jesu gegeben ist und sich im Leben derer, die sich darauf einlassen, auswirkt.
Das heißt (W413), in der Befolgung des neuen Gebotes „würde sich die Schülerschaft Jesu als ‚neue Welt‘ darstellen, von Jesus ‚zurückgelassen, um der Welt ihre Beziehung zu ihm nun durch ihre gegenseitige Liebe zu zeigen‘“, wie Wengst mit Worten von Barrett [440] formuliert. „An der Stelle des nicht mehr anwesenden Messias stünde so die messianische Präsenz seiner Schüler.“ In diesem Zusammenhang wäre
das „neue Gebot“ analog zum „neuen Bund“ von Jer 31,31-34 {zu verstehen}. Dieser „neue Bund“ ist kein anderer als der bisher von Gott mit seinem Volk Israel geschlossene Bund. Es ist der erneuerte alte, dessen Verpflichtungen aber von den menschlichen Bundespartnern tatsächlich erfüllt werden, weil sie diese – da aufs Herz geschrieben – verinnerlicht haben. So wäre auch das „neue Gebot“ das erneuerte alte aufgrund seiner – von innen heraus erfolgenden – Verwirklichung.
Wengst formuliert diese „Sätze … im Konjunktiv …, weil hier im Blick auf die Geschichte der Kirche schlechterdings nicht vollmundig geredet werden kann. ‚Neue Welt‘ gibt es innerhalb der ‚alten Welt‘ immer nur im Fragment und als Episode.“ Außerdem hat der Evangelist ohnehin noch keine heidenchristlich geprägte Kirche im Blick gehabt, wie wir sie kennen, sondern die Sammlung eines Restes von ganz Israel, der in der vom Messias gebotenen Solidarität miteinander den Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit tätig erwartet.
Wie dem auch sei, nach Vers 35 bleibt Wengst zufolge
das Erkennungszeichen der Schülerschaft Jesu ein Anspruch, der nur teilweise eingelöst ist und immer wieder eingelöst werden will: „Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Das ist das die Schülerschaft Jesu qualifizierende Merkmal, an dem sie von außen wahrgenommen werden soll.
Dass Exegeten dazu gerne „einschlägige altkirchliche Zeugnisse“ zitieren, besonders dasjenige von Tertullian <989> über „das positive Wirken und Verhalten der ‚christlichen Partei‘“ seiner Zeit, betrachtet Wengst eher mit Zurückhaltung, da eine solche Wahrnehmung des Christentums durch Außenstehende kaum unserer heutigen Erfahrung entspricht. Und schon damals war Tertullians Werk ein „Apologeticum“, also die Verteidigungsschrift eines christlichen Insiders, der als solcher die Meinung der Gegenseite über die Diakonie der Christen auch geschönt dargestellt haben kann:
„Doch eben solcher Liebe Werk drückt uns in den Augen vieler ein Mal auf. ,Seht‘, sagen sie, ,wie sie sich gegenseitig lieben‘ – sie selbst nämlich hassen sich gegenseitig – ,und wie sie füreinander zu sterben bereit sind‘ – sie selbst nämlich wären eher einander umzubringen bereit.“
Hartwig Thyen (T607) bezeichnet die „das folgende Liebesgebot einleitende Anrede der Jünger mit dem Diminutiv teknia (Kindlein)“ in Vers 33 als eine johanneische „Stileigentümlichkeit“, da sie zwar „in unserem Evangelium einzig an dieser Stelle“ begegnet, dafür allerdings „dem anonymen Verfasser des Ersten Johannesbriefs geläufig (2,1.12.28; 3,7.18; 4,4 u. 5,21…)“ ist:
Mit der liebevollen Anrede seiner doch so fehlsamen Jünger als ,meine Kindlein‘ bringt der Erzähler Jesu bedingungslose Liebe zu denen zum Ausdruck, deren Kassenverwalter Judas bereits unterwegs ist, seinen Herrn dem Tode auszuliefern, deren als ,Felsenmann‘ ausgezeichneter Sprecher Petrus (1,42; 6,68f) ihn dreimal verleugnen wird (13,13,38; 18,15ff) und die ihn (bis auf den einen, ,den Jesus liebte‘) in der entscheidenden Stunde alle allein lassen werden (16,32).
Inhaltlich „erinnert Jesus seine Jünger“ in Vers 33 an seine Erklärung gegenüber der jüdischen Volksmenge auf „der Höhe des Laubhüttenfestes“:
„Noch eine kurze Weile bin ich unter euch, dann aber gehe ich hin, zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich (dann) suchen, doch nicht finden, denn wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht gelangen“ (7,33f). … Aber als sein bleibendes Vermächtnis hinterläßt er ihnen sein ,neues Gebot‘…
Die Formulierung dieses Gebotes in den Versen 34 und 35 wird nach Thyen durch Bultmann <990> „treffend“ als „eine erste Antwort auf die Frage“ gedeutet, „wie es den Jüngern denn möglich sein soll, in ihrer Verlassenheit (V. 33) das Verhältnis zu ihrem Herrn festzuhalten“ (T608):
„Die Zukunft wird unter einen Imperativ gestellt! Die um ihr Sein als zuständliches Sein Besorgten werden in ein Sein verwiesen, das den Charakter des Sollens hat. Dem Wahn, daß das Haben ein verfügendes Besitzen sei, wird ein Haben gezeigt, das in der Erfüllung einer Aufgabe besteht. Der verzweifelnde Blick in die Vergangenheit, die nicht mehr ist, wird umgewendet in die Zukunft, die verpflichtend kommt. Eine unechte Zukunft, die nur das Verharren im Vergangenen wäre, wird zur echten Zukunft gemacht, die den Glauben fordert. Und indem der Inhalt der entolē {Gebot} lautet: hina agapate allēlous {dass ihr einander liebt}, wird die Sorge um das Ich in die Sorge um den Anderen verwandelt. … Nicht so steht es also, daß Jesus beim Scheiden als Ersatz für seine Gegenwart ein ethisches Prinzip aufrichtet, unter das das menschliche Leben allgemein zu stellen wäre; ein Prinzip, das etwa in Jesu historischer Gestalt anschaulich geworden wäre. Gerade dann wäre ja das Problem des Abschieds, das Problem des Verhältnisses zum entschwundenen Offenbarer, nicht gelöst; denn dann wäre dieses Verhältnis aufgelöst, man brauchte den Offenbarer nicht mehr, und der Gewinn der Zukunft wäre in die eigene Hand gelegt. Damit hätte aber auch die Vergangenheit ihren Sinn verloren; sie wäre, auch wenn sie pädagogische Bedeutung gehabt hätte, doch für die Zukunft gleichgültig geworden“.
Unter Bezug auf Moloney <991> hält es Thyen für „einleuchtend“, dass
die Gabe (didōmi hymin {ich gebe euch}) des neuen Gebots und dessen inhaltliche Explikation ihre exakte, nicht nur formale, sondern auch inhaltliche Entsprechung in der Gabe der Fußwaschung als hypodeigma {Vorbild} hat…
Daraus folgt nach Thyen weiter, dass „das gesamte Kapitel 13 von V. 1-38 als Einheit gelesen sein will“ und „die Passage 13,31-38“ nicht „als die Einleitung der sogenannten Abschiedsreden der Kapitel 14-17“ betrachtet werden darf, wie das die „meisten Kommentatoren“ tun:
Wie die Gabe des eingetauchten Bissens an Judas, der ihn ausliefern sollte, Jesu bedingungslose Liebe auch zu seinen Feinden offenbart – zu Petrus, der ihn dreimal verleugnen wird und zu seinen wankelmütigen Jüngern, die ihn am Ende alle verlassen werden -, so und nicht anders sollen auch die Jünger einander lieben.
Wie Wengst widerspricht auch Thyen der Auffassung, „daß das Liebesgebot durch den Gebrauch des Lexems allēlous {einander} im Sinne der Binnenethik eines Konventikels auf die Liebe der Gemeindeglieder zueinander beschränkt würde“:
Vielmehr setzt sich ja Gottes Liebe zum kosmos, die er in der Gabe und Sendung seines einzige Sohnes erwiesen hat (3,16) und die sich im Sterben Jesu für das Leben der Welt vollenden soll, in der Sendung der Jünger in die Welt fort und fordert mit der Wendung: kathōs ēgapēsa hymas {wie ich euch geliebt habe} auch von ihnen eine Liebe, die bereit ist, Jesus selbst ins mögliche Martyrium nachzufolgen (13,36-38; 16,2f u. ö.), so daß in ihrem Tun Jesu Tat gegenwärtig bleibt [Bultmann 404].
Interessant ist, dass Thyen außerdem ähnlich wie Veerkamp unter Bezug auf das von Jesus seinen Jüngern gegebene hypodeigma {Vorbild} der Fußwaschung davon spricht, dass „er ihnen jegliche Art von Autonomie“ nimmt und (T608f.) „sie, wie zuvor sich selbst, zu Sklaven von- und füreinander“ macht. „Er unterwirft sie damit dem strengen heteros nomos {fremden Gesetz} des jeweils Anderen (vgl. 13,15f).“ Damit (T609) „ist die Forderung der wechselseitigen Liebe“ als vom Glauben „unablösbare Praxis, sein Wurzelgrund und Inhalt“ zu verstehen.
Da nach Vers 35 „an der Liebe der Jünger zueinander alle erkennen sollen, daß sie Jesu Jünger sind“, muss diese Forderung jedenfalls „insofern im Dienste der Liebe Gottes zur Welt und ihrer Erlösung“ stehen, als
die Welt das ja nur [wahrnehmen kann] …, wenn die einander liebenden Jünger als die von Jesus Gesandten, sich in deren nur das Eigene liebendes Wesen einmischen. Darum darf das ,Einander‘ keinesfalls als argumentum e silentio {stillschweigendes Argument} für die Behauptung mißbraucht werden, daß Jesu Liebesforderung dadurch auf das Verhalten innerhalb einer ,johanneischen Gemeinde‘ reduziert und die gebotene Liebe zum Nächsten, auch wenn er der Feind sein sollte, ausgeschlossen werde…
Dass Johannes Jesu „den unverständigen Jüngern (13,28f)“ gegebenes Liebesgebot „gewiß nicht zufällig zwischen das Weggehen des Judas und die Ankündigung der dreifachen Verleugnung Jesu durch Petrus“ einschaltet, heißt nach Thyen vielmehr,
daß unser Evangelium nicht das Porträt einer in Bruderliebe verbundenen und vom Rest der Welt getrennten johanneischen Gemeinde einander liebender Brüder ist, sondern der Aufruf des Evangelisten an die Christenheit seiner Tage – eine Christenheit, die wohl eher dem Bild der erzählten Jünger gleicht, die ihren Herrn verraten, verleugnet und ihn, wenn es ernst wurde, im Stich gelassen haben – doch endlich zu einer solchen Gemeinde zu werden, damit die Welt sie als die Jünger Jesu erkennen kann.
Einmal mehr (T610) wehrt sich Thyen hier also dagegen, „die Existenz einer vom Rest des Urchristentums abgetrennten und auch im soziologischen Sinn ,johanneischen Sekte‘ erschließen zu wollen“. Zugleich fällt erneut auf, dass Thyen vielleicht etwas zu vorschnell von einer einheitlicher aufgestellten „Christenheit“ zur Zeit des Johannes ausgeht, als dies tatsächlich der Fall war. Auch wenn man das johanneische Umfeld nicht für einen elitären und in der Nähe der Gnosis anzusiedelnden nur auf sich selbst bezogenen Konventikel hält, so deuten die Konzentration auf Israel statt auf eine Völkermission und die zugleich schärfste Auseinandersetzung mit den „Juden“ oder „Judäern“, vor denen sich die Nachfolger des Messias Jesus aus Furcht zurückziehen, doch darauf hin, dass im Johannesevangelium andere Akzente gesetzt werden als bei Paulus und in den synoptischen Evangelien. Vor allem aber geht es dem Evangelisten noch nicht um ein als neue Religion dem Judentum gegenüberstehendes Christentum, sondern er versteht sich als Jude, der Jesus als den messianischen Befreier ganz Israels von der römischen Weltordnung proklamiert, womit er auch deren judäischen Kollaborateuren einschließlich des Verräters Judas aus seiner eigenen Anhängerschaft entgegensteht.
Thyens spricht dagegen unbefangen von „einer johanneischen Ekklesiologie“, also der Lehre von einer um Jesus gescharten Gemeinde oder Kirche. Als Haupteinwand gegen die Annahme, diese Gemeinde sei nur eine auf sich selbst bezogene sektiererische Gruppe, führt er an, dass deren „Entfaltung“
von der Sendung der Jünger durch den Auferstandenen (20,19ff) ausgehen muß. Denn sie ist der Grund, in dem sie wurzelt. Darum darf auch die Liebesethik unseres Evangeliums nicht von diesem Fundament getrennt und auf das eine neue Gebot von 13,34f und 15,12ff reduziert werden.
Warum aber nennt Jesus in „erkennbarem Zusammenhang mit der Szene des letzten Mahles und der Fußwaschung … seine Forderung an die Jünger hier eine entolē kainē {ein neues Gebot}“? Auch Thyen weist dazu wie Wengst darauf hin, dass doch
das Gebot ,einander zu lieben‘ aber bereits in der Tora, nämlich in Lev 19,18 mit dem nachdrücklichen Nachsatz ˀani JHWH {ich bin JHWH} (LXX: egō eimi kyrios {ich bin der HERR}) gegeben und dort – ohne daß es die ,FremdIinge‘ ausschlösse (Lev 19,34: hoti prosēlytoi egenēthēte en gē Aigyptō {denn ihr wurdet Fremdlinge im Land Ägypten}) – ebenfalls auf das ,Einander‘ der Glieder des Gottesvolkes Israel bezogen ist…
Obwohl das Wort kainē {neu} „sich im gesamten Evangelium nur hier und in 19,41“ findet, „wo der Erzähler Jesu Grab als ein mnēmeion kainon {neues Grab} bezeichnet und kainon {neu} sogleich durch die Erklärung: en hō oudepō oudeis ēn tetheimenos {in dem noch niemals einer beigesetzt war}, definiert“, kann Thyen zufolge „in solchem oder ähnlichem Sinn, als wäre ein derartiges Gebot niemals zuvor laut geworden, … die Neuheit von Jesu Gebot nicht verstanden werden.“ Mit einem Zitat von Bultmann [404f.] begründet Thyen vielmehr diese Neuheit ähnlich wie Wengst im Blick auf die von Jesus heraufgeführte endzeitliche neue Welt:
Eine kainē {neu} heißt Jesu entolē {Gebot} „nämlich nicht als ein neu entdecktes Kulturideal, das durch Jesus in der Welt proklamiert worden wäre. Das Liebesgebot ist nicht ,neu‘ wegen seiner relativen Neuheit in der Geistesgeschichte. ,Neu‘ in diesem Sinne ist es weder im Blick auf das AT noch im Blick auf die heidnische Antike, in der die Forderung des dienenden Füreinanderseins – wie auch immer motiviert – längst erfaßt ist. Aber ,neu‘ ist das Liebesgebot Jesu auch, wenn es altbekannt ist, sofern es das Gesetz der eschatologischen Gemeinde ist, für die ,neu‘ nicht eine historische Eigentümlichkeit, sondern ein Wesensprädikat ist. ,Neu‘ ist das in der empfangenen Liebe des Offenbarers begründete Liebesgebot als ein Phänomen der neuen Welt, die Jesus heraufgeführt hat; und so wird 1Joh 2,8 seine Neuheit als die des eschatologischen Geschehens beschrieben“.
Auch darauf (T610f.), dass Gott (Jeremia 31,31) mit „der Einschreibung seiner Gebote (nomous mou {meines Gesetzes, meiner Tora}) in die Herzen der Kinder Israels und Judas nicht einen anderen Bund als den vom Sinai und nicht eine andere Tora als die damals gegebene, sondern die eschatologische Erneuerung und neue Inkraftsetzung des von seinem Volk vielfach gebrochenen alten Bundes und der so oft übertretenen Sinaitora verheißt“, beruft sich Thyen wie Wengst, um zu begründen (T611), dass „das Lexem kainē {neu} auch in Joh 13,34 nicht ein geistesgeschichtliches Novum …, sondern die eschatologische Inkraftsetzung des alten Gebots von Lev 19,18 zur Sprache“ bringt. Als „den ältesten und u.E. authentischen Kommentar zu Joh 13,34f“ sieht Thyen daher den Abschnitt 2,7-11 im 1. Johannesbrief, in dem das neue Gebot Jesu als das „entolēn palaian hēn eichete ap‘ archēs {das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt}“, bezeichnet wird, das aber deswegen neu ist, „hoti hē skotia paragetai kai to phōs to alēthinon ēdē phainei {weil die Finsternis vergeht und das wahre Licht schon scheint}“.
An späterer Stelle (T614) ergänzt Thyen, dass Johannes das Gebot Jesu, „einander zu lieben“ auch im intertextuellen Spiel „mit der lukanischen Mahlszene (Lk 22,14ff)“ als neu verstanden haben könnte, denn „in der paulinisch-lukanischen“ Fassung der Abendmahlsworte ist „von dem potērion als der kainē diathēkē en tō haimati mou … {Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut} (Lk 22,20 / 1Kor 11,25)“ die Rede.
Sodann analysiert Thyen unter Berufung auf Augenstein <992> den Gebrauch der Worte entolē/entolai {Gebot/Gebote}, die im Singular und Plural im Johannesevangelium 11mal und in den Johannesbriefen weitere 18mal vorkommen. Der Gebrauch in der Einzahl ist für Johannes typisch, „der sechs mal im Evangelium und zehnmal in 1/2Joh erscheint.“ Dabei ist viermal „das Gebot, das der Vater Jesus gegeben hat“, bezeichnet (10,18; 12,49.50; 14,31), und zweimal das „Gebot an die Jünger, einander zu lieben“ (13,34; 15,12). Die Mehrzahl entolai {Gebote} wird ohne Bezeichnung ihrer Inhalte „nahezu formelhaft mit dem Verbum tērein {halten} verbunden: Joh 14,15.21, 15,10, sowie 1Joh 2,3.4; 3,2224; 5,2f“. Zusammenfassend schreibt Thyen:
Augenstein hat aufgewiesen, daß Joh „das Gebotehalten ähnlich wie das Deuteronomium und die deuteronomistische Literatur verwendet“, wo ein enger Zusammenhang besteht zwischen der erwählenden Liebe Gottes, der Liebe zu Gott (Dtn 6,4f) und dem Halten seiner Gebote. Er schließt daraus: „Im Joh wird die Wendung entolas tērein {Gebote halten} ähnlich wie im Dt, nicht benutzt um das Halten bestimmter, inhaltlich fest umrissener Gebote, sondern den Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zum Ausdruck zu bringen“.
In diesem Zusammenhang unterstreicht Thyen nochmals, dass alle drei Johannesbriefe „unser überliefertes Evangelium voraussetzen und intertextuell mit ihm spielen“ und dass die
mit dem logos hon ēkousate {Wort, das ihr gehört habt}, identifizierte entolē palaia {das alte Gebot} … darum keine andere sein [wird] als das Gebot von Lev 19,17f.34 (s.u. zu 15,12ff). Und palaia {alt} ist hier als ein durchaus positives Prädikat zu begreifen. Die Rabbinen haben die Präexistenz der Tora gelehrt, und dem entspricht es, daß für unseren 1Joh das Gebot der Bruderliebe bereits bei der ersten Mordtat der Menschheitsgeschichte, beim Brudermord Kains, in Kraft ist (3,11f). Wie bereits im Evangelium die Schrift für Jesus und durch sie der Vater für seinen Sohn zeugt, und wie das Evangelium Jesus als den Toratreuen, die Ioudaioi dagegen aber als die Übertreter ihres eigenen Gesetzes darstellt, so ist auch in den Briefen Gottes Gesetz die unumstrittene Basis der Argumentation.
Der Unterschied der Johannesbriefe zum Evangelium, dass dort „von der Bruderliebe“, hier aber „vom Gebot, einander zu lieben, die Rede ist“, liegt nach Thyen wohl daran,
daß Jesu Brüder hier im Unterschied zu seinen Jüngern seine leiblichen Brüder sind (2,12 und 7,2ff), und zum anderen darin, daß hier erst der Auferstandene seine Jünger, die er in 15,14 bereits seine Freunde genannt hatte, zu seinen Brüdern erklärt und macht (20,17). Im übrigen wird das alte neue Gebot von Lev 19,17f.34 durch den Gebrauch des ,Brudernamens‘ gerade nicht auf den Kreis einer ,johanneischen Gemeinde‘ beschränkt.
Nach Augenstein [22ff. und 94ff.] „dient dieser Name“ vielmehr „der Einschärfung der Verantwortung für den Anderen und intensiviert so das Gebot“. Bereits seit Kain, dessen Name in 1. Johannes 3,12 genannt wird, ist, wie Lévinas <993> sagt,
„die Nähe des Nächsten meine Verantwortlichkeit für ihn. Nahen heißt: der Hüter seines Bruders sein. Hüter seines Bruders ist, wer als Leibbürge für ihn eintritt. Hierin besteht die Unmittelbarkeit. Die Verantwortlichkeit rührt nicht von der Brüderlichkeit her, sondern die Brüderlichkeit ist der Name für die Verantwortlichkeit für den anderen, die diesseits meiner Freiheit liegt“. Andererseits ist das Gebot für 1Joh 2,8 ,neu‘ und „in ihm und in euch wahr“ und verwirklicht, weil seit dem Kommen Jesu die Finsternis versinkt und das wahre Licht bereits scheint.
Dass der 1. Johannesbrief „die Neuheit des Gebotes“ daher begründet, dass es auch „en hymin {in euch}“ wahr ist, drückt Thyen zufolge allerdings „wohl mehr den Wunsch des Verfassers als die Wirklichkeit bei den Adressaten aus.“ Da die in 1. Johannes 2,8 verwendeten „Tempora der Verben paragetai und ēdē phainei {vergeht [die Finsternis] und scheint schon [das wahre Licht]} es aus[schließen], hier eine vergangene Epoche der Finsternis von der gegenwärtigen des Lichts zu unterscheiden“, sondern nach Augenstein [103f.] „vielmehr ‚das unabgeschlossene Ineinander beider Bewegungen‘“ bezeichnen, geben sie „damit dem Eschaton {den letzten Dingen} Raum.“ Wie Wengst scheint jedoch auch Thyen nicht wirklich davon überzeugt zu sein, dass dieses Eschaton im Sinne eines Lebens der kommenden Weltzeit des Friedens und der Liebe bereits in der Form angebrochen ist, dass „die Christen“ in einer für die Welt erkennbaren Weise „einander lieben“, wie es in Johannes 13,35 in Aussicht gestellt wird.
Nach Ton Veerkamp <994> ist die wechselseitige Ehrung Gottes mit seinem Messias durch dessen Tod am römischen Kreuz ein „Geschehen“, das „einmalig“ ist, und
der Versuch, es dem Messias nachzumachen, ist eine Illusion: „Wo ich hingehe, könnt ihr nicht kommen“, das hat er zu den Judäern gesagt (7,34), und das muss er auch den Schülern sagen {13,33}. Damit ist die Frage des Simon Petrus {13,36} vorweggenommen und zunächst negativ beantwortet. Positiv wird ihm der Ort gezeigt, wohin er gehen kann und muss. Dieser Ort ist die Solidarität, das neue Gebot. Die Fußwaschung ist das Zeichen des neuen Gebotes.
An dieser Stelle zitiert Veerkamp Rudolf Bultmann [404] und stimmt ihm zu:
„Eine direkt auf Jesus gerichtete Liebe gibt es nicht … eine Liebe, die sich direkt auf Gott richtete, gibt es ja nicht (1 Joh 4,20f.). Jesu Liebe ist nicht persönlicher Liebesaffekt, sondern freimachender Dienst; ihre Erwiderung ist nicht eine mythische oder pietistische Christus-Innigkeit, sondern das allēlous agapan.“
In den Augen von Veerkamp ist es auffällig, dass neben diesem einen Gebot der wechselseitigen menschlichen agapē {Solidarität} bei Johannes nicht einmal das biblische Gebot, Gott zu lieben, seinen Platz behält:
So vordringlich schien diese innere Solidarität einer politischen Untergrundgruppe dem Johannes, dass er, der Judäer, Deuteronomium 6,5 aufhebt: „Du sollst lieben den NAMEN, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Leidenschaft.“ Es heißt, für die rabbinischen Judäer wie für die Messianisten: „Wo ich hingehe, könnt ihr nicht kommen“. Gott – zu ihm geht der Messias – ist den Menschen unzugänglich. Das ist eine Grundeinsicht der Schrift: „Nicht sieht MICH der Mensch und lebt“, Exodus 33,20. Aber die „Liebe“ zu Gott ist nach der Ansicht des rabbinischen Judentums nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine unbedingte Verpflichtung Israels. Bei Johannes gibt es die Solidarität („Liebe“) Gottes und des Messias zu den Menschen, aber nicht umgekehrt. Für die Menschen ist nur die Solidarität untereinander möglich – aber dann ist sie ebenfalls eine unbedingte Pflicht. Solidarität mit („Liebe“ zu) dem Messias ist das Befolgen seines Gebotes, wir werden das eindringlich hören, 15,1ff. So und nur so wird Gott geehrt. Kein Doppelgebot bei Johannes.
Auf die Frage, ob und in welcher Weise sich die Solidarität der Schüler Jesu untereinander tatsächlich später bewährt hat, geht Veerkamp nicht weiter ein. Ihn beschäftigt stattdessen eine andere bohrende Frage:
Die Frage nach der Niederlage des Jahres 70 ist: Wozu noch eine messianische Vision? Denn die vernichtende Niederlage im Jahr 70 bedeutete für viele Messianisten das Ende ihres Messianismus. Für das rabbinische Judentum soll der Messianismus vorerst keine politische Priorität mehr haben. Für die Gruppe um Johannes ist das die eigentliche Herausforderung. Wenn der Messias nicht auf der Tagesordnung steht, was hat diese Gruppe als solche dann noch unter den Kindern Israels zu suchen?
Die Schüler Jesu stellen diese Frage mehrfach in der Form, dass sie wissen wollen, wohin er, der Messias, geht. Jesus wird sich dieser Frage stellen und sie eingehend beantworten.
↑ Johannes 13,36-38: Jesu Gespräch mit Petrus über seine Nachfolge und seine Verleugnung
13,36 Spricht Simon Petrus zu ihm:
Herr, wo gehst du hin?
Jesus antwortete ihm:
Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen;
aber du wirst mir später folgen.
13,37 Petrus spricht zu ihm:
Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen?
Ich will mein Leben für dich lassen.
13,38 Jesus antwortete ihm:
Du willst dein Leben für mich lassen?
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.
[25. Oktober 2022] Die Antwort (W413), die Simon Petrus auf seine in Vers 36 gestellte Frage: „Herr, wohin gehst du?“ von Jesus erhält, versteht Klaus Wengst in der Weise, dass Jesu „Aussage, dass die Schüler Jesus nicht folgen können, … nicht definitiv“ ist; „sie gilt nur für die erzählte Zeit unmittelbar vor Jesu Tod. Danach werden sie ihm folgen.“ Damit (W414) bekommt Petrus im Grunde
dieselbe Antwort wie schon in 13,7. In der dort geschilderten Situation konnte er die Bedeutung der ihm von Jesus erwiesenen Fußwaschung nicht erkennen; er würde es aber „nach all dem“ vermögen. Jetzt kommt es darauf an, dass Jesus seinen Weg zu Ende geht: den Weg in den Tod, mit dem er Gott und Gott ihn verherrlicht. Diesen Weg geht er allein; kein Schüler kann ihn mit ihm gehen. Ist er ihn gegangen, wird es Leben aus der Frucht dieses Todes, wird es „Nachfolge“ geben.
Während „das Wort ‚folgen‘ … bisher im Evangelium in erster Linie die unmittelbare Nachfolge hinter Jesus“ bezeichnete, bekommt es jetzt, „da Jesus weggeht und nachdem er sein Vermächtnis, einander zu lieben, ausgesprochen hat“, eine neue Bedeutung, nämlich dass es den Schülern trotz der Abwesenheit des Messias möglich ist, „dieses Vermächtnis zu verwirklichen“, indem sie sein Gebot erfüllen.
Petrus aber versteht die Antwort Jesu nach Vers 37 so „wenig wie in 13,8“ und fragt:
„Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen?“ Er will schon jetzt mit Jesus gehen und erklärt sich bereit, dafür sehr viel zu wagen: „Mein Leben will ich für dich einsetzen.“ Das erinnert unmittelbar an eigene Aussagen Jesu, der als der gute Hirte sein Leben für die Schafe einsetzt (10,15.17f.). Das ist das Ziel seines Auftrags, den er zu Ende führen wird. Angesichts dessen zeigt das Angebot des Petrus ein geradezu groteskes Unverständnis.
Sehr knapp hebt Wengst sodann die „Hintergründigkeit“ der johanneischen Aufnahme der synoptischen Tradition der Verleugnung durch Petrus hervor: Sie
wird dadurch unterstrichen, dass Jesus die Aussage des Petrus als Frage wiederholt und darauf die Verleugnung ankündigt: „Dein Leben willst du für mich einsetzen? […] Es kräht kein Hahn, bis du mich dreimal verleugnet hast.“ Über diese Situation hatte die Ankündigung späterer Nachfolge in V. 36 schon hinaus gewiesen. Und das ist auch der wesentliche Ertrag der Einleitung dieser Rede, dass es Nachfolge Jesu geben wird, auch wenn er nicht mehr da ist, nämlich in der Erfüllung seines Vermächtnisses, des Gebotes, einander zu lieben.
Auch nach Hartwig Thyen (T613) missversteht Petrus, wie er
sich zuvor den Dienst der Fußwaschung durch seinen Herrn nicht gefallen lassen wollte (13,6ff), so … auch jetzt wieder Jesu Rede von seinem Weggang und überhört förmlich das ,neue Gebot‘, das die Jünger von nun an wechselseitig für einander verantwortlich macht.
Während „zahlreiche Ausleger die V. 34f mit dem ,neuen Gebot‘ als eine sekundäre Einfügung durch den sogenannten ,kichlichen Redaktor‘“ beurteilen, weil die neue Frage des Petrus in Vers 36 „so nahtlos an V. 33 anzuschließen scheint“, macht in den Augen von Thyen „erst das Liebesgebot, das die Jünger statt auf ihren Herrn, der sie verläßt, ganz und gar auf einander verweist, das Mißverständnis des Petrus völlig offenbar“ (T613f.):
Obgleich – auch für Johannes – fortan gilt: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40), meint Petrus immer noch, Jesus in seiner Liebe festhalten zu können. Aber wie er, als Jesus ihm die Füße waschen wollte, noch nicht begreifen konnte, was die Fußwaschung bedeutete, sondern das erst später verstehen sollte (13,7), so kann er, und so können seine Mitjünger, für die er spricht, Jesus jetzt noch nicht nachfolgen. Sie werden ihm freilich später nachfolgen und Petrus wird ihm sogar im qualifizierten Sinne seines Martyriums nachfolgen (vgl. 21,18f). Um das ,Wohin‘ des Weggangs Jesu wissen einstweilen mit dem geliebten Jünger und Erzähler der Geschichte Jesu allein die Leser.
Dass Petrus bereit sein würde, mit dem Schwert für die Freiheit Jesu zu kämpfen und dabei sogar sein Leben für ihn hinzugeben, wird sich bei der Verhaftung Jesu zeigen. Aber dann muss er
sich von Jesus sagen lassen: „Stecke dein Schwert in seine Scheide! Soll ich denn etwa den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gegeben hat?“ (18,11). Fast im Wortlaut nimmt Petrus auf, was Jesu als der gute Hirte gesagt hatte: ho poimēn ho kalos tēn psychēn autou tithēsin hyper tōn probatōn {der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein} (10,11). Doch damit überschätzt er sich bei weitem. Denn allein auf diesem Sterben des guten Hirten für seine Schafe beruht und darin gründet die Neuheit des neuen Gebots. Für Jesus kann Petrus und wird Petrus sein Leben nur vermittelt hingeben, indem er es als Konsequenz des Gebots, einander zu lieben, für seine Brüder hingibt. … Mit der Gegenfrage: „Du willst dein Leben für mich hingeben?“ gibt Jesus Petrus auf zu bedenken, daß die Relation des guten Hirten zu seinen Schafen unumkehrbar ist. „Amen, Amen ich sage dir: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreiınal verleugnen!“
Indem Thyen die zweifache Rede von der Liebe Jesu in 13,1 und 34 sowie „das zweifache Mißverstehen des Petrus in V. 7ff u. 36ff“ als eine absichtsvolle Umschließung des gesamten 13. Kapitels auffasst, sieht er sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass der Abschnitt „13,31-38 nicht der Beginn der sogenannten ersten Abschiedsrede (13,31-14,31) ist, sondern unablösbarer Bestandteil unseres 13. Kapitels, das als Ganzes Jesu Abschiedsrede eröffnet und ihre Themen vorgibt.“
Ton Veerkamp <995> betont zur Antwort Jesu auf die Frage des Petrus in Vers 36 die Unzugänglichkeit des Ortes, wohin der Messias Jesus gehen wird:
Der Messias geht an einen Ort, der für alle, „Juden“ oder „Christen“, unzugänglich ist. Auch Simon Petrus kann ihm nicht folgen, „später wirst du folgen“, ist die enigmatische {rätselhafte} Antwort auf die diesbezügliche Frage Simons. Erst in Kap. 21 wird das deutlicher werden: Simon Petrus wird durch die gleiche Niederlage gehen müssen, durch die auch der Messias geht.
Was Petrus daraufhin Jesus entgegnet, deutet Veerkamp im Sinne einer dem Willen Jesu vollkommen entgegengesetzten messianisch-politischen Strategie:
Simon Petrus beschwört dem Jesus seine Bereitschaft zur messianischen Dschihad, sein Zelotentum, denn das bedeutet tithesthai tēn psychēn, seine Seele einsetzen. Jesus weist das Ansinnen Simons zurück, indem er dessen Verleugnung ankündigt. Denn dieser Ausdruck „Seele einsetzen“ hat zwar eine vertikale Dimension: der Messias als Hirte setzt seine Seele für seine Schafe ein, weil er dazu Vollmacht erhalten hat (10,18). Aus dieser Vertikale ergibt sich für die Schüler aber nur eine Horizontale (vgl. 1 Johannes 3,16), man kann sich für die Brüder einsetzen, aber nicht für den Messias, geschweige denn für Gott.
In diesem Zusammenhang deutet Veerkamp die Verleugnung des Petrus nicht als eine verwerfliche Tat, sondern geradezu als einen Akt der Einsicht, dass weder zelotisch-militärische Abenteuer noch draufgängerische Selbstopferung den Zielen des Messias Jesus entsprechen:
Im Garten jenseits des Baches Kidron wird Simon versuchen, dem Messias auf seine Weise nachzufolgen, mit dem gezogenen Schwert. Im Hof des Großpriesters wird Simon das Naheliegende tun: er wird Jesus verleugnen; er wird begreifen, dass es mit dem gezogenen Schwert nicht geht, er wird endlich und politisch den Messias verstehen.
Der Messias wertet die Verleugnung nicht; er stellt nur fest, dass Simon, im Hof des Großpriesters vor die Wahl gestellt, in diesem Augenblick dem Messias nicht folgen kann. Er wird ihn „verleugnen“ müssen, also das Gegenteil dessen tun, was bei Johannes viermal homologein (zugeben) heißt (1,20 [zweimal]; 9,22; 12,42).
Nach Veerkamp beurteilt der Evangelist Johannes hier die Haltung der führenden Messianisten wie Petrus extrem kritisch im Sinne einer Sympathie für die zelotischen Aufständischen in den Judäischen Kriegen:
Was Simon hier sagt, ist die Aufforderung zu einem neuen heroischen oder zelotischen Abenteuer. „Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Meine Seele werde ich für dich einsetzen“ heißt: „Warum kämpfen wir nicht? Lasst uns für eine neue messianische Weltordnung die Römer bekämpfen.“ Solche Nachfolge wäre der Marsch ins Verderben – und war der Marsch ins Verderben in den Jahren 70 und 135.
↑ Johannes 14,1: Auf Gott und Jesus vertrauen, damit das Herz nicht erschüttert wird
14,1 Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich!
[4. November 2022] „Lasst euch nicht erschrecken!“ So übersetzt Klaus Wengst (W415) Johannes 14,1a, wo wörtlich vom „Herzen“ der Schüler die Rede ist, denn (Anm. 62) gemäß „biblischer Anthropologie bezeichnet ‚Herz‘ nicht den Sitz des Gefühls, sondern vor allem den des Wollens, also das Personenzentrum.“ Indem Jesus nach „dem kurzen Gespräch mit Simon“ jetzt „wieder alle Schüler“ anspricht, geht er darauf ein, dass „durchaus Anlass zu erschrecken“ besteht:
für die Schüler angesichts der bevorstehenden Hinrichtung Jesu und für die Leser- und Hörerschaft in ihrer bedrängten Situation. Erlittene Ohnmacht versetzt in Schrecken. Der Hauptteil der Rede führt aus, warum die Schülerschaft Jesu sich dennoch nicht erschrecken zu lassen braucht. Was sie positiv gegen den Schrecken tun kann, stellt Jesus in der unmittelbar anschließend gegebenen weiteren Aufforderung programmatisch voran: „Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!“
Dazu betont Wengst, dass hier „kein Nebeneinander auf unterschiedliche Personen bezogener Glaubensweisen“ gemeint ist, vielmehr setzt, wer „auf Jesus vertraut, … „auf den in ihm präsenten Gott Israels“, womit Johannes 12,44 aufgenommen wird: „Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich geschickt hat.“ Außerdem verweist Wengst auf „eine biblische Analogie in Ex 14,31. Dort heißt es vom Volk Israel nach der Erfahrung der Rettung am Schilfmeer: ‚Und sie glaubten an den Ewigen und an Mose, seinen Knecht.‘“ Nachdem Israel (W416) „in dem hier erzählten Geschehen ‚die starke Hand‘ Gottes erblickten“, ist für sie der „Glaube an Mose … nichts anderes als der Glaube an den durch ihn handelnden Gott.“
Diese Erfahrung Israels vom rettenden Glauben steht hinter der Aufforderung, nicht zu erschrecken, sondern auf den in Jesus präsenten Gott zu vertrauen. Sie hat sich in dem Bekenntnis verdichtet, dass Gott Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Dieses Bekenntnis bezeugt „die starke Hand“ Gottes, die Jesu Hinrichtung nicht das Letzte sein ließ, was über ihn zu sagen ist. Dass Johannes in dieser Rede Jesus aus österlicher Perspektive sprechen lässt, zeigte sich schon gleich am Beginn in 13,31f. und wird sich noch mehrfach zeigen. Er bezeugt so Israels Gott als im Kreuzestod Jesu in tiefste Erniedrigung mitgehenden und sie überwindenden Gott. An ihm macht sich der Glaube fest; auf ihn wird das Vertrauen gesetzt. Nur deshalb ist die Aufforderung, sich nicht erschrecken zu lassen, angesichts der bedrängenden Erfahrungen kein leeres Wort, sondern hat Grund.
Hartwig Thyen (T616) beschäftigt sich vor seiner Auslegung des ersten Verses von Kapitel 14 nochmals mit der umstrittenen Frage, wo Jesu Abschiedsreden genau beginnen. Einerseits bekräftigt er seine Einschätzung, die Verse 31-38 des Kapitels 13 „nicht von der Mahl- und Fußwaschungsszene“ zu lösen, um sie „als die Eröffnung der sogenannten ,Abschiedsrede‘ (bzw. Abschiedsreden) von Joh 14-17 zu behandeln…, weil zu den unverständigen und zweifelnden Jüngern neben Judas, der Jesus ausliefern sollte, auch Petrus gehört, der ihn dreifach verleugnen sollte.“ Andererseits aber folgt Thyen
jedoch Segovias <996> Behandlung von Joh 13-17 als einer ebenso typischen wie einheitlichen „Farewell Type-Scene“, zu der Joh 13 die Szenerie und den literarischen ,Sitz im Leben‘ liefert. Die Hinzunahme dieses gesamten Kapitels zu der folgenden Abschiedsrede und dem abschließenden Gebet Jesu zum Vater ist um so notwendiger als die Weinstockrede von Joh 15 ebenso als die Reinterpretation von Joh 13 einschließlich des Liebesgebots (V. 34f) verstanden sein will, wie sich Joh 16 als eine in neue Dimensionen vorstoßende Reinterpretation von Joh 14 erweisen wird. Und endlich muß auch Jesu Gebet zum Vater (Joh 17) als die reinterpretierende Klimax des gesamten Aktes (Kap. 13 17) begriffen werden, der Jesu Abschied von seinen Jüngern und dessen Folgen für sie thematisiert.
Dass die eigentliche Abschiedsrede Jesu mit 14,1 eröffnet wird, bekunden einige Handschriften Thyen zufolge dadurch (T617), dass sie „der Mahnung Jesu: ‚Euer Herz erschrecke nicht!‘, die Worte kai eipen tois mathetais autou {und er sagte den Jüngern} voranstellen“, was auch „in der späteren Einteilung des Evangeliums in Kapitel seine Entsprechung“ findet.
Das Verb tarassō {erschrecken},
das jetzt die Gemütsverfassung der Jünger angesichts des bevorstehenden Weggangs Jesu spiegelt, diente zuvor bereits dreimal, nämlich in 11,33; 12,27 und 13,21, der Beschreibung von Gemütsbewegungen Jesu.
Johannes Beutler, <997> demzufolge in diesem „wiederholten Gebrauch des Lexems tarassō ein intertextuelles Spiel mit dem Doppelpsalm 42/43 vorliegt“, betrachtet „nun auch 14,1-14 als einen um diesen Psalm kreisenden Midrasch“. Insbesondere führt er die bei Johannes nur in 14,1 erscheinende Aufforderung: pisteuete eis ton theon {vertraut auf Gott}, auf die im Kehrvers des Psalms (42,6.12; 43,5) dreimal vorkommende „Selbstaufforderung zum Vertrauen auf Gott (elpison epi ton theon {hoffe auf Gott})“ zurück.
Die beiden Glieder des Satzes „mit dem zweifachen pisteuete {glaubt}, das zunächst mit eis ton theon {an Gott} und danach mit eis eme {an mich} verbunden ist“, begreift Thyen im Sinne einer ergänzenden Erläuterung. Das verbindende kai wäre dann „etwa mit das heißt“ wiederzugeben (T618):
Wie der Glaube an Gott den Glauben an Jesus als seinen Gesandten impliziert, so impliziert das Glauben an Jesus den Glauben an den Vater, der ihn gesandt hat [vgl. Segovia 81].
Abwegig erscheinen Thyen die Auslegungen von Fischer und Bultmann. <998> Günter Fischer
begreift das erste pisteuete {ihr glaubt} als Indikativ und paraphrasiert den Satz dann so: „Da ihr an Gott glaubt, d. h. doch nicht zu denen gehört, die sehen und doch nicht sehen (9,39-41), hören und doch nicht hören, sondern vielmehr die Ehre sucht, die vom alleinigen Gott kommt (5,44), so glaubt an mich“. Doch der damit von Fischer bei den Jüngern vorausgesetzte Glaube an Gott, der den Glauben an Jesus gewissermaßen erst ermöglichen soll, wird dem Text u. E. ebensowenig gerecht wie Bultmanns Interpretation des Satzes: „Glaubt ihr an Gott?, Dann glaubt ihr auch an mich; denn an Gott könnt ihr ja nur glauben durch mich!“
Einleuchtend findet Thyen dagegen die Wiedergabe des Textes von Hans-Joachim Iwand, <999> „der in seine Auslegung viel stärker den Kontext mit dem Trostwort Jesu an die wegen seines Weggangs verstörten Jünger einbezieht“:
„Bewährt euren Glauben an Gott an mir! An diesem meinem Weggang und Hingang. Erst dann ist es der durch die Endlichkeit durchbrechende, sich ihr gegenüber kräftig erweisende Glaube. Gott Vater kann nicht von unseren Augen weggenommen werden, ihn hat niemand gesehen, aber durch den Sohn kommt Sehen und Nichtsehen, kommt die Negativität, kommt der Tod als Aufgabe der Bewältigung für den Glauben ins Spiel“.
Ton Veerkamp <1000> übersetzt Johannes 14,1 mit den Worten:
Euer Herz sei nicht erschüttert.
Setzt euer Vertrauen auf GOTT, euer Vertrauen setzt auf mich.
Diese Aufforderung ist ein Wagnis, eine Zumutung. Sie versteht sich keineswegs von selbst. Sie kann und muss erst im Folgenden ausgeführt und begründet werden:
Natürlich sind sie erschüttert. Wie kann man angesichts der Katastrophe des Jahres 70 nicht erschüttert sein? Jesus sagt, er gehe hin, damit die Schüler da sein werden, wo Jesus da sein werde. Deswegen sollen ihre Seelen nicht erschüttert sein, wie die Seele des Messias angesichts des Todes des Freundes erschüttert war, 11,33, und er das vor der Menge zugab, 12,27. Jetzt will er den Psalm 6 nicht beten: „Meine Seele ist erschüttert.“ Vielmehr wird die Niederlage der Wendepunkt sein. Das Kreuz sei seine Erhebung und die Erhebung sei die Wende, er werde so alle zu sich ziehen. So hörten wir es in 12,27-33.
Wie schwer es Jesu Schülern fällt, auf Jesus zu vertrauen, zeigen die drei Einwände, die Thomas, Philippus und der andere Judas gegen diese Zumutung Jesu vorbringen werden.
↑ Johannes 14,2-3: Jesus geht hin, um den Seinen einen Ort auf Dauer zu gründen
14,2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wenn‘s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt:
Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?
14,3 Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten,
will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
auf dass auch ihr seid, wo ich bin.
[5. November 2022] Jesu Mahnung, sich nicht erschüttern zu lassen, sondern auf Gott und ihn selbst zu vertrauen, begründet er Klaus Wengst zufolge (W416), indem er
seinen Weggang in mehreren Aspekten positiv entfaltet. Zunächst verbindet er {in Vers 2} mit ihm das aus seiner jüdischen Tradition bekannte Motiv von den Wohnungen im Haus des Vaters: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Würde ich euch andernfalls sagen: Ich gehe, euch einen Platz zu bereiten?“ Das hat er im bisherigen Evangelium so nicht gesagt, aber der Sache nach ist damit das 12,25f. Ausgeführte aufgenommen.
Bekannt ist (W417) das „Motiv von den himmlischen Wohnungen“ vor allem aus dem äthiopischen Henochbuch. <1001> Dort spricht
der ans „Ende der Himmel“ versetzte Henoch: „Und ich sah dort eine andere Vision: die Wohnungen der Heiligen und die Ruheorte der Gerechten. Hier sahen meine Augen ihre Wohnungen bei den Engeln seiner Gerechtigkeit und ihre Ruheorte bei den Heiligen. […] Und ich sah ihre Wohnungen unter den Fittichen des Herrn der Geister“ (1. Hen 39,4f.7). Der Kontext des Henochbuches zeigt, dass es bei der Vorstellung von den himmlischen Wohnungen nicht um die Illusion eines Wolkenkuckucksheimes geht, sondern um das auf unbedingtem Vertrauen auf Gott gründende Einfordern eines Ortes, an dem die Mächtigen der Erde, die über Leichen gehen, keine Macht mehr haben. Dieses Vertrauen und Einfordern führen zu einer widerständigen Praxis gegen eine ungerechte und gemeine Welt.
Außerdem verweist Wengst auf einen rabbinischen Bericht <1002> „über das Martyrium des Rabbi Chanina ben Teradjon“, in dem erzählt wird,
dass der Präfekt auch die Torarolle verbrennen lässt, aus der der Rabbi gelehrt hat. Er bekommt daraufhin gesagt: „Mein Herr, bilde dir nicht ein, dass du die Tora verbrannt hast. Denn an den Ort, von dem sie ausging, ist sie zurückgekehrt: zum Haus ihres Vaters.“ Dieses „Haus des Vaters“ ist ein unangreifbarer Zufluchtsort für alles, was zu Gott gehört. Dass die Tora einen solchen Ort hat, lässt trotz Verbot an ihr festhalten, sie auslegen und sie praktizieren.
Mit seinem Weggang erhält Jesus diesen Ort und er verspricht seinen Schülern, ihnen an ihm einen Platz zu bereiten. Er tut damit endzeitlich für seine Schüler das, was nach einer rabbinischen Tradition <1003> die sch‘chináh {Einwohnung der Ehre Gottes} für Israel während des Wüstenzuges getan hat: „Entsprechend einem Vortrupp, der seinen Truppen voranzog und ihnen einen Ort bereitete, an dem sie lagerten, so zog Gott in seiner Gegenwart Israel voran und bereitete ihnen einen Ort, an dem sie lagerten.“
Obwohl nicht alle Traditionen, auf die sich Wengst beruft, an einen Ort denken lassen, der im Himmel zu finden ist, sieht er in seiner Auslegung von Vers 3 den Blick Jesu „weiterhin auf die himmlische ‚Bleibe‘“ gerichtet, die dieser seinen Schülern ausdrücklich zusichert:
„Und wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen.“ Johannes nimmt hier die Erwartung seiner Tradition vom endgültigen rettenden Kommen Jesu auf. Er verwirft sie nicht. Sie ist eine Dimension auch seiner Hoffnung. Mit der Folge, die das Kommen Jesu hat, setzt er jedoch zugleich einen neuen Akzent: „sodass, wo ich bin, auch ihr seid“. Das erinnert an 12,26, wo Jesus von der Nachfolge als dem Ort seiner Gegenwart gesprochen hat. Die Gegenwart ist für seine Schülerschaft kein bloßer Wartestand. Das wird die Fortsetzung der Rede deutlich machen, in der anschließend nicht zufällig die Metapher des Weges eine Rolle Spielt. Das „Bleiben“ vollzieht sich im Gehen eines bestimmten Weges.
Auch Hartwig Thyen (T618) sieht Jesus „am Ende seines Erdenweges“ gleichsam unterwegs zum „himmlischen Heiligtum“, das er in Vers 2 das „Haus seines Vaters mit seinen vielen Wohnungen“ nennt und das in enger Beziehung zu „dessen irdischem Abbild, dem Tempel Jerusalems“, steht, denn in „der Erzählung von der Tempelreinigung, hatte er zuvor bereits den Jerusalemer Tempel das ‚Haus seines Vaters‘ genannt (2,16) und sein Tun hatte seine Jünger daran erinnert, daß geschrieben steht: ‚Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren‘ (Ps 69,10; s. o. Zu 2,17).“ Auch zu diesem Vers erblickt Thyen in Psalm 43,3 eine Parallele, wo sich der Beter, fern „von Gottes Heiligtum“, nach den skēnōmata {der Wohnung, wörtlich: den Zelten} Gottes sehnt:
Das im NT nur hier und in Joh 14,23 vorkommende und in der LXX einzig in 1Makk 7,38 erscheinende Lexem monē {Bleibe}, das Joh hier anstelle der skēnōmata des Psalms benutzt, muß hier wohl als ad-hoc-Substantivierung des Verbums menein {bleiben} begriffen werden, das in unserem Evangelium vierzigmal erscheint …
Mit einem Zitat von E. Fuchs <1004> bestimmt Thyen das, was Johannes mit dem Wort monē bezeichnet, noch einmal anders als räumlich auf den Himmel bezogen (T619):
„Das johanneische Bleiben hebt in die Liebe. Sie ist der wahre Raum und die ewige Zeit, das der Welt verkündigte Dasein Gottes in unserer Existenz. Was Bultmann das eschatologische Ereignis nennt, das erschließt sich bei Johannes als der Raum, von dem das Wort sagt, daß Gott in uns bleibt und wir in ihm“.
Die zweite Hälfte von Vers 2 übersetzt Thyen in der üblichen Weise: „Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, daß ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten?“, auch wenn „Jesus seinen Jüngern dergleichen – zumindest wörtlich – bisher noch gar nicht gesagt“ hat.
Doch der Sache nach hat er ihnen das durchaus bereits gesagt: „Wenn einer mir dienen wird, dann wird er mir nachfolgen, und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein“ (12,26) und: „Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen“ (12,32).
Ausführlicher als Wengst beschäftigt sich Thyen zu Vers 3 (T620) mit der umstrittenen Bedeutung der neuen „Information, die dieser Vers bietet…, daß Jesus jetzt erklärt, nachdem er hingegangen sei und seinen Jüngern ihren Platz bereitet habe, werde er wiederkommen und sie zu sich nehmen“:
Wenn Jesus hier dem intimen Kreis seiner um ihn versammelten Jünger verheißt, daß er wiederkommen und sie zu sich nehmen werde, damit sie da, wo er ist, ihre ewige Bleibe finden, so darf man diese Verheißung trotz ihrer fraglos apokalyptischen Metaphorik keinesfalls unmittelbar oder gar ausschließlich auf seine endzeitliche Parusie {Wiederkunft} und das Gericht über Lebende und Tote beziehen.
Zur Begründung weist Thyen zunächst darauf hin, dass „die Parusie des Menschensohnes in der urchristlichen Tradition ein Vorgang vor der Öffentlichkeit des Kosmos“ ist. Der johanneische Jesus spricht hier aber von einem Wiederkommen, das gerade dem Kosmos nach Johannes 14,18-19 verborgen bleibt. Außerdem fügt er folgendes Argument hinzu:
Zudem müßte man dann für die meisten der hier Angeredeten zwischen ihrem Martyrium oder ihrem natürlichen Sterben und jener noch ausstehenden Parusie einen Zwischenzustand konstruieren und die monai nicht als Orte des ewigen Bleibens, sondern als bloß vorläufige Asyle begreifen. Doch von einem derartigen Zwischenzustand weiß Johannes nichts. Für ihn gilt vielmehr, daß jeder, der an Jesus glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt, und daß jeder, der lebt und an ihn glaubt, in Ewigkeit nicht sterben wird (11,25f; vgl. 5,24f). Das berechtigt freilich nicht dazu, Jesu vierfach wiederholte Verheißung, am Jüngsten Tage werde er jeden, den der Vater ihm ,gegeben‘ oder ,zu ihm gezogen hat‘, auferwecken (6,39 f.44.54; vgl. 3,36; 5,28f) als eine mit der vermeintlich rein präsentischen Eschatologie unseres Evangeliums unvereinbare Glosse einer ,kirchlichen Redaktion‘ auszuscheiden. Ausscheiden muß man vielmehr alle Versuche, den auferstandenen Jesus unserem landläufigen Verständnis der Zeit und ihrem kalendarischen Diktat zu unterwerfen.
Um diesen Gedankengang zu untermauern, beruft sich Thyen erneut auf Friedrich-Wilhelm Marquardt, <1005> der sehr betont davon spricht, dass Gott
durch die österliche „Befreiung Jesu von der Macht des Todes“ … zugleich „das zerstörerische Wesen der Ungleichzeitigkeit“ beseitigt und Jesus das „unter der Herrschaft der Todes-Endgültigkeit“ undurchdringliche Tor zwischen den ,Gezeiten‘ der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft „sperrangelweit geöffnet“ [hat].
Für Thyen sind daher im Sinne des Johannes „alle Konstruktionen von ‚Zwischenzuständen‘ ebenso wie die Rede von einer die Synoptiker vermeintlich bedrängenden ‚Verzögerung der Parusie‘ törichte Mißverständnisse“, zumal Neugebauer <1006>
im Blick auf die jüdischen Apokalypsen und zumal auf die Testamenten-Literatur darauf aufmerksam macht, daß „die Kombination unterschiedlicher eschatologischer Konzepte in einer Schrift … nichts Besonderes“ sei…
Auch auf Barrett <1007> beruft sich Thyen zustimmend (T620). Dieser
sieht das palin erchomai {ich komme wieder} „auf das eschatologische Kommen Jesu oder jedenfalls auf sein Kommen zu dem einzelnen Jünger bei dessen Tod“ bezogen und fügt dem treffend hinzu: „Aber die anschließende Rede, in der das Thema des ,Gehens und Kommens‘ ständig wiederholt wird, zeigt deutlich, daß das Denken des Joh über das Kommen Jesu sich keineswegs in der älteren, synoptischen Vorstellung der Parusie erschöpft. Die Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern, ihre wechselseitige Einwohnung (monē – menein {Bleibe – bleiben}) wird nicht bis zum Jüngsten Tag oder auch bis zum Todestag eines Jüngers aufgeschoben“. Daß sich Jesu Rede von seinem Gehen und Kommen nicht in der synoptischen Parusievorstellung „erschöpft“, erscheint uns als eine glückliche Formulierung, da so der Gedanke der Parusie mit seinen kosmischen und universalen Implikationen nicht bestritten, sondern im Blick auf die unzerstörbare Gemeinschaft Jesu mit den Seinen vertieft wird.
Schließlich zieht Thyen Erwägungen von Dodd <1008> in Betracht, „der in Joh 14,2f ‚die engste Annäherung an die traditionelle Sprache der kirchlichen Eschatologie“ sieht:
„Nun ist es sicherlich klar, dass die ‚Wiederkunft‘ Christi in einem anderen Sinne zu verstehen ist als in der gängigen christlichen Eschatologie. Sie besteht darin, daß nach und wegen des Todes Jesu seine Nachfolger in die Vereinigung mit ihm als ihrem lebendigen Herrn und durch ihn mit dem Vater eintreten und so in das ewige Leben eingehen werden. Das ist es, was er meinte, als er sagte: ‚Ich komme wieder und nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin.‘ (vgl. auch 17,24)“. Doch wenn der Auferstandene seinen Jüngern bei Mt verheißt: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (28,20), ohne daß der Evangelist die traditionelle Erwartung der weltöffentlichen Parusie Jesu deshalb preisgegeben hätte, ist die Differenz zur „gängigen christlichen Eschatologie“ wohl doch nicht so groß, wie sie oft dargestellt wird.
Besonders interessant finde ich Thyens weiteren Hinweis auf Barrett [445f.], der „mit guten Gründen davon“ spricht,
daß die johanneische Eschatologie zwar modifiziert, jedoch „nicht so sehr ,realisiert‘, als vielmehr individualisiert“ sei. „Denn Jesus kommt zu dem Glaubenden wahrscheinlich bei seinem Tod, um ihn in die himmlische Wohnung aufzunehmen. Ob man dies nun (wie Bultmann es tut) als gnostische Eschatologie beschreiben sollte, ist nicht klar; jüdische Eschatologie erfuhr eine ähnliche Transformation nach 70 n. Chr. … Martyn <1009> sagt, Johannes modifiziere die Hoffnung auf eine Heimat im Himmel (14,2) in die Realität einer Heimat auf Erden (V. 23); Joh scheint aber doch eher beide Vorstellungen nebeneinander beizubehalten“.
Vor diesem Hintergrund ist nun doch zu fragen, ob Johannes tatsächlich die jüdische endzeitliche Erwartung des Lebens der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker auf Erden unter dem Himmel Gottes individualisiert und verjenseitigt hat.
Für Thyen scheint außer Frage zu stehen, dass es hier um das himmlische ewige Leben jedes Christen geht. Allerdings zeigt in seinen Augen der „chiastische {Anordnung über Kreuz} Aufruf pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete {wörtlich: glaubt an Gott und an mich glaubt} (14,1)“ (T621f.),
daß das ,in Christus‘ bereits eröffnete ,ewige Leben‘ kein sicherer Besitz ist, sondern allen Anfechtungen und Anläufen des ,Fürsten dieser Welt‘ gegenüber ständig in Glaube, Hoffnung und Liebe bewährt werden muß. Auch für das Evangelium muß deshalb gelten, was 1Joh 3,2 so expliziert: „Geliebte, schon jetzt sind wir Gottes Kinder. Doch noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, daß wir ihm dann gleich sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist“. Dieser Satz liest sich geradezu wie ein Kommentar zu Joh 14,2f…
Ton Veerkamp <1010> distanziert sich anders als Wengst und Thyen von der in der christlichen Kirche schon sehr früh selbstverständlich gewordenen Auffassung, dass Johannes 14,2-3 auf ein himmlisches Jenseits zu beziehen sei:
Jetzt geht Jesus ins Detail: er wird „einen Ort gründen“. Schon sehr bald wurden diese Worte dahingehend verstanden, dass Jesus jenseits dieser Erde und dieses Lebens einen bleibenden Wohnort für die einrichten wird, die an ihn glauben. Das ist eine Vertröstung auf ein Jenseits, das Johannes gar nicht kannte. Dennoch rückt bei ihm die real-irdische Perspektive der zōē aiōnios, des Lebens der kommenden Weltzeit, in weite Ferne. Zwar ist „Himmel“ bei Johannes der Bereich, aus dem der bar enosch, der MENSCH, stammt und in den er zurückkehrt, aber nirgends ist bei ihm der Himmel eine Perspektive für Menschen. Wir können den Text nicht verstehen, wenn wir uns von einer verbreiteten (früh-)christlichen Verjenseitigung leiten lassen. Jesus macht sich für die Schüler nicht auf himmlische Wohnungssuche. Die monē ist ein dauerhafter Aufenthalt auf Erden, „Aufenthalt für viele“. Das Haus des VATERS ist nicht der Himmel.
So selbstverständlich, wie Thyen die Jenseitigkeit des von Jesus gegründeten Ortes voraussetzt, so kategorisch wird diese also von Veerkamp bestritten. Aber kann er das auch begründen? Immerhin verweist er selbst am Rande (Anm. 429) auf „eine lebhafte Debatte“, die es „nicht nur im rabbinischen Judentum, sondern auch in Kreisen, die die apokalyptische Literatur geschaffen haben“, darüber gab, „was mit den Gerechten geschieht, nachdem sie gestorben sind und bevor die kommende Weltzeit eintritt“. Zwar erwähnt er nur, dass für diese Zwischenzeit „der gan ˁeden, also der Garten Eden, als vorübergehender Ort“ angegeben wird, aber nach Wengst gab es ja auch jüdische Traditionen, vor allem in 1. Henoch 39, die von Wohnungen der Gerechten im Himmel erzählen. Genau das Letztere geschieht im Johannesevangelium jedoch an keiner Stelle. Nirgends wird ein Blick in den Himmel geworfen, an keiner Stelle werden Stationen einer Himmelsreise Jesu beschrieben, in Johannes 20,17 stellt Jesus sogar den Prozess seines Aufsteigens zum VATER ausdrücklich als „noch nicht“ abgeschlossen dar.
Schauen wir einmal genau an, wie Ton Veerkamp die Verse 14,2-3 übersetzt:
14,2 Im Haus meines VATERS ist für viele ein Ort von Dauer.
Wenn nicht, hätte ich es euch gesagt,
denn ich gehe ja hin, euch einen Ort zu gründen.
14,3 Und wenn ich gegangen bin und euch einen Ort gegründet habe,
wiederum komme ich, um euch anzunehmen zu mir selbst,
damit auch ihr seid, wo ICH BIN.
Zum Ausdruck monai pollai {wörtlich: viele „Bleiben“} in Vers 2 schreibt Veerkamp (Anm. 425):
Monai, der Plural von „Bleibe“, ist schwierig. In der LXX gibt es das Wort nicht (außer 1 Makkabäer 7,38, wo es wohl maqom bedeutet). Wir haben in der Anm. zu 1,32 über das Verb menein gesagt, es habe als Hintergrund ˁamad oder qum. Freilich steht in der nächsten Zeile topos, maqom. Monē zeigt den Aspekt der Dauer, ein dauerhafter Ort. „Bleibe“ hat aber in der Gegenwartssprache die Bedeutung von „Dach überm Kopf“. Wir müssen diesen ganz bestimmten maqom umschreiben: „für viele ein Ort von Dauer“.
Wenn monē also gleichbedeutend mit topos oder maqom, „Ort“, verwendet wird, wie ist dann der Ausdruck hetoimasai topon hymin {euch einen Ort zu bereiten}, zu begreifen? Veerkamp versteht ihn auf dem Hintergrund biblischer Stellen, die von dem Ort handeln, wo Gott seinen befreienden NAMEN wohnen lässt (Anm. 426):
In 1 Chronik 15,1 ist die Rede davon, dass David dem Bundesschrein einen Ort begründet oder stiftet (hebräisch wa-jakhun maqom, griechisch hētoimasen ton topon). Auf alle Fälle ist topos in diesem Zusammenhang nicht irgendein beliebiger Ort, sondern der Ort überhaupt, das Haus Gottes (des VATERS), pars pro toto Jerusalem bzw. Land Israel (vgl. Genesis 13,14, wo das Land, das Gott dem Abraham zeigt, maqom, „Ort“, genannt wird. Das Haus Gottes (der Ort, maqom, den Gott erwählt, dort SEINEN NAMEN wohnen zu lassen, Deuteronomium 12,11 usw.) ist der einzige Ort für jenes Israel, das dem Messias vertraut. Der Messias gründet einen Ort, der anders als das Haus Gottes in Jerusalem ein Ort von Dauer (monē) sein wird, ein Ort, der nicht zerstört wird. Der Himmel ist damit ganz sicher nicht gemeint, eher die messianische Gemeinde selbst.
Soweit die auf seine Übersetzung bezogenen Anmerkungen Veerkamps aus dem Jahr 2015. Bereits in seiner Auslegung im Jahr 2007 begreift er den von Jesus gegründeten Ort bei Johannes in einer ähnlichen Weise, wie in den paulinischen Schriften von der messianischen Gemeinde als dem Leib Christi die Rede ist:
Bei Johannes, überhaupt in der ganzen Schrift, beherbergt nicht der Himmel, sondern die Erde den kommenden Ort (vgl. Psalm 115,16).
Im Gespräch mit der samaritanischen Frau war die Rede von der Zeit, wo man sich „dem VATER (NAMEN) inspiriert und in Treue verneigt“ (4,23), aber nicht vom Ort, oder eher vom Nicht-Ort: weder in Jerusalem noch auf diesem Berg (Gerizim).
Hier ist aber vom Ort die Rede und nicht von der Zeit. Im Gespräch nach der Vertreibung der Kaufleute und Geldwechsler aus dem Heiligtum ist vom Abriss des Heiligtums und von seiner Errichtung nach drei Tagen die Rede (2,19), aber Johannes sagt ausdrücklich, damit meine Jesus das Heiligtum seines Körpers. Der Ort, ho topos, ha-maqom, ist das Heiligtum. Für Johannes ist der Ort das Heiligtum, das nach drei Tagen errichtet wird, der Körper des Messias (sōma Christou, vgl. Epheser 4,12), die messianische Gemeinde.
Besonders schwierig und der Auslegung bedürftig schätzt Veerkamp die Wendung palin erchomai kai paralēmpsomai hymas pros emauton ein, die er folgendermaßen übersetzt:
„Wiederum komme ich, um euch aufzunehmen zu mir selbst.“ Die Aussage dieses Satzes wird bestimmt durch den folgenden Finalsatz: „damit auch ihr seid, wo ich bin“. Bei Matthäus ist die Sache klar: Der bar enosch, MENSCH, kommt auf den Wolken des Himmels, um die Lebenden und die Toten zu richten, die Freigesprochenen kommen „in das Königreich, für sie bereitet, basileian hētoimasmenēn“, 25,34. Johannes sagt etwas anderes. Bei ihm wird auch etwas „bereitet“ (hetoimazein), statt des Königreichs ist es bei Johannes der Ort. Es gibt bei ihm kein finales Gerichtsverfahren. Wer dem Messias Jesus nicht vertraut, ist bereits verurteilt, er ist verloren, er hat keinerlei Perspektive mehr. Für so einen Menschen kommt nur das, was ohnehin schon ist: die Todesordnung Roms.
Aber was konkret meint Johannes, der an anderen Stellen die Vorstellung vom Königreich Gottes durch das Leben der kommenden Weltzeit ersetzt, mit dem Ort, den Jesus für diejenigen gründet, die auf ihn vertrauen?
Der Ort ist ohne Zweifel jene Synagoge, in die Jesus ganz Israel zusammenführen wird. Das ist der Ort Jesu, dort werden die Schüler sein.
Aber es bleibt „eine Spannung zwischen hingehen und wiederum kommen. Diese Spannung wird in 20,17 verschärft durch das Wort noch nicht.“ Das heißt: Jesu Hingehen in seinen Tod, sein Aufsteigen zum VATER mündet nicht einfach in einen nahtlosen Übergang zu einem Weiterleben Jesu im Himmel, an dem später auch alle anderen im Glauben an Jesus Verstorbenen teilhaben werden. Erst recht (Anm. 427) geht Jesus
nicht in den Himmel, um wiederzukommen, sondern er geht den Weg, den er gehen muss, den Weg in seinen Tod; er kommt am Tag eins der Schabbatwoche (20,19), um den Schülern die Inspiration der Heiligung einzuhauchen. Dann ist der Ort gegründet, wo Jesus und seine Schüler sind, die messianische Gemeinde.
Damit besteht Veerkamp – wie schon in seiner Auslegung von Johannes 10,17-18 – darauf, das Wort palin nicht generell mit „wieder“ zu übersetzen, sondern hier im Sinne einer Steigerung (oder später in 16,16ff. gar Entgegensetzung) zu verstehen.
Letzten Endes besteht die unauflösbare Spannung darin, dass Jesu Aufstieg zum VATER erst dann vollendet ist, wenn das Leben der kommenden Weltzeit tatsächlich angebrochen ist – was bis heute nicht der Fall ist. Aber das kann nach Johannes nur geschehen, wenn die messianische Gemeinde, in der durch „die Inspiration der Heiligung“ (wie Veerkamp den Heiligen Geist umschreibt) die von Jesus gebotene agapē, „Solidarität“, in die Tat umgesetzt wird, eine Art Platzhalter für die Sammlung ganz Israels darstellt. Mit dem „Kommen“ Jesu muss also mehr gemeint sein als „nur die Errichtung des Körpers des Messias, der messianischen Gemeinde“:
Durch das Wörtchen vielmehr (palin) bleibt eine offene Stelle. Vielmehr hört ein Jude im Wort Ort das politisch-irdische Zentrum Israels. Das Kommen des Messias hat die Zusammenführung der auseinandergesprengten Gottgeborenen als Ziel (11,52), und dafür ist ein irdischer Ort nötig. Die messianische Gemeinde ist unter den realen römischen Verhältnissen der einstweilige Ort. Die messianische Gemeinde hält für Israel die irdische, ortsgebundene Zukunft des Messias offen. Wir werden bei der Besprechung von 21,22 noch einmal auf dieses Kommen eingehen müssen.
Bedenkt man, dass schon bald die messianische Gemeinde zu einer christlichen Kirche mutiert, die sich als ein neues oder als das wahre Israel <1011> versteht, und zwar im Gegensatz zum realen jüdischen Volk Israel, dann muss man wohl von einem geradezu tragischen Scheitern der johanneischen Vision eines „Ortes auf Dauer“ sprechen, den Jesus seinem Volk Israel gründen wollte. Man mag es dennoch für segensreich halten, dass durch die christliche Kirche die Kunde vom Gott Israels auch in die Völkerwelt hinausgetragen wurde, aber es bleibt doch zu beklagen, welchen Verrat diese Kirche an ihren jüdischen Geschwistern begangen hat und wie weit sie sich von ihren jüdisch-messianischen Wurzeln entfernt hat. Ob wir Christen uns heute von Johannes belehren lassen könnten, dass Jesus seinen Nachfolgern nicht einfach einen Platz im Himmel verspricht, sondern dass diejenigen, die auf ihn vertrauen, schon hier auf Erden einen „Vortrupp des Lebens“ <1012> darstellen, dem daran gelegen ist, dass die Todesordnungen dieser Welt überwunden werden?
↑ Johannes 14,4-7: In Jesus als Weg, Treue und Leben ist der VATER zu erkennen
14,4 Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg.
14,5 Spricht zu ihm Thomas:
Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst;
wie können wir den Weg wissen?
14,6 Jesus spricht zu ihm:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
14,7 Wenn ihr mich erkannt habt,
so werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
[6. November 2022] Bevor Klaus Wengst (W417) an die Verse 4 und 5 herangeht, fasst er nochmals die Auslegung der Verse 2 und 3 zusammen: „Die Schüler sollen also da sein, wo Jesus ist. Das ist das Ziel.“ In Vers 4 wiederholt Jesus jedoch, dass er weggeht (W417f.):
Wie können da die Schüler bei ihm sein? Jesus sagt: „Und wohin ich gehe, kennt ihr den Weg.“ Das ist nach dem Zusammenhang der Weg, den sie selbst zu gehen haben, wollen sie in der Situation des erfolgten Weggangs Jesu da sein, wo er ist. Von diesem Weg sagt Jesus, dass die Schüler ihn kennen. Es ist der Weg der Nachfolge (12,26), der in der Erfüllung seines Vermächtnisses (13,34f.) zu gehen ist. Das alles wurde den Schülern schon gesagt.
Das können diese (W418) im Gegensatz zur „Leser- und Hörerschaft“ aber noch nicht verstehen, weil ihnen die „Ostererfahrung“ noch fehlt. Daher tritt in Vers 5 der Schüler Thomas auf
und gibt ihrem Unverständnis Ausdruck: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen?“ Jesus geht in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert. Das wissen die Schüler vor Ostern ebenso wenig, wie sie den Weg kennen, der sich daraus für sie ergibt.
Dass die Schüler auch die in Vers 6 und 7 erfolgende Antwort Jesu nicht verstehen werden, während „die Leser- und Hörerschaft“ dazu selbstverständlich in der Lage sein soll, stellt Wengst bereits vor der Auslegung von Vers 6 fest:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ Der sich hier selbst zunächst als „Weg“ bezeichnet, tut das in der dargestellten Situation als jemand, der dabei ist, einen ganz bestimmten Weg zu gehen – einen Weg, der ins Leiden, in die tiefste Erniedrigung am Kreuz führt. Indem er diesen Weg nicht „allein“ geht, sondern Gott mit ihm ist (8,16.29), macht er ihn als Erweis von Gottes sich hingebender Liebe kenntlich (3,16). So ist er der Weg als derjenige, der im Blick darauf als sein Vermächtnis das Gebot gegeben hat, einander zu lieben. Diesen Weg nehmen wahr, die ihm nachfolgen, indem sie sein Vermächtnis halten.
Dass Jesus sich zugleich auch als „die Wahrheit“ bezeichnet, stimmt nach Wengst nur „wenn und weil es gilt, dass Gott diesen Weg mitgeht“. Durch „ihn und mit ihm“ handelt
der in der Bibel bezeugte wirkliche Gott …, der den Weg nach unten geht. In der Solidarität mit den Leidenden und Bedrängten erweist der wirkliche Gott seine Wahrheit. Wahrheit ist hier nicht als etwas ein für alle Mal Feststehendes verstanden, eine unvergängliche Wesenheit, die hinter den Phänomenen der Wirklichkeit zu entbergen wäre. Als Wahrheit gilt vielmehr das, was sich unterwegs bewährt, was sich auf dem Weg bewahrheitet. In der Bibel wird Gott als der mitgehende Gott erfahren, auf den man sich verlassen kann; und so schließt die Wahrheit seiner Wirklichkeit auch seine Treue, seine Verlässlichkeit, ein.
Als treffendes Beispiel dafür, dass Gottes Wahrheit in der Treue zu seinem Volk besteht, führt Wengst Psalm 117,2 an, wo es heißt: „Machtvoll über uns ist Gottes Freundlichkeit“ und dann parallel fortgefahren wird: „[…] und die Wahrheit (emét) des Ewigen gilt für alle Zeit“. Damit ist
nicht eine zeitlose Wahrheit gemeint, sondern Gottes nicht endende Verlässlichkeit, seine beständige Treue als sein Mitgehen mit seinem Volk in der Zeit. Nach dem Johannesevangelium zeigt Gott diese mitgehende Treue gerade auch am Kreuz Jesu. Und deshalb gilt an dieser Stelle schließlich das Dritte: „Ich bin das Leben.“ Das sagt derjenige, der in den Tod geht. So kann dieses Leben nur ausgesagt werden als Gottes Protest gegen den Tod, als Überwindung des Todes, als Auferweckung.
Als Hintergrund dafür zieht Wengst (Anm. 70) auch Psalm 16,11 in Betracht sowie den gesamten Psalm 86. Dort ist in Vers 11 von Weg und Wahrheit und ab Vers 13 von der Errettung des Lebens aus der Tiefe des Todes die Rede.
Von daher kann Wengst zufolge (W419) Jesu Selbstaussage über Weg, Wahrheit und Leben nicht „anders wahrgenommen werden als im Kontext des Aufstandes, des Protestes, der Verweigerung gegenüber aller Todeswirklichkeit“. Dabei ist
die Reihenfolge zu beachten. Am Anfang steht „der Weg“. Ein Weg ist zu gehen: der von Jesus als dem Beauftragten Gottes gewiesene und sich an Jesus orientierende Weg. Jesus verheißt, dass dieser Weg sich bewähren, sich als verlässlich erweisen wird. Was in dieser Weise „wahr“ ist, lässt wirklich leben. Und zum Leben gehört immer auch „das Leben der anderen“, nicht nur das eigene und das der eigenen Gemeinschaft. Wahrheit hat demnach nicht zuletzt ihr Kriterium im Leben der anderen.
Die Auslegung von Vers 6b leitet Wengst mit einem Zitat von Thomas Brodie <1013> ein:
„Gerade weil dieser Weg ziemlich erschreckend ist, könnte der Leser wünschen, einen anderen zu finden. Und so fügt Jesus, gleichsam als Antwort, hinzu: ,Niemand kommt zum Vater außer durch mich.‘
So verwahrt sich Wengst dagegen (Anm. 72), die Aussage Jesu „als Zeugnis eines absoluten und exklusiven Anspruchs“ zu verstehen, wozu auch Brodie betont:
„Der hier betonte Gegensatz bezieht sich nicht auf andere Religionen, sondern auf jeden Ansatz, der das umgeht, was Jesus repräsentiert, nämlich die Betonung des Menschlichen. Während Thomas und Philippus etwas mehr Ätherisches wünschen, ist der Weg dieser Jesus, der bald sterben muss.“
Nach Wengst ist entscheidend (W419),
dass Jesus diese Aussage gegenüber seinen verunsicherten Schülern macht, nicht gegenüber Außenstehenden. In diesem Gegenüber dient die doppelte Verneinung {wörtlich: „niemand kommt… wenn nicht…“} als unbedingte Vergewisserung. Mit den Schülern wird der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde versichert, dass dieser Weg, auf den sie sich in der Nachfolge Jesu eingelassen hat, kein Abweg ist, der in die Irre führte und anderen Göttern dienen ließe. Es ist vielmehr ein Weg, auf dem man ganz bestimmt „zum Vater“ kommt. Das ist die Verheißung, die hier gegeben wird. Demnach geht es nicht um Abgrenzung.
Dennoch ist es Wengst natürlich bewusst, dass üblicherweise „Joh 14,6 als Ausdruck eines Exklusivitätsanspruches gelesen“ wird. Er führt dazu beispielhaft Udo Schnelle und Rainer Hirsch-Luipold <1014> an. Der Letztere betont wiederholt, „dass Gott nur in Jesus erkannt werden könne“, während es bei Schnelle heißt:
„Der Evangelist bindet das Verständnis Gottes exklusiv an die Person Jesu; wer Gott ist, kann nur an Jesus abgelesen werden. Damit formuliert Johannes einen nicht mehr zu überbietenden Exklusivitätsanspruch“.
Auf diese Weise ignorieren beide die auch im Johannesevangelium „immer wieder vorausgesetzte Bekanntheit Gottes in Israel“.
In diesem Zusammenhang erinnert Wengst an den jüdischen Religionsphilosophen Franz Rosenzweig <1015> (1886-1929), der zu Johannes 14,6
am 1.11.1913 an seinen christlich getauften Vetter Rudolf Ehrenberg (1884-1969) [schreibt]: „Was Christus und seine Kirche in der Welt bedeuten, darüber sind wir einig: es kommt niemand zum Vater denn durch ihn. Es kommt niemand zum Vater – anders aber, wenn einer nicht mehr zum Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes Israel (nicht des einzelnen Juden)“. Rosenzweig konnte es respektieren, dass Ehrenberg durch Jesus den Weg zum Vater gefunden hat. Können wir es respektieren, dass Rosenzweig – mit seinem Volk – beim Vater geblieben ist?
In Vers 7 entfaltet Johannes (W420) anschließend noch einmal ausdrücklich, dass „Gott der mit Jesus in den Tod am Kreuz mitgehende Gott ist“. Nur wer den durch Jesus „und an ihm handelnden Gott“ erkennt, erkennt Jesus wirklich:
„Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen.“ … Die Fortsetzung spitzt zu: „Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihr ihn gesehen. „Von jetzt an heißt: von Beginn der 13,1 genannten „Stunde“ an, die die Stunde der Passion und des Todes Jesu ist. „Von jetzt an“ tut Jesus keine Wunder mehr, sondern geht den Weg ans Kreuz. Gerade im Blick darauf wird Erkennen und Sehen Gottes ausgesagt, der hier präsent ist. Aber er ist es ja zugleich in der Verborgenheit des Kreuzes. Das Wahrnehmen Gottes im Kreuz Jesu ist ein höchst paradoxes „Sehen“ gegen den Augenschein.
In den Augen von Hartwig Thyen (T622) macht sich nach Jesu Aussage in Vers 4: „Und wohin ich gehe, dahin kennt ihr ja den Weg“, nicht zufällig „nun ausgerechnet Thomas zum Sprecher der Jünger … und erwidert: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollten wir da den Weg kennen?“
Denn zum einen offenbart dieser Einwand den ironischen Unterton von Jesu vorausgegangenem Wort und zeigt, daß die Jünger, was sie längst wissen sollten, faktisch noch lange nicht begriffen haben. Und zum anderen soll der Leser wohl erinnern, daß es ja Thomas war, der, wenn auch mit einem resignierten Unterton, beim Aufbruch Jesu nach Bethanien zum Grab des Freundes Lazarus seine Mitjünger aufgefordert hatte: „Dann laßt auch uns gehen, daß wir mit ihm sterben“ (11,16). Er hat also zumindest damals bereits geahnt, was da auf sie zukommen würde. Und auch, daß Wege nicht nur im Kopf gewußt, sondern mit den Füßen gegangen sein wollen, auch wenn sie in die äußerste Gefahr führen, schien er damals begriffen zu haben.
Allerdings geht es Johannes „hier ebenso wie in Joh 11,16 und 20,24ff nicht darum, ein Charakterbild dieses Thomas zu zeichnen“, sondern Thomas dient als Stichwortgeber für Jesu feierliche Antwort in den Versen 6 und 7. Dabei fragt er Thyen zufolge nicht „nach Jesu Weg, sondern nach seinem eigenen und dem Weg seiner mit ihm über das Weggehen Jesu erschreckten und ratlosen Mitjünger“.
In dem in Vers 6 folgenden ICH-BIN-Wort muss „als Antwort auf die Thomasfrage jetzt der ,Weg‘ (egō eimi hē hodos {ICH BIN der Weg}) das zentrale Thema sein“. Die beiden Hinzufügungen hē alētheia {die Wahrheit} und hē zōē {das Leben} sind „Präzisierungen dessen, was hier ‚Weg‘ heißt.“ Das „doppelte kai“ ist daher nach Thyen nicht mit „und“ zu übersetzen, sondern muss „als ein epexegetisches verstanden werden“, das die erste Bezeichnung näher erklärt, wie de la Potterie <1016> ausführt:
„Die Worte hē alētheia kai hē zōē dienen dazu, – ausdrücklich und ohne Bild – die Bedeutung der von Jesus am Anfang des Verses verwendeten Metapher anzugeben: egō eimi hē hodos. Der erste Begriff, ‚der Weg‘, ist wichtiger. Es stimmt, dass die drei Substantive grammatikalisch koordiniert sind (durch ein doppeltes kai), aber sie sind es nicht für ihre Bedeutung. … Das erste kai ist lediglich epexegetisch. Der Vers besagt also nicht, dass Jesus der Weg zum Vater ist, gerade weil er die Wahrheit und das Leben ist; alētheia und zōē erklären seine Rolle als Vermittler: Weil Jesus die Wahrheit und das Leben ist, kann er uns zum Vater führen“.
Thyen nimmt diesen Gedankengang auf, indem er hinzufügt:
Es ist der in seinen Tod weggehende jüdische Mann Jesus, der fleischgewordene und damit sterbliche Logos, der hier als der Weg der Wahrheit und des Lebens prädiziert wird.
Auch nach Thyen muss „der ,soteriologische {auf Rettung bezogene} Nachsatz‘ unseres egō-eimi-Wortes: oudeis erchetai pros ton patera ei mē di‘ emou {niemand kommt zum Vater außer durch mich}“ näher erläutert werden, denn er musste
häufig als Grund der gnadenlosen Behauptung und oft rigorosen Durchsetzung eines Absolutheitsanspruchs des Christentums herhalten …, der sich bis zu den Zwangstaufen der spanischen Juden und den öffentlichen Verbrennungen der Ketzer zur höheren Ehre Gottes verstieg…
Folgende vier „Klarstellungen“ sind ihm zufolge nötig (T624):
Zum ersten muß gesagt werden, daß es Jesus, der historische Jude aus Nazaret, ist, der hier erklärt, daß er, und allein er und keiner sonst (oudeis) der Weg der Wahrheit und des Lebens ist, durch den einer zum Vater und der Vater zugleich zu einem kommt. An ihm vorbei kommt niemand zum Vater. Die Rede von einem Absolutheitsanspruch des Christentums oder irgendeines vermeintlichen irdischen Vertreters Jesu Christi ist darum ein Akt hybrider Usurpation der Majestät Gottes, ganz abgesehen von dem in diesem Zusammenhang unerträglichen Reden von ,Ansprüchen‘ irgendwelcher Art.
Da zweitens das Kommen zum Vater bei Johannes gleichbedeutend ist mit dem Glauben an Gott, wie die Stellen 6,35 und 7,37f. zeigen, „Glauben aber … bei Johannes niemals die Bedingung“ ist, „die einer erfüllen müßte oder auch nur erfüllen könnte, um zu Gott zu kommen und des ewigen Lebens teilhaftig zu werden“, sondern „vielmehr stets die Folge der Rettung“ ist, ist es nach Helmut Gollwitzer <1017> „nötig, 14,6b zusammen zu sehen mit 6,44: ,Niemand kann zu mir kommen außer dem, den der Vater zieht‘“. Ein ausführliches Zitat von Friedrich-Wilhelm Marquardt <1018> lässt deutlich werden, wie von dieser Einsicht Gollwitzers aus mit schwierigen Problemen der Prädestination (Vorherbestimmung der Menschen zum Heil oder zur Verdammnis) und der Apokatastasis panton (Allversöhnung, also Rettung letztlich aller Menschen) umgegangen werden kann:
„Hier revidiert Gollwitzer die Suggestionen konditionaler Logik, die von nicht wenigen biblischen Texten ausgehen, durch sachreflektierte Exegese. Der Glaube ist überall nicht die Bedingung, sondern die Folge der Rettung. Als solcher ist er das Tun der Geretteten. Die Glaubenskonditionen des biblischen Textes bezeichnen – sachlich gesehen – die von Gott selbst längst erfüllten Konditionen des Heils. ,Niemand kommt zum Vater denn durch mich‘ ist modellhaft: nicht von uns abgeforderte Bedingung, sondern vom Vater längst vollzogene Öffnung des Weges, der Wahrheit, des Lebens, das uns zugesprochen und verheißen wird. Wo immer es geschieht, daß Menschen mit Gott leben, da war Christus der ermöglichende Grund. Nach Gollwitzer vereinigen sich in der Zuversicht der Apokatastasis panton, des universalen Heils, prädestinatianische, universale und konditionale ‚Redeweisen‘. Prädestinatianische Aussagen der Bibel erklären: Heil ist nimmermehr menschliches Verdienst. Universale Aussagen verheißen: Allen gilt das Christusgeschehen. Konditionale Heilsaussagen besprechen die Art und Weise, in der das Heilsgeschehen sich beim einzelnen wirksam macht: Er glaubt dann, erkennt und tut. Daraus ergibt sich als Verstehensregel: Verstehe konditionale von prädestinatianischen her – und beide von den universalen her. Isoliere keine Redeweise von der anderen, schließe keine von der anderen aus und bevorzuge keine. Vergiß die Fragen abstrakter Logik nach Bedingungen des Heils: Denn da fragst du wie ein Pelagianer, der noch mitten im Heilsgeschehen der Rechtfertigung das ,Werken‘ nicht lassen mag und, wenn schon in nichts sonst, dann wenigstens im ,Allein aus Glauben‘ die bedingte Leistung – anderen abfordern möchte! Nirgendwo richtet der Protestantismus soviel Werkgerechtigkeit auf wie in der Glaubensforderung an die Juden“.
Drittens wiederholt Thyen (T625) seine schon mehrfach geäußerte Klarstellung, dass es im Johannesevangelium
durchweg … der bekannte Vater ist, der für seinen unbekannten Sohn zeugt und ihn bekannt macht … Darum muß Joh 14,6 in Analogie zu Worten wie 15,23 oder 5,23 begriffen werden: ,Wer nicht zu mir kommt, der kommt auch nicht zum Vater‘.
Schließlich erinnert Thyen viertens daran, „daß auch für Johannes die Hoffnung ebenso wie die Liebe konstitutive Momente des ,Glaubens‘ sind“, denn
auch ohne den Gebrauch der geläufigen Lexeme der Hoffnung und des Hoffens ist unser gesamtes Evangelium ein Aufruf zur Hoffnung. Derjenige, der die Welt überwunden hat, will in denen, die mit ihrer Angst in der Welt zurückbleiben, lebendige Hoffnung erwecken (16,33). Und wie alle anderen Ich-Bin-Worte, so ist auch 14,6 eine dementsprechende Verheißung. … Angesichts des vielfältigen und oft gar mörderischen Mißbrauchs dieser Verheißung Jesu zur Selbstbehauptung des Christentums, betrachten wir es als ein Stück notwendiger Selbstkritik unserer Theologie, das den Jüngern in der Stunde des Abschieds Gesagte als Jesu messianisches Geheimnis im Herzen zu bewahren und „den Mund (darüber) auch dann nicht übergehen zu lassen, wenn unser Herz voll sein sollte von der Hoffnung, daß Jesus schon überall da wirkt, wo der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch ohne ihn gepriesen wird“. Ja, „daß Jesu Eintreten für alle Menschen umgekehrt auch ein Leben aller Menschen durch ihn war und ist“ das ist noch nicht vollendet. Wir könnten es einstweilen nur behaupten, uns fehlt dazu noch das „beistimmende Zeugnis aller Menschen“. <1019>
Interessant ist (T626), dass Thyen trotz all dieser Klarstellungen dennoch von einem „Absolutheitsanspruch“ reden will. Da wegen Jesu in 10,30 bezeugter vollkommener Übereinstimmung mit dem Vater seine „Worte und Werke nicht die seinen, sondern diejenigen seines Vaters sind, macht Jesus“ mit 14,6
nichts anderes als den alten Absolutheitsanspruch des Vaters geltend, wie er zumal in den Kapiteln 40ff des Jesajabuches immer wieder erklingt. Darum ist ein Satz wie Joh 14,6 nicht zufälliger Ausdruck der historisch bedingten Aporie einer bedrängten Gemeinde, sondern notwendiger Ausdruck der Gewißheit des Glaubens. Denn „die Überzeugung von der ,Absolutheit der eigenen Religion‘ gehört zum unmittelbaren Eindruck des ,eigenen‘ Gottes, der in seinem Hervortreten als ,der‘ Gott – Grund und Grenze allen Seins, Sinn und Freude allen Daseins wie Möglichkeit und Zukunft allen wahren Lebens – wirksam wird. Die ,Absolutheit‘ einer Religion drückt als reflektiertes Urteil einer Religion über eine andere die tatsächliche Unfähigkeit aus, neben dem eigenen Gott die Gottheit anderer Götter zu erfassen. Die ,Absolutheit‘ der religiösen Nomoi – Einrichtungen, Antworten und Sitten – zu behaupten, ist die Dämonisierung der eigenen Religion“. <1020>
Zu Vers 7 wendet sich Thyen gegen die von der „Mehrheit der Textzeugen“ überlieferte Version „Hättet ihr mich verstanden, dann kenntet ihr auch den Vater“, die „nach dem Vorbild von 8,19“ geformt ist, „so daß Jesus hier seine Jünger ebenso wegen ihres Unverständnisses tadelte, wie dort die Juden“. Die nur von wenigen Handschriften bezeugte Lesart: „Wenn ihr mich erkannt und vor Augen habt, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen“, steht aber „in Harmonie mit dem Folgenden: kai ap‘ arti ginōskete auton kai heōrakate auton {und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen}“. Inhaltlich sieht Thyen in Vers 7 eine Erläuterung zu Vers 6 und zugleich, indem er auf einen Gedanken von Walter Bauer <1021> zurückgreift, die Überleitung
zu dem nun folgenden Gedanken, „daß Jesus nicht allein der Weg zum Vater ist, sondern daß er geradezu den Seinen den Vater verkörpert“. Mit Jesu überraschenden Worten: Ja, jetzt schon kennt ihr den Vater und habt ihn vor Augen (V. 7b), zeigt der Erzähler, daß das vorausgegangene Futurum gnōsesthe {ihr werdet kennen} nicht als temporales, sondern als logisches begriffen sein will.
Nach Ton Veerkamp <1022> werden im weiteren Verlauf von Johannes 14 aus dem Kreis der Schüler Jesu drei Einwände gegen die Art und Weise vorgebracht, in der Jesus sich als den Messias begreift, der Abschied nimmt und auf dem Wege des Todes am Kreuz zum VATER geht. Der erste Einwand bezieht sich grundsätzlich auf das Weggehen Jesu (Verse 4-5). Führt Jesu Tod am Kreuz wirklich dazu, dass Gottes zur solidarischen Liebe inspirierender Geist die herrschende Weltordnung überwindet und das messianische Leben der kommenden Weltzeit anbrechen lässt?
Was kommt, ist die Inspiration der Heiligung. Kommen kann sie nur, wenn der Messias geht: „Wohin ich gehe: Ihr wisst den Weg.“ Er wird vom Thomas umgehend eines Besseren belehrt. „Wir wissen ja nicht, wo du hingehst, wie können wir denn den Weg wissen?“ Thomas, konzentriert auf die realen politischen Machtverhältnisse, bezweifelt, dass es eine messianische Strategie geben kann. Er sagte: „Gehen auch wir mit ihm, damit wir mit ihm sterben“, 11,16. Also nicht, wie Simon: „Kämpfen wir“. Die Antwort Jesu überzeugt Thomas nicht: „Wenn ich mich von der Zukunft des Messias nicht leibhaftig überzeugen kann, werde ich mich darauf nicht einlassen“, sagt Thomas, wie man 20,25 umschreiben kann. Die überlieferten Worte taugen nicht für ein Psychogramm des historischen Thomas, reichen aber aus für die politische Haltung, die er hier repräsentieren muss: Unter römischen Verhältnissen gibt es nirgendwo eine Perspektive.
Jesu Antwort auf die Frage des Thomas in Vers 6 stellt Veerkamp wie alle ICH-BIN-Worte Jesu in den Zusammenhang mit der Selbstkundgabe des Gottes Israels durch seinen befreienden NAMEN in 2. Mose 3,14:
Jesus antwortet mit einem Spruch, der zu den meist zitierten des Johannesevangeliums gehört. In der traditionellen Übersetzung: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Mit diesem Spruch wird der Absolutheitsanspruch des Christentums gerechtfertigt.
Wir haben anders übersetzt: „ICH BIN ES, der Weg und die Treue und das Leben.“ Diese Übersetzung sagt erstens, dass die Aussage kein Urteilssatz ist: „Ich bin der Weg …“ Das Subjekt des Satzes ist der Messias. Die Definition des Messias „der vom VATER [NAMEN] Geschickte“.
Ich verstehe Veerkamp so, dass die Worte egō eimi {ICH BIN} keine Zuschreibungen über Jesus nach sich ziehen, die anderswoher als vom Gott Israels inhaltlich gefüllt werden dürften. Vielmehr kommt in ihnen zum Ausdruck, dass sich in Jesu messianischem Wirken, insbesondere in seinem Weg ans Kreuz, der befreiende Wille des NAMENS voll und ganz verkörpert. Von diesem NAMEN, vom VATER, ist Jesus als der Messias gesandt, nur von dessen Wirken her ist also auch der Sinn der nachfolgenden Worte Weg, Wahrheit/Treue und Leben zu interpretieren. Veerkamp vergleicht diese Sendung mit der Sendung des Mose:
Die Definition Moses war ebenfalls der Gesandte des NAMENS: ˀEhje schickt mich, der NAME schickt mich, Exodus 3,14. Aber die Einheit des gesandten Messias mit dem Sendenden, der NAME/VATER hat für Johannes eine andere Qualität. Mose hat über Weg und Leben geredet. In Deuteronomium 30,15-16 heißt es:
Siehe:
Ich habe dir heute vorgegeben:
das Leben und das Gute,
den Tod und das Böse.
Wie ich heute dir gebiete,
den NAMEN, deinen Gott, zu lieben,
auf seinem Weg zu gehen,
zu wahren die Gebote, die Gesetze, die Rechtsverordnungen,
und du wirst leben,
du wirst viele werden,
der NAME, dein Gott, wird dich segnen,
im Lande, wohin du kommst, es zu erben.Hier stehen „Weg“ und „Leben“ in einer eindeutigen Beziehung zum „NAMEN“. Im Lied „Lauschet ihr Himmel“ heißt es vom Gott Israels, Deuteronomium 32,4:
Der Fels, vollkommen sein Werk,
all seine Wege sind gerecht,
Gottheit der Treue, ohne Betrug.
Ein Wahrer ist er, geradeaus.Der Gott Israels ist „Weg, Treue und Leben“ für Israel. Jesus ist für Israel der Weg Gottes, er verkörpert die Treue Gottes und ist somit das Leben für Israel. Wie der NAME geschah, indem er Mose schickte – und Mose ist die Tora -, so geschieht der NAME heute durch den Messias Jesus, 1,17. Mose verkündete den Weg, die Treue und das Leben, das Gott für Israel ist. Jesus ist jetzt die einzige Gestalt des Weges Gottes, der Treue Gottes und des Lebens, das Gott verheißt.
Sowohl bei Mose als auch bei Jesus geht es darum, dass der NAME geschieht, indem Israel Befreiung erfährt und leben kann. Diese Befreiung kann nach Veerkamp unter den Bedingungen einer global unterdrückenden Weltordnung nicht mehr so vonstatten gehen wie zur Zeit des Mose oder noch des Kyros von Persien, als das Volk Israel die Chance erhielt, in einem eigenen Land, getrennt von den Völkern, die Tora als eine Disziplin der Freiheit zu verwirklichen. Im Jahrhundert des Evangelisten Johannes muss Jesus den NAMEN, dessen Worte Mose in der Tora geredet hat, als der Messias Gottes in seinem gesamten Wollen und Wirken bis hin zu seinem Sterben am Kreuz verkörpern, um die herrschende Weltordnung zu überwinden:
Hier ist ein Gegensatz, aber das Christentum hat daraus einen antagonistischen Widerspruch gemacht: Mose oder Jesus. Der Widerspruch ist kein absoluter, sondern ein bedingter. Es sind die neuen Verhältnisse, die die alten Verhältnisse außer Kraft setzen und neue Fragen stellen. Sie verlangen eine neue Antwort: das ist die Grundauffassung aller messianischen Gruppen aller Richtungen. Ohne diese neue Antwort komme niemand zum VATER.
„Zum VATER kommen“ heißt: Auf seinen Wegen gehen, nach seinen Geboten handeln. Unter den neuen Bedingungen heißt es: Auf den Wegen des Messias gehen, nach seinem neuen Gebot handeln. Wer diese neue Antwort, den Messias, diesen Messias, kennt, erkennt Gott.
In diesem Sinne vertritt Johannes durchaus einen Absolutheitsanspruch, der sich aber nicht auf die Überlegenheit der christlichen Religion gegenüber dem Judentum bezieht. Er bestätigt auch nicht einfach den Absolutheitsanspruch des Gottes Israels in der Weise, die Thyen im Anschluss an Ratschow formuliert hat. Johannes erhebt innerjüdisch für Jesus den Anspruch, dass ausschließlich er als der Messias Gottes anzusehen ist, dass nur durch Jesus die Befreiung Israels durch den NAMEN zu ihrem Ziel kommen kann.
Dass in Vers 7 auf einmal nicht nur vom Erkennen, sondern vom Sehen Gottes die Rede ist, wird Jesu Schüler zu einem weiteren Einwand herausfordern:
„Ab jetzt erkennt ihr ihn, und ihr habt ihn gesehen.“ Hier scheint ein Widerspruch zu sein: „Niemand hat je Gott gesehen“, sagt Johannes 1,18 (1 Johannes 4,12) in der Nachfolge des Wortes Exodus 33,20: „Nicht sieht mich der Mensch und lebt.“ Das bleibt für ihn unangefochten und unbestreitbar. Und jetzt auf einmal: „Ihr habt ihn gesehen!“
↑ Johannes 14,8-15: Wer Jesus sieht, sieht den VATER und tut die Werke seiner agapē
14,8 Spricht zu ihm Philippus:
Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.
14,9 Jesus spricht zu ihm:
So lange bin ich bei euch,
und du kennst mich nicht, Philippus?
Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater?
14,10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir?
Die Worte, die ich zu euch rede,
die rede ich nicht aus mir selbst.
Der Vater aber, der in mir bleibt,
der tut seine Werke.
14,11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir;
wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen.
14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer an mich glaubt,
der wird die Werke auch tun, die ich tue,
und wird größere als diese tun;
denn ich gehe zum Vater.
14,13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun,
auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn.
14,14 Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
14,15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.
[8. November 2022] Nach Klaus Wengst (W420) ist das, was Philippus gemäß Vers 8 von Jesus erbittet: „Herr, zeige uns den Vater! Und es genügt uns!“, etwas anderes als das paradoxe „‚Sehen‘ gegen den Augenschein“, das im „Wahrnehmen Gottes im Kreuz Jesu“ geschieht. In Vers 9 beharrt Jesus jedoch
darauf, im Blick auf ihn den Vater wahrzunehmen: „So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus?“ Philippus gehört zu den ersten Schülern Jesu (1,43). Er sollte eine „Sicht“ Jesu gewonnen haben, die den in ihm wirkenden Gott erkennt: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (vgl. 12,45). Es bleibt dabei, dass es kein direktes Sehen Gottes gibt; es gibt nicht mehr zu sehen als Jesus. Es käme jedoch alles darauf an, es zu glauben und darauf zu vertrauen, dass in ihm und durch ihn Gott selbst präsent ist.
Wengst meint nun allerdings, dass Philippus zu dieser Einsicht deswegen noch gar nicht fähig gewesen wäre, weil sie „sich erst von Ostern her ergibt“. Die „Leser- und Hörerschaft des Evangeliums“ dagegen hat diese Einsicht schon empfangen,
sodass sie sich nicht mehr wie Philippus fragen lassen muss: „Wieso sagst du: ,Zeige uns den Vater!‘?“ Ihr genügt die Erzählung des Evangeliums, die in ihrer Darstellung Jesu die Dimension Gottes aufscheinen lässt. Und sie scheint vor allem dadurch auf, dass Johannes die Geschichte Jesu unter der Perspektive seiner Auferweckung mit seiner Bibel erzählt.
Anders als Wengst (Anm. 77) meint Ruben Zimmermann zu Johannes 14,7-9: <1023>
„Wer im Christusbild ,nur‘ den Widerglanz des Gottes Israels erkennen will […], der verkennt m. E. Den Primat der Gegenwärtigkeit des Joh Christuszeugnisses.“ Er versteht „die joh Christologie“ in Entsprechung zu dem, „was Philosophen wie Plutarch oder Gadamer phänomenologisch zur Seinsweise des Bildes konstatierten“, und resümiert: „Erst vom Christusbild her wird Gott als Urbild erkennbar. Wer Jesus sieht, erkennt – so deutet es Joh – (erstmals) den sonst unsichtbaren Vater“.
Demgegenüber betont Wengst den im Johannesevangelium immer schon bekannten und aus der jüdischen Bibel erinnerten Gott Israels:
Nein, die im Evangelium für Jesus gebrauchten Bilder ergeben nicht „das Christusbild“, sondern sind Teil einer erinnerten Geschichte. Wer diese Geschichte im ständigen Bezug auf die Bibel erzählt, setzt den in ihr bezeugten Gott als bekannt voraus.
In den Versen 10 und 11 (W421) nimmt Jesus auf, was er bereits in 5,19.30; 7,17f.; 10,37f. gesagt hat:
„Glaubst du nicht, dass ich beim Vater bin und der Vater bei mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater, der bei mir bleibt, vollbringt seine Taten. Glaubt mir, dass ich beim Vater bin und der Vater bei mir ist. Andernfalls glaubt um eben der Taten willen!“
Jesus handelt also „ganz und gar im Auftrag Gottes“, was „sich auf dem Hintergrund der Tradition vom Einwohnen Gottes in Israel verstehen“ ließ:
Hier ist ausdrücklich vom „Wohnen“, vom „Bleiben“ Gottes bei Jesus die Rede. Gott „ist“, „wohnt“, „bleibt“ so bei Jesus, dass er in dessen Wirken zum Zuge kommt, sodass, wer Jesus hört und sein Handeln erfährt, Gott selbst begegnet. Das spitzt sich in der Situation, in der und auf die hin Jesus jetzt spricht, darin zu, dass er keine Zeichen mehr tut, sondern leiden und hingerichtet werden wird. Aber genau darin – das will diese Redeweise zum Ausdruck bringen – ist Gott präsent, führt Gott sein Werk zu Ende. Das wirkt sich in der Darstellung des Evangeliums so aus, dass Jesus gerade auch in der Passion als Handelnder erscheint, als Souverän seines Geschicks.
Dennoch bleibt nach Wengst „das Problem, dass Jesus als ein Messias geglaubt wird, der nicht da ist, und das heißt zugleich: als ein Messias ohne messianisches Reich.“ Indem Jesus aber in Vers 12 sagt: „Ich gehe zum Vater“, ist er trotzdem „nicht einfach gegangen; er ist nicht weg, als wäre nichts geschehen“, denn der
Glaube, dass sich Gott mit dem Tod Jesu in der Auferweckung des Gekreuzigten identifiziert, schließt ein, dass neue Schöpfung, Leben aus den Toten, erfolgt ist. Sie bricht sich Bahn bei denen, die daraufhin das Leben wagen und in der Nachfolge Jesu das Vermächtnis des Weggehenden halten. Darin vollbringen sie „die Taten“, die Jesus vollbracht hat, „und größere als diese“; „größere Werke, als er selbst tut, sagt er, würden sie tun, aber so, daß er sie in ihnen oder durch sie vollbringt, nicht sie gleichsam aus sich selbst“. <1024>
Damit gilt nach Josef Blank, <1025> auf den sich Wengst (Anm. 80) zustimmend bezieht:
„,Die Sache Jesu‘ ist noch gar nicht eingeholt, sie ist noch nicht angekommen, noch nicht erfüllt! Sie wäre eigentlich erst dann erledigt und passé, wenn ihre großen Verheißungen des Reiches Gottes, der verwirklichten Gerechtigkeit und Liebe, der wahren Humanität und des endgültigen Völker-Friedens schon realisiert wären. Alle bisherige Verwirklichung des Christentums in der Geschichte ist bruchstückhaft und oft sogar sehr fragwürdig. Das gilt auch für die Kirche. Die Verheißung Gottes ist noch lange nicht realisiert, wir sind erst auf dem Weg dazu.“
Insofern geht es, wie Wengst (W421) unter Berufung auf Thomas Brodie <1026> betont, „bei den ‚größeren Werken‘ um nichts Geringeres als ‚die Erneuerung der Welt und, in der Tat, der Schöpfung‘.“
Dass die (W422) zu „einem darauf ausgerichteten Tun“ herausgeforderten „Glaubenden“ damit „nicht überfordert“ werden, macht Jesus in den Versen 13 und 14 deutlich, denn ihre
Taten sind auf Bitten hin gewährte: „Und was immer ihr in meinem Namen erbittet, will ich tun.“ Die einleitende Wendung: „was immer“ ermöglicht nicht ein beliebiges Bitten; das Bitten wird vielmehr qualifiziert, dass es im Namen Jesu erfolgt. Woraufhin man sich zu Recht auf Jesus berufen kann, das soll auch erbeten werden. Sein Werk, das er gerade durch seinen Weggang vollendet, muss sich in der Wirklichkeit der Welt noch auswirken. Deshalb erscheint er hier als Erfüller der Bitten und richtet sich das Bitten an ihn.
Dass Jesu Werk dennoch „Gottes Werk“ ist, „wird am Schluss des Verses ausdrücklich gemacht“:
Die Erfüllung der Bitten im Tun der „größeren Taten“ geschieht, „damit der Vater durch den Sohn verherrlicht werde“, geschieht also zum Erweis der Ehre Gottes. So könnte die Erneuerung der Welt, um die es hierbei geht, verstanden werden als Prozess der Selbstverwirklichung Gottes in der Welt. Jesus unterstreicht die Zusage, dass geschieht, worum unter Berufung auf ihn gebeten wird: „Wenn ihr mich um etwas bittet in meinem Namen, will ich es tun.“ Die Glaubenden entsprechen dem Werk Jesu, indem sie sich als Bittende so darauf berufen, dass es sich in ihren Taten manifestiert.
Da Wengst und auch Thyen den Vers 15 anders als Veerkamp in engem Zusammenhang mit den folgenden Versen 16-24 sehen, gehe ich auf ihre Auslegung dazu erst im folgenden Abschnitt ein.
Zu Vers 8 meint Hartwig Thyen (T626) wie Wengst, dass „die Jünger einstweilen noch nicht“ begreifen, dass sie in Jesus die Verkörperung des Vaters vor Augen haben. Daher muss „Philippus als ihr Sprecher Jesus bitten …: Herr zeige uns doch den Vater, dann wollen wir zufrieden sein!“, und flieht damit wie zuvor Thomas „aus der Wirklichkeit des in Jesus eröffneten Heils in die bloße Möglichkeit“. Dazu zitiert Thyen zustimmend Hans-Joachim Iwand <1027> mit den Worten (T627f.):
„Herr, zeige uns den Vater! Das Zeigen ist ein Von-Sich-Wegweisen. Das Zeigen ist Sache des Lehrers. Aber Jesus ist mehr als ein Rabbi, Jesus ist die ,praesentia dei {Gegenwart Gottes} in Person‘ (Schniewind). Darum verweist Jesus auf sein Dasein. Sein Dasein ist die Offenbarung Gottes. Darum offenbart er sich den Seinen, indem er sie an die untrennbare Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn erinnert. Denn was auch immer an Worten von Jesus ausgeht, er ist nie das Subjekt seiner Rede, sondern es ist der Vater in ihm und er im Vater“.
Genau das stellt Jesus Thyen zufolge in seiner „Gegenfrage“ (Verse 9-11) klar, die Thyen folgendermaßen wiedergibt:
„So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht (ja) den Vater. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater! Glaubst du denn nicht, daß ich im Vater bin, wie der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, die rede ich nicht aus meinem Vermögen (ap‘ emautou), vielmehr vollbringt darin der Vater, der in mir wohnt, seine Werke. Glaubt mir (darum), daß ich im Vater bin, wie der Vater in mir ist. Und wenn nicht (d. h. wenn ihr das nicht glauben könnt), dann glaubt doch um dieser Werke selbst willen (dia ta erga auta pisteuete)!“
In dieser fragenden Form „ringt Jesus hier um das Vertrauen seiner Jünger“, wozu Thyen sich erneut auf Marquardt <1028> beruft, demzufolge Jesus hier [421] „über sein Zusammensein mit Gott und Gottes mit ihm nicht behauptend, thetisch“ redet, sondern „nur in fragender Gestalt, nur in der Weise von Fraglichkeit“. Denn [422f.]
„die christologische Bestimmung hat gerade in diesem Fall nur Sinn als eine soteriologische {auf Rettung bezogene}. Wer nicht sagen kann, zu welchem Vertrauen, in welche Gemeinschaft und Liebe ihn selbst das Bekenntnis zum vere Deus {wahrer Gott}, zum ,Gott war in Christo‘ überwindet, unterlasse dergleichen christologische und trinitätstheologische Behauptungen. Ohne eine Ekstase des Vertrauens, der Freundschaft, der Liebe läßt sich das Dogma nicht lehren“.
Am Ende von Vers 11 „äußert Jesus seine Skepsis über die Fähigkeit seiner Jünger, seinen Worten zu vertrauen“, indem „er sie auf seine Werke hin[weist], um durch sie ihr Vertrauen zu gewinnen.“ Dazu noch einmal Marquardt [423]:
„Johannes läßt Jesus hier gut jüdisch reden und urteilen. ,lch will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen‘, den Grund meines Vertrauens (Jak 2,18)“.
Nach Thyen wird in den Versen 11 und 12 der „Wirkzusammenhang zwischen Jesus und seinem Vater“ angesprochen, „den bereits der Prolog durch die hymnische Prädikation dessen preist, ohne den kein einziges Geschöpf geworden ist (1,3; vgl. 5,17)“. Eine solche „offensichtliche Überordnung der Werke Jesu über seine Worte“ wird jedoch von „Bultmann, <1029> dem darin viele folgen“ bestritten (T627f.):
„Diese erga {Werke} können ja nach V. 10 nichts anderes sein als Jesu Offenbarerwirken im Worte. Und wie 10,38 wird der Glaube an dieses Wirken von einem nur auf das Gesagte gerichteten Glauben abgehoben. Wem Jesus nicht schon Autorität geworden ist, so daß er reflexionslos seinem Worte glauben kann, der soll auf das blicken, was sein Wort wirkt, d. h. aber: auf sich selbst. Sein Wort teilt ja nicht Mysterien oder Dogmen mit, sondern deckt die Wirklichkeit des Menschen auf. Versucht er es, sich unter diesem Worte zu verstehen, so wird er das Werk des Vaters an sich erfahren“.
Einer solchen (T628) „gegen das Gefälle des Textes erfolgende Vorordnung der Worte Jesu vor die konkreten Werke des fleischgewordenen“ entspricht nach Thyen sehr genau „Bultmanns Reduktion des jüdischen Mannes Jesus auf das ‚Bloße-Daß-seines-Gekommenseins‘ und dessen stete Bezeichnung als der Offenbarer“. Demgegenüber betont Thyen, dass „das Johannesevangelium primär die Biographie des jüdischen Mannes Jesus als des Fleisch gewordenen Wortes Gottes ist und kein gnostischer Offenbarungstraktat“, denn
in dieser Stunde des Abschieds geht es ja wohl zumal um das eine große Werk seines Hingehens zum Vater, in dem sich die vielen Zeichen versammeln, „die er vor seinen Jüngern getan hat, damit sie glauben, daß er der messianische Gottessohn ist, und so das ewige Leben gewinnen“ (20,30f). Sein Weg zum Vater ist ja zugleich sein Weg in Kreuz und Tod, die Vollendung seiner Liebe zu den Seinen (13,1) durch die Hingabe seines Fleisches für das Leben der Welt (6,51) und Voraussetzung für die Gabe des Geistes, der nach 7,38f solchen Glauben ja allererst ermöglicht.
In Vers 12 bis 14 nimmt Jesus Thyen zufolge mit „dem doppelten Amen … das Stichwort der Werke, die ja nach 5,36 und 10,25 für ihn zeugen, wieder auf:
„Wer an mich glaubt, der wird eben die Werke, die ich tue, auch tun, ja er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater“. Nicht irgendeine Ausstattung der Jünger mit übernatürlichen Kräften wird sie zum Tun jener „größeren Werke“ ermächtigen, das der Scheidende ihnen hier verheißt, sondern die größeren Werke haben ihren Grund allein in dem Satz: hoti egō pros ton patera poreuomai {denn ich gehe zum Vater}. Denn wie die Werke Jesu nicht seine eigenen, sondern diejenigen seines Vaters waren, so werden auch ihre größeren Werke nicht die ihren, sondern die Werke dessen sein, der zum Vater gegangen ist und ihnen gewähren wird, um was auch immer sie ihn in seinem Namen bitten werden, damit so der Vater in seinem Sohn verherrlicht werde.
Vers 14, der das „in V. 13 Gesagte mit nahezu den gleichen Worten wiederholt“, bis auf die Ergänzung des Pronomens me {mich}, ist nach Thyen „schwerlich eine sekundäre Hinzufügung“, sondern eher von manchen Abschreibern ausgelassen worden. Aber könnte nicht auch in den anderen Handschriften der Satz mit dem ergänzten „mich“ hinzugefügt worden sein, um die Möglichkeit zu betonen, dass man sich betend nicht nur an Gott, sondern auch an Jesus wenden kann?
Die (T629) „überraschende Aussage, daß die Jünger nach dem Weggang Jesu nicht nur eben die Werke tun werden, die er getan hat, sondern daß sie darüberhinaus sogar größere als diese vollbringen werden“, will Thyen nicht „auf die größeren Missionserfolge und zumal auf die Ausdehnung der Mission auf die Heidenvölker“ deuten, wie das viele Exegeten tun, und auch nicht wie Bultmann [472] allein darauf beziehen, dass Jesu Werk „als zeitlich begrenztes, durch seinen Hingang beendetes … ,unvollständig‘“ ist und „seinen Sinn noch nicht erfüllt“ hat, denn
es geht bei dem Satz: ,Denn ich gehe zum Vater‘, wohl um mehr noch als nur darum, daß hier das bloß zeitliche Begrenztsein des Erdenwirkens Jesu ausgesagt werden soll, zumal dieser conditio humana {Bedingung des Menschseins} natürlich auch das Wirken der Jünger unterworfen ist. Nein, Jesu Hingang zum Vater sprengt zugleich alles zeitliche Begrenztsein seines Wirkens, es erhebt das Einmal dieses Wirkens in den Rang des „Einfürallemal“ und macht Jesus durch das Gebet en tō onomati mou {in meinem Namen} anrufbar, so daß er selbst ihre größeren Werke wirken wird: egō poiesō, hina doxasthē ho patēr en tō hyiō {das will ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird}.
Da sich Thyen zufolge in Johannes 16,23f. zeigen wird (T630), „daß das Gebet im Namen Jesu sein Hingegangensein zum Vater voraussetzt“, dienen hier „die V. 12-14 mit ihrem viermaligen Gebrauch von Futurformen des Verbums poiein {tun} der Überleitung in die neue Zeit der größeren Werke und des Geistes“. Zu diesbezüglichen Untersuchungen von Christian Dietzfelbinger <1030> meint Thyen:
Im Bann seiner Überzeugung von der vermeintlich rein präsentischen Eschatologie des Evangeliums und seiner Vorordnung des Wortes vor das Werk Jesu neigt Dietzfelbinger freilich allzu sehr dazu, die nachösterliche und vom Parakleten inspirierte Predigt der Jünger als Vollbringen der größeren Werke platt mit der eschatologischen Auferweckung und dem Lebendigmachen der Toten zu identifizieren. Darüber scheint er vergessen zu haben, daß nach 13,34f doch nicht an der vollmundigen Predigt der Jünger, sondern gerade an ihrem stillen Wirken in der Liebe zueinander, so wie Jesus sie geliebt hat, jedermann (pantes) erkennen soll, daß sie Jesu Jünger sind, und daß dieses Wirken der Kirche in der Einheit mit ihrer missionarischen Verkündigung wiederum nur sēmeion {Zeichen} des künftigen eschaton {Endzeit} und keinesfalls schon dieses selbst sein kann.
Ton Veerkamp <1031> spekuliert nicht darüber, ob diejenigen, die das Johannesevangelium lesen, den hier dargestellten Schülern Jesu durch ihre Ostererfahrung etwas voraus haben. Anscheinend geht er davon aus, dass die von skeptischen Schülern gestellten Fragen auch nach der Auferweckung des Messias von den Toten nicht einfach beantwortet und erledigt sind, und schreibt zur Reaktion des Philippus auf Jesu Aussage, dass sie in der Begegnung mit ihm Gott gesehen haben:
Philippus nimmt das sofort auf: „Zeige uns den VATER, und es genügt uns.“ Offenbar hat es in der Gruppe Zweifler und Skeptiker gegeben, die „Johannes“ schier zur Verzweiflung brachten. Aber ebenso offenbar nimmt er diese Fraktion sehr ernst.
Nach Veerkamp zeigt sich in der Frage des Philippus der Wunsch, genau zu wissen, wie und wann endlich die herrschende Weltordnung überwunden sein wird. Letztlich schimmern bei denen, die so fragen, immer noch zelotisch-messianische Erwartungen auf einen Messias durch, der durch einen Aufstand mit einem Schlag die kommende Weltzeit herbeiführt:
Ihre Skepsis ist zwar berechtigt, aber sie lähmt die Gruppe in ihrem Kampf um eine politische Perspektive. In der Antwort Jesu klingt diese Verzweiflung unüberhörbar mit, und zwar über jene, die sagen: „Ich will Sicherheit.“ Etwa so, wir würden in dieser und jener Phase sein, es würde so und so lange dauern, bis das ganze Reich des Todes an seinen inneren Widersprüchen zusammenbreche, und dann … Was kommt dann? Der Messias? Diese Menschen müssen sehen, dass der Gott Israels nur durch die Zerschlagung irrealer messianischer Erwartungen am Schandkreuz Roms Israel getreu ist.
Hier sieht Veerkamp bei Johannes einen klaren Unterschied zur Einschätzung des Kreuzestodes Jesu in den „synoptischen Evangelien“, die „den Messias am Kreuz … den 22. Psalm beten“ lassen:
„Mein Gott, mein Gott, warum verlässt du mich?“ Gottverlassenheit war keinen einzigen Augenblick eine Realität im Leben dieses Messias. Das ist der Hauptinhalt der Botschaft, von Anfang an. Philippus war von Anfang an dabei gewesen (1,43), und Philippus war in dieser Erzählung eine wichtige Gestalt (1,43ff.; 6,5.7; 11,21f.). „So lange Zeit war ich mit euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?“
Und gerade weil Jesus bei Johannes niemals von Gott verlassen ist, kann umgekehrt der Gott Israels nicht mehr anderswo als im Schicksal dieses konkreten Messias erfahren werden:
Wer den Messias sieht, sieht Gott, wer dem Messias vertraut, vertraut Gott. Keine andere und keine legitime Gotteserfahrung („sehen“) ist möglich als das Sehen des Messias, dieses Messias, dieses gescheiterten Messias! Dieses Sehen und Erkennen ist eine Praxis. Die Praxis der Schüler, sofern sie sehen, erkennen, vertrauen, ist die des Messias, und diese Praxis wird überzeugender sein als die des Messias selbst („größere Werke“). Diese messianische Praxis ist die Ehre Gottes, sie, und nur sie.
Weil es hier um Werke geht, und zwar um eine auf Vertrauen gegründete Praxis, ist es durchaus folgerichtig, dass Jesu diesbezügliche Worte mit Äußerungen über das Gebet (Verse 13 und 14) und die Wiederaufnahme des Themas der agapē, der solidarischen Liebe (Vers 15) fortgesetzt werden:
Wenn man um sie betet, wird sie gegeben werden, weil das Gebet um diese Praxis das Sehen, Erkennen und Vertrauen voraussetzt. Die Praxis, die aus der Solidarität mit dem Messias entsteht, ist das Wahren der Gebote des Messias. In 15,12 wird noch einmal verdeutlicht, was im 13. Kapitel vorgemacht wurde: Solidarität mit dem Messias = Solidarität untereinander = Sklavendienst des einen an den anderen Schüler, des anderen an den einen Schüler.
Einem persönlichen Gebetsleben gegenüber hat Ton Veerkamp Vorbehalte, <1032> von daher äußert er sich zurückhaltend, aber ausgesprochen differenziert über das Thema des Betens, Bittens und sogar Forderns im Verhältnis der Menschen zu Gott, der Schüler Jesu zum Messias und des Messias zu Gott:
Unvermittelt, so scheint es, tauchen Sätze auf, die sich auf das Gebet der Gemeinde beziehen. Aber es fragt sich, ob es um „Gebet“ geht. Für „beten“ hat die Schrift ein anderes Wort hithpalel bzw. proseuchesthai. Richtet sich Jesus an den Gott Israels (VATER), dann setzt Johannes ein anderes Wort ein als wenn es die Schüler tun (sollen). Der Messias „fragt“ (erōtan) um einen anderen „Anwalt“, das heißt: er wird ihn „anfordern“. Die Schüler „bitten“ (aitein), und das Äußern dieser Bitte geschieht in Zusammenhang mit dem Wahren der Gebote, hier und in 15,7 bzw. 15,16. Es geht hier nicht um Belohnungen, die sich die Schüler mit dem Wahren der Worte oder der Gebote des Messias verdient hätten. Vielmehr geht es darum, dass sie dann genau um das bitten, was dem Gebot der Solidarität und dem Sein mit dem Messias entspricht. Das erweist sich aber als äußerst problematisch und kommt im Abschnitt 16,23-28 ausführlich zur Sprache.
↑ Johannes 14,15-17: Die Inspiration der Treue als ein anderer Beistand, paraklētos
14,15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.
14,16 Und ich will den Vater bitten
und er wird euch einen andern Tröster geben,
dass er bei euch sei in Ewigkeit:
14,17 den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen kann,
denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
[9. November 2022] Vers 15 wiederhole ich hier noch einmal, da er von Wengst und Thyen (anders als von Veerkamp) in einem engen Zusammenhang mit dem Folgenden gesehen wird. Nach Klaus Wengst (W422) sind die Verse 15 bis 24 als ein zusammenhängender Abschnitt aufzufassen, in dem „Jesus den Schülern beim Tun des von ihm Gebotenen einen Beistand“ verheißt:
Die Verbindung der Aussagen von der Liebe zu Jesus und vom Halten seiner Gebote hält den ganzen Abschnitt zusammen. Diese Verbindung steht am Beginn in V. 15 und findet sich variiert in V. 21. In nochmaliger doppelter Wiederholung, positiv und negativ gewendet, wobei die „Gebote“ durch das „Wort“ bzw. die „Worte“ ersetzt werden, steht sie in V. 23f. betont am Schluss. In dem ersten, größeren Zwischenraum kündigt Jesus in V. 16f. als „anderen Beistand“ die Geisteskraft an und in V. 18-20 seine eigene künftige Anwesenheit. Dabei schillern die Aussagen so, dass sie unterschiedliche Assoziationen hervorrufen: an sein österliches Erscheinen, an seine Gegenwart in der Kraft des Geistes, an sein endzeitliches Kommen.
Im einzelnen beantwortet Vers 15 Wengst zufolge die Frage: „Wie kann man Jesus lieben, wenn er nicht mehr da ist?“ Dies geschieht in genauer Entsprechung zur jüdischen Tora, worauf Wilckens <1033> hinweist (W422f.), denn „wie im AT die Liebe zu Gott im Tun seiner Gebote geübt wird (Dtn 10,12f. […]), so sollen Jesu Jünger Jesus lieben, indem sie seine Gebote halten.“
Warum aber (W423) spricht Jesus „jetzt in der Mehrzahl von seinen ‚Geboten‘“? Er hat doch nach „der Erzählung des Evangeliums … seinen Schülern nur ein Gebot gegeben (13,34f.), das er an späterer Stelle ausdrücklich wieder aufnimmt (15,12f.17), nämlich das Gebot, einander zu lieben.“ Ein „Ungedanke“ ist es nach Wengst, dem johanneischen Jesus zu unterstellen, er hebe,
indem er seinen Schülern ausdrücklich nur das eine Gebot ans Herz legt, einander zu lieben, damit stillschweigend die konkreten Einzelgebote der Tora auf…, wie sie sich in dem nach dem Willen Gottes fragenden Auslegungsprozess herausstellen … In 10,35 betont er, dass „die Schrift nicht aufgelöst werden kann“. Bezogen auf das eigene Tun Jesu begegnen ebenfalls der Singular „Gebot“ und der Plural „Gebote“. Nach 10,18 ist es ihm vom Vater gegebenes Gebot, sein Leben einzusetzen (vgl. 12,49f.). In 15,10 stellt er umfassend fest: „Ich habe die Gebote meines Vaters gehalten.“ Entsprechend sagt er in 8,29, dass er „jederzeit das vor ihm Wohlgefällige“ tue. Beides kann im jüdischen Kontext gar nichts anderes heißen, als dass er die Toragebote (mizvót) hält. Das den Schülern gegebene eine Gebot dürfte in seinem Verhältnis zu den übrigen Geboten nicht anders verstanden sein als das Gebot der Nächstenliebe in der rabbinischen Tradition, nämlich als „große Zusammenfassung in der Tora“. <1034> Als solche Zusammenfassung hebt das Liebesgebot die anderen Gebote nicht auf, sondern gibt die Dimension und die Intention für ihre Erfüllung an.
Indem sich „also in dem vom Liebesgebot bestimmten Halten der Gebote“ die „Liebe zu Jesus … bewährt“, werden eben darin … auch die ‚größeren Taten‘ vollbracht, von denen vorher die Rede war.“
Nach Vers 16 wird bei diesem „Tun des von Jesus Gebotenen … die Schülerschaft Jesu“, also „die Gemeinde nicht ohne Beistand sein“, denn
Jesus verheißt: „Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, auf dass er auf immer bei euch sei.“ Hier begegnet erstmals im Johannesevangelium der Begriff „Paraklet“ (parákletos).
Wie schon (Anm. 88) August Tholuck <1035> unter Hinweis „auf die klassische Gräzität {griechische Sprachkultur}, auf Philon und auf die rabbinische Literatur …, in der das griechische Wort als Fremdwort begegnet“, erwiesen hat (W423f.), bezeichnet dieses „Wort … ‚den zum Beistand Herbeigerufenen‘. Diese Bedeutung ist an allen Stellen, an denen es im Evangelium begegnet, ‚dem Sinne überall treffend‘.“
Indem (W424) dieser „Beistand als ein ‚anderer Beistand‘ bezeichnet wird“, wird vorausgesetzt,
dass auch Jesus schon als Beistand seiner Schüler wirkte. Jetzt geht er weg; er wird hingerichtet werden. Aber gerade das ist für ihn der Weg zum Vater. So wird er den Vater bitten, dass der andere Beistand kommt. Doch geht es hier nicht nur um die Frage der Kontinuität. Denn dann wäre Jesu Weggang, sein Tod am Kreuz, nur als ein chronologisches Datum verstanden, das die Zeit seiner Wirksamkeit beendet. Es hat aber eine eigene positive Bedeutung. Durch ihn erhält Jesu Schülerschaft, was sie vorher nicht hatte, mit ihm vermacht er ihr die Liebe Gottes, sodass sie sich an sein Vermächtnis, einander zu lieben, halten kann und soll. Dann steht ihnen der andere Beistand auch in anderer Weise bei; dann geht es bei ihm darum, dass der so verstandene Tod Jesu als Zuspruch der Liebe Gottes immer wieder zur Wirkung kommt.
In Vers 17 kennzeichnet Jesus „den angekündigten Beistand näher als ‚die Geisteskraft der Wahrheit‘“; sie bewirkt es, dass Menschen die Gegenwart Gottes im gekreuzigten Jesus und im neu geschaffenen „Leben aus den Toten“ wahrnehmen „und entsprechend leben und handeln“. Von dieser Geisteskraft
heißt es weiter, dass „die Welt“ sie „nicht aufnehmen kann“. In der Gegenüberstellung zur Schülerschaft Jesu, zur Gemeinde, bezeichnet „die Welt“ alle Außenstehenden. Dass sie diese Geisteskraft nicht aufnehmen, nicht annehmen, legt sie nicht auf Ablehnung fest. Als „Welt“ können sie es nicht. Ließen sie sich darauf ein, wären sie nicht mehr Welt, sondern Gemeinde. Das macht Gemeinde aus, dass sie sich von der Kraft dieses Geistes bewegen lässt und damit deren Wirksamkeit zeigt. Die Welt kann das nicht, „weil sie sie weder sieht noch kennt.“
Wie zuvor schon im Blick auf Gott spricht Johannes, wie Adolf Schlatter <1036> meint, jetzt auch im Blick auf den Geist
„von einem theoreín (‚sehen‘), weil er ihn als den Wirkenden denkt und der Wirker in seiner Wirkung sichtbar wird“ – also darin, wie Gemeinde lebt und handelt. Das Leben und Handeln der Gemeinde – wenn es sich denn tatsächlich kraft des Geistes vollzieht – können auch Außenstehende wahrnehmen. Aber weil sie den Grund solchen Lebens und Handelns nicht erkennen, werden sie dazu neigen, es als Schwärmerei, als ärgerliches Weltverbesserertum, als verbissenes Zusammenhalten abzutun. Für die Schülerschaft Jesu gilt demgegenüber: „Ihr kennt sie (die Geisteskraft), weil sie bei euch bleibt und unter euch sein wird.“ Sie kennen sie, weil sie sich darauf eingelassen haben und kraft dieses Geistes leben, weil sie sich darauf verlassen, dass der in den Tod Jesu mitgehende Gott auch ihrem Leben Grund gibt.
Auch Hartwig Thyen (T630) sieht den Abschnitt 14,15-24
umschlossen vom Liebesgebot, in V. 15 zunächst in der positiven Gestalt: „Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten“ … und am Ende (V. 24) in der negativen Form: „Wer mich nicht liebt, der wird auch meine Worte nicht beachten“.
Auch er verweist darauf, dass die Worte entolas und logous, „Gebote“ und „Worte“, hier als gleichbedeutend aufzufassen sind:
Wohl nicht zufällig soll das zunächst gebrauchte Lexem entolē {Gebot} die Jünger (und mit ihnen die Leser des Evangeliums) an Jesu neues Gebot erinnern, einander zu lieben (13,34f). Und das gilt um so mehr, als Jesus hier ja im Begriff ist, von den Jüngern weg hin zu seinem Vater zu gehen und sich ihnen damit als unmittelbares Objekt ihrer Liebe entzieht. In dieser nahen Zukunft gilt vielmehr mutatis mutandis {unter Abänderung des zu Ändernden} Jesu mit dem doppelten Amen eingeleitetes Wort: „Wer einen aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat“ (13,20).
Und auch er erinnert, indem er sich auf Jörg Augenstein <1037> beruft, daran, dass
Johannes mit den Wendungen entolas bzw. logous tērein {Gebote bzw. Worte halten} „auf das alttestamentliche Konzept des Gebotehaltens, wie es besonders in der deuteronomistischen Literatur zum Ausdruck kommt, zurückgreift“.
Zu den Versen 16 und 17 betont Thyen, dass „nicht etwa das hier neu eingeführte Lexem paraklētos den Ton trägt“, denn es wird ohne Artikel in der Formulierung allos paraklētos {anderer Beistand} eingeführt und sogleich „mit dem ,Geist der Wahrheit‘ (to pneuma tēs alētheias: V. 17)“ gleichgesetzt. Dieses „pneuma {Geist}, das jedem Leser seines Evangeliums seit 1,32; 4,24; 7,37ff bekannt ist“, wird hier in seiner Funktion als paraklētos herausgestellt. Darum übersetzt Thyen die Verse 16-17 folgendermaßen (T630f.):
„Und ich werde den Vater bitten, daß er euch einen Anderen als Parakleten gebe, damit der in Ewigkeit bei euch sei, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht zu ergreifen vermag, weil sie ihn weder sieht noch erkennt. Ihr dagegen kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch wohnen“. So wie der Geist seit Jesu Taufe durch Johannes auf ihm blieb (kai emeinen ep‘ auton {und er blieb auf ihm}) und ihn als denjenigen erwies: ho baptizōn en pneumati hagiō {der mit dem heiligen Geist tauft} (1,32f), so wird der Geist, nachdem Jesus ihn hingegeben (paredōken to pneuma {er übergab den Geist} 19,30; s. u. z. St.) und ihn als Auferstandener seinen Jüngern eingehaucht hat (20,22), nun in ihnen bleiben.
Dass (T631) dieser Geist als „Geist der Wahrheit“ bezeichnet wird, ist nach Thyen unmittelbar aus dem Johannesevangelium verständlich. Das Wort alētheia {Wahrheit} ist hier
nichts anderes als die Wahrheit dessen, der soeben gesagt hatte, er selbst sei die Wahrheit in Person: egō eimi hē hodos kai hē alētheia kai hē zōē {Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben} (V. 6). Er, Jesus, ist auch die alētheia pasa {ganze Wahrheit}, in die jener ,Geist der Wahrheit‘ die Jünger nach Joh 16,13f einführen wird, denn ekeinos eme doxasei, hoti ek tou emou lēmpsetai kai anangelei hymin {jener wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen} (16,13f). Als derjenige, der die Wahrheit bezeugt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, kann von ihm gesagt werden: to pneuma estin hē alētheia {der Geist ist die Wahrheit} (1Joh 5,6…).
Dazu, dass diesen Geist „der Kosmos ihn nicht aufzunehmen vermag, weil er ihn weder sieht noch erkennt“, meint ähnlich wie Wengst nun auch Thyen, und zwar unter Berufung auf Bultmann, <1038> dieser Satz
bedeute nicht, daß ein Ungläubiger nicht zum Glauben kommen könne. Vielmehr bezeichne er den Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt und besage: „Die Welt kann als Welt den Geist nicht empfangen; sie müßte ja sonst ihr Wesen, das, was sie zur Welt macht, preisgeben“. … Darin, daß der Kosmos den Parakleten nicht aufnimmt, wiederholt sich also, was der Leser von den Reaktionen der Welt auf Jesu Auftreten kennt. Offenbar muß demnach mutatis mutandis auch vom Geist der Wahrheit gelten, daß niemand zu ihm zu kommen und ihn aufzunehmen vermag, wenn der Vater ihn nicht ,zieht‘ (6,44). Die Jünger dagegen werden ihn erkennen, weil er bei ihnen bleibt und in ihnen sein wird (hoti par‘ hymin menei kai en hymin estai).
Ton Veerkamp <1039> weist zu Vers 16 darauf hin, dass er „zu einer Fülle von Spekulationen sowie nutzlosen und daher unwissenschaftlichen Diskussionen Anlass gegeben“ hat, nämlich darüber, „wer wohl jene Gestalt sei, die Johannes paraklētos nennt, den Paraklet.“ Wengst und Thyen muss man allerdings zugestehen, dass sie sich solcher Spekulationen enthalten. Zur Bedeutung von paraklētos schreibt Veerkamp:
„Anwalt“ übersetzen wir, nach seiner Funktion im Gericht (16,7ff.). Das Wort kann „Tröster“ bedeuten, weil es von parakalein stammt; dieses Verb bedeutet ursprünglich „herbeirufen“ und im abgeleiteten Sinne „trösten, ermutigen“. Es leitet sich von der hebräischen Wurzel nacham her. In diesem Sinne wird es oft in den apostolischen und evangelischen Schriften verwendet, ebenso wie das verwandte Wort paraklēsis, „Trost, Ermutigung“. Die Wortgruppe fehlt bei Johannes, eben bis auf das Wort paraklētos, das nun wiederum in allen anderen Schriften beider Testamente fehlt. Das Wort findet sich nur bei Johannes und nur dann, wenn von der Weltordnung die Rede ist.
Eben diesen Zusammenhang zwischen dem paraklētos als „Anwalt“ und dem kosmos als der „Weltordnung“ begreift Veerkamp entschieden anders als Wengst und Veerkamp, die das Stichwort „Welt“ im Gegensatz zur religiösen Kategorie der „Gemeinde“ zu verstehen suchten. Insofern übersetzt Veerkamp in Vers 17 den Ausdruck pneuma tēs alētheias, der das Wort paraklētos erklärt, auch nicht mit „Geist der Wahrheit“:
Er ist „die Inspiration der Treue“, die „die Weltordnung nicht (über)nehmen kann“. Das eine, die Inspiration der Treue, schließt das andere, die Weltordnung des Betruges, aus, weil sie diese Inspiration weder in Betracht zieht (Treue ist kein Element der Politik, bis heute nicht) noch erkennt, und erkennen ist in der Schrift der Erkenntnis entsprechend handeln.
Ein Element dieser politischen Deutung des Parakleten ist auch, dass Veerkamp das Wort theōrein in einem Sinne versteht, den das deutsche Wort „Theorie“ aufgenommen hat, nämlich eines Betrachtens oder in Betracht Ziehens. In seinen Augen geht es hier nicht um einen religiösen Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt, sondern um den in den jüdischen Schriften vielfach bezeugten politisch-theologischen Gegensatz zwischen der Treue des Gottes Israels zu seinem Volk Israel und den falschen Göttern, die jede Art von Unterdrückung und Ausbeutung legitimieren:
Was auch immer oder wer auch immer der „Paraklet“ sein mag, er/sie/es ist auf alle Fälle der absolute Widerspruch zu dem, was in der Weltordnung Roms gang und gäbe ist. Deswegen ist diese Inspiration bleibend bei und mit den Schülern. Paraklet ist das, was die Treue zum Zentrum aller politischen Praxis macht. Eine „Gestalt“ muss man sich darunter nicht vorstellen; überhaupt sind Vorstellungen („Bilder“) in dieser Tradition ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man weiß, dass Treue für Rom geradezu eine unpolitische Kategorie ist (Pilatus: „Was ist schon Treue?“ 18,38) und der paraklētos oder das pneuma gerade Treue (alētheia) als Wesenbestimmung hat, dann weiß man genug. Der Anwalt, die Inspiration der Treue, wird gegeben, wenn das Gebot der Solidarität mit dem Messias und untereinander gewahrt wird. Der Ort der Solidarität, die messianische Gemeinde, wird durch die Treue inspiriert und ist so der Gegenentwurf zur herrschenden Weltordnung.
↑ Johannes 14,18-21: Jesu zukünftige Gegenwart bei denen, die seine Gebote halten
14,18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen;
ich komme zu euch.
14,19 Es ist noch eine kleine Zeit,
dann sieht die Welt mich nicht mehr.
Ihr aber seht mich,
denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.
14,20 An jenem Tage werdet ihr erkennen,
dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
14,21 Wer meine Gebote hat und hält sie,
der ist‘s, der mich liebt.
Wer mich aber liebt,
der wird von meinem Vater geliebt werden,
und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
[11. November 2022] Indem Jesus (W424) nach der Verheißung der „Geisteskraft als Beistand“ in Vers 18 auch noch „seine eigene künftige Anwesenheit“ ankündigt, wird Klaus Wengst zufolge (W424f.)
dieselbe Sache noch einmal anders gesagt; es liegt eine sachliche Parallele vor. Er verspricht seinen Schülern: „Ich will euch nicht verwaist zurücklassen.“ Der Anschein ist gegenteilig: Jesus geht in den Tod; seine Schüler bleiben zurück. Dennoch sollen sie nicht verwaist sein. Jesus spricht hier nicht als Vater zu Kindern, sondern als Lehrer zu Schülern.
„Dem entspricht“, wie Wengst an Hand einer Reihe rabbinischer Quellen feststellt,
„das Bild vom Lehrer als Vater in der rabbinischen Tradition. … Eine Generation in Israel ohne Lehrer wäre verwaist. Wo es fähige Lehrer gibt, kommt Gottes Wort, weil ausgelegt, als lebendig im Volk zur Wirkung.
Aber wie kann Jesus, der „für seine Gemeinde … der Lehrer schlechthin“ ist, sein Versprechen wahrmachen: „Ich komme zu euch“? Wengst erwägt drei verschiedene Antworten auf diese Frage von Weiß, Zahn und Wilckens <1040> und gelangt zu der Schlussfolgerung, dass nach dem Kontext „alle drei Möglichkeiten“ denkbar sind, „sodass nach deren Zusammenhang gefragt werden und keine einseitige Festlegung erfolgen sollte.“ Nach Weiß ist „sein Wiedererscheinen nach der Auferstehung gemeint“, nach Zahn „die endgiltige Rückkehr Jesu aus der oberen Welt zu seiner auf Erden lebenden Gemeinde, seine Parusie“, und nach Wilckens „wird dieses Kommen Jesu ‚im Kommen des Geistes geschehen‘“.
In Vers 19 stellt Jesus wieder die „Welt“ und die „Schüler“ Jesu einander gegenüber:
„Noch eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr.“ Bis zu seinem Tod ist es nur noch „eine kurze Zeit“. Dann nehmen ihn Außenstehende nicht mehr wahr, gilt er für sie als erledigt. Mit seiner Hinrichtung sind für die Welt die Akten über ihn geschlossen. Für sie wird er, der so „weggeht“, auch wirklich weg sein. Nicht aber für seine Schüler: „Ihr aber seht mich, weil ich lebe.“ „Ich lebe“ – das sagt hier derjenige, der in den Tod geht. So erklingt an dieser Stelle die Osterbotschaft.
Diese Botschaft werden „Mirjam aus Magdala“ und „zehn Schüler“ (20,18.25) in der Weise bezeugen, dass sie „den Herrn gesehen“ haben:
Dieses nur begrenzte Sehen ist für die lesende und hörende Gemeinde schon wieder Vergangenheit und doch weiß auch sie sich mit den Schülern von Jesus angeredet, wenn er fortfährt: „Und ihr sollt auch leben.“ Sie erfährt Leben und erhält die Zusage von Leben, das nicht mehr in Frage gestellt werden wird, indem sie sich auf die Osterbotschaft einlässt und sich an das Vermächtnis Jesu hält. Darin nimmt sie ihn als lebendig Gegenwärtigen wahr. In ihrer Lebendigkeit spiegelt sich wider, dass er lebt.
Mit den Worten: „An jenem Tag werdet ihr erkennen“, nimmt Jesus in Vers 20 das zuletzt in Vers 17 angesprochene „Thema des Erkennens … wieder auf. Dabei (W426)
bezieht sich die Zeitbestimmung „an jenem Tag“ zuerst auf den Ostertag. Wie aber dort schon weiter geblickt wurde auf die in diesem Tag gründende Zeit der Gemeinde, ist diese auch hier mit einbeschlossen. Schließlich klingt in der Wendung „an jenem Tag“ die Tradition vom endzeitlichen Kommen Jesu an, von seiner Parusie. … Der von Ostern her gegebene Geist ist damit zugleich die Kraft, die jetzt schon Tote lebendig macht und die zugleich die Verheißung auf den endgültigen Durchbruch des Lebens gegen den Tod festhält (vgl. 5,24-29).
Schon in Vers 10 und 11 war davon die Rede gewesen, „dass der Sohn beim Vater und der Vater beim Sohn ist“. Hier werden nun mit der Formulierung, „dass ich bei meinem Vater bin und ihr bei mir seid und ich unter euch bin“, über
die dortige Aussage hinaus … nun auch die Schüler Jesu in diese Beziehung mit hineingenommen. Wie es dort darum ging, dass im Tun – und Erleiden – Jesu Gott zum Zuge kommt, so wird damit hier gesagt, dass im Leben und Handeln seiner Schülerschaft Jesus zum Zuge kommt.
Das wiederum geschieht im „Halten seiner Gebote“, was in Vers 15 „als Bedingung der Liebe zu ihm“ genannt worden war und was jetzt in Vers 21 wiederaufgenommen wird, indem „Bedingung und Folge miteinander“ ausgetauscht werden:
„Diejenigen, die meine Gebote haben und sie halten, die sind es, die mich lieben.“ Wenn dieselben Inhalte wechselweise als Bedingung und Folge erscheinen können, sind sie der Sache nach identisch, besteht die Liebe zu Jesus im Halten seiner Gebote und ist das Halten seiner Gebote Ausdruck der Liebe zu ihm. Mit diesen Aussagen umschließt Jesus die Ausführungen über den verheißenen Beistand und seine in diesem gegebene künftige Anwesenheit. Er ist daher so in seiner Schülerschaft gegenwärtig, dass sie sich kraft des Geistes an sein Vermächtnis hält.
Für diejenigen, „die das tun und so Jesus lieben“, folgen weitere Verheißungen, erstens: „Sie werden von meinem Vater geliebt werden.“ Es ist dieser Vater, der nach 3,16 „in der Hingabe des Sohnes die Welt geliebt hat“ und der nach 3,35 „den Sohn liebt“, der gemäß 10,17 „sein Leben einsetzt“. Wer also „das Vermächtnis Jesu befolgt“, bleibt „nicht ohne die liebende Antwort dessen“, der Jesu Lebenshingabe ermöglicht hat. Außerdem verheißt Jesus entsprechend
der Einheit des Wirkens von Vater und Sohn (10,30) … denen, die ihn im Halten seiner Gebote lieben, sie auch seinerseits zu lieben, und fügt hinzu: „Und ich werde mich ihnen zeigen.“ Denjenigen, die sich darauf einlassen, dass auf dem Weg Jesu in den Tod Gott mitgeht und den Tod überwindet, und die sich deshalb an das Vermächtnis Jesu halten, wird die neue Gegenwart Jesu kraft des Geistes zur Gewissheit werden. Ihnen wird er sich in ihrem Leben und Handeln als lebendig und gegenwärtig erweisen. Daneben klingt in diesem letzten Satz auch ein Hinweis auf die Ostererscheinungen an.
Nach Hartwig Thyen (T632) unterscheidet Jesus in Vers 18 „das Versprechen seiner eigenen Wiederkunft … vom Kommen des Geist-Parakleten ebenso deutlich“, wie er es
zugleich unlösbar mit ihr verknüpft …, indem er erklärt: „Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme (vielmehr) zu euch! Es dauert nur noch eine kleine Weile, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr dagegen werdet mich sehen, denn ich lebe und so sollt auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin und daß ihr in mir seid, so wie ich in euch bin“.
Anders, als es Wengst und seine Gewährsleute sehen, kann in Thyens Augen die
Wendung eti mikron {noch [eine] kleine [Zeit]} … unmöglich die Zeit bis zur Parusie Jesu bezeichnen, zumal die ja zur Zeit der Niederschrift des Evangeliums immer noch aussteht, und Jesus so zumindest eine ganze Generation von Christen als Waisen in der Welt zurückgelassen hätte. Und da sich auch Johannes die endzeitliche Parusie Jesu schwerlich anders denn als ein weltöffentliches Geschehen vorgestellt haben dürfte, könnte er von diesem Kommen Jesu ja auch kaum gesagt haben, daß die Welt ihn dann nicht sehen könne.
Mit dem eti mikron nimmt Jesus eine Formulierung aus 13,33 auf, wo er gesagt hatte:
„eti mikron meth‘ hymōn eimi { (nur) noch eine kleine Weile bin ich bei euch}. (Danach) werdet ihr mich suchen, doch wie ich den Juden bereits gesagt habe: Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht gelangen (7,34), so sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht gelangen“.
Daher kann sich nach Thyen auch die „Wiederaufnahme dieses Verses“ in 14,19
nur auf Jesu unmittelbar bevorstehendes Weggehen in den Tod am Kreuz als seine Verherrlichung beziehen und darum muß das hymeis de theōreite me {ihr aber werdet mich sehen}, das er den Jüngern, nicht aber der blinden Welt verheißt, auf das österliche Wiedersehen bezogen werden.
Zur Begründung dafür, dass „es sich hier um eine absichtsvolle Wiederaufnahme von 13,33 mit dem anschließenden Liebesgebot (13,34f) handelt“, verweist Thyen weiter auf das Wort orphanoi {Waisen}, „das den dort als teknia {Kindlein} Jesu Angeredeten entspricht“, und auf „Jesu erneute Rede von seinen entolai {Geboten} und von der wechselseitigen Liebe (agapan) zwischen Jesus, seinem Vater und den Jüngern in V. 21.“
Vor allem aber nimmt Thyen ernst, dass „die Jünger, wie Jesus ihnen in 13,33 gesagt hatte, von sich aus nicht dahin gelangen können, wohin er gehen wird“. Aus diesem Grund „kommt er in Kürze zu ihnen. Dann werden sie ihn sehen, weil er (der am Kreuz Gestorbene) lebt und auch sie (kraft seines Todes) leben werden.“
Und eben weil (T632f.) „Jesus seinen Jüngern in Kürze (eti mikron) als unmittelbares Objekt ihrer Liebe entzogen sein wird, kann sich ihre Liebe zu ihm fortan nur noch im Halten seiner Gebote äußern“, was Jesus nochmals in Vers 21 feststellt und weiter entfaltet:
Wer an meinen Geboten festhält und sie erfüllt (ho echōn tas entolas mou kai tērōn autas), der ist derjenige, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. … Die reflexive Wortverbindung emphanizō seauton bedeutet: sich zeigen, sich offenbaren. Bei Mt 27,53 heißt es von denen, die beim Sterben Jesu, als die Erde bebten und der Vorhang im Tempel zerriß, aus ihren Gräbern auferstanden und sich in die heilige Stadt begaben, daß sie dort von vielen gesehen wurden (Passiv: emphanisthēsan pollais). Ähnlich dürfte es in unserem V. 21 stehen: Der getötete Jesus wird sich seinen Jüngern als Lebendiger zeigen und damit seine Verheißung erfüllen: hymeis de theōreite me {ihr werdet mich sehen} (V. 19).
Nach Ton Veerkamp <1041> besteht ein „letztes Element der Antwort an Philippus“ in der Bewertung der Abwesenheit des Messias. Erneut begreift er den kosmos im Gegenüber zur Schülerschaft Jesu nicht einfach neutral als Außenstehende, sondern als die herrschende römische Weltordnung, durch die Jesus aus dem Weg geräumt werden wird. Dieser Abschied Jesu wird nach den Versen 18 und 19
nicht bedeuten, dass die messianische Gemeinde verwaist ist. Für Rom bedeutet diese Abwesenheit, dass der Messias keine politische Rolle mehr spielt; Rom hat ihn hingerichtet, und das Problem ist damit erledigt. Bis heute erledigt man in römischer Weise Probleme mit Gewalt. „Ein wenig“ (mikron) wird die Weltordnung dem Messias keine Beachtung mehr schenken (theōrei), aber die Schüler werden ihm Beachtung schenken. Das Wörtchen mikron, das schon 13,33 anklang, wird sich noch als ein gewaltiges Problem erweisen, 16,16ff.
Die Erkenntnis, die Jesu Schüler dadurch erhalten, dass sie dem „Messias Beachtung schenken“ und dass er ihnen versichert: „Ich lebe und ihr werdet leben“, drückt Jesus in Vers 20 und 21 mit folgenden Worten aus:
„Ich mit meinem VATER, ihr mit mir und ich mit euch“, das ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist dreifach:
Wer die Gebote behält und sie wahrt,
der ist es, der solidarisch mit mir ist. (1)Wer solidarisch mit mir ist,
der wird Solidarität durch meinen VATER erfahren. (2)Folglich:
Und ich werde solidarisch mit ihm sein, (3)
ich werde mich selbst vor ihm als wirklich erweisen.
Diese „Umschreibung für emphanizein …: „sich selbst als wirklich erweisen“ begründet Veerkamp folgendermaßen:
Emphanizein kommt in der LXX zweimal vor, beide Male in Exodus 33: in V.13 für „sich erkennen lassen, sich zu erkennen geben“, und in V.18 für „sich sehen lassen“ (aber dort nur in einer Handschrift). Da es in Kapitel 14 um „Gott sehen“ geht, könnte Exodus 33 der Hintergrund sein. Der Kernsatz dort, „Nicht sieht MICH der Mensch und lebt“ (33,20), ist Grundvoraussetzung für die Theologie des Johannes; vgl. 1,18 und auch 1 Johannes 4,12. An eine Theophanie {Gotteserscheinung} ist nicht gedacht; hier schreibt die LXX immer ōphthē. Die in 14,21-22 zumeist gewählte Übersetzung mit „offenbaren“ ist weniger geeignet. Für „offenbaren, öffentlich machen“ hat Johannes immer phaneroun. „Gott sehen“ heißt: Jesus als Messias erkennen.
Daraus folgt nach Veerkamp für die Auslegung von Vers 21:
Der Messias ist für den, der ihm vertraut, mit ihm solidarisch ist und sein Gebot wahrt, wirklich, er bestimmt das Leben derer, die ihm vertrauen, real. Schön. Aber ist das mehr als eine Einbildung der Gruppe, mehr als eine Halluzination von Leuten, die sich in die Isolierung manövriert haben? Am Gang der Weltordnung ändert das nichts. Es geht um nichts mehr oder weniger als um die Wirklichkeit des Messias und um den Realitätssinn der messianischen Gemeinde.
Dass diese Einschätzung Jesu auch von den Schülern Jesu mit ebensolcher Skepsis aufgenommen wird, wird sich sofort im nächsten Vers 22 zeigen.
↑ Johannes 14,22-26: Wie sich Jesus seiner Schülerschaft zu erkennen gibt und nicht dem kosmos
14,22 Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot:
Herr, was bedeutet es,
dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt?
14,23 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten;
und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm nehmen.
14,24 Wer aber mich nicht liebt,
der hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort,
sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.
14,25 Das habe ich zu euch geredet,
solange ich bei euch gewesen bin.
14,26 Aber der Tröster, der Heilige Geist,
den mein Vater senden wird in meinem Namen,
der wird euch alles lehren
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
[12. November 2022] Der Schüler (W426), der in Vers 22 von Johannes „als ‚Judas, nicht der Iskariot‘, eingeführt wird, begegnet nach Klaus Wengst (Anm. 96) in anderen Texten des Neuen Testaments
sonst nur in den Katalogen in Lk 6,16 und Apg 1,13 als „Judas, (der Sohn) des Jakobus. Er steht dort an der Stelle des Thaddäus in den Katalogen bei Matthäus (10,3) und Markus (3,18).
Nachdem Jesus angekündigt hat (W426), „sich den ihn Liebenden zu zeigen“, stellt dieser Judas ihm die Frage (W427): „Herr, wie kommt es, dass du dich uns zeigen willst und nicht der Welt?“ In den Augen von Wengst ist diese Frage der „Sache nach … eine Frage, die von außen kommt“, und zieht eine Parallele zum beißenden Spott des Kelsos, <1042> der „in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts“ als „der älteste uns literarisch überlieferte Bestreiter des Christentums“ auftritt:
„Wenn Jesus wirklich göttliche Macht offenbaren wollte, hätte er gerade denen, die ihn misshandelt hatten, und dem, der ihn verurteilt hatte, und überhaupt allen erscheinen müssen. […] Er fürchtete doch wohl nicht mehr irgendeinen Menschen, nachdem er gestorben und, wie ihr behauptet, Gott war; er ist auch durchaus nicht dazu geschickt worden, damit er verborgen bliebe. […] Als ihm bei seinem leibhaftigen Auftreten nicht geglaubt wurde, verkündigte er maßlos allen; als er aber, nachdem er von den Toten auferstanden war, einen starken Glauben hervorgerufen hätte, erschien er nur einem einzigen Weibsbild und seinen Vereinsgenossen heimlich und nebenbei. […] Als Bestrafter zeigte er sich also allen, als Auferstandener aber nur einer Person, wo doch das Gegenteil hätte der Fall sein müssen“.
Unter Hinweis auf Apostelgeschichte 10,40f. hält es Wengst für „wahrscheinlich, dass in dieser Weise schon viel früher Anfragen gestellt wurden.“ Dass es hier ein Schüler ist, der „sozusagen nach objektiver Kontrolle in einem Bereich verlangt, in dem es nur das subjektive Experiment geben kann“, ist ein Beleg dafür, dass auch innerhalb der Gemeinde Jesu die „Gewissheit über die Gegenwart Jesu … immer wieder neu gewonnen werden“ muss.
In seiner Antwort (Verse 23-24) „wiederholt“ Jesus eine ganze Reihe „vorher gemachte[r] Aussagen“:
„Diejenigen, die mich lieben, werden mein Wort halten“ und …: „Diejenigen, die mich nicht lieben, halten meine Worte nicht.“ Statt von seinen „Geboten“ ist jetzt von seinem „Wort“ und seinen „Worten“ die Rede. Doch kann darunter nichts anderes als unter den Geboten verstanden sein, da auch das Wort und die Worte „gehalten“ werden sollen. So sind hier das Wort und die Worte Jesu als wegweisend und gebietend verstanden. Und dass das Wort, das die Schüler von Jesus zu hören bekommen, nicht seins ist, sondern „das des Vaters, der mich geschickt hat“, haben die das Evangelium Lesenden und Hörenden hinsichtlich der Lehre Jesu schon 7,16 vernommen. Wiederholung ist auch die an das Halten des Wortes Jesu geknüpfte Verheißung: „Und mein Vater wird sie lieben.“
Mitten drin aber, am Ende von Vers 23, ergänzt Jesus eine Aussage, die „an den Anfang des Kapitels“ erinnert, wo „Jesus von den vielen Wohnungen im Haus seines Vaters gesprochen und seinen Schülern verheißen“ hat, „zu gehen und ihnen einen Ort zu bereiten.“ Die „Bewegung“ dieser Aussage kehrt er nun um:
„Und zu ihnen wollen wir kommen und uns eine Bleibe bei ihnen verschaffen.“ …Gott und Jesus kommen, um sich bei denen eine Bleibe zu verschaffen, die das von Jesus vermittelte Wort Gottes, die seine Gebote halten. War die Ortsangabe in V. 2f. nicht als Weltflucht verstanden, so meint die Ortsangabe in V. 23 keine Verinnerlichung. Dagegen spricht die Rede vom Halten der Gebote bzw. des Wortes. Wie in der jüdisch-rabbinischen Tradition ist die Vorstellung vom Einwohnen Gottes mit dem Tun des Gebotenen verbunden. Das von Gott in Jesus gesprochene Wort weist ein in den durch Jesu Tod eröffneten Raum geschwisterlicher Liebe. Dem Evangelisten Johannes geht es so um die Gemeinde als den Ort der neuen Gegenwart Jesu kraft des Geistes.
An dieser Stelle hält Wengst (W428) die Antwort Jesu auf Judas offenbar für beendet, denn in Vers 25 hebt Jesus dazu an, den gesamten „Hauptteil seiner ersten Abschiedsrede“ abzuschließen:
Er blickt zunächst auf sein Reden überhaupt zurück: „Das habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weilte.“ Das war ein anderes Weilen, nämlich ein leibhaftiges – nach ihm hatten schon gleich die ersten Schüler in 1,38 gefragt -, als das gerade angekündigte. Das in der Zeit seines Verweilens unter ihnen Gesagte ist nun Vergangenheit. Aber die Perfektform des Verbs zeigt an, dass dieses Reden in Geltung bleibt. Es wird darin immer wieder Geltung gewinnen, was Jesus anschließend ausführt: „Und der Beistand, die heilige Geisteskraft, die der Vater in meinem Namen schicken wird, die wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Die Belehrung des Geistes besteht nicht in etwas Neuem, sondern in der Erinnerung.
Diese „Erinnerung an Jesus“ ist nicht einfach das Gedenken an einen Toten; vielmehr „ist und bleibt“ Jesus „durch die Ostererfahrung“ eben „nicht ein ein für alle Mal Gewesener“. Darum kann sich Jesus „beim Erinnern in der Gemeinde als lebendig“ erweisen, kann „sein damaliges Wort schöpferisch neu gesprochen“ werden, kann er „sich im Zeugnis seiner Schülerschaft (vgl. 15,26f.) schon selbst zu Gehör und in Erinnerung bringen“. Den „Geist“ versteht Wengst als „die Kraft solcher lebendigen Erinnerung, des je neuen Begreifens Jesu. Er ist die Kraft der Wiederholung.“ Und es sind „die Evangelien“, die als „Zeugnisse der geistgewirkten Erinnerung an Jesus“ dienen, wobei besonders das Johannesevangelium als „vergegenwärtigende Neuformulierung des Überlieferten“ zu lesen ist:
Das Nebeneinander von „lehren“ und „erinnern“ macht deutlich, dass es beim Erinnern eben nicht um ein einfaches Wiederholen geht, sondern das vergangene Reden Jesu wird so wieder geholt dass es in gegenwärtiger Lehre neu ausgedeutet wird. Die in solcher Geistesgegenwart erfolgende Neufassung des über Jesus Tradierten kann es – vordergründig gesehen – sehr verändern, wie das beim Johannesevangelium offensichtlich der Fall ist. Und doch besteht der Anspruch, dass gerade und nur so die authentische Stimme Jesu laut wird.
Eine solche geisterfüllte Auslegung des von Jesus Erinnerten, die das damals Gesagte erheblich verändern kann, vergleicht Wengst mit „der Auslegung der Tora in der rabbinischen Tradition“. Er erwähnt die eindrückliche Geschichte <1043> „von Mose im Lehrhaus Rabbi Akivas“:
Obwohl dort nur Mose ausgelegt wird, versteht Mose nichts, als er im Lehrhaus Rabbi Akivas anwesend ist; und doch gelten alle Auslegungen als „Halacha des Mose vom Sinai“ … Dasselbe bleibt nicht dasselbe, wenn es in veränderter Situation nur einfach wiederholt wird. Es muss anders gesagt werden, um dasselbe bleiben zu können.
Hartwig Thyen (T633) nimmt an, dass der in Vers 22 näher als ouk ho Iskariōtēs {nicht der Iskariote} bezeichnete Judas „unter dem Eindruck der Rede Jesu von „jenem Tag“ (hē ekeinē hē hēmera) … seinen Herrn, ähnlich wie Zahn (s.o.)“, missversteht, indem er dabei an „das eschatologische Erscheinen des Weltenrichters“ denkt und ihn „nun verwundert fragt: Herr, wie soll das denn zugehen, daß du dich allein uns, nicht aber der Welt zeigen willst?“ Aber ist dieses Missverständnis nicht allzu verständlich, wenn die Schülerschaft Jesu doch vom Messias Jesus die Überwindung dieses Kosmos und den Anbruch der kommenden Weltzeit erwarten? Immerhin ist,
seit Amos (5,18ff) den jom jhwh {Tag des HERRN, Tag JHWHs} beschwor, … dessen Bezeichnung als jener Tag nahezu zum terminus technicus {stehende Wendung für den Tag der Entscheidung, des Weltgerichts} geworden. Das zeigen Jes 2,11.17; Sach 12,3f.6.8f; 14,6; äthHen 45,3f; 63,38, der Sprachgebrauch der Rabbinen sowie im Neuen Testament Mt 7,22; Lk 10,12; 17,31; 2Thess 1,10; 2Tim 4,8; vgl. Röm 2,16; Mk 13,32; u.ö. Da Johannes, ähnlich wie Matthäus (s. o.) und viele der übrigen urchristlichen Zeugen, diesen Tag JHWHs mit der Auferstehung Jesu von den Toten bereits angebrochen sieht, ist die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks an jenem Tage wohl absichtsvoll.
Äußerst kritisch geht Thyen mit einer Deutung der Frage des Judas um, die ähnlich auch Wengst vertritt und die Thyen bei Dietzfelbinger <1044> findet. Dieser (T633f.)
verläßt hier die Welt des Textes und fragt: „Welchem geschichtlichen Anlaß … diese im Neuen Testament singuläre Frage entsprungen“ sein könne. Und er vermutet: „Wahrscheinlich ist sie Reflex antichristlicher Polemik, in Jüngerbesorgnis gehüllt, und noch in dieser Verhüllung ist Kritik und Hohn solcher Polemik vernehmbar: Die Rede von Jesus, dem Auferstandenen, ist unglaubwürdig, weil sie nur von der Zeugenschaft seiner Anhänger getragen wird. Deren Zeugnis aber ist von durchsichtigem Interesse bestimmt: Die alte Anhänglichkeit an Jesus läßt den Getöteten zum Lebendigen werden“.
Mit unverhüllter Ironie (T634) hält es Thyen „für eine absurde Idee“,
daß Johannes hier seine vermeintlich apologetische Absicht derart fein in die Besorgnis des Judas gehüllt haben sollte, so daß das außer Dietzfelbinger bisher keiner je bemerkt hat…, zumal Johannes der von Dietzfelbinger hinter dem Einwand des Judas vermuteten antichristlichen Polemik ja nichts entgegensetzt, sondern ihr eher neue Nahrung gäbe. Uns scheint darum eine Deutung der Frage des Judas im Horizont johanneischer ,Mißverständnisse‘ wahrscheinlicher.
Dem entspricht es nach Thyen, dass Jesus in Vers 23 keine neuen Argumente liefert, sondern dem Judas einfach „mit der Wiederholung des Liebesgebotes aus V 15“ antwortet:
„Wenn einer mich liebt wird er mein Wort bewahren (ton logon mou tērēsei)“ und mit der Verheißung „dann wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und unsere Wohnung bei ihm bereiten (eleusometha kai monēn par‘ autō poiēsometha)“.
Dass Jesus nun das Wort entolas {Gebote} aus Vers 15 durch das Wort logous {Worte} ersetzt, ist nach Thyen „nur ein weiteres Beispiel für die Vorliebe unseres Evangelisten, mit Synonyma zu spielen, und nicht etwa eine absichtsvolle oder gar wertende Unterscheidung zwischen Jesu Gebot und seinem Wort.“ Dass bei Johannes
von einer Abrogation {Aufhebung} der Tora bei Johannes nirgendwo die Rede ist und sich bei ihm auch keine entsprechende Andeutung findet, sondern die Geltung der Tora vielmehr stets vorausgesetzt ist, hat Augenstein <1045> in seinem Beitrag: „Jesus und das Gesetz im Johannesevangelium“, scharfsinnig erwiesen: „Das Gesetz und die Schrift zeugen von Jesus. Sie machen sein Tun verständlich. Durch sein Handeln legt er das Gesetz aus. Das Gesetz stellt den Anspruch Jesu heraus und legitimiert ihn. Gleichzeitig verurteilt es seine Gegner der Gesetzesübertretung. In all seinen Funktionen bleibt das Gesetz Gottes Gabe. Dem Gesetz kommt deshalb eine Schlüsselrolle im Joh zu, die weit über das traditionelle Schema von Verheißung und Erfüllung hinausweist. Das Joh zeigt vielmehr die Einheit von Christusgeschehen und dem in der Schrift niedergelegten Willen Gottes auf und bezieht sie so auf Christus, daß es ihren Ursprung in der Fülle des Logos sucht“.
Mit der Vorstellung von Vers 23, dass Jesus und der Vater gemeinsam zu dem kommen werden, der ihn liebt, und sich bei ihm ihre Wohnung bereiten,
nimmt der Erzähler das Stichwort monē {Bleibe} aus der einleitenden Rede Jesu von den himmlischen Wohnungen in seinem Vaterhaus (14,2f) wieder auf. Er tut das freilich nicht im Zuge einer entmythologisierenden Destruktion von deren apokalyptischem Hintergrund zugunsten seiner vermeintlich rein präsentischen Eschatologie…, sondern er kann das tun, weil für ihn gilt, „daß die biblischen Zeugnisse präsentischer Eschatologie der Sache nach von denen futurischer her ihre Wirklichkeit haben, umgekehrt aber unser futurisches Sprechen in der Schule der Gegenwart (‚präsentischer Eschatologie‘) gelernt werden kann“. Und daß es darum unmöglich ist, „die beiden Gestalten biblischer Eschatologie gegeneinander ausspielen zu wollen“. <1046>
In Vers 24 nimmt Jesus wieder auf, was er in Vers 21 „vor dem Einwand des Judas“ gesagt hatte, und beendet so auch in Thyens Augen die Antwort auf Judas:
Wer mich nicht liebt, der wird auch meine Worte (= Gebote s. o.) nicht halten. Und der Logos, den ihr gehört habt, ist nicht mein Wort, sondern (das Wort) dessen, der mich gesandt hat.
Es folgt Thyen zufolge in den Versen 25 und 26 eine nähere Erläuterung der Rolle des in 14,16 erstmalig erwähnten Parakleten (T634f.):
„Das (alles) habe ich euch gesagt, solange ich bei euch bin. Der Paraklet aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren, indem er euch an alles erinnert, was ich euch gesagt habe.“
Dabei versteht Thyen das
kai zwischen ,er wird euch alles lehren‘ und ,er wird euch an alles erinnern‘ … als ein epexegetisches {erläuterndes}: Der Geist lehrt alles dadurch, daß er an alles von Jesus Gesagte erinnert. Wie Jesu Logos, nicht sein eigener, sondern der Logos dessen ist, der ihn gesandt hat (V. 24), so ist auch die Lehre des Geist-Parakleten nicht seine, sondern nur die Erinnerung an Jesu Worte und Taten, ein Erinnern, das den Glaubenden freilich jenseits aller Mißverständnisse des Irdischen erst erschließt, wer dieser Jesus wirklich war, ist und in aller Zukunft sein wird. Gerade indem er so an den Weg des historischen Jesus erinnert, fügt der Geist ihm aber nichts hinzu, sondern deckt nur auf, was da, unter Zeichen und Mißverständnissen verborgen, wirklich geschah.
Damit ist klar, dass es „auf dem Wege historischer Rekonstruktion“ unmöglich ist, den „wirkliche[n] Jesus“ zu entdecken, „ihn vermag allein der Glaube zu sehen, den erst der Geist der Wahrheit ‚ereignet‘. Zu diesem transitiven Gebrauch des Lexems ‚ereignen‘ als einer vox media {mittleren oder vermittelnden Stimme} zwischen in gleicher Weise unzureichenden ontologischen Seinsaussagen und technologischen Funktionsaussagen über Gott und Jesus Christus“ verweist Thyen auf Ratschow. <1047>
Ton Veerkamp <1048> identifiziert den Schüler „Judas Nicht-Iskariot“ zugleich als einen „der Brüder des Herrn“, was mich zunächst überrascht hat. Dabei könnte er an den Brief des Judas denken, in dessen erstem Vers sich Ioudas als „ein Sklave von Jesus, dem Messias, und ein Bruder von Jakobus“ vorstellt, wobei Letzterer als „Bruder des Herrn“ bekannt ist. Abgesehen davon entspricht die hier vorgestellte Haltung dieses Judas derjenigen der Brüder Jesu in 7,2-10, indem er Jesu Aussage in 14,21, dass die „Wirklichkeit des Messias“ in der „Solidarität der Schüler“ besteht, „als mangelhafte Wirklichkeitsmächtigkeit bzw. Realitätssinn“ auffasst. Er fragt ja: Warum ist der Messias nur wirkmächtig für diejenigen, die auf ihn vertrauen?
„Warum also nicht wirklich für die Weltordnung?“ Dieser Einwand entspricht der Aufforderung der Brüder Jesu, sich öffentlich als Messias zu erkennen zu geben, 7,4: „Offenbare dich der Weltordnung (phanerōson seauton tō kosmō).“ Dann wäre das Problem gelöst. Der Messias hat aber mit seiner Verborgenheit geantwortet.
Im Grunde geht es also nochmals um die zentrale Frage, warum der Messias sich von Rom umbringen lässt, statt dem Imperium in einem triumphalen Feldzug endgültig den Garaus zu machen und so die Endzeit der kommenden Weltzeit des Friedens einzuläuten. Oder andersherum gefragt: Wenn Jesus zu Letzterem eben nicht imstande ist, sondern sich aus dieser Welt(ordnung) verabschiedet, aber seine Schüler dennoch romfeindlich auftreten, beschwören sie dann nicht unabsehbare Gefahren herauf?
Dieses Problem ist in allen messianistischen Kreisen äußerst dringend. Da sich der Messias Rom gegenüber nicht als die ausschlaggebende Wirklichkeit erweist, ist für das rabbinische Judentum das Bekenntnis zu Jesus ben Joseph als Messias Israels vollkommen hohl und gefährlich. Seine Schüler könnten durch erneute militärische, aber vollkommen aussichtslose Abenteuer versucht sein, die Wirklichkeit des Messias Rom gegenüber mit der Waffe in der Hand nachzuweisen. Deswegen sei diese Art von Messianismus zu bekämpfen.
Anders als Wengst und Thyen erkennt Veerkamp in den nun folgenden beiden Abschnitten bis zum Ende des Kapitels 14, also dem Ende der ersten Abschiedsrede, die „zwei Teile“ einer Antwort Jesu auf die Frage des Judas. Diese beiden Teile enthalten inhaltlich klar umgrenzte Klärungen:
Erstens die Zusammenfassung der Lehre, 14,23-26. Dann die Alternative: welchen Frieden bringt Rom, welchen der Messias, 14,27-31?
Betrachten wir also zunächst die „Zusammenfassung der Lehre“ Jesu, die in den Augen von Veerkamp „einige Sachen“ zuspitzt. Nach Vers 23 ist die
Solidarität mit dem Messias … das Wahren seiner Gebote, und die Gebote fallen zusammen mit dem einen, neuen Gebot. Dann erweist der Gott Israels seine Solidarität mit Israel (agapēsei); hier ist agapē sachlich deckungsgleich mit ˀemeth, „Treue“. Diese Solidarität oder Treue äußert sich darin, dass „wir zu ihm kommen und uns bei ihm zum Ort von Dauer (monē) machen“. Hier wird die Ankündigung von 14,2 präzisiert, und es wird endgültig klar, dass es sich nicht um eine „Wohnung im Himmel“ handelt. Die Richtung ist, wenn man will, von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Wir kommen nicht in den Himmel; wenn überhaupt kommt der Himmel zu uns.
Im Jahr 2015 hat Veerkamp in seiner Anm. 438 zur Übersetzung von Johannes 14,23 folgende Überlegungen zum Stichwort monē hinzugefügt:
Monē, hebräisch maqom, „Standort“. Der Satz bedeutet, dass derjenige, der seine Solidarität mit dem Messias durch das Wahren von dessen Wort unter Beweis stellt, zum meqom ˀelohim, „Standort Gottes“, wird; einen ähnlichen Gedanken finden wir in 1 Johannes 4,12: „Wenn wir miteinander solidarisch sind, bleibt Gott standfest (menei – monē!) mit/in uns.“ Eine Minderheit der Handschriften hat das Medium poiēsometha geändert in Aktiv: poiēsōmen. Offenbar wurde das Medium nicht verstanden, d.h. verstanden wurde nicht, wie Gott und sein Messias sich zum Ort machen könnten. Der Getreue (pisteuōn) ist der Ort Gottes. „Wohnung nehmen bei ihm“ hat den Beigeschmack „bei ihm einziehen“, was albern ist.
„Vielleicht“, so bemerkt Veerkamp bereits im Jahr 2007 (Anm. 443), will also „Johannes mit dem merkwürdigen Wort monē das angeben, was später im Judentum und vor allem in dessen Mystik Schechina heißen wird, Einwohnung im zerstreuten jüdischen Volk.“ Durch diese „Einwohnung im solidarischen Menschen“, so fährt Veerkamp in seiner Auslegung fort, „werden Gott und der Messias“ wirklich, wirkmächtig. Der folgende Vers 24 betont umgekehrt:
Unwirklich werden Gott und der Messias, wenn es keine Solidarität gibt. So erklärt Jesus dem Judas das Verb emphanizein, „wirklich werden“.
Jesus besteht also darauf, dass es keine andere Art und Weise als diese agapē gibt, durch die Gott in der Schülerschaft des Messias seine Treue erweisen und weltüberwindend wirksam werden kann. Indem er in den Versen 25 und 26 auf den bereits erwähnten paraklētos zurückkommt, erläutert er, wie seine Schüler das, was er sie zu seinen Lebzeiten gelehrt hat, bewahren können:
Dies ist die Summe dessen, was der Messias gesagt hat, „als er bei ihnen blieb“. Das ist die bleibende „Lehre des Messias“, sie muss in lebendiger „Erinnerung“ bleiben, und das ist das Werk jenes „Anwalts“, der hier die Gestalt eines Lehrers annimmt: Nur die „Inspiration der Heiligung“ kann die Schüler das alles lehren, was der Messias gesagt hat.
Denn der Anwalt, paraklētos, advocatus, wirkt von Gott her als „Inspiration der Treue“, pneuma tēs alētheias, und wirkt auf Menschen als „Inspiration der/zur Heiligkeit“, pneuma hagion. In der Schrift ist „heilig“ Nachfolgung Gottes, Leviticus 20,7-8, also keine religiöse Kategorie, sondern Kategorie der politischen Praxis, die praktische Umsetzung der Tora.
Diese Inspiration bedeutet „in Erinnerung rufen“. Ohne die Solidarität gibt es keine lebendige Erinnerung an den Messias, und ohne diese lebendige Erinnerung an den Messias kann es auf Dauer keine Solidarität geben. Messianische Wirklichkeit, das, was als wirklich in Erscheinung tritt, ist der Zusammenhalt der Gruppe. Dort, und nur dort ist Gott, ist der Messias, wirklich.
Veerkamp macht allerdings auch auf Gefahren dieser Lehre des johanneischen Jesus aufmerksam:
Die Wirklichkeitsauffassung des Johannes ist eine sehr verkürzte Sicht auf Wirklichkeit. Man hat den Eindruck, dass Judas Nicht-Iskariot mit seiner sehr legitimen Frage mit einer sehr verkürzten Antwort abgespeist wird. Das wird in der Geschichte des Christentums während der Moderne – vor allem im Pietismus – weitreichende Folgen haben. Aus dem Leben der kommenden Weltzeit wird das individuelle ewige Leben jenseits von irdischen Orten und Zeiten. Bei Johannes aber ist die Einwohnung Gottes in der messianischen Gemeinde nicht das innere Erlebnis eines kleinen Kreises, sondern auch Kampfansage an die Weltordnung.
↑ Johannes 14,27-31: Jesu Kampfansage gegen den „Frieden“ der Weltordnung
14,27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
14,28 Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe:
Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
Hättet ihr mich lieb,
so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe;
denn der Vater ist größer als ich.
14,29 Und jetzt habe ich‘s euch gesagt, ehe es geschieht,
damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird.
14,30 Ich werde nicht mehr viel mit euch reden,
denn es kommt der Fürst dieser Welt.
Er hat keine Macht über mich.
14,31 Aber die Welt soll erkennen,
dass ich den Vater liebe
und tue, wie mir der Vater geboten hat. –
Steht auf und lasst uns von hier weggehen.
[14. November 2022] Nach Klaus Wengst (W429) spricht Jesus im „abschließenden Teil der ersten Abschiedsrede“ in den Versen 27-31
den Schülern – und mit ihnen der Gemeinde – seinen Frieden zu und nimmt in erweiterter Form die Mahnung von V. 1 auf (V. 27). Er fasst die ganze Rede in knappster Formulierung zusammen (V. 28) und stellt ihre Funktion heraus (V. 29). Nachdem Johannes die Lesenden und Hörenden über den Tod Jesu als ihnen zugutekommenden Weggang zum Vater belehrt hat, kann er zum Passionsgeschehen überleiten (V. 30f.).
Welcher Art ist der Friede, den Jesus in Vers 27 mit den Worten: „Frieden lasse ich euch zurück. Meinen Frieden gebe ich euch“, hinterlässt? Wengst stellt vergeistigte und weltflüchtige Interpretationen von Zahn und Bultmann einer „erfrischend“ bodenständigen von Calvin <1049> gegenüber. Während Zahn diesen Frieden als „die befriedigte und befriedigende Verfassung der Seele“ versteht und Bultmann „als ‚das eschatologische Heil‘, die den Glaubenden geschenkte ‚Möglichkeit ihrer Existenz‘ als Freiheit von der Welt“, greift Calvin auf die biblische Überlieferung zurück:
„Unter Frieden versteht Christus glückliches Ergehen, wie die Menschen es sich zu wünschen pflegen, wenn sie sich treffen oder auseinandergehen. Denn das bedeutet Friede im Hebräischen.“ Solcher Frieden stellt sich als Wirkung des Todes Jesu ein, wo auf sein Vermächtnis vertraut und ihm gefolgt wird, wo die Bedrängten untereinander Solidarität üben und Solidarität erfahren.
Auf das „Gegenbild“ zu diesem Frieden spielt Jesus sofort unmissverständlich an:
„Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.“ Dieses Gegenbild, wie die Welt Frieden gibt, stand der Leser- und Hörerschaft des Evangeliums in Gestalt der Pax Romana unmittelbar vor Augen. Es tritt auch im Johannesevangelium in Erscheinung. Die römische Macht gibt „Frieden“ durch militärischen Einsatz (11,48) und um der Friedenssicherung und Machterhaltung willen schreckt sie auch nicht, wie die Passionsgeschichte zeigen wird, vor der Hinrichtung eines Unschuldigen zurück.
Insofern enthält der „Anspruch Jesu, Frieden zu bringen“, wie Wengst unter Berufung auf Bill Salier <1050> meint, „eine polemische Schärfe“:
„Die imperialen Untertöne dieses Anspruchs und der beabsichtigte Gegensatz zu alternativen Quellen des Friedens würde von denen wahrgenommen werden, die unter der Wohltat oder auch der Gewalt der Pax Romana lebten“.
Aus „Erfahrungen von Solidarität“ kann dagegen der „Friede Jesu“ entstehen, indem nach Blank <1051> „mit der Gegenwart Jesu in der Gemeinde“ bereits „die Anwesenheit der neuen Welt“ erfahren werden kann:
Wo solche Erfahrungen gemacht werden, weichen Furcht, Feigheit und Resignation. So wiederholt Jesus die Mahnung vom Beginn des Hauptteils in verstärkter Form: „Lasst euch nicht erschrecken und verzagt nicht!“
In Vers 28 schlägt Jesus sodann (W429f.)
das wesentliche Thema des Hauptteils der Rede noch einmal an: „Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe weg und komme zu euch.“ Das hat er im vorangehenden so wörtlich zwar nicht gesagt. Aber genau darum ging es: um sein Weggehen, also seinen Tod, und um sein Kommen, seine Präsenz in der Gemeinde kraft des Geistes, ja genauer um sein Weggehen als Bedingung seines Bleibens im erneuten Kommen.
Was meint Jesus aber nun, wenn er im Blick darauf sagt: „Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, weil der Vater größer ist als ich“? Obwohl es stimmt, was Jesus sagt, denn die „Schüler freuen sich ja nicht, ihre Fragen zeigen Unverständnis und Ratlosigkeit“, sieht Wengst darin keinen „Tadel“ an die Schüler,
sondern eine indirekte Mahnung und Verheißung an die Leser- und Hörerschaft des Evangeliums. Denn Jesus lieben heißt, seine Gebote zu halten, was sich konzentriert in der Erfüllung seines Vermächtnisses, einander zu lieben. Dieses Vermächtnis aber ist begründet im Tod Jesu, mit dem er seiner Schülerschaft die Liebe Gottes vermacht (3,16). Das ist der Anlass zur Freude, der den vorösterlichen Schülern noch verborgen bleibt.
Insofern ist „Jesu Aussage“ nicht so zu verstehen, als erwarte Jesus durch seine Rückkehr zum Vater „großen Vorteil für sich selbst“, wie dies Bauer <1052> mit einem Hinweis auf Sokrates formuliert hat, der sich darüber freute, mit seinem Tod „zu andern Göttern zu kommen, die auch weise und gut sind, und dann auch zu verstorbenen Menschen, welche besser sind als die hiesigen“. Nein, nach Wengst geht es „nicht um einen ‚Vorteil‘ für Jesus, sondern – wenn man schon so reden will – um einen Vorteil für die Schüler“, denn, wie Blank [135] sagt, ist
„das Fortgehen Jesu zum Vater … geradezu die Bedingung für seine bleibende Gegenwart in der Gemeinde“. Erst sein Weggang in den Tod vollendet sein Werk, weil mit diesem Tod sich der größere Vater identifiziert und ihn so nicht bloßes Ende des Lebens Jesu sein lässt, sondern ihn zum Leben wendet. So kommt der Vater für die Schülerschaft Jesu im Helfer Geist zum Zuge, unter dessen Beistand sie das Vermächtnis Jesu erfüllt und darin Frieden und Freude hat.
In Vers 29 argumentiert Jesus „in derselben Weise“ im Blick auf seinen Tod, wie er „in 13,19 in Bezug auf den Verrat des Judas“ geredet hat: „Und jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es geschehen ist, damit ihr glaubt, wenn es geschieht.“ Erneut ist dies aus „nachösterliche[r] Perspektive“ formuliert:
Im Blick auf den Tod Jesu ermutigt Johannes die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde, auf den gerade hier präsenten Gott zu vertrauen. Dieser Tod widerlegt nicht den Anspruch Jesu, von Gott gesandt zu sein. Er ist nicht ihn treffendes blindes Schicksal. Das bringen wieder die Motive zum Ausdruck, dass Jesus seinen Weg in den Tod vorher kennt und ihn bewusst selbst geht.
Mit dem Satz: „Nicht mehr viel werde ich mit euch reden“, deutet Jesus in Vers 30 „das Ende seiner Rede“ an, indem seine Begründung: „Denn es kommt der Herrscher der Welt“, bereits auf seine Festnahme anspielt:
Wer nach 18,3 kommt, ist Judas, in den nach 13,27 der Satan eingegangen war und der in 6,70f. als „Teufel“ bezeichnet wurde. Mit ihm aber kommen nicht nur „Wachleute der Oberpriester und Pharisäer“, sondern vor allem auch eine römische Kohorte, um Jesus festzunehmen und ihn – nach Zwischenstationen bei Hannas und Kajafas – schließlich an Pilatus als seinen Richter zu übergeben.
So wird (W430f.)
dieses Kommen des ‚Herrschers der Welt‘ … seinem Reden mit den Schülern ein Ende machen.“ Dieses Geschehen und das ihm folgende von Verhören, Verurteilung und Hinrichtung wird damit als teuflisch charakterisiert. Es erfolgt unter der Form des Rechts und ist doch nicht rechtens.
Was Jesus hier (W431) über den „Herrscher der Welt“ sagt, kai en emoi ouk echei ouden, ist nach Wengst mit: „Auf mich aber hat er keinen Anspruch“ zu übersetzen. Wörtlich steht da (Anm. 111):
„An mir hat er nichts“. Die griechische Wendung „A hat (nichts) an B“ entspricht der hebräischen „Es gibt für A (nichts) auf B“. Beide haben die Bedeutung: „(k)einen Anspruch auf jemanden haben“.
Und obwohl (W431) „also ‚der Herrscher der Welt‘ keinen Anspruch auf Jesus hat“, geht dieser nach Vers 31 dennoch
den Weg in den Tod, „damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe“. Wie in der Sendung Jesu sich Gottes Liebe zur Welt manifestiert (3,16), so erscheint hier als Ziel die Erkenntnis dieser Sendung durch die Welt. Nur an dieser Stelle ist im Johannesevangelium von der Liebe Jesu zum Vater die Rede. Auch diese Liebe wird sofort als Tun des Gebotenen ausgelegt: „Und wie es mir der Vater geboten hat, so handle ich.“
Daraus, dass Jesus hier eine Erkenntnis der Welt anstrebt, wie er auch (Anm. 113) in 17,21 vom Glauben der Welt reden wird, ergibt sich nach Wengst die Schlussfolgerung, die Frey <1053> folgendermaßen formuliert: „Der vermeintlich geschlossene Gegensatz zwischen Jesus und den Jüngern auf der einen und der Welt auf der anderen Seite wird dadurch aufgebrochen“. Beide setzen dabei eine allgemeine Definition von kosmos als der Menschenwelt voraus, die auf dem Wege der Mission für den Glauben an Jesus gewonnen werden kann. Trotz seiner Einsichten über den Unterschied des Friedens Jesu von der Pax Romana lässt Wengst also nach wie vor die Möglichkeit außer Acht, das Wort kosmos als den Inbegriff der gottfeindlichen römischen Weltordnung zu begreifen.
Wie ist nach Wengst (W431) Jesu „Aufforderung zum Aufbruch“ zu verstehen, mit der er „diese Abschiedsrede“ abschließt: „Steht auf, lasst uns von hier weggehen!“?
In der seit Beginn von Kap. 13 vorgestellten Situation kann diese Aufforderung – zumindest zunächst – nichts anderes bedeuten, als dass Jesu Schüler sich mit ihm zusammen von dem abgeschlossenen Mahl erheben und den Raum verlassen, in dem sie das Mahl eingenommen hatten.
In Anm. 114 schließt Wengst jedoch „nicht aus, dass damit auch eine darüber hinausgehende Bedeutung verbunden ist.“ Dazu verweist er auf Takashi Onuki. <1054> Ihm zufolge
„wird daran nicht allein eine literarische Szenenänderung erkennbar, sondern zumindest implizit auch die Aufforderung an die Lesergemeinde, mit dem nun gefestigten Glauben und der zurückerlangten Identität aufs neue in die Welt hinauszugehen“.
Ein Problem besteht darin (W431), dass Johannes 18,1 „unmittelbar an 14,31“ anschließen könnte, und es
würde niemand etwas vermissen. Nun aber steht der Text von Kap. 15-17 dazwischen. Ab 15,1 redet Jesus weiter, als hätte er weder diese Aufforderung zum Aufbruch gegeben noch zuvor festgestellt, „nicht mehr viel“ mit seinen Schülern zu reden. Es ist verständlich, dass diese Beobachtungen Anlass für vielfältige literarkritische Operationen gegeben haben. Dabei konnte grundsätzlich so vorgegangen werden, dass man entweder Kap. 15-17 an Stellen vor 14,30 unterbrachte oder sie für spätere Hinzufügungen erklärte.
Wengst gibt aber seiner Überzeugung Ausdruck, dass auch die Kapitel 15 bis 17 „auf den Evangelisten Johannes zurückzuführen“ sind, da sie sich „sprachlich und theologisch nicht von Kap. 13f. unterscheiden lassen, sodass nicht auf einen anderen Autor oder gar mehrere andere Autoren geschlossen werden kann“. Abgesehen davon hätte, wie Bauer [188] betont, „ein Redaktor ‚diese Schwierigkeit (nämlich die Stellung des Schlusses von 14,31 im jetzigen Text) gewiß nicht geschaffen‘“. Daher meint Wengst:
Dass der Evangelist den Schluss von 14,31 an seinem Ort stehen ließ, ist nicht literarische Nachlässigkeit, sondern ein Signal an seine Leser- und Hörerschaft, das Folgende als ergänzende Parallele zur ersten Abschiedsrede zu lesen und zu hören.
Nach Hartwig Thyen (T635) muss man in Vers 27 im
verdoppelten Wunsch des Friedens, der als der Friede Jesu so ausdrücklich von allen Arten von Frieden, die die Welt zu bieten vermag, unterschieden wird, das Lexem eirēnē wohl im Vollsinn des biblischen schalom als von Gott gewährtes Heil verstehen (vgl. 16,33 und 20,19.21.26).
Dem ist gewiss zuzustimmen, nur bleibt offen, wie denn der Vollsinn dieses Heils zu begreifen ist: Umfasst es persönliches Seelenheil und gesellschaftliche Überwindung aller Konflikte? Will es über Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden auf dieser Erde unter dem Himmel Gottes hinaus auf himmlische Rettung ausgreifen? Das Wort „Heil“ als solches taugt als vielfach zu füllende Formel kaum zu einer eindeutigen Klärung dessen, was Johannes hier gemeint haben kann.
Abgesehen davon schließt sich Thyen zufolge in Vers 27 mit der Wiederaufnahme der Wendung mē tarrassesthō hymōn hē kardia {euer Herz erschrecke nicht} „der Bogen, den V. 1 … ausgespannt hatte“. Mit dieser „formale[n] Inklusion um die ganze Rede Jesu“ sieht er diese damit auch als abgeschlossen an, wonach „der nun folgende V. 28 ein knappes Resümee ihres Inhalts“ bietet:
Dazu nennt er mit den Stichworten des Weggehens und erneuten Kommens Jesu und dem Liebesgebot noch einmal ihre Hauptthemen. Das Liebesgebot erscheint jetzt in einem Konditionalsatz, dessen neue Information darin besteht, daß Jesus seinen von Trennungsschmerz und Angst bewegten Jüngern eschatologische Freude verheißt… Auch wenn einige Kopisten … anstelle des Imperfekts ēgapate me {mich liebtet} das Präsens agapate me {mich liebt} geschrieben und damit aus dem irrealen einen realen Konditionalsatz gemacht haben, weil sie es wohl nicht wagten, den heiligen Aposteln einen solchen Mangel an Liebe zu unterstellen, ist das Imperfekt doch wohl ursprünglich und der Satz darum fraglos ein Irrealis: „Wenn ihr mich wirklich liebtet, dann müßtet ihr, (statt euch zu ängsten) euch doch freuen, daß ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich“…
Zu Vers 29 weist Thyen wie Wengst auf die Entsprechung zu Johannes 13,19 hin (T636):
Ganz ähnlich erklärt er hier nun: „Und jetzt habe ich (dies alles) zu euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es denn geschehen wird, Glauben faßt (hina … pisteusēte)“. Auch hieran wird wieder deutlich, daß der nach dem Weggang Jesu kommende österliche Geist der bleibende Grund des Glaubens ist (vgl. 7,38f).
Die „beiden Verse“ 30 und 31,
in denen Jesus seinen Jüngern erklärt, weil der ,Fürst der Welt‘, der über ihn freilich keine Macht habe, bereits unterwegs sei, werde er nicht mehr vieles mit ihnen reden, und die in der Aufforderung gipfeln: egeiresthe, agōmen enteuthen {steht auf und lasst uns von hier weggehen}, gehören darum zu den rätselhaftesten unseres Evangeliums, weil sich zwischen diesen Aufbruchsbefehl und seine Ausführung in Joh 18,1ff mit den Kapiteln 15-17 und im Widerspruch zu dem ouketi polla lalēsō meth‘ hymōn {nicht viel werde ich mit euch reden} drei lange Kapitel mit weiteren Reden Jesu einschieben.
Die vielfältigen Versuche, dieses Rätsel literarkritisch zu lösen, lehnt Thyen ab, weil „man in all diesen Fällen die durch 14,31 entstehende Aporie der Unfähigkeit der Herausgeber aus dem Kreis der vermeintlichen johanneischen Schule zuzuschreiben hätte“. Wie Wengst beurteilt er „Joh 15-17 als einen Autographen des Evangelisten“, also als von ihm selbst geschriebene Ergänzung:
Strukturell läßt sich ja nur feststellen, daß der Autor den Faden seiner Erzählung mit 14,31 niederlegt, um ihn erst mit Kapitel 18 wieder aufzunehmen und daran anzuknüpfen, so daß die folgenden Reden Jesu (Joh 15-17) formal als eine große Parenthese {Klammer} erscheinen. Wie der Leser mit diesem Verfahren umgehen soll, ist dagegen eine andere Frage.
Die „Behauptung, die langen ihm folgenden Reden widersprächen dem Satz Jesu, weil der Fürst der Welt bereits unterwegs sei, werde er nicht mehr vieles mit seinen Jüngern bereden können“, nennt Thyen mit Dodd <1055> „treffend“
„ein Beispiel für genau die Art von plumper Kritik, die niemals auf das Werk eines Geistes wie dem unseres Evangelisten angewandt werden sollte.“ Denn „wie lang diese Reden auch sein mögen, sie sind von Anfang bis Ende mit dem Bewusstsein des Abschieds aufgeladen, und die Zeit ist kurz“. Allen Hypothesen über die mögliche Genese der durch 14,31 bezeichneten Aporie gegenüber, sehen wir uns mit Dodd „nach wie vor mit dem Problem konfrontiert, den vorhandenen Text zu erklären“.
Den ho tou kosmou archōn {Herrscher der Welt} in Vers 30 identifiziert Thyen eindeutig mit dem „Teufel“, der im
Unterschied zu Markus {14,42}, wo Judas, der Verräter, naht (idou ho paradidous me ēngiken {Siehe, der mich verrät, ist nahe}), bei Johannes … bereits unterwegs [ist] (erchetai gar ho tou kosmou archōn {denn es kommt der Herrscher der Welt}). Das entspricht der lukanischen Version, wo Jesus denen, die gekommen sind, ihn zu verhaften, erklärt: autē estin hymōn hē hōra kai hē exousia tou skotous {dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis} (22,53).
Wenn allerdings nach Thyen auch bei Johannes wie „bei Lukas (22,3) … der wahre Feind Jesu der Satan und Judas nur eines von dessen menschlichen Werkzeugen“ ist, was bereits aus 13,2 und 27 hervorgegangen war, so wage ich anzumerken, dass Thyen erneut eine präzise Analyse der biblischen Vorstellung des ßatan als eines Widersachers des Gottes Israels vermissen lässt, der zufolge auch der römische Kaiser bzw. dessen Statthalter Pilatus als Verkörperung der widergöttlichen römischen Weltordnung und somit als ßatan bzw. diabolos oder ganz buchstäblich als „Herrscher des kosmos“ aufgefasst werden kann. Richtig an Thyens Einschätzung ist allerdings, dass Judas im Johannesevangelium als ein Werkzeug dieser als satanisch oder diabolisch empfundenen Macht dargestellt wird.
In diesem Sinne mag auch Dodd <1056> zuzustimmen sein, der sich fragt,
ob man nicht sagen könne, daß Johannes „den inneren geistigen Aspekt der Situation unmittelbar vor dem Verrat“, wie Markus sie beschreibe, in den Kontext des Redens Jesu mit seinen Jüngern beim letzten gemeinsamen Mahl verlagert habe. Denn „nicht nur im Garten stand Jesus seinem Feind gegenüber. Dort begegnete er dem Widersacher in der Person des Judas und ging ihm entgegen, aber die Macht und Bosheit des Archon waren nicht auf seinen menschlichen Vertreter beschränkt. Christus hatte bereits mit ihm zu tun; er war bereits geistig auf den Konflikt zugegangen, während er noch mit seinen Jüngern im Obergemach sprach. Das ist zumindest eine mögliche Art und Weise, den Abschnitt zu verstehen, und eine, die gut mit der Art und Weise des Evangelisten übereinstimmt.“
Für Ton Veerkamp <1057> ist von Anfang an klar, dass Jesu messianisches Wirken darauf abzielt, die gottfeindliche römische Weltordnung zu überwinden und das Leben der kommenden Weltzeit, wie es die biblischen Propheten verheißen haben, herbeizuführen. Daher steht für ihn die Bedeutung des zweiten Teils der Antwort Jesu auf die Anfrage des Judas, warum er sich nicht der Weltordnung zu erkennen gibt, außer Frage. Was Jesus in Vers 27 mit „Frieden“ meint, muss auf dem Hintergrund der jüdischen Schriften, etwa Hesekiel 13,1-16 oder Jeremia 6,14f., politisch verstanden werden:
Der zweite Teil der Antwort Jesu ist die Kampfansage und bezieht sich auf den absoluten Widerspruch zwischen der pax Romana und der pax messianica. Friede ist eine Sehnsucht, weil fast nie Friede war, und was als Friede galt, war schäbige, „schmierige“ (Ezechiel 13,10.16!) Gewalt, im Großen wie im Kleinen, Jeremia 6,14f.:
Vom Kleinen bis zum Großen,
machen sie, Gewinnler, Gewinne;
vom Propheten bis zum Priester:
all ihr Tun ist Lüge.
Angeblich heilen sie den Riss durch das Volk
und leichtsinnig sagen sie:
„Friede, Friede!“
Ist aber kein Friede.
Demgegenüber wird der Friede Jesu als eine „pax messianica“, ein messianischer Friede, in Psalm 72 beschrieben:
Gott, dem König gib dein Recht,
deine Wahrhaftigkeit dem Königssohn.
Er urteile über dein Volk wahrhaft,
über deine Unterdrückten mit Recht.
Dann bringen die Berge dem Volk Frieden,
die Hügel durch Wahrheit.
Er schaffe den Unterdrückten im Volk Recht,
er befreie die Bedürftigen,
er zermalme den Unterdrücker.
Ehrfurcht für dich bleibt so lange wie die Sonne,
wie der Mond, Geschlecht für Geschlecht.
Es steige hinab wie Regen auf die Wiese,
wie Tau riesele es zur Erde:
in seinen Tagen gedeihen die Wahrhaften
und mehrt sich Friede, bis kein Mond mehr ist …Friede, Wahrheit, Recht gehören in dieser Großen Erzählung unlöslich zusammen. Wo kein Recht für die Unterdrückten ist, wo der Ausbeuter blüht, dort ist kein Friede. Friede geschieht einem Volk, dem Recht geschieht, und Recht ist Befreiung vom Unterdrücker, Befreiung aus Not. Diese pax messianica ist gemeint.
Wo aber Rom auftritt, sich einmischt in Bürgerkriege wie in den Bürgerkrieg der Judäer in der Provinz Judäa, dort heilt es keinen Riss im Volk, sondern es vernichtet einen Teil des Volkes und schleift das Haus seines Gottes. Pax Romana ist Krieg mit anderen Mitteln, aber kein Friede. Solches „Heilen“ zieht immer Kriege nach sich – bis zum heutigen Tag!
Zu Vers 28 verzichtet Veerkamp an dieser Stelle auf eine Auslegung, da Johannes die Begründung später nachliefern wird:
Warum sie sich freuen sollten, dass er weggeht, bleibt hier unbegründet. Dass der VATER größer sei als der Messias ist kein großer Trost, da doch die Anwesenheit des Messias der Treuebeweis des Gottes Israels sein soll. Wir müssen auf die Begründung 16,5ff. warten.
Den tou kosmou archōn {Herrscher der Welt} hatte Veerkamp zwar wie Thyen auch bisher schon mit dem ßatan oder diabolos, wie ihn Johannes versteht, identifiziert, aber nicht im Sinne einer überweltlichen Macht, sondern des innerweltlichen Kaisers von Rom, dem Jesus buchstäblich in Gestalt seines Vertreters in Israel, Pontius Pilatus, gegenübertreten wird. Auf dieser Grundlage kann Veerkamp an die Auslegung der Verse 29 bis 31 herangehen, und zwar ohne die von Jesus beabsichtigte „Erkenntnis der Weltordnung“ im Sinne eines Aufrufs zur Völkermission zu begreifen:
Der Messias muss dies alles sagen, bevor die Stunde der Bewährung kommt; sie kommt, wenn der „Führer der Weltordnung“ kommt. Lange haben wir gezögert, archōn mit „Führer“ zu übersetzen. Aber für Johannes ist der Cäsar „Menschenmörder“ (8,44), und das beschmutzte Wort Führer ist angemessen.
Das, was der Messias hier tun muss, dient der Erkenntnis der Weltordnung, dass nichts und niemand einen Keil zwischen den Messias und den Gott Israel treiben kann; sie sollen erkennen, „dass ich mit dem VATER solidarisch bin“. Er muss sich in die Hände dieses Führers geben (buchstäblich, denn Pilatus ist der Repräsentant dieses Führers, „Freund des Cäsar“ nennen ihn die Priester, 19,12). Jesus wird vor ihm bezeugen, dass zwischen der Befriedung durch Rom und dem Frieden des Messias keine Vermittlung sein kann: Zwischen dem Cäsar und dem Messias gibt es nur die Verbindung des Nichts: „Mit mir hat er nichts“, heißt es. Es gibt keine Vermittlung, kein Drittes, eben „nichts, ouden“. Der Widerspruch ist absolut.
Der Weggang des Messias ist „Gebot des VATERs“, weil unter den realen, von Rom geschaffenen Umständen die Niederlage die einzige Möglichkeit des Sieges ist. Am Kreuz wird die Weltordnung ein für allemal ins Unrecht gestellt. Das ist die endgültige Entlarvung Roms. Entlarvung ist nicht der Sieg, den wir eigentlich wollen, aber Rom ist auf alle Fälle nicht länger Schicksal, und zur Resignation besteht kein Grund mehr. „Steht auf, wir wollen von hier weggehen“, sagt Jesus.
Alles klar? Nichts ist klar, Jesus muss alles noch einmal erklären, bevor sie wirklich „von hier weggehen“ können.
↑ Johannes 15,1: Jesus als der getreue Weinstock und sein VATER als der Winzer
15,1 Ich bin der wahre Weinstock
und mein Vater der Weingärtner.
[19. November 2022] Während nach Klaus Wengst (W434) die „Ausführungen der ersten Abschiedsrede … vom Weggang Jesu und also der Trennung von ihm“ bestimmt waren, steht in „der zweiten … die dennoch bleibende Verbundenheit mit ihm im Mittelpunkt.“ Er sieht das erste „Teilstück 15,1-16,4a“ wiederum aufgeteilt in
zwei sich gegenüber stehende Abschnitte. Der erste stellt im Bild vom Weinstock und den Reben die auf der Bindung an Jesus basierende Liebe der Schülerschaft untereinander als das heraus, was Gemeinde ausmacht (15,1-17). Der zweite geht auf den Hass der Welt ein, dem sich Jesu Schülerschaft ausgesetzt sieht (15,18-16,4a). Während der erste Abschnitt die Gemeinde als das kennzeichnet, was sie sein soll, nämlich neue Welt, beschreibt der zweite den schweren Stand, den sie in der alten Welt hat.
Ein dritter Abschnitt (16,4b-15) nimmt „das Kommen der Geisteskraft als Beistand“ wieder auf und stellt ihre Funktion „gegenüber der Welt und gegenüber der Schülerschaft Jesu“ dar; danach wird „im vierten und letzten Abschnitt“ wie im Kapitel 14 „auf die Gegenwart Jesu nach seinem Weggang und deren Folgen eingegangen (16,16-33)“.
Mit seinen Worten (W435): „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer“, knüpft Jesus in Vers 1 „an biblische Tradition an.“ Dazu erwähnt Wengst am Rande (Anm. 119), dass in „Jer. 2,21; Ez 17,5-10; Hos 10,1 … das Bild von Israel als Weinstock für prophetische Kritik genutzt“ wird, aber vor allem denkt er (W435) an Psalm 80,9.15f., wo das Volk Israel als der von Gott eingepflanzte Weinstock benannt wird:
„Einen Weinstock hast Du aus Ägypten ausgehoben, Völker vertrieben und ihn eingepflanzt. […] Gott, mächtig über Heere, schaue doch wieder vom Himmel und sieh, gedenke dieses Weinstocks, des Setzlings, den Deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den Du Dir stark gemacht hast!“
Das heißt: Im Johannesevangelium ist hier wieder „auf Jesus konzentriert, was von Israel im Ganzen gilt. Mit der Bezeichnung ‚der wahre Weinstock‘ wird von ihm ausgesagt, dass er wirklich ‚Pflanzung‘ Gottes ist, dass in ihm und durch ihn Gott wirkt, sodass er Leben zu geben vermag.“ Indem Wengst in dieser Weise ernst nimmt, dass Jesus als der Messias des Gottes Israels zunächst einmal das Volk Israel repräsentiert, vermeidet er (Anm. 120), das Bild vom Weinstock so zu lesen, „wie es meistens geschieht“ und wie es zum Beispiel Schnelle <1058> tut, als ob „sich Jesus damit an die Stelle (setzt), die bis dahin Israel einnahm“.
Eine (W436) „sachliche Parallele zur Bezeichnung Jesu als Weinstock“ findet Wengst darin, dass „in der rabbinischen Literatur das nach der Katastrophe des Jahres 70 von Rabban Jochanan ben Sakkaj gegründete Lehrhaus ‚der Weinberg in Javne‘ genannt wird“, worauf Barrett <1059> hinweist:
Diese Bezeichnung erfolgt ebenfalls auf dem Hintergrund biblischer Tradition. In ihr gilt Israel nicht nur als Weinstock, sondern auch als Weinberg Gottes (vgl. nur Jes 5,1-7). Mit Gottes Weinberg Israel ist es trotz der Verwüstungen des Jahres 70 nicht aus; er wird sozusagen neu angelegt in Gestalt des Lehrhauses in Javne, das für Israel das Überleben und Weiterleben als Volk Gottes im Tun seines Willens ermöglicht.
Hartwig Thyen betrachtet das gesamte Kapitel 15 einschließlich der Verse 16,1-3 als die dritte Szene (T582) des fünften Aktes „der dramatischen Historie Jesu“, in dem uns der „lange Abschied Jesu von seinen Jüngern“ vor Augen geführt wird. Ihm zufolge (T638)
ist diese neue Szene sowohl formal als auch inhaltlich ein in sich wohlkomponierter und selbständiger Teil seines abschiedlichen Redens zu seinen Jüngern. Durch den unvermittelten Neueinsatz mit dem egō-eimi-Wort, in dem Jesus sich selbst als ,der wahre Weinstock‘ prädiziert, seinen ,Vater‘ als dessen ,Weingärtner‘ und seine Jünger als die fruchttragenden Rebzweige daran bezeichnet, ist er deutlich vom Vorausgehenden abgegrenzt. … Stand in Joh 14 der unmittelbar bevorstehende Abschied Jesu im Zentrum, so richtet sich der Blick jetzt zunehmend auf die Zeit danach, auf Weg und Auftrag der Jünger, nachdem ihr Herr von ihnen gegangen ist.
Thyen unterteilt (T639) diese Szene im „Anschluß an Moloneys <1060> Kommentar“
in drei Abschnitte , die jeweils durch das auf das Vorangehende zurückblickende Gliederungselement tauta elalēka hymin ktl. {das habe ich euch gesagt usw.} (V. 11), tauta entellomai hymin ktl. {das habe ich euch geboten usw.} (V. 17) und wieder tauta lelalēka hymin ktl. {das habe ich euch gesagt} (16,1) abgeschlossen werden. Alle drei Passagen beleuchten jeweils einen besonderen Aspekt dessen, was es heißt, Jesu Jünger zu sein.
Dabei will Moloney den Abschnitt 15,1-11 „nicht unter dem geläufigen Titel: ,Die Weinstockrede‘“ behandeln, sondern „unter der Überschrift ,Vom Bleiben‘“, da „nicht die Weinstockmetaphorik selbst, sondern das durch sie unüberhörbar gemachte lebensnotwendige Bleiben der Jünger bei Jesus … das eigentliche und mit V. 11 abgeschlossene Thema dieser Passage“ ist.
Danach wird in den Versen 12-17 mit „den Stichworten entolē/entellomai {Gebot/ gebieten} und agapan {lieben} … das Liebesgebot von 13,34f“ neu interpretiert und „das Einander-Lieben als sichtbares Zeugnis wahrer Jüngerschaft und Ursprung des Hasses der Welt“ beschrieben.
Und endlich bringt der dritte und letzte Abschnitt (15,18-16,3) diesen Haß, dem die Jünger mit derselben Notwendigkeit ausgesetzt sein werden, wie zuvor ihr Herr, mit den Leitwörtern misein, diōkein und poiein eis {hassen, verfolgen und antun} ausdrücklich zur Sprache.
Zur Selbstbezeichnung Jesu in Vers 1 als hē ampelos hē alēthinē {der Weinstock, der wahre} und seines Vaters als des geōrgos {Weingärtners} schreibt Thyen „im Anschluß an Ricoeurs Arbeiten zur Metapher“, auf die er bereits in seiner Auslegung zu Johannes 6,35 eingegangen war, dass (T640) „das gesamte Ich-Bin-Wort einschließlich seiner Kopula eimi und der gesamte ihm folgende Kontext“ zur metaphorischen Rede gehört. Dabei ist, wie Thyen unter Berufung auf Frank <1061> sagt, „die Metapher nicht bloßer Schmuck der Rede oder pädagogisches Instrument, sondern eine Redeweise, die auf gar keine Weise ‚zugunsten einer gleichsam authentischen Präsenz des vollen Sinnes hintergehbar‘ ist“.
Auch nach Thyen kann die Rede vom Weinstock, der „hier ohne jede Vorbereitung mit dem bestimmenden Artikel eingeführt wird: egō eimi hē ampelos hē alēthinē {ICH BIN der Weinstock, der wahre}“, nur „an die Fülle der biblischen Texte vom Weinstock bzw. vom Weinberg“ anschließen, der „den Jüngern wie den Lesern wohlbekannt sein dürfte“, was der „außergewöhnliche Nachsatz dieses Ich-Bin-Wortes, kai ho patēr mou ho geōrgos estin {und mein Vater ist der Weingärtner}, … nachdrücklich“ bestätigt. Dazu nennt Thyen zunächst
das Weinberglied Jesajas, der von der enttäuschten Liebe und dem Zorn eines Freundes über seinen trotz aller Mühen der Anlage und Pflege dennoch mißratenen Weinberg singt. Das Sängers Freund ist Gott und Israel dessen geliebter Weinberg (Jes 5,1-7). Dieses Lied hat zahlreiche Nachklänge in der Bibel; vgl. Hos 10,1; Jer 2,21; 5,10; 6,9; 12,10; Ez 15,1-8; 17,3-10; 19,10-14; Mt 21,33-44 par.; vergleichbar ist die paulinische Rede vom edlen Ölbaum und seinen Zweigen Röm 11,17ff.
Großen Wert legt Thyen darauf, dass „der Weinstock nicht wegen möglicher und konkurrierender Ansprüche anderer Retter- oder Offenbarergestalten polemisch als der ,wahre‘ (hē ampelos hē alēthinē) bezeichnet wird, als wäre ampelos ein derartiges Hoheitsprädikat“. Das begründet er mit Jeremia 2,21, wo Gott den von ihm
gepflanzten fruchttragenden Weinstock als den ,wahren‘ (ephyteusa se ampelon karpophoron pasan alēthinēn {ich hatte dich gepflanzt als einen vollends fruchttragenden wahren Weinstock}) dem fruchtlos wildwachsenden oder verwilderten (ampelos allotria {fremden Weinstock}) gegenüberstellt. Aber der in der Gegenwart verwilderte, fremden Völkern, wilden Tieren und dem Feuer ausgelieferte Weinberg oder Weinstock Gottes wird im Eschaton {Endzeit} wieder üppig blühen und fruchten: „An jenem Tage wird man sagen: Ein köstlicher Weinberg, besingt ihn! Ich, JHWH, will ihn behüten. Immerfort will ich ihn tränken, daß sein Laubwerk nicht falle; bei Tag und Nacht will ich ihn bewachen …“ (Jes 27,2).
Außerdem verweist Thyen auf den „Juda-Segen von Gen 49,11, den die Rabbinen früh auf den Messias gedeutet haben“ und wie Wengst auf Psalm 80, in dem fast „alle Züge dieser Weinstock-Metaphorik … versammelt“ sind und in dem (T640f.) „der Weinstock auf eigenartige Weise, nämlich durch einen synthetischen parallelismus membrorum {in dem zwei aufeinanderfolgende Zeilen das Gleiche etwas anders sagen} mit dem Menschensohn identifiziert wird“. Diese Verse 15-16 in Psalm 80 (in der Septuaginta ist es Psalm 79) (T641) macht Dodd im Anschluss an Bernard <1062> folgendermaßen für die Auslegung von Johannes 15 fruchtbar:
Durch den parallelismus membrorum identifiziert er also Israel, den Weinstock, den JHWH Zebaoth aus Ägypten geholt und, nachdem er die Völker vertrieben hatte, eingepflanzt hat, so daß seine Schatten die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes bedeckten, mit dem ,Sohn‘. Und wenn Jesus, nachdem er sich selbst metaphorisch als den wahren Weinstock identifiziert hat, Gott seinen Vater und den Weingärtner nennt (kai ho patēr mou ho geōrgos estin), dann übernimmt er damit als der Sohn die Rolle dessen, der als Stellvertreter vor Gott eintritt für Gottes Weinstock Israel, ja, wie der Hohepriester kraft seines Amtes geweissagt hatte, nicht nur für dieses Volk allein, sondern darüberhinaus für die weltweit zerstreuten Gotteskinder (11,51f).
Zur Frage, ob „als die ,Quelle‘ von Joh 15, aus der der Evangelist schöpft“, auch „die späten und verworrenen“ mandäischen Schriften angesehen werden könnten, folgt Thyen Rainer Borig, <1063>
daß allein die den Jüngern der Erzählung ebenso wie ihren potentiellen Lesern vertrauten biblischen Texte den Hintergrund bilden können. Schon die Eröffnung der Rede durch die Selbstprädikation Jesu als der wahre Weinstock zeigt an, daß der Weinstock eine Jüngern wie Lesern bekannte Größe sein muß. Bei einem Autor, der seinen Protagonisten in ständiger Auseinandersetzung mit den Ioudaioi als einen zeichnet, der nichts selbst unternimmt und sagt, sondern einzig den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat, der stets in Übereinstimmung mit der ,Schrift‘ handelt, um diesen Jesus als den „Messias, von dem Mose in der Tora und die Propheten geschrieben haben“ (1,45), ja als „den Sohn Gottes und basileus tou Israēl {König von Israel}“ (1,49) zu erweisen, damit seine Leser an diesem Glauben festhalten und so teilhaben am ewigen Leben (20,31), wird man den Wurzelgrund dieses Redens vom Weinstock schwerlich anderswo suchen dürfen als in der Welt der Bibel …
Wenn Eduard Schweizer, <1064> der das entgegen „seiner früheren Überzeugung von der mandäischen Herkunft der Metaphorik vom guten Hirten und wahren Weinstock“ inzwischen auch so sieht, nun allerdings sagt: „An die Stelle Israels tritt der wahre Weinstock Christus, der die fruchttragenden Ranken in sich schließt“, so stellt Thyen klar (T641f.):
Hier kommt freilich alles darauf an, wie man das „An-die-Stelle-Treten“ verstehen will. Denn ,Vertreten‘ oder ,Ersetzen‘, das ist hier die Frage. Schweizer scheint sie im Banne der alten ,Substitutionstheorie‘, wonach die Kirche als das ,neue Gottesvolk‘ Israel, Gottes altes Eigentumsvolk, aus der göttlichen Erwählungsgeschichte verdrängt und ersetzt haben soll, im letzteren Sinne beantworten zu wollen. Doch in einem Evangelium, dessen jüdischer und mit seinen jüdischen Volksgenossen solidarischer Protagonist erklärt: „Das Heil kommt von den Juden“ (4,22), und der seinem geliebten Jünger sterbend die Fürsorge für seine jüdische Mutter anbefiehlt (19,27, s,u. z. St.), wird man das ,An-die-Stelle-Treten‘ wohl im Sinne der Stellvertretung begreifen müssen, die Israels Erwählung nicht abrogiert {außer Kraft setzt}, sondern sie im Gegenteil ebenso voraussetzt wie sie sie zugleich neu in Kraft setzt … Auch wenn die ,Seinen‘, nämlich die Ioudaioi, den fleischgewordenen logos nicht aufnahmen (1,11), bleiben sie gleichwohl die Seinen und werden nicht etwa durch andere ersetzt. Nach dem prophetischen Wort des Kaiaphas (11,49ff) stirbt Jesus für dieses Volk, so daß die über der intimen Szene der Fußwaschung beim letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern stehende Wendung des Erzählers: agapēsas tous idious tous en tō kosmō eis telos ēgapēsen autous {wie er die Seinen, die in der Welt sind, geliebt hatte, so liebte er sie nun bis zur Vollendung} (13,1), sie durchaus ein- und nicht etwa ausschließt.
Ton Veerkamp <1065> stellt zur nach Johannes 14,31 überraschenden Fortführung des Redens Jesu fest:
Hier war die „Abschiedsrede“ beendet. Offenbar hat der Passus Johannes 13-14 die Bedenken in der Gruppe nicht ausgeräumt. Johannes 15-16 fasst eine weitere Diskussion(sphase) in der Gruppe zusammen. Zunächst geschieht das in einem langen Monolog, 15,1-16,15. Dann aber nimmt Johannes die für ihn kennzeichnende Form des Dialoges wieder auf, 16,16-17,1a. Die gleichen Themen der Kapitel 13 und 14 kommen erneut zur Sprache.
Aus Veerkamps Anm. 447 zur Übersetzung von Johannes 15,1 im Jahr 2015 geht hervor, dass er sich anders als bei anderen Ich-bin-Worten Jesu an dieser Stelle nicht dazu in der Lage sieht, die Identifikation mit dem Weinstock im Sinne der Verkörperung Jesu als des befreienden NAMENS des Gottes Israels zu begreifen, der hier von der Metapher des Weinstocks her gefüllt werden müsste. Da dem Satz „Ich bin der getreue Rebstock“ ausdrücklich der Satz „und mein VATER ist der Winzer“ folgt,
muss das egō eimi als einfacher Prädikatsatz übersetzt werden, da sich Jesus eindeutig vom VATER unterscheidet: Ich der Rebstock, ER, DER DASEIN WIRD, VATER, der Winzer.
In seiner Auslegung aus dem Jahr 2007 hatte Veerkamp allerdings 15,1 noch so wiedergegeben: „ICH BIN ES: der getreue Rebstock.“ Dieser Übersetzung möchte ich nach wie vor folgen, denn Johannes hatte ja schon bisher Jesus genau in seiner Verkörperung Israels zugleich als die Verkörperung des befreienden NAMENS Gottes dargestellt. Von daher traue ich Johannes zu, dass in seinen Augen schon Gott selbst sich mit Israel als seinem getreuen Weinstock identifizieren konnte, hatte er doch bereits (1. Mose 1,26) die Menschheit nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen und (2. Mose 4,22) das von ihm als Bündnispartner zur Verwirklichung seiner Wegweisung erwählte Volk Israel seinen einziggezeugten Sohn genannt.
Veerkamps Abkehr von seiner damaligen Übersetzung hat meiner Ansicht nach den Grund, dass er sich davor scheut, das göttliche ICH BIN allzu sehr auf den Menschen Jesus zu beziehen, da dem Juden Johannes eine solche Vergöttlichung Jesu nicht zuzutrauen wäre. Das sehe ich etwas anders als er, wie ich es in meiner Auslegung von Johannes 8,54-59 bereits dargelegt habe. Zwar bleibt Jesus ganz und gar dieser bestimmte jüdische Mann Jesus ben Joseph von Nazareth, und dennoch verkörpert sich genau in seinem ganzen Wollen und Wirken der befreiende NAME Gottes.
Zwei prophetische Texte und einen Psalm sieht Ton Veerkamp „im Hintergrund der ersten Verse dieses Abschnitts, 1-7“, der mit der „klassischen israelitischen Metapher“ des Rebstocks beginnt:
Zunächst Jesaja 5,1ff.
Ich will ja für meinen Freund singen,
den Gesang vom Weinberg meines Freundes.
Einen Weinberg hatte mein Freund,
am fettbödigen Hang.
Er grub ihn um, befreite ihn von Steinen,
bepflanzte ihn mit rotem Rebstock (ßoreq, ampelos sorēch),
baute einen Wachtturm mitten in ihm,
schlug eine Keltergrube aus ihm.
Er hoffte auf Traubenertrag,
er trug nur Verfaultes.Dann Jeremia 2,21:
Ich selber habe dich gepflanzt als roter Rebstock (ßoreq),
alles getreue Saat.
Wie hast du dich mir verwandelt,
verkehrter, fremder Rebstock?In der griechischen Fassung:
Ich selber habe dich gepflanzt,
fruchttragenden Rebstock (ampelos), ganz getreu.
Wie hast du dich verkehrt in Bitteres,
du, fremder Rebstock (ampelos)?Dann das Lied „Hirte Israels, lausche“ (Psalm 80). In diesem Lied wird Israel verglichen mit einem Rebstock, den Gott aus Ägypten in das Land hinaufgebracht hat, „seine Wurzel eingewurzelt … seine Ranken streckten sich bis zum Meer aus.“ Die Stichworte unseres Gleichnisses Johannes 15,1-2 (ampelos, Rebstock und klēmata, Ranken, Blütenzweige) finden wir auch in diesem Lied. Thema des Liedes ist der Niedergang Israels, das zur Beute fremder Völker geworden ist. Der Refrain des Liedes (viermal, V.4.8.15.20) lautet:
Gott: lasse uns wiederkehren,
es leuchte Dein Angesicht,
wir werden befreit.Die Texte sehen Israel als Weinberg, wo die Rebstöcke Früchte tragen: Israels erhoffter Ertrag ist die Rechtsordnung seines Gottes. Tatsächlich aber ist Israel der fremde Rebstock, der keine Früchte trägt, und wenn, dann nur beˀuschim, Verfaultes.
Es ist diese „Sehnsucht nach der Wiederherstellung Israels“, auf die nun in Johannes 15,1 „der Messias“ antwortet:
„ICH BIN ES: der getreue Rebstock.“ Ausgerechnet im Psalm 80 ist von einem ben ˀadam {Sohn des Menschen} (die hebräische Form für das aramäische bar enosch) die Rede, V.18f.:
Sei Deine Hand über dem Mann Deiner Rechten,
über den MENSCHEN, den Du Dir mit Kraft ausgestattet hast.
Nie mehr wollen wir uns abwenden von dir,
lass uns leben, die wir mit Deinem Namen gerufen sind.Dieser Hintergrund lässt uns verstehen, was mit diesem Gleichnis gesagt wird. Der Messias Israels ist jener bar enosch, MENSCH, und so Israel selber, Daniel 7,27. Er ist der absolute Gegensatz zu jenem trügerischen Israel, jenem „verkehrten, fremden Rebstock“. Für Israel als Kollektiv wird die Metapher Rebstock verwendet. Der Rebstock ist der Messias, die Mitglieder der Gruppe sind die Blütenzweige, die Trauben. Sie müssen versorgt sein, damit die Trauben Frucht tragen. Das ist nicht das Werk des Messias, sondern des Winzers, des Gottes Israels.
Wie Wengst und Thyen interpretiert also auch Veerkamp die Selbstidentifikation Jesu mit dem Weinstock nicht so, dass er an die Stelle Israels tritt und damit Israel verdrängt, sondern ganz im Gegenteil: In ihm erblickt der Evangelist ein Israel, das dem Willen Gottes entspricht, und diejenigen, die sich vertrauensvoll um ihn scharen, bilden den wachsenden Rest eines Israel, dem das Leben der kommenden Weltzeit inmitten der Völker verheißen bleibt. Gerade indem der Messias sich von der römischen Weltordnung hinrichten lässt, stellt er diese in ihrem menschenmörderischen Gewalt als Widersacher des NAMENS bloß und weist den Weg zu ihrer Überwindung durch die Praxis der agapē, einer solidarischen Liebe.
↑ Johannes 15,2-5: Das Fruchtbringen und die Reinigung der Reben am Weinstock
15,2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
nimmt er weg;
und eine jede, die Frucht bringt,
reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe.
15,3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen,
das ich zu euch geredet habe.
15,4 Bleibt in mir und ich in euch.
Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst,
wenn sie nicht am Weinstock bleibt,
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.
15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
[20. November 2022] Nach Klaus Wengst (W435) wird in der Entfaltung „der Bildrede vom Weinstock und den Reben“ klargestellt, dass „die Zeit nach Jesu Weggang“ nicht als Getrenntsein von ihm“ erfahren werden muss. Nur durch die „Verbundenheit Jesu mit den Seinen“, haben diese „wirkliches Leben“, und das entscheidet sich darin,
ob die Menschen in der Gemeinde ihrerseits an diesem Ort bleiben, ob sie sich an die Worte Jesu halten oder nicht. … Von diesem Bild {vom Weinstock und den Reben} her erweist sich die Option, nicht zu bleiben, als eine unmögliche Möglichkeit. Jesus wird mit dem Bild des Weinstocks als Vermittler wirklichen Lebens dargestellt, sodass – wer daran partizipieren will – gar nicht anders kann, als zu bleiben.
Jesus beginnt in Vers 2 damit (W436), das Bild „von Gott als Winzer“ folgendermaßen auszuführen:
„Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe.“ Nach den hier gebrauchten Formulierungen denkt Johannes nicht an den großen Rebschnitt vor Beginn der der Vegetationszeit, bei dem das meiste von dem heruntergeschnitten wird, was im Vorjahr gewachsen ist, auch fruchtbare Triebe. Es bleiben nur diejenigen stehen, die den günstigsten Stand am Stock haben. Hier jedoch ist die Arbeit während der Vegetationszeit im Blick: das Abschneiden von Geiztrieben, das Ausbrechen von Nebentrieben und das Kürzen der Fruchttriebe. Die Kraft des Weinstocks soll in die Ausbildung der Trauben und nicht in weiteren Holzwuchs gehen. Demgemäß ist das Ziel, Frucht, ja „mehr Frucht“ zu bringen.
Mit Vers 3: „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe“, spricht Jesus seinen Schülern eine „Reinheit“ zu, die „kein Selbstzweck“ ist,
sondern die Befähigung, „mehr Frucht“ zu bringen. Dafür muss sich Jesu Schülerschaft, dafür müssen sich die Menschen in der Gemeinde nicht erst noch qualifizieren; sie sind schon qualifiziert. Es findet sich im ganzen Abschnitt keine Aufforderung, Frucht zu bringen. Das wäre auch widersinnig, Frucht wird nicht gemacht, Frucht wächst. Sie stellt sich ein, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Jesu Schülerschaft ist „rein“, ist befähigt „um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe“. Das ist die Voraussetzung, die gegeben ist: das im Evangelium gesprochene Wort vom Handeln Gottes in Jesus, das Vergebung zuspricht und Orientierung gibt und das deshalb Jesu Schülerschaft befähigt, nun ihrerseits zu handeln, Frucht zu bringen.
Darauf folgt eine Mahnung, die „den ganzen Abschnitt“ bestimmt: „Bleibt bei mir!“ Anders als es die Lutherbibel und viele Exegeten tun, hält es Wengst (W435, Anm. 116)
für fehlleitend, en in diesem Zusammenhang mit „in“ zu übersetzen. Man tut es nicht bei dem Vergleichssatz vom Weinstock und den Reben. So wenig es dort um Mystik geht, so wenig beim Verhältnis zwischen Jesus und seiner Schülerschaft/Gemeinde. Nach Johannes bleibt sie bei Jesus, indem sie bei seinem Wort bleibt, sich an das von Jesus Überlieferte hält, wie er es im Evangelium darstellt.
Diese Aufforderung (W436), dieser „Imperativ“, ist nach Wengst „indikativischen Charakters“, das heißt, er beschreibt etwas, was schon da ist und eigentlich nicht erst befohlen werden muss. Jesus fordert dazu auf, „bei dem zu bleiben, was Leben gibt und Frucht wachsen lässt.“ Für „die Situation der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde“ bedeutet das: „Es geht schlicht darum, … trotz Bedrängnis in der Gemeinschaft der Gemeinde auszuharren“ (W437):
Diesem Bleiben verspricht Jesus sein Bleiben; Verlässlichkeit und Treue sind seinerseits gegeben: „Und ich bleibe bei euch.“ Worin sich dieses gegenseitige Bleiben konkret vollzieht, wird V. 7 erkennen lassen.
Zunächst aber vergleicht Jesus sein Verhältnis zu seinen Schülern mit „einem bestimmten Aspekt“ des Bildes „vom Weinstock und den Reben“:
„Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann – sie kann es nur, wenn sie am Weinstock bleibt -, so auch ihr nur, wenn ihr bei mir bleibt.“ Wie es sich mit dem Weinstock und den Reben verhält, so verhält es sich mit Jesus und den Menschen in seiner Gemeinde. Deshalb ist das Nicht-bleiben, das Weggehen, eine unmögliche Möglichkeit. Wie sollten die Reben, wenn sie es denn könnten, so töricht sein, ihren Weinstock zu verlassen, sodass sie ihrer Bestimmung nicht mehr zu entsprechen vermögen, nämlich Frucht zu bringen?
Die Aufforderung, „nicht gleich aufzugeben und wegzulaufen, sondern geduldig ‚bei der Sache‘ – und in der Gemeinde – zu bleiben“, greift Jesus in Vers 5 noch einmal auf, indem er „seine bildliche Identifizierung mit dem Weinstock“ wiederholt und zugleich „auch seine Schüler ausdrücklich mit den Reben“ identifiziert,
was er bisher schon vorausgesetzt und sachlich ausgewertet hat: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben.“ Das spricht er seinen Schülern zu, als ob er sie „von jeglichem Leistungsdruck entbinden möchte“. <1066> Auch danach wiederholt er in leichter Veränderung bereits Gesagtes: „Diejenigen, die bei mir bleiben – und ich bei ihnen -, bringen viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nämlich nichts tun.“ Für die Schülerschaft Jesu ist das Bleiben in der Schule Jesu die entscheidende Voraussetzung, wenn es denn einen Ertrag geben soll.
Hartwig Thyen (T642) beschäftigt sich in seiner Auslegung von Vers 2 und 3 eingehender mit der Rolle, die der „‚Vater‘ Jesu“ spielt, indem er „als geōrgos {Weingärtner} um seinen Weinstock bemüht“ ist. Wie Gott nach dem „Weinberglied“ (Jesaja 5,1ff)
seinen Weinberg liebevoll angelegt hat, damit er gedeihe und reiche Frucht bringe, und ihm deshalb seine kundige Pflege zuwendet, so … beseitigt (airei) {er hier} die wilden und unfruchtbaren Triebe und ,reinigt‘ (kathairei) die Edlen, damit sie noch reichere Frucht bringen.
Dabei lenken, worauf Segovia <1067> hinweist, diese lautlich gleichen oder ähnlichen Wörter airei und kathairei „die Aufmerksamkeit des Lesers nicht nur auf die beiden konträren Rollen des Vaters, sondern zugleich damit auch auf das gegensätzliche Schicksal der entsprechenden Zweige“.
In dem darauf „[v]öllig unvermittelt“ folgenden Vers 3: „ēdē hymeis katharoi este, dia ton logon hon lelalēka hymin {Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe} (vgl. 13,10)“, muss man das
Perfekt lelalēka {geredet habe} … mit Segovia wohl als eines „einer abgeschlossenen Handlung“ verstehen, „die darauf hinweist, dass der gesamte Dienst, einschließlich der ‚Stunde‘ bereits vollendet ist“. Jesus spricht hier mit anderen Worten bereits als der zum Vater Erhöhte und Verherrlichte. „Ihr seid bereits rein“ muß im Licht der Weinstockmetaphorik darum heißen: Euch hat der Vater als der geōrgos {Weingärtner} bereits gereinigt, und zwar durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Dabei ist dieser logos, wie Jesus wiederholt betont hat, ja nicht sein Eigener, sondern nur der vom Vater gehörte. Und er ist nicht das von Jesus Gesagte, das von ihm ablösbar wäre und nach seinem Weggang als Lehre bliebe, sondern der logos ist er selbst und leibhaftig als sein allem von ihm Gesagten zugrundeliegendes Sagen. Implizit ist damit in V. 3 bereits ausgedrückt, was V. 5 durch die Wiederaufnahme des eröffnenden egō-eimi-{ICH-BIN-}Wortes dann so explizieren wird: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“.
Ab Vers 4 beherrschen Formen des Wortes menein {bleiben} bis Vers 16 die weiteren Aussagen. Überhaupt finden sich von dessen
insgesamt 118 Vorkommen im ganzen Neuen Testament … 67, also weit über die Hälfte, im Corpus Iohanneum (40 im Evangelium gegenüber 3 bei Mt; 2 bei Mk und 7 bei Lk; außerdem 24 im 1Joh und 3 im 2Joh). Typisch und im übrigen Neuen Testament ohne Analogie ist vor allem die Verwendung von menein in den sogenannten ,reziproken Immanenzformeln‘ vom wechselseitigen Bleiben des Sohnes in den Glaubenden und der Glaubenden im Sohn …
Dass (T643) „die bereits in Joh 6,56 und 14,20 begegnende lmmanenzformel {Formulierung des „In“-Seins} ihren Ursprung nicht in der Weinstock-Metaphorik hat, sondern daß diese erst umgekehrt über ‚das bildlose katharoi {rein} in V. 3‘ mit ihr verbunden wird“, hat Thyen zufolge Borig <1068>
klar erwiesen. Zudem sprengt die Rede vom ,Bleiben‘ die Metaphorik vom Weinstock, „denn eine Rebe des natürlichen Weinstocks hat (ja) nicht die ,Wahl‘, zu bleiben oder zu gehen“. <1069> Die auf das Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern bezogene Immanenzformel scheint vielmehr eine Übertragung der Rede Jesu von seiner eigenen reziproken Immanenz {wechselseitigen „In“-Seins} im Vater und des Vaters in ihm auf seine Relation zu seinen Jüngern zu sein. Ohne sie „wie sonst als ,Auftakt‘ zur Sohn-Jünger-Immanenzformel zu benutzen“, spricht Jesus in 10,38 {Thyen verweist irrtümlich auf 10,18} sowie zweifach in 14,10f vom In-Sein des Vaters in ihm und seinem In-Sein im Vater, und zwar jeweils im Blick auf die ,Werke‘, deren gemeinsames Subjekt der Sohn in der Einheit mit dem Vater ist (vgl. 10,30; u. s. Borig 208f).
Indem Jesus (T642) in Vers 4 mit „dem Imperativ meinate“ seinen Jüngern gebietet, „so ,in ihm‘ zu bleiben, wie er ,in ihnen‘ bleiben wird“, gibt er ihnen zugleich (T643) zu verstehen, dass sie „fruchtlos“ bleiben, „wenn sie nicht in Jesus bleiben“, weil auch „die Rebe keine Frucht tragen kann, wenn sie nicht ,im Weinstock‘ (en tē ampelōs) und so mit ihm verbunden bleibt“:
Denn von ihnen gilt ja, wie nun mit der Wiederaufnahme des egō-eimi-Wortes von V. 1 ausdrücklich gesagt wird: hymeis ta klēmata {ihr seid die Reben}. Und wie die Werke des Sohnes nicht in seiner Autonomie, sondern in seiner ,Wirkeinheit‘ mit dem Vater gründen, so gilt auch vom Wirken der Jünger: hoti chōris emou ou dynasthe poiein ouden {ohne mich könnt ihr nichts tun}. … Die größeren Werke der Jünger (14,12) haben ihren Grund also in ihrer Wirkeinheit mit dem Weggegangenen, der jetzt nicht mehr nur bei ihnen (par‘ hymin menōn: 14,25), sondern ,in ihnen‘ ist.
Ganz anders als Wengst will Thyen also zumindest das „In“-Sein Jesu in den Jüngern wortwörtlich als eine Steigerung seines „Bei“-ihnen-Seins verstehen. Das klingt nach Mystik, obwohl Thyen das nicht so nennt; er könnte die bleibende Gegenwart der Worte Jesu in den Jüngern meinen, die auf andere Weise durch die Gabe des Geistes der Wahrheit als des Parakleten ausgedrückt wird. Dass Thyen die Präposition en {in} so pointiert anders als die Präposition para {bei} übersetzen will, passt allerdings nicht ganz zu seiner sonst vertretenen Überzeugung, dass Johannes Synonyma liebt; nichts spricht dagegen, beide Formulierungen als gleichbedeutend aufzufassen, zumal bei Johannes im Hintergrund der griechischen Vokabel en auch das hebräische bɘ stehen kann, das eine große Bedeutungsbreite von „in, bei, durch, mit, von“ haben kann. Hinzu kommen die Probleme, dass auf der Bildebene ja auch die Reben nicht im Weinstock, sondern an ihm wachsen, und dass zumindest kaum vorstellbar ist, wie die Jünger wortwörtlich in Jesus sein sollen – es sei denn, Johannes spräche von Jesus so ähnlich, wie Paulus (1. Korinther 12,27) vom „Leib Christi“ als der Gemeinde Jesu spricht.
Auch nach Ton Veerkamp <1070> ist das „Werk Gottes“ als des Winzers, das darin besteht (Vers 2), den Weinstock zu „reinigen“, an den Schülern Jesu bereits durch Jesus selbst vollzogen worden:
Durch das Wort (logos, davar) des Messias sind die Schüler rein, 15,3. Das bedeutet: durch das Wort erfüllen die Schüler „schon“ (V.3) jene Bedingung der Reinheit, die von jeher für die Gemeinschaftsfähigkeit jedes einzelnen Mitglieds des Volkes erfüllt wird.
Es gibt aber eine Voraussetzung für diese Reinheit, die erfüllt sein muss, nämlich die „intensive Verbindung mit dem Messias“. Darum fordert Jesus seine Schüler auf: „Bleibt fest bei mir, wie ich bei euch.“ Zu dieser „Übersetzung des Verbs menein, ‚bleiben‘“, verweist Veerkamp (Anm. 453) auf seine Anm. 77 zur Übersetzung von Johannes 1,32:
Menein, „bleiben“, steht in der LXX in sehr vielen Fällen (mehr als 50%) für die Wurzel ˁamad, „stehen“, und qum, „aufgerichtet sein“, und hat demnach die Konnotation einer festen Verbundenheit.
Ähnlich wie Wengst und anders als Thyen deutet Veerkamp das „in“ Jesus Bleiben also nicht in Richtung einer mystischen Verschmelzung. Er versteht das Bleiben „bei“ Jesus im Sinne eines Festhaltens an dem, was er „messianische Vision“ nennt:
Die messianische Vision ist die Grundbedingung für ein wahrhaftes Leben. Wenn man nicht wirklich zuversichtlich ist, dass die herrschenden Zustände, eben die „Weltordnung“, nicht unveränderbar sind, sondern ein „Leben in der kommenden Weltzeit“ (zōē aiōnios) eine reale Perspektive für das Leben der Menschen auf der Erde ist, kann man nichts ausrichten: Denn „getrennt von mir (chōris emou) könnt ihr nichts tun“. Sonst ist alles Tun nutzlos, dürr, unfruchtbar.
↑ Johannes 15,6-8: Vom Nicht-Bleiben und Bleiben bei Jesus und dem Fruchtbringen zur Ehre des VATERS
15,6 Wer nicht in mir bleibt,
der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt,
und man sammelt die Reben
und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.
15,7 Wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren.
15,8 Darin wird mein Vater verherrlicht,
dass ihr viel Frucht bringt
und werdet meine Jünger.
Die (W437) in Vers 6 beschriebene harte „negative Konsequenz für diejenigen, die nicht bleiben“, wird Klaus Wengst zufolge ausschließlich „auf der Bildebene“ beschrieben: „Wer nicht bei mir bleibt, wird hinausgeworfen – wie die Rebe, die dann verdorrt; und man sammelt die verdorrten Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.“ Schon das Wort „hinausgeworfen“ kann sich, so meint er, nur auf das Bild der Rebe beziehen, denn
wer nicht bleiben will, geht und kann nicht mehr „hinausgeworfen“ werden. Aber der Effekt ist – das wird hier betont -, dass er „draußen“ ist. Der Text bleibt also beim Beschreiben des Verfahrens mit den abgeschnittenen Reben ganz und gar auf der Bildebene und nimmt keinerlei Ausdeutungen vor. Das sollte davon abhalten, ihn in dieser Hinsicht zu „vervollständigen“.
Ich verstehe zwar, warum Wengst darauf beharrt, hier werde nur beschrieben, was mit abgeschnittenen Reben passiert, und nicht etwa abtrünnigen Schülern Jesu der Tod oder sogar das ewige Höllenfeuer angedroht. Aber warum sollte Johannes auf der Bildebene, wie Wengst zusätzlich anmerkt (Anm. 126), hier „eher an den großen Rebschnitt vor der Vegetationszeit“ denken „als an das wiederholt erfolgende Schneiden in ihr“, wenn er diesem Bild keinerlei Bedeutung auf der Sachebene zumisst? Immerhin wird nach Johannes 12,31 auch der archōn tou kosmou toutou, der Herrscher dieser Weltordnung, ekblēthēsetai exō, nach draußen ausgestoßen oder hinausgeworfen; daher kann zumindest das ballomai exō, das Hinausgeworfenwerden, nicht nur auf die Bildebene der Reben bezogen werden.
Außerdem gibt es eine biblische Stelle, Hesekiel 19,10-14, gemäß 19,1 „ein Klagelied über die Fürsten Israels“, wo ein Weinstock ausgerissen wird, seine Früchte verdorren und auch seine Reben verdorren und verbrannt werden, nur dass diese Reben dort hauptsächlich als rabdos, „Ranke“, bezeichnet werden (einmal allerdings steht in Vers 10 auch blastos, „Spross“, und in Vers 11 klēma, „Rebe“) (nach Luther 2017):
10 Deine Mutter war wie ein Weinstock (ampelos) im Weingarten,
am Wasser gepflanzt;
fruchtbar und voller Ranken (blastos) war er von dem vielen Wasser;
11 seine Ranken (rabdos) wurden so stark, dass sie zu Zeptern taugten;
sein Wuchs wurde hoch bis an die Wolken
und man sah, dass er so hoch war und so viele Ranken (klēmatōn) hatte.
12 Aber er wurde im Grimm ausgerissen und zu Boden geworfen.
Der Ostwind ließ seine Frucht verdorren,
und seine starken Ranken (rabdos) wurden zerbrochen,
dass sie verdorrten und verbrannt wurden.
13 Nun ist er gepflanzt in eine Wüste, in ein dürres, durstiges Land,
14 und ein Feuer ging aus von einer Ranke (rabdou);
das verzehrte seine Triebe und seine Frucht.
Es blieb an ihm keine starke Ranke (rabdos) mehr für ein Zepter.
Das ist ein Klagelied; zum Klagelied ist es geworden.
Ich kann mir vorstellen, dass Johannes angesichts derer, die sich dem messianischen Wirken Jesu verschließen und sich von ihm trennen oder ihn ablehnen, in dieses alte Klagelied einstimmt, das tödliche Folgen der Abkehr Israels von Recht und Gerechtigkeit beschreibt. Damit meint Johannes sicher keine ewige Verdammnis mit den erst von der späteren Christenheit ausgemalten Höllenqualen, aber er könnte daran denken, dass eine Menschheit, die sich der agapē Jesu verschließt, immer wieder dazu fähig ist, diese Erde selbst in eine Hölle zu verwandeln. Und auch nach Wengst (W437) fehlt jedenfalls denen, die nicht „in der Schule Jesu“ bleiben, „die entscheidende Voraussetzung, wenn es denn einen Ertrag geben soll“, wie er zu Vers 5 ausgeführt hatte. Indem Jesus in Vers 7 seine Schüler anredet, nennt er nochmals (W437f.) als diesbezügliche
Voraussetzung den schon mehrfach genannten Punkt, dass sie bei ihm bleiben. Er fügt die weitere Voraussetzung an, dass seine Worte unter ihnen bleiben. Das Bleiben Jesu bei seiner Schülerschaft vollzieht sich also in dem Bleiben seiner Worte bei ihr. Das aber heißt; Jesus bleibt nach seinem Weggang so bei seiner Schülerschaft, er bleibt so in seiner Gemeinde, dass seine Worte bei ihr lebendig bleiben. Und sie bleibt ihrerseits so bei ihm, dass sie sich an seine Worte erinnert, sie wiederholt, sie sich von neuem gesagt sein und sich von ihnen leiten lässt. Ist diese Voraussetzung gegeben, verheißt Jesus: „Bittet, was immer ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“ Die sich an Jesu Worte halten, werden davon auch in ihrem Wollen bestimmt sein. Was sie so wollen, worauf sie aus sind und was sich doch nicht einfach „machen“ lässt, darum sollen sie bitten.
Wie bereits in 14,13f. (W438) wird einem „[s]olchem Bitten … Erfüllung verheißen“, da „Jesu Rede und Handeln ganz und gar davon bestimmt“ ist, „was Gott gebietet (vgl. nur 14,31; 15,20)“. Das heißt, jedes „Bitten“ der „Schülerschaft Jesu … steht in einem Zusammenhang mit der Frucht, die von ihr erwartet wird“, es „enthebt nicht davon, so zu handeln, dass Erbetenes – wie fragmentarisch auch immer – schon verwirklicht wird“. Aus diesem Grund schließt Jesus in Vers 8
den ersten Teil des Abschnitts mit der Aussage ab: „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Schüler werdet.“ Bringen Jesu Schüler Frucht, so geben sie damit Gott die Ehre. Überraschend ist, dass der Aussage vom Fruchtbringen die vom Schülerwerden parallel steht. Das sagt Jesus nach der im Text vorgestellten Situation zu den ihm treu gebliebenen Schülern, unter denen auch Judas nicht mehr weilt, nachdem schon in 6,66 viele weggegangen waren. Zur Schülerschaft Jesu zu gehören, kann daher kein statisches Beharren meinen, kein Abwarten mit verschränkten Armen. Schüler und Schülerin Jesu kann offenbar nur bleiben, wer es im Vollzug tätigen Lernens immer wieder wird. Der Ort dieser Schule war für die erste Leser- und Hörerschaft des Evangeliums die bedrängte Gemeinde.
Hartwig Thyen (T643) schaut genauer als Wengst die Formulierung von Vers 6 an. Zunächst fasst ihm zufolge die
generelle Formulierung: ean mē tis menē en emoi ktl. {wenn einer nicht in mir bleibt} … nicht nur die Möglichkeit, sondern wohl die konkrete Erfahrung ins Auge, daß sich auch ein Jünger, einer derer, die rein sind durch das Wort, das Jesus zu ihnen gesagt hat, von diesem Herrn abwenden und fortan nicht mehr mit ihm wandeln mag (vgl. 6,66). Solche Erfahrungen könnten der Grund dafür sein, daß Johannes statt vom reziproken einai en {wechselseitigen „Sein in“} bevorzugt vom Bleiben spricht und zum Bleiben mahnt.
Weiter ist es nach Thyen Gott als der Vater Jesu und der Winzer des Weinbergs,
der jeden, der nicht im Sohn bleibt, wie eine fruchtlose Rebe beseitigt und verdorren läßt, damit sie (die Arbeiter dieses Winzers?) diese (auta) einsammeln, ins Feuer werfen und verbrennen.
Zur Begründung dafür verweist Thyen auf die Verbformen eblēthē exō {wird hinausgeworfen} und exēranthē {wird verdorrt}, die als so genannte gnomische Aoriste in der Vergangenheitsform eine allgemeine Wahrheit im Passiv ausdrücken, wobei „die Wendung hōs to klēma {wie die Rebe} … zur Metaphorik des Weinstocks zurücklenkt und an die in V. 2 beschriebene Tätigkeit des geōrgos {Winzers} erinnert“.
Unter Berufung auf Borig und Hoskyns <1071> stellt Thyen fest (T643f.), dass
der schlichten Beschreibung gegenüber, die V. 2 von der Tätigkeit des geōrgos {Weingärtners} gab, jetzt „synoptische Gerichtsterminologie“ [Borig 51] oder allgemeiner gesagt: biblische Gerichtssprache eingesetzt [wird]. … Dazu verweist Hoskyns [476] auf Mt 5,13 (blēthen exō); 13,30.40f (synagousin; vgl. Mk 13,27 par.); Mt 15,13; 18,8f sowie auf Röm 11,22. Zu erinnern ist aber auch an Ps 80,17; Ez 15,2ff und Mal 3,19.
Von daher weist Thyen Interpretationen wie die oben auch von Wengst vorgelegte zurück, wobei er sich konkret gegen Barrett und Lindars <1072> wendet:
Barrett erklärt zu den Worten eis to pyr … kaietai {man wirft sie in Feuer, und sie verbrennen}, sie seien „in erster Linie gleichnishaft; d. h., es sind die unfruchtbaren Reben, die in das Feuer geworfen und verbrannt werden“. Ähnlich will Lindars die Wendung hōs to klēma {wie die Rebe} lediglich auf das metaphorische eblēthē exō {wird hinausgeworfen} beziehen, „was nicht wörtlich zu nehmen ist. Jesus spricht nicht von Exkommunikation. Der Rest des Verses erzählt, was mit den Zweigen geschieht, die weggeworfen werden. Sie verdorren aus Mangel an Saft, und ihr einziger Nutzen besteht darin, dass sie als Brennholz dienen. Nochmals: Jesus spricht nicht von ewiger Strafe; er sagt nur, dass ein Jünger, der die Gemeinschaft mit ihm abbricht, nutzlos ist“.
Thyen betont zwar, dass Vers 6 „im Zusammenhang vornehmlich der Warnung der Jünger vor dem Abfall dient und kein Interesse daran zeigt, die Schrecken des Jüngsten Gerichts auszumalen“, aber in seinen Augen
dürfen die gewiß nicht zufälligen Anklänge daran nicht überhört werden. Denn nicht vom Schicksal der unfruchtbaren Reben, die endlich verbrannt werden, ist hier die Rede, sondern von demjenigen (tis), der nicht ,in Jesus‘ bleibt und dem es darum hōs to klēma {wie der Rebe} ergehen wird …
In Vers 7, der „den verheißenden Ton von V. 5“ aufnimmt, erklärt Jesus „wieder in direkter Anrede seiner Jünger …: ‚Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben …‘“, was Thyen als „einen synonymen Parallelismus“ deutet: „Das Bleiben der Worte Jesu in den Glaubenden ist also die Weise, wie sie selbst in ihm bleiben.“
Ebenso knapp wie auf Vers 7 geht Thyen auch auf Vers 8 ein, der ausdrücklich auf das in Vers 1 „mit den Worten ‚und mein Vater ist der Winzer‘ Gesagte“ zurückkommt:
Wie es allein Jesu himmlischer Vater ist, der wie ein Winzer alles Unfruchtbare beseitigt und das Fruchtbare mehr als fruchtbar macht, so ist er es, der als liebender Vater die Gebete derer erhört, die in seinem Sohn bleiben, indem sie dessen Worte in sich bewahren. Denn nicht die Verherrlichung des Sohnes, die der Vater ja längst vollbracht hat, sondern die Verherrlichung des Vaters durch ihr fruchtbringendes Bleiben in seinem Sohn, das sie zu rechten Jüngern und als solche erkennbar macht (13,34f), ist Ziel und Inhalt ihres Weges …: en toutō edoxasthē ho patēr mou {darin ist mein Vater verherrlicht}.
Ton Veerkamp <1073> verzichtet in seiner Auslegung auf eine Beschäftigung mit Vers 6. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er für meine oben vorgestellte Interpretation vor dem Hintergrund von Hesekiel 19,10-14 offen gewesen wäre.
Zu Vers 7 schreibt er kurz und bündig:
Mit dem Messias verbunden bleiben ist mit seinen gesprochenen Worten (rhēmata) verbunden bleiben. Und wenn man mit dem Messias fest verbunden ist, wird jedes Gebet – freilich aus dieser Verbundenheit heraus – Gehör finden, weil die Worte sozusagen diktieren, was zu fragen ist. Diese Worte sind, so werden wir hören, Gebote.
Anders als Wengst und Thyen sieht Veerkamp den Vers 8 nicht als Abschluss eines ersten Teils von 15,1-17, sondern als Auftakt zu einem zweiten Teil:
Der zweite Teil dieses Abschnitts (15,8-17) ist nach einer strikten Logik aufgebaut. Zunächst aber wird festgehalten, was für Johannes „Gott ehren“ heißt. „Schüler dieses Messias“ und „fruchtbar sein“ ist die johanneische Definition für ein wahres, sich bewährendes Leben.
↑ Johannes 15,9-11: Standfest in der Liebe des VATERS bleiben und Freude erfahren
15,9 Wie mich mein Vater liebt,
so liebe ich euch auch.
Bleibt in meiner Liebe!
15,10 Wenn ihr meine Gebote haltet,
bleibt ihr in meiner Liebe,
so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe
und bleibe in seiner Liebe.
15,11 Das habe ich euch gesagt,
auf dass meine Freude in euch sei
und eure Freude vollkommen werde.
[22. November 2022] Was bedeutet es aber nun für Ton Veerkamp, <1074> Gott zu ehren und als Schüler seines Messias „fruchtbar“ zu sein? Die „Logik“, nach der die Verse 8-17 aufgebaut sind, beschreibt er folgendermaßen:
Grundfigur ist dabei immer: Der Vater ist solidarisch mit mir, ich mit euch, ihr miteinander. Damit diese Figur wirklich werden kann, wird eine Grundbedingung formuliert: „Wenn ihr meine Gebote wahrt, dann werdet ihr festbleiben in meiner Solidarität.“ Das Wahren der Gebote ist folglich die Verbundenheit mit dem Messias und so Bedingung für die Fruchtbarkeit. Die solidarische Verbundenheit des Messias mit dem Gott Israels ist das Wahren seiner Gebote. Daher ist das, was von den Schülern gefordert wird, strikte imitatio Christi, Nachfolge des Messias.
Zur Erläuterung der ungewöhnlichen Übersetzung von agapan in Vers 9 mit „solidarisch sein“ und von agapē in Vers 10 mit „Solidarität“ erinnere ich an Veerkamps Auslegung von Johannes 3,16. In seinen Augen läuft die Verwendung der Worte „lieben“ und „Liebe“ zu sehr Gefahr, das hier Gemeinte mit einer von Zuneigung bestimmten Emotion zu verwechseln, statt an die Selbstverpflichtung Gottes zur Treue und Solidarität mit dem Volk Israel zu denken, das er tatsächlich aus Liebe zu seinem Bündnispartner erwählt hatte.
Die unvermittelt auftauchende Erwähnung der Freude Jesu und seiner Schüler in Vers 11 bringt Veerkamp in einen Zusammenhang mit den anderen Stellen im Johannesevangelium, wo diese Freude ebenfalls eine Rolle spielte und spielen wird:
Bevor wir nun hören, was denn genau der Inhalt der Gebote ist, erklingt der Satz über die Freude. Viermal hören wir im Evangelium: „die Freude ist erfüllt“. Einmal wird er von Johannes gesagt, dreimal von den Schülern. Sie ist die Freude des Messias als auch über den Messias, die erfüllt wird (3,29; 15,11; 17,13). Johannes sagt, der Freund des Bräutigams „freut sich mit Freude“ beim Hören der Stimme des Bräutigams; „diese meine Freude ist also erfüllt: Jener muss zunehmen, ich muss geringer werden“, 3,29. Zweimal erfüllt sich die Freude des Messias in den Schülern, 15,11 und 17,13, einmal erfüllt sich die Freude der Schüler wie die Freude einer Frau, die ihr Kind geboren hat, 16.24. Im Gleichnis über den Rebstock und in seiner Deutung erfüllt sich die Freude durch die Fruchtbarkeit im Werk der Solidarität. Es geht um die Fruchtbarkeit (die Werke!) des Messias selber, die in den Schülern wirklich wird.
Unter Hinweis auf seine Auslegung von Johannes 3,29-30 betont Veerkamp in diesem Zusammenhang, dass bei „Johannes … die Fruchtbarkeit abnehmen“ musste, „damit die messianische Fruchtbarkeit um so deutlicher werden kann.“
Nach Klaus Wengst (W438) hatte in den Versen 1-8 „das Bild vom Weinstock und den Reben Jesu Rede“ bestimmt:
Daraus nimmt er im zweiten Teil des Abschnitts (V. 9-17) nur noch einmal das Motiv vom Fruchtbringen auf. Ansonsten redet er jetzt ohne Bild und interpretiert das im Bild zentrale Motiv des Bleibens als Liebe.
Zu Vers 9 hebt Wengst hervor, dass erneut die Mahnung Jesu, „in seiner Liebe“ zu bleiben, „wie in V. 4 sozusagen indikativischen Charakter hat“, indem er zunächst herausstellt, dass Liebe eine Gabe Gottes an Jesus und Jesu an seiner Schüler ist:
„Wie mich der Vater geliebt hat, habe ich auch euch geliebt.“ Das entspricht sachlich der Bildrede in V. 1. Zugleich nimmt er damit auf, was Johannes der Täufer in 3,35 über das Verhalten des Vaters zum Sohn und er selbst in 13,1 über sein Verhalten zu den Schülern gesagt hat. Gott hat Jesus geliebt: Er hat sich zu ihm bekannt, gerade zu dem, der in den Tod geht. Jesus hat seine Schüler geliebt: Er setzt für sie sein Leben ein.
Das Bleiben in der Liebe Jesu bezieht Wengst erneut auf das Bleiben der vom Evangelium Angesprochenen in der Gemeinde Jesu:
Bevor die Schüler aufgefordert werden zu lieben, werden sie dazu angehalten, in der Liebe Jesu zu bleiben. Für die das Evangelium Lesenden und Hörenden bedeutet das, in dem Raum zu bleiben, der von der Liebe Jesu bestimmt ist, im Raum der Gemeinde.
Weiter wird, wie bereits in 14,15.21, dieses Bleiben in Vers 10 als das
Halten seiner Gebote ausgelegt: „Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben.“ Jesus begründet das in seinem eigenen Verhalten gegenüber Gott: „Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.“ Wie die Liebe zu Gott vollzieht sich das Bleiben in seiner Liebe im Halten seiner Gebote.
Nach Wengst kann unter diesem Halten der Gebote Jesu „im Kontext biblisch-jüdischer Tradition“ nichts anderes gemeint sein (W439) „als das Halten des von Gott in der Tora Gebotenen“:
Die Gebote Jesu, des Sohnes, sind keine anderen als die des Vaters. Wenn er die Gebote im Liebesgebot zusammenfasst, gibt er damit nicht ein Gebot anstelle aller anderen Gebote, sondern benennt die Dimension und Intention, in der die Gebote zu halten sind. Wer sich durch Jesus von Gott geliebt erfährt und begreift, kann die Gebote nicht anders halten, als dabei von Liebe bestimmt zu sein.
Leider ist nach Wengst (Anm. 127) diese
Selbstverständlichkeit … in der Rezeption des Johannesevangeliums durch die Völkerkirche verloren gegangen, indem sie sich selbst gegen das „jüdische Gesetz“ profilierte. Als „Ethik des Johannesevangeliums“ nur die Liebe zueinander festzustellen – und als Verengung zu kritisieren -, geht genau an dieser Voraussetzung des „Haltens der Gebote“ vorbei. Die Liebe zueinander wird besonders thematisiert wegen der besonderen Situation.
Zum in Vers 11 angeschlagenen „Ton der Freude“ verweist Wengst (Anm. 129) auf Johannes 14,28 und zum Topos der „erfüllten bzw. vollendeten Freude“ wie Veerkamp auf 3,29. Hier wird die Freude zum Hintergrund, vor dem (W439) „das zusammenfassende Gebot“ der Liebe erklingen soll:
„Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude unter euch sei und ihr von Freude erfüllt werdet.“ Wer in der Liebe bleibt, wer Liebe erfährt, hat Freude. Jesus bleibt in der Liebe Gottes, weil er seinen Weg, der ihn in den Tod am Kreuz führt, im Halten des von Gott Gebotenen geht. Wieder steht hier die Situation seines Abschieds im Hintergrund. Sie ist kein Anlass für Trauer. Dass er so reden kann, wie er es tut, veranlasst im Gegenteil Freude, zunächst für ihn selbst. Die aber ist ansteckend, indem die durch ihn vermittelte Liebe die Seinen zu einem entsprechenden Verhalten anstiftet und sie so mit seiner Freude erfüllt werden.
Nach Hartwig Thyen (T644) nennt Vers 9 als „den Urgrund des wechselseitigen und befruchtenden In-Seins der Jünger in Jesus und Jesu in seinen Jüngern … die Liebe des Vaters zu Jesus und Jesu Liebe zu seinen Jüngern“. Dabei muss man „mit Segovia <1075>“ die
beiden Aoriste, mit denen die Liebesrelationen ausgesagt werden, … als konstative begreifen …, d. h. beide blicken auf das im Sterben Jesu vollendete Heilswerk Gottes zurück, so daß Jesu Liebe zu seinen Jüngern hier in der Perspektive des tetelestai {es ist vollbracht} und der Hingabe des Geistes (paredōken to pneuma {übergab er den Geist}) von 19,30 gezeichnet ist. Hier spricht also bereits der, der die größte Liebe, die einer überhaupt haben kann, dadurch erwiesen und konkretisiert hat, daß er für seine ,Freunde‘ gestorben ist (15,13ff). Und in solcher Liebe zu bleiben, ruft er sie auf: meinate en tē agapē tē emē {Bleibt in meiner Liebe}.
Nach Vers 10 konkretisiert sich dieses Bleiben in der Liebe Jesu darin (T644f.),
seine Gebote zu halten, so wie er die Gebote seines Vaters gehalten hat (tetērēka) und damit in dessen Liebe bleibt. Wie zuvor die konstativen Aoriste blickt auch dieses Perfekt tetērēka auf die am Kreuz vollendete Liebe Jesu zurück und bestimmt sie darüberhinaus zugleich als eine Liebe, in der die Jünger jetzt und auch in jeder künftigen Gegenwart geborgen sein werden.
Anders als Veerkamp und Wengst sieht Thyen (T645) in „der zusammenfassenden Wendung tauta lelalēka hymin {das habe ich euch gesagt}“ und in „der Angabe des Zieles dieses Gesagten: hina hē chara hē emē en hymin ē kai hē chara hymōn plērōthē {damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde}“, den Abschluss des ersten Abschnitts von Johannes 15:
Die Freude Jesu, von der er wünscht, daß sie auch seine Jünger erfülle, hat ihren Grund darin, daß er die Gebote seines Vaters gehalten hat und darum in dessen Liebe bleibt. Wenn Bultmann <1076> zu 16,28 erklärt, als Kennzeichen der ,eschatologischen Existenz‘ der Jünger, habe deren Freude „kein angebbares Woran“, so muß man ihn mit Fuchs fragen, ob „die eschatologische Freude nicht dennoch konkret als Freude an der Liebe bezeichnet werden (muß), so daß hier Werk und Person des Offenbarers von selbst im Blickfeld des Glaubens bleiben“.
Wie „das Kommen des Sohnes Gottes in die Welt“ den „Täufer Johannes“ mit Freude erfüllt hatte (3,29), so sollten Jesu Jünger sich nach 14,28 auch über „das Weggehen Jesu“ zum Vater freuen. Darüber ist aber hier noch nicht das letzte Wort gesprochen: „weiteres zur Freude der Jünger s. u. zu 16,20ff; 17,13 und 20,20.“
↑ Johannes 15,12-17: Jesu Gebot der Solidarität für die von ihm erwählten Freunde
15,12 Das ist mein Gebot,
dass ihr einander liebt,
wie ich euch liebe.
15,13 Niemand hat größere Liebe
als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
15,14 Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
15,15 Ich nenne euch hinfort nicht Knechte;
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich Freunde genannt;
denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe,
habe ich euch kundgetan.
15,16 Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt
und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt
und eure Frucht bleibt,
auf dass, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen,
er‘s euch gebe.
15,17 Das gebiete ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt.
[23. November 2022] Das Gebot Jesu, auf das die bisherigen Verse hinausliefen, wird nach Klaus Wengst (W439) in Vers 12 „wie in 13,34 … in spezifischer Zuspitzung“ ausgesprochen und „wie dort in der von ihm erwiesenen Liebe“ begründet: „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.“
Dass man nach Wengst „das eine neue Gebot Jesu nicht wie Zahn <1077> gegen die vielen Gebote Moses ausspielen“ darf, sondern dass „dieses eine im Halten der vielen zum Zuge kommt“, <1078> stand in der früheren Version seines Johanneskommentars, worauf Thyen (T650) hinweist. In seinem hier besprochenen Kommentar von 2019 hatte Wengst bereits zu Johannes 15,10 (W438f.) betont, dass unter dem „Halten der Gebote Jesu ‚im Kontext biblisch-jüdischer Tradition‘ nichts anderes gemeint sein“ kann „als das Halten des von Gott in der Tora Gebotenen“.
Jetzt wendet sich Wengst (W439) sogleich Vers 13 zu und findet in ihm die konkrete Beschreibung von „Jesu Liebe zu seinen Schülern“ in folgendem
allgemein gehaltenen Satz: „Größere Liebe als diese hat niemand, als das Leben für die Freunde einzusetzen.“ Als der größte Liebeserweis gilt hier der Einsatz des Lebens für andere; genau das steht Jesus im Begriff zu tun. In der vorgestellten Situation redet er seine Schüler an. Sie hat er beim Erweis der gerade genannten Liebe im Blick. Deshalb wird hier vom Lebenseinsatz für die Freunde gesprochen.
Dazu merkt Wengst (Anm. 130) im „Blick auf antike Freundschaftsethik“ an, indem er Malina und Rohrbaugh <1079> zitiert, dass hier „fiktive Verwandtschaft, nicht politische Freundschaft“ beabsichtigt ist. Sie „implizierte gegenseitige Verpflichtungen von hohem Rang“ und „schloss die Bereitschaft ein, den Freund unter Einsatz des eigenen Lebens zu verteidigen“. Soll damit ausgeschlossen sein, dass die Ziele messianischer Freunde politischer Art sein konnten – etwa im Sinne der Überwindung der gottfeindlichen römischen Weltordnung durch die Solidarität des Gottes Israels?
Kritisch setzt sich Wengst (W439) mit der „Wirkungsgeschichte“ auseinander, die der Vers 13
[l]osgelöst aus seinem Kontext und außerhalb theologischer Kommentare und Monographien … besonders in der populären theologischen Kriegsliteratur während des Ersten Weltkriegs gehabt [hat] und bei ungezählten „Heldengedenkfeiern“ in der Zeit danach. Als ein Beispiel sei Ludwig Müller <1080> angeführt, von 1933-1945 „Reichsbischof“.
Jesus (W440) sagt in Vers 14 im
Blick auf den Begriff Freunde … seinen Schülern dasselbe, was er ihnen vorher hinsichtlich des Bleibens in seiner Liebe gesagt hat: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.“ Seine Schüler erweisen sich als seine Freunde, wenn sie sich an das von ihm Gebotene halten, das den Geboten Gottes entspricht und das er im Gebot, einander zu lieben, zusammengefasst hat. Auf die in Jesus manifest gewordene Liebe Gottes lässt sich ein, wer sich selbst liebend verhält.
Als „sachliche Analogie hierzu“ zitiert Wengst einen „Ausspruch des Rabbi Meïr“: <1081>
„Jeder, der sich mit der Tora um ihrer selbst willen beschäftigt, ist vieler Dinge würdig; und nicht nur das, sondern die ganze Welt ist es wert, ihm zu gehören. Er wird geliebter Freund (Gottes) genannt.“
Indem Jesus „seine Schüler als Freunde“ anspricht, tut er das gemäß Vers 15 „im Kontrast zu Knechten bzw. Sklaven“. Da (Anm. 131) nach dem „biblischen Recht … ein hebräischer Sklave im siebten Jahr freizulassen ist (Ex 21,2)“, während „ein doúlos“ im „griechisch-römischen Bereich … ein rechtlich lebenslang unfreier Mensch“ ist, der „kein Recht auf Freilassung“ hat, übersetzt Wengst hier lieber nicht mit „Sklave“, sondern mit „Knecht“ (W440):
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt; denn ich habe euch alles kundgetan, was ich vom Vater gehört habe.“ Auch im bisherigen Evangelium hat Jesus seine Schüler nicht Knechte genannt. Er hat im Vergleich vom Herrn und Knecht gesprochen und dabei einen Aspekt dieser Relation im Blick auf sein Verhältnis zu seinen Schülern betont (13,16). Das wird er gleich wiederholen. Einen anderen Aspekt im Verhältnis von Herr und Knecht schließt Jesus für das Verhältnis zu seinen Schülern hier entschieden aus, dass es nämlich eins von Befehl und Gehorsam sei, bei dem der Knecht über Sinn und Zweck des ihm befohlenen Tuns nichts weiß. Er wird nicht ins Vertrauen seines Herrn gezogen. Das aber macht den Freund aus, dass er ins Vertrauen gezogen wird.
Als Parallele dazu führt Wengst die Art an, „wie die biblisch-jüdische Tradition über Abraham und Mose als Freunde Gottes redet (vgl. Gen 18,17; Jes 41,8; 2. Chr 20,7; Ex 33,11).“ Dazu findet er folgende Auslegung <1082> zu 1. Mose 18,17:
„Gleich einem König, der drei Freunde hatte und nichts ohne ihr Wissen tat. Einmal wollte der König etwas ohne ihr Wissen tun.“ Zwei schaltet er aus. „Im Blick auf den dritten, der ihm der liebste von ihnen war, sprach er: ‚Ich tue nichts ohne sein Wissen.‘“ Das wird auf Gott im Verhältnis zu Adam, Noah und Abraham bezogen und schließlich gesagt: „Im Blick auf Abraham, der ihm der liebste von ihnen war, sprach er: ,Ich tue nichts ohne sein Wissen.‘“
Aber warum will Jesus seine Schüler „nicht mehr“ Knechte nennen, wenn er das doch auch bisher nicht getan hat? Das ist nach Wengst darauf zurückzuführen, dass im Johannesevangelium „der irdische Jesus – besonders in den Abschiedsreden – aus österlicher Perspektive spricht“:
Jesus hat seine Schüler ins Vertrauen gezogen und sie damit zu Freunden gemacht. Das bringt er mit der schon öfter gebrauchten Wendung zum Ausdruck, ihnen alles kundgetan zu haben, was er vom Vater gehört hat (vgl. 3,32; 8,26.40). Er hat ihnen keine himmlischen Geheimnisse „offenbart“, sondern sie dessen zu vergewissern versucht, dass in ihm – und gerade und besonders in seinem Tod – Gott begegnet. Von hier aus bekommt die Wendung „nicht mehr“ ihren Sinn. Denn in dieses Vertrauen, dass Jesu Schülerschaft ihrerseits auf den hier begegnenden Gott vertraut, lässt sie sich erst nach Ostern ziehen.
In Vers 16 wird allerdings deutlich, dass Jesus „Schülerschaft“ zwar „Jesus befreundet“ ist, „weil er sie ins Vertrauen gezogen hat“, aber dennoch ist (W440f.)
nicht … er in gleicher Weise ihr Freund; zusammen bilden sie keinen Freundschaftsbund. Das im Vergleich von Herr und Knecht ausgesagte Gefälle bleibt bestehen. Das sagt Jesus deutlich: „Nicht ihr habt mich für euch erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ Jesu Handeln konstituiert dieses Verhältnis, nicht das Handeln derjenigen, die zu ihm kommen, mögen sie auch auf sehr unterschiedlichen Wegen gekommen sein, wie schon das Kommen der ersten Schüler zeigte.
Mehrere Aspekte kommen weiter zu „dem erwählenden Ruf Jesu“ hinzu, erstens der Aspekt der Sendung, indem er die Schüler
„dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und eure Frucht beständig sei.“ Hier ist ein wesentliches Moment aus der Bildrede aufgenommen: das Fruchtbringen. Im Blick ist damit noch einmal ein „fruchtbares“ Gemeindeleben, das „neue Welt“ aufleuchten lässt und darin „beständig“ zu sein sucht. Dem Ziel, Frucht zu bringen, fügt Jesus als Folge an, „sodass der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet“. Jesu Schülerschaft handelt als zugleich bittende. Dass sich Frucht einstellt, ist immer auch Gabe.
Zum Abschluss dieses Abschnitts wiederholt Jesus „sein Vermächtnis aus 13,34“ in Vers 17:
„Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.“ Die für die erste Leser- und Hörerschaft des Evangeliums elementare Bedeutung dieser Mahnung zur Solidarität untereinander tritt angesichts des im folgenden Abschnitt Ausgeführten deutlich hervor.
Sehr viel ausführlicher als Wengst beschäftigt sich Hartwig Thyen (T645) mit dem Umstand, dass Vers 12 zwar „im wesentlichen die Wiederaufnahme des neuen Gebotes Jesu von 13,34“ darstellt, aber diesem „intertextuellen Verfahren entsprechend … jetzt nicht mehr als neues, sondern … als Jesu Gebot bezeichnet“ wird, nämlich als
hē entolē hē emē {mein Gebot}. Hatte Jesus in V. 10 noch im Plural von ,seinen Geboten‘ gesprochen, so sind alle diese Gebote jetzt in dem einen Gebot, einander so zu lieben, wie Jesus seine Jünger geliebt hat, konzentriert. Die Wendung kathōs ēgapēsa hymas {wie ich euch geliebt habe} ist, wie der Kontext von Joh 13 gelehrt hat, nicht nur ein Hinweis auf das Wie der Liebe zu einander, sondern unveräußerlicher und seine eschatologische Neuheit begründender Teil des Gebots selber. Und im Licht des Sklavendienstes der Fußwaschung als der Vorabbildung des Liebestodes Jesu für seine Freunde fordert sein Gebot, den Anderen zu lieben kathōs ēgapēsa hymas, nichts geringeres als dies, daß der eine zum Sklaven des anderen werde und dessen Tod mehr fürchte als den eigenen (vgl. 18,8).
Sodann setzt sich Thyen kritisch mit Hermann Timm <1083> auseinander, der zu Vers 12
erklärt, mit der Bezeichnung seines neuen Gebotes als hē entolē hē emē beanspruche Jesus „die Liebesidee als geistiges Eigentum. Und das zu Recht“, und … {der} dieses Gebot – entgegen dem oben zu 13,34 Gesagten – ein geistesgeschichtliches Novum nennt…
Das kann insofern nicht der Fall sein (T645f.), als
hier etwas als das geistige Eigentum eines Mannes ausgegeben wird, der nicht müde wird, immer wieder zu betonen, daß er nichts aus sich selber und seinem Eigenen tue oder rede, sondern nur solches sage und wirke, das der allen bekannte Vater ihm zeige und sage.
Erst recht (T646) liegen Thyen zufolge die folgenden „antijüdischen Töne und Timms Rede von der abrogatio legis {Aufhebung des Gesetzes} doch völlig jenseits der Welt unseres Evangeliums“, wenn Timm behauptet,
mit diesem neuen Gebot habe „die alttestamentliche Rede von Herr(gott) und (Gottes-)Knechtschaft ihre Legitimation verloren. Die Liebeserkenntnis alteriere das dominante Gottesprädikat des überkommenen Glaubens, weil sie keine Herrschaft und keinen blinden Gehorsam mehr zuläßt“ … Sein Plädoyer gegen den vermeintlichen „Sklavengeist des monotheistisch-monarchischen Juden- Philosophengottes, der seine Ratschlüsse zu inkommunikablen Seinsgeheimnissen tabuisier(e), weil er selbst in der despotischen Ohnmacht des Suisuffizienten {der Selbstgenügsamkeit} befangen“ sei, beruht doch wohl eher auf der uns höchst fragwürdigen Interpretation einer zudem willkürlich isolierten Einzelpassage unseres Evangeliums. Es spiegelt überholte Meinungen aus dem Spektrum von dessen romantisch-idealistischer Benutzung und ein Gemenge aus pseudoprotestantischen und antijüdischen Affekten gegen die Tora als angeblichen Heilsweg. Auf den Text des gesamten Evangeliums und sein intertextuelles Spiel mit der jüdischen Bibel als seine Zeugin und den synoptischen Prätexten kann es sich jedoch schwerlich berufen.
Ich würde gegen Timm zu allererst betonen, dass der Gott Israels alles andere als ein ein selbstgenügsamer Philosophengott oder knechtender Herrgott ist, sondern dass seine höchste Ehre darin besteht, das von ihm erwählte Volk in die Freiheit zu führen, damit es sein Leben in Freiheit, Recht und Frieden durch Befolgung der Tora bewahrt. Thyen weist zur Begründung seiner Kritik an Timm darauf hin, dass Jesus dieselben Schüler, die er „seine Freunde“ und „nicht länger Sklaven“ nennt, schon „wenige Zeilen“ später „nachdrücklich an sein Wort erinnern“ muss, dass
ein Knecht nicht größer sei als sein Herr (13,16 = Mt 10,24!). … Wenn auch fraglos verwandelt, bleibt die Dialektik von Herr und Knecht doch bestehen: hymeis phōneite me: ho didaskalos kai ho kyrios, kai kalōs legete; eimi gar {Ihr nennt mich euren Lehrer und euren Herrn, und tut recht daran, denn der bin ich} (13,13). Ohne diesen Hintergrund brächte man den Akt der Fußwaschung um seine Pointe, die doch in dem wunderbaren Tausch (Luther) besteht, daß der Herr sich hier zum Sklaven seiner Jünger macht: „Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein“ (Luther, Lobt Gott ihr Christen alle gleich).
Später ergänzt Thyen (T650) im Zusammenhang der Auslegung von Vers 14, dass sich die Jünger Jesu „als seine Freunde … nur dadurch erweisen, daß sie tun, was er ihnen gebietet“, so dass „die Herr-und-Knecht-Relation durch diese Erklärung der Freundschaft nicht etwa aufgehoben wird, wie Timm meint, sondern daß dieser Herr sie nur zutiefst verwandelt“. Das heißt: „Jesus, aus dessen Mund der Vater spricht“, bleibt „der gebietende Herr.“
Zur Bestimmung der inhaltlichen Aussage des Liebesgebots kommt Thyen (T646) auf Gedanken zurück, die er bereits zu Johannes 13,12-17 entfaltet hatte:
Als Gebot (entolē), den jeweils anderen zu lieben, d.h. ihn in seinem Anderssein zu respektieren, ist das Verhältnis zum anderen Menschen ein irreduzierbar ethisches Verhältnis. Das hat Lévinas in zahlreichen Studien dadurch erwiesen, daß er dessen Differenz zum ontologischen Verhältnis herausgestellt hat.
Zu diesem Unterschied zwischen einem Erkennen, das auf das Sein oder Wesen von Menschen gerichtet ist, die dadurch zu Gegenständen, Objekten, gemacht werden, und einer ethischen Beziehung zu Menschen, die diese als Personen, Subjekte, ernst nehmen, zitiert er erneut Ludwig Wenzler, <1084> der Lévinas Gedanken in einer Weise zusammenfasst, die zwar schwer zu begreifen ist, die ich aber dennoch nicht kürzen möchte, um das Verständnis nicht noch zusätzlich zu erschweren (T646f.):
„Der ,Primat der Ontologie“, das heißt der Erfassung und Konstitution der Wirklichkeit durch das transzendentale Bewußtsein oder – in der Fundamentalontologie Heideggers – durch das Seinkönnen des Daseins, scheint universal unerschütterlich zu sein. Mit einer Ausnahme: der Andere widersetzt sich dem Verstandenwerden in den Kategorien des Seins. Dem Anderen gegenüber erscheint das Verstehen und Ergreifen im Licht des Seins als ein Akt der Gewalt, weil es gerade die Anderheit des Anderen auslöscht, sich unterwirft, im extremen Fall dadurch, daß es den Anderen tötet. – Zugleich aber muß diese Gewalt am Anderen scheitern. Der Gewalt des Könnens und Verstehens stellt sich im Anderen eine unbedingte Grenze entgegen: Genau das, was den Anderen als ihn selbst ausmacht, entgeht dem Können des autonomen Subjekts. Der Andere stellt der Gewalt des Verstehens und Beherrschens einen Widerstand entgegen, der selbst nicht wieder von der Art der Gewalt ist, sondern gerade in der Schutzlosigkeit des anderen besteht. Diese Schutzlosigkeit spricht sich aus in der Bitte: Du wirst mich nicht töten. Diese Bitte hat den Rang eines Befehls. Der Widerstand gegen die Gewalt ist ethischer Widerstand. In diesem ethischen, gewaltlosen Widerstand drückt sich ein Bedeuten aus, das nicht von der sinngebenden Intentionalität eines erkennenden Subjekts ausgeht, sondern das vom Anderen selbst kommt. Lévinas nennt dieses Bedeuten, in dem sich der Andere selbst ausdrückt und in dem er sich als ethischer Widerstand jedem Ergreifenwollen entgegenstellt, das Antlitz des Anderen [„Wir nennen Antlitz die Epiphanie {offenbarende Erscheinung} dessen, was sich so direkt und eben dadurch von Außen kommend einem Ich darstellen kann“ <1085>]. Dieses Antlitz entzieht sich der Gewalt, die im Ergriffenwerden durch das Sehen besteht. Es gibt sich nicht durch Gesehenwerden kund, es spricht. Es spricht mich an und fordert von mir eine Antwort. Es stellt durch seinen Widerstand mein Können und meine Gewalt in Frage und fordert Gerechtigkeit. Es macht mich verantwortlich. Durch diesen ethischen Anspruch ist jedes ontologische Verständnis des Anderen und jedes auf dem Vollzug des Seins beruhende Verhältnis zu ihm in Frage gestellt und unterfangen. Die Rolle der Ersten Philosophie geht von der Ontologie auf die Ethik über“.
Das Gleiche drückt Thyen dann aber auch noch etwas weniger philosophisch abgehoben aus (T647):
Wie der barmherzige Samariter der lukanischen Erzählung durch das geschlagene und entstellte Antlitz des unter die Räuber Gefallenen in eine Verantwortung gerufen ist, der er sich nicht entziehen kann, so sollen die Jünger sich wechselseitig von dem jeweils Anderen in dessen Geiselhaft nehmen und sich vor ihm auf die Anklagebank setzen lassen, <1086> so wie Jesus sie geliebt hat, indem er sein Fleisch für das Leben der Welt gab (6,51). Der nomos {Gesetz}, dem mich das Antlitz des Anderen unterwirft und für ihn verantwortlich macht, ist ein heteronomer, der meine Autonomie und mein Können zerbricht.
Noch einmal wendet sich Thyen in diesem Zusammenhang gegen Timm, der „das Verhältnis zum Anderen“ [93ff] mit „den ontologischen Kategorien von lntersubjektivität, Symmetrie, Synchronie {Gleichzeitigkeit} und Gleichursprünglichkeit“ zu beschreiben versucht, was aber unmöglich ist:
Liebe beruht vielmehr auf einem diachronen {ungleichzeitigen} in keiner Vergangenheit lokalisierbaren Erwähltsein des Einen durch den Anderen. Anders als Heidegger, dem „der Tod … die eigenste Möglichkeit des Daseins“ ist <1087>, sieht Lévinas den Tod nicht als die letzte Möglichkeit des Daseins, sondern als dessen absolute Grenze und als die Unmöglichkeit meines Könnens. „Eine einzige Möglichkeit läßt mir der Tod, die aber in keiner Weise meine Möglichkeit ist, sondern die mir allein durch den Tod gewährt wird; es ist die Möglichkeit, im unabwendbaren Sein zum Tode – für den Anderen zu sein, den Tod des Anderen mehr zu fürchten als den eigenen Tod … Der Umstand, daß der Tod die Möglichkeit eröffnet, im Sein zum Tode für den Anderen zu sein, deutet darauf hin, daß es ,jenseits des Todes‘ eine Dimension des Sinnvollen, des Unzerstörbaren, des Friedens geben kann“ [Wenzler 73f].
Zu den Versen 13-15 kommt Thyen zunächst auf Martin Dibelius <1088> zu sprechen, der „in der von dem Liebesgebot der V. 12 u. 17 eingeschlossenen Passage 13-15 eine ‚midraschartige Abschweifung‘“ erblickte, „nach der V. 16 zum Liebesgebot zurücklenke.“ Dabei lehnt Thyen aber sowohl die Annahme von Dibelius ab, Vers 13 sei ein „vorjohanneisches Traditionsstück“ gewesen, als auch dessen Fazit (T647f.):
„Die Bedeutung des Wortes ,Liebe‘ in dem Spruch 15,13 aber ist nicht die johanneische, sondern eine populärere, allgemeine; der hier angedeutete Gedanke vom Opfertod aus Liebe wird im Evangelium weder sonst noch hier besonders hervorgehoben“.
Thyen fragt sich dazu (T648), warum
ein Autor seinem Werk mittels einer eigens dazu gebildeten midraschartigen Abschweifung ein traditionelles Wort über das freiwillige Sterben für die Freunde als Gipfel aller Freundesliebe inkorporiert haben [sollte], wenn sein eigenes Verständnis von Liebe als Wesensgemeinschaft (Dibelius) dessen ,gemeinchristlich-ethischer‘ Bedeutung als altruistischer Liebesgesinnung diametral widerspricht? Nein! … Wie sich nach Dtn 6,4f die Liebe zu Gott mit allen Kräften des Leibes und der Seele, und das heißt unter Einschluß der Sinnlichkeit, nicht anders als im Halten seiner Gebote zu äußern vermag, so muß auch die Liebe zu Jesus sich nach seinem Weggang mit Leib, Seele und allen Sinnen auf den Anderen richten. Auch bei Johannes dürfte also mutatis mutandis Jesu Wort gelten: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).
Zu Recht betont Dibelius in den Augen von Thyen „die große Nähe von Joh 15,13-15 zur antiken, namentlich durch Aristoteles ausgebildeten Freundschaftsethik“, die „in der hellenistischen Zeit nach Alexander Eingang in die jüdische Märtyrerliteratur gefunden“ hat, wozu Thyen auf „1Makk 9,10; 6,44; 2Makk 6,28; 7,9.37; 8,21; 14,37; 4Makk 6,28; 17,20ff“ verweist (T648f.):
Der Tod der Märtyrer, die auch in Verfolgung und Leiden treu an Gott und seinem Gebot festhalten, wird nicht als ihr Ende beklagt, sie werden vielmehr zu idealen Vorbildern und von Gott mit neuem Leben belohnt… lm Unterschied zu dem zumeist auf Freundespaare bezogenen antiken Freundschaftsideal ist bei Johannes – wie auch sonst im Neuen Testament – das hypodeigma {Vorbild} der Lebenshingabe Jesu (13,15) nicht nur Motiv, sondern zugleich auch Grund des Gebotes, den anderen auch mit dem Einsatz des eigenen Lebens zu lieben. … Wenn man V. 13 nicht wie Dibelius von seinem Kontext isoliert, dann erscheint der Tod Jesu hier nicht als seine heroische Tat, sondern als treuer Gehorsam gegenüber dem väterlichen Gebot und als der Gipfel seines rettenden Heilshandelns …
Dazu, dass Johannes (T648) statt „des synoptischen didōmi tēn psychēn hyper tinos {das Leben für jemanden geben} … die scheinbar schwächere Wendung tithēmi tēn psychēn mou hyper tinos {mein Leben für jemanden einsetzen}“ verwendet, „die in griechischen Texten das Wagen oder den Einsatz des Lebens für jemanden oder für eine Sache ausdrückt“, meint Thyen, dass einerseits „das tithēmi {Einsetzen} im Blick auf den Einsatz Jesu durch Joh 10,17f längst als dessen tatsächliche Lebenshingabe definiert ist“, aber andererseits „in der Mahnung an die Jünger die Bedeutung, für den Anderen das eigene Leben einzusetzen, gleichwohl stets mitschwingen“ dürfte, „so daß tithēmi tēn psychēn {das Leben einsetzen} zu den absichtsvoll doppeldeutigen Ausdrücken bei Johannes zu zählen wäre“.
Erwägenswert finde ich Thyens Gedanken, dass der Akzent „auf der Lebenshingabe für die Freunde“ in Vers 13 „aber nicht etwa die Feindesliebe“ ausschließt. Denn das ist gar nicht sein Thema. Gesagt wird vielmehr nur, daß es keinen größeren Liebeserweis als die Lebenshingabe für die Freunde gibt.
Nach dem (T649) allgemein mit den Worten oudeis und tis {niemand und einer} formulierten Vers 13, der
freilich insgeheim schon auf Jesu Sterben für seine Jünger bezogen war, deckt V. 14 das dadurch auf, daß Jesus nun in direkter Anrede seiner Jünger und in Wiederaufnahme des Lexems philos erklärt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
In Vers 15 wird dann „an dem Gegensatz zum Dasein eines Sklaven“ erläutert, „[w]as es heißt, ein Freund zu sein“:
Wenn Jesus sagt, er nenne seine Jünger nun ,nicht mehr‘ (ouketi) seine Sklaven, sondern vielmehr seine Freunde, denn als seinen Freunden habe er ihnen ja stets alles kundgetan, was er bei seinem Vater gehört habe, während der Sklave blind gehorchen müsse, weil er ja nicht wisse, was sein Herr vorhabe und tue, so darf man dieses ouketi nicht so deuten, als habe Jesus seine Jünger zuvor jemals seine Sklaven genannt und sie als solche behandelt, als distanziere er sich hier von seinem 13,13 ausgesprochenen Wort und mache seine vormaligen Sklaven erst jetzt und durch dieses Wort zu seinen Freunden. Denn was er bei seinem Vater gehört hat, das tut er ihnen ja nicht erst jetzt kund, sondern das hat er seit dem ersten Tage ihrer Berufung immer schon getan.
Anders als Wengst unterscheidet Thyen ein „Vorher von einem Nachher“, also das „Vorher blinden Sklavengehorsams von dem Nachher freundschaftlicher Freiheit“ nicht erst aus österlicher Perspektive, als ob die Schüler Jesu erst nach Ostern in der Lage seien, sich als Freunde Jesu zu begreifen. Nach Thyen kann sich dieses Vorher
nur auf eine Zeit vor ihrer Erwählung zu seinen Jüngern beziehen, eine Zeit, ehe er ihnen, die an seinen Namen glaubten, die Vollmacht gegeben hatte, Gottes Kinder zu werden (1,12f). Im Blick ist also eine Zeit, da Jesus ihnen wie den Ioudaioi {Juden} von 8,31ff hätte sagen müssen: „Amen, Amen ich sage euch: jeder der Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave aber bleibt nicht für immer im Hause, sondern allein der Sohn bleibt in Ewigkeit. Nur wenn der Sohn euch befreit, seid ihr wirklich Freie“ (8,34-36) und müßt nicht in euren Sünden sterben (8,24). Ist es bloßer Zufall, daß diese Metaphorik von Sklaverei und Freiheit aus Kapitel 8 hier wiederaufgenommen und durch das Gegenüber des Sklaven und des Freundes variiert wird?
Später scheint Thyen (T650) aber eine Sichtweise wie die von Wengst doch nicht ganz auszuschließen, wenn er schreibt:
Wenn wir uns daran erinnern, daß nach Joh 14,31f in unserem Kapitel verborgen bereits der zum Vater erhöhte Sohn spricht, dann wird man das ouketi {nicht mehr} zugleich auch auf die kommende Zeit des Geistes beziehen dürfen, so daß die Neuheit des Gebotes dann wie bei Jeremia 31,31ff auch darin bestünde, daß Jesu Gebot seinen Jüngern fortan in die Herzen geschrieben wäre…
In der Art (T649), wie Jesus hier diejenigen seine Freunde nennt, „die er in sein Vertrauen gezogen, denen er das Geheimnis seines Weges kundgetan hat, und denen er sogleich offenbaren wird, daß der Haß der Welt, so wie er ihn jetzt trifft, auch sie nicht verschonen wird“, sieht Thyen auch ein intertextuelles Spiel mit Lukas 12,4 angedeutet:
legō de hymin tois philois mou, mē phobēthēte apo tōn apokteinontōn to sōma ktl. {Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können.} Jedenfalls aber muß man die Bezeichnung der Jünger als Freunde Jesu im Zusammenhang mit den analogen Vorbildern solcher Rede im Alten Testament und in der jüdischen Überlieferung sehen, wo z.B. Abraham, dem Gott nicht verbarg, was er zu tun gedenke, der Freund Gottes genannt wird: Jes 41,8; 2Chr 20,7; Jak 2,23; vgl. Sap 7,27.
Dazu verweist Thyen außerdem auf die von Wengst [146] angeführte rabbinische Auslegung von 1. Mose 18,17 zu Abraham als dem vertrautesten Freund Gottes.
Indem Jesus in Vers 16 erklärt (T650): „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt …“, so kommt Thyen zufolge der „asymmetrische Charakter der Liebesrelation“
auch darin zum Ausdruck, daß sich in ihr der Eine stets vom Anderen erwählt und zur Liebe ,erweckt‘ weiß. Nicht kraft meiner freiheitlichen Autonomie habe ich mir den Anderen in meiner Zeit zu meinem Alter-Ego erwählt, sondern längst bevor ich überhaupt ich im Nominativ sagen konnte und vor aller Zeit dieses Ich, war da der Andere, der mich (Akkusativ!) erwählt, für sich verantwortlich gemacht und in den Zustand der Anklage versetzt hat.
Damit bezieht sich Thyen erneut auf das bereits erwähnte Werk von Lévinas, Wenn Gott ins Denken einfällt. Worauf es Thyen ankommt, hebt er mit eindringlichen Worten hervor:
Nicht ihm Gleiche und insofern Liebenswerte hat er {Jesus} sich erwählt, sondern Ungleiche und Schwache. In die heillosen Strukturen ,dieser Welt‘ verstrickte und sich unter der Gewalt ihres ,Fürsten‘ ängstende Sünder hat er sich als seine Freunde erwählt und sie dadurch erst zu Liebenswerten gemacht. Wenn Jesus diejenigen, die er ins Vertrauen gezogen hat, seine Freunde nennt, so ist er dadurch doch nicht „in gleicher Weise ihr Freund; zusammen bilden sie keinen Freundschaftsbund. (Denn) das im Vergleich von Herr und Sklave ausgesagte Gefälle bleibt bestehen“ [Wengst 146].
Außerdem betont Thyen, dass „die Liebesrelation bei Johannes nicht ,Wesensgemeinschaft‘ ist (Dibelius), sondern vielmehr ,Tätergemeinschaft‘“, was im zweiten Teil von Vers 16
die Wiederaufnahme des Lexems karpos {Frucht} aus der einleitenden Weinstock-Metaphorik [zeigt]: „sondern ich habe euch erwählt und dazu ausersehen, daß ihr Frucht bringen sollt, und daß eure Frucht bleibe“. Das Fruchtbringen besteht nach dem näheren Kontext im Tun der Gebote Jesu, die sich verdichten in dem einen Gebot, einander zu lieben.
Zwar sieht Thyen „Erwählung und Sendung als die beiden Seiten ein und derselben Medaille aufs engste miteinander verbunden“, aber er will „das Fruchtbringen“ – „unter Berufung auf 4,31ff“ – „doch nicht einseitig auf die möglichen und erwünschten Missionserfolge der Jünger reduzieren“. Stattdessen zitiert er nochmals zustimmend Wengst [146] (T650f.):
„Im Blick ist damit (vielmehr) noch einmal ein ,fruchtbares‘ Gemeindeleben, das (die) ,neue Welt‘ aufleuchten läßt und so bleibt“, ein Gemeindeleben, an dem „jedermann erkennen soll, daß ihr meine Jünger seid“ (13,35).
Der dritte Teil von Vers 16 (T651), „hina ho ti an aitēsēte ton patera en tō onomati mou dō hymin {damit, was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, er euch gebe}“, drückt in seiner „Parallelität“ zum „Fruchtbringen als Zweck und Inhalt der Erwählung“ aus, dass „auch die Früchte, die die Jünger durch ihr Tun hervorbringen sollen, vom Vater gewährte Gaben sind.“
Mit Vers 17: „Das (alles) gebiete ich euch, auf daß ihr einander liebet!“, wird nach Thyen der in Vers 12 eröffnete zweite Abschnitt der Rede Jesu beendet, indem „Jesus auf seine Worte“ zurückkommt,
mit denen er in V. 12 diesen zweiten Abschnitt seiner Rede eröffnet hatte. Wengst [147] bemerkt dazu treffend, die „für die erste Leser- und Hörerschaft des Evangeliums elementare Bedeutung dieser Mahnung zur Solidarität untereinander (trete) angesichts des im folgenden Abschnitt Ausgeführten deutlich hervor“.
Anders als Thyen deutet Ton Veerkamp <1089> deutet das in Vers 12 ausgesprochene Gebot Jesu im Sinne einer auf die eigene messianische Gruppierung beschränkten Forderung:
„Dies ist mein Gebot: dass ihr miteinander solidarisch seid.“ Für die Gruppe um Johannes, die eine sehr schwierige Phase durchmacht – die Leute laufen ihr ja davon, 6,60ff., sie streiten und verketzern sich untereinander, 1 Johannes 2,18; 2 Johannes 10; 3 Johannes 9 -, ist der Zusammenhalt der Gruppe lebensnotwendig. Die Solidarität konzentriert sich ganz auf die Gruppe selber. Wie gesagt, von universeller Menschenliebe bzw. Philanthropie keine Spur.
Ob das Gebot der agapē wirklich nur auf die eigene Gruppe bezogen bleiben soll, möchte ich allerdings von der späteren Sendung der Schüler (20,21-23) her bezweifeln; auch kann die Überwindung einer Weltordnung des Hasses und der Gewalt doch wohl nur gelingen, wenn Solidarität auch demjenigen gilt, der nicht zu meiner Gruppe gehört, selbst wenn Johannes nicht ausdrücklich von Feindesliebe spricht. Radikal genug ist immerhin die Forderung des johanneischen Jesus, zum gegenseitigen Sklavendienst bereit zu sein (13,14-15).
Bestätigt sieht sich Veerkamp in seiner Deutung dadurch, dass Jesus in den folgenden Versen 13-15 seine Schüler ausdrücklich seine Freunde nennt, denen seine Solidarität in außerordentlicher Weise gilt:
Der Zug ins Sektiererische färbt hier auf Jesus selber ab: niemand habe größere Solidarität, als wenn er seine Seele für seine Freunde einsetzt, sagt er und nennt die Schüler „Freunde“, nicht länger Sklaven. Das sollte man mit Römer 5,7ff. vergleichen, wo dieser Einsatz in seiner extremsten Form – die Hingabe des eigenen Lebens – nicht der Freunde, sondern der Verirrten wegen geschieht! Die Freundschaft dieses winzigen Kreises mit dem Messias ist darin begründet, dass Jesus sie mit dem „bekanntgemacht hat, was er von seinem VATER gehört hat“. Sie sind der bevorzugte und zunächst einzige Adressatenkreis dieser Bekanntmachung.
Wie Wengst und Thyen macht jedoch auch Veerkamp zur Freundschaft Jesu mit seinen Schülern darauf aufmerksam, dass diese das Gefälle zwischen ihm und ihnen nicht aufhebt, was Jesus in Vers 16 deutlich zur Sprache bringt:
Johannes spürt selber, dass bei aller Freundschaft die Verhältnisse deutlich bleiben müssen. Nicht die Schüler haben sich den Messias erwählt, sondern der Messias die Schüler unter Angabe des Zweckes dieser Erwählung: „Frucht tragen = untereinander solidarisch sein“. Wir werden auf die Erwählung bei der Besprechung von 15,19 zurückkommen müssen. Die Freundschaft des Messias wirkt sich dahingehend aus, dass er beim VATER die Erhörung ihres Gebetes erwirken wird. Die Freundschaft ist ein Geschenk des Messias, es gibt keinen Rechtstitel für sie.
Zum in Vers 17 nochmals wiederholten Gebot der untereinander geübten agapē macht Veerkamp an dieser Stelle noch einmal klar, wie er darauf gekommen ist, dieses Wort mit „Solidarität“ zu übersetzen:
Wir machen noch einmal auf den sehr eng definierten Bereich aufmerksam, in dem die Solidarität wirksam wird. Wir können uns das kaum vorstellen. Für uns sind die Schüler schlicht die Platzhalter für alle Christen. Da die Christenheit zeitweise als deckungsgleich mit der ganzen Menschheit vorgestellt wurde, wird aus der Solidarität unter den wenigen Freunden eine Generaltugend. Das macht aber ein korrektes Verständnis unseres Textes unmöglich. Wir haben die Solidarität einen Kampfbegriff genannt und sie analog der Solidarität in der Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts gedeutet. <1090>
Zu beachten ist aber, dass auch nach Ton Veerkamp die johanneische Gruppierung nicht auf Dauer in ihrem sektenhaften Kreisen um sich selbst verharrt:
Im sektiererischen Milieu des Johannesevangeliums und der Johannesbriefe war die agapē in erster Linie eine Ingroup-Tugend. Erst als die Sekte ihre Isolation durchbrach und Johannes zu einem kirchlichen Text wurde, konnte die johanneische Solidarität politisch fruchtbar werden. Freilich wurde im kirchlichen Gebrauch die Solidarität als messianische Tugend par excellence zur allgemeinen Menschenliebe und verlor so ihre politische Kraft. Sie war einmal Zusammenhalt im Kampf gegen die Weltordnung des Todes. Sie wurde zur allgemeinen Philanthropiesauce, die über die Weltordnung des Todes ausgegossen wurde. Solche Moralisierung ist Johannes fremd.
Wünschenswert wäre es von diesen Überlegungen her, die universale Zielrichtung der agapē im Sinne des ethischen Verhältnisses zum Anderen, wie es Lévinas versteht, mit einer zumindest auch politisch zu verstehenden Solidarität „im Kampf gegen die Weltordnung des Todes“ zu verbinden.
↑ Johannes 15,18-21: Der Hass des kosmos und „ihre“ Verfolgung der aus dem kosmos Erwählten
15,18 Wenn euch die Welt hasst,
so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.
15,19 Wäret ihr von der Welt,
so hätte die Welt das Ihre lieb.
Weil ihr aber nicht von der Welt seid,
sondern ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt.
15,20 Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe:
Der Knecht ist nicht größer als sein Herr.
Haben sie mich verfolgt,
so werden sie auch euch verfolgen;
haben sie mein Wort gehalten,
so werden sie eures auch halten.
15,21 Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen;
denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.
[25. November 2022] Nach Klaus Wengst (W441) „stellt der nun folgende Abschnitt“ die Folgen der „sich aus der Bindung an Jesus“ ergebenden „Solidarität untereinander“ heraus, und zwar bringt „dieses ‚weltfremde‘ Verhalten in Distanz zur Welt“, ja, es provoziert geradezu „deren Hass … Das wiederum lässt auf der anderen Seite die innergemeindliche Solidarität umso notwendiger erscheinen.“ Wieder ist die Frage zu stellen, in welcher Weise hier von Welt und Weltfremdheit die Rede sein soll.
Nach Wengst ist im gesamten Abschnitt von 15,18 bis 16,4a primär von der jüdischen Welt die Rede, was er folgendermaßen begründet:
Der Nebensatz am Beginn {von Vers 18}: „Wenn euch die Welt hasst“ gibt keine Möglichkeit an, die eventuell eintreten könnte, sondern stellt eine Realität fest, die von der nachösterlichen Schülerschaft, der Gemeinde, erfahren wird. Wie sich der hier genannte Hass konkretisiert, steht in 16,2. Danach werden die als Hass erlebten und gedeuteten Erfahrungen in einem jüdischen Kontext gemacht. „Die Welt“, von der im Gegenüber zur Schülerschaft Jesu geredet wird, ist also – zumindest primär – eine jüdische Welt. Das zeigt sich nicht erst in 16,2, sondern schon in 15,25. Dort spricht Jesus von „ihrer Tora“, nachdem er ab V. 20 die Rede von „der Welt“ mit der dritten Person Plural („sie“) fortgeführt hat.
Die erste Leser- und Hörerschaft des Evangeliums sieht, dass die sie umgebende Welt sich von ihr distanziert; sie erfährt und deutet das als Hass. Das ist die Voraussetzung, die Johannes hier gegeben sieht. Mit dieser Gegebenheit will er umgehen.
Indem Wengst aber (W442) weiter auf die Fortsetzung von Jesu Satz eingeht: „So wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat“, bezieht er diese Aussage über die „Welt“ nun doch nicht mehr nur auf die „jüdische Welt“ allgemein, sondern auf ihre führenden Kräfte und darüber hinaus auf die „römische Welt“:
Vom Hass der Welt auf Jesus war schon in 7,7 die Rede. Dort sagte Jesus, dass die Welt ihn hasse, „weil ich ihr bezeuge, dass ihre Taten böse sind“. Dabei war deutlich, dass unter „Welt“ besonders die in ihr Mächtigen und Einflussreichen verstanden sind. Deren Handeln gegen Jesus, das ihm, einem Unschuldigen, den Tod bringt, stellt Johannes dar. Es ist von Opportunismus (11,48-50) und dem Interesse der Machterhaltung (19,12f.) bestimmt. So dürfte hier die römische Welt mit in den Blick kommen. Wenn Jesus seinen Schülern sagt, dass die Welt ihn „vor euch“ gehasst hat, ist das nicht nur in zeitlicher Hinsicht verstanden.
Es bleibt also in der Schwebe, von wem genau der „Hass der Welt gegen Jesu Schülerschaft“ ausging, aber Wengst geht davon aus, dass Johannes ihn „aus der Perspektive einer bedrängten Minderheit“ beschreibt.
Spannend sind seine Bemerkungen über die Wirkungsgeschichte dieses Textes. Im Blick auf „unsere Situation“ im 21. Jahrhundert gibt Wengst Emanuel Hirsch <1091> in seiner Einschätzung Recht, dass wir „im allgemeinen keine Gelegenheit (haben), das zu durchleben, was in dieser Lektion mit dem Haß der Welt gegen den Jünger Jesu wirklich gemeint ist“. Wenn allerdings Hirsch dazu im Jahr 1936 meinte: „Wer anders redet, mißbraucht große und schwere Worte für kleine Peinlichkeiten“, denn wir „stehen als Christen in einer großen öffentlichen kirchlichen Ordnung, und die christlichen Lehrer und Prediger werden nicht geächtet, sondern aus öffentlichen Mitteln bezahlt“, muss nach Wengst bedacht werden, dass „gerade in der Zeit, in der das Buch von Hirsch erschien…, schon welche geächtet [waren] und … nicht mehr bezahlt [wurden], weil sie jüdisch waren oder Juden widerfahrenes Unrecht kritisiert hatten.“
Für „ein Unding“ hält Wengst es auch, wenn man „die Geschichte der Kirche“ betrachtet, aus Johannes 15,18 mit Barrett <1092> den Schluss zu ziehen: „Es ist so wahrhaftig die Natur der Welt, zu hassen, wie es die Natur der Christen ist, zu lieben“. Vielmehr wäre in seinen Augen zu fragen,
ob heutige Aufnahme dem Text nicht in der Weise gerecht werden könnte und müsste, dass der Gemeinde als Schülerschaft Jesu Distanz zur Welt der Starken und Mächtigen und also auch ein gutes Stück „Weltfremdheit“ zukommt.
Diese „Weltfremdheit“ wird in Vers 19 von Jesus näher beschrieben und damit begründet,
warum seine Schülerschaft von der Welt Hass erfährt. Zunächst setzt er einen nicht zutreffenden Fall und zieht daraus hypothetisch eine Folgerung: „Wenn ihr von der Welt wärt, liebte die Welt das ihr Eigene.“ Die Angesprochenen sind offenbar weltfremd. Nicht von der Welt zu sein, beschreibt also nicht ein anderes „Wesen“, sondern ein anderes Verhalten, meint, sich nicht nach der Art der Welt – der starken Welt – zu verhalten. Nach dem Blick auf diesen nicht zutreffenden Fall fährt Jesus fort: „Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich mir euch aus der Welt erwählt habe, hasst euch deshalb die Welt.“ Jesu Schüler sind nicht mehr „von der Welt“, weil Jesus sie der Konformität mit der Welt entnommen hat. Jesu Schule erzieht zum Nonkonformismus. Sie verhindert es, „Mitläufer“ zu sein, lässt vieles nicht mitmachen, was sich gleichsam als selbstverständlich eingeschlichen hat.
Nach Vers 20 dürfen sich seine Schüler „nicht darüber wundern“, dass sie „mit ihm konform gemacht … werden, wenn sie nicht mit der Welt konform gehen“:
Dazu nimmt er eine schon in 13,16 gemachte Aussage auf: „Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe: Kein Knecht ist größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“ Bleibt die Schülerschaft Jesu in seiner Schule, wird sie von den negativen Erfahrungen nicht verschont bleiben, die auch er hat machen müssen. … Neben den negativen Erfahrungen scheint aber auch noch kurz eine positive Möglichkeit auf: „Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch eures halten.“ Die Welt ist nicht auf Ablehnung festgelegt; ist doch auch Jesu Schülerschaft von ihm „aus der Welt“ erwählt worden.
Mittlerweile hat sich wieder gezeigt, dass nach Wengst die „Welt“ in diesem Abschnitt keineswegs so eindeutig allein als „jüdische Welt“ zu verstehen ist, wie er anfangs gemeint hat. Er spricht von der Welt der Mächtigen, der Starken, bringt diese in Verbindung mit der römischen Welt und scheint am Ende von der Menschenwelt im Allgemeinen zu reden, aus der heraus die Schüler Jesu erwählt worden sind.
Mit dem folgenden Vers 21 fasst Jesus
das bisher in diesem Abschnitt Gesagte zusammen und leitet damit zugleich zur nächsten kleinen Einheit über: „Aber das alles werden sie euch gegenüber tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich geschickt hat.“ Obwohl er noch gar keine Maßnahmen im Einzelnen angeführt hat, redet er mit „das alles“ zusammenfassend. … Was die Schülerschaft Jesu an negativen Erfahrungen machen muss, trifft sie „um meines Namens willen“, d. h. um Jesu willen; denn der Name steht für die Person. Handeln die Menschen in der Gemeinde bewusst als Schülerinnen und Schüler Jesu und bleiben sie dabei, haben sie keine Wahl, es sich auch anders aussuchen zu können: Was Jesus treffen soll, der in ihrem Wirken weiterwirkt, wird sie treffen.
Indem Wengst die Erwähnung des Namens Jesu lediglich als Verdeutlichung des Bezugs auf seine Person begreift, lässt er außer Acht, dass hier auch eine bewusste Erinnerung an den NAMEN des Gottes Israels beabsichtigt sein kann, den Jesus im Johannesevangelium verkörpert und von dem er sich gesandt weiß, was er im selben Atemzug erwähnt:
Das begründet Jesus schließlich damit, dass „sie den nicht kennen, der mich geschickt hat“. Damit wird das gegen die Gemeinde des Johannesevangeliums gerichtete Handeln, das sie vonseiten der jüdischen Mehrheit erfährt, darauf zurückgeführt, dass diese es nicht anzuerkennen vermag, im Reden, Handeln und Erleiden Jesu spreche und handle Gott. Insoweit macht der Evangelist eine sachlich zutreffende Aussage. Sie erhält aber in seiner Situation die deutliche Tendenz, der Gegenseite daraufhin Kenntnis Gottes überhaupt abzusprechen und ihr Hass gegen Gott zu unterstellen. Dementsprechend wird darin die entscheidende Sünde gesehen, Jesu Reden und Handeln nicht als Reden und Handeln Gottes anzuerkennen.
Gerade wenn man ernst nimmt, dass nach Johannes Jesus in seinem messianischen Wirken, das im Kreuz am Kreuz und seiner Übergabe des Geistes an seiner Schülerschaft gipfelt, den befreienden NAMEN Gottes verkörpert, ist durchaus nachzuvollziehen, dass er denen, die Jesus als den Messias ablehnen, unterstellt, dem NAMEN selbst untreu geworden zu sein. Weil sie den Gesandten des NAMENS nicht anerkennen, können sie auch den, der Jesus gesandt hat, Gott selbst, nicht (mehr) kennen. Ob man Johannes darin zustimmen kann, darf und soll, und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, darüber wird noch nachzudenken sein.
Nach Hartwig Thyen (T651) war schon längst zu „ahnen“, dass „das Jüngersein einen … zum Schicksalsgenossen Jesu macht und daß folglich der Haß der Welt, der Jesus getroffen hat, auch die treffen wird, die ihm ,nachfolgen‘“, aber erst in Vers 18ff.
wird den Jüngern hier nun zum ersten Mal eingehend expliziert, daß die Welt sie hassen wird, weil sie Jesus haßt. Nach 16,4 hatte Jesus ihnen von dieser dunklen Kehrseite ihres Jüngerseins zuvor nämlich darum noch nichts gesagt, weil er selbst ja bei ihnen war und sie als ihr guter Hirte behütete, so daß keines seiner Schafe Schaden nehmen (10,28f) und keiner derer, die der Vater ihm gegeben hatte, verloren gehen sollte (6,39; vgl. 18,8).
Von einer „missionarischen Aussendung der Jünger und von deren Negativerfahrungen bei dieser Mission zu Lebzeiten Jesu“ ist allerdings im Johannesevangelium anders als bei den Synoptikern (vgl. Matthäus 10 und Parallelen) keine Rede:
Mit den Worten: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“, sendet in unserem Evangelium vielmehr erst der Auferstandene seine Jünger in die Welt, nachdem er sie zuvor mit dem Geist begabt und mit der Vollmacht ausgestattet hat, Sünden zu vergeben oder die Sünder bei ihnen zu behaften (20,19ff). Dennoch entspricht er darin, daß er dies den Jüngern vor seinem Leiden und Sterben erklärt, damit sie von dem Kommenden nicht überrascht und zu Fall gebracht werden, dem Aufriß des Markusevangeliums, wo Jesus die Jünger in seiner ‚apokalyptischen Rede‘ (Mk 13,9-13 parr.) auf die ihnen als seinen Nachfolgern bevorstehenden Verfolgungen vorbereitet.
Johannes übernimmt „diese Verfolgungstradition aus seinen Prätexten“ und gibt ihnen nach Dodd <1093> zugleich „eine typisch johanneische Wendung“, indem „er Jesus erklären läßt: ‚Die Welt haßt euch, weil ihr nicht ihresgleichen seid‘ (hoti de ek tou kosmou ouk este {weil ihr nicht aus dieser Welt seid}: V. 19).“
Über die Frage, was an dieser Stelle mit dem Stichwort „Welt“ gemeint sein mag, macht sich Thyen nicht so viele Gedanken wie Wengst; er scheint von vornherein den kosmos sehr allgemein als Gott und Jesus gegenüber feindlich eingestellte Menschenwelt vorauszusetzen, aus der heraus auch die Jünger erwählt worden sind (T652):
Weil Jesus jetzt von einer Zeit nach der erzählten Zeit redet, wird man das ginōskete {wisset} in V 18 als Imperativ begreifen müssen: Wenn es ernst wird, sollen die Jünger bedenken, daß die Welt ihren Herrn schon vor ihnen mit ihrem Haß verfolgt hat. V. 19 fährt dann fort: Wenn ihr ek tou kosmou {aus der Welt} wäret, dann würde die Welt euch als ihresgleichen lieben. Weil ihr aber nicht (mehr) aus der Welt seid – denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt (exelexamēn hymas ek tou kosmou) -, haßt euch die Welt. Früher hatte Jesus den Ioudaioi {Juden} gesagt: „Ihr seid von unten (ek tōn katō este), ich dagegen bin von oben (egō ek tōn anō eimi). Ihr seid aus dieser Welt, ich aber bin nicht aus dieser Welt (egō ouk eimi ek tou kosmou toutou)“ (8,23). Und am Ende dieser Rede heißt es dann: „Und als er das sagte, glaubten viele an ihn“ (8,30; s. o. z. St.). Und das muß ja heißen, daß sie als Glaubende die Vollmacht empfingen, Gottes Kinder zu werden (1,12f), daß sie nun nicht mehr ek tou kosmou toutou {aus dieser Welt} sind, sondern solche, ,aus Gott‘ (1,13), die ,von oben‘ und ,aus dem Geist geboren sind‘ (3,3ff). Hier werden wir zu Zeugen dessen, was auch den Jüngern widerfahren sein muß. Denn auch sie sind, was sie jetzt sind, ja nur kraft seines Erwählens. Sie sind nicht, wie ihr Herr, von Haus aus ek tōn anō {von oben}, sondern wie jene Ioudaioi waren sie, ehe sie glaubten, ,von unten‘ und ,aus dieser Welt‘. Und wie die Reben ihr Wachstum, ihre Kraft und ihre Fruchtbarkeit allein vom Weinstock empfangen, so verbindet sie jetzt allein sein Erwählen mit ihrem Herrn.
In den Worten Jesu in Vers 20: „Erinnert euch des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr …“ (13,13ff.) sieht Thyen zunächst „unmißverständlich ausgesprochen, daß sie durch sein Erwählen nicht etwa gleichen Wesens mit ihrem Herrn geworden sind.“ Diese Ausdrucksweise macht nachdenklich, da er doch die Einheit Jesu mit Gott gerade nicht als Wesensaussage im Sinne der griechischen Ontologie begreifen wollte, aber ebenso wenig als reine Aussage über eine Funktion des Menschen Jesu. Auf jeden Fall bleibt das Gefälle zwischen Jesus und seiner Schülerschaft, wie auch immer es konkret aufzufassen ist, erhalten.
Aus „dieser Erinnerung an 13,13ff“ ergibt sich an dieser Stelle etwas Neues, nämlich
daß jetzt die Schicksalsgemeinschaft der Jünger mit ihrem Herrn den definierenden Kontext bildet. Im Hintergrund dürfte Mt 10,24-26 stehen: „Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es genügt, daß der Schüler werde wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie schon den Hausherrn Beelzebul gescholten haben, um wieviel mehr werden sie dann seine Hausdiener schelten. Fürchtet euch darum nicht vor ihnen!“ (vgl. … die entsprechenden Verfolgungstexte: Mt 5,10-12; 10,16ff; 23,34; Mk 13,9ff; Lk 9,23f; 14,27) Mit Jesus und seinem Schicksal verbindet die Jünger allein seine Liebe, und die stiftet – wie wir von Lévinas gelernt zu haben glauben – diesseits aller Rede vom Wesen ein genuin ethisches Verhältnis, das sie zu Schicksalsgenossen ihres Herrn und füreinander verantwortlich macht: „Wie sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Und wie sie mein Wort bewahrt haben, so werden sie auch das Eure bewahren“.
Da, wie gesagt, die Jünger zu Lebzeiten Jesu noch nicht zur Verkündigung ausgesandt worden sind, kann hier nur „wiederum der bereits zum Vater Erhöhte“ sprechen (T652f.),
der sie mit den Worten: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch …“ erst am Ostertag senden wird. Indem Jesus sie aus der Welt heraus als die Seinen erwählt hat, hat er sie der Welt entfremdet, so daß die sie nicht mehr als ihr ,Eigenes‘ (V. 19) betrachten kann. Darum wird die Liebe der Welt, die nur nach ihrer eigenen Ehre trachtet und allein das Eigene liebt, umschlagen in Verfolgung und Haß des Fremden.
In Vers 21, der ausdrücklich erklärt, „daß dieser Haß den Jüngern um des Namens Jesu willen (dia to onoma mou) widerfahren wird, weil sie sich nämlich zu ihm bekennen und seine Gebote halten und damit anzeigen, daß sie auf seine Seite übergelaufen sind“, sieht Thyen ein intertextuelles Spiel mit Matthäus 10,22:
„kai esesthe misoumenoi hypo pantōn dia to onoma mou“ {Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen}. So können die Jünger gerade daran, daß sie vom Haß der Welt verfolgt werden, erkennen, daß sie, wenn auch nach wie vor ,in der Welt‘, dennoch, wie ihr Herr, nicht mehr ek tou kosmou {aus der Welt} sind. Umgekehrt soll ihnen daran zugleich deutlich werden, daß ihre Verfolger, weil sie den nicht anerkennen, den der Vater gesandt, durch dessen Mund er gesprochen und dessen Werke er gewirkt hat (5,36f; 14,10f u. ö.), mit dem Gesandten auch den Sender hassen, den einzigen Gott, auf den sie sich berufen und von dem sie behaupten, daß er ihr Vater sei (8,41ff…).
Ton Veerkamp <1094> unterscheidet in dem Stück Johannes 15,18 bis 16,4 zwischen verschiedenen Teilen, in denen zunächst vom kosmos als der „Weltordnung“ und dann von der „Synagoge“ die Rede ist und in die mit der Erwähnung des Parakleten ein Vorgriff auf den folgenden Abschnitt eingeschoben ist:
In diesem Stück ist von der Weltordnung (18-19) und von der Synagoge 20-25; 16,1-4) die Rede. Die beiden Verse 15,26-27 greifen dem nächsten Abschnitt vor.
Zum Stichwort misein, „hassen“, mit dem Veerkamp „das Verhalten der Weltordnung gegenüber der messianischen Gemeinde“ beschreibt, weist er (Anm. 459) zunächst darauf hin, dass es – ähnlich wie das Wort agapan mit entgegengesetzter Bedeutung – nicht im Sinne einer Emotion oder eines Gefühls verstanden werden darf:
Das hebräische Wort ßanaˀ, „hassen“, deckt ein weites Feld von Emotionen ab; Lea „hasst“ Rachel, weil Lea dem Jakob „verhasst“ und Rachel seine Geliebte ist (Genesis 29,31; vgl. die Rechtsfolgen für diesen Fall: Deuteronomium 21,15ff.). Die Brüder „hassen“ den Joseph; er ist mehr als seine Brüder das geliebte Kind Jakobs, Genesis 37,4ff. Die Grundemotion ist hier Neid und Eifersucht. Amnon vergewaltigte Tamar, seine Halbschwester; nach dieser brutalen und unmenschlichen Tat „hasste er sie mit sehr großem Hass, größer war der Hass, mit dem er sie hasste, als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte“, 1 Samuel 13,15. Solche Emotionen scheiden bei der Deutung von Johannes 15,13ff. aus.
Da nach Veerkamp das Wort kosmos in diesem Zusammenhang eindeutig auf die römische Weltordnung zu beziehen ist, kann es sich bei ihrem Hass nur „um einen politischen Vorgang“ handeln. Daher empfiehlt sich in seinen Augen die Übersetzung „mit Hass bekämpfen“, denn „Hassen allein würde die Emotion beschreiben“:
15,18 Wenn die Weltordnung euch mit Hass bekämpft,
erkennt, dass sie mich als den ersten unter euch bekämpft hat.
15,19 Wenn ihr von der Weltordnung wärt,
würde die Weltordnung dem, was zu ihr gehört,
freundschaftlich gesonnen sein.
Da ihr aber nicht von der Weltordnung seid,
sondern ich euch aus der Weltordnung herausgewählt habe,
deswegen bekämpft euch die Weltordnung mit Hass.
Damit ist nach Veerkamp nicht gesagt, dass Jesus oder seine Schülerschaft nicht unter emotionalem Hass zu leiden hätten. Er differenziert folgendermaßen zwischen dem Hass der Weltordnung und dem Hass derer, die im Auftrag der Weltordnung tätig werden:
Die Weltordnung, Rom, kann den Messianismus bekämpfen und tut dies konsequent, aber leidenschaftslos, weil sie ihren Feinden haushoch überlegen ist. Um ihre Untertanen für die leidenschaftslose Bekämpfung der politischen Feinde mobilisieren zu können, muss man in ihnen die Leidenschaft des Hasses erzeugen. Der Hass der Auftragsgeber selber ist emotionslos, völlig rational und kalkuliert; der Hass der Ausführenden ist blind, muss geradezu blind sein, damit die Gewaltschwelle, die in jedem Lebewesen vorhanden ist, überschritten werden kann.
Wie kommt Veerkamp aber darauf, den Hass, von dem hier die Rede ist, so eindeutig auf die römische Weltordnung und ihre Handlanger zu beziehen? Er begreift die hier vorliegenden Verse von den biblischen Psalmen her:
In den Psalmen kommt die Wortgruppe „hassen, Hasser, Hass“ sehr oft vor. Hier geht es um mehr als Neid, Überdruss, Eifersucht zwischen einzelnen Menschen, es geht im Grunde immer um die Feinde Israels, denen das Ich der Psalmen, das toratreue Israel, fast hoffnungslos unterlegen ist. Man kann sich davon eine Vorstellung machen, wenn man z.B. folgende Worte auf sich wirken lässt, Psalm 139,21f.:
Etwa Deine Feinde, EWIGER,
sollte ich sie nicht hassen?
Die gegen Dich rebellieren,
sollten die mich nicht anekeln?
Mit ganzem Hass hasse ich sie,
zu Feinden sind sie mir geworden.Der Grund des „Hasses“ ist die politische Feindschaft. Warum behandelt Rom die Schüler als politische Feinde? Weil es den Messias „als ersten“ gehasst hat, weil es den, der für die radikale Alternative zu Rom steht, „prinzipiell“ (so kann man das Wort prōton hier umschreiben) bekämpfen muss, mit äußerster Grausamkeit, eben „mit Hass“.
Von den Schülern Jesu wird nun gesagt, dass sie – anders als etwa die mit Rom kollaborierende Priesterschaft zur Zeit Jesu oder das sich zur Zeit des Johannes in einer Nische des Imperiums einrichtende rabbinische Judentum (oder auch der Geschichtsschreiber Josephus) – nicht als Freunde der Weltordnung anerkannt sind:
Freundschaftliche Beziehungen (ephilei) unterhält die Weltordnung mit denen, die nach ihren Ordnungen und Prinzipien denken und handeln, „von der Weltordnung her“ (ek tou kosmou) heißt das hier. Wieso kommen die Schüler nicht „von der Weltordnung“ her? Offenbar ist das gar nicht selbstverständlich. Selbstverständlich wäre vielmehr, dass die Schüler sich verhalten wie die meisten anderen Leute, die sich der Weltordnung angepasst haben. Anpassung ist das Normale, sie ist oft schiere Überlebensstrategie.
Aber wie kam es zum unangepassten Verhalten der Schüler Jesu? Es hat seinen Grund darin, dass sie vom Messias aus dieser Weltordnung herausgeholt wurden. Diesen Vorgang der Erwählung deutet Veerkamp von den biblischen Schriften her als einen Akt der Liebe im Namen des Gottes Israels:
Unangepasstes Verhalten, erst recht unangepasstes politisches Verhalten ist etwas Verwunderliches und Lebensgefährliches. Sie sind nicht angepasst, nicht weil sie sich es selber ausgesucht haben, sondern weil sie „aus der Weltordnung heraus erwählt wurden“, die gleichen Worte ek tou kosmou, aber mit völlig anderer Stoßrichtung. Erwählt werden heißt: sie wurden unverhofft konfrontiert mit einer Alternative, die sie nicht von sich aus hätten bedenken können.
In der Schrift ist der Erwählte Israel, bechiri, „mein Erwählter“, Jesaja 43,20; 45,4; 65,15 usw. Gehäuft kommt das Verb „erwählen“, bachar, im Deuteronomium und im Buch Jesaja (vor allem Jesaja 40-66) vor. Beide Bücher zielen auf einen unverhofften Neuanfang, Jesaja 43,22; 44,1:
Und nicht hast du nach mir gerufen, Jakob,
hättest du dich bemüht um mich, Israel?
…
Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht,
Israel: ich erwähle es!Oder Deuteronomium 7,7-8:
Nicht weil ihr mehr seid als alle Völker
hat sich der NAME an euch gehangen,
hat er euch erwählt;
denn ihr seid das geringste aller Völker.
Nein, weil er euch liebte …Die Erwählung ist ein souveräner Akt, wie die Liebe, es gibt keine Rechtsansprüche und keine rationalen Gründe. Liebe begründet man nicht. Deswegen ist hier mit „lieben“ zu übersetzen. Erst als er „einen Bund geschlossen hatte mit seinem Erwählten“ (Psalm 89,4), gibt es Rechtstitel.
Die Erwählung der Schüler erzählt Johannes in 1,37-51. Vor allem Nathanael macht das klar. Er hat nicht nach dem Messias gerufen, sich nicht um einen Messias bemüht, vielmehr könne, so sagt er, aus Nazareth nichts Gutes kommen. Er sieht und er hört, was er gar nicht erwartete.
Verglichen werden kann diese Erwählung der Schüler Jesu nach Veerkamp mit Erfahrungen der modernen Arbeiterbewegung und ihres Umfelds:
Eine vollständig neue politische Perspektive kann einen Menschen vollständig aus dem Gang der Dinge herausreißen, er kann von heute auf morgen ein völlig anderes Leben beginnen, „aus der Weltordnung herausgewählt werden“ – die Formulierung des Johannes ist also sehr genau.
Dazu merkt Veerkamp an (Anm. 460):
So wie der Messianismus auf diese Galiläer gewirkt hat, so hat auch die Arbeiterbewegung auf nicht wenige bürgerliche Künstler um 1900 gewirkt. Die Arbeiterbewegung hat eine messianische Wirkung auf sie, wie Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik, Berlin/Neuwied 1970, 5ff., schreibt. Viele Gedichte des linksradikalen Gegners Lenins, Herman Gorter, schäumen nur so vor messianischer Begeisterung; die russische Lyrik der Revolutionszeit 1917-1930 hatte ebenfalls messianische Züge. Die Arbeiterbewegung hatte sozusagen diese Dichter „erwählt“, diese aber nicht die Arbeiterbewegung.
In Vers 20 wird nach Veerkamp deutlich, dass Johannes die Nachfolge Jesu nicht nur ethisch-moralisch begreift, sondern auch in einem politischen Sinn:
Könnte der Gedanke „Wie der Herr, so der Sklave“ in 13,16 vielleicht eine bloß moralische imitatio Christi verlangen, so ist in 15,20 zweifellos ein gemeinsames politisches Schicksal gemeint: gemeinsamer Kampf, gemeinsames Schicksal: verfolgt, gehasst werden.
Ab Vers 20 ist (bis zum Vers 8 des folgenden Kapitels) nicht mehr vom kosmos die Rede. Das führt Ton Veerkamp zu folgender Schlussfolgerung:
Aber jetzt ändert sich das Subjekt, von „Weltordnung“ zu „sie“. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass mit diesem Plural das rabbinische Judentum gemeint ist. Sie „verfolgen, bekämpfen mit Hass, sie schließen aus der Synagoge aus, erkennen nicht“. Das Objekt sind die Schüler, der Grund; „wegen meines Namens“. Das Objekt des Hasses sind, so deutet Johannes, nicht so sehr die Schüler, sondern vielmehr der Messias und der Gott Israels, der VATER.
Warum erscheint nach der Erwähnung des Hasses der Weltordnung nun so unvermittelt das rabbinische Judentum quasi als ausführendes Organ dieses Hasses? Das wird in der Auseinandersetzung mit den weiteren Versen dieses Abschnitts zu klären sein. Vorab kann nur gesagt werden, dass in den Augen des messianischen Juden Johannes diese rabbinischen Juden offenbar so sehr auf die Seite der Weltordnung gewechselt sind, dass sie, wie Jesus sagt, „kein Wissen“ mehr haben „von dem, der mich geschickt hat“, denn in dem Messias, der den befreienden NAMEN verkörpert, nehmen sie eben dieses befreiende Wirken des VATERS nicht wahr.
↑ Johannes 15,22-25: „Ihr“ unentschuldbarer und grundloser Hass gegen Jesus und seinen VATER
15,22 Wenn ich nicht gekommen wäre
und hätte es ihnen nicht gesagt,
so hätten sie keine Sünde;
nun aber können sie nichts vorbringen,
um ihre Sünde zu entschuldigen.
15,23 Wer mich hasst,
der hasst auch meinen Vater.
15,24 Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen,
die kein anderer getan hat,
so hätten sie keine Sünde.
Nun aber haben sie es gesehen,
und doch hassen sie mich und meinen Vater.
15,25 Aber es muss das Wort erfüllt werden,
das in ihrem Gesetz geschrieben steht:
„Sie hassen mich ohne Grund“ (Psalm 69,5).
[26. November 2022] In den Versen 22-24 führt Jesus Klaus Wengst zufolge (W443) „zweimal in derselben Struktur parallel aus“, was er in Vers 21 gesagt hatte, nämlich dass seine jüdischen Gegner „den nicht kennen, der mich geschickt hat“:
Am Beginn steht jeweils ein verneinter Bedingungssatz, der einmal auf das Reden Jesu blickt: „Wäre ich nicht gekommen und hätte nicht zu ihnen geredet“ und zum anderen auf sein Handeln: „Hätte ich unter ihnen nicht die Taten vollbracht, die kein anderer vollbracht hat“. Daran schließt er beide Male eine Folgerung mit identischen Worten im Irrealis an: „hätten sie keine Sünde“. Darauf folgt jeweils eine mit „jetzt aber“ eingeleitete Feststellung. In dem „Jetzt aber“ ist mitgesagt, dass die zu Beginn hypothetisch erwähnte Bedingung tatsächlich gegeben ist und Jesus in Wort und Tat gewirkt hat und also auch die Folgerung lauten muss: Sie haben Sünde. So wird festgestellt, dass „sie hinsichtlich ihrer Sünde keine Entschuldigung haben“. Schließlich nimmt Jesus mit dem Thema des Hasses den Beginn des Abschnitts wieder auf. Die Gedankenführung erhält ihre Spitze darin – was schon am Schluss von V. 21 angelegt war -, dass der Hass gegen Jesus als Hass gegen Gott selbst beschrieben wird: „Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater“; „[…] und doch gehasst: mich sowohl als auch meinen Vater“.
Wie schon mehrfach zuvor wendet sich Wengst auch hier mit deutlichen Worten gegen die in seinen Augen ungerechtfertigte Beurteilung des Judentums durch den Evangelisten Johannes (W443f.):
Wer der hier vorgetragenen Logik des Johannes folgt, kann das Judentum theologisch nur negativ unter der Kategorie der Sünde wahrnehmen. Aber schon die Interpretation der jüdischen Ignorierung und Nicht-Anerkenntnis Jesu als Hass mag zwar von den Erfahrungen des Johannes und seiner Gemeinde her verständlich erscheinen, trifft aber nicht das Selbstverständnis der jüdischen Lehrer, die sich von den an Jesus als Messias Glaubenden als Häretikern abgrenzten. Diese Kategorie des Hasses taugt schon gar nicht für die Beschreibung der weiteren Geschichte des jüdischen Verhältnisses zu Jesus. Wo er vorkommt, ist er darin begründet, wie Jesus im Verhalten der Kirche Juden begegnet ist. Für die neuere Zeit kann von jüdischem Hass gegen Jesus keine Rede sein. Angesichts des jüdischen Zeugnisses in Wort und Tat über die Liebe zu Gott erweist sich der Schluss vom Hass auf Jesus zu dem auf Gott als eine Zwangslogik, der wir nicht mehr folgen können und dürfen.
Folgerichtig lehnt Wengst (W444) daher den „im Text angelegten Kettenschluss“ ab, wie ihn Barrett <1095> formuliert:
„Weil die Christen in Christus sind, haßt derjenige, der sie haßt, Christus, und wer Christus haßt, haßt den Vater, der ihn gesandt hat“ (Hervorhebung von mir). In seiner Auslegung von V. 23 betont Barrett zunächst völlig zu Recht: „Joh(annes) besteht immer darauf, daß man das Werk Jesu ohne das beständige Wirken Gottes nicht denken kann. Was Jesus tut, wird von Gott getan“. Aus dieser positiven Intention darf aber nicht die Folgerung gezogen werden: „[…] und wie der Mensch sich Jesus gegenüber verhält, so verhält er sich gegenüber Gott“.
Derartige „Kettenschlüsse“ finden sich nach Wengst (Anm. 136) „ausdrücklich auf die Juden bezogen“ schon „besonders oft und prägnant in Luthers Schrift gegen die Juden von 1542/43“, aber auch (W444) in neueren deutschen Johanneskommentaren, etwa von Schnackenburg und Wilckens, <1096> „gilt das Judentum“, so der erstere, als „das ungläubige Judentum“, und letzterer, „der zu Recht aus V. 25 schließt, ‚daß von V. 20 an von den Juden die Rede ist‘“, formuliert „[b]esonders prägnant“:
„Der Haß gegen Jesus ist Haß gegen Gott. Sünde ist Verweigerung der Anerkennung Gottes im Sinne des Ersten Gebots. Weil dieses nur in ganzheitlicher Liebe zu Gott erfüllt werden kann (Dtn 6,4f.), regiert in aller Sünde ein entsprechend tiefer, ganzheitlicher Haß (Dtn 5,9). Da in Jesus Gottes einzig-einer Sohn begegnet und sein Wort Gottes Wort ist, ist jeder Haß gegen Jesus wesenhaft Gotteshaß“.
Abschließend wird in Vers 25 der „Jesus treffende Hass“, der wiederum „den von der Schülerschaft Jesu erfahrenen Hass“ begründet, mit der bereits in 13,18 verwendeten Formulierung: „Aber das ist geschehen, dass ausgeführt werde“, als ein Widerfahrnis erklärt, das „mit der Schrift“ und daher „mit Gott verbunden“ ist und nicht etwa „ein blindes Schicksal, dem er hilflos ausgeliefert wäre“:
Wie in 10,34 bezeichnet „Tora“ die ganze Schrift; und die Wendung „ihre Tora“ bedeutet so wenig eine Distanzierung wie dort in der Anrede die Wendung „eure Tora“. In 10,35 betont Jesus – bezogen auf das zitierte Wort -, dass „die Schrift nicht aufgelöst werden kann“. Als Schriftwort zitiert Jesus: „Ohne Grund haben sie mich gehasst.“ Johannes hat damit die in Ps 35,19; 69,5 begegnende partizipiale Wendung „die ohne Grund mich Hassenden“ – auch in LXX Ps 34,19; 68,5 findet sie sich in dieser Weise – zu einem Satz umgeformt. Jesus spricht hier als der leidende Gerechte, dem unverschuldet Unrecht widerfährt, dem aber Gott Recht verschaffen wird.
Hartwig Thyen (T653) erinnert zu den Versen 22-25 unter Berufung auf Dodd <1097> daran, dass sie
auf ihre Weise wiederholen und variieren, was Jesus jenen gesagt hatte, die den Blindgeborenen verfolgt und ausgestoßen hatten. Der war nach dem Täufer, Johannes, der erste Christ, der seinen Glauben öffentlich bekannt hatte und der darum den Haß der Welt erfahren mußte. Und Jesus war vor denen, die sich das Richteramt über ihn angemaßt hatten, für ihn eingetreten und hatte ihnen erklärt: „Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden zu Sehenden werden, die Nicht-Sehenden aber zu Blinden“. Und als sie ihn daraufhin fragten: „Sind wir denn etwa auch Blinde?“ hatte er ihnen geantwortet: „Wenn ihr denn wenigstens Blinde wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Weil ihr (im Gegensatz dazu) aber behauptet: Wir sind Sehende bleibt eure Sünde!“ (9,39ff). Das muß, wie V. 22f sagt, ja wohl heißen, daß bis zum Kommen Jesu die Sünde gleichsam suspendiert ist: „Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde. Jetzt, (da ich ja zu ihnen gekommen bin und zu ihnen geredet habe) haben sie im Blick auf ihre Sünde aber keine Ausrede mehr (prophasin ouk echousin). (Denn) wer mich haßt, der haßt auch meinen Vater“. Seinem Reden zu ihnen fügt Jesus sogleich noch seine Werke hinzu, die er unter ihnen getan hat: „Hätte ich unter ihnen die Werke nicht getan, die kein anderer je gewirkt hat, so hätten sie keine Sünde. Doch die haben sie jetzt ja vor Augen (heōrakasin), und dennoch verfolgen sie nicht nur mich mit ihrem Haß, sondern (wie daran offenbar wird) auch meinen Vater. Doch das tun sie, damit sich das Wort erfülle, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Grundlos haben sie mich gehaßt!“ (V. 24f).
Damit gibt Thyen das Urteil des johanneischen Jesus wieder, ohne hier erkennen zu lassen, ob er selbst es auf das Judentum insgesamt beziehen würde, wie dies die von Wengst angeführten Exegeten Schnackenburg und Wilckens tun. In seinen Ausführungen zu Johannes 9,39-41 hatte es den Anschein gehabt, als ob er Bultmanns Auslegung teilen würde, derzufolge alle Menschen einschließlich der Juden, die sich dem Glauben an Jesus verschließen, als Sünder gerichtet sind.
Von „der Tora“ distanziert sich Jesus allerdings in den Augen Thyens nicht,
wenn er die seinen Jüngern gegenüber jetzt als ho nomos autōn {ihr Gesetz} bezeichnet. Damit behaftet er vielmehr die, die Gott sich zum Eigentumsvolk erwählt und denen er als Unterpfand seiner Treue sein Gesetz gegeben hat, bei ihrer Tora. Im übrigen ist nomos {Gesetz, Tora} hier wohl wieder Bezeichnung der gesamten jüdischen Bibel, denn das Zitat über den grundlosen Haß (emisēsan me dōrean {Grundlos haben sie mich gehasst!}) entstammt dem Psalter, nämlich Ps 69,5: ßonˀaj chinnam {Die mich ohne Grund hassen} (= Ps 68,5 LXX: eplēthynthēsan hyper tas trichas tēs kephalēs mou hoi misountes me dōrean {In der Überzahl über die Haare meines Kopfes hinaus sind diejenigen, die mich grundlos hassen}).
Thyen hält es zwar grundsätzlich auch für
möglich, daß es sich hier um ein Zitat aus Ps 35,19 (LXX 34,19) {Thyen führt versehentlich Ps 39,19 an} handelt, wo es heißt: „Nicht freuen sollen sich, die mich zu Unrecht bekriegen (hoi echthrainontes mou adikōs), die mich grundlos hassen (hoi misountes me dōrean)“; vgl. auch PsSal 7,1. Doch da Johannes den Psalm 69 bereits in 2,17 zitiert hat und ihn in 19,28f abermals anrufen wird, dürfte er auch hier sein Prätext sein. <1098>
Ton Veerkamp <1099> konzentriert sich in seiner Auslegung der Verse 22-25 zunächst auf das Schriftzitat in Vers 25. Dass das „rabbinische Judentum“ Jesu Schüler wegen des Namens Jesu, in dem sich doch der NAME des Gottes Israels verkörpert, mit Hass verfolgt und bekämpft (Vers 23), ist für den Evangelisten Johannes
eigentlich unbegreiflich. Er kann nicht verstehen, weswegen die Synagoge sich der messianischen Gemeinde gegenüber so verhält, und er reiht sich ein bei denjenigen, die in Israel grundlos gehasst wurden…
Dazu verweist Veerkamp wie Thyen auf die Psalmen 35,19 und 69,5; ausdrücklich zitiert er jedoch Psalm 109,1ff.:
Gott meiner Preisung, schweige nicht.
Denn der Mund des Verbrechers
und der Mund des Betrugs
öffnen sich gegen mich.
Reden des Hasses umzingeln mich,
führen Krieg gegen mich, grundlos (dōrean, chinnam)!
Statt Liebe sind sie ein Satan für mich,
mich – ein Gebet! <1100>
Sie setzen das Böse statt das Gute ein,
Hass statt meiner Liebe!Grundlos, chinnam, dōrean, ist in Israel immer ein sehr ernster Vorwurf. So wirft das Buch Hiob dem Gott seines Schicksals vor, er verschlinge den Gerechten grundlos.
Der Hass Roms gegen den Messias ist zwar nicht berechtigt, aber doch begründet. Das kann man verstehen. Der Hass der Synagoge ist für Johannes rational nicht nachzuvollziehen. Für diesen hasserfüllten Kampf haben sie nur „Vorwände“ (prophaseis).
Zu diesem Wort prōphasis bemerkt Veerkamp in seiner Anm. 457 zur Übersetzung von Johannes 15,22:
Das Wort ist in der LXX selten; es steht für das aramäische ˁillah (in der griechischen Bibelübersetzung Theodotions zweimal in Daniel 6,5-6). Dort bringen Männer „falsche Beschuldigungen“ gegen Daniel vor König Darius. In Markus 12,40 par. fressen die Schriftgelehrten bzw. Peruschim {Pharisäer} die Häuser der Witwen unter dem Vorwand – prophasei – langer Gebete. „Entschuldigung“ wäre zu schwach. Hier geht es um Ausreden: Sie tun, als ob der Messias nie zu ihnen geredet hätte.
In Vers 24 bekräftigt der johanneische Jesus, was er über seine Worte sagt, durch eine weitere Aussage über seine Werke:
Wenn der Messias diese Werke nicht getan hätte, ja dann …! Jetzt aber heißt es mit dem Psalm: „Hass statt meiner Liebe“.
Ton Veerkamp zieht aus dieser Argumentation Schlussfolgerungen, die sich auf die politische Konfliktlage am Ende des 1. Jahrhunderts beziehen:
Wenn irgendwo, dann wird hier deutlich, dass eine rationale Diskussion über politische Wege zwischen Ekklesia {wörtlich: Die „Die Herausgerufenen“, Selbstbezeichnung der messianischen Gemeinde bei Paulus, Lukas und Matthäus} und Synagoge nicht geführt wurde; die eine ist für die andere irrational. Bei Rom könnte man das verstehen; es hat Gründe, den Messias „mit Hass zu bekämpfen“. Aber die Judäer. Sie haben die Werke gesehen, „die niemand anders getan hat.“ Sie bekämpfen ihn und uns, sagt Johannes, „grundlos“.
Genau im Blick auf dieses Stichwort „grundlos“ äußert Veerkamp starke Vorbehalte gegenüber der Haltung der vom Evangelisten Johannes repräsentierten jüdischen Messianisten:
Wir sind hier nicht parteilich. Wir müssen nur feststellen, dass mit dem Vorwurf „grundlos“ ein Gespräch, geschweige denn eine Verständigung, unmöglich wird. Wir stellen fest, dass Johannes nicht nach Gründen bei seinen Gegnern suchen will – und die Suche nach Gründen auf beiden Seiten wäre die Grundbedingung für ein Gespräch zwischen beiden Seiten. Johannes setzt seinerseits grundlos (!) voraus, dass das rabbinische Judentum keine Gründe haben kann. Er gibt sich hier erst gar keine Mühe. Die Auslegung muss das Irrationale, das in der Vokabel chinnam, dōrean, steckt, feststellen, ohne in diesem Konflikt Partei sein zu können.
Von der oben beschriebenen Wengstschen Kritik unterscheidet sich diese Einschätzung des Johannesevangeliums grundlegend dadurch, dass es nicht einfach Ablehnungserfahrungen der johanneischen Gemeinde sind, die übertreibend als Hass interpretiert werden und einen Grundstein legen für den späteren Antijudaismus der christlichen Kirche. Nach Veerkamp werfen vielmehr die Messianisten um Johannes dem rabbinischen Judentum den Abfall vom befreienden Gott Israels vor. In den folgenden Versen wird sich zeigen, dass sie es konkret dafür verantwortlich machen, sie dem tödlichen Hass der römischen Weltordnung auszusetzen.
↑ Johannes 15,26-27: Der Geist der Wahrheit und Jesu Schüler als seine Zeugen
15,26 Wenn aber der Tröster kommen wird,
den ich euch senden werde vom Vater,
der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht,
der wird Zeugnis geben von mir.
15,27 Und auch ihr legt Zeugnis ab,
denn ihr seid von Anfang an bei mir.
[28. November 2022] Die Auslegung der letzten beiden Verse von Johannes 15 beginne ich mit Ton Veerkamps <1101> Gliederungsvorschlag für den Abschnitt 15,26 bis 16,15. In seinen Augen ist „[d]ieses Stück“ nämlich „klar und übersichtlich strukturiert“, und zwar durch drei Versanfänge, die vom Kommen des Parakleten handeln, von Veerkamp mit „Anwalt“ wiedergegeben, der bereits zuvor als der Geist der Wahrheit identifiziert worden war und den Veerkamp wiederum als die „Inspiration der Treue“ des Gottes Israels versteht:
„Wenn er kommt“ (hotan de elthē), 15,26;
„kommend“ (elthōn), 16,8;
„wenn sie kommt“ (hotan de elthē), 16,13.
Im ersten Teil dieses Abschnitts, der mit 16,7 endet, werden abschließende Äußerungen über die Verfolgung der Schüler Jesu nach seinem Weggang zum Vater durch die Ankündigung der Sendung des Parakleten umschlossen.
Folgendermaßen übersetzt Veerkamp die Verse 26 und 27:
15,26 Wenn der Anwalt kommt,
den ich euch im Auftrag des VATERS schicken werde,
die Inspiration der Treue, die vom VATER ausgeht,
wird sie über mich Zeugnis geben.
15,27 Auch ihr werdet Zeugnis geben,
weil ihr von Anfang an mit mir seid.
In Vers 26 wird grundlegend festgestellt, dass alles, was nach dem Johannesevangelium über Jesus zu bezeugen ist, von dem Gott Israels ausgeht und nicht etwa eine neue Offenbarung darstellt, die über die Treue dieses Gottes hinausgeht oder gar an ihre Stelle treten soll:
Der Anwalt (paraklētos) wird durch Jesus geschickt „seitens des Vaters“. Er ist die „Inspiration der Treue“; das Festhalten an der Treue Gottes zu Israel und an jener exemplarischen Konzentration Israels, die die Gruppe ist („die Zwölf“, 6,67), inspiriert die Schüler. Die Inspiration geht vom Gott Israels aus, sie bringt keine neue Weltreligion, sondern das, was mit dem Wort VATER = Gott Israels aus- und angesagt ist. Das muss näher erklärt werden, und das tut Johannes in 16,13-15. Jetzt geht es um das Zeugnis: Das, was vom Gott Israels kommt, zeugt von Jesus. Und zu diesem Zeugnis werden die Schüler befähigt, „inspiriert“.
Zu den Wendungen ap‘ archēs und ex archēs, die beide jeweils zweimal im Johannesevangelium vorkommen (8,44 und 15,27 bzw. 6,64 und 16,4), stellt Veerkamp grundsätzliche Überlegungen an:
Das Wort „Anfang“ spielt im Evangelium eine überragende Rolle; „Anfang“ steht buchstäblich „am Anfang“ des Textes. Johannes unterscheidet zwischen ex archēs und ap‘ archēs. Das erste bedeutet „von Anfang an“; das zweite, will mir scheinen, von jenem „Anfang“ an, der das Grundprinzip des Evangeliums (en archē, 1,1) ist. Das „Prinzip“ der Schüler ist der Messias, der das „Wort am Anfang“ ist, eben das prinzipielle Wort des Gottes Israels. Das Zeugnis der Schüler lautet: Unser Prinzip ist die kommende messianische Epoche, das inspiriert unser Leben und richtet es aus, weil wir prinzipiell mit dem Messias sind. So kann man die letzten Wörter von 15,27 umschreiben. Das erklärt auch das Präsens este, „seid“.
Mit dieser Deutung stimmt überein, dass Veerkamp die Worte ap‘ archēs auch in 8,44 im Sinne einer prinzipiellen Aussage auslegt, nämlich im Blick auf die prinzipiell menschenmörderische Haltung des diabolischen Widersachers des Gottes Israels, den er als den Kaiser der römischen Weltordnung identifiziert. Demgegenüber beziehen sich sowohl in 6,64 als auch in 16,4 die Worte ex archēs einfach auf die zurückliegende Zeit, in der die Schüler zu Jesus kamen und bei ihm waren.
Klaus Wengst verbindet die Verse 25 und 26 enger mit dem vorangegangenen „Redeabschnitt“, in dem „herausgestellt“ wurde (W444f.),
dass Jesu Schülerschaft von einer Umwelt, die ihr nicht wohlgesonnen ist, das erfährt, was auch Jesus erfahren hat. Sie erfährt es deshalb, weil sie in ihrem Zeugnis das Wirken Jesu gegenwärtig erhält. Um diesen Aspekt hervorzuheben, greift diese zweite Rede auf die an zwei Stellen der ersten Abschiedsrede gegebene Verheißung des Beistands zurück: „Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater schicken werde – die Geisteskraft der Wahrheit, die vom Vater ausgeht -, der wird über mich Zeugnis ablegen.“
In den Augen von Wengst (W445) geht das, was in Vers 25 vom Parakleten gesagt wird, nicht über die bisherigen Aussagen in der ersten Abschiedsrede hinaus:
Die Anknüpfungen sind deutlich in der Benennung dessen, der kommt, als „Beistand“ (parákletos: 14,16.26) und in seiner Identifizierung als „die Geisteskraft der Wahrheit“ (14,17; vgl. 14,26; „die heilige Geisteskraft“). Sie gehen noch weiter: Die Aussagen, dass Gott ihn auf Jesu Bitten hin geben (14,16) bzw. in dessen Namen schicken wird (14,26), unterscheiden sich sachlich nicht von der hier gemachten, dass Jesus ihn vom Vater schicken und er vom Vater ausgehen wird. Schließlich wird die Ankündigung, dass der Beistand alles lehren und an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat (14,26), so aufgenommen, dass er über Jesus Zeugnis ablegen wird.
Erst Vers 27 führt nach Wengst einen Schritt weiter, indem Jesus seinen Schülern zusagt:
„Und ihr legt auch Zeugnis ab.“ Da der Beistand, die Geisteskraft, Jesu Schülerschaft gegeben wird, vollzieht sich sein Zeugnis in ihrem Zeugnis. Ihr Zeugnis erfolgt kraft des Geistes und nicht aus ihr selbst heraus. Sie gibt kein historisches Protokoll. Die von Jesus in der vorgestellten Situation angeredeten Schüler legen Zeugnis ab, „weil ihr von Anfang an bei mir seid“. Sie sind Zeugen des Wirkens und Leidens Jesu. Aber sie nehmen diese Zeugenschaft wahr in der vom österlichen Geist (20,22) geleiteten und so den Tod und das Wirken Jesu reflektierenden Erinnerung.
Auch Hartwig Thyen (T654) sieht in „dem nun folgenden Wort von dem Parakleten (ho paraklētos)“ keinen Einschnitt, mit dem ein neuer Abschnitt beginnt. Mit ihm
nimmt Jesus die Rede von dem Geist der Wahrheit wieder auf, den er in 14,16 als einen nach ihm kommenden ,anderen Parakleten‘ eingeführt hatte. Wie schon in 14,26 (s.o. z. St.) dient hier der definierende Artikel ho als auf 14,16 zurückverweisendes Demonstrativum. Hatte Jesus zu Anfang gesagt, er werde den Vater bitten, daß der den Jüngern einem Anderen als ihren Parakleten geben möge, und hieß es 14,26, der Vater werde diesen ,im Namen Jesu senden‘, so sagt Jesus jetzt, er selbst werde den Jüngern den Parakleten, nämlich den Geist der Wahrheit (wie 14,16), der vom Vater ausgehe (ho para tou patros ekporeuetai), vom Vater her senden. Bei einem Autor, der gewiß ist, daß nichts von alledem, was existiert, je ohne den geworden ist, der ,im Anfang bei Gott war‘ (1,1), und den er sagen läßt: ,Ich und der Vater sind Eines‘ (10,30), ist diese Verschiebung des Akzents vom Vater auf den Sohn sicher nicht absichtslos erfolgt, und erst recht ist sie kein Indiz dafür, daß in den Kapiteln 15-17 ein anderer die Feder geführt hätte als unser Evangelist, wie das einige Ausleger mutmaßen. Im Gegenteil! … Als der Zeuge dessen, der die Wahrheit ist, heißt der Geist to pneuma tēs alētheias {der Geist der Wahrheit}, denn peri emou {von mir}wird er zeugen.
Zweifellos spielt Thyen zufolge
Johannes in diesem Verfolgungs-Kontext wiederum mit dem synoptischen Logion: „Wenn sie euch aber vor die Synagogen, vor die Machthaber und vor die Herrschenden führen, dann seid nicht besorgt darum, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt“ (Lk 12,11; vgl. Lk 21,12ff; Mk 13,11; Mt 10,19).
Die „Wendung kai hymeis de martyreite {Legt aber auch ihr Zeugnis ab}“ begreift Thyen von „ihrem kontextbedingten futurischen Sinn abgesehen“ als einen „Imperativ“, mit dem „die Jünger nicht einfach als weitere Zeugen neben den Parakleten gestellt“ werden; vielmehr „ist das einleitende kai mit dem emphatischen hymeis de {ihr aber} explikativ, so daß man mit Hoskyns <1102> paraphrasieren muß: Ja, ihr seid es vielmehr, die da als Zeugen auftreten müssen und werden“.
↑ Johannes 16,1-3: Die Gefahr, ohne den Schutz der Synagoge zu Fall zu kommen
16,1 Das habe ich zu euch geredet,
dass ihr nicht zu Fall kommt.
16,2 Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen.
Es kommt aber die Zeit,
dass, wer euch tötet, meinen wird,
er tue Gott einen Dienst.
16,3 Und das werden sie tun,
weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen.
[29. November 2022] Obwohl bereits in Johannes 15,26 vom Kommen des Geistes die Rede war, was als Auftakt eines bis 16,15 reichenden neuen Abschnitts betrachtet werden kann, sieht Klaus Wengst (W445) erst in den Versen 16,1-4a den vorigen Abschnitt beendet, denn er
benennt konkret die negativen Erfahrungen, die Jesu Schülerschaft zu erwarten hat, und stellt betont heraus, dass sie darauf eingestellt sein muss und dass sie sich also nicht davon irritieren lassen darf. So sagt Jesus gleich zu Beginn im Blick auf das Vorangehende: „Das habe ich euch gesagt, damit ihr nicht Anstoß nehmt.“ Die vorher pauschal angesprochenen und gleich konkret zu benennenden negativen Erfahrungen können es veranlassen, dass „Anstoß“ genommen wird, der zu „Fall“ kommen lässt. Schon in 6,61 hat Jesus seine über die Rede vom Himmelsbrot murrenden Schüler gefragt: „Das lässt euch Anstoß nehmen?“ Im Fortgang wurde dann erzählt, dass „viele von seinen Schülern weggingen, zurück, und nicht mehr mit ihm zogen“ (6,66). Die jetzige Aussage zielt also darauf, dass die das Evangelium Lesenden und Hörenden in der Gruppe bleiben und sich nicht zur Mehrheit zurückwenden.
Konkret nennt Jesus zunächst
die schon zweimal im Evangelium angeführten distanzierenden Maßnahmen (9,22; 12,42), jetzt als Ankündigung für die Zukunft: „Man wird euch von der synagogalen Gemeinschaft fernhalten.“ Diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, werden aus ihren bisherigen Lebenszusammenhängen ausgegrenzt und isoliert.
Dazu bemerkt Wengst (Anm. 138), dass diese „Ankündigung für die Zukunft in 16,2 … ganz im jüdischen Bereich“ bleibt und „nicht – wie Mt 10,18 / Mk 13,9 / Lk 21,12 – auch Verhöre vor ‚Statthaltern und Königen‘“ nennt.
Wie fremd das in 16,2 angesprochene Problem späterer Auslegung geworden ist, zeigt die Frage Augustins: <1103> „Was war es aber Schlimmes für die Apostel, von den jüdischen Synagogen ausgestoßen zu werden, als ob sie nicht im Sinne gehabt hätten, sich von ihnen zu trennen, auch wenn sie keiner ausstoßen würde?“
Als (W445f.) „eine zweite Maßnahme“ sagt Jesus über „diese Distanzierung hinaus“ die Bereitschaft zur tödlichen Verfolgung voraus: „Ja, es kommt die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu leisten.“ Wengst nimmt an (W446), dass Johannes auch dabei „tatsächliche Erfahrungen seiner Leser- und Hörerschaft im Blick hat“, aber welche könnten das sein?
Wenn das Töten von sich zu Jesus Bekennenden als vermeintlicher Dienst gegenüber Gott erscheint, ist ein jüdischer Kontext vorausgesetzt, in dem dieses Handeln, weil an Abgefallenen vollzogen, als Gott gefällig gedeutet werden konnte. Urbild solchen Handelns ist der Eiferer Pinhas (Num 25,6-13). Über ihn heißt es im Midrasch: <1104> „Und ihm und seiner Nachkommenschaft wird gehören (ein Bund ewigen Priestertums, weil er für seinen Gott geeifert) und Sühne verschafft hat (für die Kinder Israels) (Num 25,13). Hat er denn etwa ein Opfer dargebracht, da von ihm gesagt ist: Sühne? Aber das ist gesagt, um dich zu lehren, dass jeder, der das Blut von Frevlern vergießt, gilt, als hätte er ein Opfer dargebracht.“ Man kann aus Joh 16,2 im Zusammenhang mit der Pinhas-Tradition schließen, dass in einzelnen Fällen an Jesus glaubende Juden durch Verursachung oder Beteiligung anderer Juden getötet wurden. Es ist vorstellbar, dass solches Handeln nachträglich im Rückgriff auf die Gestalt des Pinhas Rechtfertigung fand.
Wengst nimmt allerdings an, dass Juden „als eigentliche Täter“ höchstens „Akte von Lynchjustiz“ verübt haben könnten oder „mittelbar … als Förderer und Helfer staatlicher Verfolgungsmaßnahmen“ aktiv wurden, wozu er (Anm. 140) auf Apostelgeschichte 17,5-9 und 18,12f. sowie die Märtyrerakten des Polykarp 12,2; 13,1; 17,2; 18,1. verweist.
Vor allem aber (W446) „kann und darf“ Wengst zufolge beim Versuch einer „Rekonstruktion“ feindseliger Handlungen seitens der jüdischen Mehrheit gegenüber Anhängern Jesu „nicht von der inzwischen abgelaufenen Geschichte, d. h. von den Untaten der Kirche, abgesehen werden“, wozu er Josef Blank <1105> zitiert:
„Wir können heute nicht mehr daran vorbei, solche Sätze, die am Anfang der Kirchengeschichte, vor neunzehnhundert Jahren geschrieben worden sind und die damals noch einen unschuldigen, unbelasteten Sinn hatten, mit dem zu vergleichen, was in den zurückliegenden Jahrhunderten aus ihnen gemacht worden ist. […] Es dauerte nicht lange, da hat sich die Kirche gegenüber Außenseitern und Abweichlern, gegenüber Häretikern und gegenüber den Juden derselben Unterdrückungsmethoden bedient, unter denen sie die ersten dreihundert Jahre hindurch zu leiden hatte“. Zu 16,2 fragt er, „wer dächte da nicht an die Opfer der Inquisition? Dort ist es ja geschehen, daß die Christen der Überzeugung waren, mit den Verbrennungen überzeugungstreuer Menschen, oder wie in Spanien zahlloser Juden, einen Gottesdienst zu zelebrieren und das Seelenheil der Betroffenen zu retten: ,Auto da fé = actus fidei‘, also: ,feierliches Gottesbekenntnis‘, das mit Hochämtern, Prozessionen und öffentlichem Gepränge begangen wurde, so lautet die offizielle Bezeichnung für diese grauenhaften Veranstaltungen. Man könnte noch zahllose andere Beispiele anführen. Sie würden nur den Beweis verstärken, daß die christlichen Kirchen sich nicht mehr unbefangen und mit gutem Gewissen auf solche Texte berufen können. Denn sie haben inzwischen so viel von der Welt und welthaftem Verhalten übernommen, vor allem vom Verhalten der Mächtigen, daß die Frage, ob jemand oder etwas ,aus der Welt‘ oder ,nicht aus der Welt‘ ist, auch von den Kirchen und ihrer Praxis her nicht mehr unbefangen zu beantworten ist“.
In Vers 3 wird die Aussage von 15,21 noch einmal wiederholt:
„Und das werden sie tun, weil sie weder den Vater erkannt haben noch mich.“ Zur Pauschalität, mit der bestritten wird, dass die Gegenseite „den Vater“ kenne, ist zu 15,21 das Nötige gesagt. Wo allerdings Menschen unter Berufung auf Gott umgebracht werden, stimmt auch die Gotteserkenntnis nicht.
Hartwig Thyen (T654) stellt Jesu Aussage in Vers 1: „Das habe ich euch gesagt, damit ihr nicht zu Fall kommt (skandalisthēte…)“ in einen Zusammenhang mit Matthäus 24,10, worauf Vers 2 „dann die kommenden Anstöße (skandala)“ konkretisiert,
die die Jünger zu Fall bringen könnten und nennt diese beiden: (1) „Sie werden euch zu aus der Synagoge Ausgeschlossenen machen (aposynagōgous poiēsousin hymas). Und danach: (2) „Ja, es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, glauben wird, Gott damit ein wohlgefälliges Opfer darzubringen“ (latreian prospherein tō theō: 16,2).
Nach Thyen ist Jesu „Ankündigung von Verfolgung und Martyrium“ nicht auf Ereignisse im Leben „einer vermeintlichen johanneischen Gemeinde“ zu beziehen, sondern sie gilt vielmehr (T654f.)
den in der Erzählung um ihn versammelten Jüngern. Und das sind nach dem Weggang „vieler seiner Jünger“ (6,66ff) und nachdem Judas vom Tisch des letzten Mahles hinausgegangen war in die Nacht, wohl die verbliebenen Elf. Und ebenso wie unser Erzähler wissen natürlich auch seine potentiellen Leser um die traurige Erfüllung dieser ,Weissagung‘ Jesu. Denn die Martyrien des Zebedaiden Jakobus (Act 12,2 um 44), und nach Mk 10,35ff wohl auch das seines Bruders Johannes (s.u. zu 21,20ff), sowie dasjenige des Petrus (Joh 13,36; 21,18f), und darüberhinaus diejenigen des Stephanus (Act 7), des Herrenbruders Jakobus mit weiteren unbekannten Judenchristen um das Jahr 62 (Josephus, Ant XX, 200), aber auch die wohl ebenfalls mit Martyrien verbundenen Verfolgungserfahrungen der jungen Gemeinde von Thessaloniki (1Thess 2,14ff), das Paulusmartyrium sowie die Opfer des neronischen Wütens nach dem Brand Roms im Juli 64 dürften der Christenheit am Ende des ersten Jahrhunderts allgemein bekannt gewesen sein und Jesu Worte hinreichend illustrieren.
Die konkrete Aussage Jesu allerdings (T655): „pas ho apokteinas hymas doxē latreian propherein tō theō {jeder, der euch tötet, wird glauben, Gott damit ein (wohlgefälliges) Opfer darzubringen}“, spiegelt nach Thyen „schwerlich eine jüdische Praxis zur Zeit des Evangelisten“, sondern ist, wie M. Davies <1106> meint, wohl eher „aus der Schrift extrapoliert“:
Das bei Johannes hier singuläre Lexem prospherein {darbringen}, das auch im gesamten übrigen Neuen Testament nur noch viermal vorkommt, nämlich in Röm 9,4 und 12,2, sowie in Hebr in 9,1 und 6, ist Ausdruck für den kultischen Dienst Gottes und zumal für die Opferdarbringung. Das letztere gilt natürlich erst recht für die in Joh 16,2 vorliegende Verknüpfung von latreia mit prospherein …
Zur letzteren Verknüpfung verweist Thyen auf Schnackenburg, <1107> der in seinen Augen aber „[k]aum zu Recht … dem Evangelisten … die zitierte Aussage von der Opferdarbringung“ abspricht und „sie ‚einem anderen Angehörigen der joh. Schule‘“ zuschreibt:
Er begründet das damit, daß die Wendung erchetai hōra {es kommt die Stunde} sonst stets auf die kommende Stunde der Verherrlichung Jesu bezogen sei, und daß der Ausdruck latreian prospherein {Opfer darbringen} singulär bei Johannes sei. Doch gerade in der absichtsvollen Parallelisierung der Stunde Jesu mit derjenigen seiner Jünger dürfte die Pointe von 16,2 liegen… Dabei macht im übrigen Schnackenburg selbst auf die Nähe dieser Aussage zur biblischen Erzählung von Pinhas aufmerksam, der in heiligem Eifern für Gott den abgöttischen Juden Simri mitsamt seiner midianitischen Buhlerin Kosbi tötete und damit die wütende Seuche vom Gottesvolk abwandte, die schon vierundzwanzigtausend Israeliten dahingerafft hatte (Num 25). JHWH selbst erklärt Mose dazu: „Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israels abgewandt, indem er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte“ (V. 11).
Aber obwohl seit „den Tagen der Makkabäer … der ‚heilige Eifer des Pinhas‘ Motiv aller jüdischen Freiheitsbewegungen“ ist, wozu Thyen auf Hengels <1108> Buch über die Zeloten verweist, und obwohl nach Schnackenburg (ebd.) der „Traktat Sanhedrin (IX, 6a) … allen Eiferern Straffreiheit“ zusichert, „,wenn sie über bestimmte religiöse Verbrecher herfallen‘. d. h. sie töten“, ist Thyen zufolge doch „von derartigen Taten und den entsprechenden Freisprüchen in Prozessen, die solchen Äußerungen entsprachen“, nichts bekannt. Er zitiert daher zustimmend (T655f.) die oben von mir wiedergegebene zurückhaltende Einschätzung von Wengst zur aktiven Beteiligung von Juden an der Verfolgung von Christen.
Den Abschluss der Szene, die mit 15,1 begonnen hat, sieht Thyen in Vers 16,3, der daran erinnert, dass „diejenigen, die den Jüngern solches antun werden, weder den Vater noch Jesus (an)erkennen“.
Ton Veerkamp <1109> geht ausführlicher darauf ein, was der in 16,2 angekündigte Ausschluss aus der Synagoge für die Anhängerschaft Jesu bedeutet:
Das rabbinische Judentum macht nun die Schüler zu Leuten „ohne Synagoge“ (aposynagōgoi). Das, sagt Jesus, solle ihnen keine Falle und kein Stolperstein sein, das Wort skandalon bedeutet ja beides. Die Drohung mit dem Ausschluss ist ja eine Falle, weil er die messianische Perspektive, und ein Stolperstein, weil er das Gehen auf dem eingeschlagenen messianischen Weg unmöglich machen soll.
Die Synagoge war keine Kirche, keine Glaubensgemeinschaft. Sie war vielmehr gleichermaßen Ort der Versammlung und Organ der Selbstverwaltung, wo die Kinder Israels im Rahmen des von den Römern anerkannten Status‘ einer Ethnie mit ihrem zugelassenen Kult (religio licita) ihre Angelegenheiten selber regeln konnten (politeuma in Alexandrien). Das bedeutete einen nicht unbedeutenden Schutz vor behördlichen Maßnahmen und behördlicher Willkür. Das Maß an Autonomie variierte je nach Zeit, Stadt und Region. <1110> Der synagogale Status war etwas zwischen vollem Bürgerrecht und dem Status eines Fremden und Zugereisten.
Weiter erläutert Veerkamp, warum es aus der Sicht des rabbinischen Judentums durchaus gute Gründe dafür gab, eine Bewegung, die einen von den Römern als Aufrührer gekreuzigten Juden als Messias proklamierte, aus ihren Versammlungen auszuschließen:
Der Status war aber prekär; es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Privilegien eingezogen wurden und es von den Behörden geduldete oder gar veranlasste Vertreibungen und Pogrome gab, wie z.B. den Pogrom 37/38 in Alexandrien. Die Synagoge musste also darauf achten, dass Gruppen, die staatsfeindliche Anschauungen vertraten, nicht die Überhand gewannen.
Offenbar war die Führung der Synagoge an dem Ort, wo sich Johannes und seine Gruppe aufhielten, zu dem Schluss gekommen, diese stellen eine Gefahr für die Synagoge dar. Deswegen war es ihre Pflicht, solche Gruppen vor die Tür zu setzen. Die Führung der Synagoge, in deren Zuständigkeitsbereich die Gruppe um Johannes gehörte, vertrat die Richtung des rabbinischen Judentums, Johannes dagegen machte aus seiner Abneigung gegen diese Richtung keinen Hehl. Der Ausschluss war ein legitimer und politisch nachvollziehbarer Akt der synagogalen Führung. Das ist der Grund, den wir sehen können und sehen müssen, und deswegen ist das Wort „grundlos“ (chinnam, dōrean) fehl am Platze. Es gehört zur selbstverständlichen Pflicht nicht-jüdischer Exegeten, den Konflikt einmal von der Warte der Synagoge her nachzuvollziehen und nicht von vornherein Partei für „Jesus und die Apostel“ zu ergreifen. Wie gesagt, Johannes hält sich erst gar nicht bei der Suche nach den Gründen für den Ausschluss auf. Hier müssen wir keine Schüler des Johannes sein.
Auf der anderen Seite macht Veerkamp deutlich, dass schon der Ausschluss aus der synagogalen Gemeinschaft gleichbedeutend sein konnte mit der Auslieferung an staatliche Verfolgung und sogar tödliche Bedrohung:
Wenn andererseits eine Gruppe aus der Synagoge ausgeschlossen wird, verliert sie Status und Schutz, und die Mitglieder dieser Gruppe müssen sich einzeln mit den römischen Behörden auseinandersetzen. Das bedeutete Lebensgefahr. Die Hinrichtung staatsfeindlicher Elemente war ein Akt politischer Loyalität, und eine solche Loyalität war damals ipso facto {durch die Tatsache selbst} religiöser Natur. Wer sich an solcher Verfolgung beteiligt, leistet einen „öffentlichen Dienst“ (latreia) jenem Gott, der Staatsgott war.
Allerdings geht Veerkamp wie Wengst und Thyen davon aus, dass Juden bei solchen Verfolgungen kaum in größerem Maße aktiv wurden:
Die Anhänger des rabbinischen Judentums beteiligten sich nach der Anschauung des Johannes an der Verfolgung. Dafür gibt es außerhalb des Evangeliums keinerlei Belege. Messianisten („Anhänger eines gewissen Chrestos“, schreibt der Gouverneur von Bithynien Plinius um 110 an Kaiser Trajan) wurden von Römern hingerichtet, Angehörige der judäischen Ethnie hatten diese Möglichkeit kaum, aber sie hatten die Möglichkeit der Denunziation. Ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten, können wir nicht wissen. Aber die Synagoge konnte niemanden töten. Mag es vielleicht Mord und Totschlag unter den verfeindeten Fraktionen gegeben haben, so geschah dies allenfalls privat und sicher nicht als „öffentlicher Dienst“ (latreia).
Als Beispiel einer solchen privat ausgetragenen Schlägerei verweist Veerkamp (Anm. 466) auf eine Erzählung aus der Apostelgeschichte:
Lukas berichtet von einem Versuch der Synagoge in Korinth, die Auseinandersetzung mit dem Messianisten Paulus zu einer politischen Affäre zu machen. Der Gouverneur Gallio erklärte sich für nicht zuständig, und die Sache ging vor den Augen Gallios mit einer Tracht Prügel für den Vorsteher der Synagoge Sosthenes aus, Gallio war das alles egal, Apostelgeschichte 18,12ff. Solche Schlägereien waren keine latreia!
In den Augen von Veerkamp sind aber bereits „die politischen Folgen des Ausschlusses“ aus der Synagoge ausreichend, um „die Schärfe“ verständlich zu machen,
mit der Johannes sich gegen das rabbinische Judentum wendet, und sie erklären auch, weswegen Johannes bei seinen Gegnern keine rationalen Gründe für ihre Haltung finden konnte. „Ihr sucht mich zu töten“, 7,19; 8,40; 8,59; 10,31; 11,53; 12,10, lautet der ständige Vorwurf. Dieser Vorwurf ist angesichts der bereits früh einsetzenden Verfolgung und Ermordung von Messianisten durch Rom offenbar nicht völlig haltlos; der Ausschluss bedeutete Lebensgefahr für die Ausgeschlossenen. „So etwas macht man nicht, es gibt keine vertretbaren Gründe für einen Ausschluss, der für die Ausgeschlossenen Lebensgefahr bedeutet“, so kann man den Vorwurf des Johannes umschreiben.
Letzten Endes ist nach Veerkamp der Konflikt zwischen den johanneischen Messianisten und dem rabbinischen Judentum im Rückblick als tragisch zu bezeichnen:
Freilich ist auch die politische Orientierung der Messianisten rational nachvollziehbar. Wenn unter römischen Verhältnissen die Lage der Kinder Israels innerhalb und außerhalb des Landes prekär ist, dann dürfen diese nicht darauf hoffen, Nischen zu finden, in denen sie überleben können, sondern dann brauchen sie eine völlig andere Welt. Das sagt Paulus nicht weniger deutlich als Johannes. <1111> Die Tatsache, dass zwischen Überleben und Weltrevolution keine Vermittlung ist, macht die Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes tragisch. Wir können aus dem sicheren Abstand von zwei Jahrtausenden rationale Gründe auf beiden Seiten entdecken. Aber für die damals Betroffenen war eine rationale Auseinandersetzung offenbar nicht möglich.
Zu Johannes 16,3 muss jedenfalls nach Veerkamp wie nach Wengst dem Vorwurf widersprochen werden, das rabbinische Judentum habe seine Bindung an den Gott Israels aufgegeben:
Für Johannes stellt sich die Synagoge außerhalb Israels: „Sie erkennen weder den VATER noch mich.“ „Gott nicht erkennen“ ist die Aufkündigung des Bundes, den der Gott Israels mit den Vätern und mit den Kindern Israels geschlossen hat. Anders als der Tötungsvorwurf ist dieser Vorwurf, das rabbinische Judentum habe seine Bindung zum Gott Israels aufgegeben, sehr wohl haltlos, wir müssen ihm widersprechen. Wenn dem rabbinischen Judentum dieser Vorwurf gemacht wird, wenn das Schule macht, und es hat Schule gemacht, wird Israel vom Christentum enterbt werden. Der Vorwurf ist strikt analog zum Atheismusvorwurf, den die römischen Behörden den Christen machen werden. Nur hatte Johannes keine Macht, und man konnte den Vorwurf als lächerlich zurückweisen. Aber als das Christentum zur Staatsreligion und die christliche Kirche zu einer staatlichen Institution wurde, hatte der Vorwurf weitgehende politische Folgen.
↑ Johannes 16,4-7: „Ihre“ Stunde, der Weggang Jesu und das Kommen des Parakleten
16,4 Aber dies habe ich zu euch geredet,
damit, wenn ihre Stunde kommen wird,
ihr daran denkt, dass ich‘s euch gesagt habe.
Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt,
denn ich war bei euch.
16,5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem,
der mich gesandt hat;
und niemand von euch fragt mich:
Wo gehst du hin?
16,6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe,
ist euer Herz voll Trauer.
16,7 Aber ich sage euch die Wahrheit:
Es ist gut für euch, dass ich weggehe.
Denn wenn ich nicht weggehe,
kommt der Tröster nicht zu euch.
Wenn ich aber gehe,
werde ich ihn zu euch senden.
[30. November 2022] Die erste Hälfte von Vers 4 betrachtet Klaus Wengst (W447) als das Ende des mit 15,18 begonnenen Abschnitt, in dem Jesus
noch einmal den Zweck seines Redens damit angibt, dass seine Schülerschaft auf die sie treffenden schlimmen Erfahrungen gefasst sei: „Aber das habe ich euch gesagt, damit ihr euch, wenn ihre Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es zu euch gesagt habe.“ Auffällig ist, dass er im Blick auf die Leidenserfahrungen der hier angeredeten Schüler nicht von „eurer Stunde“ spricht, sondern von „ihrer Stunde“, nämlich der Stunde ihrer Bedränger, während er doch hinsichtlich der eigenen Passion von seiner Stunde sprach (7,30; 8,20; 13,1). Seine Schülerschaft hat es nicht in der Hand, wann sie bedrängt wird und wann nicht. Aber sie soll wissen, dass sie unter der Souveränität dessen steht, der ihr die Bedrängnis ansagt.
Erst in der zweiten Hälfte von Vers 4 beginnt Wengst zufolge ein dritter Abschnitt der zweiten Abschiedsrede, der den Blick von „Jesu Schülerschaft … auf den kommenden Beistand“ lenkt, obwohl von dessen Kommen bereits in 15,26 die Rede war:
Das soll Gewissheit geben, ihre schwierige Situation bestehen zu können. Zunächst wird Jesu Weggang als notwendige Bedingung für das Kommen des Beistands herausgestellt und eben das als für die Schülerschaft Jesu nützlich betont (V. 4b-7). Diesen Nutzen expliziert das Folgende am Wirken des Beistands gegenüber der Welt (V. 8-11) und in der Schülerschaft Jesu selbst (V. 12-15).
Kann aber in der Mitte von Vers 4 ein tiefer Einschnitt gesehen werden, wenn sowohl Vers 4b als auch Vers 6 nochmals auf das unmittelbar zuvor Gesagte Bezug nehmen?
Jesu Satz (Vers 4b): „Das aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war“, lässt nach Wengst „ein deutliches Bewusstsein von der Differenz zwischen der vorösterlichen Zeit der Schüler im Zusammenleben mit Jesus und der nachösterlichen Zeit der Gemeinde“ erkennen,
die Jesu leibhaftige Anwesenheit nicht kennt. Während Jesus bei seinen Schülern war, hat er sie bewahrt. Was er ihnen nicht von Anfang an gesagt hat, obwohl sie von Anfang an bei ihm waren (15,27), umfasst beides: die Ankündigung der Feindschaft der Welt und die Ankündigung dessen, dass er weggeht. Diese Feindschaft trifft die von Jesus verlassene Schülerschaft, die sein Werk fortsetzt. Die Erfahrung von Verlassenheit steht im Hintergrund des Textes. Wieder zeigt sich deutlich die Situation des Abschieds.
In Vers 5 wiederholt Jesus, dass er weggeht, indem er zugleich „das Ziel seines Weggangs“ angibt: „Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich geschickt hat.“ Somit ist sein
Weggang, der durch seinen Tod erfolgt, … auftragsgemäße Rückkehr des Boten. Der Richtungssinn seines Lebens ändert sich mit seinem Tod nicht, sondern kommt in ihm gerade zum Ziel. Das verstehen seine Schüler nicht – und können es vor Ostern auch nicht verstehen. Dieses Nichtverstehen kommt hier darin zum Ausdruck, dass Jesus ihnen sagt: „Und niemand von euch fragt mich: ,Wo gehst du hin?‘“ Das Ziel des Weges Jesu kennen sie nicht und fragen auch nicht danach. Sie erwarten nicht, dass sein Tod eine positive Bedeutung für sie haben könnte. Sie lassen sich gefangen nehmen von dem Gedanken, verlassen zu sein und Feindschaft erfahren zu müssen.
Dass (Anm. 141) „Jesu hier getroffene Feststellung, dass niemand frage, wo er hingehe, im Widerspruch zu 13,36“ steht, „wo Simon Petrus genau diese Frage gestellt hatte: ‚Herr, wo gehst du hin?‘“, ist in Wengsts Augen lediglich als eine Formalität zu betrachten, denn „die Frage hat jeweils eine andere Funktion. Als nicht gestellte legt sie die Unkenntnis über das Ziel des Weges Jesu offen, als gestellte die Anmaßung voreiliger Nachfolge.“
In Vers 6 (W448) beginnt Jesus nach Vers 1 und 4 einen dritten Satz mit den Worten tauta lelalēka hymin {weil ich euch das gesagt habe}. Wengst bezieht ihn allerdings nicht auf das zuvor über die Verfolgung der Schülerschaft Gesagte, sondern zunächst nur auf Jesu wiederholte Ankündigung seines Weggangs zum Vater:
Jesus geht zu dem, der ihn geschickt hat. Er geht in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert. Dass seiner Gemeinde daraus Hilfe erwächst, sodass sie ihre von Feindschaft bestimmte Situation bestehen kann, sagt er anschließend thetisch und führt es in zwei Hinsichten aus. Doch zuvor spricht er die Verlassenheitserfahrung seiner Schüler an, die auch der nachösterlichen Gemeinde nicht fremd ist, sondern sie immer wieder trifft und anficht. Die Schüler fragen nicht nach dem Richtungssinn des Weges Jesu. „Weil ich euch das gesagt habe, hat vielmehr Trauer euer Herz erfüllt.“
Dann aber sieht Wengst die hier angesprochene Trauer doch wieder in einem Zusammenhang mit der Verfolgungssituation der Schüler und der johanneischen Gemeinde:
Die Schüler sehen nur auf sich; die Situation, die sie erwartet, scheint trostlos zu sein. Die Gemeinde erfährt so die ihre. Jesus ist weg und Feindschaft trifft sie. Sie wird religiös diskriminiert, sozial isoliert und wirtschaftlich boykottiert. Die das Herz erfüllende Trauer ist der die ganze Person ergreifende Kummer von Bedrängten, die in ihrer Bedrängnis nicht mehr wissen, was sie an Jesus haben.
Was (Anm. 142) hier „und an weiteren Stellen“ in besonderem Maße deutlich wird, beschreibt Dettwiler <1112> als die „fiktionale Redeweise“ der Abschiedsreden:
„Die auf der literarischen Ebene skizzierte historische Ursprungssituation bildet die transparente Vorlage für die Bestimmung des Verhältnisses der nachösterlichen joh(anneischen) Gemeinde zum irdischen Jesus; die vergangene Jesusgeschichte und die gegenwärtige joh(anneische) Gemeindesituation […] sind gleichsam ineinandergefaltet“.
Da die von Jesus angekündigte Situation von der Gemeinde offenbar nur schwer zu bewältigen ist, beteuert Jesus in Vers 7 „gegen den Augenschein schlimmer Erfahrungen“, dass er mit seinen anschließenden Worten „die Wahrheit“ sagt:
„Es nützt euch, dass ich weggehe.“ … Die erfahrene Feindschaft ist nicht die ganze Wirklichkeit und nicht die entscheidende. Durch Jesu Weggang gibt es etwas, das stärker ins Gewicht fällt. Als das wird „der Beistand“ genannt, für dessen Kommen das Weggehen Jesu notwendige Voraussetzung ist: „Wenn ich nämlich nicht wegginge, würde der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gegangen bin, werde ich ihn zu euch schicken.“ Wenn der Weggang Jesu für seine Schülerschaft von Nutzen ist, weil an diesen Weggang die Gabe des Beistandes gebunden ist, dann ist dieser Beistand nicht nur Ersatz für Jesus, sondern dann muss mit ihm ein Mehr geboten sein, das über die Gegenwart des irdischen Jesus hinausgeht. Er bringt das Werk Jesu, das sich in seinem Tod vollendet, zur Wirkung.
Hartwig Thyen hatte sich bereits in seiner Einleitung zur zweiten Abschiedsrede (T638) dagegen gewandt, „die Zäsur zwischen Joh 15 und Kapitel 16 innerhalb von 16,4“ anzunehmen. Zwar hat (T639) der Vers 4 auch „eine Brückenfunktion … zwischen Joh 15 und 16“, trotzdem versteht er „den gesamten V. 4 als die Eröffnung von Joh 16.“ Zur Begründung „für diesen Gliederungsvorschlag“ greift er auf „die Beobachtung der beiden Autoren“ Simoens und Moloney <1113> zurück, „daß zwischen 15,21 und 16,3 eine gewiß nicht zufällige Entsprechung besteht“. Wenn ich mir diese „Entsprechung“ jedoch genauer anschaue, so bestätigen sich meine Zweifel, ob vor dem Vers 4 oder mitten in ihm überhaupt ein tiefer Einschnitt wahrzunehmen ist:
Faßte 15,21 mit den Worten: alla tauta panta poiēsousin eis hymas dia to onoma mou, hoti ouk aidasin ton pempsanta me {Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat}, alles zuvor Gesagte zusammen und schloß so den Gedankengang ab, so blickt 16,3 mit nahezu gleichsinnigen Worten abschließend auf das in 15,22-16,2 zum Thema des Hasses der Welt Gesagte zurück: kai tauta poiēsousin hoti ouk egnōsan ton patera oude eme {Und das werden sie euch antun, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen}…
Da aber bereits 15,21 zusammenfassend auf das Vorangehende zurückblickt, ohne dass der Abschnitt beendet war, könnte genau so gut auch nach dem Rückblick in 16,3 der Gedankengang noch fortgesetzt werden, was in meinen Augen auch der Fall ist. Thyen selbst nimmt zwar an (T639), wieder unter Rückgriff auf Moloney [417], dass „der 16,3 folgende Satz alla tauta lelalēka hymin ktl. {Aber das habe ich euch gesagt usw.} in 16,4 nicht einfach mit 16,1 zusammen eine Inklusion um 16,1-4a und so den Abschluß von Joh 15 bildet…, sondern vielmehr mit dem betont vorangestellten adversativen alla einen Neueinsatz markiert“, aber genau so gut könnte man in der dreifach wiederholten rückblickenden Wendung tauta lelalēka hymin in den Versen 1, 4 und 6 des 16. Kapitels ein Indiz dafür sehen, dass der Rückblick auf die von Jesus angekündigte Verfolgungssituation auch in 16,3 noch nicht zu seinem Ende gekommen ist. Hinzu kommt, dass in Vers 4 mit der Wendung hotan elthē hē hōra autōn {wenn ihre Stunde kommt} nochmals die Stunde der Verfolger erwähnt wird und in Vers 6 von der Trauer der Jünger Jesu die Rede ist, die sicher nicht nur auf den Weggang Jesu, sondern auch auf das bezogen ist, was ihnen bevorsteht.
Auch Thyen nimmt jedenfalls an (T656), dass Vers 4 „unsere neue Szene mit der vorausgegangenen“ auf doppelte Weise verknüpft, und zwar erstens
durch die Wiederaufnahme der Rede von der kommenden Stunde derer, die die Jünger mit ihrem Haß verfolgen werden. Wenn diese Stunde anbricht, sollen sie sich daran erinnern, daß Jesus ihnen das bei seinem Abschied bereits angekündigt hatte. Zum anderen aber weist das tauta lelalēka {das habe ich gesagt} nicht nur auf die eben angekündigten künftigen Verfolgungen und möglichen Martyrien der Jünger zurück, sondern auf Jesu gesamte Abschiedsreden seit 14,1. Denn von allem darin Gesagten gilt ja: tauta de hymin ex archēs ouk eipon, hoti meth‘ hymōn ēmen {Das habe ich euch nicht zu Anfang gesagt, denn ich war bei euch}.
Das heißt also: Weil Jesus (T656f.) „als ihr Paraklet (14,6) und guter Hirte (10) bei ihnen war und sie vor allem Übel bewahrt hat (vgl. 18,8f)“, konnte in dem, was er seinen Schülern ex archēs {zu Anfang} sagte, „[w]eder von seinem Abschied …, der die Herzen der Jünger mit Trauer erfüllt (V. 6), noch von dem kommenden Parakleten, der ihre Trauer in Freude verkehren soll, noch auch von dem auf sie zukommenden und sie womöglich gar verschlingenden Haß der Welt“ die Rede sein.
Aus diesen Überlegungen folgt nach Thyen (T657), dass der Vers 16,4 „als die unteilbare Eröffnung der neuen Szene“ zu begreifen ist. Wo er im Folgenden von den Kapiteln 15 und 16 spricht, setzt er also voraus, dass die Verse 16,1-3 noch zu Kapitel 15 zu ziehen sind:
War das gesamte Kapitel 15 ein reiner Monolog Jesu, der sich als Reinterpretation von Joh 13 erwies und seine Mitte hatte in der Wiederaufnahme und Vertiefung des Liebesgebots (13,34f) und in der Entfaltung von dessen Kehrseite im Haß der Welt, so zeigt sich Joh 16 jetzt als ,Relektüre‘ [Dettwiler 213ff] von Joh 14. Abgesehen von der Wiederaufnahme und Reinterpretation nahezu aller Themen von Joh 14 entspricht Joh 16, im Gegensatz zu dem rein monologischen Charakter von Joh 15, dem 14. Kapitel als seinem von ihm unablösbaren ,Bezugstext‘ auch darin, daß Jesu Rede hier wie dort von Jüngerfragen unterbrochen wird und so einen dialogischen Charakter gewinnt …
Dettwiler [ebd.] hat dazu Thyen zufolge „breit und einleuchtend begründet“, dass
unser Kapitel nicht etwa nur eine Parallelversion von Joh 14 aus dem vermeintlichen ,Nachlaß‘ des Evangelisten oder eine entsprechende Rede aus seiner ,Schule‘ ist, die sie hier eingefügt hätte, sondern an seiner Stelle im überlieferten Text des Evangeliums mit seinen konstitutiven Bezügen auf Joh 14 überhaupt erst geschaffen wurde und nur in dieser Relation verstanden werden kann…
Konkret wird in Vers 5 „dem ex archēs {von Anfang an}, da Jesus noch bei seinen Jüngern war, mit dem nyn de hypagō {jetzt aber gehe ich hin} sein Weggehen zu dem gegenüber[gestellt], der ihn gesandt hat“. Damit wird „erneut das Thema des Abschieds aus Kapitel 14“ aufgenommen:
Als ein absichtsvoller Zug der ,Relektüre‘ erscheint hier auch erneut die schon 13,36 von Petrus gestellte Frage: kyrie, pou hypageis? {Herr, wohin gehst du?}, die Thomas dann so variiert hatte: kyrie, ouk oidamen pou hypageis {Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst} (14,5): „Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat (pros ton pempsanta me) und keiner von euch fragt mich: Wohin gehst du?“ Bei diesem Satz weiß man nicht so recht, ob Jesus nur konstatiert, daß sie ihn nach seinem Wohin nicht fragen, oder ob er beklagt, daß sie verstummt und ihre Herzen von Trauer erfüllt sind, denn sein Wohin hat er ja förmlich im selben Atemzug als seinen Weg zu dem genannt, der ihn gesandt hat. Und schon 14,28 hatte er ihnen ja gesagt: „Wenn ihr mich liebtet, dann müßtet ihr euch darüber freuen, daß ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich“.
Alle Versuche, durch „Neuordnungen der Textfolge“ oder „die Zuschreibung von Textteilen an andere Autoren“ die (T658) „Interpretation von Joh 16,5“ zu erleichtern, weist Thyen zurück. Noch einmal folgt Thyen Dettwilers [219f.] Überlegungen:
Dettwiler, der in der literarischen Wiederaufnahme der Petrus- und Thomasfragen von 13,36 und 14,5 ein absichtsvolles Indiz des Vorgangs der Relektüre sieht, erklärt Jesu Vorwurf, daß die Jünger ihn nicht nach seinem Wohin fragten, doppelt: Zum einen seien die Jünger derart in ihrer Trauer gefangen, daß es ihnen die Sprache verschlagen habe, so daß sie nur noch schweigen und das Schicksal Jesu nicht mehr wahrzunehmen vermöchten; zum anderen aber solle V. 5 „dem Leser bereits zu Beginn den neuen Hauptakzent der Rede signalisieren: Nicht mehr die Frage nach dem Weg Jesu (christologische Fragestellung), sondern nach dem Weg der Jüngergemeinde, nach ihrer kritischen Befindlichkeit in einer feindlichen Welt (anthropologisch-ekklesiologische Fragestellung) ist nun Gegenstand der Ausführungen“. Mit anderen Worten heißt das ja wohl: In der Trauer der Jünger und ihrer Furcht vor dem Verlassensein in einer feindlichen Welt hat die Sorge um ihre eigene Zukunft die Frage nach dem Weg ihres Herrn verdrängt.
Während eigentlich „nach 14,28 die Freude darüber, daß Jesus zum Vater geht, der größer ist als er, ihre Herzen erfüllt haben“ sollte, hat sich nach Vers 6 aber ganz „im Gegensatz … ihrer nun Trauer bemächtigt und ihre Herzen erfüllt.“ In diesem Satz ist „lypē {Trauer} mit dem aktiven Prädikat peplērōken {hat erfüllt} … das ,handelnde‘ Subjekt des Satzes“.
Insofern am Anfang von Vers 7 die „Wendung: all‘ egō tēn alētheian legō hymin {Aber ich sage euch die Wahrheit} … der Einführung der neuen und vierten Verheißung des Geistes der Wahrheit als des Parakleten“ dient, ist hier Thyen zufolge kaum „alētheia {Wahrheit} einfach als Gegensatz zu pseudos {Lüge} zu begreifen“, denn „dafür würde Johannes wie in 4,18 oder 19,35 alēthes oder alēthē legein gebrauchen“: <1114>
Es geht vielmehr auch hier um die Wahrheit der Offenbarung, zu der Jesu Weggehen als die Bedingung für das Kommen des Parakleten konstitutiv hinzugehört. Diese ,Wahrheit‘ ist für die Jünger jedoch einstweilen noch eine paroimia {Bild, Rätselwort} (16,25), die ihnen erst der verheißene Paraklet erschließen wird. „Als Jesus seinen Jüngern sagte, dass er weggehen werde, sagte er gewiss etwas Paradoxes, Rätselhaftes, das die Apostel zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen konnten: Sie würden die wahre Bedeutung erst dann verstehen, wenn der Paraklet gekommen war. So war das Wort, das Jesus beim letzten Abendmahl sprach, bereits eine wahre Offenbarung, wenn auch noch implizit und verschleiert“.
Die „Wendung sympherei hymin hina egō apelthō, es kommt euch zugute und geschieht zu euren Heil, daß ich fortgehe“, vergleicht Thyen mit dem „prophetische[n] Wort des Hohenpriesters in 11,50 u. 18,14“ (T658f.):
Da das Weggehen Jesu die heilsgeschichtlich notwendige Bedingung dafür ist, daß der Paraklet zu den Jüngern kommen kann, geschieht es tatsächlich zu ihrem Heil: ean gar mē apēlthō, ho paraklētos ouk eleusetai pros hymas {Denn ginge ich nicht weg, dann käme der Paraklet nicht zu euch} (vgl. 7,37ff).
Mit der zweiten Hälfte von Vers 7 beginnt nach Thyen (T659) „die vierte, letzte und umfassendste der Verheißungen des Parakleten“, die „alle drei ihr vorausgegangenen, nämlich 14,16f: 14,26 und 15,26“, voraussetzt und „als deren Resümee verstanden sein“ will:
Darum verbieten sich u.E. auch alle Textumstellungen. Auch daß Jesus nun – wie schon in 15,26 (hon egō pempsō hymin para tou patros {den ich euch vom Vater her senden werde}) – ausdrücklich sagt, er selbst werde den Parakleten zu ihnen senden, ist angesichts seiner Einheit mit dem Vater kein Widerspruch zu 14,16, wo er erklärt hatte, der Vater werde den Geist auf seine Bitte hin senden, und zu 14,26, wo es hieß, der Vater werde ihn in seinem Namen senden. Denn gerade diese, bei einem Autor wie unserem Evangelisten, gewiß nicht zufälligen Variationen bringen auf ihre Weise unnachahmlich das egō kai ho patēr hen esmen {Ich und der Vater, eins sind wir!} (10,30) zur Sprache.
Ton Veerkamp <1115> beschäftigt sich zu Vers 4 (Anm. 468) mit Handschriften des Johannesevangeliums, in denen das Wort autōn {ihre} hinter den Worten hē hōra {die Stunde} ausgelassen wird:
Wie soll das gehen, haben sich nicht wenige Kopisten des Johannestextes in der Spätantike gefragt, dass ihre Stunde (nämlich die der Worte über die Verfolgung) kommen soll? Seine Stunde, ja – aber ihre? Also lassen sie das Pronomen weg. Diese Handschriften wurden nach Konstantin, nach den Verfolgungen geschrieben, unter dem Eindruck, ihre Stunde sei vorbei, die Stunde jener Worte, die die Verfolgung ankündigen. Die Auslassung ist mehr als ein Lapsus. Die Auslassung besagt, dass der Messias Christus, der Messianismus, das Christentum und die Kirche, die nicht länger unter der Obrigkeit leiden, selber zu Obrigkeit geworden sind.
Das Evangelium selbst geht dagegen noch von der realistischen Erwartung aus, dass die Schüler des von Rom gekreuzigten Messias ebenfalls mit der Feindschaft der römischen Weltordnung und ihrer Handlanger rechnen müssen:
Jesus warnt seine Schüler: „Aber das habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommt, ihr dessen gedenkt, was ich zu euch sagte.“ Der Sklave ist nicht mehr als sein Herr, und der Herr wird gekreuzigt, solange Rom steht. Ap‘ archēs, „von Anfang an“ (15,27), waren die Schüler mit ihm, es wurde ihnen zum Lebensprinzip, Schüler dieses Messias zu sein. Was das unter den herrschenden Umständen bedeutet, hat der Messias aber zunächst, ex archēs, „anfänglich“ (16,4), nicht gesagt. Dass das Prinzip sich in Verfolgung und Tod bewähren muss, das hat er ihnen erst jetzt deutlich gemacht. Das Sagen haben vorerst die Großpriester und Pilatus. Diese Weltordnung, ihre Stunde.
Sehr ernst nimmt Jesus die in Vers 6 ausgedrückte Trauer seiner Schüler, die nach Vers 5 nicht einmal mehr die zuvor gestellten Fragen nach dem Ziel des Weggangs Jesu aufkommen lässt, so dass Veerkamp zufolge lypē hier angemessen mit „Schmerz“ zu übersetzen ist:
Der Messias weiß es: „Der Schmerz hat euer Herz erfüllt“, ihr Herz ist nur noch Schmerz, nur noch schiere Verzweiflung: Der geht, wir bleiben; was bleibt uns, kommt überhaupt noch etwas? Die Frage von Simon Petrus, 13,36, und die von Skepsis bestimmte Frage von Thomas, 14,5, werden hier nicht einmal mehr gestellt und das berechtigte Ansinnen des Philippus: „Zeige uns den VATER“ (14,8) und die Aufforderung des anderen Judas: „Zeige der Weltordnung, wer die Macht hat“ (14,22): das alles kommt hier nicht mehr auf, sie wissen inzwischen, was ihm und ihnen blüht, etwas anderes gibt es gar nicht mehr zu sehen als Niederlage, nur Niederlage. Das „Gehen zum Vater“ ist ja das Gehen in einen furchtbaren Tod.
In den Augen von Veerkamp machen es sich die „meisten Kommentatoren … ziemlich leicht“, mit der Trauer der Schüler Jesu umzugehen:
Die saturierte Existenz der Berufstheologen verstellt ihnen den Blick auf eine Lage, die verzweifelter nicht sein konnte: völlig an den Rand gedrängt, ohne Aussicht auf eine Wende zum besseren, geschweige auf das Leben der kommenden Weltzeit. Für sie, und für Unzählige, die nach ihnen in einer vergleichbaren Situation verkehren, ist hier Ende, keine Wende. Für die Kommentatoren sind die Schüler immer die Dummen, die den Durchblick nicht haben…
Wörtlich zitiert Veerkamp in diesem Zusammenhang Rudolf Bultmann [430], der den Schmerz der Schüler Jesu ein „Missverständnis“ nannte:
„Sie fragen nicht, wohin er geht – die Antwort wäre ja: zum Vater; und damit wäre das Rätsel gelöst … Die lypē der Jünger beruht auf einem Missverständnis …“. Man fragt sich, wie Bultmann, als er seinen berühmten Kommentar schrieb, 1941, nicht sehen konnte, dass die Konzentrationslager voll derer war, denen das unsäglich qualvolle Ende die einzige Perspektive war, und wie er von „Missverständnis“ reden konnte.
Den Beginn von Vers 7 übersetzt Veerkamp auf ungewöhnliche Weise:
16,7 Der Treue entsprechend sage ich euch:
es nützt euch, dass ich weggehe.
Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Anwalt nicht zu euch kommen;
wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch schicken.
In seiner Anm. 464 zur Übersetzung von Johannes 16,7 schreibt er zu der Wendung tēn alētheian legō {der Treue entsprechend sage ich}:
Natürlich sagt Jesus auch die „Wahrheit“, er lügt ja nicht. Aber im Evangelium hat nun mal alētheia die Tragweite der ˀemeth, der Treue. Ein adverbialer Gebrauch von Derivaten der Wurzel ˀaman (ˀaman, ˀomna, ˀumnam, ˀomnam) wird in der LXX mit ep’ alētheias, alētheia, wiedergegeben. Aber man kann auch an den griechischen Accusativus respectus {Akkusativ der Beziehung} denken.
Aber was ist es nun, was Jesus „der Treue entsprechend“ seinen Schülern ans Herz legen muss? Veerkamp zufolge haben seine auf der Treue des Gottes Israels beruhenden Worte eine klare politische Zuspitzung:
Johannes rechnet an dieser Stelle mit einem ganz bestimmten Messianismus als politischer Strategie ab. Der Weggang des Messias „sei nützlich“, sympherei. Dieser Ausdruck kommt bei Johannes ein weiteres Mal vor, 11,50 (und dessen Echo in 18,14). Dort stellt der Großpriester den Tod Jesu als politisch nützlich vor. Der politische Nutzen ist auch hier gemeint. Solange die Leute denken, dass der Messias im Kampf gegen Rom durch einen militärischen Sieg das Problem beseitigen wird, das die Weltordnung für die Menschen darstellt, solange denken sie in Kategorien der Weltordnung. Die Grundkategorie muss die Treue sein; deswegen sag Jesust „der Treue entsprechend“ (tēn alētheian), dass es der Politik der Treue entspricht, wenn er keinen schnellen Sieg erringt, sondern weggeht, zu seiner Bestimmung, dem VATER. Dieser Weg führt nur durch die Niederlage. Johannes richtet sich hier eindeutig gegen den Messianismus der Zeloten. So kommt man dem siegreichen Rom nicht bei, so kann jener Anwalt nicht kommen.
Aber kann denn der „Anwalt“, dieser paraklētos, dieser „Geist der Wahrheit“, diese „Inspiration der Treue“ politische Befreiung von der römischen Weltordnung bewirken? Die nächsten Verse wird Veerkamp als Antwort auf diese Frage deuten:
Was geschieht, wenn er kommt?
↑ Johannes 16,8-12: Der Paraklet als Ankläger der Weltordnung im Blick auf die Verirrung, die Bewährung und das Gerichtsurteil
16,8 Und wenn er kommt,
wird er der Welt die Augen auftun
über die Sünde
und über die Gerechtigkeit
und über das Gericht;
16,9 über die Sünde:
dass sie nicht an mich glauben;
16,10 über die Gerechtigkeit:
dass ich zum Vater gehe
und ihr mich hinfort nicht seht;
16,11 über das Gericht:
dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
16,12 Ich habe euch noch viel zu sagen;
aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.
[1. Dezember 2022] Klaus Wengst (W448) hatte gesagt, dass nach dem „Weggang Jesu“ mit der „Gabe des Beistandes … ein Mehr geboten sein“ muss, „das über die Gegenwart des irdischen Jesus hinausgeht.“ Aber wie bringt dieser „das Werk Jesu, das sich in seinem Tod vollendet, zur Wirkung“ und worin besteht „also der Nutzen seines Weggangs“? Das „legt Jesus zunächst in Hinsicht auf die Welt dar“, wobei Wengst von vornherein darauf hinweist (Anm. 143), dass die Verse 8-11 „dem Verstehen besondere Schwierigkeiten“ bereiten und „jede Auslegung dieser Stelle nicht mehr als ein Versuch sein kann.“ Jesus beginnt mit einer einleitenden These (W448):
„Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen in Bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht.“ Das Wort „überführen“ weist auf den Zusammenhang eines Prozesses. Was im Evangelium beim Prozess Jesu zur Darstellung kommt – dass der verurteilte und hingerichtete Angeklagte doch der Sieger ist, wobei schon im Verfahren die Rollen eigenartig getauscht werden -, bringt der Beistand zur Manifestation in der Auseinandersetzung der Gemeinde mit der ihr feindlichen Welt. Diese Auseinandersetzung erscheint als ein Prozessgeschehen, das die Welt ins Unrecht und die Gemeinde ins Recht setzt. Das ist die Sicht, die Johannes seiner Leser- und Hörerschaft vermitteln will. Die „Welt“ sieht das ganz anders.
Wieder einmal definiert Wengst nicht genau, wer oder was hier mit „Welt“ gemeint sein soll. Er scheint einerseits ein Gegenüber von „Welt“ und „Gemeinde“ vorauszusetzen, wobei die „Welt“ Menschen umfasst, die den Mitgliedern der Gemeinde feindlich gegenüberstehen, andererseits sind es offenbar auch Vertreter der „Welt“, die Jesus anklagen, verurteilen und hinrichten, während tatsächlich sie selbst das über Jesu verhängte Urteil verdienen. Außerdem fällt mir auf, dass er mit keinem Wort die Begriffe hamartia, dikaiosynē und krisis in ihrer Bedeutung näher unter die Lupe nimmt, sondern einfach ihre übliche Übersetzung „Sünde, Gerechtigkeit und Gericht“ übernimmt.
Wengsts Auslegungsversuch läuft darauf hinaus (W448f.), dass die
von Johannes vermittelte Sicht … also wiederum der Stabilisierung der eigenen Gruppe in ihren sie bedrängenden Erfahrungen [dient], in denen sie sich von der Mehrheit distanziert sieht. Das kann zu ideologischer Verhärtung führen und Distanz auch da behaupten lassen, wo sie möglicherweise gar nicht gegeben ist. Darauf ist zu achten, wenn das Überführen der Welt durch den Beistand unter einzelnen Gesichtspunkten entfaltet wird.
Diese Formulierungen lassen darauf schließen, dass Wengst in diesem Abschnitt ausschließlich oder vorwiegend den Konflikt der johanneischen Gemeinde mit der ihr feindselig gegenüberstehenden jüdischen Mehrheit widergespiegelt sieht. Auch ob das wirklich der Fall ist, wird zu prüfen sein.
Nach Vers 9 (W449) überführt der Beistand „die Welt ‚in Bezug auf Sünde, insofern als man nicht an mich glaubt‘“, was nahelegt, wie es Schnackenburg <1116> formuliert,
dass „der Unglaube […] die Sünde schlechthin“ sei, dass „,Sünde‘ im eigentlichen Sinn darin besteht, an Jesus nicht zu glauben, der Unglaube gegenüber Jesus also die eigentliche Sünde ist“.
Das wird (Anm. 144) „[b]esonders scharf … – in Zwangslogik – von Wilckens <1117> herausgestellt:
„Das Nein des Unglaubens gegenüber Jesus ist Sünde im eigentlichen Sinn. Sünde ist ihrem Wesen nach Ungehorsam gegen Gott. Ist es aber Gott, der Jesus in die Welt gesandt hat, um allen an ihn Glaubenden Leben zu geben (3,16), dann ist jedes definitive Nein gegen Jesus definitives Nein gegen Gott. Denn Gott und Jesus sind eines“.
Wenn diese Zwangslogik stimmt und von uns Christen auch heute noch als verbindlich übernommen wird, dann wären, so Wengst (W449)
„die Juden“ einmal mehr Prototypen des Unglaubens und damit auch die „eigentlichen“ Sünder. Demgegenüber ist daran zu erinnern, dass nach 12,44 die an Jesus Glaubenden gerade nicht an ihn glauben, sondern an den, der ihn geschickt hat. Und es wäre wahrzunehmen, dass Gott, der Jesus geschickt hat, Israels Gott ist und bleibt. So wäre „die eigentliche Sünde“ die Missachtung des ersten Gebots und also jedwede Art von Götzendienst. Diese Linie ist im Johannesevangelium angelegt, aber nicht ausgeführt. Dass das nicht geschieht, ist situations- und erfahrungsbedingt.
Diese Einschätzung setzt voraus, dass es der johanneischen Gemeinde auf Grund ihrer Erfahrungen von Ausstoßung und Verfolgung nicht möglich war, die nach wie vor bestehenden Gemeinsamkeiten mit der jüdischen Mehrheit wahrzunehmen und auszusprechen. Es ist die in Vers 2 „angesprochene Erfahrung …, die Johannes so reden lässt, wie er es tut“:
Wie er in Kap. 8 „die Juden“ auf die Tötungsabsicht festlegt, so sieht er hier die jüdische Welt aufgrund gemachter Erfahrungen nur in ihrem negativen Verhalten gegenüber der Gemeinde. Löst man die Aussagen des Johannes aus diesem Zusammenhang und spricht gegen inzwischen gemachte andere Erfahrungen weiterhin vom „Unglauben der Juden“, werden sie zur bloßen Ideologie.
Hier scheint das Wort „Welt“ von Wengst also eindeutig als „die jüdische Welt“ definiert zu sein, gegenüber der die „Gemeinde“ eine Art richtender Funktion ausübt:
Die Frage, wie denn der Beistand, die Geisteskraft, es aufdeckt, dass Sünde im Unglauben gegenüber Jesus besteht, beantwortet Schnackenburg [148] so: „Durch die glaubende Gemeinde!“ Sie, die sozusagen Produkt der Geisteskraft ist, erfährt die Feindschaft der sie umgebenden Welt und sieht deren sie treffende Taten in ihrem Glauben an Jesus begründet. So führt sie diese Taten auf den Unglauben gegenüber Jesus zurück, der damit zur „Sünde schlechthin“ wird.
Indem Wengst damit das Stichwort hamartia, „Sünde“, durch Johannes praktisch mit dem Unglauben gegenüber Jesus gleichgesetzt sieht, aus dem die feindseligen Taten gegen die an Jesus Glaubenden hervorgehen, setzt er grundlegend eine Definition von hamartia voraus, die sich auf den Bereich ethisch-moralischer Taten aus religiöser Motivation bezieht.
Nach Vers 10 überführt der Beistand „die Welt weiter ‚in Bezug auf Gerechtigkeit, insofern als ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht‘“. Dazu fragt Wengst:
Inwiefern liegt darin, dass Jesus zum Vater geht, ein Erweis von Gerechtigkeit? Er geht ja in den Tod. Er geht so in den Tod, dass er unschuldig verurteilt und hingerichtet wird. Ihm geschieht bitteres Unrecht. Indem gerade dieser Gang in den Tod als Gang zum Vater dargestellt wird – zum Vater, der ihn verherrlicht (13,31f.) -, ist damit zugleich gesagt, dass er doch zum Recht kommt, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Schon in 8,50 wurde deutlich, dass Gott der Richter ist, der dem in die Niedrigkeit des Kreuzes gehenden Jesus zum Recht verhelfen wird.
Wengst ist davon überzeugt, dass damit „hier die biblisch-jüdische Tradition von der Gerechtigkeit Gottes aufgenommen“ ist (W449f.), „dass Gott denen zum Recht verhilft, die Unrecht erleiden – den Einzelnen im Volk (vgl. nur Ps 103,6) und dem Volk Gottes im Ganzen (vgl. nur Jer 51,10).“
Eine solche Auslegung ist nachvollziehbar, allerdings gebe ich zu bedenken, dass in den von Wengst zitierten Schriftstellen das Wort zɘdaqah von Martin Buber <1118> gar nicht mit „Gerechtigkeit“, sondern mit „Bewahrheitungen“ bzw. „Bewährung“ wiedergegeben wird (gerade hier wurde es übrigens nicht einmal in der Septaginta mit dikaiosynē ins Griechische übertragen). Zur Verdeutschung der Schrift weist Buber grundsätzlich darauf hin, dass die Übersetzung von zɘdaqah mit „Gerechtigkeit“ die schriftgemäße Grundbedeutung dieses Wortes einengt:
„Zedek … bedeutet die Zuverlässigkeit eines Handelns einem äußeren oder inneren Sachverhalt gegenüber; einem äußeren gegenüber, indem es ihn zur Geltung bringt, ihm Raum schafft, ihm sein Recht werden läßt; einem inneren, indem es ihn verwirklicht, ihn aus der Seele in die Welt setzt. Der einzige deutsche Wortstamm, der beiden Bedeutungen Genüge tut [wogegen das dem Stamm schafat entsprechende ‚Recht‘ nur auf die erste trifft], ist ‚wahr‘: Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Bewahrheitung [des Unschuldigen im Gericht], Wahrspruch, Wahrbrauch [der mit ehrlicher Intention getane Brauch], Bewährung stecken den Umfang des Begriffes ab.“
In meinen Augen dürfte diese Bedeutung von zɘdaqah im Hintergrund des Wortes dikaiosynē dem jüdisch-messianischen Evangelisten Johannes noch vertraut gewesen sein, so dass zu Wengsts Auslegung zumindest noch Fragen offen bleiben.
Wieder fragt Wengst (W450), auf welche Weise „der Beistand, die Geisteskraft, diese Gerechtigkeit“ aufdeckt. Und wiederum antwortet er: „durch die Gemeinde“, da es in Vers 10 heißt: „insofern als ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht“. Das erläutert er folgendermaßen mit einem abschließenden Zitat von Thyen (T664):
Jesu Schülerschaft, die ihn nicht mehr sieht, vertraut im Blick auf den im Evangelium erzählten Weg Jesu doch auf Gott (vgl. 20,29), der „Recht und Gerechtigkeit schafft für alle Bedrängten“ (Ps 103,6). Und sie praktiziert selbst diese Gerechtigkeit im Halten des Vermächtnisses Jesu. „Ob sie diese Gerechtigkeit indes wirklich praktiziert, ist freilich eine andere Frage. Sicher ist nur, daß sie das tun sollte, weil allein daran erkannt werden kann, daß sie Jesu Jüngerschaft ist.“
In der Aussage, dass Jesu Schülerschaft „ihn nicht mehr sieht“, meint Wengst (Anm. 147) „keinen Widerspruch zu 14,19 oder 16,16-19 konstatieren“ zu müssen, denn
Johannes lässt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Aspekte des Wortes „sehen“ anklingen. Hier betont er, dass es jenseits der österlichen Erscheinungserfahrungen kein Sehen Jesu im eigentlichen Sinn gibt.
Hier treten die Verstehensschwierigkeiten des Textes, auf die Wengst eingangs verwiesen hatte, besonders deutlich zutage, denn das Nicht-mehr-Sehen Jesu kann jedenfalls nur auf Umwegen Jesu Gerechtigkeit aufdecken: Einerseits muss hier der Glaube von 20,29 im Hintergrund stehen, der kein Sehen voraussetzt; andererseits soll sich dieser Glaube, von dem ausdrücklich hier gar keine Rede ist, auf den Gerechtigkeit schaffenden Gott richten, und sich zugleich in der Praxis dieser Gerechtigkeit verwirklichen.
Nach Vers 11 schließlich (W450)
überführt der Beistand die Welt „in Bezug auf Gericht, insofern als der Herrscher dieser Welt gerichtet ist“. Hier ist aufgenommen, was 12,31 und 14,30 gesagt wurde. Gerade im Tod Jesu, wo das Unrecht gewalttätiger Macht zu seinem Triumph zu kommen scheint, setzt es sich doch nicht durch, sondern läuft sich tot und wird überwunden, weil Jesus nicht allein, sondern der Vater bei ihm ist (8,16.29).
An dieser Stelle scheint es mir, als ob Wengst die Überführung der „Welt“ im Blick auf „Gericht“ nicht sehr viel anders einschätzt als im Blick auf „Gerechtigkeit“. In beiden Fällen geht es ihm zufolge um das „Unrecht gewalttätiger Macht“, dass Jesus angetan wird, mit dem Unterschied, dass hier vom Gericht über den „Herrscher dieser Welt“ die Rede ist. Dazu hebt Wengst besonders hervor (Anm. 149), dass nach Dettwiler <1119>
nicht vom Gericht über „die Welt“ die Rede ist, sondern über den „Herrscher der Welt“. Damit werde „der Welt […] ein positives Moment zugesprochen […], nämlich die Befreiung von der sie bestimmenden Macht des Bösen“, was sie „wiederum zur Adressatin des durch die Gemeinde verkündigten Gerichts- und Heilswortes“ mache.
Somit wird deutlich, dass nach Wengst in Johannes 16,8-11 von der „Welt“ nicht nur im Blick auf „die jüdische Welt“ oder als des Inbegriffs „gewalttätiger Macht“ die Rede ist, sondern auch im Sinne der Menschenwelt, die sich nach Befreiung sehnt.
Ohne dazu auf einen Anhalt am hier vorliegenden Text zu verweisen, geht Wengst einfach davon aus (W450), dass auch hier
der Beistand, die Geisteskraft, dieses Gericht durch die Gemeinde aufdeckt. Sie erweist es, sie zeigt die Nichtigkeit des „Herrschers dieser Welt“, indem sie sich seinem Einfluss verweigert, indem sie sich in ihrem Verhalten von Unrecht und Gewalt nicht bestimmen lässt. Bleibt sie trotz der sie treffenden Feindschaft bei Jesus, bleibt sie in der Liebe (vgl. 15,10), so gibt sie Zeugnis für das, was wirklich gilt.
Nachdem auf diese Weise „in V. 8-11 die Funktion des Beistands gegenüber der Welt beschrieben“ wurde, kommt Wengst zufolge „in V. 12-15 seine Funktion gegenüber der Gemeinde in den Blick“. Dabei deutet er Jesu Wort in Vers 12 als Einleitung dieser weiteren Ausführungen über den Parakleten, ohne in Erwägung zu ziehen, dass diese Aussage sich genau so gut auch als Abschluss der vorigen Passage lesen lässt:
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.“ Nach Bauer <1120> vertritt Johannes „hier die Überzeugung, daß, was der irdische Herr die Seinen gelehrt hat, nicht den Charakter der abschließenden Offenbarung zeigt, sondern eine Ergänzung verträgt, einer solchen bedarf“. Das trifft jedoch nicht den hier gemeinten Sachverhalt. Wie der Beistand nach 14,26 an alles erinnert, was er gesagt hat, so spricht er auch nach dem Folgenden nur das, was er hört; und was er kündet, entnimmt er dem, was Jesus gehört.
Dazu verweist Wengst (Anm. 151) auf die drastischen Worte Martin Luthers: <1121>
„Der heilige Geist hat ein Maß, wie weit er predigen soll, und nicht weiter. Darum ist eine Kirche, die anders lehrt als Christus, nicht die christliche Kirche, sondern des Teufels leidige Hure.“
Worin aber besteht dann (W450) der „Unterschied zwischen dem Reden Jesu und dem Reden des Beistands“? Nach Wengst kann (W451)
die Schülerschaft Jesu vor Ostern nicht verstehen …, was Jesus sagt, tut und erleidet. Was sie vor allem jetzt nicht ertragen könnte, wären Ankündigungen über Jesu Leiden und Tod. Es ist auffällig, dass sich im Johannesevangelium solche Ankündigungen nicht finden. Ohne die österliche Perspektive, die die Schüler in der vorgestellten Situation nicht haben, böten sie einen unerträglichen Blick auf ein aussichtsloses Ende. Was demgegenüber der Beistand leistet, ist die aus österlicher Perspektive erfolgende Erschließung dessen, was Jesus gesagt, getan und erlitten hat, die je neu erfolgen muss. So gelesen, besteht auch kein Widerspruch zu 15,15, wonach Jesus alles vom Vater Gehörte seinen Schülern kundgetan hat: „Jesus hat alles gesagt, aber dieses ,Alles‘ muß jeder Jüngergeneration neu erschlossen werden.“ <1122>
[2. Dezember 2022] Anders als Wengst setzt sich Hartwig Thyen (T659) zunächst mit dem „scheinbare[n] Widerspruch“ auseinander, dass nach 14,17 „der Kosmos“ den Parakleten „nicht empfangen könne, weil er ihn im Gegensatz zu den Jüngern weder sehe noch erkenne (14,17)“, während es in 16,8 nun heißt,
der Paraklet werde den Kosmos bezüglich dessen, was Sünde, was Gerechtigkeit und was Gericht ist, ins Unrecht setzen, oder er werde ihm demonstrieren, was diese Trias in Wahrheit bedeute: ekeinos elenchei ton kosmon peri hamartias kai peri dikaiosynēs kai peri kriseōs {jener wird der Welt demonstrieren, was es um Sünde, um Gerechtigkeit und um Gericht ist}. Gleichwohl wäre es aber töricht zu fragen, wie denn ein Geist eine Welt soll überführen können, den diese weder zu sehen noch zu erkennen vermag. Denn zum einen ist kosmos bei Johannes ein höchst ambivalentes Lexem, dessen jeweilige Bedeutung nur der Kontext erschließt. Darum muß hier daran erinnert werden, daß es Gottes Liebe zum Kosmos ist, die ihn zur Gabe seines Sohnes bewegte, und daß er diesen Sohn ebenso wie ja wohl auch jenen ,anderen Parakleten‘ nicht in die Welt gesandt hat, hina krinē ton kosmon, all‘ hina sōthē ho kosmos di‘ autou {dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde} (3,17). Und zum anderen vollzieht sich das Zeugnis des Geistes für Jesus ja nicht nur neben, sondern zugleich auch in, mit und unter dem Zeugnis der Jünger, die sehr wohl sichtbar sind und an deren Liebe zueinander der kosmos sie doch als Jesu Jünger erkennen soll (13,34f).
Zu der von Thyen betonten Schwierigkeit, die Bedeutung von „Welt“ im Johannesevangelium angemessen zu bestimmen, gehört auch die Frage, ob sich die Verse 8-11 überhaupt an die „Welt“ richten oder nicht doch nur an die Jünger Jesu. Dazu schreibt Thyen (T559f.), der selber, wie gesagt, die gesamte Passage bis Vers 15 „als die vierte, letzte und umfassendste der Verheißungen des Parakleten“ begreift:
De la Potterie <1123> unterscheidet innerhalb dieser Passage die V. 7-11 als die vierte von V. 12-15 als fünfte und letzte der Paraklet-Verheißungen. Sofern die Tätigkeit des Parakleten in den V. 7-11 auf den kosmos gerichtet ist (elenchei ton kosmon {er wird die Welt überführen}), während in den V. 12-15 wieder seine Relation zu den Jüngern im Zentrum steht, könnte man tatsächlich so unterscheiden. Doch de la Potterie bezieht die V. 7-11 gerade nicht auf das Forum der Weltöffentlichkeit, sondern deutet sie als [410] „die Demonstration der Schuldhaftigkeit der Welt durch den Parakleten, die sich nur in den Herzen der Jünger abspielt“. Das aber macht seine eigene Unterscheidung zweier Verheißungen fragwürdig. lm Anschluß an Berrouard <1124> bezweifelt er nämlich, daß es sich bei diesem ,Überführen der Welt‘ primär überhaupt um das Zeugnis des Parakleten vor dem kosmos und/oder um das geistvermittelte Zeugnis der Jünger vor Synagogen und Herrschenden handeln könne, wie in den synoptischen Verfolgungslogien. Denn auch wenn von dem Parakleten hier gesagt werde: ekeinos elenchei ton kosmon {jener überführt die Welt}, dürfe man darüber doch nicht übersehen, daß er auch hier nicht in die Welt gesandt werde, sondern daß Jesus verspricht, ihn zu seinen Jüngern zu senden (pempsō auton pros hymas {ich werde ihn zu euch senden}). Darum will de la Potterie die Passage in dem Sinne verstehen, daß der Geist den Jüngern als testimonium internum {inneres Zeugnis} die Sünde der Welt aufdecken und sie dadurch allererst zu Zeugen Jesu machen wird. Doch dabei übersieht er, daß nach V. 8 doch der kosmos der Adressat des parakletischen elenchein {Überführens} ist und nicht etwa die Jünger.
Von dieser „einseitigen Interpretation“ de la Potteries will Thyen allerdings immerhin „einen Nebenton der Verheißung“ gelten lassen, den er „hörbar gemacht“ hat:
Denn unter dem Gesichtspunkt der elenxis {Überführung} des kosmos durch den Parakleten peri dikaiosynēs {im Blick auf die Gerechtigkeit} erklärt Jesus: hoti pros ton patera hypagō kai ouketi theōreite me {sofern ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht} (V. 10). Zu dieser unvermittelten Anrede der Jünger mit dem auffälligen theōreite me {ihr seht mich} hatte schon Bultmann <1125> bemerkt: „Es könnte ja auch heißen: hoti ouketi theōrousin me {sie sehen mich nicht mehr}. Aber die Paradoxie des Sieges wird durch das theōreite me {ihr seht mich} viel stärker zum Ausdruck gebracht, indem vom Standpunkt der Jünger aus geredet wird: sie sollen wissen, daß gerade die Tatsache, daß sie ihn nicht mehr sehen, sein Sieg ist“.
Da in den nun folgenden Versen 9-11 nach Bultmann [434] das „hoti … natürlich jedesmal explikativ {erläuternd}, nicht begründend gemeint“ ist, übersetzt es Thyen „mit ,sofern‘“. Carson <1126> übersieht dagegen in Thyens Augen „den abstrakten Charakter der drei artikellosen Lexeme hamartia, dikaiosynē und krisis“, sondern nimmt „sie als konkrete Beschreibungen des verlorenen Zustandes der Welt“ und begreift „das dreifache hoti jeweils als kausale Konjunktion („er wird die Welt ihrer Sünde, ihrer Gerechtigkeit und ihres Gerichturteils überführen“).
Da nach Thyen alle drei Erläuterungen, die „durch hoti“ erfolgen, „auf den Weg und den Sieg Jesu bezogen sind“, stimmt Thyen Thüsing <1127> zu,
der ganz zutreffend auf die Parallelität des martyrein {Bezeugen} des Parakleten in 15,27 mit seinem elenchein {Überführen} in unserer Passage verweist und daraus schließt, daß „das elenchein als Bezeugen des Unrechts der Welt durch denselben Akt (geschieht), der positiv Bezeugung Jesu und seines Sieges ist“, und daß gerade deshalb „auch dieses elenchein (bei dem als Objekt vor allem die den Glauben Verweigernden im Blick stehen) noch ein martyrein ist, das auf die Weckung des Glaubens hingeordnet ist“. … Darum sind die V. 8-11, die vom elenchein ton kosmon peri hamartias kai peri dikaiosynēs kai peri kriseōs {Überführen des Kosmos wegen der Sünde und wegen der Gerechtigkeit und wegen des Gerichts} reden, nichts anderes als die negative Kehrseite des positiven Zeugnisses des Parakleten und der Jünger für Jesus von 15,26f… Und wie die durch die österliche Gabe des Geistes ausgerüsteten und als seine Zeugen in die Welt gesandten Jünger Jesu (20,21f), so setzt auch der Paraklet mit seiner elenxis {Überführung} des kosmos nur fort, was schon die Kehrseite von Jesu eigenem Wirken durch seine Worte und seine Taten war: vgl. nur Jesu eigenes Resümee seiner öffentlichen Wirksamkeit in 12,44ff sowie in 3,19ff; 5,45; 8,46; 9,39ff; 15,22ff …).
Da also „das elenchein {Überführen} des kosmos durch den Parakleten nur die negative Kehrseite seines positiven und die Welt zum Glauben rufenden martyrein {Bezeugens}“ ist, darf man Thyen zufolge nicht, wie es Dietzfelbinger <1128> tut (T660f.) „diese beiden Seiten … auseinanderreißen und zur Funktion seiner elenxis {Überführung} erklären: „Seine Aufgabe besteht also nicht im Gewinnen von Menschen. Hier wird nicht missioniert, sondern gerichtet“.
Konkret zu Vers 9 schreibt Thyen (T661):
Was es um Sünde ist, wird der Paraklet daran aufdecken, daß sie nicht an Jesus glauben (hoti ou pisteusousin eis eme: V. 9). Dabei nimmt der Erzähler mit dem Plural sie glauben nicht die Rede von denen wieder auf, von denen Jesus zuletzt gesagt hatte: „Aber das alles werden sie euch antun, weil sie weder meinen Vater noch mich anerkennen“ (16,3). Statt sich von dem Wort: „Grundlos haben sie mich mit ihrem Haß verfolgt“ (Ps 69,10), das in ihrer eigenen heiligen Schrift geschrieben steht, zur Umkehr bewegen zu lassen, haben sie es an dem gerechten Jesus ganz buchstäblich zur Erfüllung gebracht (15,21ff; s.o. z.St.).
In diesem Zusammenhang erinnert Thyen daran, dass sich die Jünger bereits „nach Jesu Reinigung des zum Kaufhaus verkommenen ,Hauses seines Vaters‘ in Jerusalem (2,14ff) … eines anderen Wortes aus eben diesem Psalm 69 ,erinnert‘“ hatten. Dort war in 2,17 das Wort vom Eifer um das Haus Gottes aus Psalm 69,10 im „Vorblick auf das tatsächliche Ende Jesu am Kreuz“ an Stelle der Vergangenheitsform „durch das Futurum kataphagetai me {wird mich verzehren}“ ausgedrückt worden:
Darum bezeichnen die Worte: hoti ou pisteusousin eis eme {sofern sie nicht an mich glauben}, primär nicht irgendein dogmatisches Defizit jener hier unbestimmt „sie“ Genannten, sondern damit zugleich ihr zutiefst ethisches Versagen. Zu lieben vermögen sie nur ihr Eigenes. Statt nach der Ehre Gottes zu trachten und seine Gebote zu halten, sind sie allein auf ihre eigene Ehre aus und verfolgen alles Fremde mit ihren grundlosen Haß. Darin manifestiert sich, daß sie nicht ,an Jesus glauben‘. Denn allein daran, daß einer Jesu Gebote hält, die in seinem Liebesgebot gipfeln, vermag er zu erkennen, daß er ihn erkannt hat und an ihn glaubt (1Joh 2,3ff). Wird das nicht stets mitbedacht, dann ist es zumindest höchst mißverständlich, die Verweigerung des Glaubens an Jesus als die ,Ursünde‘ des kosmos zu bezeichnen. Die beginnt vielmehr bereits im Paradies und dann mit dem Haß Kains, der ek tou ponērou {von dem Bösen} war und seinen Bruder ,abschlachtete‘ (esphaxen ton adelphon autou: 1Joh 3,11f…).
Indem Thyen die Erwähnungen des Wortes hamartia im Johannesevangelium durchgeht, setzt er dessen übliche Übersetzung mit „Sünde“ voraus: Diese wird mit dem Ziel „der Erlösung des kosmos“ nach 1,29 von Jesus als dem „Lamm Gottes … beseitigt“, was in 5,14 und 20,23 konkretisiert und in 1. Johannes 3,5 aufgenommen wird. In den Kapiteln 8 und 9 erscheint hamartia mehrfach als Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern (8,21.24.34.46; 9,34.41). Der im letzteren Vers (T662) vertretenen Anklage Jesu gegen die Pharisäer: „Wenn ihr doch wenigstens blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Da ihr jetzt aber behauptet, wir sehen, bleibt eure Sünde bestehen“, stellt Thyen schließlich die „Aussage des scheidenden Jesus über die, die seine Jünger mit ihrem Haß verfolgen werden“ (15,22f.) gegenüber: „Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde, (denn) wer mich haßt, der haßt auch meinen Vater“:
Die problematische Differenz zu 9,41 liegt darin, daß jetzt nicht wie dort gesagt wird, die Sünde derer, die behaupten, Sehende zu sein, und Jesus dennoch verwerfen, bleibe an ihnen haften, sondern daß es hier heißt, sie hätten überhaupt keine Sünde (hamartian ouk eichosan), wenn Jesus nicht gekommen und zu ihnen geredet sowie seine Werke vor ihren Augen getan hätte. Das läßt sich kaum anders als so verstehen, „daß die Sünde der Welt erst nach dem Gekommensein Jesu und in ihrer Entscheidung gegen Jesu Wort und Werk definitiv geworden ist“. <1129> Weil aber mit dieser Entscheidung ja derjenige verworfen wird, der von Gott gesandt war, die Sünde der Welt zu beseitigen, kann das im Kontext unseres Evangeliums natürlich nicht heißen, daß die Sünde nicht schon vor Christus in der Welt gewesen wäre. So fährt Onuki ebd. denn auch fort: „Jesu Gekommensein und seine Zuwendung zur Welt setzen freilich ihre tatsächliche Verlorenheit einfach voraus“.
Anders als Onuki will Thyen „aus dieser isolierten Stelle“ allerdings nicht schließen, „daß für den Evangelisten die Sünde nicht schon in dieser Verlorenheit bestehe, sondern daß erst der Haß der Welt gegen Jesus und den göttlichen Liebesakt seiner Sendung ,Sünde‘ genannt werden könne“, was Stenger <1130> noch „schärfer formuliert“:
„Ohne dieses sein Kommen in Wort und Werk und ohne die damit gegebene Möglichkeit positiver wie negativer Stellungnahme gegenüber seiner Person gäbe es keine Sünde“.
Gegen Onuki und Stenger führt Thyen ins Feld, dass „für Johannes … der diabolos {Teufel} als archōn tou kosmou toutou {Fürst dieser Welt} schon ap‘ archēs {von Anfang an} ein anthrōpoktonos {Menschenmörder} (8,44; vgl. 1Joh 3,11ff)“ war, und dass „bereits Abraham, der derartige vom Haß inspirierte Werke nicht getan hat (8,40), … den Tag Jesu voller Freude gesehen (8,56)“ hat:
Sünde gibt es also nicht erst post Christum natum {nach der Geburt Christi} in der Welt, sondern bereits ap‘ archēs {von Anfang an}, so wahr das im Fleischgewordenen erschienene und Sünder von Gerechten scheidende Licht den Menschen immer schon leuchtete. Nicht „solange“ (heōs), sondern „Jedesmal (hotan), wenn ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt“, hatte Jesus seinen Jüngern erklärt (9,5; s. o. z.St.).
Etwas verspätet, aber durchaus passend zur Kritik an einer christlich verengten Definition von Sünde als Unglauben gegenüber Jesus lässt Thyen seine Auslegung von 16,9 mit einer „nachdenklichen Anmerkung“ von Ludger Schenke [307] zum in Joh 15,21-25 ausgedrückten angeblich grundlosen Hass jüdischer Kreise auf Jesus und seine Anhänger ausklingen:
„Der Text legt die Annahme nahe, daß der Autor und seine Leser wegen religiöser Auseinandersetzungen unter den Gewalttätigkeiten einer jüdischen Mehrheit zu leiden hatten. Dafür suchen sie nach Gründen und finden keine. Aber Vorsicht vor Verurteilung! Nur etwa 200 Jahre später werden sich die Verhältnisse umgekehrt haben und eine friedliche jüdische Minderheit wird durch eine staatlich protektionierte christliche Mehrheit bedrängt werden, Jahrhunderte lang mißachtet, verfolgt und fast ausgerottet sein. Deshalb dürfte sich das Urteil Jesu im JohEv längst gegen die ,Christen‘ gewendet haben und jetzt ihnen den Vorwurf grundlosen Gotteshasses entgegenhalten“.
Zur Auslegung von Vers 10 geht Thyen (T663) nochmals grundsätzlich auf die Verwendung des Wortes elenchein {Überführen} im Zusammenhang „mit Sünde, Gerechtigkeit und Gericht“ ein, wozu in seinen Augen „ein Doppeltes klar“ ist. Erstens ist diese Vorstellung „in der jüdischen Apokalyptik beheimatet“, was sich zum Beispiel im Judasbrief 14f. zeigt, demzufolge
Henoch prophezeit habe: „Siehe, es kommt der Herr mit seinen heiligen Myriaden, um über alle zu Gericht zu sitzen (poiesai krisin kata pantōn) und jeden Menschen wegen aller seiner gottlosen Werke anzuklagen“ (kai elenxai pasan psychēn peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn…). … Dieser feste apokalyptische Zusammenhang zeigt, daß im eschatologischen Gericht die Scheidung der Sünder von den Gerechten erfolgt. Darum müssen die Lexeme hamartia {Sünde} und dikaiosynē {Gerechtigkeit} auch in unserer Passage wohl der Bezeichnung dieser Alternative dienen. Auch die durch das Zeugnis des Parakleten heraufgeführte krisis {Gericht} scheidet also die Sünder von den Gerechten …
Zweitens aber zeigen Thyen zufolge „die drei hoti-Explikationen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, daß der Paraklet, was es um diese Trias ist, an Jesus und seinem Weg zum Vater erweisen wird.“
Konkret zu Vers 10 wendet sich Thyen gegen den Vorschlag von Hatch, <1131>
dikaiosynē {Gerechtigkeit} hier im Sinne des paulinischen Gedankens der gnadenhaften Rechtfertigung des Sünders zu begreifen, „wonach der Gläubige gerechtfertigt oder von seinen Sünden freigesprochen wird, indem Christus als sein Fürsprecher vor dem Vater im Himmel für ihn eintritt“.
Dagegen spricht schon, dass an keiner Stelle „im gesamten Corpus Iohanneum“ das „mit 39 Vorkommen im NT und zumal für die paulinische Theologie bezeichnende Verbum dikaioō {rechtfertigen} (25mal!)“ auftaucht, und auch von „den insgesamt 92 Vorkommen des Lexems“ dikaiosynē
im gesamten NT, davon 50 allein bei Paulus, finden sich in unserem Evangelium nur zwei, nämlich hier und in V. 8; dazu kommen noch drei für die Deutung unserer Passage gewichtige Vorkommen in 1Joh 2,29; 3,7 und 3,10. Ähnlich wie hier, wo dikaiosynē offensichtlich das Oppositum {Gegensatz} zu hamartia {Sünde} ist, wird das Adjektiv dikaios {gerecht} im 1Joh gebraucht, wo etwa von Kain gesagt wird: ta erga autou ponēra ēn, ta de tou adelphou autou dikaia {seine Werke waren böse, aber die seines Bruders gerecht} (3,12), wo Jesus im Sinne seiner Sündlosigkeit als der ,Gerechte‘ bezeichnet wird (1,9; 2,1.29; 3,7), und 3,7: ho poiōn tēn dikaiosynēn dikaios estin, kathōs ekeinos dikaios estin {Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist}.
Stattdessen verwendet „Johannes an Stellen, wo man das Lexem dikaiosynē erwartet, das Nomen alētheia {Wahrheit}“, etwa in 3,21; 4,23f.; 8,32.44; 14,6; 17,17.19; 18,37f., worauf Lindars <1132> hinweist. Aus all dem folgert Lindars treffend, dass hier „keine unmittelbare Abhängigkeit von Paulus“ vorliegt. Vielmehr haben „Paulus und Johannes den genannten apokayptischen Hintergrund je auf ihre Weise verarbeitet“. Überhaupt hält Thyen unter den (T664) vielen umstrittenen Interpretationen „der elenxis {Überführung} des Kosmos durch den Parakleten bezüglich Sünde, Gerechtigkeit und Gericht … diejenige von Lindars für die plausibelste“ und gibt sie folgendermaßen wieder (T663f.):
Seiner Meinung nach macht der Satz über die dikaiosynē {Gerechtigkeit} deutlich, daß es nicht das bloße Glauben an Jesus ist, das von den Sünden befreit, sondern, daß es darauf ankommt, was einer glaubt: „Es ist die Tatsache, dass Gott zum Heil der Menschen gehandelt hat (3,16), und dass der Glaube nicht nur eine intellektuelle Zustimmung ist, sondern dass man sich Gott anvertraut, eben weil er es getan hat“. Wie in den apokalyptischen Prätexten sieht Lindars dikaiosynē als das positive Gegenüber von hamartia {Sünde}, so daß nur derjenige sich im Gericht – d. h. hier: im elenchein {Überführen} des Parakleten – als Gerechter erweisen wird, der an die Vollendung des göttlichen Erlösungswerkes durch Jesu Hingehen zum Vater glaubt und diesen Glauben durch die ihm entsprechende Praxis sichtbar macht. Die Worte: kai ouketi theōreite me {und ihr mich nicht mehr seht}, deutet Lindars dementsprechend so: „d. h. ihr bleibt in der Welt, um diese Tatsache bekannt zu machen und sie so in das Leben der Menschen einzubringen. Denn in der Sendung der Jünger überführt der Paraklet die Welt, indem er die Herzen der Menschen dem Urteil aussetzt, das je nach ihrer Reaktion auf die eine oder andere Weise ausfällt“.
In seinen eigenen Worten fasst Thyen seine Interpretation von Vers 10 noch einmal so zusammen:
Da der kosmos nach Joh 14,17 den Geist der Wahrheit weder zu empfangen, noch zu sehen oder zu erkennen vermag, müssen es nach 15,27 die Jünger sein, die ihm Gestalt und Stimme verleihen, oder besser: in denen er sich sichtbar, hörbar und – da der geliebte Jünger ja einer aus ihrer Mitte ist – auch lesbar machen wird.
Dazu zitiert Thyen den oben von mir besprochenen Satz von Wengst (W450): „Jesu Schülerschaft, die ihn nicht mehr sieht, vertraut im Blick auf den im Evangelium erzählten Weg Jesu doch auf ,Gott …, der Recht und Gerechtigkeit schafft für alle Bedrängten‘ (Ps 103,6); und sie praktiziert selbst diese Gerechtigkeit im Halten des Vermächtnisses Jesu“, und kommentiert ihn mit dem dort seinerseits von Wengst zitierten Satz (T664):
„Ob sie diese Gerechtigkeit indes wirklich praktiziert, ist freilich eine andere Frage. Sicher ist nur, daß sie das tun sollte, weil allein daran erkannt werden kann, daß sie Jesu Jüngerschaft ist (13,35).“
In Vers 11 wird nach Thyen „der Paraklet den Kosmos auch darüber ins Bild setzen …, was es um das Gericht ist“, denn, wie
das Perfekt kekritai {ist gerichtet} zeigt, ist die definitive Verurteilung des Fürsten der Welt, die das elenchein {Überführen} des Parakleten ans Licht bringen wird, zwar in der Vergangenheit erfolgt, als Jesus durch seinen Tod hindurch zu seinem Vater ging, aber sie bleibt fortan das jede neue Gegenwart bestimmende Geschehen. lm Futurum hatte Jesus zuvor schon einmal erklärt: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt nach außen hinausgestoßen werden 12,31: nyn ho archōn tou kosmou toutou eblēthēsetai exō (s. o. z. St.). Und in 14,30 hatte er mit dem Nahen des Fürsten der Welt begründet, daß er vieles nicht mehr mit seinen Jüngern bereden könne (s. o. z. St.).
Auch an dieser Stelle zitiert Thyen zustimmend Wengst (W459) und geht wie dieser ohne weiteren Anhalt am Text davon aus, dass „der Beistand … dieses Gericht durch die Gemeinde aufdeckt…, indem sie sich in ihrem Verhalten von Unrecht und Gewalt nicht bestimmen lässt.“
Alles in allem entspricht Thyens Deutung der Verse 8-11 insofern ziemlich genau derjenigen von Wengst, als die „Welt“ durch das in der Praxis der Gerechtigkeit bewährte Zeugnis der Nachfolger Jesu ihrer Sünde überführt werden soll, die als Gegensatz zur göttlichen Gerechtigkeit zu verstehen ist und sich im Unglauben gegenüber Jesus manifestiert. Dabei scheint Thyen die „Welt“ als letzten Endes für dieses Zeugnis erreichbar anzusehen, sie ist, abgesehen von ihrem archōn {Fürsten, Herrscher} nicht einfach dem Gericht verfallen.
In Vers 12 sieht Thyen – wieder wie Wengst – den Beginn eines neuen Abschnitts, in dem nach der Klärung „über das richterliche Wirken des Parakleten der Welt gegenüber … nun die Explikation seiner Funktionen innerhalb der Jüngerschaft“ folgt. Merkwürdig ist aber, dass er den Satz: „Ich habe euch noch vieles zu sagen, doch das könnt ihr jetzt noch nicht ertragen“ als Einleitung des Folgenden betrachtet, obwohl er zugleich (T664f.), „[w]ie 14,30; 2Joh 12; 3Joh 13 zeigen, … die Wendung polla echō hymin legein {Vieles habe ich euch noch zu sagen}“ mit Dietzfelbinger [193] und Bultmann [441] als eine „konventionelle Abschlußformel“ betrachtet:
Das daran angeschlossene all‘ ou dynasthe bastazein arti {aber das könnt ihr jetzt noch nicht ertragen} liefert die Begründung dafür, daß Jesus jene polla {vielen Dinge} jetzt noch nicht sagen kann: Seine Jünger könnten sie in dieser Abschiedsstunde noch nicht ertragen (bastazein heißt im Alltagsgebrauch tragen, metaphorisch – wie hier – gelegentlich ertragen…
[3. Dezember 2022] Ton Veerkamp <1133> geht ganz anders an die Auslegung von Johannes 16,8-12 heran, schon allein, indem er entscheidende Begriffe anders als üblich definiert. Mit kosmos ist hier ihm zufolge eindeutig Rom als die herrschende „Weltordnung“ gemeint, allerdings steht nicht allein sie vor Gericht, sondern auch das rabbinische Judentum, das sich mit ihr arrangiert, und die messianische Gemeinde, die ihr zu widerstehen sucht. Die Worte hamartia und dikaiosynē sind von den jüdischen Schriften her als „Verirrung“ oder Abweichung von den Wegen der befreienden Tora bzw. als „Bewährung“ auf eben diesen Wegen zu begreifen. Veerkamps Übersetzung dieses Abschnitts sieht daher folgendermaßen aus:
16,8 Dieser kommt und klagt die Weltordnung an,
wegen der Verirrung,
wegen der Bewährung,
wegen des Gerichtsurteils.
16,9 Zwar was die Verirrung betrifft:
dass sie mir nicht vertraut haben;
16,10 aber was die Bewährung betrifft,
dass ich zum VATER hingehe
und ihr mich nicht mehr beobachten könnt;
16,11 und was das Gerichtsverfahren betrifft:
dass der Führer dieser Weltordnung abgeurteilt ist.
Vor der Beschäftigung mit diesen Versen hatte Veerkamp gesagt, dass der „Weggang des Messias“ deswegen „nützlich“ sei, weil der Weltordnung Roms nicht durch messianisch-zelotische Abenteuer beizukommen sei, sondern paradoxerweise nur „durch die Niederlage“ hindurch, nur durch Jesu Tod am Kreuz. Davon redet Jesus „der Treue entsprechend“ (tēn alētheian), also um der Treue des Gottes Israels in der Welt zum Durchbruch zu verhelfen, nämlich letzten Endes die Menschenwelt von der Weltordnung zu befreien, die auf ihr lastet. Mit seinem Tod wird Jesus seinen Schülern die Inspiration oder den Geist dieser Treue übergeben, wie aus 19,30 (paredōken to pneuma {er übergab den Geist}) und 20,22 hervorgeht (labete pneuma hagion {empfangt heilige Inspiration}). Dieser Geist, diese Inspiration, ist das einzige, was vom Messias bleiben wird:
„Messias kata pneuma {nach dem Geist}, Messias inspirationsgemäß“, sagt Johannes hier dem Paulus nach, was von Messias bleibt, sei die Inspiration. Der „Messias kata sarka {nach dem Fleisch}, Messias verwundbar in seiner menschlichen Existenz“, ist so nicht aufgehoben, denn am „Messias nach dem Fleisch“ hängt die Treue Gottes zu Israel, sagt Johannes in der Vorrede, 1,14. Man darf also den Ausdruck „nach dem Fleisch“ nicht vergessen, wenn es hier um das pneuma geht, den „Geist“.
Mit folgenden Worten macht Veerkamp nochmals deutlich, warum er diesen Geist, diesen Parakleten, diesen Anwalt „die Inspiration der Treue“ nennt:
Dieser Anwalt ist die Inspiration der Treue, das heißt: solange die Schüler der Vision der Treue Gottes zu Israel, also der Vision des Messias, treu bleiben, kann kein anderer kommen und ihnen etwas vormachen, etwa dass Rom eigentlich halb so wild sei, dass man auch das Positive an Rom sehen müsse, dass sich die Zeiten geändert haben und man sich ihnen anpassen solle.
Vers 8 beschreibt nun nach Veerkamp die Funktion, die der Paraklet gegenüber dem kosmos auszuüben hat:
Wozu die Inspiration? Ihre Aufgabe ist hier „anklagen“. Das Wort hinter dem griechischen elenchein ist das hebräische jakhach. Es hat einen Bedeutungsbereich von „argumentieren“ über „ermahnen“ bis „anklagen, zurückweisen“. Da es um ein Gerichtsverfahren geht, ist „anklagen“ angemessen. Angeklagt wird die Weltordnung, und zwar bezüglich der Verirrung, der Bewährung und des Gerichts(urteils). Und zwar stehen alle vor Gericht: das rabbinische Judentum, die messianische Gemeinde und die politische Führung der Weltordnung.
Wie Veerkamp in seiner Anm. 470 zur Übersetzung von Johannes 16,9-11 aus dem Jahr 2015 zu erklären versucht, ist in der Deutung der parallel aufgebauten Verse 9-11 deren „Konstruktion … über die Partikel men … de … de, ‚zwar …, aber …, aber‘“ zu beachten:
Verirrung ist die Negation der Bewährung. Das fehlende Vertrauen auf den Messias macht die endgültige Abrechnung mit der herrschenden Weltordnung zu einem Ding der Unmöglichkeit; das ist die eine Ebene des Konflikts. Die andere Ebene besteht darin, dass der Anwalt im Gericht die Schüler vertritt, indem er als Staatsanwalt gegen den Führer der Weltordnung auftritt. Die Schüler haben sich zu bewähren, weil der Messias nicht länger Element ihrer „Theorie“ sein kann (weil er weggeht); das Leben der messianischen Gemeinde ist das Leben ohne Messias und lebt nur noch aus der Inspiration der Treue, die vom VATER und vom Messias ausgeht (Verse 13-15), also aus der messianischen Inspiration. Schließlich wird sich die Bewährung des Messias im vernichtenden Urteil über Rom zeigen, vgl. Daniel 7,12. Man darf daher in der Übersetzung diese drei Partikel nicht unterschlagen. Diese Bewährung wird, im Gegensatz zur Verirrung der Peruschim und im Gegensatz zum Urteil des Gerichts über Rom, sozusagen „gerichtsnotorisch“. Sie ist die Aufhebung beider Konfliktebenen.
In seiner Johannesauslegung aus dem Jahr 2007 behandelt Veerkamp die dreifach ausgeführte Anklage gegen die Weltordnung mit ihren jeweils unterschiedlich akzentuierten Adressaten ausführlicher. Zunächst geht es in Vers 9, was ja auch Wengst und Thyen voraussetzen, um das rabbinische Judentum. Die Anklage bezieht sich aber nach Veerkamp nicht einfach auf den fehlenden Glauben an Jesus im religiösen Sinn, der in ethisch verwerflichen Taten zum Ausdruck kommt, sondern auf eine „Sünde“, hamartia, die in einer Abirrung vom Weg der befreienden Tora besteht, der in den Augen des Johannes zu seiner Zeit nur in der Nachfolge des Messias Jesus beschritten werden kann:
Erstens. Das rabbinische Judentum habe der messianischen Vision, wie sie in Jesus verkörpert ist, nicht vertraut. Eine Strategie des „sicheren Ortes“ ohne messianische Vision sei Kapitulation vor dem Satan, dem Feind, vor Rom. Das ist der politische Grundfehler, die hamartia, hebr. chataˀ.
Würden wir uns angewöhnen, diese Wörter endlich mit „Verirrung, Irrtum, irregeleitet sein“ zu übersetzen und nicht mit „Sünde“, wären wir den moralistischen Mief los, der sich mit „Sünde“ verbindet. Hamartia ist das Gegenteil des Lebensganges im Licht, der durch die messianische Vision aufgeklärt ist (11,9; 12,36). Chataˀ ist deshalb der Gang in die politisch falsche Richtung. Ob Johannes bzw. die Rabbinen recht haben, steht auf einem anderen Blatt, aber auf alle Fälle ist das mit hamartia gemeint.
Sollte Veerkamp damit allerdings einen radikalen Gegensatz zwischen hamartia als politischer Verirrung und persönlicher Verfehlung vertreten, dann würde er in meinen Augen über sein Ziel hinausschießen. In meinen Augen ist es gerade ein Markenzeichen der Tora wie der Propheten und nicht zuletzt der Psalmen, dass Aussagen über Religion und Politik, Kollektiv und Individuum in unlöslicher Verbindung miteinander stehen.
In Vers 10 geht es nach Veerkamp weder darum, dass Jesus trotz seiner Verurteilung durch die Mächtigen der Welt als der Gerechte dasteht, noch um das Problem der Rechtfertigung des Sünders oder darum, dass man sich im Gericht durch einen praktisch bewährten Glauben an Jesu als Gerechter erweist, sondern um die Problematik, die sich für die Anhänger Jesu durch seinen Weggang zum VATER ergibt:
Zweitens. Die messianische Gemeinde hat sich freilich gerade darin zu verantworten, dass sie sich nicht bewährt, weil sie sich und ihrer Umwelt den Weggang des Messias, und genau diesen Weggang, nicht erklären kann. Es ist die Haltung, die auch Lukas kennt: „Wir hatten so gehofft“, sagen seine Emmausschüler. Diese messianische Gemeinde hatte eine vorgefertigte Meinung über den Messias, seine politischen Wege, seine Aussichten, seinen absolut sicheren Sieg.
Spannend finde ich es nun, dass Veerkamp das griechische Wort theōrein, vom dem das deutsche Wort „Theorie“ abgeleitet ist, auf eine in der Johannesexegese ungewöhnliche Weise begreift, nämlich so, dass es darum geht, Jesus in einer bestimmten Weise zu beobachten, in Betracht zu ziehen, in ihre Hoffnungen einzubauen:
Die politischen Anschauungen dieser Leute fasst Johannes mit dem Wort theōrein zusammen. Fast alle Kommentatoren halten dieses Verb für ein Synonym für blepein, „sehen“. Aber es hat vielmehr mit dem zu tun, was wir „Theorie“ nennen, mit der Messiastheorie der Gemeinde. Der Weggang, gerade dieser Weggang, kam bei ihnen eigentlich nicht vor. Er hätte ihre gängige Messiastheorie (die christlichen Theologen nennen das Christologie) über den Haufen geworfen. Niederlage als Sieg? Absit! {Das sei ferne!} Es geht hier um die Antwort auf die Frage des Judas Nicht-Iskariot: wie steht es um die Wirkung des Messias auf die Weltordnung?
In einem solchen Zusammenhang ist nun von Belang, dass dass Wort dikaiosynē, wie ich oben in Anlehnung an Buber zu erläutern versucht habe, im biblischen Sprachgebrauch nicht einfach nur mit „Gerechtigkeit“ zu übersetzen ist, sondern auf einer übergreifenderen Ebene die Bedeutung der „Bewährung“ hat:
Dass sie nun mit ihren Theorien immer noch einem bestimmten Messiasbild verhaftet bleiben, zeigt, dass sie sich nicht bewähren: ouketi theōreite me, in eurer Theorie ist für mich eigentlich kein Platz. In dieser messianischen Gemeinde wäre keine dikaiosynē, „Bewährung“. Wie zentral diese Sache ist, zeigt der Abschnitt 16,16-22, wo es um „sehen“ und „in Betracht ziehen“ geht. Die Inspiration der Treue überführt die messianische Gemeinde, dass sie den alten zelotischen Messiasvorstellungen nachhängt und, nachdem diese sich zerschlagen hatten, sie diesen Messias („mich“) nicht länger „in Betracht ziehen“.
So gesehen wird im Zuge der Anklage des Anwalts gegen die Weltordnung nicht einfach, wie Wengst meint (W448) „die Welt ins Unrecht und die Gemeinde ins Recht“ gesetzt, sondern auch und gerade die messianische Gemeinde ist dazu aufgerufen, ihr Vertrauen auf einen scheinbar machtlosen und gescheiterten Messias im fortdauernden Widerstand der agapē gegen die Weltordnung zu bewähren.
Bei dem in Vers 11 erwähnten archōn tou kosmou {Herrscher, Fürst, Führer der Welt} geht es, wie Veerkamp bemerkt (Anm. 472), in allen ihm eingesehenen Kommentaren um „den ‚Teufel‘“, was in seinen Augen entweder gar nicht oder nicht überzeugend belegt wird. So schreibt beispielsweise
Siegfried Schulz <1134> … zu 16,11: „Nicht der Nazarener wurde am Kreuz von Jerusalem, also der Welt, und Rom gerichtet, sondern gerade in seinem Kreuzestod hat der vermeintlich Gerichtete und Gemordete über die Welt und ihren eigentlichen Herrscher, den Teufel, triumphiert.“ Die einfache Umkehrung wäre gewesen: nicht Rom habe den Messias, sondern der Messias habe Rom gerichtet. Aber die Teufelvorstellung ist seit Jahrhunderten so festgerostet, dass alle jenen eingebildeten Teufel sehen, aber natürlich niemals die faktische „weltliche Obrigkeit“, den einzig wahren leibhaften „Teufel“.
Veerkamp hatte bereits in seiner Auslegung von Johannes 8,44 klargestellt, dass die Worte diabolos oder satanas sich im Johannesevangelium eindeutig auf die römische Weltordnung bzw. ihren Kaiser als den Widersacher des Gottes Israels beziehen. In 16,11 kommt er zum dritten und letzten Mal in der Formulierung ho archōn tou kosmou zur Sprache:
Drittens. Rom, so macht die Inspiration der Treue klar, sei bereits abgeurteilt, kekritai, Perfekt. Der Führer dieser herrschenden Weltordnung hat keine Zukunft, das Urteil ist endgültig, es entspricht genau dem Urteil über Antiochos IV., jenes zehnte Horn des Monstrums des politischen Hellenismus (Daniel 7). Gerade die Niederlage – am Kreuz und im Jahr 70 – bestätigt das. An dieser Weltordnung und ihrem Kaiser ist nichts gut.
Das ist den Leuten schwer klarzumachen, vor allem, wenn diese Weltordnung vorerst weiter herrscht. Mehr als vier Jahrhunderte später formulierte der Nordafrikaner Augustinus <1135> in den zehn ersten Büchern seines Hauptwerkes eine prinzipielle Kritik an Rom (De Civitate Dei – Vom Staat Gottes, geschrieben zwischen 412 und 417). Inspiration der Treue bedeutet hier die Überzeugung: Mit Rom ist es vorbei. Gar nichts war mit Rom vorbei, seine große Zeit, 98-180, steht gerade bevor. Deswegen sind die Menschen um Johannes sehr skeptisch.
Gerade weil diese Skepsis nur allzu verständlich ist, muss sich nach Veerkamp der nächste Vers 12 genau auf das eben Gesagte beziehen und nicht als Einleitung auf die dann folgenden Verse bezogen werden:
Vieles wäre darüber zu sagen, meint Jesus, aber das ginge nicht. Jetzt, vor dem Weggang Jesu und vor der Ankunft der Inspiration der Treue, wäre das schwer zu verstehen. Auch danach nicht; deswegen schreibt Johannes sein Evangelium mit den Abschiedsreden und ihren verzweifelten Fragen. Dieser Satz bedeutet wohl, dass die Feststellungen des Theologen „Johannes“ noch lange nicht ausdiskutiert waren. Der Text ist ein einstweiliges Ergebnis laufender Auseinandersetzungen in der Gruppe. Aber das Grundsätzliche ist hier gesagt: Verirrung heißt: nicht vertrauen. Durchhalten, aber ohne messianisch-zelotische Illusionen, heißt Bewährung. Über Rom ist auf alle Fälle das letzte und entscheidende Wort gesprochen.
↑ Johannes 16,13-15: Die Trinität der Inspiration der Treue, die vom VATER ausgeht und im Messias Jesus Gestalt angenommen hat
16,13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in aller Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht aus sich selber reden;
sondern was er hören wird, das wird er reden,
und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
16,14 Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird er‘s nehmen und euch verkündigen.
16,15 Alles, was der Vater hat, das ist mein.
Darum habe ich gesagt:
Er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.
[4. Dezember 2022] Im ersten Teil von Vers 13 wird Klaus Wengst zufolge (W451) der Beistand, dessen überführendes Wirken in den vorigen Versen beschrieben wurde, wie „schon in 14,17 und 15,26 … als ‚die Geisteskraft der Wahrheit‘ bezeichnet“:
„Wenn aber jener kommt, die Geisteskraft der Wahrheit, wird er euch in alle(r) Wahrheit leiten.“ … Die Geisteskraft steht so bei, dass sie die Wirklichkeit Gottes als in Jesus präsent erschließt und seiner Treue vergewissert. „Wirklichkeit“ und „Treue“ sind Aspekte, die in dem hebräischen Wort emét mitschwingen, das hinter dem griechischen Wort alétheia („Wahrheit“) steht. Diese Geisteskraft wird die Gemeinde „in alle(r) Wahrheit“ leiten. An dieser Stelle ist in Hinsicht auf zwei Überlieferungsvarianten des griechischen Textes keine eindeutige Entscheidung möglich. Nach der einen Variante leitet die Geisteskraft „in der ganzen Wahrheit“. Sie bewahrt die Gemeinde sozusagen in dem Lebensraum, der durch die Wahrheit und Wirklichkeit der Präsenz Gottes in Jesus eröffnet und gegeben ist. Nach der anderen Variante leitet die Geisteskraft „in die ganze Wahrheit“. Damit würde der Aspekt akzentuiert, dass die Wahrheit und Wirklichkeit der Präsenz Gottes in Jesus je neu erschlossen werden muss und nur in solchem Erschließen jeweils „ganz“ wird. Daher kann es nicht zu einem „Besitzen“ der „ganzen Wahrheit“ kommen.
Zum Stichwort „Die ganze Wahrheit“ betont Wengst, dass „von Ostern her“ in Jesus „Gott ganz präsent ist“, was aber „nicht so verstanden werden … muss und darf …, dass er es ausschließlich in ihm sei.“ Denn Gott
ist „der wahrhaftige bzw. der treue Gott“, der seinem Volk „den Bund und die Barmherzigkeit bewahrt“ (Dtn 7,9). Zur „ganzen Wahrheit“ gehört es daher, dass Gott „sein Volk nicht verstoßen wird“ (Ps 94,14) und es auch „nicht verstoßen hat“ (Röm 11,2), sondern dass Israels Erwählung durch Gott unwiderruflich ist (Röm 9,4f.; 11,28f.).
Der zweite Teil von Vers 13 liefert die Begründung für den ersten, also dafür,
dass der Beistand „in alle(r) Wahrheit leitet“. „Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch das Kommende künden.“ Dieser Beistand ist kein freischwebender Geist, sondern er redet unter bestimmtem Bezug. Die Verkündigung der Gemeinde, die er wirkt, erfolgt im Rückgriff auf das, was Jesus gesagt, getan und erlitten hat. Vom Beistand werden hier in Relation zu Jesus dieselben Aussagen gemacht wie bisher im Evangelium von Jesus in Relation zu Gott.
Dazu verweist Wengst darauf (Anm. 154), dass der Beistand „nicht aus sich selbst“ redet, „wie es Jesus auch nicht tut: 7,17; 8,28; 12,49; 14,10“, und er „redet, was er hört, wie es auch Jesus tut: 3,32; 8,26.40.47; 15,15.“
Die Aussage im letzten Teil von Vers 13 in Bezug auf die Zukunft deutet Wengst so (W451):
Durch den Beistand wird Jesu Wirken so zum Zuge kommen, dass die Gemeinde die Herausforderungen dessen bestehen kann, was in ihrer Situation auf sie zukommt.
Nach Vers 14 (W452) wird so, wie „nach 13,31f. und 14,13 Gott durch Jesus verherrlicht wird“, nun Jesus durch den Beistand verherrlicht:
„Jener wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinen nehmen und euch künden wird.“ Die Grundbedeutung des hebräischen Verbs, das hinter dem griechischen Wort für „verherrlichen“ steht, ist „gewichtig sein“. Der Beistand gibt Jesus Gewicht, „verherrlicht“ ihn, indem er dessen Werk in der Verkündigung der Gemeinde je neu zum Zuge kommen lässt. Die geistgewirkte Verkündigung der Gemeinde besteht in der Aufnahme des Wirkens Jesu. Sie hat ihren „Text“ nicht in der eigenen Gegenwart. Die aber ist sehr wohl ihr „Kontext“. Das Johannesevangelium selbst ist ein beredtes Beispiel dafür, wie aus „Text“ und „Kontext“ ein neuer Text wird.
In Vers 15 bindet Jesus schließlich sein eigenes
Wirken an Gott zurück: „Alles, was der Vater hat, ist mein.“ Damit ist der Sache nach aufgenommen, was in 3,35 und 13,3 damit ausgesagt wurde, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Jesus soll nur darum Gewicht zukommen, weil in seinem Wirken Gott zum Zuge kommt. „Deshalb habe ich gesagt, dass er (der Beistand) von dem Meinen nimmt und euch künden wird.“
Obwohl Wengst in seiner Auslegung ausdrücklich auf die Treue Gottes gegenüber Israel und auf den hebräischen Hintergrund des Wortes „verherrlichen“ zu sprechen kommt, macht er in meinen Augen zu wenig deutlich, dass sich in den Augen des Johannes Gottes kavod {Herrlichkeit oder Ehre} gerade darin verwirklicht, dass Israel inmitten der Völker in Freiheit, Recht und Frieden leben kann.
Hartwig Thyen (T665) weist zu Vers 13 zunächst auf die Art und Weise hin, wie der Erzähler durch „das maskuline Demonstrativum ekeinos {jener} … das eher personal klingende ho paraklētos {der Beistand} von V. 7 auf[nimmt] und … so – im Spiel mit der Rede vom ,Geist der Wahrheit‘ als einem ,anderen Parakleten‘ (14,16f) – das folgende Neutrum to pneuma tēs alētheias {der Geist der Wahrheit} geschickt mit diesem Maskulinum“ verbindet:
Dadurch verleiht er dem pneuma die Personalität des Parakleten. Und wie er zu Eingang (14,16) den Geist der Wahrheit als ,einen anderen Parakleten‘ bezeichnet hatte, so kommt er in diesen letzten Worten über den jetzt ja bekannten Parakleten auf diesen Anfang zurück, indem er ihn wieder den ,Geist der Wahrheit‘ nennt.
Ein wenig problematisch erscheint mir hier die allzu starke Ausstattung des Parakleten mit einer personalen Identität, die an die Vorstellung von drei unterscheidbaren Personen einer Dreifaltigkeit erinnert, wie sie im Christentum später entwickelt wurde, während Johannes doch gerade eher die Übereinstimmung der Inspiration, die von Jesus bzw. seinem VATER ausgeht, mit den Worten Jesu selbst und der Treue des Gottes Israels betont.
Als „erste neue Information über diesen Geist“ erfahren wir, dass „er die Jünger in der ganzen Wahrheit führen wird: hodēgēsei hymas en tē alētheia pasē“. Thyen entscheidet sich für diese Lesart, obwohl die Mehrheit der Handschriften die Version „eis tēn alētheian pasan {in die ganze Wahrheit}“ bietet; da die „Angabe des Zieles solcher Weg-Führung durch eis aber geläufiger Sprachgebrauch und deshalb die Formulierung mit en die lectio difficilior {schwierigere Lesart} ist, wird man die letztere vorziehen“.
Das Wort hodēgein mit seiner Bedeutung der Führung auf einem Weg (hodos)
kommt bei Johannes nur hier vor und seine Konnotation mit alētheia {Wahrheit} verweist deutlich auf das egō-eimi-{ICH-BIN-}Wort von 14,6 zurück, durch das Jesus sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben prädiziert hatte. Jesus selbst ist der Weg, auf dem der Geist der Wahrheit seine Jünger führen und er ist die ganze Wahrheit in der er sie orientieren wird.
Wilhelm Michaelis <1136> hatte allerdings aus Psalmtexten wie LXX 24,5.9 oder 142,10 her, „wo hodēgein {führen} und didaskein {lehren} jeweils in synonymen Parallelismen stehen“, den Schluss gezogen,
daß hodēgein in Joh 16,13 nicht die Bedeutung von führen oder leiten, sondern vielmehr die von anleiten oder lehren (didaskein) habe. Er betrachtet diesen letzten der Paraklet-Texte darum als Reinterpretation von 14,26. Aber gerade weil Joh 14 u. E. tatsächlich der Prätext ist, der in Kapitel 16 reinterpretiert wird, sollte man die Beziehung zu 14,6 nicht übersehen und darum das ambivalente Lexem hodēgein nicht einseitig auf die Bedeutung des Lehrens festlegen. Gerade dadurch, daß Johannes hier nicht wie in 14,26 vom Lehren des Geistes, sondern von seinem hodēgein spricht, evoziert er, schwerlich absichtslos, die Metaphorik des Weges, den die Jünger zu gehen haben. Und wie in 16,1-3 deutlich wurde, wird das gewiß kein leichter und sicherer Weg sein, sondern ein Weg, auf dem die, die darauf unterwegs sind, ständiger Ermutigung und sicherer Führung bedürfen. Darum ist das Lexem hodēgein, das bei Johannes einzig hier vorkommt, „wohl sehr bewußt gewählt“, um auszudrücken, daß das Wirken des Geistes nicht die bloße Mitteilung dessen sein kann, was an Jesu Offenbarung etwa noch fehlte, sondern daß es ein offener Prozeß ist, der andauern wird bis zum Jüngsten Tage …
Weiter geht Thyen darauf ein (T666), dass „der Geist als dieser Führer auf dem Wege der Wahrheit nicht aus eigener Vollmacht reden, sondern nur das sagen“ wird, „was er jeweils hören wird“, wobei „zunächst wohl absichtsvoll offen gelassen“ ist, ob „der Geist diese Dinge vom Vater oder vom Sohn ,hören wird‘“.
Was aber meint Jesus mit den weiteren Worten: „kai ta erchomena anangelei hymin {und die künftigen Dinge wird er euch verkündigen}“? Nach Thyen ist das die Art und Weise, „wie der Geist die Jünger auf dem Wege in die ganze Wahrheit leiten wird“, und gewiss nicht ein Hinweis darauf, „daß der Geist den Jüngern nach und nach die ‚letzten apokalyptischen Höhepunkts der Weltgeschichte‘ erschließen werde, um sie so in Stand zu setzen, den göttlichen Erlösungsplan zu begreifen“, wie Carson <1137> meinte, „als müsse bei Johannes erst der Ostern verliehene Geist die synoptische apokalyptische Rede Jesu halten.“ Auch Thüsings <1138> Vorschlag, die künftigen Dinge, von denen hier die Rede ist, von „der im Kontext vorausgesetzten Situation des Abschieds Jesu her“ auf „Jesu Tod und Erhöhung“ zu beziehen“, ist nach Thyen „höchst unwahrscheinlich, weil der Geist doch erst nach diesen Ereignissen gesandt und verliehen werden wird“.
Für Strathmann <1139> dagegen ist es
„das einzig Natürliche“, bei der Offenbarung der künftigen Dinge „an die Gabe der urchristlichen Prophetie zu denken, wie sie in der Offenbarung des Johannes ihr mächtigstes Zeugnis hinterlassen hat“.
Mit Kragerud, <1140> der ganz ähnlich „als die treibende Kraft und den konkreten Hintergrund unseres Evangeliums den nachapostolischen Wanderprophetismus erweisen zu können“ meinte, setzt sich Thyen ausführlicher auseinander:
Namentlich in den Texten über den geliebten Jünger mit dessen charakteristischem Gegenüber zu Petrus sowie in denjenigen über den Parakleten sah er die Auseinandersetzung des johanneischen Wanderprophetentums, das die fiktionale Gestalt des geliebten Jüngers symbolisieren soll, mit dem „Amtschristentum der Großkirche“, das Petrus repäsentiere [113ff].
Dabei ist für Kragerud der „geliebte Jünger“ letztlich nicht ein „Individuum“, sondern „nichts anderes als der symbolische Repräsentant der wandernden Propheten des johanneischen Kreises [126ff]“, womit er, wie Thyen urteilt (T666f.), jedoch das
Geschriebensein des Evangeliums, das doch all jene vermeintliche Mündlichkeit der wandernden Propheten besiegelt, … zu Unrecht herunter[spielt]. Er macht stattdessen das Kollektiv eines „johanneischen Kreises“ zum Evangelisten, so daß Jesus am Ende nicht das literarische Werk Johannesevangelium, sondern eben diesen Kreis, der es selbst hervorgebracht haben soll, als das bleibende und notwendige Korrektiv der ,Großkirche‘ autorisiert hätte.
Solchen „Deutungsversuchen“ gegenüber (T667) kann Thyen unter Berufung auf Schnackenburg <1141> „nur mit kritischer Reserve“ begegnen:
Denn gerade die Texte über den Parakleten legen ja „den größten Nachdruck darauf, daß der Geist nur an das erinnert, was Jesus gesagt hat (14,26), daß er bei seinem Hineinführen in die ganze Wahrheit nicht von sich aus redet, sondern das, was er hört, kundtut (16,13). … So kann es auch unbefangen heißen: ,Und er wird euch das Zukünftige verkünden‘; wiederum soll das im Zuge der ganzen Aussage sicher keine Empfehlung für zukunftsdeutende Propheten sein. Im Spruch 15,26f werden die Jünger ausdrücklich deshalb als Zeugen beansprucht, weil sie ,von Anfang an‘ mit Jesus zusammen waren“.
Aus all dem zieht Thyen ganz im Sinne von Wengst den Schluss, dass die „,kommenden Dinge‘, die der Geist der Wahrheit den Jüngern von Fall zu Fall, und wenn es jeweils an der Zeit ist, kundtun wird, … die konkreten Hindernisse, Ängste und Probleme auf dem Weg“ sind, „den die Jünger in der Nachfolge ihres weggegangenen Herrn fortan gehen müssen.“ Zustimmend zitiert Thyen dazu Onuki, <1142> der treffend
dieses jeweils auf die Gemeinde Zukommende „durch die plurale Form von ta erchomena ausgedrückt [sieht]. Die nachösterliche Situation der Lesergemeinde bleibt inmitten der feindlichen Welt nicht immer ein und dieselbe, sondern verändert sich. Das vollendete Offenbarungswerk Jesu ist also doch insofern noch unvollendet, als es für die jeweils wechselnde Situation aktualisiert werden muß“. In diesem Sinne sind die erchomena die ,vielen Dinge‘ (polla), die Jesus noch zu sagen hat (V. 12), über die er in der Abschiedsstunde aber schweigt, weil seine Jünger sie jetzt noch nicht zu ertragen vermögen.
Anders als Wengst geht Thyen auf das in jedem der Verse 13-15 vorkommende Wort anangellein {verkünden} ein, das zuvor bereits in 4,25 und 5,15 verwendet worden war. In 4,25 hatte die (T668) „Samaritanerin“ vom Messias gesagt: „wenn der kommt, wird er uns alles offenbaren“, was, „ebenso wie in unseren Parakletsprüchen, deutlich den Klang der eschatologischen und definitiven Offenbarung“ hat, „die auch alle erchomena {kommenden Dinge} einschließt.“ Und wenn in 5,15 der von Jesus geheilte Gelähmte den Juden verkündete, „daß es Jesus gewesen sei, der ihn gesund gemacht habe“, dann wird man Thyen zufolge „den Geheilten gerade wegen des Gebrauchs des in unserem Evangelium derart ausgezeichneten Lexems anangellō als einen rechten Zeugen Jesu begreifen müssen, und nicht etwa als einen üblen Denunzianten.“
Zur Deutung der Verse 14 und 15 selbst beschränkt sich Thyen auf folgende knappe Worte:
Weil der Paraklet alles, was er Jesu Jüngern offenbaren wird, einschließlich der von Jesus bisher ungesagten kommenden Dinge, aus dem Jesu Eigenen nehmen wird (ek tou emou lēmpsetai), wird er ihn verherrlichen, und, von diesem Geist erfüllt, werden ihn auch seine Jünger verherrlichen. Und weil hier gilt: „Alles, was mein Vater hat, das ist (auch) das Meine“, wird so mit dem Sohn zugleich auch der Vater verherrlicht (V. 15).
Ton Veerkamp <1143> sieht in den Versen 13 bis 15 das angedeutet, was der christlichen Lehre von der Dreieinigkeit zu Grunde liegt. Diese ist in seinen Augen ganz und gar von der Treue des Gottes Israels her zu begreifen:
Wenn nun „jener“ (der Anwalt) kommt, „die Inspiration der Treue“, dann führt sie die Gruppe „den Weg entlang (hodēgēsei)“, und zwar „mit ganzer Treue“. Diese Treue, ˀemeth, alētheia, ist die Treue zu Israel. Sie führt die Gruppe auf den messianischen Weg. Sie redet nicht „von sich aus“. Ihre Rede hat die Ehre des Messias zum Ziel; das ist das Kommende. Was zum Messias gehört – und nur das -, wird sie annehmen und ankündigen. Und das, was zum VATER, zum Gott Israels, gehört, ist das, was zum Messias gehört. Die Inspiration lässt die Schüler nur das reden, was sie, die Inspiration, selber hört: nämlich die Treue Gottes zu Israel, und diese Treue nimmt, so Johannes, endgültig Gestalt im Messias Jesus an. VATER, Messias, Inspiration der Treue, das ist eine unverbrüchliche Einheit. Hier, und nur hier, liegt die Wurzel dessen, was das Christentum Trinität nennen wird.
In seiner Anm. 474 zur Übersetzung von Johannes 16,13 deutet Veerkamp das Verb hodēgein von den auch bei Thyen erwähnten Psalmen 25,5 und 142,10 her:
[O]ft ist hidrikh und nacha (griechisch hodēgein), „auf den Weg führen“ bzw. „leiten“, mit limad, „lehren“, verbunden. Die Inspiration macht die Tora und den Lebensgang (halakha) neu. Die Inspiration ist die Kunde (angelia) des Kommenden, und das Kommende ist die vom Messias Jesus kommende Weltzeit. Diese Inspiration vom Gott Israels und dem Messias her bindet beide Testamente, TeNaK und Evangelium, unlöslich zusammen. Die kirchliche Dogmatik meint eigentlich nichts anderes: „VATER (TeNaK) und SOHN (Evangelium), unlöslich verbunden im HEILIGEN GEIST.“
Zur Einheit der beiden Testamente der Bibel, auf die Veerkamp in dieser Weise im Jahr 2015 zu sprechen kommt, schreibt er bereits in seiner Johannesauslegung im Jahr 2007 (Anm. 476):
Was ist unter diesen Umständen die Einheit von VATER und SOHN und HEILIGEM GEIST? Dass die Schrift Israels nicht zufällig die Schrift der Ekklesia ist, versucht auch das Dogma von Nicäa klarzustellen. Aber die Einheit ist hier keine ontische, in der Wirklichkeit des Volkes Gottes vollzogene Einheit, sondern eine ontologische, eine mit den Seinskategorien der Wissenschaftssprache des Späthellenismus formulierte Einheit. Kein Jude von damals und heute, nicht einmal ein ketzerisches Kind Israels aus den Tagen der Kaiser Domitian oder Trajan, hätte so etwas je verstehen können. Unter den herrschenden Umständen des Kompromisses mit dem Ausbeutungssystem des Kolonats des neuen Imperiums (Konstantin und Nachfolger) war Besseres nicht möglich gewesen. Nicäa und Chalcedon waren das Beste, was die Kirche hätte beschließen können, um das Band mit Israel nicht auch theoretisch endgültig durchzuschneiden. Praktisch kam dabei heraus ein Tritheismus Vater, Sohn, Heiliger Geist, gar Tesseratheismus, zusätzlich die Theotokos Maria, und das Judentum musste ins Ghetto. Die „Trinität“ des 1. Johannesbriefes, „Wasser, Blut, Inspiration“ hatte eine andere Pointe. <1144>
Die von Johannes bezeugte Trinität läuft also nach Veerkamp noch nicht auf den Abschied vom Judentum und auf das Christentum als neue Religion hinaus:
Das heißt: es gibt kein neues Projekt Gottes. Der jüdische Philosoph Jakob Taubes <1145> sieht die Tendenz zu einem neuen Projekt, und zwar bei Paulus:
Es steht an für Paulus die Gründung und Legimitierung eines neuen Gottesvolkes. Das kommt Ihnen nach zweitausend Jahren Christentum nicht sehr dramatisch vor. Es ist aber der dramatischste Vorgang, den man sich vorstellen kann in einer jüdischen Seele.
Wenn Taubes Paulus richtig interpretiert, dann sind die Verse Johannes 16,13-15 eine direkte Polemik gegen Paulus, zumindest gegen das, was die messianisch-paulinischen Gemeinden aus Paulus‘ Theologie gemacht haben sollen. Gottes Treue zu ganz Israel setzt das Vertrauen dieses Israel dem Messias gegenüber voraus, denn „alles, was des VATERS ist, ist auch mein“. Diese Einheit ist das Hauptthema des ganzen Evangeliums, die Einheit mit dem Gott Israels. Das Projekt eines neuen Gottesvolkes trennt Johannes von Paulus. Sein Horizont ist kol jißraˀel, das ganze Israel, inklusive aller Ketzer und solcher „Bastarde“ wie der Leute aus Samaria. Das trennt ihn von Matthäus und dessen kol ha-gojim, alle Völker, auch wenn sie bei ihm die ganze Tora der Rabbinen <1146> lernen müssen (Matthäus 28,20). Deswegen hat die Gruppe um Johannes später, trotz offenbar schwerwiegender Bedenken, Simon Petrus als Hirten, also die Führung der Messianisten judäischer Herkunft, akzeptiert (Johannes 21). Lukas hat einen grandiosen Versuch unternommen, beide messianischen Richtungen („Petrus“ und „Paulus“) miteinander zu verknüpfen. Aber nirgends ist die physische Zugehörigkeit Jesu zu Israel („Fleisch“) so betont worden, wie es die Schule dieses Johannes tut.
Nochmals hämmert Ton Veerkamp uns ein, worin im Kern die johanneische Trinität besteht:
Die Inspiration redet nicht von sich selbst aus, sie ersinnt keine neue Geistreligion. Was sie hört, ist das Wort des Messias; „das kündigt sie an“. Das Wort des Messias ist das Wort des VATERS. Was also die Inspiration ankündigt, ist das Wort des VATERS, das auch das Wort des Messias ist. Das eine Wort ist der Gott Israels, der Messias Israels, die Inspiration des Messias Israels. Das ist die johanneische Trinität.
Was daher anzukündigen und zu verkündigen ist, ist die Einheit von VATER, Messias, Inspiration der Treue. Die Einheit hat ihren materiellen Vollzug in Israel, zugespitzt in jenem Sohn Israels, der als Messias Israels die exemplarische Konzentration seines Volkes ist. Sicherlich wird diese Inspiration dargestellt als etwas, das „hören wird“ und „das Kommende ankündigen“ wird, aber seine Wirkung ist wie „Pneuma“, wie Wind, wie Atemluft, wie eben Inspiration, die vom Gehörten ausgeht, und Inspiration, die ausgeht von dem, was kommt, die kommende Weltzeit (erchomena, ha-ba, ˁolam ha-baˀ, ho aiōn ho mellōn).
Damit verficht Veerkamp eine radikal auf die Veränderung dieser Welt gerichtete Deutung der johanneischen Lehre von den letzten Dingen (Eschatologie), die ganz und gar an den biblischen Verheißungen für das Volk Israel inmitten der Völker orientiert bleibt:
Das ist die Vision: dass alle Dinge ihrer wahren und gerechten Bestimmung entgegen gehen, dass nicht alles bleibt, wie es ist. Das Kommende ist das Neue, aber es ist nicht das andere, erst recht nicht die neue Religion. Angesichts der herrschenden Weltordnung, kosmos, ˁolam ha-se, ist die Inspiration der Treue zum Bund mit Israel der eigentliche Inhalt der Ankündigung. Aus dieser Inspiration des Gottes und dessen, der „wie Gott“ (hyios theou) ist, werden die Schüler und ihre Nachfolger leben.
In seiner Anm. 475 zur Übersetzung von Johannes 16,15 geht Veerkamp darauf ein, warum dieser „ganze Vers“ von einigen Handschriften weggelassen worden sein mag (zum Beispiel von P66 und dem Codex Sinaiticus):
16,15 (Alles was dem VATER gehört, ist auch mein;
deswegen sagte ich euch, was sie von mir empfängt,
wird sie euch ankündigen.)Freilich ist der Vers keine bloße Wiederholung. Diese Inspiration bringt nichts Neues; der Messias tut das Werk des Gottes Israels; diese Inspiration stiftet zu nichts anderem an als zur Wiederherstellung Israels. Der Vers dient der Erklärung von 16,14, weil manche schon früh mit dem „Heiligen Geist“ die Ankündigung einer neuen „historischen“ Epoche, einer neuen Religion, gesehen haben. Die Einheit VATER-MESSIAS-INSPIRATION ist die Einheit des ganzen Weges Israels, von der Genesis bis zur Chronik, und der Gang der messianischen Gemeinde unter der Weltordnung.
Am Rande beschäftigt sich Veerkamp auch noch (Anm. 479) mit dem „Streit zwischen den orthodoxen Kirchen und den Kirchen des Westens über das filioque {ob der Heilige Geist vom Vater und dem Sohn ausgeht oder nur vom Vater}“, der für uns „bizarr“ wirkt:
Bei Johannes ist der Streit schon längst entschieden. Die Inspiration („Geist“) geht vom Messias („Sohn“) aus; „alles, was zum VATER gehört, gehört zum Messias“, folglich geht die Inspiration von beiden aus: vom Messias und vom Gott. Friedrich-Wilhelm Marquardt zeigt den Belang des alten Streits sehr deutlich im zweiten Band seiner Christologie: „Der Heilige Geist weht ja nach östlicher Theologentradition nicht vom Sohn, nicht von Jesus zu uns her, sondern als direkte Gotteskraft vom ewigen Vater, die keiner geschichtlichen Vermittlung bedarf.“ <1147> Deswegen ist der Streit mit den orthodoxen Kirchen nicht ohne Belang – erst recht nicht für die Bekämpfung des Antijudaismus in ihrem Bereich.
Bestätigt sehe ich diese Einschätzung durch ein Gespräch mit dem Pfarrer einer russisch-orthodoxen Gemeinde, der mir einmal erklärte, dass ihr Ostertermin vor allem deswegen von unserem abweicht, weil man um jeden Preis verhindern will, dass er mit dem jüdischen Passafest zusammenfällt.
Abschließend hebt Veerkamp zur Auslegung der Verse 13 bis 15 wie Thyen die dreimalige Verwendung des Wortes anangellein hervor:
Und die Aufgabe der Inspiration der Treue ist, dies „anzukündigen, anzukündigen, anzukündigen (anangellein)“, dreimal! Wenn wir das zentrale Lehrstück des Christentums, das Dogma des drei-einigen Gottes, überhaupt noch durchdenken wollen, dann müssen wir bei dieser johanneischen Trinität anfangen.
↑ Johannes 16,16-19: Einem Augenblick der Nichtbeachtung Jesu steht ein Augenblick des Sehens Jesu gegenüber
16,16 Noch eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich nicht mehr sehen;
und abermals eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich sehen.
16,17 Da sprachen einige seiner Jünger untereinander:
Was bedeutet das, was er zu uns sagt:
Noch eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich nicht sehen;
und abermals eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich sehen;
und: Ich gehe zum Vater?
16,18 Da sprachen sie:
Was bedeutet das, was er sagt:
Noch eine kleine Weile?
Wir wissen nicht, was er redet.
16,19 Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten,
und sprach zu ihnen:
Danach fragt ihr euch untereinander,
dass ich gesagt habe:
Noch eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich nicht sehen;
und abermals eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich sehen?
[5. Dezember 2022] Vor der Auslegung des letzten Abschnitts von Kapitel 16 weist Klaus Wengst (W452) auf eine weitere Parallele der zweiten zur ersten Abschiedsrede hin:
In der ersten Abschiedsrede hat Jesus im Abschnitt 14,15-24 seiner Schülerschaft zunächst die Geisteskraft als Beistand verheißen und dann seine eigene künftige Anwesenheit in der Kraft und Gegenwart des Geistes angekündigt. So folgen nun auch hier nach den ausführlichen Darlegungen über den Beistand solche über ein Wiedersehen mit ihm.
In 14,19 hatte Jesus gesagt: „Noch eine kurze Zeit – und die Welt sieht mich nicht mehr“. Eben das sagt er nun in Vers 16,16 seinen Schülern:
„Eine kurze Zeit – und ihr seht mich nicht mehr.“ In 14,19 stand der Aussage, dass die Welt ihn nicht mehr sieht, unmittelbar die andere gegenüber: „Ihr aber seht mich.“ Das bleibt in Geltung und wird auch gleich gesagt werden. Aber zunächst verhält es sich mit den Schülern nicht anders als mit der Welt: Sie sehen Jesus nicht mehr, wenn und weil er tot ist.
Damit ist für Wengst klar (W452f.), dass die „‚kurze Zeit‘ … in der vorgestellten Situation“ auf „die knappe Zeitspanne bis zu Jesu Tod, weniger als ein Tag“, zu beziehen ist (W453):
Diese im Grunde schlichte Feststellung hat für die Schüler eine andere Bedeutung als für die Welt. Für die Welt ist Jesus mit seinem Tod erledigt; sie hat sich seiner entledigt und geht zu ihrer Tagesordnung über. Für seine Schüler ist sein Tod Anlass von Trauer – aber auch die Eröffnung eines neuen Anfangs. Das will Johannes seiner Leser- und Hörerschaft verdeutlichen. Er tut es zunächst mit der Feststellung, dass das Nicht-mehr-Sehen seitens der Schüler terminiert und also kein definitives ist: „Und wieder eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen.“ Auf die kurze Zeit bis zu Jesu Tod, nach der sie ihn – wie die Welt – nicht mehr sehen, folgt also eine weitere kurze Zeit, nach der sie ihn – anders als die Welt – wiederum sehen. Nach der Darstellung des Evangeliums muss damit, zumindest in einem ersten Aspekt, das Sehen Jesu gemeint sein, wie es die Geschichten über die österlichen Erscheinungen in Kap. 20 erzählen. Nur dann besteht eine Entsprechung hinsichtlich der jeweils genannten „kurzen Zeit“. Für diesen Bezug spricht weiter: Die bald folgende Ankündigung Jesu, dass seine Schüler sich freuen werden, findet sich in einer der Erscheinungsgeschichten aufgenommen (20,20).
Wengst betont allerdings, dass das „Sehen des Auferstandenen“ als Bezug des „erneuten Sehen[s] Jesu … nicht isoliert“ betrachtet werden darf. Auch „die Erscheinungsgeschichten selbst“ stehen ja „nicht für sich“, sondern haben „bedeutsame Folgen“:
Was Jesus jetzt hinsichtlich des „Nicht-mehr-Sehens“ und des „Wiedersehens“ ankündigt, zeigt die Erzählung von Mirjam aus Magdala. Sie sieht Jesus nicht mehr, nicht einmal seinen Leichnam, und weint am Grab (20,11; vgl. 16,20). Sie sieht ihn wieder, ohne es zunächst zu merken (20,14f.), und erkennt ihn erst, als sie von ihm mit Namen angesprochen wird (20,16; vgl. 10,3). Sie will sich zu ihm so verhalten, wie sie es vor seinem Tod gewohnt war. Aber genau das wird ihr verwehrt (20,17). Sie muss es lernen, loszulassen und die neue und andere Weise der Gegenwart Jesu wahrzunehmen, wie sie mit und seit Ostern gegeben ist. Das erneute „Sehen“ Jesu „kurze Zeit“ nach seinem Tod ist daher nicht auf die Osterzeugen beschränkt, sondern diese Ankündigung enthält als weitere Dimension auch die Wahrnahme Jesu in der Kraft des Geistes, so dass sich mit den in der Erzählung angesprochenen Schülern auch die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde als angeredet verstehen kann. Dazu soll es kommen, dass sie in ihren bedrängenden Erfahrungen die lebendige Stimme Jesu vernimmt und so ermutigt wird.
In Vers 17 ergreifen Jesu Schüler „in dieser zweiten Abschiedsrede“ zum ersten Mal das Wort, allerdings ohne ihn direkt anzusprechen. Vielmehr
sprechen „welche von seinen Schülern zueinander“. Wie „die Juden“ in 7,35f. und 8,22 wiederholen sie Jesu Aussage und bekunden dabei ihr Nichtverstehen: „Was ist das, was er zu uns sagt: ‚Eine kurze Zeit – und ihr seht mich nicht und wieder eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen‘?“ Über diese Wiederholung gehen sie noch hinaus und beziehen in die Frage, was es denn bedeute, auch die vorher in V. 10 (vgl. V. 5) gemachte Aussage Jesu ein: „Ich gehe zum Vater.“
Mit der Wiederaufnahme dieses Satzes erklärt Johannes „die Zusammengehörigkeit der beiden aus V. 16 zitierten Sätze“, die deswegen von den Schülern nicht verstanden werden, weil sie nicht begreifen, dass Jesu Gang „in den Tod“ sein Gang „zum Vater“ ist; er geht ja (W454) „in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert und deshalb den Tod nicht das letzte Wort über Jesus sein lässt.“
Mit einer „geradezu umständlichen Wiederholung“ stellt Johannes in Vers 18
die Ratlosigkeit der Schüler noch breiter dar: „Sie sagten also: ‚Was ist das, was er sagt, das: eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet.‘“ {Damit} … wird die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde angestoßen, ja gedrängt, die so betonte „kurze Zeit“ aus der Perspektive der in der Erzählung agierenden Schüler zu reflektieren. Sie wird dann erkennen, dass sie ja schon jenseits beider genannten „kurzen Zeiten“ lebt und dass es also darauf ankäme, in ihrer Zeit trotz aller und in allen widrigen Erfahrungen Jesus zu „sehen“, seine Gegenwart wahrzunehmen.
In Vers 19 wird noch ein drittes Mal „der Leser- und Hörerschaft des Evangeliums“ die Aussage Jesu über die kurzen Zeiten „zu bedenken gegeben“, indem nun „wieder Jesus selbst die Initiative“ ergreift:
Er „wusste, dass sie ihn fragen wollten, und sagte ihnen“. Die Schüler kommen also gar nicht erst dazu, Jesus zu fragen. Er weiß, dass sie es tun wollen, und antwortet ungefragt. Dabei spricht er zunächst noch einmal aus, was er selbst schon gesagt hat und seine Schüler wiederholt haben: „Darüber grübelt ihr miteinander, dass ich gesagt habe: ,Eine kurze Zeit – und ihr seht mich nicht und wieder eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen?“
Nach Wengst zeigt sich „in dem so breit dargestellten Nichtverstehen der Schüler …, dass es kein wirkliches Verstehen Jesu gibt abgesehen von seinem Tod am Kreuz und abgesehen vom Zeugnis seiner Auferweckung.“ Damit gibt er die vertraute christliche Deutung dieses Abschnitts wieder.
Hartwig Thyen (T669) erinnert daran, dass die „kleine Weile“ nicht erst in 14,19, sondern bereits in 7,33f. und 13,33 von Jesus thematisiert worden war. Dort hatte er zunächst den Juden und dann auch seinen Jüngern gesagt: „noch eine kleine Weile bin ich unter euch“, und: „wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht gelangen“:
Dem hatte er im folgenden Kapitel 14 noch hinzugefügt: „Noch eine kleine Weile, dann wird der Kosmos mich nicht mehr sehen, ihr dagegen werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr begreifen, daß ich in meinem Vater bin, so wie ihr in mir seid und ich in euch bin“ (14,19f). Dieses letztere Wort über die ,kleine Weile‘ wird nun in 16,16-19 reinterpretierend so präzisiert, daß aus der einen zwei ,kleine Weilen“ werden: die eine nämlich als die Zeit bis zu Jesu Hingang durch den Tod zu seinem Vater und die darauf folgende andere als die kurze Zeit bis zu seinem österlichen Wiedersehen mit den Jüngern …
Wie Wengst und seinerseits in zustimmendem Bezug auf Bauer <1148> bezieht Thyen also „das palin mikron {wiederum eine kleine Weile} ebenso wie das erchomai {ich werde kommen} von 14,18, das es reinterpretiert, auf Jesu österliches Erscheinen“ (T670):
Freilich hat Johannes dieses österliche Erscheinen Jesu nicht wie Lukas zeitlich auf die vierzig Tage bis zur Himmelfahrt limitiert und historisiert. Darum fügt Bauer dem eben Gesagten sogleich hinzu: „Damit ist aber auch jetzt wieder nicht alles gesagt. Denn 20-24 ist offenbar nicht an einen kurzen Tag der Wiedervereinigung gedacht, sondern an einen ewig dauernden Zustand der Freude … Ist die kurze Spanne der Trauer verflossen, so bleiben Jünger und Meister vereint“.
Demgegenüber mahnt Thyen jedoch zur Zurückhaltung, denn
wie die Offenbarung der erchomena {kommenden Dinge} durch den Parakleten ein bis zum Eschaton {Endzeit} währender Prozeß ist, so dürfte parallel dazu auch die Verwandlung der Traurigkeit der Jünger in vollkommene Freude ein unabgeschlossenes Prozeßgeschehen sein. Denn der Haß der Welt und die Verfolgung und damit die Anfechtung des Glaubens der Jünger dauern ja an bis zu dem Tage, da sie Gott sehen werden, wie er ist (1Joh 3,2). Darum ist da keine „kurze Spanne der Trauer“, die Ostern „verflossen“ wäre, sondern es gilt vielmehr auch nach Ostern: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (16,33).
Es gibt aber auch Exegeten, die sich fragen, was die Rede von der abermals kurzen Weile für „die potentiellen Leser des Evangeliums am Ende des ersten Jahrhunderts lange nach jenem Auferstehungstag und nach den Jüngern“ noch bedeuten könne, und die das palin mikron „auf die endzeitliche Parusie {Wiederkunft} Jesu beziehen und dem Evangelisten eine entsprechende Naherwartung unterstellen“. Thyen meint aber, dass dieses palin mikron „hinsichtlich seiner Dauer in dem mikron {kurze Weile} bis zur Kreuzigung Jesu seine Entsprechung haben muß“, sonst
wäre es ja mehr als nur Ironie, sondern purer Zynismus des Erzählers, wenn er am Ende des ersten Jahrhunderts und lange nach dem Tod (zumindest der meisten) seiner Jünger Jesus im Blick auf den Zeitpunkt seiner endzeitlichen Parusie von einem mikron sprechen ließe.
Da Thyen „den Prologsatz: ‚und wir sahen seine Herrlichkeit‘ und das ihm entsprechende Proömium {Vorrede} des 1Joh als gemeinchristliches Bekenntnis begreift“ und beides nicht „auf die Erfahrung der ersten Augenzeugen“ beschränkt, geht er davon aus, dass
die ja auch weiterhin unter Verfolgung und in Angst lebende Gemeinde die Begegnung mit ihrem auferstandenen Herrn … mit jeder Feier des achten Tages zugleich immer auch noch vor sich hat, wie der zweifelnde Thomas, ohne den und dessen Zweifel sie im Evangelium überhaupt nicht vorkäme (s. u. zu 20,24ff).
Alles in allem erklärt Thyen zufolge wohl schon „das Rätseln der Jünger“ über die kleine Weile, verbunden mit Jesu Weggang zum Vater und (T671)
Jesu ausdrückliche Qualifizierung seiner Rede als en paroimiais {in Rätselrede, in Bildern} gesagter (V. 25) … die Verwirrung auch der späteren Interpreten … Sie rührt ganz fraglos daher, daß Johannes hier Erfahrungen der österlichen Freude mit Elementen der eschatologischen Hoffnung auf die Parusie Jesu zu einer neuen Einheit verschmolzen hat, wie er ja auch die Begabung der Jünger mit dem Geist als Anbruch der neuen Schöpfung versteht (s.u. zu Joh 20,19ff).
Allerdings lehnt Thyen nachdrücklich die Vorstellung ab, dass „Johannes Karfreitag, Ostern, Pfingsten und die Parusie oder Jesus und den Parakleten einfach miteinander identifiziert hätte“. Gegen Bultmann <1149> betont er, dass die
österlichen Erscheinungen Jesu … sowenig wie die übrigen sēmeia {Zeichen} bloße und eigentlich überflüssige Zugeständnisse an die „Schwachheit der Jünger“ [sind], denen „die Erscheinung des Auferstandenen konzediert“ würde, obwohl es dessen „im Grunde nicht bedürfen“ sollte. Auch der These Bultmanns, <1150> „daß die von anderen als in die Zeit fallendes Ereignis erwartete Parusie“ von Johannes zwar nicht einfach geleugnet … oder gar zu einem Seelenvorgang, einem Erlebnis umgedeutet“ würde, sondern daß er seinem Leser vielmehr die Augen öffne, damit er begreife: „Die Parusie ist schon gewesen! Jene naive Teilung in eine erste und zweite Parusie, die wir anderswo finden, wird verworfen“, vermögen wir sowenig zuzustimmen wie seiner durch literarkritische Amputationen begründeten Konstruktion der johanneischen Eschatologie als einer rein präsentischen. Diese Kritik gilt auch Bultmanns Reduktion Jesu als des doch Fleisch gewordenen logos auf das bloße Daß seines Gekommenseins, seinem Kierkegaard entlehnten Reden vom weltlosen Augenblick, sowie von der Forderung und Entscheidung des Glaubens, Interpretamenten, für die der Text des Evangeliums keine zureichenden Gründe bietet. Und endlich bleibt uns Bultmanns Reden von der „Entweltlichung“ der Glaubenden solange höchst fragwürdig, als die solcher Entweltlichung notwendig korrespondierende neue Zuwendung der Glaubenden zum kosmos als Gottes Schöpfung und Spiegel seiner Herrlichkeit unbedacht bleibt, denn um dieser Erfahrung willen, wird Jesus doch bereits im Prolog unseres Evangeliums als der Schöpfungsmittler gepriesen …
Nicht zuletzt wegen „des intertextuellen Spiels unseres Evangelisten mit seinen synoptischen Prätexten“ werden die dort betonten und hier im Zusammenhang mit „der durch den Geist vermittelten Gegenwart des Erhöhten“ nur angedeuteten Züge „seines künftigen und weltöffentlichen Erscheinens in Herrlichkeit“ nicht etwa völlig gegenstandslos:
Ebenso wie die Erwählung der Ioudaioi {Juden} bestehen bleibt, weil von ihnen nach 4,22 doch die sōteria {Heil, Errettung} kommt, bleibt es auch dabei, daß Gott seinen Sohn gesandt hat, damit der kosmos – und nicht etwa nur eine kleine Gruppe dazu Prädestinierter – durch ihn erlöst werde (3,17). In diesem Sinne können wir Brown <1151> nur zustimmen, wenn er erklärt: „Wir finden keinen Hinweis darauf, dass die johanneische Theologie jemals die Hoffnung auf die endgültige Wiederkunft Jesu in sichtbarer Herrlichkeit aufgegeben hat, obwohl das Evangelium eindeutig mehr Gewicht auf all die eschatologischen Merkmale legt, die sich bereits im ersten Kommen Jesu verwirklicht haben. Die Frage ist nicht die nach der Gegenwart in und durch den Parakleten im Gegensatz zum Kommen Jesu in Herrlichkeit, sondern nach der relativen Bedeutung beider.“
Außerdem geht Thyen auf die ganz ähnlichen Vorstellungen von Paolo Ricca <1152> zum „Verhältnis zwischen Jesu erstem Kommen und dem traditionell seine Parusie Genannten“ ein. Da dieser (T671f.)
jedoch – anders als Brown – die bleibende Gegenwart des weggehenden Jesus bei den Seinen und in der Welt nicht durch diejenige des Parakleten ersetzt, sondern den Parakleten als einen allos {anderen} streng von Jesus unterscheidet, kann er Jesu Parusie {Wiederkunft} als einen einzigen Prozeß begreifen, der durch seine Inkarnation und die geistvermittelte Gegenwart des Erhöhten unter den Seinen eröffnet wurde, gleichwohl aber bis zu Jesu endgültigem und weltöffentlichem Erscheinen noch unvollendet ist.
Der „monologische Dialog oder dialogische Monolog Jesu“, mit dem Jesus in Vers 19 „auf Fragen der Jünger antwortet, über die sie“ in den Versen 17 und 18 „nur untereinander gerätselt und die sie ihm unmittelbar aber gar nicht gestellt haben“, bildet den „Übergang“ zu einer Phase der zweiten Abschiedsrede, in der wie „in dem hier reinterpretierten Kapitel 14 … jetzt nach dem rein monologischen Reden Jesu in 15,1-16,15 wieder dialogische Elemente“ erscheinen:
Jesus weiß, was sie bewegt hat, und kennt ihre unausgesprochene Bitte um eine Erklärung seiner rätselhaften Worte. Und dennoch läßt er den Kern ihrer Frage und ihres Nichtwissens (ouk oidamen: V. 18), was es nämlich um dieses siebenfach wiederholte mikron ist, im Dunkel des Rätsels. Als den Grund des Rätselns der Jünger (peri toutou zēteite met‘ allēlōn {darüber rätselt ihr untereinander}) wiederholt Jesus in V. 19 ausdrücklich sein ihnen unbegreifliches Wort (V. 16) von den beiden jeweils durch mikron bezeichneten kurzen Zeitspannen, nach deren erster sie ihn zunächst nicht mehr sehen werden (ouketi theōreite) um ihn dann aber nach einem weiteren mikron erneut zu sehen (kai palin mikron opsesthe me).
Auffällig ist, dass weder Wengst noch Thyen auf die Verben theōreō und horaō aufmerksam machen, die sie unterschiedslos mit „sehen“ übersetzen, obwohl durch sie der Blick auf die erste und zweite kurze Zeit jeweils unterschiedlich benannt wird.
Auch gehen beide mit keinem Wort auf den biblischen Hintergrund ein, vor dem das in den Versen 16 bis 19 siebenfach wiederholte Wort mikron zu begreifen ist, auf den Ton Veerkamp <1153> in seiner Anm. 480 zur Übersetzung von Johannes 16,16 aufmerksam macht:
Der Hintergrund ist Jesaja 54, das Lied rani, ˁaqara, „juble, Unfruchtbare“. Die Verse 54,7-8 haben den gleichen Duktus wie Johannes 16,16. „Einen kurzen Augenblick (regaˁ qaton, LXX: chronon mikron) habe ich dich verlassen, mit großer Erbarmung (be-rachamim gadol) hole ich dich zurück.“
Aber damit greife ich der Auslegung der Verse 16-19, wie Veerkamp sie im Zusammenhang mit den Versen 20-22 rückblickend entfaltet, vor. Als ihren Ausgangspunkt sieht er „das Problem der Schüler“, das in der „Zeit“ besteht:
Der Messias ist weggegangen, kommt der Messias noch, und wann? Johannes erklärt offenbar den Satz 14,19: „Noch ein wenig, und die Weltordnung wird mich nicht länger in Betracht ziehen, ihr aber zieht mich in Betracht, weil ich lebe und ihr leben werdet.“ Hier wird also das Gegenteil gesagt: „Ein wenig, und ihr zieht mich (wie die Weltordnung!) nicht in Betracht.“ Er nimmt den gerichtsnotorischen {vom Gericht amtlich zur Kenntnis genommenen} Vorwurf von 16,10 wieder auf und fängt mit einem Spruch an, den kein Mensch versteht.
Wie bereits in der Auslegung von Johannes 16,10 deutet Veerkamp das Verb theōrein also nicht als ein einfaches Sehen mit den Augen, sondern als die Beachtung des Messias, der gekreuzigt werden wird, in einer Theorie und Praxis seiner Nachfolge.
Im Hintergrund der folgenden Ausführungen schwingen persönliche Erfahrungen Ton Veerkamps mit, der als Sohn eines religionslosen Bauarbeiters und einer katholischen Mutter bis 1967 dem Jesuitenorden angehörte und geweihter Priester war:
In alten Zeiten wurde in der römisch-katholischen Liturgie am dritten Sonntag nach Ostern dieser Abschnitt gelesen, im Latein der Vulgata: modicum et iam non videbitis me et iterum modicum et videbitis: „Wenig, und ihr werdet mich nicht mehr sehen; wieder wenig, und ihr werdet mich sehen.“ Das ist Abrakadabra, und das liegt auch daran, dass die alten lateinischen Handschriften und auch Hieronymus hier schlecht übersetzt haben. Sie unterschlagen den Unterschied zwischen theōreite und opsesthe, zwischen „ihr werdet in Betracht ziehen“ und „ihr werdet sehen“.
Das Veerkamp die übliche Auslegung dieser geheimnisvollen Worte kennt, kann er sich die ironische Bemerkung nicht verkneifen, dass die „ganze Zunft der Kommentatoren“ darüber „natürlich Bescheid“ weiß. Als eine „Kostprobe“ zitiert er Ulrich Wilckens <1154> zu 16,16ff.:
Die Leser wissen natürlich beim ersten Mal, was mit der Aufeinanderfolge in „kurzem“ und „nochmals in kurzem“ gemeint ist: Auf Jesu Tod wird seine Auferstehung am dritten Tag (vgl. 1 Kor 15,9) folgen …“.
Dieser allzu einfachen Sichtweise bringt Veerkamp geballte Skepsis entgegen:
Johannes hätte hier, wie bei den Synoptikern, Jesus sagen lassen können: „Der Messias wird ausgeliefert, gekreuzigt, er stirbt. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen.“ Das tut Johannes nicht. Ostern und der Glaube an Ostern löst das Problem der Zeit nicht. Johannes lässt vielmehr den Spruch Jesu dreimal hören.
Auf der Ebene der Erzählung wissen die Schüler natürlich nicht, was in den kommenden Stunden und Tagen geschehen wird. Sie rätseln über das Wort. Aber warum muss Johannes einen ratlosen, rastlos diskutierenden Schülerkreis vorführen? Offenbar ist auf der Ebene des Textes, ein bis zwei Generationen Jahre später, das Problem akut. Rom hat gesiegt; es scheint das ewige Leben zu haben, weit und breit kein Messias zu sehen.
Den Schlüssel zum Verständnis der Worte, über die die Schüler Jesu ratlos und rastlos rätseln, findet Veerkamp im Rück- und Vorblick auf Worte Jesu am Anfang und Ende des Johannesevangeliums:
Es hieß nach dem Disput über den Abriss des Heiligtums in 2,22: „Als er nun von den Toten aufgerichtet wurde, gedachten die Schüler dessen, was er gesagt hatte, sie vertrauten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte“, und, am offenen Grab: „Freilich hatten sie noch kein Wissen von der Schriftstelle, nach der er von den Toten aufstehen müsse“, 20,9. Das heißt: die Unfähigkeit, das Wort „Ein wenig usw.“ zu verstehen, hat mit mangelndem Schriftverständnis zu tun (vgl. 12,16)!
Damit ist der Weg gebahnt, um mit Hilfe des Rückgriffs auf die Schrift – vor allem auf die schon erwähnte Stelle Jesaja 54,7-8 – einer angemessenen Auslegung des Wortes mikron näherzukommen. Dieses Unternehmen kann jedoch erst von den folgenden Versen 20-22 her im Rückblick gelingen.
Wichtig zum Verständnis der Verse 16-19 ist außerdem eine angemessene Interpretation des Wortes palin, das nach Veerkamp sowohl in den jüdischen Schriften wie im Johannesevangelium sehr unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann, wie er in seiner Anm. 481 zur Übersetzung von Johannes 16,16 ausführt:
Palin, „zurück, wiederum, dagegen“, 45mal bei Johannes. In der LXX steht das Wort für schuv, „wiederkehren“, verbunden mit einer Verbalform; selten aber für hosif mit einem Infinitiv oder für ˁod; letztere Worte geben eine Kontinuität wieder: „so und weiter“. In diesem Sinne verwendet Johannes das Wort auch, etwa 1,35; 4,3 usw. In anderen Fällen bedeutet es „dagegen“, 6,15; 16,28; dort steht die Diskontinuität im Vordergrund. Das gilt auch für 16,16ff. Die Geburt eines Kindes, die dem Schmerz ein Ende macht, ist keine Wiederholung und kein Wiedersehen, sondern etwas völlig Neues, deswegen „dagegen“.
Auch damit greift Veerkamp vor auf das folgende Bild der gebärenden Frau. Festzuhalten ist jedoch schon jetzt, dass in seinen Augen das palin mikron nicht einfach das bruchlose Wiedersehen Jesu nach seiner Auferstehung bezeichnen kann, was ja auch in Thyens Ausführungen zur noch ausstehenden endzeitlichen Wiederkunft Jesu angeklungen war.
Zur Einstimmung auf das folgende Bild der „Stunde der Frau“ sei Veerkamps eindrucksvolle Übersetzung der Verse 16-19 wiedergegeben:
16,16 Ein Augenblick, und ihr beachtet mich nicht mehr,
dagegen ein Augenblick, und ihr werdet mich sehen.“
16,17 Einige unter seinen Schülern sagten zueinander:
„Was soll das, was er uns sagt:
‚Ein Augenblick, und ihr beachtet mich nicht mehr,
dagegen ein Augenblick, und ihr werdet mich sehen‘;
und:
‚Ich gehe hin zum VATER‘.
16,18 Sie sagten also:
„Was soll dieses ‚ein Augenblick‘,
wir wissen nicht, was er redet!“
16,19 Jesus erkannte, dass sie ihn befragen wollten,
er sagte zu ihnen:
„Darüber forscht ihr untereinander nach, da ich sagte:
‚Ein Augenblick, und ihr beachtet mich nicht mehr,
und dagegen ein Augenblick, und ihr werdet mich sehen.‘
Schauen wir nun, wie Jesus mit diesem Rätseln seiner Schüler umgeht.
↑ Johannes 16,20-22: Die bleibende Freude der Schüler Jesu in der Stunde der Frau
16,20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Ihr werdet weinen und klagen,
aber die Welt wird sich freuen;
ihr werdet traurig sein,
doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden.
16,21 Eine Frau, wenn sie gebiert,
so hat sie Schmerzen,
denn ihre Stunde ist gekommen.
Wenn sie aber das Kind geboren hat,
denkt sie nicht mehr an die Angst
um der Freude willen,
dass ein Mensch zur Welt gekommen ist.
16,22 Auch ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
[6. Dezember 2022] Nach Klaus Wengst (W454) führt Jesus in Vers 20 „betont mit dem doppelten Amen eingeleitet“ seine „dreimal gemachte Aussage thetisch aus“:
Der Ankündigung, dass seine Schüler ihn nach kurzer Zeit nicht mehr sehen, entspricht hier zunächst: „Weinen und klagen werdet ihr.“ Innerhalb der Erzählung des Evangeliums wird das dargestellt, wenn Mirjam aus Magdala am Grab Jesu weint (20,11.13.15). Jesu Schülerschaft, die ihm gefolgt ist und auf ihn ihre Hoffnung gesetzt hat, sieht sich enttäuscht und allein gelassen. Der Tod Jesu scheint ein definitives Ende gesetzt zu haben. So bleibt ihr nur Weinen und Klagen. Das hat eine antithetische Entsprechung: „Die Welt aber wird sich freuen.“ Derselbe Grund – der als definitives Ende verstandene Tod Jesu – führt zu einer gegenteiligen Reaktion. Die Welt ist froh, einen unbequemen Mahner los zu sein, der ihr bezeugte, „dass ihre Taten böse sind“ (7,7). Diese Freude der Welt wird in der weiteren Erzählung des Evangeliums nicht dargestellt. In dem den Schülern angekündigten Weinen und Klagen dürfte die lesende und hörende Gemeinde sich selbst wiedergefunden haben.
Indem Jesus der variierten Aussage: „Ihr werdet traurig sein“ sodann den Satz: „Aber eure Trauer soll zur Freude werden“ gegenüberstellt, legt er „die Verheißung aus, dass seine Schüler ihn nach einer weiteren ‚kurzen Zeit‘ sehen werden“. Von dieser Freude wird (W455) in 20,20 die Rede sein:
Da heißt es von Jesu Schülern, die sich aus Furcht eingeschlossen hatten, dass sie „sich freuten, als sie den Herrn sahen“. Die Trauer der Gemeinde, ihr Weinen und Klagen rühren gewiss von den bedrängenden Erfahrungen her, denen sie ausgesetzt ist. Was aber die Trauer zur totalen macht, ist der Eindruck, dass es mit Jesus ganz und gar aus, dass er ein für alle Mal erledigt sei. Erweist sich aber dieser Eindruck als unzutreffend, wird Jesus als lebendig Gegenwärtiger wahrgenommen, bricht sich inmitten der Trauer und sie überwindend Freude Bahn.
Was Jesus in Vers 21 erläuternd dazu sagt: „Wenn eine Frau gebiert, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, erinnert sie sich nicht mehr der Bedrängnis aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist“, benennt Wengst als „ein eindrückliches Beispiel aus dem menschlichen Erfahrungsbereich“, das belegen soll: „Die Freude nach der Geburt lässt alle vorangehende Not vergessen.“ In diesem Zusammenhang erinnert Wengst daran (Anm. 157), dass „das Bild der unter Wehen gebärenden Frau … mehrfach in der jüdischen Bibel“ unter „dem Aspekt der Not begegnet“, etwa im Buch Jesaja 21,3; 26,17; 37,3, während der „Aspekt der Befreiung nach der Not … sich nicht auf der Bildebene“ findet, „aber in der Sache ausgesprochen“ wird in Hosea 13,13f. und Micha 4,9f. Nach Turid Karlsen Seim <1155> (W455) lässt „hier der Begriff ‚Stunde‘ …, obwohl er ‚kein geläufiger griechischer Ausdruck für den Geburtstermin‘ war, … an ‚die Stunde‘ als diejenige des Todes Jesu am Kreuz denken, die zugleich die Stunde seiner ‚Verherrlichung‘ ist.“
Weiter verweist Wengst (Anm. 158) auf eine „schöne weitergehende Interpretation“, die Ruben Zimmermann <1156> „aus dem bildlichen Vergleich“ gewinnt:
Der schwangeren Frau „bleibt trotz unmittelbarster Nähe Form und Gestalt ihres Kindes verborgen. Erst durch die, mehr noch nach der Geburt kann das Kind erkannt, d. h. von der Mutter gesehen werden. Erst jetzt kann eine soziale Beziehung entstehen und ausgebildet werden, in der zwei Individuen von Angesicht zu Angesicht in Kontakt zueinander gebracht werden. Die Schüler werden mit derselben Realität konfrontiert. Jesus war immer bei ihnen. Aber sie haben ihn nicht gesehen, wie er wirklich ist (Joh 14,9 […]). Erst beim Weggang und erst beim Schmerz der Trennung in der Stunde des Kreuzes können die Schüler Jesus wirklich kennen und erkennen. Das Abschneiden der ,Nabelschnur‘ physischen Zusammenlebens öffnet ihre Augen, den Christus zu sehen“.
Indem Jesus (W455) das Bild der Frau in Vers 22 „auf seine Schüler“ bezieht: „So seid auch ihr jetzt bekümmert“, spricht er mit diesem „Jetzt“ vom „Jetzt der Passion und des Todes Jesu“, das er in Vers 5 angesprochen hatte, also von der
Zeit, in der das Herz der Schüler von Trauer erfüllt ist (V. 6), weil sie noch nicht begriffen haben, was V. 7 gesagt ist, dass Jesu Weggang ihnen nützt. Die Zeit der Trauer wird also für die Schülerschaft Jesu auf die Zeit der Passion und des Todes Jesu befristet, die für die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde schon längst zurückliegt. Sie wird empfinden, dass ihre eigene Trauer dazu in Diskrepanz steht. Das soll sie auch. Und sie soll beim weiteren Lesen und Hören lernen, dass sie zwar Anlass zur Trauer hat, aber noch mehr und vor allem Grund zur Freude. So fährt Jesus fort: „Ich werde euch aber wiedersehen und ihr werdet euch von Herzen freuen.“
Dieser „zweite Satz“ (Anm. 160) stimmt in seiner wörtlichen Übersetzung: „Und euer Herz wird sich freuen“, genau mit einem Teil „einer Gottesrede an die in Jerusalem Wohnenden“ in Jesaja 66,14 überein: „Und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen.“
Aber mit welchem Recht (W456) fügt Jesus diesen Worten noch den Satz hinzu: „Und niemand nimmt euch eure Freude weg“? Wengst antwortet:
Niemand nimmt sie weg, weil sie ihnen niemand nehmen kann. Denn am Grund der Freude, dass sich Gott zum Gekreuzigten bekannt hat, dass es mit Jesus nicht ein definitives Ende genommen hat, kann niemand rütteln. Daher sind Trauer und Resignation der Gemeinde unzeitgemäß. Sie lebt nicht in der Stunde der Passion und des Todes Jesu, sondern von ihr. Daher ist ihr Signum österliche Freude.
In diesem Zusammenhang ist es auch von Belang, dass es „in der am Beginn des Abschnitts dreimal wiederholten Aussage“ hieß: „Ihr werdet mich sehen“, jetzt aber heißt es: „Ich werde euch sehen“:
Das Wiedersehen beruht nicht auf einer Aktion der Schülerschaft, beruht nicht etwa darauf, dass sie unbeirrt das Werk Jesu fortsetzte. Es geschieht von Jesus her, weil Gott ihn nicht dem Tod überlassen hat. Deshalb ist auch die Freude nicht auf Momente wie den in 20,20 erzählten beschränkt.
Hartwig Thyen (T672) gibt den feierlich eingeleiteten Vers 20 folgendermaßen wieder: „Amen, Amen ich sage euch: Ihr werdet weinen und wehklagen (klausete kai thrēnēsete), der kosmos aber wird sich freuen (charēsetai). Ihr werdet voller Trauer sein (lypēthēsesthe), aber eure Trauer soll in Freude verkehrt werden“, und erklärt die hier verwendeten Vokabeln klaiein und thrēnein unter Rückgriff auf die von Bultmann <1157> angeführten Bibelstellen Jeremia 22,10, 2. Samuel 1,17 und Johannes 11,31ff. als Elemente „der Totenklage“:
Mit dieser Ankündigung der Totenklage und der Trauer der Jünger, deren besonderes Profil darin besteht, daß ihrer Trauer über Jesu Tod die Freude der Welt über seine Beseitigung korrespondiert, wird das Rätsel um das erste mikron gelöst. Ob man deshalb freilich mit Bultmann die Alternative konstruieren darf, die lypē der Jünger sei „nicht die persönliche Trauer über den Verlust eines geliebten, über den Hingang eines großen Menschen“, sondern „vielmehr die Situation der Einsamkeit im kosmos, in der diejenigen stehen, die durch Jesus aus dem kosmos herausgerufen sind (17,16; 15,19)“, erscheint uns jedoch höchst fragwürdig. Denn einmal weist die der Totenklage entstammende Terminologie doch eindeutig auf die reale Trauer um den Tod eines geliebten Menschen. Zum anderen ist es doch die Trauer der Jünger über den Tod Jesu – und nicht etwa ihre Welteinsamkeit -, der die Freude der Welt über dieses Ende des vermeintlichen Gotteslästerers korrespondiert. Was Bultmann auseinanderreißt und einander alternativ entgegensetzt, ist vielmehr ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis. Als Ausdruck ihres Verbundenseins mit Jesus scheidet gerade ihr Klagen und Trauern die Jünger vom kosmos und seiner Pseudofreude und macht sie zu Einsamen und Verfolgten …
Auf den zweiten Teil von Vers 20 geht Thyen mit keinem Wort ein; Vers 21 betrachtet er als die Erläuterung seines Wortes
von Trauer und Wehklagen der Jünger und der ihr entsprechenden Freude des kosmos über seinen Tod durch das Rätselwort (paroimia) von der gebärenden Frau, deren Freude über die Geburt ihres Kindes sie den Schmerz und die Qual ihrer Wehen alsbald vergessen läßt.
Wie Wengst verweist auch Thyen dazu auf den „metaphorische[n] Gebrauch der Wehen der Schwangeren zur Beschreibung der Not des unterdrückten Volkes … im Alten Testament“, zum Beispiel in Jesaja 13,8f.; 26,16ff.; 37,3 (T673):
Im Anschluß an diese Metaphorik entstand der Ausdruck von den Wehen des Messias, der in der Apokalyptik nahezu zum terminus technicus für die Katastrophen geworden ist, die der verheißenen Geburt des Messias und seines messianischen Volkes vorausgehen müssen. Am nächsten steht unserer Passage wohl Jes 66,5ff: „Hört das Wort JHWHs, die ihr vor seinem Wort zittert: Wohl sagten eure Brüder, die euch hassen und euch um meines Namens willen geächtet haben: Soll JHWH doch seine Herrlichkeit offenbaren, damit wir Zeugen eurer Freude werden. Doch sie sollen zuschanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt. … Horch, JHWH zahlt seinen Feinden heim. Ehe sie noch kreißte, hat sie geboren; ehe noch Wehen über sie kamen, hat sie ein Kindlein zur Welt gebracht. Wer hat solches je gehört und jemals gesehen? Wird denn ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Wird ein Volk etwa auf einmal geboren? Kaum ist Zion in Wehen, da hat sie ihre Kinder schon geboren. Sollte ich denn durchbrechen, aber nicht geboren werden lassen, spricht JHWH? … Freu dich Jerusalem, jubelt über sie alle, die ihr sie liebt! Jubelt und frohlockt mit ihr, die ihr um ihretwillen getrauert habt“…
Zustimmend bezieht sich Thyen auf Lindars, <1158> der „unsere Passage wohl zu Recht als ein intertextuelles Spiel mit diesem Jesajatext“ begreift:
Er warnt vor einer allegorischen Ausschlachtung der Parabel von der Gebärenden und sieht deren Pointe wie die des jesajanischen Prätextes in dem plötzlichen Übergang der Bedrückung in unbeschreibliche Freude…
Auch in der Auslegung von Vers 22 lehnt sich Thyen an Lindars an:
Zu dem unerwarteten Subjektwechsel von dem: kai palin mikron kai opsesthe me {und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen} in V. 16 zu dem palin de opsomai hymas {aber wieder werde ich euch sehen} in V. 22 bemerkt Lindars, damit verfolge der Erzähler wohl die Intention, die Gedanken seiner Zuhörer/Leser von den Erscheinungen des Auferstandenen weg auf die bleibende Beziehung Jesu zu den Seinen zu richten, die er durch sein Sterben und Auferstehen gestiftet habe. Wie in der Thomaserzählung von 20,24ff wird damit die Initiative von demjenigen, der sein Sehen zur Bedingung seines Glaubenkönnens machen will, auf Jesus verlagert, der ihn sieht und sich ihm zeigt.
Zur „Verheißung, daß fortan niemand den Jüngern die durch dieses neue Sehen verursachte Freude rauben kann“, bemerkt Thyen, dass „das Präsens, wie oft bei Johannes, futurische Bedeutung“ hat und „zugleich der Qualifikation dieser Freude als einer unzerstörbaren Gabe“ dient.
Außerdem weist Thyen auf zwei Einsichten Onukis <1159> zu Vers 22 hin: Erstens muss „das zweite mikron auf die mit Ostern einsetzende neue Gegenwart des Erhöhten bezogen werden“, und zweitens ist mit der Einsicht, dass „niemand den Jüngern ihre Freude rauben könne“, vorausgesetzt, „daß der Gegensatz zwischen den Jüngern und der Welt eben auch an ,jenem Tage‘ fortdauern wird“.
Auffällig ist in den Auslegungen von Wengst und Thyen, dass sie zwar auf biblische Hintergründe des Bildes von der gebärenden Frau aufmerksam machen, aber unsere Passage bei Johannes in keinster Weise von diesen Hintergründen her näher beleuchten. Genau eine solche Auslegung des gesamten Abschnitts 16,16-22 von der Schrift her hatte Ton Veerkamp <1160> jedoch schon angekündigt, und er nähert sich ihr auf folgende Weise:
Bei Lukas muss Jesus den Emmausschülern die Schriften erklären, „beginnend bei Mose und bei allen Propheten übersetzt er ihnen, was in den Schriften über ihn [geschrieben worden] ist“, 24,27. Johannes lässt Jesus mit einer allgemeinen Ankündigung antworten, dass sich der Schmerz in Freude verwandeln wird.
Es scheint nun, dass Jesus ein nettes Beispiel anführt: Eine Frau hat große Schmerzen bei der Geburt ihres Kindes; wenn es dann da ist, vergisst sie ihren Schmerz. Ulrich Wilckens verweist mit Nestle-Aland auf Jesaja 26,17. Es geht tatsächlich um eine Situation, die der Situation der Schüler ähnlich ist: „EWIGER, unser Gott, unsere Baale spielen die Herrn, anders als Du“, 26,13. Dann aber heißt es, 26,17f.:
Wie eine Schwangere, nahe dem Gebären:
sie windet sich, schreit in ihren Wehen.
So sind wir geworden,
weg von deinem Antlitz, EWIGER!
Schwanger waren wir, in Krämpfen waren wir,
Wind haben wir geboren.
Befreiung wurde dem Land nicht getan,
nicht fielen die Siedler des Erdkreises …Jeder sieht, dass dieser Verweis unseren Abschnitt nicht erklärt; in Johannes 16 wird kein Wind, sondern ein Kind geboren!
Merkwürdig ist, dass auch Wengst und Thyen zwar auf diese und andere biblische Stellen aufmerksam machten, die nicht ganz genau zu unserer Johannes-Stelle passen, aber das Jesaja-Kapitel 54 außer Acht lassen, in dem nicht nur die Freude der ehemals Unfruchtbaren zum Ausdruck kommt, sondern auch der siebenfach wiederholte kleine Augenblick des Johannes seinen biblischen Ursprung hat:
Jesus antwortet vielmehr mit einem Midrasch des Liedes „Juble, Unfruchtbare (rani ˁaqara), Jesaja 54,1-17. In V.7f. heißt es:
Einen kleinen Augenblick (chronon mikron, regaˁ qaton) habe ich dich verlassen,
mit großem Erbarmen dich zurückgeholt;
Mit einer Flut an Wut verbarg ich mein Antlitz
einen Augenblick vor dir,
mit weltzeitlanger Zuneigung habe ich mich deiner erbarmt:
hat dein Auslöser, der NAME gesagt.Und das Lied hat so angefangen, 54,1f.:
Juble, Unfruchtbare, die du nicht geboren hast,
breche in Jubel aus, jauchze, die du nicht kreiste,
mehr sind die Söhne der Verödeten
als die Söhne der Baalsfrau,
hat der EWIGE gesagt.
Wenn Johannes mit seiner penetranten Wiederholung der Worte über den kurzen Augenblick auf diese Jesaja-Worte anspielt, die nicht nur Jesu Schüler offenbar vergessen oder niemals in den Blick genommen haben, ist es nicht verwunderlich, dass bis heute diese Verse weitgehend nur oberflächlich im Sinne einer baldigen Wiedersehensfreude der Jünger mit Jesus ausgelegt werden:
Die Gruppe versteht die Schrift nicht, deswegen können sie Johannes/Jesus nicht verstehen. Was nach der Niederlage gegen Rom und der Zerstörung des Ortes mit Israel geschieht, geschieht nicht das erste Mal. Das mikron von 16,16 ist der kleine Augenblick von Jesaja 54,7f. Die Geburt des Kindes der Schmerzensfrau, die ihren Schmerz in Freude verwandelt, ist die Wiederkehr Israels aus der Verödung der Verschleppung Babels.
Wie sind vor diesem Hintergrund die Worte Jesu vom nicht mehr in-Betracht-Ziehen und vom dann doch erneuten Sehen Jesu zu begreifen?
Und nun findet die entscheidende Umkehrung statt. Der Messias scheint durch seine Niederlage seine Rolle bei den Schülern ausgespielt zu haben, sie ziehen ihn nicht mehr in Betracht, die messianische Vision ist angesichts der massiven Tatsache der Machtverhältnisse so erdrückend, daß Messias zu einer albernen Vision wird (ouketi me theōreite {ihr werdet mich nicht mehr beachten, in Betracht ziehen}). Das wird „einen kleinen Augenblick“ („ein wenig“) dauern.
Dann aber werden sie sehen. Aber sehen können sie nur dann, wenn sie gesehen werden. Hier, 16,22, ändert sich die Syntax: aus dem Subjekt wird das Objekt, aus dem Objekt wird das Subjekt: „Um so mehr werde ich euch sehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird euch niemand wegnehmen.“
Abschließend weist Veerkamp zu Vers 22 auf die besondere Art hin, wie dieses Gesehenwerden durch den Messias nach der Ermordung Jesu am Kreuz Roms ein neues Sehen des Messias hervorrufen wird:
Die Schüler verabschieden nicht den Messias, sondern der Messias verabschiedet sich von den Schülern. Die Schüler werden den Messias nicht (mehr) beachten, sondern der Messias wird sie sehen, und dann werden sie ihn als den Herrn (kyrios) sehen: „Die Schülern freuten sich, als sie den Herrn sahen« (20,20), aber erst, nachdem ihnen die Wundmale an den Händen und an der Brust gezeigt wurden. Sie sehen, dass der Ermordete als Ermordeter der Herr ist, an der Stelle derer, die sich als Herren aufspielen. Aber das ist noch ein weiter Weg, wie wir am Beispiel des Thomas sehen werden.
Die dadurch hervorgerufene Freude bezieht sich also nicht auf die Wiederbelebung eines Verstorbenen oder auf die Hoffnung, ihn im Himmel wiederzusehen, sondern darauf, dass die herrschende Weltordnung mit der Ermordung des Messias jegliche Legitimität verloren hat. Es mag blauäugig erscheinen, im Tod Jesu am Kreuz in dieser Weise den Sieg über das römische Imperium besiegelt zu sehen und daraufhin den Anbruch der kommenden Weltzeit des Friedens in tätiger solidarischer Liebe zu erwarten, aber nach Veerkamp hat zumindest der Evangelist Johannes das so gesehen. Schon bald jedoch hat eine heidenchristlich dominierte Kirche seine Worte über die kleine Zeit nicht mehr verstanden und in ein Abrakadabra über eine ins Jenseits verlagerte Erlösung verwandelt.
↑ Johannes 16,23-28: Den VATER als Freund bitten im Namen dessen, der zu ihm zurückkehrt, in der Stunde des Redens ohne Bilder
16,23 Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen,
wird er‘s euch geben.
16,24 Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen.
Bittet, so werdet ihr empfangen,
auf dass eure Freude vollkommen sei.
16,25 Das habe ich euch in Bildern gesagt.
Es kommt die Stunde,
da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde,
sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater.
16,26 An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen.
Und ich sage euch nicht,
dass ich den Vater für euch bitten werde;
16,27 denn er selbst, der Vater, hat euch lieb,
weil ihr mich liebt
und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin.
16,28 Ich bin vom Vater ausgegangen
und in die Welt gekommen;
ich verlasse die Welt wieder
und gehe zum Vater.
[7. Dezember 2022] Für Klaus Wengst steht zweifellos fest (W456), dass Jesu Verheißung in Vers 23a: „An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen“, auf die „Zeit der Gemeinde bezogen“ ist:
„Jener Tag“ ist nicht nur der Ostertag, an dem die Schüler nach der Erzählung des Evangeliums Jesus in der Tat nichts fragen. Er umfasst auch die durch ihn eröffnete und begründete Zeit der Gemeinde, die vom Wirken der für die Endzeit angekündigten Geisteskraft bestimmt ist. Was die Schüler Jesus hatten fragen wollen, betraf den Sinn seines Weggangs. Darauf waren auch die Fragen bezogen, die in der ersten Abschiedsrede einzelne Schüler an Jesus stellten. Ist durch und seit Ostern der Weggang Jesu in seiner Bedeutung für diejenigen, die sich darauf einlassen, erschlossen, gibt es keine Fragen mehr an Jesus zu stellen. Dann versteht es sich von selbst, aus der Frucht seines Weggangs zu leben, ihn zu lieben im Halten der Gebote (14,15; 15,10) und in der Erfüllung seines Vermächtnisses, einander zu lieben (13,34f.).
Das bedeutet nach Wengst aber nicht, dass es überhaupt keine Fragen mehr zu stellen gibt. Mit Blank <1161> stellt er fest, (Anm. 161) dass
„Glaube zugleich fraglose Gewißheit im göttlichen Glaubensgrund [ist], und zugleich ‚fragwürdig‘ und in Frage gestellt durch das ,In-der-Welt-Sein des Glaubens‘. Insofern stellt der Glaube selbst dem Menschen immer neue Fragen. Ebenso stellen die menschlichen Lebens- und Welt-Erfahrungen, da sie sich fortgesetzt ändern, dem Glauben neue Fragen, denen er nicht ausweichen darf“.
Bereits die Verse 23b-24 (W456) machen deutlich, dass „keine allgemeine Fraglosigkeit angesagt ist“, denn in ihnen wird „die Notwendigkeit des Bittgebetes“ vorausgesetzt, von dem bereits in 14,13f. und 15,7.16 die Rede war:
„Was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen, sodass ihr von Freude erfüllt seid.“ Gegenüber den Stellen, an denen dieses Motiv vorher angeführt wurde, finden sich hier zwei Besonderheiten. Einmal betont Jesus ausdrücklich, dass seine Schüler bisher nicht in seinem Namen gebeten haben. „Bis jetzt“ ist Jesus seinen Weg noch nicht zu Ende gegangen. „Jetzt“ aber wird er „verherrlicht“, geht er in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert. Darauf können sie sich „von jetzt an“ berufen. Das Gebet „im Namen Jesu“ bezieht sich also auf Tod und Auferweckung Jesu, auf Gottes Leben schaffendes Handeln am gekreuzigten Jesus. Von daher bekommt es seine Ausrichtung und seine Gewissheit.
Als weitere Besonderheit erwähnt Wengst, „dass mit dem erhörungsgewissen Gebet das Motiv der Freude verbunden wird“. Wer den Vater im Namen Jesu bittet, wird Freude empfangen (W457):
In 15,11 stand dieses Motiv im Kontext des Haltens der Gebote und der Erfüllung des Vermächtnisses Jesu, einander zu lieben. Beides gehört zusammen. Sowohl das Bitten als auch das Handeln beziehen sich auf das Wirken Gottes in Tod und Auferweckung Jesu und lassen sich daran ausrichten. So kommt es zur Erfahrung von Leben und damit zur Freude.
Dazu zitiert Wengst „zwei rabbinische Traditionen“ <1162> als „sachliche Analogien“, wobei die eine „die vollkommene Freude in der Ausrichtung am Wort und Willen Gottes“ erblickt, während die andere „mit Bitten und Empfangen solidarisches Handeln“ verbindet:
„Wenn die Israeliten Recht und Gerechtigkeit tun, freut sich der Heilige, gesegnet er, über sie. […] So sprach der Heilige, gesegnet er, zu den Israeliten: ‚Meine Kinder, was für eine Freude gibt es für den Menschen in dieser Weltzeit? Allein an den Worten der Tora! Passt auf! Alle, die sich an Gold und Silber, an Edelsteinen und Perlen freuen, was ist ihre Freude daran nach der Stunde des Todes? Nach deiner Freude der Tod. Welchen Gewinn gibt es für all deine Freude? Ihr aber kommt und freut euch mit mir in vollkommener Freude, so wie ich mich über euch freue für immer und alle Zeit. Denn es ist gesagt (Jes 65,18): Freut euch und jubelt usw.‘“
„Und ein Gerechter schenkt und gibt (Ps 37,21). Das sind die Israeliten; denn sie essen und trinken und segnen. Resch Lakisch sprach: ,Du findest, dass der Gerechte, wenn ihm der Heilige, gesegnet er, gibt, was er für sich durch seine Hand erbittet, wiederum aus dem Seinen schenkt. Das ist, was geschrieben steht: Und ein Gerechter schenkt und gibt“.
Im Zusammenhang mit dem „Bitten im Namen Jesu, wobei die Zeit Jesu von der Zeit nach seinem Weggang unterschieden wurde“ fügt Jesus in Vers 25 „eine grundsätzliche Bemerkung über sein Reden“ ein:
Für dieses Reden gilt dieselbe Unterscheidung der Zeiten: „Das habe ich euch in Rätseln gesagt. Es kommt die Zeit, da ich nicht mehr in Rätseln zu euch sprechen, sondern euch offen über den Vater verkünden werde.“ Dass Jesus in Rätseln gesprochen hat, wird hier im Rückblick grundsätzlich formuliert. Es bezieht sich nicht nur auf die Bilder und Beispiele wie zuletzt in V. 21, sondern charakterisiert sein Reden als Ganzes. Alles Reden Jesu, wie Johannes es darstellte, ist ein Reden in Rätseln. Die kommende Zeit, die hier in den Blick genommen wird, ist keine andere als die, von der V. 23 als „jenem Tag“ sprach und V. 26 gleich wieder sprechen wird: die durch Ostern eröffnete und begründete Zeit der Gemeinde, die unter endzeitlichem Horizont steht.
Wenn Wengst mit diesem endzeitlichen Horizont den Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker in den Blick nimmt, den die auf den Messias Jesus vertrauende Gemeinde in solidarischer Praxis tätig erwartet, dann kommt diese Auslegung derjenigen von Veerkamp nahe.
Wengst betont zugleich, dass das
für diese Zeit angekündigte ‚offene‘ Reden Jesu … allerdings kein anderes [ist] als das Reden ‚in Rätseln‘, wie es im Evangelium steht. Es gibt kein anderes Reden Jesu als das im Evangelium dargestellte, das ja schon das kraft des Beistandes, kraft des Geistes der Wahrheit, wieder-holende Reden ist. Es bleibt auf der erzählten Ebene den Hörenden verschlossen. Die Frage ist, ob das auch auf der Ebene der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde gilt oder ob dieses Reden „in Rätseln“ den Blick öffnet für den in und durch Jesus handelnden Gott und so zur offenen Rede wird. Ob das Reden Jesu im Evangelium „in Rätseln“ oder „offen“ erfolgt, ist also Sache der Rezeption. Es wird „offen“, wo sozusagen das Osterlicht durchbricht und sich Vertrauen auf Gott einstellt, wie er hier wirkt.
Wengst zufolge erwartet Jesus, dass genau „das geschehen wird“, wie er es „wiederum am Thema des Bittens in seinem Namen“ in Vers 26a aufzeigt: „An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten.“ Er muss gar nicht mehr erwähnen (W458), „dass diesem Bitten Erfüllung widerfährt“, sondern betont in den Versen 26b-27,
dass er dafür nicht als Vermittler einzutreten braucht: „Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater um euretwillen fragen werde.“ Er begründet das damit, dass die auf ihn sich Berufenden direkten Zugang zu Gott haben: „Er selbst nämlich, der Vater, liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin.“ In der Sendung Jesu kommt Gott als der zum Zug, der die Welt liebt (3,16). Die sich darauf einlassen – eben das sind die Glaubenden und Jesus im Halten des von ihm Gebotenen Liebenden (14,15.21; 15,10) -, erfahren Gottes Liebe in der Erfüllung ihrer Bitten.
Indem Jesus in Vers 28 dazu weiter ausführt: „Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater“, hinterlässt er nach Barrett <1163> „ein vollständiges Summarium des christlichen Glaubens, wie es der Art des Joh(annesevangeliums) entspricht“. Nach Wengst ist jedoch auch hier
zu beachten, dass Rede „in Rätseln“ vorliegt, die erst noch als „offene“ Rede erschlossen werden muss und es nicht schon an sich selbst ist. Es ist ja nicht gemeint, dass ein Gottwesen vom Himmel gekommen und wieder dahin zurückgekehrt sei, nachdem es die Erde kurz berührt hat. Es geht vielmehr darum, im Handeln und Geschick Jesu mit seinem elenden Ausgang – und gerade dort – die Gegenwart und Wirksamkeit Gottes wahrzunehmen.
Auch nach Hartwig Thyen (T673) bezieht sich in Vers 23 die „üblicherweise auf das Eschaton verweisende Wendung ,an jenem Tage‘ (en ekeinē tē hēmera)“ wie „schon in 14,20“ auf (T673f.)
den Ostertag als den Zeitpunkt, durch den der Prozeß der Parusie Jesu, die in seinem weltöffentlichen Erscheinen am Jüngsten Tage gipfeln wird, eröffnet und in Kraft gesetzt wird … Darum sollte man zwischen dem österlichen Wiedersehen und dem traditionell ,Parusie‘ genannten Kommen Jesu keinen Gegensatz konstruieren…, sondern die Doppeldeutigkeit der Sprache als durchaus absichtsvoll begreifen.
Paolo Ricca <1164> übersieht Thyen zufolge (T674) in diesem Zusammenhang
das Phänomen der Intertextualität des Joh mit seinen synoptischen Prätexten. Aus dem Schweigen über das traditionelle Eschaton schließt er, „die Parusie (könne) eigentlich nur für die Kirche bedeutungsvoll sein“. Darum abstrahiere Joh „ständig von einer kosmologischen Eschatologie. … Jesus betet nicht für die Welt (17,9). Die doxa des endgeschichtlichen Jesus wird nicht klarer sein als die, die im historischen Jesus erschienen ist. Wenn die Augen der Welt sich vor jener Herrlichkeit nicht geöffnet haben, wie werden sie sich dann bei der Erscheinung der künftigen Herrlichkeit auftun? Wenn die Welt Jesus nicht sah und jetzt den Geist nicht sieht, wie wird sie dann Christus in seiner Wiederkunft sehen? Joh läßt diese verhängnisvolle Frage offen“. Dabei übersieht Ricca jedoch den ambivalenten Gebrauch des Lexems kosmos bei Joh. Denn natürlich betet Jesus nicht für einen kosmos, der die Seinen mit seinem Haß blutig verfolgt, sehr wohl aber bittet er den Vater insofern dennoch für die Welt, als er zu ihm betet: ou peri toutōn de erōtō monon, alla kai peri tōn pisteuontōn dia tou logou autōn eis eme, hina pantes hen ōsin ktl. {nicht nur für diese bitte ich, sondern ebenso für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit alle Eines seien…} (17,20f).
Das Wort erōtan muss nach Thyen in Vers 23 „ganz eindeutig mit fragen“ übersetzt werden, obwohl es in Vers 26 „als Synonym von aitein für das Beten erscheint“:
Denn nach der Frage, die die Jünger soeben bewegt hatte (V. 17f) – ohne daß sie es gewagt hätten, sie Jesus zu stellen -, und die Jesus ihnen dann förmlich aus dem Mund genommen und mit der Paroimie {Rätselrede} von der gebärenden Frau beantwortet hatte (V. 19ff), kann erōtan hier nur fragen heißen. Im Gegensatz zu dem in diesem Sinne ambivalenten Lexem erōtan wird das Beten bei Johannes durchgängig durch aitein ausgedrückt; vgl. nur die Passage 14,12-14, die hier ja ganz offenkundig reinterpretiert wird. Allein die Wiedergabe von kai en ekeinē hēmera eme ouk erōtēsete ouden durch „an jenem Tage werdet ihr mir keine Fragen mehr stellen“ vermeidet nicht nur den Widerspruch zu 14,12ff, dem hier vorausgesetzten Prätext, sondern sie lenkt den Blick der Angeredeten zugleich auf die ihnen verheißene Freude …
Wieder einmal folgt eine feierlich durch amēn amēn legō hymin {Amen, Amen, ich sage euch} eröffnete Erklärung Jesu, nämlich
daß nach seinem Weggang an die Stelle ihrer unmittelbaren Kommunikation mit ihm das Gebet zum Vater in seinem Namen treten wird, dessen Erhörtwerden sie gewiß sein dürfen. Wie sein Hingehen zum Vater die Bedingung dafür ist, daß der Paraklet erscheinen kann, damit er die Jünger in die ganze Wahrheit führe (16,13), so eröffnet Jesu Gang zu seinem Vater den Jüngern auch die Möglichkeit, sich nun mit ihren Bitten unmittelbar an den Vater zu wenden, der ihnen gewähren wird, um was auch immer sie ihn in Jesu Namen bitten werden (V. 24). Die neue Information besteht in der Wendung in meinem Namen. Denn ausdrücklich erklärt Jesus: „Bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten“, und im Spiel mit den synoptischen Prätexten vom Beten und der Erhörung des Gebets (Mt. 7,7f; Lk 11,9f) fügt er hinzu: aiteite kai lēmpsesthe, hina hē chara hymōn ē peplērōmenē {Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei} (V. 24) …
Jesu Wort in Vers 25 will Thyen zufolge wie schon „die Wendungen: tauta lelalēka ktl. {das habe ich gesagt} in 14,25…, 15,11 und … in 16,1 auf alles bezogen sein …, was Jesus im Evangelium bis dahin jeweils gesagt hat“. Neu ist demgegenüber jetzt, dass er (T675)
nun erklärt, das alles habe er seinen Jüngern en paroimiais (in verhüllter Rede) gesagt. Da aber nach 7,39 erst der Geist, dessen Erscheinen Jesu Verherrlichung im Tode und seinen Hingang zum Vater voraussetzt, alle Rätsel lösen und die ganze Wahrheit erschließen wird, müssen die genannten Wendungen in 14,25; 15,11 und 16,1 wohl auch die jetzt erst explizierte Näherbestimmung des Gesagten als Rätselrede (en paroimiais lelalēka) implizieren. Darum muß die kommende Stunde, da Jesus nicht mehr in Rätseln, sondern unverhüllt (parrhēsia) von seinem Vater künden wird (V. 25), die Stunde des Geistes sein…
Da in Vers 26 die „Wendung: en ekeinē tē hēmera {an jenem Tage} aus V. 23“ aufgenommen wird, kann „jene Stunde, bzw. jener Tag, nicht auf den Tag der endzeitlichen Parusie Jesu beschränkt werden“, vielmehr muss „dies die Stunde der Begabung der Jünger mit dem österlichen Geist sein“ (Verse 26-27):
„An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen beten und ich sage euch (ausdrücklich), daß ich den Vater nicht für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich liebt und glaubt, daß ich von Gott ausgegangen bin“. Zumal Jesus in 14,23 jedem, der ihn liebt und seine Gebote hält, verheißen hatte, daß er zusammen mit dem Vater zu ihm kommen und daß sie ihre Wohnung bei ihm errichten werden, müssen die Perfektformen eme pephilēkate {mich liebt} und pepisteukate {glaubt} im Deutschen sinngemäß durch präsentische Indikative wiedergegeben werden.
Zu Vers 28, mit dem „Jesus seine abschiedliche Rede“ beschließt, weist Thyen darauf hin, dass er „kunstvoll“ formuliert ist und dass „[n]eben dem Aorist exēlthon {ich ging aus}, der den historischen Anfang des irdischen Weges Jesu markiert, … das ihm folgende Perfekt elēlytha {ich bin gekommen} die bleibende Gegenwart des Weggehenden zur Sprache“ bringt. So gesehen geht es in Jesu Abschiedsreden gar nicht um einen definitiven Abschied, den Jesus von seinen Jüngern nimmt, vielmehr bleibt er in der Gestalt des Geistes bei ihnen gegenwärtig.
Ton Veerkamp <1165> geht etwas anders mit „jenem Tag“ um, auf den in Vers 23 Bezug genommen wird, und legt die Verse 23-24 folgendermaßen aus:
„An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen“, heißt es. An welchem Tag? Am Tag, an dem die Schüler erkennen werden, „dass ich mit meinem VATER bin und ihr mit mir und ich mit euch“, 14,20. Denn dann gibt es keine Distanz mehr zwischen dem Messias und seinen Schülern. Jetzt ist diese Distanz da (sie ziehen den Messias nicht in Betracht). Noch einmal die Versicherung: Der VATER wird geben, was die Schüler im Namen des Messias fragen werden. Und dann die Feststellung: „Bis heute habt ihr nicht in meinem Namen gefragt.“ Offenbar geschah die Gebetspraxis der Gruppe nicht im Namen des Messias. Um was hier gebetet werden soll, werden wir im Gebet des Messias hören.
Auf den Vers 25 geht Veerkamp nur ganz knapp und nur indirekt ein, indem er schreibt: „Jetzt kommt ‚offen‘ zur Sprache, was ‚an jenem Tag‘ sein wird. Fragen sind nicht mehr nötig.“ Anscheinend geht er davon aus, dass auch eine Rede in Bildern und Rätselworten nicht mehr notwendig ist, wenn die Schüler wahrgenommen und sich darauf eingelassen haben, dass es genau der am Kreuz ermordete Jesus ist, der die Weltordnung besiegt. Alle bildhafte und rätselhafte Rede Jesu im Johannesevangelium lief offenbar auf nicht anderes hinaus, als was in den Versen 26 und 27 von der Freundschaft mit Gott und vom Vertrauen auf den Messias ausgesagt wird:
16,26 An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten,
und ich sage euch nicht, dass ich den VATER euretwegen fragen werde,
16,27 der VATER selbst ist euch ein Freund,
weil ihr zu meinen Freunden geworden seid
und darauf vertraut habt, dass ich im Auftrag GOTTES gekommen bin.Dann werden sie im Namen des Messias bitten, und es bedarf keiner Intervention des Messias mehr: die Schüler werden dann nicht nur in der Solidarität, sondern in der Freundschaft Gottes sein: der VATER selbst ist ihnen ein Freund. Und er wird es sein, weil die Schüler die Freundschaft mit dem Messias und das Vertrauen in den Messias verwirklicht haben. Das bezeichnen die beiden Perfekta pephilēkate {seid zu Freunden geworden} und pepisteukate {habt vertraut}.
Zur Freundschaft mit Gott schreibt Veerkamp in seiner Anm. 482 zur Übersetzung von Johannes 16,27:
Da die Schüler nicht länger douloi, „Sklaven“, sondern philoi, „Freunde“, sind (Perfekt, vgl. 15,15), ist deutlich, dass die Solidarität Gottes mit Israel (agapē) gegenüber den Schülern als der Kerngruppe Israels auf eine neue Stufe gehoben wird, die der „Freundschaft“.
Der in Veerkamps Augen „unvermittelt“ angeschlossene nächste Satz ist so, wie er ihn auslegt, in seinen Konsequenzen von außerordentlicher Tragweite:
Der Messias ist ausgegangen vom VATER und in die Weltordnung hinein gekommen. Um so mehr verlässt er die Weltordnung und geht zum VATER. Die Bewegung, die Lebensbewegung des Messias, ist Weggang von Gott – was das Kommen in, ja, unter die Weltordnung wirklich ist. Das Verlassen der Weltordnung ist nicht nur einfach weggehen und die Weltordnung lassen, wie sie ist. Das Gegenteil werden wir im letzten Satz des Abschiedsgespräches hören, wiederum ein johanneisches Perfektum: nenikēka ton kosmon, ich habe die Weltordnung besiegt. Der Gang zum VATER ist die Verwandlung der Weltordnung. Solange diese Bewegung nicht vollendet ist – und sie ist mit der Auferstehung nicht vollendet -, ist der Gang zum Vater nicht vollendet. Das wird aber erst in der Begegnung mit Maria aus Magdala deutlich, 20,11-18.
In diesen Sätzen konzentriert Veerkamp das Hauptanliegen seines gesamten Wirkens als befreiungstheologischer Ausleger der Bibel und insbesondere des Johannesevangeliums: Nur wenn „die Welt anders“ <1166> wird, bleibt die Ehre des Gottes Israels gewahrt, indem sich sein befreiender und Recht schaffender NAME durchsetzt und das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker anbrechen lässt.
↑ Johannes 16,29-32: Trotz ihres Vertrauens werden die Schüler Jesus allein lassen
16,29 Sprechen zu ihm seine Jünger:
Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild.
16,30 Nun wissen wir,
dass du alle Dinge weißt
und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt.
Darum glauben wir,
dass du von Gott ausgegangen bist.
16,31 Jesus antwortete ihnen:
Jetzt glaubt ihr?
16,32 Siehe, es kommt die Stunde
und ist schon gekommen,
dass ihr zerstreut werdet,
ein jeder in das Seine,
und mich allein lasst.
Aber ich bin nicht allein,
denn der Vater ist bei mir.
[8. Dezember 2022] Dass, wie Klaus Wengst zum vorigen Vers 28 gesagt hat (W458), Jesu Rede insofern nur „in Rätseln“ vorliegt, als nur „im Handeln und Geschick Jesu mit seinem elenden Ausgang … die Gegenwart und Wirksamkeit Gottes wahrzunehmen“ ist, „machen im Folgenden die Reaktion der Schüler und die Kritik Jesu daran deutlich“. Zunächst kommen in den Versen 29-30 die Schüler zu Wort:
„Sieh doch! Jetzt redest du offen und sprichst keine Rätselrede.“ Indem Johannes die Schüler hier Jesus korrigieren lässt, weist er gleich zu Beginn ihrer Stellungnahme darauf hin, dass es einmal mehr eine nicht verstehende sein wird. Obwohl Jesus das offene Reden erst für die kommende Zeit angekündigt hat, meinen sie feststellen zu können, dass er es jetzt schon tue. Das stellt ihr dann geäußertes Wissen und Glauben von vornherein in ein schiefes Licht: „Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass jemand dich frage. Daher glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist.“ Formal gesehen, sagen die Schüler nichts Falsches und auch nichts Unzureichendes. Sie erschließen als ihr Wissen, was sich aus dem Reden Jesu ergibt, und wiederholen als ihren Glauben, was er gesagt hat. Aber das war ja ein Reden in Rätseln, das sich als offenes Reden erst von Ostern her erschließen kann.
Jesus stellt auf die Rede der Schüler hin in den Versen 31-32 ihren „unzeitigen und deshalb unangemessenen Glauben“ heraus:
Er fragt zunächst: „Schon jetzt glaubt ihr?“ Diese Infragestellung hat darin ihren Grund, dass der von den Schülern geäußerte Glaube noch nicht den Tod Jesu im Blick hat. Auf dieses „Noch nicht“ des Todes Jesu bezieht sich das fragende „Schon“.
Was Wengst genau mit einem „unzeitigen … Glauben“ meint, beantwortet er (Anm. 169) mit einem Zitat von Herbert Kohler: <1167>
„So verständlich ein Glaube an einen allwissenden und das heißt denn auch immer an einen allmächtigen Gott sein mag, er kommt zu früh, weil er die Stunde Jesu noch nicht in sich aufgenommen hat. Dieser Glaube ist unzeitgemäßer und damit zeitlos gültiger Glaube. Erst wenn der Tod Jesu am Kreuz in diesen Glauben kommt, kommt der Glaube zu seinem wahren Ursprung.“
In Jesu Ankündigung (W459) in Vers 32: „Passt auf! Es kommt die Zeit und ist gekommen, dass ihr euch zerstreut, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst“, zeigt sich, dass „sich die Frage nach dem Glauben an Jesus erst angesichts des Gekreuzigten stellt“, denn Wengst zufolge spielt Johannes „hier in Aufnahme von Sach 13,7 die Tradition von der Flucht der Schüler bei seiner Festnahme ein.“
Zwar ist es Wengst bewusst, dass nach der Darstellung des Johannes Jesus selbst „bei der Festnahme dafür“ sorgt, dass seine Schüler „unbehelligt bleiben. Aber Fakt ist auch hier, dass er ‚allein‘ bleibt und sie ‚weggehen‘ (18,8).“ Dabei kann die Formulierung (Anm. 171), dass „sie ‚jeder in das Seine‘ gehen, … bedeuten: ein jeder in seine Heimat.“ Dazu verweist er auf eine Formulierung von Josephus (Bell. 4, 5, 5) und auf 1. Makkabäer 6,54. Nach Johannes „bleiben die Schüler aber in Jerusalem. So mag die Wendung im übertragenen Sinn verstanden sein: „Jeder sucht seine eigene Sicherheit und kümmert sich nicht um Jesus“. <1168>
Genau darin zeigt sich die Fragwürdigkeit des in Johannes 16,30 abgelegten Glaubensbekenntnisses der Schüler Jesu:
Glaube ist nicht das Aufsagen eines Bekenntnisses – schon gar nicht, wenn es überhaupt nicht gefragt ist -, sondern das Bewähren des Bekenntnisses, sein „Bewahrheiten“ in den in der Nachfolge Jesu sich stellenden Herausforderungen. Warum der vorher behauptete Glaube der Schüler ungenügend ist, wird besonders deutlich, wenn Jesus der Ankündigung, dass sie ihn verlassen werden, die Versicherung folgen lässt: „Und doch bin ich nicht allein, weil der Vater bei mir ist.“ Gerade mit dem in den Tod gehenden Jesus, den die Schüler verlassen, ist Gott. Ihr Glaube ist ungenügend, weil er sich genau da von Jesus abwendet, wo Gott ganz und gar bei ihm ist.
Auch nach Hartwig Thyen (T675) zeigt sich in der letzten Einmischung der Jünger in Jesu Rede in den Versen 29-30, dass sie nicht begriffen haben, dass „alles Reden des lrdischen und nicht etwa nur spezielle ,Bildworte‘, wie zuletzt das von der gebärenden Frau, en paroimiais {in Rätselrede} erging, und daß Jesus erst in der Zeit des Geistes en parrhēsia {offen} zu ihnen reden wird“. Sie meinen stattdessen
aufgrund seiner letzten Worte von seinem Hingang zum Vater …, mit ihnen sei die verheißene ,Stunde‘ des Geistes bereits angebrochen, die Stunde, da er ihnen ,unverhüllt‘ (en parrhēsia) vom Vater künden und nicht mehr in Rätselworten (en paroimiais) zu ihnen reden werde.
Nach ihrem Bekenntnis: „Jetzt wissen wir, daß du alles weißt und es nicht nötig hast, daß einer dich fragt. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist!“, würde man nun die Fortsetzung erwarten (T675f.):
Darum brauchst du niemanden zu fragen. … Doch stattdessen heißt es hier: Du hast es nicht nötig, daß jemand dich frage! Bultmann <1169> erklärt dazu: „Du weißt schon voraus, was jeder dich fragen möchte – wie es ja gerade vorher durch V. 19 demonstriert war. Die Allwissenheit des Offenbarers ist also nicht als eine abstrakte Eigenschaft verstanden, sondern als sein Wissen, das sich den Seinen mitteilt“. Zugleich aber ist offenbar gemeint, daß es für die Jünger notwendig war, Jesus Fragen zu stellen, solange er stets in Rätselworten zu ihnen geredet hatte. Jetzt aber, da er ihnen vermeintlich ,frei heraus‘ (en parrhēsia) von seinem Vater kündet, besteht diese Notwendigkeit nicht mehr (wörtlich: hat er es nicht mehr nötig [ou chreian echeis]). Denn die Jünger wähnen sich bereits an jenem Tage, von dem Jesus gesagt hatte: kai en ekeinē hēmera eme ouk erōtēsete ouden {und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen} (V. 23).
Die Reaktion Jesu (T676) in Vers 31 „auf das vorzeitige Bekenntnis der Jünger mit der ironischen Gegenfrage: arti pisteuete? Ihr meint, jetzt schon glauben zu können?“ erinnert an die Art, „wie Jesus auf das Petrusbekenntnis mit dem Wort reagiert hatte, daß einer aus dem engen Kreis der Zwölf von ihm Erwählten ihn ausliefern werde (6,70f)“:
Und dem fügt er im Spiel mit Sach 13,7 und den synoptischen Prätexten (Mk 14,27; Mt 26,31… hinzu: „Siehe es kommt die Stunde, ja sie ist bereits angebrochen, daß ihr zerstreut werdet (hina skorpisthēte), ein jeder in sein Eigenes (eis ta idia), und mich allein lassen werdet. Allein bin ich freilich niemals, denn der Vater ist ja stets an meiner Seite“ (V. 32).
Zur „sogenannten Jüngerflucht nach Galiläa“, von der Johannes nichts weiß, vertritt Thyen die These, dass diese samt entsprechenden „galiläische[n] Erscheinungen“ des Auferstandenen ohnehin von Matthäus nur fälschlich „aus Mk 14,27 und 16,7 … erschlossen“ wurde, während „der ursprüngliche und absichtsvolle Schluß des Markusevangeliums“ in Markus 16,8 „dessen Leser zur Relektüre der in Galiläa beginnenden Jesuserzählung im Lichte der Auferstehung Jesu auffordert.“ Jedenfalls darf nach Thyen aus
der Wendung eis ta idia {in das Seine} … jene vermeintliche Flucht der Jünger und schon gar nicht deren Flucht ins ferne Galiläa erschlossen werden. Denn bei seiner Verhaftung im Garten offenbart er sich seinen Häschern mit seinem egō eimi {ICH BIN} und fordert zugleich den freien Abzug seiner Jünger: „Wenn ihr also mich sucht, dann laßt diese ziehen!“, was der Erzähler sogleich so kommentiert: „Damit das Wort, das er (17,12) gesprochen hatte, erfüllt werde: Ich habe keinen von denen, die du mir gegeben hast, verloren“ (18,8f). Die Jünger bleiben beieinander und der Auferstandene erscheint den ängstlich Versammelten in Jerusalem (Joh 20). Von diesem Kontext her muß eis ta idia deshalb primär nicht als Ortsveränderung begriffen werden, wie 1Makk 6,54: kai eskorpisthēsan hekastos eis ton topon autou {und sie wurden zerstreut und gingen jeder an seinen Ort}, sondern als das Komplement {Ergänzungsstück} des folgenden „und mich laßt ihr allein“. Daß die Jünger in der Stunde des Todes Jesu in das ihnen je Eigene hinein zerstreut werden, heißt, daß sie ihre Gemeinschaft mit Jesus und sein Liebesgebot preisgeben, daß jetzt jeder von ihnen sich selbst der Nächste ist. Die Verleugnung dieser Gemeinschaft durch Petrus, ihren Sprecher (18,15ff), und ihre Abwesenheit in der Stunde seiner Kreuzigung – mit der Ausnahme des Jüngers, den Jesus liebte – sind sprechende Beispiele solchen ,Zerstreutwerdens in das je Eigene‘.
Die Verse 29 bis 32 kommentiert Ton Veerkamp <1170> ganz knapp:
Die Schüler sagen, sie haben verstanden, Jesus habe alles offengelegt, keine Rätsel mehr. Jesus dämpft die Euphorie sofort. Die Stunde kommt, die Stunde der Bewährung. Und diese Bewährungsstunde bestehen sie nicht.
Worin genau diese Stunde der Bewährung aber besteht, darin stimmt Veerkamp nicht mit Wengst und Thyen überein, denn im Zusammenhang mit der Gefangennahme Jesu erwähnt Johannes keine allgemeine Flucht der Jünger:
Alle Kommentatoren denken an die Stunde der Gefangennahme. Aber diese Stunde ist nicht gemeint. Simon kämpft, zwei Schüler folgen der Polizeitruppe, die Jesus festgenommen hat. Der „geliebte Schüler“ steht unter dem Kreuz, in deutlicher Abweichung von der Passionserzählung der Synoptiker. Johannes vermeidet in der Erzählung der Festnahme anders als Matthäus und Markus den Hinweis auf Sacharja 13,7: „Schlage den Hirten, die Schafsherde wird auseinandergejagt.“
Nun taucht ein Rückbezug auf Sacharja 13,7 bei Johannes zwar nicht in der Erzählung der Gefangennahme Jesu auf, aber eben doch schon hier in Vers 32, nachdem die Schüler Jesu ein ähnlich vollmundiges Bekenntnis zu Jesu abgelegt haben wie Petrus in Johannes 6,68f. Veerkamp weist in seiner Anm. 484 zur Übersetzung von Johannes 16,32 darauf hin, dass das Wort „skorpisthēte, hebräisch nefozothem“ sich auf einen Vorgang bezieht, „der mit der Versprengung Israels (vgl. 11,52) zusammenhängt“ oder ihm gleichkommt. Von daher deutet er diese Stelle so:
An dieser Stelle verlässt Johannes die Ebene der Erzählung (fiction) und betritt die Ebene des Erzählers (reality). Gemeint ist die Stunde, in der die Gruppe auseinanderläuft, sie ist die Stunde, die Jesus vorhersagt und die am Schluss der Brotrede Element der Erzählung ist: „Deswegen gingen viele seiner Schüler weg, rückwärts, ihr Gang war nicht länger mit ihm“, 6,66. In dem Augenblick, wo sie ohne Synagoge sind, wiederholt sich die Tragödie der Trennung. Sie gaben ihre messianische Vision auf. „Den Messias allein lassen“ ist nichts anderes, als die messianische Vision aufgeben, und die Aufgabe der messianischen Vision geschieht nach Johannes in dem Augenblick, wo sie, vor die Entscheidung zwischen diesem Messias und der Synagoge gestellt, bei der Gruppe bleiben oder sich der Synagoge zuwenden.
Demgegenüber betont Jesus ausdrücklich:
Aber ich bin nicht allein,
weil der VATER mit mir ist.Noch einmal wird unterstrichen, dass die Einheit zwischen dem Gott Israels und dem Messias bleibt, die Sache des Messias ist die Sache Gottes, und die Sache Gottes bleibt Israel.
↑ Johannes 16,33: Der Friede des Messias und die Überwindung der Weltordnung
16,33 Dies habe ich mit euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.
[9. Dezember 2022] Das letzte (W459), was Klaus Wengst zufolge „Jesus seiner Schülerschaft in dieser zweiten Abschiedsrede zu sagen hat“, ist aber nicht seine „Kritik am unzeitigen Glauben“. Es folgt noch der programmatische Vers 33:
Am Schluss blickt er noch einmal zusammenfassend auf sein Reden zurück und gibt ihm ein Ziel: Seine Schülerschaft soll durch ihn Frieden gewinnen. Im Blick auf die angekündigten bedrängenden Erfahrungen, die er als ihre künftige Situation schlicht feststellt, spricht er ihr Mut zu und begründet diesen Mut in seinem Sieg über die Welt, den er ebenso schlicht feststellt.
Im Gegensatz „zu der vorher angekündigten Zerstreuung der Schüler ins je Eigene, zu ihrer Vereinzelung“, steht dabei das Ziel seines Friedens: „Das habe ich euch gesagt, auf dass ihr durch mich Frieden habt.“ Indem die Schüler „der in Jesu Tod vermachten Liebe Gottes trauen und sich an sein Vermächtnis halten, einander zu lieben“, überwinden sie ihre Vereinzelung: „Frieden wird sich einstellen in einer solidarischen und partizipatorischen Gemeinschaft.“
Diesen Frieden bestimmt Wengst näher (Anm. 172), indem er sich an Augustin und Schnackenburg anlehnt und von Bultmann <1171> abgrenzt. Augustin hatte gesagt:
„Wo aber Liebe ist, da ist Frieden“… Abgelehnt ist damit die stoische Bestimmung des Friedens als des Seelenfriedens des Einzelnen, der in seinem Innersten nicht von der äußeren Welt getroffen werden kann. Abgelehnt ist damit aber auch die individualistisch verengte Deutung Bultmanns, nach der Frieden „die ständig zu ergreifende Möglichkeit des gläubigen Existierens“ sei; er werde „wirklich nur im Vollzuge der gläubigen Existenz, die eben darin eschatologische Existenz ist, daß sie ständig die Welt überwindet und sich aus der schon gewonnenen Zukunft versteht“. Vgl. dagegen Schnackenburg, nach dem es „um den Lebensraum (geht), der den Jüngern in Christus erschlossen ist und in dem sie trotz aller Drangsal dieser Welt geborgen sind“.
Unmittelbar (W460) nach dieser Zielbestimmung „seines Redens“ erinnert Jesus mit seinen Worten: „In der Welt werdet ihr bedrängt“, an das, was „er in 15,18-16,4a angekündigt hat“, er „nimmt“ es „nicht zurück“:
Die Bedrängnis ist da; Jesu Schülerschaft bekommt sie zu spüren. Aber immer wieder schien auch auf und wird es gleich noch einmal, dass die Bedrängnis nicht die ganze und vor allem nicht die entscheidende Wirklichkeit ist. So kann auch die Trauer keine totale, sondern nur eine vorübergehende sein.
Hat Jesus in der ersten Abschiedsrede dazu gemahnt, sich nicht erschrecken zu lassen und nicht zu verzagen (14,1.27), so fordert er nun im Blick auf die Bedrängnis positiv dazu auf, Mut zu haben. Gegen alles, was dafür spricht zu resignieren, auch gegen alle vermeintlich guten Gründe, die gar für Feigheit angeführt werden könnten, ermutigt Jesus seine Schülerschaft, den Weg der Nachfolge bewusst zu gehen. Dass sie es kann, dafür trifft er eine abschließende Feststellung: „Ich habe die Welt besiegt.“
Wieder einmal fällt auf, dass Wengst zunächst völlig undefiniert lässt, was hier mit dem Stichwort kosmos, „Welt“, gemeint ist. Erst in der Beschreibung des Sieges Jesu, der „ein höchst eigenartiger Sieg“ ist, lässt er durchblicken, dass er hier weder an die jüdische Welt noch an die allgemeine Menschenwelt der Völker denkt, sondern an Menschen, die ihre Macht skrupellos einsetzen. Der Sieg Jesu ist nämlich
kein siegreiches Sich-Durchkämpfen, kein offenbarer Triumph. Er erfolgt im Unterliegen, in der Ohnmacht des Todes am Kreuz. In den Augen der Welt – der starken und mächtigen Welt, die, wie sich hier zeigt, über Leichen geht – ist es eine offensichtliche Niederlage. Dieser Sieg ist ein geglaubter Sieg, der darauf vertraut, dass Gott sich zu diesem Ohnmächtigen bekannte und damit Lebensgrund gibt jenseits der Siege und Sieger.
Obwohl Wengst zufolge (Anm. 173) Luthers „eingängige Übersetzung: ‚In der Welt habt ihr Angst‘ … einen hier nicht treffenden Akzent“ setzt, lässt er dennoch Luther <1172> das letzte Wort zur „Auslegung von 16,33“, indem er aus dessen „Predigt vom 1. August 1528“ folgenden Abschnitt zitiert:
„Es ist ein über die Maßen schöner Text, desgleichen sich kaum im Evangelium findet: alles, was Christus hat, schenkt er uns. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, er ist wider dich und du und die ganze Welt (sind ihm unterworfen). Aber das ist der Trost, daß du nicht in dir, sondern in mir einen Trost schöpfen sollst, daß du sagen magst: ob ich gleich überwunden werde, so ist doch Christus noch nicht überwunden, nicht erschossen von des Teufels Geschosse und von der Pest. Wer das kann, der hat den rechten Griff. Es steht da, daß die Welt oben liegen und dennoch überwunden werden soll. So ist‘s mit Christus geschehen: am Kreuz gestorben und verachtet, ist er unterlegen, hat all‘ seine Lehre und Werke verloren und hängt als ein verfluchter Bösewicht (am Kreuz). Heißt das obgelegen? Dennoch obsiegt er. Eben darin, daß er in Nöten steckt, überwindet er. […] Das ist der christliche Glaube, der sich aus sich selber in Christus schwingen kann. Wenn das geschieht, folgt der Trost. Wer das nicht erfährt, begreift‘s nicht, wie süß und treffend diese Worte sind“.
Nach Hartwig Thyen (T677f.) beschließt Johannes 16,33
Jesu abschiedliches Reden zu seinen Jüngern endlich mit dem triumphierenden Satz: „Das (alles) sage ich euch (tauta lelalēka hymin), damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt dagegen habt ihr Angst. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt besiegt (egō nenikēka ton kosmon)“. Unwiderlegbar erhebt in diesem Satz der bereits zu seinem Vater erhöhte Sieger seine Stimme.
Von Gail O‘Day <1173> übernimmt Thyen die treffende Beobachtung (T678)
daß das mehr und anderes ist als eine simple Prolepse, die als eine temporale Figur lediglich die Zeitfolge des Erzählten überspränge: „Johannes 16,33 ist mehr als (oder etwas anderes als) proleptisch, weil es den Moment des Sieges nicht vorwegnimmt oder voraussieht. Es bringt nicht die erzählte Gegenwart in die Zukunft, sondern bringt die Zukunft in die erzählte Gegenwart. Dies unterscheidet sich von der Überschneidung zwischen der von Jesus vorausgesehenen Zukunft und der gegenwärtigen Erfahrung der johanneischen Gemeinschaft (Culpepper, Anatomie 37). Es wird eine zeitliche Verbindung zwischen der Erzählung und der Erfahrung des Lesers hergestellt, aber sie wird dadurch hergestellt, dass die Erzählgegenwart verändert wird, und nicht einfach durch die Verwendung der zukünftigen Zeitform, um auf die Gegenwart des Lesers hinzuweisen. … Johannes 16,33 macht die Kategorien der Prolepsis, der Antizipation und der Retrospektion im Grunde genommen unbrauchbar, weil es seine eigene zeitliche Ordnung aufstellt. Die zeitlichen Kategorien der Abschiedsrede vermitteln ihre zentrale theologische Überzeugung: Die Zukunft ist gesichert, weil der Sieg bereits errungen ist“.
Weiter macht Thyen darauf aufmerksam, dass der in 14,30 von Jesus angekündigte „Sieg über den Fürsten dieser Welt bzw. den ponēros {den Bösen}“ hier in 16,33 als gleichbedeutend mit „dem Sieg über den kosmos“ erwiesen wird. Indem Thyen den archōn des kosmos zugleich als den „Fürsten dieser Welt“ und als den ponēros bestimmt, setzt er eine Sicht des kosmos voraus, die ihn als Herrschaftsbereich einer gegen Gott gerichteten dämonisch-diabolisch-satanischen Macht begreift. Ein ähnlicher Wechsel
findet sich auch in 1Joh 2,13f und 5,4. Dort wird freilich nicht von Jesus, sondern von den Glaubenden gesagt: Ihr habt den Bösen besiegt (nenikēkate ton ponēron) und: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt besiegt hat (hautē estin hē nikē hē nikēsasa ton kosmon, hē pistis hēmōn). Statt vom Glauben der Jünger ist hier demgegenüber von ihrem In-Sein in Jesus die Rede: Inmitten der euch ängstigenden Welt (vgl. 15,18-16,3) habt ihr in mir Frieden. Reinterpretierend nimmt der Erzähler hier mit dem Lexem eirēnē {Frieden} das Thema von Joh 14,27ff wieder auf. Und wie dort ist dieser Friede nicht von der Art, wie die Welt Frieden gibt und begreift (ou kathōs ho kosmos didōsin), sondern mitten in der fortbestehenden Bedrückung und Anfechtung (thlipsis) der Glaubenden kommt in ihm das eschatologische Heil zum Vorschein und gibt ihnen teil an dem von Jesus errungenen Sieg über den kosmos. Dieser Friede gründet im Glauben und besteht in dem wechselseitigen In-Sein Jesu in den Glaubenden und der Glaubenden in ihm. Darum ist mit der Wendung In mir habt ihr Frieden nichts anderes gesagt als in 1Joh 5,4, daß nämlich der Glaubende an Jesu Sieg über den kosmos teilhat. Darum ist die Mahnung tharseite {seid getrost} hier von großem Gewicht, denn sie erinnert an die niemals endende Aufgabe, zwischen Jesus und der Welt zu wählen …
Unbestimmt bleibt in diesem Zusammenhang, worin konkret „das eschatologische Heil“ bzw. der „Sieg über den kosmos“ bestehen soll. Denkt Thyen an ein den Glaubenden verheißenes Seelenheil im jenseitigen Himmel, das daran gebunden ist, im Diesseits aus dem Glauben an Jesus die Liebe zu leben, oder ist seine Vorstellung von den letzten Dingen zumindest auch auf eine Veränderung dieser Welt in Richtung auf einen Frieden im Sinne des Schalom der jüdischen Schriften ausgerichtet?
Ton Veerkamp <1174> deutet die Rede vom Frieden und von der Welt in politischen Kategorien, die er den jüdischen heiligen Schriften entnimmt, indem er den Vers 33 von der Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei her auslegt:
Noch einmal wird das Thema Friede von 14,27 aufgegriffen, allerdings dann mit einer anderen Tendenz. Dort, 14,27ff., wird der Gegensatz zwischen der pax messianica und der Pax Romana aufgestellt. Jetzt hören wir:
Das habe ich zu euch geredet [=14,27ff.],
dass ihr mit mir Frieden habt:
Unter der Weltordnung werdet ihr in Bedrängnis sein.Neu ist die Erfahrung, dass Frieden mit dem Messias haben notwendig Bedrängnis mit der Weltordnung haben bedeutet. Thlipsis, zara, war und ist der Normalzustand Israels unter den Völkern und erst recht unter Rom. Johannes versichert der Gruppe, dass Bedrängnis nur dann auszuhalten ist, wenn sie den Frieden des Messias als reale politische Perspektive für sich sehen. Deswegen knüpft er hier die Verbindung zu Exodus 14. Johannes wählt das Wort, das er bei seiner Erzählung über Jesus, gehend auf dem Wasser, vermeidet. Die Synoptiker haben an der Stelle: tharsei, „sei unverzagt“. In den meisten Fällen haben die Übersetzer der Schrift Israels, wie Johannes in 6,20, das gewöhnliche mē phobeisthe (ˀal thiraˀu), „fürchtet euch nicht“. In manchen Fällen wählen sie aber das positive tharsein, unverzagt sein. Unter anderem an einer entscheidenden Stelle. Das Volk sprach zu Mose, Exodus 14,12:
War das nicht die Rede, die wir zu dir in Ägypten redeten:
„Lass von uns ab, wir wollen Ägypten dienen,
denn besser ist es für uns, Ägypten zu dienen,
als in der Wüste zu sterben.“Mose erwidert, Exodus 14,13:
Fürchtet euch nicht [ˀal-thiraˀu, tharseite]
stellt euch auf,
seht die Befreiung durch den NAMEN,
mit der er euch heute befreien wird.
Denn wie ihr heute Ägypten seht,
werdet ihr es nicht weiter sehen, in Weltzeit!
Der NAME wird für euch kämpfen,
also schweigt!Genau dieses Wort wählt Johannes. Was in der Tora Ägypten ist, das ist im Evangelium der kosmos, die Weltordnung, das ist Rom. An diesen Sieg des NAMENS über Ägypten denkt Jesus, als er sagt: „Ich habe die Weltordnung besiegt.“ Weil der NAME Ägypten besiegt hat.
Veerkamp weigert sich also, den Sieg über die Welt und ihren Fürsten zu verjenseitigen und eschatologisches Heil ganz oder teilweise als Vertröstung auf den Himmel zu begreifen. In Gestalt der „starken und mächtigen Welt, die … über Leichen geht“, wie sie Wengst (W460) gekennzeichnet hat, steht den um Johannes gruppierten jüdischen Messianisten eindeutig das römische Imperium mit ihrem Kaiser an der Spitze gegenüber.
Aber ist es nicht naiv, den Sieg über dieses menschenmörderische System zu behaupten? Veerkamp zufolge ist es kein Zufall, dass Johannes die Siegeszuversicht Jesu unter Rückgriff auf die Befreiungserfahrung im 2. Buch Mose formuliert:
Natürlich ist das nenikēka ton kosmon, „ich habe die Weltordnung besiegt“, eine Durchhalteparole. Kein wirklich ernsthafter Mensch kommt in Krisensituationen ganz ohne Durchhalteparolen aus. Aber diese Durchhalteparole hat Realitätsgehalt in der Erinnerung an die geschehenen Befreiungen Israels aus der Bedrängnis unter den Völkern. Das Perfektum hier ist das Perfektum von Exodus 14,30:
Der NAME hat Israel an jenem Tag befreit (wa-joschaˁ JHWH)
aus der Hand Ägyptens.
Und Israel sah Ägypten
tot am Ufer des Meeres.In der Schrift gibt es keine Idyllen. In der herrschenden Weltordnung gibt es auch keine Idyllen. Mit diesem Satz „ich habe die Weltordnung besiegt“ endet das Abschiedsgespräch. Aber hier ist Ägypten nicht tot, die Bedrängnis bleibt. Deswegen singt hier keine Mirjam wie in Exodus 15, sondern es betet der Messias die große Fürbitte für die messianische Gemeinde.
Bevor dieses Gebet einsetzt, beendet Johannes die Abschiedsgepräche mit den Schülern durch die Anfangsworte von 17,1 – tauta elalēsen Iēsous:
17,1a Darüber hatte Jesus geredet.
↑ Es war aber Nacht: Das Gebet des Messias (Johannes 17,1-26)
[11. Dezember 2022] Die Abschiedsgespräche, die Jesus mit seinen Schülern führt, gehen fast nahtlos über in das Gebet, das Jesus an seinen VATER richtet. Nach Ton Veerkamp <1175> gehört es wie auch die anschließende Erzählung von der Gefangennahme Jesu und der Ereignisse am Hof des Hohenpriesters Hannas immer noch zum johanneischen Kapitel „Es war aber Nacht“. Ihm zufolge nimmt
[d]as Gebet des Messias … den Platz jener Szene ein, die die Synoptiker zwischen dem Weggang aus dem Saal und der Festnahme einschalten. Kein „Engel“ tröstet hier den Messias, weil die „Erschütterung der Seele“ bereits erwähnt und überwunden ist.
Das Anliegen des Messias in diesem Gebet ist das Gegenteil des skorpizesthai, auseinandergejagt werden, von 16,32; es ist die Einheit der messianischen Gruppe.
Zur Gliederung bemerkt Veerkamp lediglich, dass dieses
lange Stück … zwei „Strophen“ [hat], die jeweils am Ende einen Gedankenreim haben: 17,11 vierte Zeile; „damit sie zu einer Einheit werden wie wir“. Und 17,23: „Ich mit ihnen und du mit mir / damit sie vollkommen zu einer Einheit werden.“ Diese Einheit ist für Johannes eine Herzensangelegenheit. Sein politisches Programm war, Israel zur Einheit zusammenzuführen. Deswegen muss es eine unverbrüchliche Einheit von Anfang und bis zum Ende zwischen dem Messias und Gott geben: „Ich und der VATER: EINS sind wir!“ (10,30).
Klaus Wengst (W462) betrachtet das „Gebet Jesu“ in Kapitel 17 in „der eigenartig ortlosen Situation zwischen der Aufforderung Jesu von 14,31, aufzubrechen und den Raum des letzten Mahles zu verlassen, und dem tatsächlich erzählten Aufbruch in 18,1, in der schon die zweite Abschiedsrede erfolgte“, als „ein Gebet sozusagen in der Schwebe, im Übergang.“ Diesen Schwebezustand beschreibt er zunächst mit Formulierungen von Burkhalter, Brodie, Tholuck, Schnackenburg und Becker. <1176> So (Anm. 175) betont Burkhalter, dass sich Jesus in „logischer Konsequenz zu dem über das Bitten Gesagte … nun selber im Gebet an den Vater“ wendet. Nach Brodie ist dabei (W462) der „betende Jesus … anwesend und abwesend zugleich“, wozu (Anm. 176) Tholuck beobachtet, „daß der Betende proleptisch gleichsam schon aus der Welt heraus versetzt spricht“. Zwar ist (W462) „vorgestellt …, dass Jesu Schüler sein Beten mithören“, ist es doch, wie Schnackenburg meint, „für die Ohren der späteren Gläubigen bestimmt“, womit zugleich, so Becker, diese „Selbstdarstellung des Sohnes und sein Eintreten für die Seinen als Mittel der Vergewisserung der Gemeinde anzusehen“ ist.
Mit dem Gebet, das auf Jesu „nun zur Vollendung kommendes Werk zurückblickt und um die Bewahrung der zurückbleibenden Seinen bittet“, nimmt der Evangelist Johannes
die biblisch-jüdische Tradition auf, in der hervorragende Personen entsprechend handeln. In 1. Chr 29 geht es um den Übergang des Königtums von David auf Salomo, wobei die Aufforderung, den Tempel zu bauen, eine wichtige Rolle spielt. Kurz vor seinem Tod spricht David ein Gebet (1. Chr 29,10-19). Darin weist er auf das schon Bereitgestellte hin und betet für das Volk und Salomo hinsichtlich der Ausrichtung der Herzen auf Gott.
Außerdem verweist Wengst auf Gebete Abrahams und Moses vor ihrem Tod (im Jubiläenbuch 22,7-9 bzw. LibAnt 19,8f., das ich quellenmäßig nicht zuordnen kann), in denen sich ebenfalls wie in Johannes 17 „der Rückblick auf das Getane und die Bitte für die, die zurückbleiben“ finden, was er als Ausgangspunkt für „eine Gliederung“ betrachtet.
- In den Versen 1-3 sieht Wengst die „Einleitung des ganzen Kapitels“, in der „Jesus für sich selbst um ‚Verherrlichung‘“ bittet, indem er „von sich als dem Sohn in der dritten Person spricht“ und feststellt, „dass die Stunde gekommen sei.“
- Die Verse 4-5 enthalten „nach einem Rückblick auf sein Werk unter dem Gesichtspunkt, dass er damit Gott verherrlicht hat, in der ersten Person Singular“ die Bitte Jesu „darum, seinerseits verherrlicht zu werden.“
- In den Versen 6-11 bittet Jesus für „die ihm anvertrauten Menschen … um Bewahrung“.
- Dieses Thema nimmt er in 12-17 unter dem Gesichtspunkt der „Feindschaft von der Welt“ in der Bitte, „sie vor dem Bösen zu bewahren und sie zu heiligen“, noch einmal auf.
- Die Verse 18-21 enthalten einen „Rückblick“, demzufolge „Jesus sie gemäß seiner eigenen Sendung in die Welt gesandt hat“, wodurch Menschen (W463) in den Blick kommen, „die durch sie glauben werden“ und für die Jesus bittet, „dass sie alle einmütig zusammenwirken“.
- In der letzten Bitte (22-24) „nimmt Jesus die Themen ‚Herrlichkeit‘ und ‚Einmütigkeit‘ noch einmal auf und formuliert in der letzten Bitte den Wunsch der bleibenden Verbundenheit mit den ihm von Gott Anvertrauten“.
- Die Verse 25-26 enthalten „Feststellungen und keine Bitte“, die Wengst „als hervorgehobenen Abschluss des Gebetes“ betrachtet.
Eine andere Gliederung des Kapitels Johannes 17 schlägt Hartwig Thyen (T682) unter Berufung auf Brown und Moloney <1177> vor, die sich an „seiner dreifachen formalen Nennung des Betens Jesu in V. 1 (‚Jesus erhob seine Augen zum Himmel‘), V. 9 (,Ich bete für sie‘) u. V. 20 (,Nicht allein für diese bete ich.‘)“ orientiert: „(1) 1-8; (2) 9-19 und (3) 20-26.“
Außerdem setzt sich Thyen (T678f.) mit Versuchen von Loisy, Bauer, Walker, Schenk, Cullmann, Wilkens, Barrett, Becker und Thüsing <1178> auseinander, die literarische Gattung und den intertextuellen Zusammenhang von Johannes 17 näher zu bestimmen. So beurteilte in seinen Augen bereits Loisy [53] dieses Kapitel „treffend als ‚eine sehr regelmäßig konstruierte, lyrische Paraphrase‘ der Vater-Unser-Bitten des Matthäusevangeliums“, und (T679) W. Bauer, „der Joh 17 als ein ‚schriftstellerisches Produkt des Evangelisten‘ beurteilt“, erwies „eine unmittelbare Abhängigkeit einzelner Züge des Gebets von dem matthäischen Vater-Unser“. Walker sieht in Johannes 17 eine Art „Midrasch“ zur matthäischen Version des Herrengebets im Licht der johanneischen Theologie und auch W. Schenk verstärkt einleuchtend die Beobachtungen zur „Intertextualität beider Gebete“. Soweit ist Thyen mit diesen Autoren einverstanden.
Da Loisy meinte, als „den Sitz im Leben dieses Gebets … das Passionsgedenken bei der Eucharistiefeier ausmachen zu können“, bestimmte er „das Kapitel seiner Gattung nach deshalb als eucharistisches Gebet“, worin ihm Schenk [588], Cullmann [108] und dessen Schüler W. Wilkens folgten. Letzteren zitiert Thyen mit folgenden Worten [156]:
„Bemerkenswert sind die Parallelen aus den eucharistischen Gebeten der Didache. Und gewiß (sic) spielt das kai hyper autōn egō hagiazō emauton {und für sie heilige ich mich} V. 19 auf das hyper hēmōn {für uns} des Abendmahlsberichts an. Bezeichnenderweise folgt dann auch sogleich die Bitte um die Einheit der Gemeinde (V. 20ff). Das Gebet erhält von der Eucharistie her Farbe“.
Gegen diese „Rede vom ,Sitz im Leben‘ einer ,Gattung‘ eucharistischer Gebete“, die einer „Hochschätzung der vermeintlichen ,mündlichen Tradition‘“ in „der älteren Formgeschichte“ und ihrer gleichzeitigen „Vernachlässigung der Kategorie der ,Schriftlichkeit‘“ entspricht, stellt Thyen die knappe Klarstellung von Becker [510]: „Das Gebet ist nie so von Jesus gesprochen worden, noch im Gottesdienst der Gemeinde verwendet worden“, und Barrett [485] hat
im Blick auf den poetisch-literarischen Charakter von Joh 17 zu Recht eingewandt, auch wenn die Ansicht „in einem gewissen Maße plausibel (sei), daß das Gebet sich im Kontext der Abendmahlsliturgie entwickelt“ habe, müsse dabei aber „immer beachtet werden, daß kein Zelebrant sich so mit dem Herrn selbst und mit der Stellung des Herrn in der Nacht, in welcher er verraten wurde, identifizieren konnte, daß er tatsächlich in der ersten Person Singular sagen konnte: ,verherrliche mich … ich habe deinen Namen offenbart … ich kam von dir … ich komme zu dir“ usw.“.
Aber gegen Barretts „Vermutung, das Gebet Jesu habe sich ‚im Kontext der Abendmahlsliturgie entwickelt‘“, wozu dieser „ebenso wie andere vor und nach ihm auf die Abendmahlsgebete der Didache (Did 9-10)“ verweist, wendet Thyen ein, dass „das von der Didache zitierte Vater-Unser mit Sicherheit keine von Matthäus unabhängige Tradition“ ist; außerdem ist es „weder bei Matthäus noch in der Didache ein Eucharistiegebet“, sondern schon bei Matthäus
vielmehr das Muster des privaten Betens, zu dem sich der Jünger in sein tamieion zurückziehen und die Tür verschließen soll (Mt 6,6). Das tamieion als die Vorrats- oder Speisekammer, ist der einzig verschließbare und insofern privateste Raum des Hauses.
Thüsing sah Thyen zufolge (T680) schon 1962 [125]
in seiner ,Auslegung des Hohepriesterlichen Gebets‘ … ganz richtig, daß wir kein Recht haben, ‚Jo 17 zu einem Eucharistiegebet bzw. zu einer Liturgie der johanneischen Gemeinden zu stempeln‘, daß es aber gleichwohl ‚nur wenige Texte des Neues Testaments (gebe), die so sehr zum Verständnis der eucharistischen Wirklichkeit‘ beitrügen. Erst 1977, in seinem Beitrag zur Schürmann- Festschrift, erklärt Thüsing dann ausdrücklich [308]: „Inzwischen bin ich zu der Auffassung gekommen, daß das Gebet Joh 17 vor allem mit dem synoptischen Herrengebet kontrastiert und zusammengeschaut werden sollte“.
Viele Exegeten bestreiten aber, dass „Johannes das Vater-Unser erst aus dem Matthäusevangelium habe lernen müssen“. Dafür macht Thyen vor allem eine Monographie von Gardner-Smith <1179> aus dem Jahr 1938 über Johannes und die synoptischen Evangelien verantwortlich, durch die es
nahezu zum Dogma der Johannesexegese geworden ist, daß Johannes keines der überlieferten synoptischen Evangelien gekannt haben soll, sondern sich ausschließlich auf andere Quellen und zumal auf nur mündlich überlieferte Traditionen bezogen habe.
Erst durch „die sorgfältigen Arbeiten von Neirynck und Sabbe“ und „einige Beiträge in dem von A. Denaux <1180> herausgegebenen Sammelband“ über Johannes und die Synoptiker aus dem Jahr 1992 ergab sich in „der alten Frage nach dem Verhältnis unseres Evangeliums zu den Synoptikern“ ein Umdenken, das nach Thyen aber in gewisser Hinsicht ebenfalls in Frage zu stellen ist (T680f.):
Angesichts der von Literar- und Quellenkritik sowie seit einigen Jahrzehnten durch die Redaktionsgeschichte dominierten Forschungslage auf diesem Feld, waren diese Autoren als die Begründer dieses neuen Paradigmas freilich genötigt, nun als Antikritik ihrerseits die synoptischen Evangelien in dem Sinne, wie Markus als Quelle von Matthäus und Lukas gilt, ebenfalls als die Quellen des vierten Evangeliums zu behandeln. Wir haben demgegenüber das Verhältnis des vierten zu den drei älteren Evangelien unter dem Gesichtspunkt ihrer Intertextualität behandelt und die letzteren deshalb als die Prätexte bezeichnet, die durch den neuen Text nicht etwa abgelöst oder gar verdrängt werden sollen, <1181> sondern vom neuen Text vielmehr in ihrer Geltung vorausgesetzt werden. Daß darum gerade das Spiel mit ihnen, das ,Zwischen‘ der Intertextualität also, die Pointe des neuen Textes ist, hat sich u. E. zumal an der Auslegung von Joh 6 und 11f bewährt…
Inhaltlich betont Thyen zu Johannes 17, dass Jesus, indem er „in seinem Gebet zum Vater bereits auf sein vollendetes Erlösungswerk zurückblickt, … hier gleichsam als der schon Erhöhte“ betet, denn:
kai ouketi eimi en tō kosmō {Ich bin schon nicht mehr in der Welt} (17,11). Und weil mit V. 6-26 der größte Teil seines Gebets beherrscht ist von seinem Eintreten und seiner Fürbitte für die Seinen, wird das Gebet seit den Tagen Cyrills von Alexandria weithin als das Hohepriesterliche Gebet bezeichnet. D. Chytraeus (1531-1600), der darin viele Nachfolger gefunden hat, begriff in diesem Sinn V. 19 als den Schlüssel zum Verständnis des gesamten Gebets, das er dementsprechend als die praecatio summi sacerdotis {Gebet des Hohenpriesters} bezeichnete. Man könnte sagen, daß Jesus hier, obgleich noch irdisch und inmitten seiner Jünger, bereits als ihr himmlischer Paraklet für sie vor seinem Vater eintritt, wie es 1Joh 2,1f im Spiel mit unserem Gebet und Joh 14,16f formuliert; vgl. Walker [239]. Ja, trotz der ausdrücklichen Aussage: ou peri tou kosmou erōtō {Nicht für die Welt bitte ich} (17,9), wo kosmos freilich im Gegensatz zu den Glaubenden die ihnen feindlich begegnende Welt bezeichnet, bittet Jesus dennoch auch ,für alle Menschen‘, oder, wie es in 1Joh 2,2 heißt: peri holou tou kosmou {für die ganze Welt}, nämlich für die gesamte geschaffene Welt (s. u. z. St.).
Der „Block des abschiedlichen Redens Jesu in den Kapiteln 14-16“ wird nach Thyen von den beiden Kapiteln 13 und 17 trotz ihrer „verschiedenen Genres“ mit inhaltlich genau entsprechenden Themen umschlossen, indem
Jesus in seinem Gebet zum Vater nahezu alle Themen der um die Fußwaschung zentrierten Narratio {Erzählung} von Joh 13 wiederaufnimmt, nämlich diejenigen der wechselseitigen Verherrlichung des Sohnes durch den Vater und des Vaters durch den Sohn, der in seiner Lebenshingabe gipfelnden Liebe Jesu und seines Liebesgebots, der Unbeständigkeit und Anfechtung der Jünger und der Offenbarung des Vaters durch Jesu Wort und Weg [vgl. Moloney 459].
Unter Bezug auf Becker [523-529] stellt Thyen heraus (T681f.),
daß der große Block Joh 13-17 als eine Spielart der Gattung des ,literarischen Testaments‘ begriffen sein will, die zumal im Alten Testament und im frühen Judentum ihre spezifische Prägung erfuhr… Häufig, und zwar stets erst nach der eigentlichen Abschiedsrede der scheidenden Helden oder Patriarchen, erscheinen in diesen Testamenten als deren typische Äußerungen auch abschiedliche Gebete… [vgl. Moloney 463]. Diese formale Beobachtung macht Becker treffend gegen Bultmanns Eingliederung des Gebets Jesu in das 13. Kapitel geltend.
Nicht einverstanden ist Thyen jedoch damit, dass nach Becker erst eine spätere Redaktion den „johanneischen Dualismus“ und seine angebliche „Weltfeindlichkeit“ durch die „Einfügung von Joh 17 in ein bereits publiziertes Evangelium“ verkirchlicht haben soll. Dafür gibt es „keinerlei ernsthafte stilistische und inhaltliche Argumente und erst recht nicht das geringste Indiz in der Textüberlieferung“. Daher liest Thyen „Jesu abschiedliches Gebet als konstitutiven und dem Genre des literarischen Testaments adäquaten Teiltext unseres Evangeliums“, das in sich einen geschlossenen Zusammenhang bildet.
↑ Johannes 17,1-5: Jesu Gebet zum VATER um das Leben der kommenden Weltzeit in der Stunde ihrer wechselseitigen Ehrung
17,1 Solches redete Jesus
und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach:
Vater, die Stunde ist gekommen:
Verherrliche deinen Sohn,
auf dass der Sohn dich verherrliche;
17,2 so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen,
auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast:
das ewige Leben.
17,3 Das ist aber das ewige Leben,
dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist,
und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
17,4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden
und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.
17,5 Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.
[12. Dezember 2022] Zu Beginn seiner Auslegung von Johannes 17,1 weist auch Klaus Wengst (W463) wie Veerkamp darauf hin, dass der Evangelist mit der „Feststellung: ‚Das hat Jesus geredet‘ … die Abschiedsreden Jesu als beendet erscheinen“ lässt, so wie er (Anm. 180) in 12,36 „das öffentliche Wirken Jesu mit diesem Satz abgeschlossen“ hatte (W463):
Jesus wird zwar gleich weiterreden und die eigentliche Adressatenschaft dabei dieselbe bleiben, nämlich die lesende und hörende Gemeinde, aber in der vorgestellten Erzählsituation spricht Jesus nicht mehr zu den Schülern, sondern im Gebet zu Gott. Diese Richtungsänderung hebt Johannes mit dem Vermerk hervor, dass Jesus „seine Augen zum Himmel erhob“. Gleich zu Beginn spricht er Gott als „Vater“ an. Das wird in diesem Gebet noch mehrfach geschehen. So hat er es auch schon in 11,41 und 12,27f. getan. Angesichts dessen, dass Johannes das Verhältnis zwischen Gott und Jesus immer wieder als eins zwischen Vater und Sohn darstellt, ist das nicht überraschend. Diese Anrede hebt Jesus nicht aus seinem Volk heraus oder trennt ihn gar davon, sondern verbindet ihn damit.
An Jesu anschließender Feststellung, dass „die Stunde gekommen ist“, die er (Anm. 183) „natürlich nicht Gott gegenüber zu machen“ brauchte, wird Wengst zufolge
deutlich, dass dieses vor den Schülern gesprochene Gebet für die Ohren der das Evangelium Lesenden und Hörenden bestimmt ist. Ihnen soll an dieser Stelle betont in Erinnerung gerufen werden, welche Stunde jetzt geschlagen hat. Damit ist aber auch klar, dass die Beobachtung, etwas in diesem Gebet Ausgeführtes müsse nicht Gott gesagt werden, nicht als Argument taugt, solche Teile literarkritisch auszuscheiden, wie es etwa Becker <1182> im Blick auf V. 3 tut.
Bereits in 12,23 und 13,1 war darauf hingewiesen worden (W463), dass die „‚Stunde‘ der Passion und des Todes Jesu, auf die im Evangelium schon früh vorausgeblickt wurde, … jetzt da“ ist, und auch in 12,23.27f. war „damit das Thema der Verherrlichung verbunden“ gewesen, mit dem hier „zugleich an den Beginn der ersten Abschiedsrede in 13,31f. angeknüpft“ wird:
Wenn Jesus im Blick auf diese Stunde den Vater bittet: „Verherrliche Deinen Sohn!“, dann möchte er, dass Gott ihn nicht fallen lasse, sondern sich vielmehr gerade jetzt, da er in diesen Tod geht, zu ihm bekenne. So geht die Bitte darauf, dass Gott dieser Stunde des Todes Jesu Gewicht gebe, dass der Gekreuzigte das Gewicht Gottes bekomme.
Wengst erinnert zwar erneut daran (Anm. 184), „dass die Grundform des hinter dem griechischen Wort für ‚Verherrlichen‘, ‚ehren‘ stehenden hebräischen Verbs die Bedeutung ‚schwer sein‘ hat“, aber indem dieses Gewicht von Johannes angeblich nur der Person Jesu als des Gekreuzigten zugeschrieben wird, blendet er aus, wie die Ehre Gottes und des Messias auf Israels Befreiung zu beziehen ist.
Interessant ist, dass Wengst die Vorstellung von der Verherrlichung Jesu durch den Vater so sehr auf die Auferweckung Jesu von den Toten zuspitzt und einengt, obwohl von dieser gar nicht ausdrücklich die Rede ist, dass er von ihr her die in seinen Augen damit verbundene Vorstellung von der Rückkehr Jesu zu Gott in einer ganz bestimmten Weise problematisiert (W463f.):
An dieser Stelle wird die Grenze des Bildes vom Boten deutlich, der mit einem Auftrag ausgesandt wird und nach erledigter Aufgabe zu seinem Auftraggeber zurückkehrt. So häufig diese Vorstellung im Johannesevangelium begegnet und so sehr sie die Sicht Jesu in ihm prägt – sie bleibt ein Bild und ist nicht die Sache selbst. Von sich aus kann Jesus gar nicht wie ein Gesandter zu seinem Auftraggeber „zurückkehren“. Seine „Rückkehr“ kann nur gelingen, wenn der Vater ihn „verherrlicht“, wenn Gott ihn nicht im Tode belässt, sondern von den Toten aufweckt. Genauso wenig ist Jesus im eigentlichen Sinn als Gesandter „von Gott ausgegangen“. Am Anfang bei Gott war „das Wort“ (1,1). Jesu Ausgang von Gott hängt daran, dass dieses Wort in ihm „Fleisch ward“ (1,14).
Bei diesem „Wort“, das sich in Jesus verkörpert, ist nach Wengst (Anm. 185) „selbstverständlich ‚nicht irgendein gegenständlicher lógos ásarkos‘ {nichtfleischlicher Logos} im Blick und auch ‚nicht irgendein abstrakter lógos‘“, wie Thyen (T688) ihm das (siehe unten) unterstellt, „sondern das biblisch bezeugte Sprechen Gottes, das Schöpfung werden ließ – desselben Gottes, der in Jesus neuschöpferisch zu Wort kommt.“
Wenn aber (W464) die „Verherrlichung des Sohnes durch den Vater“ in ihrem Kern darin besteht, dass der Vater den Sohn von den Toten auferweckt, wie kann dann umgekehrt das Ziel dieser Verherrlichung sein, „dass der Sohn Dich verherrliche“? Dieses Ziel wird nach Wengst darin eingelöst, dass „Jesus nach Ostern kraft des Geistes in der Gemeinde zur Wirkung kommt“, denn so „gibt er in ihr Gott Gewicht, ‚verherrlicht‘ er ihn.“ Was er damit konkret meint, verdeutlicht er (Anm. 187) durch ein Zitat von Augustin: <1183>
„Allein in sich selbst kann die Klarheit des Vaters allerdings weder vermindert noch vermehrt werden, bei den Menschen aber war sie ohne Zweifel geringer, als Gott nur in Judäa bekannt war, noch nicht vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang den Namen des Herrn seine Diener priesen. Weil aber durch das Evangelium Christi bewirkt wurde, daß der Vater durch den Sohn den Völkern bekannt wurde, so hat in der Tat auch der Sohn den Vater verherrlicht. Wenn aber der Sohn nur gestorben und nicht auferstanden wäre, so wäre er ohne Zweifel weder vom Vater verherrlicht worden, noch hätte er den Vater verherrlicht; nun aber vom Vater verherrlicht durch die Auferstehung, verherrlicht er durch die Verkündigung seiner Auferstehung den Vater“.
Indem Wengst diese Interpretation Augustins vollinhaltlich teilt, bezieht er die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn ausschließlich auf die Öffnung des Glaubens an den Gott Israels für die Völker der Welt. Die Frage bleibt aber immer noch offen, ob das Johannesevangelium in dieser Weise quasi „paulinisiert“ oder „matthäisiert“ werden darf. Gerade an der Auslegung des 17. Johannes-Kapitels wird sich zeigen, ob das Hauptanliegen des Johannes tatsächlich die Mission aller Völker der Welt ist oder nicht vielmehr die Befreiung der Welt von der versklavenden Weltordnung, die auf ihr lastet, die zunächst einmal Israel inmitten der Völker zugute kommt, statt umgekehrt, wie es schon bald geschehen wird, die Juden aus dem neuen Israel einer heidenchristlich dominierten Völkerkirche auszuschließen.
Offenbar fühlt sich Wengst (W464) durch die „anschließende Ansage“ in Vers 2, „dass Gott Jesus ‚Macht über alles Fleisch‘ gegeben hat (vgl. 3,35; 13,3)“, darin bestätigt, dass auch im Johannesevangelium eine Völkermission im Blick ist, denn (Anm. 188) die „biblische Wendung ‚alles Fleisch‘ bezeichnet alle Menschen, wobei ‚Fleisch‘ den Aspekt der Hinfälligkeit und Vergänglichkeit anklingen lässt (vgl. Jes 40,6).“ Dabei lässt er allerdings unberücksichtigt, dass in genau dem von ihm zitierten Buch Jesaja Gottes Macht über alle Völker vorausgesetzt ist, obwohl seine Solidarität vor allen anderen seinem auserwählten Volk Israel gilt.
Nochmals betont Wengst (W464) im Zusammenhang mit Vers 2, dass diese Machtübergabe an Jesus „nicht unabhängig von der gerade erbetenen Verherrlichung zu sehen“ ist:
Dass Gott Jesus „verherrlicht“, dass er ihn von den Toten aufgeweckt hat, macht ihn erst zum „Fürste des Lebens“ (E{vangelisches}G{esangbuch} 66,4). Erst das lässt seine Lebenshingabe in den Tod so zur Wirkung kommen, dass sie Leben vermittelt, „ewiges Leben“, wie es die folgende Zielangabe formuliert: „damit er allen, die Du ihm gabst, ewiges Leben gebe“.
In dieser Übersetzung von pan ho dedōkas mit „allen, die Du ihm gabst“, die Wengst nicht näher hinterfragt, <1184> scheint er einen gewissen Widerspruch zum „Hauptsatz“ zu erblicken, in dem „gerade seine ‚Macht über alles Fleisch‘ angesprochen war“. Diesen Widerspruch löst er aber nicht in der Weise auf, dass Johannes hier vielleicht doch zunächst an das dem Messias anvertraute Restvolk Israel denken könnte, sondern er interpretiert „diejenigen, die Gott Jesus gab“, mit einem Zitat von Wilckens <1185> als eine an Jesus glaubende Teilmenge der gesamten Menschenwelt:
„Die Formulierung gibt exakt wieder, dass von Gott her die Sendung Jesu der Rettung der Welt gilt, diese aber nur an den Glaubenden in der Gabe ewigen Lebens verwirklicht wird (vgl. 3,16).“
Die Gabe des „ewigen Lebens“ definiert Wengst dabei zunächst als ein „Leben im Angesicht Gottes, Leben, das nicht verloren ist, sondern ‚bleibt‘“. Näher wird, was „ewiges Leben“ ist, in Vers 3 bestimmt (W465):
„Das aber ist das ewige Leben, dass sie Dich, den allein wahren Gott, erkennen und den Du gesandt hast: Jesus, den Gesalbten.“ Wirkliches Leben besteht in der Erkenntnis – und die ist in diesem Bezug immer zugleich Anerkenntnis – des einen Gottes, des Schöpfers und Herrn von allem. Es gibt keinen Bereich, der ihm entzogen, wo er nicht wäre (vgl. Ps 139). Das aber heißt auch, dass angesichts Gottes das Leben nicht in unterschiedliche Bereiche aufgesplittert werden kann, in denen etwa unterschiedlichen „Herren“ mit ihren je „eigenen Gesetzen“ zu dienen wäre. Wird Gott als „der allein wahre Gott“ erkannt und anerkannt, sind alle Lebensbereiche auf ihn bezogen und kommt das Leben als zu jeder Zeit und an jedem Ort in Verantwortung vor ihm gelebtes zur Einheit.
In dieser Einsicht, dass „die Erkenntnis Gottes das ganze Leben bestimmt und so zu wirklichem Leben verhilft“, ist das Johannesevangelium Wengst zufolge einig mit der „rabbinische[n] Auslegung von Spr 3,6“: <1186>
„Salomo sprach (Spr 3,6): Auf all Deinen Wegen erkenne ihn. Wenn du bei jedweder Sache auf den Heiligen, gesegnet er, aufmerksam bist {wörtlich: ihn erkennst}, wird er deine Pfade ebnen (Spr 3,6).“ Der Midrasch nimmt diese Stelle noch einmal auf: „Was heißt: Auf all deinen Wegen erkenne ihn? Lass ihn dir ins Herz gegeben sein vor dir auf jedem Weg, den du gehst“. So kann auch gesagt werden, dass „alle Teile der Tora“, die ja Gottes Weisung zum Leben ist, an diesem „kleinen Abschnitt hängen“: Auf all deinen Wegen erkenne ihn und er wird deine Pfade ebnen.
Nun steht aber in Johannes 17,3 „[n]ach und neben der Erkenntnis Gottes als des allein wahren … die Erkenntnis dessen, den er gesandt hat: Jesus, den Gesalbten.“ Dass Jesus „an dieser theologisch gewichtigen Stelle Jesus als ‚Gesalbter‘ bezeichnet wird“, findet Wengst „aufschlussreich“, allerdings wird in meinen Augen nicht deutlich, welchen Aufschluss diese Formulierung konkret vermitteln soll. Er fährt nämlich einfach fort:
Damit ist erneut der Punkt herausgestellt, an dem die auf Jesus bezogene Gemeinschaft von ihrer jüdischen Umwelt die schärfste Infragestellung erfährt. Christliche Auslegung neigt dazu, diese Zusammenstellung von Gott und Jesus als dem Gesalbten so zu verstehen, dass damit die Erkenntnis Gottes exklusiv an die Erkenntnis Jesu gebunden würde. Calvin <1187> setzt das in einem Nebensatz als selbstverständlich voraus: „Weil aber Gott nur in der Gestalt Christi erkennbar ist“.
So denkt auch Martin Luther, <1188> indem er „der antiarianischen Auslegung der Kirchenväter“ folgt, nach der Jesus nicht Gottes vornehmstes Geschöpf, sondern wesensgleich mit Gott war:
Immer wieder stellt er heraus, „daß Christus Gott ist“. Es geht ihm dabei darum, dass wir es bei Jesus wirklich mit Gott zu tun bekommen. Das ergibt sich etwa daraus, wenn er formuliert, er wisse „von keinem anderen Gott als von Christus. Den will ich hören und was aus seinem Munde fließt. […] Wenn nämlich Christus freundlich redet und dich tröstet, dann sind seine Worte aufs gewisseste auch des Vaters Worte“ (580). „Wenn sie Christus reden hören und heften ihr Herz oder ihre Ohren an seine Zunge, dann geht aus diesem Munde das Wort Gottes“ (581). Und ganz prägnant sagt er von denen, „die an Christus glauben“: „Wenn sie Christus haben, treffen und erlangen sie Gott selbst“ (586). Luther kann sich aber – nicht anders als die Kirchenväter – dieses „Gott in Christus“ nur in der Kategorie des Wesens vorstellen, was die Folge hat, dass mit den Arianern auch „die Juden“ aus der Gotteserkenntnis ausgeschlossen werden: „Johannes sagt: Ihr werdet keinen Gott haben außer dem, der Jesus gesandt hat. […] Er will fürderhin nicht mehr der sein, der mit Mose geredet, sondern der Christus gesandt hat“ (568f.).
Noch heute denkt in gleicher Weise Ulrich Wilckens [262], in dessen Zitat (W465f.) Wengst (Anm. 193) das Wort „allein“ hervorhebt:
„Die ,Erkenntnis‘ Gottes […] hat im Judentum ihre entscheidende Wurzel und Mitte in der Anerkenntnis der Einzigkeit Gottes (Dtn 6,4). Daß eben dieser einzig-eine Gott sich allein zu erkennen gibt in Jesus, den er als seinen einziggeborenen Sohn gesandt hat, – das ist die Wurzel und Mitte der gesamten Botschaft des johanneischen Jesus.“
Wengst (W466) hält demgegenüber daran fest, „dass Gott schon vor Jesus ‚in der Gestalt Israels‘ erkennbar war – und es bleibt“, was er (Anm. 194) bereits in seiner Auslegung von Johannes 8,19 begründet hatte. Unter Berufung auf Calvin [411], dessen Auslegung auch die Formulierung enthält, dass „wir Gott erkennen (sollen) und Christus, den er sandte und durch den er wie mit ausgestreckter Hand uns zu sich einlädt“, meint er, dass „‚wir‘ – nämlich die Menschen aus den Völkern – den Gesalbten Jesus als die uns gegenüber ausgestreckte und uns einladende Hand Gottes begreifen“ könnten.
Nach der „Einleitung, die nicht nur die Bitte um die Verherrlichung des Sohnes enthielt“, gibt Jesus in den Versen 4 bis 5 „einen Rückblick auf sein Wirken in Hinsicht auf Gott und bittet in der 1. Person um seine Verherrlichung.“ Mit dem Satz:
„Ich habe Dich auf der Erde verherrlicht“ blickt er auf sein gesamtes Wirken zurück. In allem, was er tat, ging es allein darum, Gott zum Zuge zu bringen, Gott die Ehre, ihm Gewicht zu geben. Soli Deo gloria: „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘!“ Formal kann das mit der Botenvorstellung beschrieben werden. Jesu Aufgabe war es, im Auftrag des Vaters zu handeln. Diesen Aspekt betont die Fortsetzung des Textes, die im Evangelium schon Gesagtes aufnimmt „durch die Vollendung des Werkes, das Du mir gabst, damit ich es tue“. Davon hat Jesus in 4,34 und 5,36 gesprochen. Mit dieser Formulierung und der durch sie gegebenen Erinnerung an die genannten Stellen ist aber auch klar, dass hier nicht nur ein Rückblick vom Moment der vorgestellten Situation erfolgt, die ja noch vor der Passion liegt, sondern dass Leiden und Tod Jesu eingeschlossen sind, womit sein Werk erst seinen Abschluss erreicht (19,28.30). Jesus redet hier proleptisch {vorwegnehmend}.
Wenn Jesus in seinem „Rechenschaftsbericht die Vollendung seines Werkes erwähnt, seinen Tod am Kreuz“, dann scheint dieses „Geschehen einer grauenhaften Hinrichtung“ jedoch „mit Herrlichkeit nichts zu tun“ zu haben. Dennoch, so Wengst,
war der damit endende und zum Ziel kommende Weg Jesu schon im Blick, als in 1,14 vom Fleisch gewordenen Wort bekannt wurde: „Wir schauten seine Herrlichkeit.“ Von diesem Wort hieß es in 1,1f., dass es am Anfang bei Gott war.
Es ist genau dieser „Zusammenhang zwischen Jesus und dem Wort“, der in Vers 5 mit Jesu „Bitte um Verherrlichung“ aufgenommen wird (W466f.):
„Und jetzt verherrliche Du mich, Vater, bei Dir mit der Herrlichkeit, die ich bei Dir hatte, bevor die Welt war.“ … Was vor Erschaffung der Welt war, ist so bei Gott verankert, dass es nicht dem Vergehen unterliegt, nicht vernichtet werden kann, sondern „bleibt“. Die Bitte zielt also darauf, dass es mit Jesus durch diesen Tod nicht ein für alle Mal zu Ende sei, sondern dass gerade durch ihn und über ihn hinaus Gott zum Zuge komme. Weil Johannes in biblisch-jüdischer Tradition steht und nicht griechisch-philosophisch in den Kategorien von „Seins(weise)“ und „Wesen“ denkt, ist hier im Blick auf Jesus nicht zu reden von einer „Rückkehr zu einer Existenz, die ihm von Ewigkeit her zukam“. <1189> In jüdischer Tradition kann von den Israeliten im Ganzen gesagt werden, dass „sie waren, bevor die Welt erschaffen war“.
Wengst versteht also (W467) Vers 5 von der jüdischen Tradition <1190> her, die „einige Dinge“ kennt, „die es schon vor Erschaffung der Welt gab.“ Unter anderem wird
von den Völkern der Welt, die über Israel triumphieren, Nichtsein ausgesagt… „Aber die Israeliten waren und werden auch in Zukunft sein. Sie waren, bevor die Welt erschaffen war. Denn es ist gesagt (Ps 74,2): Gedenke Deiner Gemeinde, die Du voreinst erworben. Und sie sind jetzt. Denn es ist gesagt (Dtn 29,9): Ihr alle steht heute. Und sie werden sein. Denn es ist gesagt (Mal 3,17): Sie werden mir zum Eigentum, Spruch des Ewigen, Gottes, für den Tag, den ich mache.“ Was als vor der Erschaffung der Welt ausgesagt wird, hat also seine Qualität nicht aus sich selbst, sondern ist, was es ist, ganz und gar von Gott her.
Ebenso gab es nach rabbinischer Auffassung auch den Tempel bereits vor der Erschaffung der Welt,
der doch, als die Texte geschrieben wurden, schon lange in Schutt und Asche lag – genauso offensichtlich, wie Jesus am Kreuz geendet war. Dennoch wird an dem festgehalten, wofür der Tempel steht: Gottes Gegenwart inmitten seines Volkes.
Vor diesem Hintergrund steht für Wengst außer Frage, dass Jesu Werk nicht schon mit seinem Tod am Kreuz vollendet ist; vielmehr muss er zu diesem Zweck den Vater um seine eigene Verherrlichung in Form der Auferweckung von den Toten bitten:
Das Werk Jesu ist nicht dadurch vollendet, dass er es von sich aus zu Ende führt, also den Weg geht, der ihn in den Tod am Kreuz führt. Es ist nur dann vollendet, wenn der Vater ihn eben darin verherrlicht und ihn also nicht dem Tode überlässt. Dabei geht es nicht nur um ein Geschehen zwischen Vater und Sohn. Dementsprechend legen die Rechenschaftsberichte Jesu im folgenden Text weitere Aspekte dar und betreffen seine Fürbitten andere.
[13. Dezember 2022] Hartwig Thyen (T682) weist zu Vers 1 darauf hin, dass „die Gebetshaltung Jesu“ derjenigen bei seinem „Gebet am Grabe des Lazarus“ (11,41) entspricht, und dass er Gott dort wie hier und auch „bei dem Spiel des Erzählers mit der synoptischen Getsemane-Szene (12,28)“ mit dem einfachen „Vokativ pater“ anredet: „Jesu Gebetsgestus des Erhebens seiner Augen zum Himmel ersetzt gewissermaßen die matthäische Näherbestimmung des Vaters als des pater … ho en tois ouranois {Vater…, der du bist im Himmel} (Mt 6,9).“
Warum sagt Johannes „hier aber, anders als Matthäus, nicht pater hēmōn {Unser Vater}“? Das hat Thyen zufolge (T682f.)
einen doppelten Grund. Einmal ist Joh 17 ein aktuelles Gebet Jesu in einer konkreten Situation und nicht Modell für das tägliche Beten der Jünger …; und zum andern ist die Vateranrede in der Erzählung des irdischen Weges Jesu als des fleischgewordenen logos bei Johannes stets die exklusive Anrede dieses monogenēs para patros {Einziggeborenen vom Vater} (1,14) an seinen himmlischen Vater und nie, wie im synoptischen Vater-Unser, die Gottesanrede der Gemeinde … Erst nach der Vollendung seines Heilswerkes erklärt der Auferstandene seine Jünger ausdrücklich zu seinen Brüdern und seinen Vater zu ihrem Vater (20,17f). Wie das Herrenmahl so hat darum auch das Vater-Unser seinen Platz erst in der österlichen Gemeinde und unter dem Geleit des Geistes. Daß die potentiellen Leser des Evangeliums am Ende des ersten Jahrhunderts Gott aber nicht mit dem Vater-Unser als ihren himmlischen Vater angerufen haben sollen, ist dem Evangelium als der Geschichte des irdischen Jesus nicht zu entnehmen.
Indem Jesus „noch als der Irdische inmitten der Seinen und insofern noch vor seiner ‚Stunde‘“ erklärt, dass seine Stunde gekommen sei, redet er wie in 16,33, „als habe er den Sieg über den kosmos bereits errungen“. Dazu zitiert Thyen zustimmend François Tolmie: <1191>
„Der Einsatz dieser Technik hat eine sehr mächtige Wirkung. Sie vermittelt eindringlich die Vorstellung von Jesu absoluter Gewissheit, dass die Dinge genau so eintreten werden, wie er sie voraussagt“.
Jesu „Bitte um seine Verherrlichung“ greift 13,31f. auf, indem er „seine Verherrlichung aber nicht für sich, sondern dazu“ erbittet, „daß so der Sohn den Vater verherrliche.“ Durch diese „wechselseitige Verherrlichung … in ein und demselben Akt“ ereignet sich Thyen zufolge das, was Jesus in 10,30 ausgesagt hatte: „egō kai ho patēr hen esmen {Ich und der Vater, eins sind wir}“.
Die den Vers 2 einleitende Konjunktion kathōs {wie} hat nach Thyen „begründende Funktion“ und ist mit „weil“ oder „insofern“ zu übersetzen:
Der Sohn wird den Vater verherrlichen, sofern der ihm die Macht über alle Menschen (exousian pasēs sarkos {Vollmacht über alles Fleisch}) verliehen hat, damit er allem, das der Vater ihm gegeben hat, ewiges Leben gewähre. … Wie es hier heißt, der Vater habe dem Sohn die Macht über alles Fleisch gegeben, so hatte Jesus bereits in 5,27 gesagt, daß der Vater dem Sohn die exousia gegeben habe, das Gericht abzuhalten. Ob das freilich, wie Lindars <1192> meint, eine „direkte Reminiszenz von Dan 7,13f“ ist, so daß man von dorther auch hier von einem „Menschensohn-Kontext“ sprechen könnte, scheint uns höchst zweifelhaft (s. o. zu 5,27).
Thyen stimmt aber Lindars [519] zu, dass in Johannes 17,2 Indizien „für die Zweisprachigkeit unseres Evangelisten“ zu finden sind:
Wie die bei Johannes nur hier erscheinende Wendung pasa sarx {alles Fleisch} zur Bezeichnung der gesamten Menschheit den biblischen Ausdruck kol-baßar {alles Fleisch} aufnimmt (vgl. Jes 40,5 [LXX]: kai ophthēsetai hē doxa kyriou, kai opsetai pasa sarx to sōtērion tou theou {und es wird zu sehen sein die Herrlichkeit des HERRN, und alles Fleisch wird sehen die Rettungstat Gottes}), so zeigt auch der singularische Ausdruck pan ho dedōkas autō {allem, das du ihm gabst}, dem dann anstelle eines neutrischen Singulars in einer casus-pendens-Konstruktion {hängender Fall = Satzbau mit einem nachträglich einhakenden Bezugswort} der maskuline Plural dōsei autois {er ihnen gebe} folgt, den Einfluß des biblischen Hebräisch.
Dass Thyen den Ausdruck pan ho dedōkas autō in seiner Übersetzung des Kapitels 17 (T677) so wiedergibt, wie ich in eben in geschweiften Klammern hinzugefügt habe: „allem, das du ihm gabst“, ist für mich allerdings nicht nachvollziehbar, denn die Wortform pan kann, soweit ich weiß, keinen Dativ bezeichnen, sondern nur einen Nominativ oder Akkusativ. Daher kann sich das Wort pan zwar in Johannes 6,37.39 auf die Menschen beziehen, die (Akkusativ) der Vater Jesus gibt, aber darum geht es in 17,2 nicht. Wenn sich aber hier das Wort pan auf die Menschen beziehen sollte, denen etwas gegeben wird, dann müsste hier der Dativ panti stehen. Jedenfalls kann ich mir nicht erklären, warum Wengst, Thyen und alle Bibelübersetzungen außer Luther 2017 und Zürcher 2007 hier einen Dativ voraussetzen (vgl. meine Anm. 1184).
In Vers 3 sieht Thyen (T684) „eine der häufigen Parenthesen {eingeschobene Sätze} in unserem Evangelium“, die hier nicht einen „Kommentar des Erzählers“ darstellt, sondern in einer „Erläuterung durch den erzählten Beter Jesus“ besteht,
der damit förmlich definiert, was es um das ewige Leben ist: Darin aber besteht das ewige Leben, daß sie dich, den einzig wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dabei bezeichnet das hina ginōskousin {damit sie erkennen} nicht ein theoretisches Erkennen, sondern die höchst praktische Erkenntnis des Glaubens. Als Anerkennen, Sich-Umfangen-Wissen von der Liebe Gottes, die sich in der Sendung des Sohnes manifestiert, und als Wahrnehmung der Welt als Gottes Schöpfung ist das ,Erkennen‘ auf den Glauben angewiesen.
Diesen Worten ist grundsätzlich zuzustimmen, obwohl von den biblischen Schriften her noch genauer zu bestimmen wäre, worin sich das Erkennen des Gottes Israels im Vertrauen auf ihn konkret vollzieht.
Auch ein Zitat von Johannes Fischer, <1193> mit dem Thyen seine eigenen Ausführungen zu begründen versucht, enthält zwar eine bedenkenswerte Warnung vor einer Theologenherrschaft im Christentum, ruft aber mit dem Begriff „mythische Erfahrung“ weiteren Klärungsbedarf hervor:
„Denn nicht die Erkenntnis der Theologie verifiziert den Glauben, sondern die Erkenntnis des Glaubens verifiziert die Theologie, indem sie als praktische Erkenntnis und mythische Erfahrung in diejenige Wirklichkeit stellt, der die Theologie zudenkt. Alles andere liefe darauf hinaus, die Rede vom Priestertum aller Gläubigen zur Farce zu machen und in Wahrheit das Hohepriestertum der Theologie aufzurichten, womit aus dem Christentum eine ,Gelehrtenreligion‘ würde, zu welcher es Overbeck zufolge dank einer sich als Wissenschaft verstehenden Theologie längst geworden ist“.
Viele Exegeten haben „diese Parenthese“ als „die sekundäre Glosse eines Abschreibers“ betrachtet, wozu Thyen die diesbezüglichen Begründungen Christian Dietzfelbingers <1194> anführt:
(1) „Indem er lehrhaft das Wesen von ewigem Leben“ erkläre, falle V. 3 „aus dem Gebet und seinem Anredecharakter heraus“. (2) „Von ,Jesus Christus“ (werde) im Johannesevangelium nur noch in 1,17 gesprochen, dort sachgemäß im Bekenntnis der Gemeinde (nicht hierher gehört 20,31). In V. 3 dagegen (sei) die Wendung, eingefügt in das Gebet, analogielose Selbsttitulatur Jesu“. (3) „Die Reihenfolge hē aiōnios zōē {das ewige Leben} (begegne) nur hier; sonst (heiße) es immer zōē aiōnios. Ebenso (sei) die Wendung monos alēthinos theos {einzig wahrer Gott} auf V. 3 beschränkt“. (4) V. 3 erwecke den Eindruck, als wolle er „den Inhalt von V 24.26 vorwegnehmen und in einer eigenen Formel zusammenfassen“.
Thyen zufolge fällt jedoch erstens Vers 3 „mit seiner Gebetsanrede ‚dich, den einzig wahren Gott‘“, weder „aus dem Charakter des Gebets“ heraus, noch ist es abwegig, dass „Jesus seinen Vater hier in absichtsvollem Spiel mit dem Grundbekenntnis seines Volkes von Dtn 6,4f (‚Höre Israel …‘) als den monon alēthinos theos {einzig wahren Gott} anruft und sich selbst, wie oft bei Johannes, in dritter Person als den vom Vater Gesandten bezeichnet“.
Zweitens ist nach Thyen gerade aus 20,31 zu lernen, „daß christos, auch in der Wendung Iēsous Christos, bei Johannes noch den vollen Klang des messianischen Prädikats hat und nicht zum bloßen Eigennamen erstarrt ist. Und da Johannes 17 nach Käsemann <1195> „unverkennbar ein Summarium der johanneischen Reden und insofern ein Gegenstück zum Prolog“ darstellt (T684f.), „ist die Wiederaufnahme der Prädikation ,Jesus Christus‘ aus 1,17 auch gewiß kein Zufall.“
Drittens (T685) wird durch die Wendung hē aiōnios zōē {das ewige Leben} mit dem bestimmten Artikel hē
Jesu Wort dōsē autois zōēn aiōnion {gebe ihnen ewiges Leben} sachgemäß wiederaufgenommen und diesem Leben durch die Voranstellung von aiōnios besonderes Gewicht verliehen. Es kommt hinzu, daß unser Satz in keiner der überlieferten Handschriften fehlt.
Es ist nach Thyen also der Evangelist selbst, der in Vers 3 „ewiges Leben förmlich als das glaubende ,Erkennen des einzig wahren Gottes und dessen, den er gesandt hat, Jesus Christus‘“, definiert. Unter Bezug auf Lindars <1196> hebt Thyen dazu hervor:
Daß zōē aiōnios „Johannes‘ üblicher Ausdruck für das ,Reich Gottes‘ in der früheren Tradition (ist), vgl. 3,3.15ff“, wurde schon oft beobachtet. Lindars schließt daraus: „Es ist somit richtig, dass die ersten beiden Verse des Gebetes mit dem Beginn des Vaterunsers übereinstimmen: ,Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme‘…“; vgl. auch Joh 12,28: pater, doxason sou to onoma {Vater, verherrliche deinen Namen}… Als die engste Parallele zu V. 3 nennt Lindars treffend 1Joh 5,20.
Sehr ausführlich setzt sich Thyen mit Walter Bauers <1197> „Exkurs: Glaube und Erkenntnis zu Joh 6,69“ [103-105] auseinander, auf den dieser zur „Bedeutung des Verbums ginōskein {erkennen} in V. 3 verweist“:
Darin macht er zunächst darauf aufmerksam, daß – von der einzigen Ausnahme in 1Joh 5,4 abgesehen, wo hē pistis hēmōn {unser Glaube} als der Sieg gepriesen wird, der die Welt überwunden hat – die Nomina pistis {Glaube} und gnōsis {Erkenntnis} im gesamten Corpus Iohanneum fehlen, während die Verba pisteuein, ginōskein und oida {glauben, erkennen und wissen} im Vergleich mit allen übrigen Schriften des Neuen Testaments überaus häufig erscheinen, pisteuein nämlich 107mal, ginōskein 83 mal und oida (eidenai) 100 mal. pisteuein habe bei Johannes weniger den Sinn von fiducia {Vertrauen}, sondern werde vielmehr in der Grundbedeutung gebraucht: „Das Bekenntnis der Kirche zu Christus für wahr (zu) halten“. Dieser Glaube sei die „von Gott dem Menschen auferlegte Leistung (6,29) und (stehe) als solche auf einer Linie mit den Geboten (13,34; 14,21; 1Joh 2,4.7.8; 3,24; 5,3)“ [194]. Wie viele andere meint Bauer, daß Johannes verschiedene Stufen des Glaubens voneinander unterscheide, angefangen von dem primitiven Glauben, der der Stützung durch die Wunder bedürfe und deshalb ,gering gewertet‘ werde, bis hin zu dem allein auf Jesu Selbstzeugnis gegründeten echten Glauben, der nicht zu ,sehen‘ brauche, wofür Bauer 4,41; 6,69; 17,8.20 und 20,29 als Belege nennt.
Aber nicht genug damit, dass Bauer dermaßen abwegige Überlegungen zum Stichwort pisteuein im Johannesevangelium anstellt, als ob der Evangelist für die Werkgerechtigkeit eines pervertierten Glaubens verantwortlich wäre, mit dem sich Christen ihr ewiges Seelenheil meinen verdienen zu können, will er den Evangelisten außerdem zu einem waschechten Gnostiker machen, denn (T685f.):
Dieses Urteil über die vermeintlichen Stufungen des Glaubens läßt ihn fragen, ob man nach Johannes über sie hinaus etwa „vordringt zu der, fast ebensooft wie der Glaube begegnenden, Erkenntnis“ [104]. Zwar erschwere das Fehlen des Lexems gnōsis {Erkenntnis} „die Vermutung, Jo{hannes} hätte den Ausdruck vermieden als Bestandteil einer Richtung, zu der samt ihrem himmlischen Erlöser er sich im Gegensatz fühlte“. Dennoch aber offenbare der Evangelist dadurch enge „Beziehungen zur ,Gnosis‘, daß er das Verbum ginōskein weit häufiger gebraucht, als irgendeiner der Synoptiker“. In 8,30-32 erscheine „die Erkenntnis der Wahrheit insofern als etwas den Glauben Überlegenes, als nur ein Verharren im Glauben zur Erkenntnis (werde). … „Das energische Drängen auf Erkenntnis, dem die stete Wiederkehr des Begriffs alētheia {Wahrheit} (1,14.17; 4,23f; 5,38; 8,32.34.40.44 u. ö.) und die Vorstellung von Christus als dem Licht (1,4-9; 3,19; 8,12; 9,5; 12,46) entspricht, offenbart den hellenistischen Charakter der Religiosität unseres Evangelisten …“. Das sucht Bauer durch zahlreiche Belege aus philonischen und gnostischen Texten … zu begründen…
Nach Thyen (T686) ist es jedoch „ein unmöglicher Gedanke“, dass
Johannes ausgerechnet im Anschluß an seine Rede von dem ,einzig wahren Gott‘, die im übrigen Evangelium ohne Parallele ist und als Spiel mit dem ,Höre Israel!‘ „den jüdischen Monotheismus in hervorragender Weise zum Ausdruck bringt“, <1198> halb in die Arme der Gnosis gezogen und halb darin versunken sein soll …, zumal der Evangelist auch mit seiner Bezeichnung der Erkenntnis Gottes als Grund ewigen Lebens „das ganze Gewicht des Alten Testaments“ hinter sich hat.
Erstaunlich klar und konkret hebt Thyen an dieser Stelle die diesseitige Wirklichkeit der endzeitlichen Hoffnungen und Verheißungen der jüdischen Schriften hervor:
Im Eschaton wird die Erkenntnis der Herrlichkeit JHWHs die ganze Erde erfüllen …, so wie die Wasser das Meer bedecken (Hab 2,14). Solche Erkenntnis ist kein theoretisches Wissen um eine jenseitige Wirklichkeit Gottes, sondern die praktische Wahrnehmung seiner heilvollen Gegenwart in dieser Welt. Nach Hos 4,1 sind Israels Treue und Liebe (ˀemeth und chessed – LXX: alētheia und eleos) die notwendigen Implikationen von Gotteserkenntnis (daˁath ˀelohim – epignōsis theou), und wo sie fehlen, ist auch keine Erkenntnis Gottes (daˁath ˀelohim: Hos 4,6; vgl. Hos 6,3.6: „Laßt uns streben, JHWH zu erkennen [LXX: kai gnōsometha diōxomen tou gnōmai ton kyrion]. Sein Aufgang ist sicher wie die Morgenröte. Er wird zu uns kommen, wie der Regenguß, wie der Frühlingsregen, der die Erde tränkt. … Denn Liebe will ich, nicht Opfer, Gotteserkenntnis, nicht Brandopfer“…
Nachdem Thyen „zu dieser Art der durch den Glauben vermittelten praktischen Erkenntnis auch die schönen rabbinischen Belege bei Wengst“ positiv würdigt, die ich oben zitiert habe, kommt er zu den Fazit:
Es geht also nicht um eine den Glauben überbietende und ihn hinter sich lassende theoretische Erkenntnis propositionaler Sätze über Gott, nicht um das Für-Wahr-Halten der Aussagen des Credos (so Bauer), sondern um die praktische Wahrnehmung der mit dem Evangelium erschienenen neuen Welt Gottes, die sich allein dem Glauben, nicht aber dem Schauen erschließt.
In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Zitat von Johannes Fischer [32] außerordentlich spannend zu lesen (T686f.):
„Der Gedanke der Jenseitigkeit der Wirklichkeit Gottes meint nicht, wie es ein Supranaturalismus unterstellt, eine Art ,höherer Welt, die als solche in dieselbe theoretische Erkenntnisperspektive fällt wie die sichtbare Welt (mag auch die theoretische Erkenntnis hier an ihre Grenze stoßen). Dieses Mißverständnis führt zu einer Verdoppelung der Wirklichkeit und zieht die Erkenntnis des Glaubens von der sinnlich erfahrbaren Welt fort zu den Fragen und Problemen einer anderen Sphäre. Damit aber besteht die Gefahr, daß die Wahrnehmung und Erfahrung der wirklichen Welt der Beliebigkeit, d. h. anderen Mächten, Gestalten und Wahrheiten überlassen bleibt. … Für den Glauben meint die Jenseitigkeit Gottes nicht eine besondere Sphäre innerhalb des Bereichs der theoretischen Erkenntnis, sondern ein Jenseits der theoretischen Erkenntnis“.
Diese Äußerungen lassen mich hoffen, dass auch Thyens Johannes-Exegese letzten Endes offener ist, als ich dachte, für eine auf die Überwindung der real existierenden diesseitigen Unordnungen dieser Welt ausgerichtete Interpretation der johanneischen Endzeiterwartungen.
Nach diesen langen Erwägungen zu dem erläuternd eingeschobenen Vers 3 wendet sich Thyen (T687) nun Vers 4 zu. Hier beginnt Jesus
mit der Entfaltung seiner in den beiden ersten Versen vorgetragenen ,Grundbitte‘ an den Vater. Hatte er in dieser Grundbitte von sich selbst in dritter Person als dem ,Sohn‘ geredet und sich in dem parenthetischen V. 3 ebenfalls in dritter Person als „den du gesandt hast, Jesus Christus“ bezeichnet, so setzt mit dem V. 4 eröffnenden egō nun der genuin johanneische Ich-Stil ein, der das gesamte folgende Gebet beherrscht …: „Ich habe dich auf Erden verherrlicht (egō se edoxasa), indem ich das Werk vollendet habe, das zu vollbringen, du mir aufgetragen hast. Und nun verherrliche du auch mich, Vater, bei dir selbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war“.
An dieser Stelle geht Thyen auf den in seinen Augen „aus mehreren Gründen“ problematischen Einwand von Wengst ein, mit dem ich mich oben beschäftigt habe,
daß hier „die Grenze des Bildes vom Boten deutlich“ werde, weil Jesus ja gar nicht „wie ein Gesandter zu seinem Auftraggeber ,zurückkehren‘ (könne)“. Seine Rückkehr setze vielmehr voraus, daß der Vater ihn ,verherrliche‘, ihn nicht im Tode belasse, sondern ihn von den Toten auferwecke.
Das entscheidende Problem bei diesem Einwand besteht Thyen zufolge darin, dass „die Gesandten-Metaphorik … im Evangelium“ bereits „dadurch an ihre Grenze“ stößt, „daß Jesu Rede von seinem Einssein mit dem Vater ihre wahre Grenze markiert.“ Denn nach Käsemann [31 u. ö.] wechselt „die Formel, ,der Vater, der mich gesandt hat‘, unablässig mit der anderen vom Einssein mit dem Vater, welche ihr erst ihren spezifisch christologischen Sinn gibt“.
Damit verbunden ist nach Thyen der Umstand, dass es Jesus gar nicht nötig hat, vom Vater auferweckt zu werden:
Mit dem Vater teilt Jesus das göttliche Privileg, wen immer er will, lebendig zu machen (zōopoiein 5,21), weil allein er das Leben in sich selbst hat, wie sein Vater (5,26). Die Worte, die er geredet hat, sind Geist und Leben (6,63). Als derjenige, der die Auferstehung und das Leben in Person ist (11,25), gibt er den Seinen das ewige Leben (10,28). Ja, auch wenn seine Jünger ihn alle im Stich lassen werden, ist er doch nicht allein, denn der Vater ist stets mit ihm (16,32). Und wie er die exousia hat, sein Leben (tēn psychēn mou) hinzugeben, so hat er auch die Vollmacht, sein Leben wieder an sich zu nehmen (palin labein autēn 10,17f). Nicht zufällig ist darum in unserem Evangelium von einer Erweckung des toten Jesus durch Gott nirgendwo die Rede. Vielmehr wird Jesus den von den Ioudaioi niedergerissenen Tempel (seines Leibes!) binnen dreier Tage selbst wieder errichten (en trisin hēmerais egerō auton: 2,18ff); dementsprechend hat das Passiv: hote oun ēgerthē ek nekrōn: 2,22) die Bedeutung: als er dann auferstanden war von den Toten…
Weiter (T688) führt Thyen gegen Wengst das Argument ins Feld, dass dieser
mit der Reifizierung {Vergegenständlichung} des Abstractums logos Subjekt und Prädikat vertauscht. Denn, wie zum Prolog … bereits begründet wurde, ist das einzig reale Subjekt unseres Evangeliums der jüdische Mann Jesus. Und ebenso wie die Rede von Jesu Präexistenz-Herrlichkeit ist logos sein Prädikat und nicht irgendein gegenständlicher logos asarkos {nichtfleischlicher Logos}, der vom Fleischgewordenen getrennt werden könnte.
Gegen diese Unterstellung hat sich Wengst, wie im vorigen Abschnitt erwähnt, mit guten Gründen gewehrt. Auch ich denke, dass seinem Einwand eher zu Grunde liegt, dass eben der jüdische Mensch Jesus nichts anderes verkörpert als das Wollen und Wirken des Gottes Israels, das sich immer schon in seinem zur Tat werdenden Wort, davar, logos, ausgedrückt hat. Damit ist in den biblischen Schriften ja keine von Gott abtrennbare Gestalt gemeint, die im Himmel neben Gott existieren würde, auch wenn es metaphorisch von der Weisheit, sophia, heißt (Sprüche 8,30), dass sie schon bei der Schöpfung bei Gott war und vor ihm spielte.
Andererseits passt Thyens Betonung der Menschlichkeit des jüdischen Mannes Jesus und seine Kritik an der Verjenseitigung des johanneischen Glaubens und Wissens nicht recht zusammen mit seiner Stilisierung Jesu als eines übernatürlich wirkenden Menschen, der sich selbst problemlos wieder zum Leben erwecken kann.
Betrachten wir mit diesen Fragen im Kopf weiter Thyens Gedankengang:
Daß Jesu egō-eimi-{ICH-BIN-}Worte, zumal in ihrer prädikationslos-absoluten Gestalt, absichtsvoll mit dem „Deutero-Jesaja“ genannten Abschnitt des Jesaja-Buches spielen, haben wir bereits mehrfach beobachtet … Gerahmt ist dieser Teil des Jesajabuches durch die Sentenzen: „Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit“ (40,8) am Anfang und am Ende mit dem Wort: „Wie der Regen und der Schnee vom Himmel kommen und nicht wieder dahin zurückkehren, es sei denn, sie hätten zuvor die Erde getränkt …, so soll auch das Wort sein, das ausgeht aus meinem Munde. Es soll wahrlich nicht zu mir zurückkehren, ehe es nicht vollbracht hat, was ich wollte (syntelesthē hosa ēthelēsa), und ehe es nicht meine Gebote zu meinem Wohlgefallen erfüllt hat“ (55,10f).
Tatsächlich ist Jesus im Johannesevangelium die Verkörperung genau des befreienden NAMENS des Gottes Israels, auf den die ICH-BIN-Worte Bezug nehmen, und insofern auch genau des hier von Deuterojesaja angesprochenen Wortes. Interessant ist, dass Thyen mit dem letzteren Zitat Veerkamps These bestätigt, dass nach Johannes der Messias und Menschensohn Jesus mit seiner Auferstehung keineswegs bereits endgültig zum VATER aufgestiegen ist, da die Befreiung der Welt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, „noch nicht“ vollendet ist.
Thyen hat aber noch mehr gegen Wengst vorzubringen:
Da der erzählte Jesus in Texten wie Joh 17,5.24; 6,33ff.42.62 u. ö. völlig unzweideutig von seiner Präexistenz und Herrlichkeit beim Vater noch vor Grundlegung der Welt spricht, kann man doch schwerlich bestreiten, daß für Johannes nicht irgendein abstrakter logos, sondern Jesus der präexistente Schöpfungsmittler ist. … Johannes [hat] den Schöpfungsglauben konstitutiv in der Christologie verankert, sofern nämlich Jesus Christus als der göttliche Logos die Welt transsubjektiv als Gottes Schöpfung erschließt.
Das sieht auf den ersten Blick wieder einmal so aus, als würde Thyen die Aussage der Präexistenz Jesu und seiner Mitwirkung bei der Schöpfung direkt auf den Menschen Jesus beziehen, als ob er persönlich schon damals existiert hätte und sich daran erinnern könnte. Eine darauf bezogene Erklärung von Johannes Fischer <1199> stellt aber klar, dass offenbar auch Thyen nicht wirklich so denkt, sondern sich des metaphorischen Charakters solcher Aussagen über die Person Jesu bewusst ist:
Denn „in ihm und seiner Geschichte wird offenbar, wie Gott selbst seiner Schöpfung zugewandt ist und wie folglich die Wirklichkeit im Ganzen von Gott her zu sehen ist. Damit ist es vom Neuen Testament her evident, daß die Aussage der Gottessohnschaft bzw. der Gottheit Jesu nicht im Sinne intersubjektiver Bestimmtheit zu verstehen ist, so als würden dem Menschen Jesus damit auch noch göttliche Qualitäten zugeschrieben. Zwar ist es richtig, daß man im Neuen Testament Aussagen finden kann, die ein solches Verständnis nahelegen könnten. Doch die eigentliche Pointe der Aussage der Gottheit Jesu liegt im Logos-Charakter seiner Person und Geschichte, in welcher die Wirklichkeit im Ganzen offenbar wird, wie sie von Gott her ist, und man verfehlt eben diesen Sinn, wenn man die Gottheit Jesu in bestimmten Eigenschaften aufzuweisen sucht, die der vor knapp 2000 Jahren lebende Jesus zusätzlich zu seinen menschlichen Eigenschaften besessen haben soll. Wenn aber die Aussage der Gottheit Jesu Christi auf den transsubjektiven Offenbarungscharakter seiner Geschichte zielt, dann folgt daraus, daß die biblischen Texte, in denen Jesus als ,Sohn Gottes‘ oder ,Gott‘ zur Sprache kommt, angemessen nur in der Einstellung des Hörens rezipiert werden können, bei welcher der Blick gerade nicht auf ihn gerichtet ist, sondern vielmehr auf die Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, so daß das, was über ihn gesagt wird, über diese Wirklichkeit gesprochen ist und ihr als ihre Bestimmtheit durch ihn zugesprochen wird“.
Was in diesem Zusammenhang Begriffe wie „transsubjektiver Offenbarungscharakter“ genau bedeuten sollen, bleibt allerdings immer noch offen. Sind sie auch offen für eine Auslegung, die davon ausgeht, dass im gesamten Wollen und Wirken Jesu einschließlich der freiwilligen Hingabe seines Lebens sich einzig und allein der NAME des Gottes Israels offenbart, um Israel inmitten der Völker von der Weltordnung zu befreien, die auf dem ganzen Erdkreis lastet?
Unter Bezug auf Formulierungen von Fischer schließt Thyen seine Argumentation gegen Wengst folgendermaßen ab (T689):
Nicht im Sinne des transsubjektiven Offenbarungscharakters der Geschichte Jesu, sondern in dem intersubjektiver Bestimmtheit urteilt Wengst, wenn er erklärt: „Von sich aus (könne) Jesus gar nicht wie ein Gesandter zu seinem Auftraggeber ,zurückkehren‘. Seine ,Rückkehr‘ (könne vielmehr) nur gelingen, wenn der Vater ihn ,verherrlicht‘, wenn Gott ihn nicht im Tode beläßt, sondern von den Toten auferweckt“. Diese Verschiebung der Vollmacht, die Toten aufzuerwecken, von Jesus auf Gott ist aber nicht minder problematisch. Denn sie setzt eine Art von Theismus voraus, nach der Gott ontologisch definiert werden kann und unabhängig von seinem Wort existiert, wirkt und erkennbar ist.
Wenn Thyen aber einen „Theismus“ für problematisch hält, im Rahmen dessen es zu Gottes Wesen gehört, Menschen vom Tode erwecken zu können, ist dann ein Glaube an Gott, der nur durch sein Wort „existiert, wirkt und erkennbar ist“, nicht weniger problematisch, wenn er damit verbunden sein soll, dass im Zuge dessen Jesus dazu im Stande sein soll, sich selbst aus dem Tode zu erwecken?
[14. Dezember 2022] Ton Veerkamp <1200> verbindet die Beschäftigung mit der Gebetshaltung Jesu in Johannes 17,1b mit einem grundsätzlichen Bekenntnis zur Diesseitigkeit biblischer Hoffnungen, die davon ausgeht, dass der Himmel keinen für Menschen zugänglichen Raum darstellt (vgl. dazu auch seine Auslegung von Johannes 1,51):
Der Messias betet, wie Israel betet, Psalm 121,1; 123,1 usw., „er erhob seine Augen zum Himmel“. Der Himmel ist das, wo der Messias her kommt. Der Himmel ist nicht ein Ort, deswegen schreiben wir „das“. Der Himmel, unerreichbar für Menschen, ist die Verborgenheit Gottes. Er kommt aus der Verborgenheit Gottes und geht wieder hinein in die Verborgenheit Gottes. Das heißt: Das, was unsere letztgültige Loyalität beanspruchen kann, eben „Gott“, entzieht sich letztlich allem, was wir planen, entwerfen und ausführen können. Der Messias ist und bleibt vom Himmel her.
Der Himmel ist für Menschen grundsätzlich geschlossen. Das zweite Schöpfungswerk Gottes, jenes „Gewölbe“ (raqiaˁ) von Genesis 1,7, riegelt jenen himmlischen Bereich hermetisch gegen die irdische Realität ab. Der Himmel kann nie Bestimmung der Menschen, des menschlichen Lebens, sein. Der Messias bleibt „da“, aber nie als Element unseres Planens.
Also nicht um irgendwie als Gottmensch oder als verstorbene Seele in den Himmel zurückzukehren, beginnt Jesus sein Gebet zum Vater. Sein ganzer Wille ist vielmehr auf das gerichtet, was in den Schriften kavod, doxa, „Ehre“ Gottes heißt:
Die Augen auf den verschlossenen Himmel gerichtet, sagt Jesus: „VATER, gekommen ist die Stunde, ehre deinen SOHN.“ Die Stunde ist die Stunde der Ehre. Der Satz knüpft an 12,27 an:
„Jetzt ist meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen?
Befreie mich (hoschiˁeni) aus dieser Stunde?
Aber gerade deswegen bin ich in diese Stunde gekommen.
VATER, gib deinem Namen die Ehre!“
Es kam eine Stimme vom Himmel:
„Auch ich habe geehrt,
und ich werde ehren.“
Aber worin genau besteht diese Ehre Gottes, die üblicherweise fast immer als Verherrlichung bezeichnet wird? Nach Veerkamp muss man sich bei der Auslegung dieses Wort daran erinnern, dass bereits in den jüdischen Schriften die Ehre Gottes ganz und gar auf die Befreiung und das Leben des Volkes Israel ausgerichtet war:
Die Stunde ist die Erfüllung des Auftrages Gottes, der sein ganzes Wesen bestimmt. Es geht um die Ehre Gottes, der die Ehre des Messias ist, so wie die Ehre des Messias die Ehre Gottes ist. Und die Ehre Gottes und des Messias ist Israel, und zwar Israel befreit aus dem weltweiten Sklavenhaus Roms.
In dem Satz: „Ehre den SOHN, damit der SOHN dich ehrt“, sieht Veerkamp einen Bezug zu den Vorstellungen vom Sohn Gottes und vom Menschensohn, die bereits beide im Johannesevangelium eine Rolle gespielt haben:
SOHN ist hier der „Menschensohn“ und der „Gottessohn“, er ist der bar enosch und so der „wie-Gott“, wie wir hyios theou immer übersetzt haben.
Dass hier die Vorstellung vom Gottessohn ganz klar mit dem Bild des Menschensohns aus Daniel 7,13 verknüpft ist, zeigt Vers 2, den Veerkamp so übersetzt:
17,2 So hast du ihm Vollmacht über alles Fleisch gegeben,
dass er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen geben wird:
Leben für die kommende Weltzeit.
Dazu bemerkt Veerkamp in seiner Anm. 486 zur Übersetzung von Johannes 17,2:
„Ihm, dem bar enosch, dem MENSCHEN, wurde Macht (aramäisch schaltan, griechisch exousia bzw. archē), Ehrung und Königtum gegeben, alle Völker, Gemeinschaften, Sprachgruppen sollen ihm dienen“, Daniel 7,14.
Vers 3 wiederum lässt keinen Zweifel daran, dass beide Bezeichnungen Jesu als Gottes- und Menschensohn von der Erkenntnis des Gottes Israels her begriffen werden müssen, der Jesus als seinen Messias in die Welt gesandt hat, um das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker anbrechen zu lassen:
17,3 Und dies ist das Leben für die kommende Weltzeit,
dass sie dich erkennen, den einzigen vertrauenswürdigen GOTT,
und den du gesandt hast: Jesus Messias.
Von dieser auf Israel und seinen Gott konzentrierten Auslegung her begreift Veerkamp auch die Verse 4 bis 5, in denen nochmals von der wechselseitigen Ehrung des VATERS durch den Sohn und umgekehrt die Rede ist:
Die Ehre des Messias setzt voraus, dass er die Weltordnung besiegt hat und dass die (aus Israel), die der VATER ihm gegeben hat, Leben der kommenden Weltzeit haben werden. Das ist die Ehre Gottes, und nun soll Gott ihn ehren mit jener Ehre, die er bei Gott hatte, „bevor die Weltordnung ins Dasein kam“.
Was aber kann diese Aussage über Jesus im Rahmen der Veerkampschen Lektüre des Johannesevangeliums konkret meinen?
Dieser Ausdruck ist für die christliche Orthodoxie ohne große Geheimnisse. Kosmos sei hier einfach „Welt“, also Weltraum, also Schöpfung. Hier denke Johannes, so sagt die Orthodoxie, an die Präexistenz der zweiten Person der Trinität. Woran Johannes gedacht haben mag, wissen wir nur aus dem Text, der uns vorliegt. Aus dem Text ergibt sich weder eine metaphysische noch eine theologisch-orthodoxe Präexistenz. Das wird aber erst in 17,24: pro katabolēs tou kosmou, vor der Verwerfung der Weltordnung, klar werden.
Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bevor wir näheren Aufschluss darüber erhalten, wie Veerkamp sich die Beziehung zwischen Jesus und dem kosmos genau vorstellt.
↑ Johannes 17,6-8: Die Bekanntgabe des NAMENS an diejenigen, die SEIN Wort bewahrt und Jesu Worte als von IHM ausgegangen angenommen haben
17,6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart,
die du mir aus der Welt gegeben hast.
Sie waren dein,
und du hast sie mir gegeben,
und sie haben dein Wort bewahrt.
17,7 Nun wissen sie,
dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt.
17,8 Denn die Worte, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben,
und sie haben sie angenommen
und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin,
und sie glauben, dass du mich gesandt hast.
[15. Dezember 2022] In den Versen 6 bis 8 blickt Jesus Klaus Wengst zufolge (W467) „in der Weise auf sein Werk zurück, dass er darlegt, was er für die Seinen getan hat und wie sie es aufgenommen haben“. Als erstes sagt er: „Ich habe Deinen Namen bekannt gemacht.“ Aber wie hat er das getan? Wengst erwägt dazu mehrere Möglichkeiten, die er verwirft:
In der Bibel hat Gott einen Namen, geschrieben mit den vier Konsonanten JHWH, aber im Judentum schon lange vor Jesu Zeit nicht mehr ausgesprochen aus Respekt vor Gottes Einzigkeit. Nur der Hohepriester rief ihn einmal im Jahr aus, wenn er – solange der Tempel stand – am Versöhnungstag allein im Allerheiligsten war. Dass hier im Johannesevangelium ausgesagt sei, Jesus habe seinen Schülern den nicht ausgesprochenen und nicht auszusprechenden Namen Gottes mitgeteilt, ist nicht im Mindesten angezeigt.
Was Wengst mit diesem Satz genau meint, ist mir nicht klar. Will er damit sagen, dass die Schüler diesen Namen ja schon kannten und es nicht nötig hatten, mit ihm bekannt gemacht zu werden? Oder verwahrt er sich gegen die Vorstellung, dass Jesus den nicht auszusprechenden Namen Gottes doch ausgesprochen und damit erst in rechter Weise bekannt gemacht hätte? Mit beidem hätte er sicher Recht, und ebenso auch mit der Abweisung einer dritten unmöglichen Möglichkeit (W467f.):
Ebenso wenig ist gemeint, dass Gott vorher in Israel unbekannt oder nicht hinreichend bekannt gewesen wäre und jetzt von Jesus erschlossen würde. Das wird im Johannesevangelium an keiner Stelle behauptet, sondern das Gegenteil vorausgesetzt. Jesus hat wiederholt betont, dass er nichts als das Werk Gottes vollbringt, dass in dem, was er sagt und tut, Gott handelt. Genau darum, um die Präsenz Gottes in Jesus, geht es auch hier. Jesus hat nicht einen zuvor unbekannten Gott offenbart, sondern der in Israel bekannte und bezeugte Gott tritt in Jesu Reden und Tun auf den Plan.
Was sonst steht nach Wengst dann aber im Hintergrund von Jesu Aussage von seiner Bekanntmachung des Namens Gottes? Es ist in seinen Augen ganz klar (W468)
die für die Deutung des Gottesnamens zentrale Stelle Ex 3,14, wo es in Gottesrede heißt: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Gott wird sich im Mitgehen mit seinem Volk als helfender und rettender Gott erweisen, grundlegend bei der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und dann weiter in der Geschichte dieses Volkes Israel. Nach Ps 22,23 sagt „David“: „Ich will von Deinem Namen meinen Geschwistern erzählen, inmitten der Gemeinde Dich preisen.“
Sowohl Schnackenburg als auch Bultmann <1201> lehnen „einen möglichen Bezug auf diese Psalmstelle ab“, weil sie davon ausgehen, dass es sich, wie Schnackenburg sagt, hier „um ein rühmendes Nennen Gottes handelt, nicht um Offenbarung“. Aber genau diese Annahme, „dass es in Joh 17,6 um „Offenbarung“ von zuvor Unbekanntem ginge“, ist ja eben falsch, auch wenn (Anm. 201) Bultmann sie voraussetzt, der
nach der Zitierung einiger vermeintlich paralleler Stellen aus Gnosis und Hellenismus ohne jede Begründung fortfährt: „Nicht zu vergleichen ist also {Ψ 21,23“ (womit er sich auf Psalm 22,23 in der griechischen Version der Septuaginta bezieht)}. Er spricht sie ausdrücklich aus, wenn nach ihm für Johannes Gottes Name „nichts anderes ist als die Offenbarung, durch die Jesus Gott kenntlich macht“.
Eben weil es im Gebet Jesu von Anfang an so betont um die Ehre des Gottes Israels und seines Messias Jesus geht, ist es doch alles andere als abwegig, die Bekanntmachung des Namens dieses Gottes genau im Sinne von Psalm 22,23 zu verstehen:
Das „rühmende Nennen Gottes“ bezieht sich auf bestimmte Situationen, in denen Gottes helfende und rettende Gegenwart erfahren wurde, in denen er spricht: „Hier bin ich.“ So verheißt Gott in Jes 52,6 gegenüber der Lästerung seines Namens bei den Völkern, die Israel Gewalt antun: „Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag. Ja, ich bin‘s, der da spricht: Hier bin ich.“ Jesus hat also den Namen Gottes so bekannt gemacht, dass auf seinem Weg immer wieder Gott als der erkennbar wird, der sein „Hier bin ich“ spricht.
An dieser Stelle folgt wiederum eine Argumentation von Wengst, der bis zu einem bestimmten Punkt vollkommen zuzustimmen ist:
Jesus spricht im Johannesevangelium von Gott vor allem als seinem Vater. Gott wird in diesem Evangelium so bekannt gemacht, dass dessen Verhältnis und Verhalten zu Jesus dem von Vater und Sohn entspricht. Dabei sollte aber nie vergessen werden, dass das eine metaphorische Aussage und keine Wesensaussage ist. Gott, der sich im Evangelium Jesus gegenüber als Vater zeigt, ist derselbe Gott, nach dessen Namen Mose gefragt hat (Ex 3,13), der sich ihm als Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs vorstellt (Ex 3,6) und sein Mitsein denen verspricht, die sich auf den Weg mit ihm einlassen (Ex 3,14).
Dann aber beschreibt Wengst die späteren Auswirkungen des Johannesevangeliums, allerdings ohne zu bedenken, ob diese bereits in der Absicht des Evangelisten selbst gelegen haben:
Das Evangelium hat so gewirkt, dass durch Jesus Menschen aus den Völkern Zugang zum Gott Israels fanden, indem sie ihn als Vater Jesu kennenlernten. Sie verlassen sich darauf, dass Gott in Jesus, gerade im Gekreuzigten, sein „Hier bin ich“ gesprochen, ihn „verherrlicht“ hat.
Dabei lässt Wengst die Möglichkeit außer Acht, dass Johannes das befreiende Wirken des NAMENS im Sinne von 2. Mose 3,14 und Psalm 22,23 ganz und gar auf die Befreiung Israels bezogen haben könnte. Sie muss sich zwar inmitten der Völker abspielen, da sie unter den Bedingungen der weltweiten Herrschaft Roms nur möglich ist, wenn die gesamte Menschenwelt von der Weltordnung befreit wird, die auf ihr lastet, aber von einer generellen Völkermission redet Johannes an keiner Stelle; allenfalls „einige Griechen“, die sich für Jesus interessieren, nimmt er in 12,20 sehr zurückhaltend in den Blick.
Als Beleg dafür, dass es bei der Bekanntmachung des Namens Gottes keineswegs um die Offenbarung eines neuen Gottesnamens geht, führt Wengst als „sachliche Entsprechung“ zu Johannes 17,6 „die Rezeption von Jes 52,6“ in der rabbinischen Tradition <1202> an (W468f.):
Nach der Zitierung von Ps 91,14 heißt es: „Rabbi Jehoschua ben Levi sprach im Namen des Rabbi Pinchas ben Jair: ,Warum beten die Israeliten in dieser Weltzeit und werden nicht erhört? Weil sie den wunderbaren Namen Gottes nicht kennen. Aber in der kommenden Zeit macht der Heilige, gesegnet er, ihnen seinen Namen bekannt. Denn es ist gesagt (Jes 52,6): Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen (- an jenem Tag. Ja, ich bin‘s, der spricht: Hier bin ich). Zu jener Stunde beten sie und werden erhört. Denn es ist gesagt (Ps 91,15): Er wird mich anrufen und ich will ihn erhören.‘“ Angesichts der Erfahrung, dass Gebete nicht erhört werden, wird unter Einspielung von Jes 52,6 das rettende „Hier bin ich!“ Gottes für die Zukunft erwartet. Demgegenüber beharrt aber Rabbi Jizchak im Namen Rabbi Chijas in weiterer Lektüre des Psalms und Einspielung einer anderen Psalmstelle darauf, dass Gott so auch jetzt schon spricht: „Wenn sie mich in der Stunde bitten, da Bedrängnis sie trifft, erhöre ich sie sofort {469} (Ps 91,15): Er wird mich anrufen und ich will ihn erhören. Bei ihm bin ich in der Bedrängnis; ich will ihn retten und ihn verherrlichen. Und so spricht er (Ps 50,15): Er wird mich anrufen am Tag der Bedrängnis; ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen.“
Es bleibt noch der Rest von Vers 6 auszulegen. Wer sind denn (W469) die Adressaten, denen „Jesus den Namen Gottes bekannt gemacht hat“? Nach Wengst sind es
die „Menschen, die Du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast Du sie gegeben.“ Dass Jesus hier und im Folgenden die Seinen und nicht die Welt nennt, sollte nicht verwundern. Er hat ja im Effekt den Namen Gottes nur denjenigen bekannt gemacht und bekannt machen können, denen im Blick auf ihn und seinen Weg die Gegenwart Gottes erkennbar geworden ist, die sich darauf einlassen, dass es so sei. Das ist keine Einschränkung der in 3,16 ausgesprochenen Perspektive auf die Welt. Das Wirken Jesu wird hier unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass und wo es zum Ziel kommt, nämlich in der auf ihn bezogenen Gemeinde. Sie versteht sich in erster Linie als Gegebenheit Gottes und diese Gegebenheit wird von ihr so wahrgenommen, dass sie Jesu Worte als Wort Gottes bewahrt und bewährt: „Und Dein Wort haben sie gehalten.“
Will man als christlicher Theologe das Johannesevangelium für die Völkerkirche in Anspruch nehmen, ist das eine schlüssige Argumentation. Offen bleibt aber, ob nicht ursprünglich die Gruppierung um Johannes auf die Sammlung und Befreiung eines Restes von Israel (einschließlich Samaria, der jüdischen Diaspora und einzelner Gottesfürchtiger aus den Völkern) ausgerichtet war, der bereit sein würde, auf den Gott Israels und seinen Messias zu hören.
In den Versen 7 und 8 entfaltet Jesus beides weiter, sowohl „Gemeinde als Gegebenheit Gottes“ als auch „das Bewahren der Worte Jesu als Wort Gottes“, indem er zunächst feststellt:
„Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was Du mir gabst, von Dir ist.“ Noch einmal betont er, dass er nicht von sich aus handelt, sondern dass durch ihn niemand sonst als Gott zur Wirkung kommt. Er begründet das so: „Denn die Worte, die du mir gabst, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von Dir ausgegangen bin, und geglaubt, dass Du mich gesandt hast.“
Diese Verse könnte man als Widerspruch zur zweiten Abschiedsrede empfinden, denn als „dort die Schüler bekannten, ‚jetzt‘ zu wissen und zu glauben, wobei hinsichtlich des Ausgangs Jesu von Gott dieselbe Wendung begegnete wie hier, hat Jesus das als vorzeitigen Glauben kritisiert (16,29-32).“ Wengst fragt sich also im Blick auf das Wort nyn am Anfang von Vers 7: „Wie ist das „Jetzt“ zu verstehen?“, und gibt eine Antwort, die der Gemeinde der Zukunft einen solchen echten Glauben im Sinne der Aussage Jesu zutraut:
Es liegt bei diesem Gebet keine andere „Situation“ vor als bei der zweiten Abschiedsrede. … Wenn er „jetzt“ ihr Erkennen und Glauben feststellt, ist das im Blick auf die erzählte Situation eine proleptische Aussage, die von der das Evangelium lesenden und hörenden Gemeinde als für sie zutreffend bejaht und begriffen werden soll. Ihr sind Jesu Worte gegeben; sie hat sie als Wort Gottes angenommen. Damit ist aber sie ihrerseits diesem Wort übergeben und erfährt sich so selbst, indem sie sich darauf einlässt, als Gegebenheit Gottes.
Hartwig Thyen (T689) weist zu den Anfangsworten von Vers 6 „mit der Nennung des Namens Gottes“ zunächst darauf hin, dass sie „zusammen mit der das Gebet beschließenden Wendung“ in 17,26a „eine förmliche inclusio {Umschließung}“ bilden:
Der parallele Gebrauch der Lexeme phaneroun am Anfang dieser Inklusion und von gnōrizein an deren Ende zeigt, daß die beiden Verben hier in der Bedeutung von Kundmachen als Synonyma gebraucht sind und bestätigt so die schon des öfteren beoabachtete Vorliebe unseren Erzählers für das Spiel mit synonymen Ausdrücken …
Mit Bezug auf von Wengst angeführte Argumente wendet sich aber auch Thyen gegen „Bultmanns <1203> Wiedergabe der Lexeme durch ,offenbaren‘“, und ihm erscheint
seine dementsprechende Kommentierung, daß „für den Evangelisten die Mitteilung des Gottesnamens nicht mehr die Übermittlung eines geheimnisvollen, machthaltigen Namens (bedeute), der im Mysterium, in der Himmelsreise der Seele oder im Zauber durch das Aussprechen wirksam wird, sondern die Erschließung Gottes selbst, die Erschließung der alētheia“, zumindest höchst mißverständlich. Denn zum einen vermögen wir das Lexem alētheia {Wahrheit} nicht mit Bultmann als ,die göttliche Wirklichkeit‘ zu definieren, sondern müssen es mit Joh 14,6 sehr viel konkreter auf Jesus als den fleischgewordenen logos {Wort] und auf die geschriebenen logoi {Worte} beziehen, die von ihm zeugen. Und zum anderen könnte man Bultmanns Rede von der „Erschließung Gottes selbst“ ja so verstehen, als ob „Gott vorher in Israel unbekannt und unerschlossen gewesen wäre. Das wird im Johannesevangelium (aber) an keiner Stelle behauptet, sondern das Gegenteil vorausgesetzt“ {so Wengst, siehe oben}.
Außerdem missversteht Bultmann den biblischen Gottesnamen grundlegend, wenn er ihn in einen Topf mit Namen göttlicher oder dämonischer Mächte wirft, die zur Zwecken der Beschwörung oder der Magie ausgesprochen werden. Gerade die Unaussprechlichkeit des biblischen Gottesnamens verweist ja auf die Unverfügbarkeit des Gottes Israels, dessen NAME gerade nicht für irgendwelche gegen seinen befreienden Willen gerichtete Zwecke missbraucht werden darf.
In diesem Zusammenhang wiederholt Thyen, was er im „Anschluß an K. Barths Auslegung … zu Joh 14,6 begründet“ hat, nämlich
daß in unserem Evangelium nicht etwa der bekannte Mann Jesus für seinen unbekannten Vater im Himmel zeugt, sondern daß es durchgehend der bekannte Gott Israels ist, der für seinen unbekannten irdischen Sohn als Zeuge eintritt.
Weiter begründet Thyen, warum er in „Jesu Aussage ephanerōsa sou to onoma ktl. {ich habe deinen Namen offenbart usw.} … ein Spiel mit der Vater-Unser-Bitte um die Heiligung des Gottesnamens …: hagiasthētō to onoma sou {Geheiligt werde dein Name} (Mt 6,9)“ erblickt:
Denn auch die bei Johannes singuläre Wendung epi tēs gēs {auf Erden} in V. 4, die den Gegensatz zur Richtung des Gebets Jesu eis ton ouranon {zum Himmel} und seines bevorstehenden Weges markiert: kagō pros se erchomai {ich dagegen komme zu dir} (V. 11), hat in der Bitte: genēthētō to thelēma sou hōs en ouranō kai epi gēs {dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden} (Mt 6,10) ihre Entsprechung…
Obwohl „die Bezeichnung Gottes als des Vaters Jesu in unserem Evangelium mit 118 Vorkommen überaus häufig ist“ und die „Vater-Anrede in unserem abschiedlichen Gebet Jesu“ mehrfach gebraucht wird, hält Thyen (T690) die „Identifizierung des onoma {Namens} mit der Vater-Bezeichnung Gottes“ für „sicher verfehlt“:
Denn einmal ist Vater in unserem Evangelium kein Eigenname, sondern, abgesehen von 20,17 (s.u. z. St.), Ausdruck der einzigartigen Relation Jesu zu Gott als seinem Vater. Und zum andern ist die Vater-Bezeichnung Gottes als Ausdruck seiner Beziehung zu Israel und zum einzelnen Menschen dem Judentum – entgegen anderen Behauptungen – durchaus geläufig… Da Jesus nur hier und in 17,26 erklärt, den Namen Gottes kundgemacht zu haben, und da er in V. 11 u. 12 von diesem Namen gleich zweimal sagt, Gott ihn ihm gegeben habe (hō dedōkas moi), darf man sich wohl nicht mit der allgemeinen Auskunft begnügen, daß der Name hier einfach die Person Gottes oder gar sein ,Wesen‘ <1204> bezeichne. Man muß vielmehr an einen konkreten Gottesnamen denken. Ähnlich wie hier in V. 6 läßt der Psalmist den Sänger David Gott mit den Worten preisen: „Deinen Namen will ich meinen Brüdern kundtun, inmitten der Gemeinde will ich dich loben“ (Ps 22,23: LXX: diēgēsomai to onoma sou tois adelphois mou ktl. {auslegen werde ich deinen Namen meinen Brüdern usw.}; vgl. das den Prolog beschließende: ekeinos exēgēsato {der hat ausgelegt}). Daß dieser Psalm mit seinem „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ unserem Evangelisten geläufig ist, zeigt Joh 19,24, wo das Tun der Soldaten als Erfüllung des in Ps 22,19 Gesagten beschrieben wird: „Meine Kleider haben sie unter sich geteilt, und über mein Obergewand das Los geworfen“. In Hebr 2,12 ist Jesus der Sprecher der Worte von Ps 22,23: apangelō to onoma sou tois adelphois mou, en mesō ekklēsias hymnēsō se {Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir lobsingen}.
Somit sieht auch Thyen wie Bietenhard <1205> und Wengst „diesen Psalmvers im Hintergrund der Namensaussagen in Joh 17“ und lehnt wie Letzterer Schnackenburgs und Bultmanns Einwände dagegen ab. An der von Wengst angegebenen Stelle setzt Bultmann [380] „nämlich als den von seinem Evangelisten bearbeiteten Prätext auch für Joh 17 seine vermeintliche Quelle gnostischer Offenbarungsreden“ voraus, „wonach der Offenbarer himmlische Mysterien bringt“. Doch alle von Bultmann angeführten Belegtexte sind nach dem Johannesevangelium entstanden, mögen teilweise sogar von ihm abhängig sein und bieten „keine wirklichen Analogien“. Letzten Endes „dürfte es sich bei deren Spekulationen über den göttlichen Namen um die sekundäre Gnostisierung jüdischer Theologumena handeln, die bei Johannes noch viel ursprünglicher erscheinen“. Dazu verweist Thyen auf Brown, <1206> der noch „zwei weitere Texte aus den Nag-Hammadi-Codices“ zitiert, die (T691) „wohl darum näher bei unserem Evangelium“ sind, „weil sie es u. E. voraussetzen“, aber „mit ihrer genuin gnostischen Identifizierung des Sohnes mit dem Vater … weit über Johannes“ hinausgehen.
Es bleibt also mit Brown zu fragen, welches denn der Name Gottes sei, den Jesus kundgemacht hat. Dazu weist er darauf hin, daß der Gebrauch von haschem im Judentum ein Weg war, das unaussprechliche Tetragramm JHWH zu vermeiden. Zum ersten Mal findet sich diese Vermeidung in Lev 24,11 und 16. „Von da her wurde auch das Tetragramm JHWH vokalisiert …, was als = schɘmaˀ Name zu lesen ist“ [Bietenhard 268]. Bonsirven <1207> hat die frühe Rezeptionsgeschichte von Joh 17,6.11f u. 26 untersucht und gezeigt, daß die Väter bis zu den Tagen Cyrills von Alexandria und Augustins noch dazu neigten, die personale Relation des konkreten Namens zu betonen, während die späteren Kommentatoren darin nur noch eine Abstraktion für Person oder Wesen Gottes sahen. Mit Brown [756] und Wengst {siehe oben} folgen wir dieser Spur und sind der Meinung, daß Jesu egō eimi {IٔCH BIN}, das über die Texte Deuterojesajas ganz eng mit dem ˀehjeh ˀascher ˀehjeh {ICH BIN, DER ICH BIN} von Ex 3,14 verknüpft ist …, der göttliche Name ist, den der Vater ihm gegeben und den er den Menschen kundgetan hat.
Wie Wengst sich auf eine rabbinische Interpretation von Jesaja 52,6 berufen hat, so sieht Thyen in Jesaja 52,6: „Darum soll mein Volk meinen Namen erkennen. An jenem Tage soll es erkennen, daß ich es bin, der da spricht: Hier bin ich“, eine Parallele zu Jesu Erklärung gegenüber den Juden in Johannes 8,28: „Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, hoti egō eimi {das ICH BIN}“, so dass Brown <1208> [756] den Schluss ziehen kann:
„So ist auch der johanneische Jesus unter die Menschen gekommen, die den Namen Gottes als ‚Ich bin‘ nicht nur kennen, sondern sogar hören, weil er die Offenbarung Gottes an sein Volk ist“.
Dass Wengst „die Dinge … [g]anz ähnlich beurteilt“, habe ich oben bereits dargestellt. Dazu führt Thyen weiter aus (T691f.):
Es ist Israels Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Mose verheißen hatte: „Ich werde da sein, als derjenige, als der ich da sein werde“ (ˀehjeh ˀascher ˀehjeh: Ex 3,14), der durch Jesu Mund noch in der Stunde von dessen Verhaftung sein „Hier bin ich“ (egō eimi) spricht (Joh 18,5-8). Wenn Jesus seinem Vater betend erklärt, er habe dessen Namen den Menschen kundgetan, die Gott ihm aus der Welt heraus gegeben habe, wenn er hier und im folgenden nicht von der Welt oder der Menschheit, sondern allein von denen redet, die Gottes Eigentum waren, die er ihm aber anvertraut und für die er ihn verantwortlich gemacht habe, so sollte man das nicht auf irgendein Prädestinationsdogma zurückführen und darin keinen Widerspruch zu der universalen Perspektive von 3,16f wittern. Denn Jesus „hat ja im Effekt den Namen Gottes nur denen bekannt gemacht und bekannt machen können, denen im Blick auf ihn und seinen Weg die Gegenwart Gottes erkennbar geworden ist – die sich darauf einlassen, daß es so sei“ {so Wengst, siehe oben}. Und dieses Sich-Einlassen impliziert, daß sie das in Jesus unter ihnen gegenwärtige Wort Gottes gehalten und bewahrt haben (V. 6).
Ausdrücklich betont Thyen (T692), dass „der Satz: ‚Sie waren dein Eigentum, doch mir hast du sie anvertraut, und dein Wort haben sie gehalten‘, nicht bedeutet,
daß nicht auch alle anderen Menschen Gottes Eigentum wären und zu seiner Anbetung im Geist und in der Wahrheit gelangen sollten (4,22ff). Dazu wird Jesus die ihm Anvertrauten mit dem österlichen Geist begaben und sie in die Welt entsenden, so wie der Vater ihn gesandt hat (20,21f).
Ähnlich wie Wengst ist somit auch Thyen daran interessiert, die gesamte Völker- bzw. Menschenwelt als Adressaten des Johannesevangeliums zu begreifen, wobei Wengst den Akzent mehr darauf legt, dass die Hinzuerwählung der Völker durch den Gott Israels nicht auf Kosten der Erwählung Israels geht, während Thyen stärker daran interessiert ist, innerchristliche dogmatische Engführungen bezüglich der Vorherbestimmung zur Erlösung oder Verdammnis abzuwehren. Dass Johannes als jüdischer Messianist an der Völkerwelt als Missionsfeld seines Evangeliums noch gar nicht interessiert gewesen sein, sondern sich auf die Sammlung und Befreiung ganz Israels konzentriert haben könnte, liegt völlig außerhalb seiner Erwägungen.
Zu den Versen 7 und 8 hebt Thyen hervor, dass „der, der in Wahrheit nie allein ist, weil sein himmlischer Vater stets bei ihm ist (16,32), … hier aus der Perspektive des vollendeten Erlösungswerkes“ redet:
„Jetzt sind sie gewiß, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte (rhēmata), die du mir gegeben hast, die habe ich an sie weitergegeben und sie haben sie angenommen und erkannt, daß ich wahrlich von dir ausgegangen bin, und zum Glauben gefunden, daß du mich gesandt hast.“ In Jesu rhēmata ist für sie der logos Gottes laut geworden, den sie nach V. 6 gehalten haben.
Ähnlich wie Wengst meint auch Thyen, dass allein Jesus dieses „nyn samt dem Perfekt egnōkan, jetzt sind sie gewiß, … jetzt schon sagen“ kann, denn er redet wieder,
als sei er bereits zum Vater erhöht, als der, der im Gegensatz zu den Seinen nicht mehr in der Welt ist (V. 11). … Nähmen seine Jünger es dagegen – wie 16,29f – bereits jetzt in den Mund, so müßten sie sich erneut Jesu ironische Frage gefallen lassen: „Jetzt schon meint ihr zu glauben? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist bereits angebrochen, da ihr, ein jeder in das Seine, zerstreut und mich allein lassen werdet“.
Wie in Vers 3 bezeichnet Thyen zufolge auch in Vers 8 die
Wendung vom wahrhaften Erkennen … die praktische Erkenntnis des Glaubens, so daß egnōsan alēthōs {sie haben wahrhaftig erkannt} und episteusan {sie sind zum Glauben gekommen} die beiden Seiten der einen Medaille sind. … Dementsprechend sind auch die beiden abschließenden hoti-Sätze, daß ich von dir ausgegangen bin und daß du mich gesandt hast, der nahezu synonyme Ausdruck der Inkarnation. Allein durch ihren Subjektwechsel vom Ich Jesu zum Du des Vaters zeigen sie noch einmal unüberhörbar das Einssein beider an.
Für Ton Veerkamp <1209> steht von den jüdischen Schriften her eindeutig fest:
Der Gott Israels ist sein NAME, also das und nur das, unter dem er sich den Menschen kenntlich machen will. Sein Wesen ist und bleibt uns unzugänglich. Der NAME, unter dem allein wir Gott kennen können, ist „der aus dem Sklavenhaus Hinausführende“. Dieser NAME bleibt.
Dieser NAME ist es nun auch, der nach den Versen 6 und 26 im 17. Johannes-Kapitel durch Jesus bekanntgemacht wird, allerdings hat dabei Johannes Veerkamp zufolge andere Adressaten im Blick als die meisten anderen jüdischen Messianisten:
Die Messianisten unter den Judäern meinen, dass sich „jetzt“ der Gott Israels mit dem NAMEN Jesus Messias den Menschen kenntlich macht, nicht nur den Menschen in Israel, sondern auch den Menschen aller Völker. Johannes meint einschränkend: Den Kindern Israels, die unter den Völkern leben, und solchen aus den Völkern, die sich zu Israel bekennen.
Die konkrete Bedeutung des Wortes nyn, „jetzt“, im Zusammenhang der Verse 7 bis 8 verbindet auch Veerkamp – ähnlich wie Wengst und Thyen – mit der Zukunft der messianischen Gemeinde, indem er in den folgenden Sätzen davon spricht, dass „der Messias den Menschen sein Gebot der Solidarität“ hinterlässt und „sie bleibend … inspiriert“, denn die Schüler Jesu werden ja ihre Inspiration (pneuma) von dem Augenblick her empfangen (20,22: labete pneuma hagion), in dem Jesus mit seinem Tod am Kreuz eben diese Inspiration übergeben wird (19,30: paredōken to pneuma).
In diesem Zusammenhang richtet Veerkamp an die Adresse der Christenheit eine Mahnung, die wohl von den wenigsten unter uns in Vergangenheit und Gegenwart beherzigt wurde und wird. Er warnt nämlich davor, wir könnten Gottes in der Gestalt Jesu auf irgendeine Weise anders oder unmittelbarer habhaft werden, als dies im Blick auf den Gott Israels und seinen unverfügbaren NAMEN möglich war:
[A]uch der Messias ist in der Verborgenheit Gottes. Er kann in keine der menschlichen Unternehmungen einverleibt werden. Zwar hinterlässt der Messias den Menschen sein Gebot der Solidarität und inspiriert sie bleibend, aber er ist nie innerhalb unserer Reichweite. Alles, was wir sagen und tun, ist auf ihn hin, soweit es von ihm her kommt, also inspiriert ist. Der NAME des Messias ist also eine Buchstabierung jenes NAMENS Gottes, der Mose schickt, um Israel aus dem Sklavenhaus zu führen, Exodus 3,11ff.
Mit anderen Worten: Nur, wenn wir Jesus als die Verkörperung des NAMENS begreifen und seine Worte so hören, dass sie vor allem andern das Ziel der Befreiung Israels inmitten der Völker haben, fangen wir an, einen Zipfel von dem zu erfassen, was das Herzenanliegen des Johannes in seinem Evangelium war.
Damit Israel Befreiung erfahren kann, muss ganz Israel (wie gesagt: einschließlich Samaria, der Diasporajuden und einzelner Gottesfürchtiger aus den Völkern) in der messianischen Gemeinde gesammelt werden. Dass diese Sammlung gelingt und zur Einheit führt, ist nach Veerkamp das zentrale Gebetsanliegen des Messias Jesus:
Mit großer Zuversicht sagt Johannes, dass das gegeben wird, um was im Namen des Messias gebetet wird. Gebetet wird um die messianische Einheit. Diese Einheit fordert der Messias. Um sie werden die, die Gott dem Messias gegeben hat, beten; etwas anderes kommt ihnen nicht in den Sinn, weil sie die Worte bewahren, die der Messias ihnen gegeben hat, weil sie vertrauensvoll (alēthōs) annehmen und erkennen, dass dieser Messias von diesem Gott ausgeht.
↑ Johannes 17,9-11: Jesu Fürbitte nicht für den kosmos, sondern für die Bewahrung der Seinen im NAMEN und für ihre Einheit
17,9 Ich bitte für sie.
Nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, die du mir gegeben hast,
denn sie sind dein.
17,10 Und alles, was mein ist, das ist dein,
und was dein ist, das ist mein;
und ich bin in ihnen verherrlicht.
17,11 Und ich bin nicht mehr in der Welt;
sie aber sind in der Welt,
und ich komme zu dir.
Heiliger Vater,
erhalte sie in deinem Namen,
den du mir gegeben hast,
dass sie eins seien wie wir.
[16. Dezember 2022] Nach Klaus Wengst (W469) begründet Jesus seine Bitte „für die Seinen“, bevor er sie stellt. In Vers 9 stellt er zunächst
betont heraus, auf wen sich sein Bitten bezieht und auf wen nicht: „Für sie bitte ich. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für diejenigen, die du mir gabst.“ Jesus will hier nur für diejenigen bitten, die ihm anvertraut sind und die in bedrängter Situation leben. Für sie bittet er um Bewahrung. Sie werden bedrängt von einer Welt, die als hassende Welt beschrieben wurde. Für sie müsste anders gebetet werden.
Wengst hält Jesu Weigerung, für den kosmos zu beten, also nicht für eine grundsätzlich getroffene Entscheidung, sondern sie ist lediglich dem Augenblick geschuldet, in dem er in dieser bestimmten Weise eben nur für die Seinen bittet. Er hält also die Möglichkeit offen, dass Christen auch für eine „hassende Welt“ beten können. Offen bleibt aber auch die Frage, wer oder was hier konkret mit dem kosmos gemeint ist.
In Vers 10 unterstreicht Jesus, dass er
hier für die ihm Anvertrauten bittet …: „weil sie Dein sind und das Meine alles Dein ist und das Deine mein“. Er behaftet in seinem Bitten Gott dabei, sich um die zu kümmern, die er ihm gegeben hat und die doch auch als die ihm Anvertrauten Gottes Eigentum bleiben.
Indem Jesus schließlich (W470) „sein Bitten für die Seinen und nicht für die Welt damit“ begründet, dass er „durch sie verherrlicht“ sei, also durch sie „Gewicht“ erhält, dass „ihm … Ehre zu[kommt] durch diejenigen, die seine Worte als Wort Gottes annehmen und beherzigen“ und darin „sein Wirken zum Ziel“ kommt,
ist seine Bitte für die Seinen „im Grunde keine zweite Bitte“ neben der Bitte um die eigene Verherrlichung; denn seine Herrlichkeit, seine Ehre „hat er ja als der in der Gemeinde Wirksame und von ihr Anerkannte“. <1210> Die Bitte für die Seinen erweist sich so als Weiterführung der Bitte für sich selbst.
Damit trifft Wengst unter Berufung auf Bultmann einen wichtigen Punkt, lässt jedoch außer Acht, dass es dem jüdischen Messianisten Johannes bei dieser Ehre des Messias um nichts anderes als die Ehre des Gottes Israels geht, dessen erstes Ziel das Leben und die Befreiung Israels inmitten der Völker ist.
Noch „einen weiteren Grund“ für seine Fürbitte nennt Jesus in der ersten Hälfte von Vers 11:
„Ich bin nicht mehr in der Welt. Aber sie sind in der Welt und ich komme zu Dir.“ Auch hier redet Jesus sozusagen im Übergang, ja mehr noch, als wäre der schon vollzogen. Die Seinen sind von ihm verlassen. Er ist nicht mehr in der Welt, wohl aber sie. Es ist eine für sie feindliche Welt, eine Welt, in der sie bedrängt werden. Um was Jesus vorher gebetet hat, ist hier mit Gewissheit gesagt: Er kommt zum Vater. Er geht in den Tod, mit dem Gott sich identifiziert.
Dass der zum Vater kommende Messias schon jetzt „sozusagen im Übergang“ davon spricht, dass er „nicht mehr in der Welt“ ist, deutet Wengst fraglos als die bereits erfüllte Bitte um seine Verherrlichung. Das ist konsequent, wenn diese Verherrlichung eben in seiner Auferweckung durch den Vater besteht und wenn sein Kommen zum Vater so bestimmt wird, dass er aus der vorfindlichen Welt herausgekommen und im Himmel als dem Ort, wo Gott ist, angekommen ist. Eben hatte Wengst aber noch gesagt, dass Jesu Bitte um seine Verherrlichung mit seiner Bitte für die Seinen zusammenfällt. Kann es dann überhaupt sein, dass Jesus die erste Bitte bereits als jetzt schon erfüllt betrachtet? Wenn wir uns außerdem daran erinnern, dass nach Veerkamp der Himmel kein Ort ist, zu dem der Messias gelangen könnte, und dass sein Kommen zum VATER erst vollendet ist, wenn die Befreiung Israels inmitten der Völker an ihr Ziel gekommen ist, bleiben hier sehr viele Fragen offen.
In der zweiten Hälfte von Vers 11 spricht Jesus seine Fürbitte aus. Sie betrifft
die Bewahrung der Zurückbleibenden: „Heiliger Vater, bewahre sie in Deinem Namen, den Du mir gabst, damit sie einmütig zusammenwirken wie wir.“ Nun wird der Vater als „heiliger Vater“ angeredet.
Zu dieser Anrede meint Wengst (Anm. 204), dass sie „liturgischer Sprache entstammen“ wird, wie zum Beispiel in einem Abendmahlsgebet der Didache, das mit den Worten: „Wir danken Dir, heiliger Vater“, eingeleitet wird, und dass in „der rabbinischen Literatur … die Wendung ‚der Heilige, gesegnet er‘, die geläufigste Bezeichnung Gottes“ ist.
Warum spricht Jesus hier (W470) „von Gottes Heiligkeit“? Üblicherweise geht es in solchem Zusammenhang „oft darum, dass die zu ihm Gehörigen ihm entsprechen.“ Dazu verweist Wengst (Anm. 205) auf Ausführungen von Theodor Zahn: <1211>
„Als der Heilige, d. h. von der Welt und ihrer Art Abgesonderte und sich in seiner Eigenart Behauptende wird Gott angeredet, weil es sich darum handelt, daß auch die Jünger, statt sich der Welt zu assimilieren und in ihr sich zu verlieren, in ihrer Eigenart bewahrt werden, die sie dadurch gewonnen haben, daß Gott und Jesus sie der Welt entnommen, sie zu ihrem gemeinsamen Eigentum […] gemacht haben […]. Der heilige Gott muß die Jüngerschaft bei der Heiligkeit erhalten, zu der er sie berufen hat“. In Anm. 55 weist Zahn auf die biblischen Stellen hin, nach denen Gottes Volk Israel der Heiligkeit Gottes entsprechen soll: Ex 19,5f.; Lev 11,44f.; 19,2.
Wengst zufolge (W470) bittet Jesus allerdings hier noch
nicht um die Heiligung seiner Schülerschaft – das wird er erst in V. 17 tun -, sondern zunächst um ihre Bewahrung. Dabei wird aber in dem, worauf diese Bewahrung zielt, auch hier eine Entsprechung deutlich werden. Sie möge bewahrt werden in dem Namen, den Gott ihm gab. Vom „Namen“ hatte Jesus schon in V. 6 gesprochen. Gemeint war damit, dass Gott auf dem Weg Jesu mit seinem Ziel am Kreuz sein „Hier bin ich“ spricht. Darin soll Jesu Schülerschaft bewahrt, dabei soll sie festgehalten werden, dass sie sich auf Gott, wie er hier in seiner helfenden und rettenden Gegenwart begegnet, einlässt und verlässt, dass sie in dem durch Gottes „Hier bin ich“ eröffneten Raum des Glaubens bleibt.
Das sieht Wengst alles richtig, nur lotet er leider wieder nicht aus, was der befreiende NAME des Gottes Israels in seiner vollen Tragweite bedeutet. Es geht nicht ganz allgemein um Hilfe und Rettung, sondern um das Leben der kommenden Weltzeit für Israel.
Den Schluss von Vers 11 hina ōsin hen kathōs hēmeis {wörtlich: dass sie eins seien wie wir}, mit dem Jesus das Ziel des „Bewahrens“ der Seinen angibt, übersetzt Wengst so:
„damit sie einmütig zusammenwirken wie wir“. Vom einmütigen Zusammenwirken mit dem Vater hat Jesus in 10,30 gesprochen. Dort war deutlich, dass es sich um eine funktionale Einheit handelt, eine Einheit im Wirken.
Dazu (Anm. 206), dass die „Sprachform … hier und dort identisch“ ist, die „in 10,30 traditionell auf die Einheit des Wesens gedeutet wird“, hat Thomas von Aquin <1212> als problematische Folgerung formuliert: „also werden auch wir eins durch das Wesen sein“, was er jedoch ausschließt: „Aber dies ist nicht wahr“. In der Tat kann 10,30 von 17,11 her sehr unbefangen als eine Übereinstimmung Jesu mit dem VATER in seinem ganzen Wollen und Wirken gedeutet werden, die nicht mit den Wesensspekulationen der späteren griechisch-philosophisch beeinflussten christlichen Dogmatik belastet ist.
Wie ist also (W470f.) die „Einheit der Schülerschaft Jesu“ zu bestimmen? Es geht (W471)
um ihr Zusammenwirken, dass also ihre Bewahrung im Raum des Glaubens zu einem gemeinsamen Wirken führt. So wäre als Impuls für heutiges Suchen nach ökumenischer Einheit aufzunehmen: Entscheidend ist nicht die Herstellung einer einzigen Organisation, sondern ein gemeinsames Handeln.
Auch nach Hartwig Thyen (T692) versteht es sich „aus dem Kontext der Abschiedsreden von selbst“, dass Jesus in Vers 9
den Vater inmitten seiner Jünger, die er in einer Welt zurückläßt, die sie mit ihrem Haß verfolgt und sie auszurotten sucht (15,18-16,4), um die Bewahrung der Seinen bittet, die der Vater ihm anvertraut hat, und nicht für die sie hassende Welt betet… Für diese Welt müßte ganz anders gebetet werden. Etwa so, wie Jesus bei Lukas für diese feindliche Welt den Vater gebeten hat: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34)…
Die neue Aussage Jesu in Vers 10, „er sei in seinen Jüngern verherrlicht“ (T692f.),
erinnert an den im Zusammenhang des Liebesgebots gesagten Satz: „Daran sollen alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt“ (13,35). An der Sendung der Jünger, die das Halten von Jesu Gebot und das Bewahren seiner Worte einschließt, soll die Herrlichkeit Jesu auch in Zukunft der Welt sichtbar werden (s. u. zu V. 21). Das Perfekt dedoxasmai {ich bin verherrlicht} zeigt erneut, daß Jesus hier redet, als sei er bereits erhöht, und blicke aus dieser Perspektive auf seine Jünger und die Verläßlichkeit ihres Glaubens nach seiner Auferstehung …
„[D]ieses Perfekt ‚ich bin in ihnen verherrlicht‘“ bezieht sich aber nach Thyen
wohl allein auf die nach dem Weggang des Judas bei Jesus gebliebenen Elf … Es ist sicher kein Porträt der realen Kirche, wie sie unser Evangelist am Ende des ersten Jahrhunderts kennt, geschweige denn das getreue Abbild jener vermeintlichen ,johanneischen Gemeinde‘. Im Blick auf die realen Leser/Hörer des Evangeliums, die ja nicht nur um die Treue der Elf und die Martyrien einiger von ihnen und vieler anderer wissen, sondern auch erfahren haben, daß Judas beileibe nicht der einzige Abtrünnige geblieben ist, und die mit eigenen Zweifeln und Anfechtungen zu ringen haben, muß Jesu Aussage, „und in ihnen bin ich verherrlicht“ der kontrafaktische {gegen die Fakten gerichtete} Ansporn sein, ihr zu entsprechen und sie zur Bitte an den Vater führen, daß er es doch so fügen möge.
Wer dagegen wie Haenchen <1213> die „erzählten Jünger nicht von den späteren Christen unterscheidet“, muss „in das folgende Dilemma“ geraten:
„Die Christen gehören dem Vater, der sie darum dem Sohn geben kann, und der Sohn hat den Namen des Vaters … geoffenbart, und die Jünger und die späteren Generationen der Christen haben sie (sc. Jesu rhēmata) angenommen und bewahrt. Alles fügt sich also fest ineinander. Das wird so nachdrücklich ausgesprochen, daß man sich zu fragen versucht fühlt, inwiefern das geschieht. Ist diese Einheit der johanneischen Gemeinde [!] wirklich so frei von aller Unsicherheit und nur der ,Sohn des Verderbens‘ aus der Einheit herausgefallen (weil die Schrift oder der wirkende Gotteswille es so geschehen ließ), oder ist Judas am Ende nur die Andeutung einer Möglichkeit, die sich je und je wiederholen kann?“
„Problematisch“ ist für Thyen dabei die von Haenchen letztgenannte Alternative, „denn Judas ist beides“. Von seiner einzigartigen „heilsgeschichtlichen Rolle“, Jesus auszuliefern, ist tatsächlich in „der erzählten Welt“ des Evangeliums die Rede, in
der Welt der Erzählung dagegen sind Judas ebenso wie der Verleugner Petrus und die unverständigen und ihren Herrn immer wieder mißverstehenden Jünger durchaus Möglichkeiten, die sich ,je und je wiederholen‘. Und nicht um Judas oder Petrus moralisch zu disqualifizieren, sondern eigens dazu wird deren Verhalten so breit erzählt, damit die Leser/Hörer daran ihrer eigenen Schwächen innewerden und Jene ,Möglichkeiten‘ nicht realisieren.
Zur ersten Hälfte von Vers 11 beschränkt sich Thyen auf die Bemerkung, dass Jesus als „derjenige, der nicht mehr in der Welt, sondern bereits unterwegs ist zu seinem Vater, … diesen um die Bewahrung seiner in einer Welt zurückbleibenden Jünger“ bittet, „die sie mit ihrem Haß verfolgen wird.“
Ausführlicher beschäftigt er sich mit der Anrede Gottes als pater hagie {Heiliger Vater} (T693f.):
Eingeleitet durch das Trishagion {Dreimal Heilig} in Jes 6,3 wird die Wendung ‚der Heilige Israels‘ im Jesajabuch geradezu zum festen Gottesnamen. „Während (dabei) aber Protojesaja mit diesem Namen vorwiegend den Gerichtsgedanken verbindet, so daß der Gegensatz zwischen Jahwe und Israel zum Ausdruck kommt, verbindet ihn Deuterojesaja gerade umgekehrt mit dem Erlösungsgedanken. Denn der ,Heilige Israels‘ hat nunmehr sein Gericht vollzogen; hinter dem Gericht aber steht als letztes Ziel die Erlösung Israels“; <1214> vgl. Ps 71,22; 78,41; 89,19. In Gebete eingegangen ist die Prädikation JHWHs als des Heiligen in dem priesterlichen Gebet um die Erhaltung des eben neu geweihten Tempels… (2Makk 14,36) sowie 3Makk 2,2, wo der Hohepriester Simon Gott anruft… Wie in Joh 17 wird Gott im eucharistischen Dankgebet der Didache mit den Worten angerufen… (Did 10,2). … Wie wir schon mehrfach beobachten konnten, folgt Johannes mit der Gebetsanrede pater hagie auch hier den Spuren Deuterojesajas.
Was die Aufnahme dieser Anrede des Vaters Jesu aber von den Schriften her konkret bedeuten mag, dazu stellt Thyen keine Überlegungen an. Und die am Schluss von Vers 11 an diesen heiligen Vater gerichtete Bitte kommentiert er mit einem einzigen knappen Satz:
Damit die Jünger, die der Vater Jesus gegeben hat, so Eines seien, wie Jesus als der Sohn und Gott als sein Vater Eines sind (vgl. 10,30), bittet Jesus den Vater, sie in seinem göttlichen und heiligen Namen zu bewahren.
Offen muss dabei bleiben, auf welche Weise genau denn die Einheit der Jünger Jesu untereinander derjenigen entsprechen soll, die Thyen für Jesus als den Sohn und Gott als seinen Vater voraussetzt, und was in diesem Zusammenhang ihre Bewahrung „in seinem göttlichen und heiligen Namen“ bedeuten soll. Es mutet seltsam an, dass Thyen, der doch in Johannes 10,30 den zentralen Vers des Johannesevangeliums überhaupt erblickt, nur so beiläufig auf die in Johannes 17,11 angesprochene Einheit der Jünger Jesu eingeht, die nicht nur mit demselben Wort hen {eins} ausgedrückt wird, sondern mit den Worten kathōs hēmeis {wie wir} auch direkt auf die Einheit Jesu mit dem VATER bezogen wird. Anscheinend könnte dieser Vers seine Argumentation gegen eine rein funktionale Auslegung des Zusammenwirkens von Vater und Sohn in der von ihnen ausgesagten Einheit ins Wanken bringen.
Anders als Wengst und Thyen begreift Ton Veerkamp <1215> den Satz in Vers 9: „Nicht für die Weltordnung wünsche ich“, als eine grundlegende Aussage, die
von größter Bedeutung für die Praxis späterer Generationen sein könnte. … Offenbar gab es das Bestreben, dafür zu beten, daß die Weltordnung und ihre Agenten Gott dienstbar gemacht werden können; das liegt Johannes so fern, dass er das hier noch einmal betonen muss: die Weltordnung – und das heißt: die Träger und Trägerinnen der real herrschenden Ordnung, Regierung, Könige, Präfekten, ihre Mitläufer und Handlanger – kann und darf nie Gegenstand von Fürbitte und sein. Für „König und Vaterland“ soll hier nicht gebetet werden.
Dabei setzt Veerkamp voraus, dass das Wort kosmos in diesem Zusammenhang nicht einfach wie gemäß Wengst (W469) und Thyen (T692) die „hassende Welt“ meint, sondern die jeweils herrschende Weltordnung, im Fall des Johannes ganz konkret das römische Imperium.
Veerkamp selbst verspürt offenbar, dass er sich damit in einen gewissen Widerspruch zum Propheten Jeremia begibt, denn er sieht sich zu einer Erläuterung genötigt, warum auch dieser seiner Ansicht nach eine solche Fürbitte für die babylonische Obrigkeit „nicht von den Verschleppten in Babel verlangt“ hat (Anm. 499):
„Forscht nach dem Frieden der Stadt, wohin ich euch verschleppen ließ, und betet ihretwegen zum EWIGEN, und mit ihrem Frieden wird auch euch Friede geschehen“, Jeremia 29,7. Das ist kein Gegensatz zu Johannes 17,9. Über Frieden hatte Jeremia ganz dezidierte Auffassungen, wie wir bei der Besprechung von 14,27 gehört haben. Möge es für euch, so Jeremia, einen Zustand auch in Babel geben, der den Namen Friede verdient.
Im Grunde liegt Veerkamp mit dieser Argumentation gar nicht so weit weg von Wengst und Thyen, die ja auch voraussetzen, dass eine Fürbitte für die Welt nicht deren hasserfülltes Treiben legitimieren darf. Letzten Endes wehrt sich Veerkamp gegen die traditionell lutherische Vorstellung, jegliche obrigkeitliche Struktur müsse als von Gott ausgehend betrachtet werden und dürfe von den ihr Unterworfenen Gehorsam und Fürbitte erwarten, die vor allem mit der Argumentation des Paulus in Römer 13 begründet wurde. <1216>
Für wen oder was betet Jesus nun also wirklich? Nach Veerkamp nimmt Johannes in den Versen 9b-10 nicht bereits ganz allgemein die christliche Gemeinde der Zukunft in den Blick, was Wengst vorauszusetzen scheint, beschränkt sich aber auch nicht allein auf den engen Kreis der elf verbliebenen Jünger Jesu, worauf Thyen hindeutet:
Gegenstand des Gebetes sind die, die Gott dem Messias gegeben hat, weil sie das Israel Gottes sind, und weil sie Gottes sind, sind sie auch des Messias. In ihnen hat der Messias „seine Ehre erhalten“, dedoxasmai, Perfekt, wie nenikēka {ich habe gesiegt, überwunden}. Dass es solche geben mag, darum ist zu beten. Alles andere Beten ist Unsinn oder Aberglaube. Die Ehre des Messias vollzieht sich in der messianischen Gemeinde!
Nun folgt in Vers 11 die Klarstellung Jesu, dass er im Gegensatz zu seinen Schülern nicht mehr en tō kosmō {wörtlich: in der Welt} ist. Getreu der von ihm erläuterten biblischen Sichtweise kann es sich dabei nicht um eine räumliche Verlagerung der Existenz Jesu aus der diesseitigen Welt in einen jenseitigen Himmel handeln, vielmehr muss Jesus seine Schüler mit der Tatsache konfrontieren, dass sie den Messias unter den Bedingungen des Lebens auf dieser Erde tatsächlich nicht mehr an ihrer Seite haben:
Bei aller Einheit ist doch der Unterschied der Situation. Der Messias geht hinein in die Verborgenheit Gottes („zum VATER“), die Gemeinde bleibt unter der Weltordnung. Wenn dies klargestellt ist, kann der Messias beten: „bewahre sie!“ Und zwar für die Einheit, die keine andere sein kann, als die Einheit zwischen dem Gott Israels und seinem Messias, zwischen dem Messias und der Gemeinde, zwischen den Mitgliedern der Gemeinde untereinander.
Den Hintergrund der Gebetsanrede „VATER, heiliger“ sieht Veerkamp in seiner Anm. 489 zur Übersetzung von Johannes 17,11 im
zweite[n] Teil des Buches Levitikus; neunmal hören wir das Wort „heilig“ oder „heiligend“ in Zusammenhang mit dem NAMEN, dem Gott Israels; z.B. Leviticus 19,2: „Zu Heiligen werdet, denn heilig bin ich, der NAME, euer Gott.“
Dieser Gebetsanrede entspricht auch die Bitte um die Bewahrung der messianischen Gemeinde „mit dem NAMEN …, den Gott dem Messias gegeben hatte“. Dazu erläutert Veerkamp:
Name heißt immer jene Lebensaufgabe, die ein Mensch hat und die nur er erfüllen kann. Der Name Jesus hat mit jaschaˁ, befreien, zu tun. Befreiung Israels ist der Name des Messias. Die Befreiung ist der Messias, die Lehre von der Befreiung (Soteriologie) ist die Lehre von diesem Messias (Christologie) und umgekehrt.
Indem Veerkamp in seiner Übersetzung diesen NAMEN, der dem Messias gegeben wird, in Großbuchstaben schreibt, zeigt er zugleich an, dass der Name Jesu kein anderer ist als der NAME des Gottes Israels selbst. Ihn verkörpert er ja mit seinem ganzen Wollen und Wirken, mit seinem Leben und seiner Lebenshingabe. Nach Veerkamp kann es keine andere Christologie, keine Lehre von Jesus geben, die darüber hinausgeht, und er begründet das, indem er sich in dieser Hinsicht von der Christologie Friedrich-Wilhelm Marquardts <1217> abgrenzt (Anm. 500):
In der Schrift gibt es den Namen, keine Personen. Deswegen vermag ich Friedrich-Wilhelm Marquardt nicht zu folgen, wo er schreibt: „Andererseits soll Christologie nicht in Soteriologie … aufgehen: als dürfe man die Person hinter ihrem Werk und hinter ihrer gesellschaftlichen Rolle ruhig vergessen … Der Mensch ist nicht gleich sein Werk“. Dass hier eine „bürgerliche Unterscheidung“ vorgenommen wird, sagt Marquardt selbst, und dies mag auch „ein unverlierbarer Gewinn an Humanität“ sein. Aber das Werk des Messias und die Werke, die er von den Schülern und von uns erwartet, sind nicht vergleichbar mit den gesellschaftlichen Leistungen der Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft. Andernfalls stünde weder Gott noch dem Messias beim Gericht ein Urteil zu, nach dem jeder Mensch abgegolten wird nach seiner Praxis, Matthäus 16,27; die Praxis ist die Gesamtheit seiner Werke, Matthäus 25,31ff. Wenn wir uns der Geringsten seiner Brüder annehmen, sind wir die, die wir sein sollen und sein können: das ist der Name, mit dem Gott uns ruft, diese Werke, das sind wir! Jesus wollte erkannt werden in seinen Werken.
Zur Bestätigung dessen führt Veerkamp den Reformator Philipp Melanchthon <1218> an:
Christum cognoscere est beneficia eius cognoscere, non quod isti docent eius naturas, modos incarnationis contueri („Christus erkennen ist seine Wohltaten erkennen, nicht, was jene lehren, die seine Naturen, die Weisen seiner Fleischwerdung betrachten“). Auf Deutsch: Die Lehre vom Messias ist die Lehre von den Werken des Messias.
Die abschließende Bitte für die messianische Gemeinde in Vers 11 hina ōsin hēn kathōs hēmeis {wörtlich: dass sie eins seien wie wir} gibt Veerkamp mit den Worten wieder: „damit sie zu einer Einheit werden wie wir“. Dazu schreibt er in seiner Anm. 490 zur Übersetzung von Johannes 17,11:
Wir übersetzen „zu einer Einheit werden“, weil das semitische haja {sein im Sinne von geschehen} leistungsfähiger als das griechische einai {sein} ist. Der Konjunktiv ōsin {seien, sollen sein, geschehen} nach der Partikel hina {dass, damit} zeigt an, dass „als Einheit geschehen“ ein Zustand ist, den sich der Messias zum Ziel setzt (11,52!). Hier geht es natürlich nicht, wie Barrett und alle anderen uns glauben machen wollen, um die Einheit der Kirche, weil Johannes so etwas wie Kirche gar nicht gekannt hat. Christen und Christentum lagen außerhalb seines Gesichtsfeldes. Dass dies eine Provokation ist, hörten wir in 10,30ff.
Die Einheit, um die es Johannes Veerkamp zufolge hier geht, hatte er im Zusammenhang seiner Auslegung von Johannes 10,30 folgendermaßen beschrieben:
„ICH und mein VATER, EINS sind wir“… Sein ist hier ein semitisches Sein, ein Geschehen, nicht eine Identitätsaussage. Der Satz bedeutet: Das Handeln des Schöpfers von Himmel und Erde, des Befreiers und des Bundesgenossen Israels, und das Handeln des Messias haben eine Richtung, ein Ziel: die Einheit Israels. Die Einheit von Herde und Hirten leitet sich nur aus diesem einheitlichen Handeln Gottes und seines Messias her.
Genau aus der Einheit des Messias Jesus mit dem Gott Israels, die in 10,30 betont wird, folgt also das Gebet des Messias in 17,11 für die Einheit der Seinen im Sinne der Sammlung und Befreiung ganz Israels.
↑ Johannes 17,12: Jesu Bewahrung der Seinen im NAMEN außer dem Sohn des Verderbens
17,12 Solange ich bei ihnen war,
erhielt ich sie in deinem Namen,
den du mir gegeben hast,
und ich habe sie bewahrt,
und keiner von ihnen ist verloren
außer dem Sohn des Verderbens,
damit die Schrift erfüllt werde.
[17. Dezember 2022] Nach Klaus Wengst (W471) knüpft der Rückblick in den folgenden Versen 12 bis 14
an die Bitte des vorigen Abschnitts an. Während seines irdischen Wirkens hat Jesus die Seinen im Raum des Glaubens bewahrt und keiner ging verloren – bis auf den einen.
Indem Jesus in Vers 12 „inhaltlich die zuvor ausgesprochene Bitte“ aufnimmt: „Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie durch Deinen Namen, den Du mir gabst, und ich habe sie behütet“, beschreibt er, dass er das, was er „gerade für die Zukunft vom Vater erbat, … in der Vergangenheit getan“ hat:
Die Zusage, niemanden der ihm vom Vater Gegebenen hinauszuwerfen (6,37), hat er eingehalten und den Auftrag, niemanden von ihnen verloren zu geben (6,39), erfüllt. Und sie haben „geglaubt und erkannt“, dass er „der Heilige Gottes“ ist (6,69). Zwar wurde in der Erzählung des Evangeliums immer wieder deutlich, dass Jesu Schüler nicht wirklich verstehen und vor Ostern auch nicht verstehen können, aber sie sind geblieben. So stellt Jesus fest: „Und niemand von ihnen ging verloren.“ Damit sind die elf verbliebenen Schüler im Blick, die als das Gebet Jesu Mithörende vorgestellt werden.
Nur „ein kurzer Seitenblick“ ist es Wengst zufolge, dass Jesus „an die Feststellung, dass ‚niemand von ihnen verloren ging‘“, die Worte anfügen muss: „nur der eine Verlorene“. Zu dieser Übersetzung merkt er an (Anm. 207):
Wörtlich übersetzt, müsste es – wenn man im Deutschen die Entsprechung zwischen Verb und Nomen im griechischen Text aufrechterhalten will – heißen: „der Sohn der Verlorenheit“. Die Verbindung von „Sohn“ bzw. „Söhne“ mit einem Genitiv drückt die Zugehörigkeit von Personen zu dem mit dem Genitiv bezeichneten Bereich aus. Vgl. im NT für den Singular Mt 23,15, für den Plural Mt 8,12; Mk 2,19.
Wengst (W471) scheint anzunehmen, dass die Erwähnung des Judas, ohne seinen Namen zu nennen, fast widerwillig erfolgt:
Nach der bisherigen Darstellung des Evangeliums muss sich an dieser Stelle die Erinnerung daran aufdrängen, dass es nach 6,67-69 zwölf waren, die bei Jesus blieben, und einer von ihnen, Judas, weggegangen ist, bevor Jesus seine Abschiedsrede begann (13,30).
Nicht beantwortet wird in diesem Zusammenhang die Frage, was denn mit den vielen Nachfolgern Jesu ist, die bereits damals (6,66) Jesus verlassen haben. Der Hinweis auf die Verlorenheit des Judas verweist „mit der Angabe: ‚auf dass die Schrift ausgeführt würde‘ auf schon in 13,18f. Gesagtes“.
Hartwig Thyen zufolge (T694) begründet Jesus die in Vers 11 ausgesprochene Bitte
in V. 12 damit, daß er, solange er bei ihnen war, diese Aufgabe selbst wahrgenommen hat: Er hat die ihm Anvertrauten im Namen Gottes bewahrt und sie behütet, so daß keiner von ihnen verdorben ist außer dem ,Sohn des Verderbens‘, damit die Schrift erfüllt werde.
Anders als Wengst übersetzt Thyen also das Wort apollymi nicht mit „verlorengehen“, sondern mit „verderben“, was beides möglich ist, und er stellt die Frage:
Wird hier Judas im Spiel mit dem vorausgegangenen Verbum apollymi (oudeis ex autōn apōleto {niemand von ihnen ist verdorben}) als ho hyios tēs apōleias {der Sohn des Verderbens} bezeichnet, so wie JHWH die ,blinden Hirten‘ Israels als tekna apōleias {Kinder des Verderbens} und sperma anomon {wörtlich: Same ohne Gesetz} disqualifiziert hatte (Jes 57,4 LXX)?
Neben Texten aus Qumran erwähnt Thyen als Parallelstelle noch 2. Thessalonicher 2,3, derzufolge „vor der Parusie des Kyrios {Wiederkunft des Herrn} zunächst die Apostasie {Glaubensabfall} geschehen und der anthrōpos tēs anomias {Mensch der Gesetzlosigkeit}, der hyios tēs apōleias {Sohn des Verderbens}, offenbar werden“ muss. In diesem Zusammenhang setzt er sich mit Lindars, Moloney und Kretzer <1219> auseinander (T694f):
Lindars vermutet wohl zu Recht, daß Johannes diese apokalyptischen Obertöne im Sinn habe, wenn er vom Sohn des Verderbens rede. Aber identifiziert er wirklich Judas mit dieser eschatologischen Figur? Moloney bestreitet das und sieht in dem hyios tēs apōleias den Teufel, der von Judas Besitz ergriffen hat (s.u. zu 18,9). So oder so aber liegt das Interesse dieser Benennung schwerlich darin, Judas moralisch zu disqualifizieren, denn die Treue der anderen ist ja nicht ihre sittliche Leistung, sondern sie hat ihren einzigen Grund in der vergebenden Liebe Jesu mit der er sie behütet hat (vgl. 21,15ff). Auch wenn Johannes so „die Gefahr endgültigen Verderbens … stark heraus“ stellen mag, erscheint uns die von Kretzer daraus gezogene Konsequenz doch höchst fragwürdig: „Danach liegt es in der Verantwortung des Menschen durch Glaube (3,15f) und Nachfolge (10,27) ewiges Leben zu erlangen (10,28)“. Denn die viel und kontrovers diskutierten sogenannten prädestinatianischen Aussagen, wonach keiner zu Jesus ,kommen‘, d. h. ,an ihn glauben‘, kann, wenn der Vater nicht ,zieht‘ oder ihn Jesus ,gegeben hat‘, und die Parakletverheißungen zeigen doch sehr deutlich, daß Glaube und Nachfolge Gottes Gaben und nicht dem Menschen erschwingliche Mittel sind, durch die er das ewige Leben erlangen könnte, und daß darum auch für Johannes gilt, daß keiner Jesus kyrios nennen kann außer durch den heiligen Geist (1Kor 12,3).
Daher liegt nach Thyen (T695) der „Akzent der Benennung des Judas als ,Sohn des Verderbens‘ … vielmehr auf der eschatologischen Rolle, die Jesus selbst diesem Jünger zugewiesen hat“, und die Thyen mit einem Zitat von Bultmann <1220> erläutert:
Durch sein ,Überliefern‘ Jesu muß er das Werkzeug sein, durch das die Schrift erfüllt wird. So wurde die Auslieferung Jesu durch Judas schon beim letzten Mahl (13,27) „doppelt charakterisiert: einmal durch die Aussage, daß nach diesem Bissen der Satan von Judas Besitz ergriff, sodann durch Jesu Aufforderung: ,Was du tust, das tu alsbald!‘ Durch beides ist die Tat aus dem Bereich menschlichen, psychologischen Handelns hinausgehoben. Hier handelt nicht ein Mensch; hier handelt der Satan selbst, der Gegenspieler Gottes und des Offenbarers. Und doch zeigt sich auch hier die abgründige Nichtigkeit dieses Gegenspielers, dessen scheinhaftes Sein nur die Empörung des Nichts ist. Sofern sein Handeln in die Geschichte des Offenbarers eingreift, ist es von diesem selbst angeordnet“.
Ton Veerkamp <1221> übersetzt Johannes 17,12 folgendermaßen:
Als ich mit ihnen war,
habe ich sie bewahrt mit dem NAMEN, den du mir gegeben hast,
ich habe sie behütet.
Und niemand von ihnen ist abtrünnig geworden,
nur der Abtrünnige,
damit die Schrift erfüllt werde.
Jesus blickt also darauf zurück, dass er seine „Schüler mit dem NAMEN“, den Gott ihm gegeben hatte, „bewahrt“ hat. Es ist dieser NAME der Befreiung aus dem Sklavenhaus, der die Schüler bewahrt und sie
somit davor „behütet“, dass sie den Weg des „Abtrünnigen“, der sich der Weltordnung verschrieben hatte, gehen würden.
Diese Wiedergabe von hyios tēs apōleias mit „der Abtrünnige“, die den Versionen von Wengst und Thyen eine dritte hinzufügt, begründet Veerkamp in seiner Anm. 491 zur Übersetzung von Johannes 17,12 folgendermaßen:
Im Nestle/Aland findet sich hier der Seitenverweis „Jesaja 57,4“. Ist dies tatsächlich der Hintergrund, dann steht hyios tēs apōleias für jilde-feschaˁ, „Söhne der Abtrünnigkeit“, also „Abtrünnige“. Wenn der Seitenverweis 2 Thessalonicher 2,3 sachdienlich ist, dann kann es sich nicht um Judas Iskariot handeln, sondern um Rom, sobald es sich eindeutig als Antigott offenbart. Hier, in Johannes 17,12, geht es eindeutig um „einen aus den Zwölf“; in 2 Thessalonicher 2,3 geht es um den Abtrünnigen überhaupt. Judas ist der Handlanger, der Abtrünnige in 2 Thessalonicher ist „der Göttliche“ (hoti estin theos, V.4) und so „Antigott“ (antikeimenos), anti in der Bedeutung „statt“: Der Göttliche setzt sich an Gottes Statt.
Damit beurteilt Veerkamp die Parallelstelle 2. Thessalonicher 2,3 ähnlich wie Thyen unter Berufung auf Moloney: Dort kann nicht von Judas, dem Schüler Jesu, selbst die Rede sein, aber doch von dem, der von ihm Besitz ergriffen hat. Anders als Thyen und Moloney sieht Veerkamp in dieser antigöttlichen Gestalt, die sich selbst zu Gott macht, jedoch nicht den außerweltlich-dämonischen Teufel, sondern die sehr diesseitige satanisch-diabolische Macht des römischen Imperiums mit dem vergotteten Kaiser an ihrer Spitze.
In meinen Augen führt allerdings Veerkamps Übersetzung von apollymi als „abtrünnig werden“ und hyios tēs apōleias als „Abtrünniger“ zu Problemen, weil Johannes 18,9 sich auf diesen Vers zurückbezieht und apollymi dort „verloren- oder zugrundegehen“ bedeuten muss. Daher würde ich bei der semitischen Formulierung „Sohn des Verderbens“ bleiben. Auch eine solche Übersetzung ist sehr gut auf Jesaja 57,4 zu beziehen. Das Wortfeld apollymi scheint beide Seiten einer gegen den Gott der Befreiung rebellierenden Haltung bezeichnen zu können: sowohl das Übertreten von Gottes Geboten als auch das daraus resultierende Verderben, Zugrunde- oder Verlorengehen des Übertreters. Außerdem kann es neben dem passiven Verloren- oder Zugrundegehen auch das aktive Zerstören oder Verlorengehen-Lassen meinen.
↑ Johannes 17,13-16: Jesu Freude in den Seinen, die in, aber nicht von der Weltordnung sind, und ihre Bewahrung vor dem Bösen
17,13 Nun aber komme ich zu dir,
und dies rede ich in der Welt,
auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei.
17,14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben,
und die Welt hasst sie;
denn sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der Welt bin.
17,15 Ich bitte nicht,
dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
17,16 Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der Welt bin.
[19. Dezember 2022] In Vers 13 wiederholt sich Jesus Klaus Wengst zufolge erneut, indem er sagt (W471f.):
„Jetzt komme ich zu Dir.“ Er betont hier das Ende seiner leiblichen Gegenwart bei seinen Schülern und damit auch das Ende der Zeit, in der er sie bewahrt und behütet hat. So bereitet er die Bitten in diesem Abschnitt vor. Doch zuvor benennt er ein Ziel seines Betens. Wenn er dieses Beten als ein Reden „in der Welt“ bezeichnet, bringt er damit zum Ausdruck, dass er das Gebet zwar „im Übergang“, aber eben doch noch „in der Welt“ vor den Ohren der Schüler spricht.
Was aber ist nun das Ziel der nun folgenden Bitten? Es besteht, wie Jesus sagt, darin (W472),
„dass sie meine Freude in ganzer Fülle unter sich haben“. Seine Freude besteht darin, dass er den Auftrag erfüllt, dass er dabei „nicht allein“ ist (vgl. 16,32), sondern Gottes „Hier bin ich“ ihn bis zuletzt begleitet. An dieser Freude partizipieren sie, indem sie in dem dadurch eröffneten Raum des Glaubens gehalten werden und sich darin aufhalten, was ein bestimmtes Verhalten impliziert (vgl. 15,11; 16,24)
Den wieder „auf sein Wirken“ zurückblickenden Satz Jesu in Vers 14: „Ich gab ihnen Dein Wort“, versteht Wengst so, dass „das Spezifische eben seines Wortes“ darin bestand,
dass er es ihnen als Gottes Wort gab. Der Sache nach – und im Wortlaut ähnlich – hatte er das schon in V. 8 gesagt. Jetzt hebt er in der Fortsetzung einen Aspekt hervor, der die folgenden Bitten weiter vorbereitet: „Aber die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.“ Auch das ist Wiederaufnahme von bereits Gesagtem (vgl. 15,18f.) Die Orientierung am Wort Jesu als Wort Gottes lässt seine Schülerschaft nicht mehr „von der Welt“ sein. Gerade dadurch, dass sie Jesu Wort als Gottes Wort annimmt und sie sich so zu Jesus bekennt, in dem Gott sein „Hier bin ich“ spricht, fordert sie es heraus, dass die sie umgebende Welt sich von ihr distanziert. Das wird als feindlich erfahren und hier als Hass zusammengefasst.
Wieder drückt sich Wengst sich hier sehr vorsichtig aus, weil er die Jesu Schülerschaft „umgebende Welt“, die „sich von ihr distanziert“, ja vor allem als die Mehrheit der jüdischen Gemeinde voraussetzt, die Jesus als den Messias ablehnt. Die Feindschaft einer auf Gewalt gegründeten Weltordnung, die in der Gestalt des Römischen Weltreichs dem Gott Israels grundsätzlich entgegensteht, kommt an dieser Stelle nicht in seinen Blick.
Wie auch immer die Welt mit ihrem Hass zu verstehen ist, es ist diese Situation, auf die sich Jesu in Vers 15 formulierte Bitte bezieht,
in der Jesus zunächst sagt, was nicht geschehen soll: „Ich bitte nicht, dass Du sie aus der Welt wegnehmen mögest.“ Sie aus der Welt wegzunehmen, würde bedeuten, dass Gott sie sterben ließe und sie durch den Tod zu sich nähme.
Dazu verweist Wengst (Anm. 208) auf folgende von Schlatter angeführte rabbinische Stelle: <1222>
Wie der Besitzer eines Feigenbaumes weiß, wann es Zeit ist, die Früchte zu pflücken, „so weiß der Heilige, gesegnet er, wann die Zeit ist, die Gerechten aus der Welt zu nehmen; und er nimmt sie.“ Aber er tut es eben erst, wenn die Zeit dafür reif ist. Bis dahin ist ihr Ort in der Welt – als Zeugen Gottes.
Weiter argumentiert Wengst (W472):
Die Unterschiedenheit von der Welt, die bedrängende Erfahrungen zur Folge hat, könnte – um diese Erfahrungen nicht machen zu müssen – den Wunsch nach völliger Geschiedenheit von ihr hervorrufen. Aber Jesu Schülerschaft hat ihren Ort nicht jenseits der Welt, sondern in ihr. Nicht anders als Israel ist sie Zeuge Gottes vor der Welt.
Die letzten beiden Sätze, die so plausibel daherkommen, geben mir allerdings zu denken. Die christliche Kirche versteht ihr Zeugnis vor der Welt schon sehr bald als Weltmission, um alle Völker zum Glauben an Jesus zu bekehren. Eine solche Völkermission sieht Wengst nur insofern kritisch, als die Kirche in ihrem Zuge nicht nur in Konkurrenz zum Judentum tritt, sondern dieses sogar beerben und letztlich als neues Gottesvolk ersetzen will. Außer Acht bleibt in Wengsts letztem Satz, dass Israel sich kaum in der Weise als „Zeuge Gottes vor der Welt“ verstand, dass es alle Menschen zum Judentum bekehren wollte. Den vorletzten Satz wiederum hat eher das Judentum ernst genommen, indem es den Glauben an das Kommen einer Weltzeit des Friedens für Israel inmitten der Völker auf der Erde unter dem Himmel Gottes weniger eilfertig mit der Hoffnung auf ein ewiges Leben in einem jenseitigen Himmel vertauscht hat. Und meine These im Anschluss an Ton Veerkamp ist eben, dass Johannes noch jüdisch-diesseitiger denkt als die heidenchristliche Kirche, die sein Evangelium zwar nicht völlig weltfremd, aber doch jenseitsorientiert umdeutete.
Die im ersten Teil von Vers 15 negativ ausgedrückte Bitte präzisiert Jesus im zweiten Teil mit den Worten: „dass Du sie vor dem Bösen bewahren mögest“. Dazu gibt Wengst Bultmann <1223> recht, der „meint, dass es ‚sachlich gleichgültig‘ ist, ob hier an ‚den Bösen‘ oder ‚das Böse‘ gedacht sei.“
Auf diese erste Bitte mit ihren beiden Seiten lässt Jesus nach Wengst in Vers 17 eine „zweite, positive Bitte“ folgen. Aber zuvor
wiederholt er noch einmal die Distanz zur Welt und die Konformität mit ihm: „Nicht von der Welt sind sie, wie ich nicht von der Welt bin.“ „Man wird diesen Satz des Evangelisten nicht als die bloße Feststellung eines Tatbestandes auffassen dürfen, sondern darin einen indirekten Zuspruch sehen müssen, den diese Gemeinde nötig hat.“ <1224>
Diese Deutung bleibt allerdings unzureichend, indem Wengst wiederum darauf verzichtet, genauer zu klären, was hier überhaupt mit „Welt“ gemeint sein soll.
Hartwig Thyen meint zu Vers 13 einleitend (T695), dass Jesus mit „dem ‚jetzt aber bin ich unterwegs zu dir‘ … das ouketi {nicht mehr} von V. 11 wieder“ aufnimmt. Indem Thyen die Worte nyn de pros se erchomai {wörtlich: jetzt aber komme ich zu dir} mit der an eine normale Ortsveränderung auf einer Reise erinnernden Vokabel „unterwegs sein“ übersetzt, leistet er dem Missverständnis Vorschub, hier könne es sich tatsächlich um einen räumlich zu begreifenden Übergang Jesu von der Erde in den Himmel Gottes handeln und nicht um eine bildhafte Aussage über den Weggang Jesu aus der irdischen Vorfindlichkeit in die Verborgenheit Gottes.
In der anschließenden Wendung: „tauta lalō en tō kosmō hina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en heautois {dies rede ich in der Welt, damit sie an meiner Freude vollkommen teilhaben}“ findet es Thyen
nicht klar, worauf sich die Wendung, diese (Dinge) sage ich in der Welt, bezieht. Bezieht sie sich unmittelbar auf Jesu aktuelles Beten, so daß er auch hier als der seiner Erhörung stets Gewisse allein um seiner Jünger willen, die ihn umgeben, zum Vater betet, so wie er am Grab des Lazarus gebetet hatte: „Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast. Ich weiß jedoch, daß du mich alle Zeit erhörst. Aber um der Leute willen, die hier stehen, bete ich, damit sie glauben, daß du mich gesandt hast“? Eine derart volksmissionarische Geste ist jedoch für Jesu langes Gebet zum Vater schwer vorstellbar.
Stattdessen neigt Thyen unter Berufung auf Lindars <1225> dazu,
die Wendung tauta lalō en tō kosmō {dieses sage ich in der Welt} … auf Jesu gesamtes abschiedliches Reden zu seinen Jüngern zu beziehen, zumal die Rede von seiner vollendeten Freude ja gewiß nicht zufällig eine Wiederaufnahme des in 15,11 und 16,24 Gesagten ist.
Zum folgenden Vers 14: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und der Kosmos hat sie mit seinem Haß verfolgt, weil sie nicht (mehr) aus der Welt sind, so wie auch ich nicht aus der Welt bin“, beschränkt sich Thyen auf die lapidare Bemerkung, dass auch er sich dieser „auf den gesamten Abschied zurückblickenden Interpretation fügt“ und dass der letzte Nebensatz in einigen wenigen Handschriften fehlt.
Auch „die gesamten V. 15 u. 16“ fehlen in manchen Handschriften, aber Thyen sieht „in diesen Auslassungen keinen ernsthaften Grund“, diese Verse als später hinzugefügt zu betrachten, denn „keinesfalls darf Jesu Wort fehlen, daß er den Vater nicht darum bitte, die Seinen aus der Welt zu entrücken, sondern allein darum, daß er sie in der Welt vor dem Bösen bewahre“. Thyen sieht ja in Vers 15 (T695f.)
ein absichtsvolles Spiel mit der matthäischen Schlußbitte des Vater-Unser. Da diese Bitte vor dem Hintergrund des die Jünger treffenden aktiven Hasses der Welt ergeht (V. 14), wird man ek tou ponērou {vor dem Bösem} als den Genitiv des maskulinen Nomens ho ponēros {der Böse} begreifen müssen, das im Evangelium nur hier erscheint. Wie in 1Joh 2,13f; 3,12 und 5,18f ist das Nomen synonym mit ho archōn tou kosmou toutou {der Fürst dieser Welt} und mit ho Satanas {der Satan}, der nach 13,27 von Judas Besitz ergriffen hatte …
Nach Schlatter [323] und Bultmann [389] entspricht (T696) „das verneinte airein ek tou kosmou {aus der Welt heben, wegnehmen}“ ebenso wie „das erbetene tērein ek tou ponērou {vor dem Bösen bewahren} rabbinischem Sprachgebrauch“:
Bultmanns Erklärung, daß es für Johannes „zum Wesen der Kirche gehört … innerhalb der Welt eschatologische, entweltlichte Gemeinde zu sein“, ist nur dann richtig, wenn man zugleich bedenkt, daß solcher Entweltlichung der Jünger Jesu mit ihrer Sendung in die Welt als seine Zeugen (20,21) ihre neue Zuwendung zur Welt und deren Wahrnehmung als die von Gott geliebte Schöpfung korrespondieren muß. Doch daß Jesu Bitte, Gott möge die Seinen nicht aus der Welt nehmen, sondern sie vielmehr in der Welt vor dem Bösen bewahren, ausdrücklich und polemisch „gegen die urchristliche Naherwartung des Endes und die Sehnsucht nach der glorreichen Parusie {Wiederkunft Jesu}“ gerichtet sein soll, wie Bultmann [ebd.] urteilt, vermögen wir ihr nicht zu entnehmen. Denn Gottes airein {Wegnehmen} der Gerechten aus der Welt hat mit dem Parusiegeschehen nichts zu tun, sondern bezieht sich in Analogie zum bevorstehenden Kreuzestod Jesu auf das individuelle Sterben Einzelner. „Sie aus der Welt wegzunehmen, würde bedeuten, daß Gott sie sterben ließe und sie durch den Tod zu sich nähme“ {so Wengst, siehe oben}.
Auch daraus, dass „die Parusie Jesu in Joh 17 nicht thematisiert wird, weil es um Schicksal und Bestimmung der in der Welt zurückbleibenden Jünger Jesu geht“, lässt sich nach Thyen
eine Polemik gegen die urchristliche Parusieerwartung nicht konstruieren. Gottes Liebe zum kosmos und daß er seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt hat, daß er sie verurteile, sondern vielmehr dazu, daß der kosmos durch ihn erlöst werde (3,16f), darf über solchen Spekulationen nicht vergessen werden.
Ton Veerkamp <1226> hat über Jesu Kommen zum VATER bereits grundsätzlich gesagt, dass damit sein Weggang in die Verborgenheit Gottes gemeint ist. Obwohl er in diesem Sinne nicht mehr dem kosmos, also der Weltordnung, unterworfen ist, kann er nur im kosmos, dem seine Schüler weiterhin unterworfen bleiben, die Worte von Vers 13 im Blick auf sie formulieren:
Jetzt: komme ich zu dir,
und das rede ich noch unter der Weltordnung,
damit sie meine Freude voll und ganz in sich selber haben.
Die Wendung „das rede ich“ bezieht sich dabei nach Veerkamp auf die eben erwähnte Bewahrung mit dem NAMEN. Durch diese hat er sie
davor „behütet“, dass sie den Weg des „Abtrünnigen“, der sich der Weltordnung verschrieben hatte, gehen würden. Das ist eine vollkommene Freude, wie die von 16,11f.: dass Israel die Unfruchtbarkeit Israels genommen worden ist: „Freudige Mutter von Kindern“, Psalm 113,9.
Dieser „vollkommenen Freude gegenüber“ steht nun nach Vers 14
die hasserfüllte Bekämpfung der Schüler durch die Weltordnung, weil diese weiß, dass die reine Existenz einer messianischen Gemeinde für sie eine nicht hinzunehmende Widerrede ist.
Die Wendung ek tou kosmou, die in Vers 14 zwei Mal auftaucht: „denn sie sind nicht von der Weltordnung, so wie ich nicht von der Weltordnung bin“, hatte Veerkamp schon in seiner Anm. 487 zur Übersetzung von Johannes 17,6 mit den Worten „ihr“, nämlich der Weltordnung, „nicht mehr gehörend“, umschrieben. In seiner Anm. 492 zur Übersetzung von Johannes 17,14 fügt er hinzu:
Die Verse 14-16 haben schon viele Rätsel aufgegeben. P66 lässt die letzten zwei Zeilen von 17,14 einfach weg, 17,15-16 wird wieder von anderen Handschriften weggelassen: diesen waren die Wiederholungen einfach zu viel; Bultmann hatte schon früh Vorgänger.
Mit der letzten Bemerkung spielt Veerkamp auf die exegetischen Zerteilungen und Streichungen an, die besonders dieser neuzeitliche Exeget im Johannestext vornimmt. Er selbst meint, dass vielleicht doch gerade „das Staccato ‚nicht von der Weltordnung her‘ wichtig“ ist, „denn gerade das muss eingeschärft werden.“
Zur ersten Hälfte von Vers 15 betont Veerkamp noch deutlicher als Wengst und Thyen, dass hier eine Konzentration auf außerweltlich-jenseitige Zukunftshoffnungen abgelehnt wird:
Kein Messias kann wünschen, dass Gott diese Gemeinde aus der Weltordnung wegnimmt, weil die Perspektive und die Alternative eine außerweltliche wäre. Die hätte sie ja gerne, und Rom hat sie ja sehr gerne gehabt, diese ganze Welt von Mysterien und Religionen, die den Menschen ein Örtchen in einem Himmelchen versprechen. Obwohl das Ganze den konservativen Patriziern Roms eine Nummer zu bunt war, haben sie die Mysterienwelt des Ostens nicht bekämpft, weil sie keine ernstzunehmende Widerrede, eher ein stabilisierender Faktor im immer zur Rebellion neigenden Osten war. Aber von den Schülern „eines gewissen Chrestos“ kann sehr wohl, gerade im rebellischen Osten des Reiches, Gefahr ausgehen.
Die Bitte am Schluss von Vers 15 ist nach Veerkamp genau vor dem Hintergrund dieser zu erwartenden hasserfüllten Verfolgung durch die Weltordnung zu deuten, der sich die messianische Gemeinde keinesfalls anpassen darf, wie Vers 16 nochmals hervorhebt:
Den Hass Roms kann kein Messias diesen Schülern ersparen, darum kann er den VATER nicht bitten. Einstweilig lebt die messianische Gemeinde unter den Bedingungen der Weltordnung (en tō kosmō). Auf gar keinen Fall ist die messianische Gemeinde von der Weltordnung bestimmt (ek tou kosmou). Sie teilt, wie gesagt (15,18f.), mit dem Messias das Leben in der Weltordnung, weil der Messias in dieses Leben gesandt worden war.
Die Worte hina tērēsēs autous ek tou ponērou übersetzt Veerkamp mit: „dass du sie bewahrst vor dem Übel“, womit er darauf verzichtet, dieses Übel als den Bösen zu personifizieren und mit dem archōn tou kosmou, dem Herrscher dieser Weltordnung, oder sogar einem außerweltlichen Satan zu identifizieren.
↑ Johannes 17,17-19: Die Heiligung der in die Weltordnung Gesandten in der Treue
17,17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.
17,18 Wie du mich gesandt hast in die Welt,
so habe auch ich sie in die Welt gesandt.
17,19 Ich heilige mich selbst für sie,
auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.
[20. Dezember 2022] Die „Bitte um Heiligung“ in Vers 17 (W472) nennt Klaus Wengst mit Theodor Zahn <1227> „die positive Kehrseite“ seiner Bitte um Bewahrung seiner Schülerschaft vor dem Bösen (W472f.):
In 10,36 hat Jesus festgestellt, dass der Vater ihn geheiligt, d. h. für sich ausgesondert und beansprucht habe. Nun bittet er ihn darum, seine Schüler zu heiligen. Gott soll sie also „gleichsam als heiligen Besitz ganz für sich beanspruchen und sich zusprechen“. <1228> Das aber heißt für sie – und für die das Evangelium Lesenden und Hörenden -, sich als von Gott Beanspruchte zu verstehen und sich auch wirklich in Anspruch nehmen zu lassen.
Dass (W473) nach „der biblisch-jüdischen Tradition … Gott Israel als ihm heiliges Volk“ beansprucht, wozu Wengst auf 2. Mose 19,6 und 3. Mose 11,44f. sowie 19,2 verweist, „wird im Midrasch <1229> breit ausgeführt“:
Aus dem Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk ergibt sich, dass Israel Gottes Repräsentant, Gottes Zeuge in der Welt ist. Das hat, wie der Schluss des Midrasch deutlich macht, ethische Implikationen: „Der Heilige, gesegnet er, sprach zu ihnen: ,Wenn ihr euch bewährt, werdet ihr ,Gemeinde der Heiligen‘ genannt werden. Bewährt ihr euch nicht, werdet ihr ‚Frevelgemeinde‘ genannt werden (Num 14,27): Wie lange noch (will) diese Frevelgemeinde usw‘.“ Dass Israel von Gott geheiligt, beansprucht ist – diesen Anspruch gilt es zu bewähren. Solche Bewährung vollzieht sich innerhalb des alltäglichen Lebens im Tun des von Gott Gebotenen. Das findet seinen wohl stärksten Ausdruck in dem relativ oft begegnenden Segensspruch: „Gesegnet (der Ewige, unser Gott, der König der Welt), der uns durch seine Gebote geheiligt und uns geboten hat“, das und das zu tun (vgl. z. B. Sof 14,4; 20,6).
Zu dieser „jüdischen Tradition“ steht Jesu Bitte: „Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit“, Wengst zufolge „nicht im Gegensatz, sondern in Entsprechung“:
Die ethische Dimension war schon in der Bitte von V. 15 um Bewahrung vor dem Bösen hervorgetreten. Die Heiligung durchs Wort kann nicht der Heiligung durch die Gebote entgegengestellt werden – sind doch die Gebote Gottes gebietendes Wort. „Und die Schrift darf nicht aufgelöst werden“, betonte Jesus in 10,35. Mit den Aussagen, dass die Heiligung „durch die Wahrheit“ geschehen soll und dass Gottes Wort Wahrheit ist, wird auf Stellen aus Ps 119 angespielt, der ein einziges langes Loblied auf Gottes gebietendes Wort ist, auf seine Wegweisung, auf die Tora. In Ps 119,142 heißt es: „Deine Gerechtigkeit ist Rechtsnorm auf immer und Deine Tora ist Wahrheit“ und in Ps 119, 160: „Dein Wort ist Wahrheit von Anfang an und auf immer bestimmt Deine Gerechtigkeit alles Recht“.
In diesem Zusammenhang erinnert Wengst daran,
dass das hebräische Wort für „Wahrheit“ (emét) in den Bedeutungsbereich von „Verlässlichkeit“ und „Treue“ hineinspielt. Gott bewahrheitet sich in der Verlässlichkeit seines Wortes; er hält Wort und erweist sich so als treu. Im Evangelium ist das Wort Gottes mit dem Wort Jesu verbunden. Hier liegt alles daran, dass dem Wort Jesu die Verlässlichkeit des Wortes Gottes zukommt. Aber sein Wort steht nicht dem Wort der Schrift entgegen oder ersetzt es gar – wie ja auch die Kirche einige Zeit später die jüdische Bibel nicht durch Schriften aus der ihr spezifischen Tradition ersetzt, sondern um sie ergänzt hat.
Mit Vers 18 beginnt nach Wengst ein neuer Abschnitt, in dem ein Rückblick etwas betrifft (W473f.), was
zur erzählten Zeit noch gar nicht geschehen ist, sondern erst geschehen wird: die Sendung der Schüler (V. 18), und zum anderen etwas, das sich gerade zu vollziehen beginnt: die Hingabe Jesu in den Tod für seine Schüler (V. 19). So ist vorbereitet, dass in der Bitte der Blick ausdrücklich über die Schüler hinausgeht und diejenigen einbezieht, die ihre Sendung gewinnen wird. Sie werden in V. 20 in der Einleitung zur Bitte genannt. Deren Inhalt – das einmütige Zusammenwirken – nimmt das Ziel der in V. 11 formulierten Bitte auf, wobei sich als Ziel der jetzigen Bitte eine Perspektive auf die Welt auftut (V. 21) Die V. 18-21 erweisen sich so als eine zusammengehörige und sinnvolle Einheit.
Trotz dieses Gliederungsvorschlages halte ich es für sinnvoll, den Vers 18 gemeinsam mit den ihn umschließenden Versen 17 und 19 über die Heiligung in einem engeren Zusammenhang zu sehen.
An der Aussage Jesu (W474) in Vers 18: „Wie Du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt“, ist für Wengst nicht überraschend, „dass nun nach der Bitte um Heiligung der Schüler ihre Sendung angesprochen wird“, denn auch Jesu „Heiligung durch Gott“ war in 10,36 „unmittelbar mit seiner Sendung in die Welt verbunden“. Da anders als (Anm. 215) die „synoptischen Evangelien“ (Matthäus 10,1-42; Markus 6,7-13; Lukas 9,1-6 und 10,1-16) das Johannesevangelium bisher nicht erzählt hat (W474), „sie ausgesandt zu haben“, überrascht nun doch, dass Jesus dies „in einer Form der Vergangenheit sagt“. Er nimmt vorweg, dass er sie als „der auferweckte Gekreuzigte“ senden wird (20,21):
Wie die Sendung Jesu selbst erfolgt auch die Sendung seiner Schüler „in die Welt“. Es kann also nicht um die Pflege und Kultivierung religiöser Bedürfnisse im abgeschlossenen Zirkel gehen. Der Schülerschaft Jesu ist die Welt als Ort zur Ausführung ihres Auftrags angewiesen. Darin ist ein Doppeltes enthalten: Ihre Sendung wird nicht konfliktfrei verlaufen; dennoch darf sie den Bezug auf die Welt nicht aus den Augen verlieren. Dass dabei die Alternative von „Hass“ oder „Glauben“ nicht allein das Feld beherrschen muss, wird sich bei der Besprechung des Schlusses von V. 21 zeigen.
Mit den Worten: „Und für sie heilige ich mich, auf dass auch sie in Wahrheit Geheiligte seien“, geht Jesus in Vers 19 „auf die Heiligung der Schüler als Voraussetzung ihrer Sendung“ ein, so wie er selbst „für seine Sendung dadurch qualifiziert war, dass Gott ihn ‚geheiligt‘, für sich beansprucht hatte“. Indem „dieses Sich-Heiligen Jesu für andere erfolgt“, kann es nach Schnackenburg <1230> „kaum einen Zweifel daran“ geben, dass dabei „an Jesu Hingabe in den Tod gedacht ist“. Seine Heiligung (W475) „für sie“ lässt Wengst zufolge anklingen,
was bisher im Evangelium zur positiven Wirkung seines Todes ausgeführt wurde. Die sich auf das hier ausgesprochene Wort einlassen, sind „schon rein“ (15,3), sind geheiligt, damit aber auch qualifiziert und beansprucht, entsprechend zu leben und zu wirken. Dass sie „in Wahrheit Geheiligte“ genannt werden, nimmt entweder auf, was in der Bitte in V. 17 gesagt war, oder vergewissert, dass durch Jesus wirksame Heiligung gegeben ist.
Durch den Zusammenhang zwischen Heiligung und Sendung sind nach Hartwig Thyen (T696) bereits die Verse 17 und 18 eng aufeinander bezogen:
Wie der Vater Jesus geheiligt hat, um ihn in die Welt zu senden (10,36), so bittet Jesus nun den Vater, auch seine Jünger zu heiligen, damit er, so wie der Vater ihn in die Welt gesandt hat, nun auch sie in die Welt entsenden kann. Durch ihre Heiligung bewahrt der Vater die Jünger dadurch vor dem Bösen, daß er sie zu seinem unveräußerlichen Eigentum macht. Das erbetene Heiligen wird als ein solches en tē alētheia {in der Wahrheit} beschrieben. Und diese Wahrheit wird ihrerseits mit dem Worte Gottes identifiziert: ho logos ho sos alētheia estin {dein Wort ist Wahrheit}.
Durch ein Zitat von Schlatter <1231> lässt Thyen erkennen, dass er die Bedeutung von alētheia in diesem Zusammenhang durch ihren Gegensatz zur Lüge definiert sieht:
„Die Frage, wie der Jünger der Lüge entgehe und Gottes Eigentum werde, findet ihre Beantwortung dadurch, daß es ein Wort Gottes gibt, das er hören und bewahren kann“. In Ps 119,142 erklärt der Beter: hē dikaiosynē sou dikaiosynē eis ton aiōna, kai ho nomos sou alētheia {Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit}…
Unter Berufung auf Wengst, der ich oben bereits entsprechend zitiert habe, betont Thyen weiter (T696f.):
Daß der Heiligung durch das Wort nicht die Heiligung durch die in der jüdischen Tradition immer wieder genannten Gebote, die doch Gottes gebietendes Wort sind, entgegengestellt werden kann, weil nach 10,35 die Schrift doch nicht aufgelöst werden darf, betont Wengst völlig zu Recht. Denn da es ja die Schrift ist, die für Jesus zeugt, „liegt alles daran, daß dem Wort Jesu die Verläßlichkeit des Wortes Gottes zukommt“.
Zu Vers 19 (T697) weist Thyen darauf hin, dass die Selbstheiligung Jesu „in unserem Evangelium nur hier begegnet“: „Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit“:
Die LXX gibt das hebräische qadasch (zum Opfer oder zum Priester weihen) in der Regel durch hagiazō wieder. So bezeichnet das Verbum etwa in Ex 13,2 und Deut 15,19 die Weihe aller erstgeborenen Lämmer zum Opfer und in Ex 28,41 die Priesterweihe.
Von da aus schließt sich Thyen in einer Auseinandersetzung mit den Auslegungen von Thüsing, Dibelius und Bauer der Interpretation von Bultmann <1232> an:
Bultmann erklärt, auch wenn es an sich richtig sei, „daß Jesu Selbstopfer das priesterliche Opfer ersetzt“, bestimme V. 19 ihn doch schwerlich als Priester und Opfer zugleich wie Hebr 9,11-14 (so aber Thüsing [92]). Wohl begreife Dibelius [182] das hagiazein {heiligen} zu Recht vom Sendungsgedanken her, „falsch aber ist es, dadurch den Opfergedanken auszuschließen; beides ist für Joh eine Einheit; für ihn beginnt die Passion schon mit der Fleischwerdung“ [Bultmann 391, vgl. 344f]. Im Zusammenhang mit der vorausgestellten Hingabe-Formel hyper autōn {für sie}, die dem Leser aus dem Spiel mit den traditionellen Abendmahlsworten Jesu in 6,51 und überhaupt aus den synoptischen Prätexten, aus den Reden vom guten Hirten (10,11.15-18) und vom Weinstock (15,13) sowie aus dem unfreiwillig prophetischen Wort des Kaiaphas (11,51f) bereits geläufig ist, kann Jesu ,Selbstheiligung‘ nichts anderes bedeuten, als dies, daß er als das Lamm Gottes die Sünden der Welt trägt (1,29) und sein Fleisch hingibt für deren Leben (6,51), daß er sein Leben (psychē) für seine Schafe gibt (10,11; vgl. 10,15.17f), daß er nicht allein für das Volk (Israel), sondern auch für alle in der Welt zerstreuten Gotteskinder stirbt (11,51f), und daß er in der denkbar größten Liebe sein Leben hingibt für seine Freunde (15,13). Bultmann verweist dazu auf die schon von Bauer [205] zitierte Passage aus der Catene 373,31 des Chrysostomos: ti estin: hagiazō emauton? Prospherō soi thysian. hai de thysiai pasai hagiai legontai; kai kyriōs hagia ta tō theō {Was heißt: Ich heilige mich selbst? Ich bringe dir ein Opfer. Alle Opfer aber werden heilig genannt; und dem Herren entsprechend heilig diejenigen für Gott}. Doch Bauer übersieht die am Herrenmahl haftende Bedeutung des dem egō hagiazō emauton {ich heilige mich selbst} vorangestellten hyper autōn {für sie} und postuliert für alle Vorkommen von hagiazein {heiligen} einschließlich seines singulären reflexiven Gebrauchs in unserem V. 19 „ein einheitliches Verständnis“. Er vermeidet den Gedanken des Opfers, so daß aus V. 19 in seiner Übersetzung die hochmythologische Aussage wird: „Zu ihrem Besten gehe ich zur Göttlichkeit ein, damit auch sie selbst wahrhaft göttlichen Wesens seien“ [Bauer 206f]. Mit Chrysostomos, Bultmann und den meisten Kommentatoren vermögen wir darum das hagiazō emauton {ich heilige mich selbst} nur in dem Sinne zu begreifen, daß Jesus hier von seinem Selbstopfer für die Seinen spricht.
Diese Auslegung legt Thyen zufolge weiterhin nahe, dass „die Opfer-Bedeutung“ auch „mit dem gleichen hagiazein {heiligen}“, das er „als den Zweck seiner Selbstheiligung erbittet, damit auch sie wahrhaft Geheiligte seien“, verbunden sein könnte [so Thüsing 92]:
Hinsichtlich des Partizips hēgiasmenoi {Geheiligte} denkt Bultmann [392] ähnlich wie Thüsing: „Es hätte wohl auch gesagt werden können: ,damit auch sie sich heiligen füreinander‘. Und zweifellos schließt die Sendung der Gemeinde in die Welt (V. 18) auch die Forderung der Opferbereitschaft in der Nachfolge Jesu ein“; vgl. 15,12f.
Was Thyen in diesem Zusammenhang mit dem Stichwort „Opfer“ verbindet, erläutert er (T698) mit einem Zitat von Johannes Fischer, <1233> der in seinen Augen „die hermeneutische {auslegende} Bedeutung der Übertragung der biblischen Sühnopfer-Rituale auf den Kreuzestod Jesu einleuchtend erklärt“ hat:
Er zeigt nämlich, daß, wie schon in den biblischen Sühnopfer-Ritualen, „der eigentliche Gehalt der zunächst so befremdlichen Deutung dieses Todes als Sühnopfer in einer hermeneutischen Anweisung (besteht, in der Anweisung) …, nämlich, daß wir uns in diesem Tod so erkennen sollen, wie wir von Gott darin erkannt sind. Alles kommt also darauf an zu verstehen, daß der Glaube an den Sühnopfertod Christi kein theoretischer Glaube an eine irgendwie außerhalb seiner selbst sich vollziehende Wirkung dieses Todes ist, sondern praktischer Glaube, der die soteriologische {rettende} Wirkung des Kreuzes Christi dadurch selbst vollzieht, daß er den Glaubenden in das neue Gottesverhältnis hineinstellt, in dem eben dieser sich vor Gott erkennt, wie er erkannt ist“.
Offen muss nach Thyen bleiben (T697), „ob das artikellose en alētheia {in Wahrheit}“ am Ende von Vers 19 „im Gegensatz zu dem artikulierten in V. 17 adverbial im Sinne von alēthōs {wahrhaftig} gebraucht ist [Bultmann 391f] oder ob es wegen des engen Zusammenhangs mit V. 17 im Vollsinn wie dort verstanden sein will“.
Ton Veerkamp <1234> übersetzt die Verse 17 bis 19, indem er alētheia mit „Treue“ wiedergibt:
17,17 Heilige sie mit deiner Treue;
dein Wort ist Treue.
17,18 Wie du mich in die Weltordnung gesandt hast,
so habe ich sie in die Weltordnung gesandt.
17,19 Denn ihretwegen habe ich mich selbst geheiligt,
damit auch sie zu Geheiligten werden durch die Treue!
In seiner Anm. 493 zur Übersetzung von Johannes 17,17 erläutert er im Jahr 2015, warum er von der üblichen Wiedergabe von alētheia mit „Wahrheit“ abweicht:
„Heilige sie in der (durch die) Wahrheit, dein Wort ist (die) Wahrheit“ wird übersetzt (Luther, Becker, Schulz, Wilckens, Zürcher Bibel usw.). Aber gerade die fast hoffnungslose Lage dieser winzigen Gruppe aus Israel unter den römischen Verhältnissen ohne den Schutz der Synagoge zeigt, dass es weniger um die Wahrheit Gottes als vielmehr um seine Treue zu diesem Israel geht. „Heilige sie“: dieser Imperativ hat als Hintergrund Leviticus 19,2 u.ä. Gott ist der meqadischkhem, „der euch Heiligende“, und die Schüler dementsprechend mequdaschim be-ˀemeth, „Geheiligte durch die Treue“. Die Kombination qadosch, „heilig“, und ˀemeth, „Treue“, kommt, soweit ich sehe, in der Schrift so nicht vor.
In seiner Auslegung im Jahr 2007 bezieht Veerkamp diese Heiligung der Schüler Jesu durch die Treue des Gottes Israels auf ihre Sendung in die Weltordnung. Dass dabei das hier geforderte „Leben (zwar unter, aber nicht bestimmt von den Bedingungen der Weltordnung)“ ein „heiliges Leben“ genannt wird, ist
nichts Neues, sondern das Durchhalten eines Lebens, das Israel aufgegeben war, Leviticus 18,3ff.:
Wie nach dem Tun Ägyptens, wo ihr wohntet, tut nicht;
Und nach dem Tun des Landes Kanaan, wohin ich euch brachte, tut nicht,
nach ihren Gesetzen geht nicht den Gang.
Mein Recht tut,
Meine Gesetze wahrt,
nach diesen den Gang zu gehen.
Ich bin es, der NAME, euer Gott.Hier beginnt der zweite Teil des Buches Leviticus, das, was die kritische Forschung „Heiligkeitsgesetz“ nannte: „Denn heilig bin ich, der NAME, euer Gott“ (Leviticus 19,2; 20,26; 21,8) und: „Werdet zu Heiligen“ (19,2; 20,7; 21,6.8). „Heilige sie mit der Treue“ (hagiason autous en tē alētheia, haqdeschem be-ˀemeth) hat also Leviticus 19,2 als Hintergrund. Gott ist meqadischkhem, der euch Heiligende, und die Schüler sind dementsprechend mequdaschim be-ˀemeth, „Geheiligte durch die Treue“. Die Heiligkeit Israels besteht hier im Wahren der Tora (Leviticus 18-25), durch die sich Israel im sechsten Jahrhundert v.u.Z. aus der normalen altorientalischen Welt der Ausbeutung verabschiedete.
Anders als Wengst und Thyen begreift Veerkamp also das Stichwort der „Heiligung“ nicht allein als eine ethisch-religiöse Kategorie, sondern vor allem als gesellschaftlich-politische Herausforderung für Israel und seine führenden Kreise. Dieses politische Verständnis des Wortes hagiazein {heiligen} setzt Veerkamp auch für die jüdisch-messianische Gruppe um Johannes am Ende des 1. Jahrhunderts voraus:
Auch bei Johannes verabschieden sich die Schüler aus der Normalität der Weltordnung. Die Treue des Gottes Israels „heiligt“ die Gruppe und nimmt sie aus der Weltordnung heraus, obwohl sie unter der Weltordnung bleiben muss. Die Weltordnung setzt nicht länger die Normen und ist für die Gruppe nicht mehr die Normalität. Die Antwort der Gruppe besteht im Bewahren der Rede des Messias: Vertrauen in den Messias, Solidarität untereinander.
Diese Sicht der Dinge erlaubt es Veerkamp, den Unterschied der Messianisten um Johannes von der jüdischen Mehrheit seiner Zeit genauer ins Auge zu fassen:
Das ist ein anderes Modell als das, was Israel mit seiner Tora zu verwirklichen sucht. Nur eine sachgemäße Übersetzung bringt diesen Tatbestand ans Licht. Psalm 119,160 sagt: rosch-devarkha ˀemeth – „Die Hauptsache deiner Rede ist die Treue {übliche Übersetzung: Dein Wort ist Wahrheit}!“ Die Schlussfolgerung, die das rabbinische Judentum mit Psalm 119,142 zieht, ist eine ganz andere als die des Johannes: „Deine Bewährung ist bewährt in Weltzeit / und Deine Tora ist die Treue“, toratkha ˀemeth. Für Johannes ist das Wort (logos, davar) das Wort Gottes, und der Messias Jesus ist jetzt das Wort. Deswegen ist der Seitenverweis von Nestle-Aland für 119,160 richtig, für 119,142 aber nicht. Bei Johannes ist „Wort“ eben nicht identisch mit „Tora“. Es ist ja „eure Tora“, wie er wiederholt zu den Judäern sagt (8,17; 10,34; vgl. 15,25).
Dennoch verabschiedet sich Johannes keineswegs vollständig von der Tora und erst recht nicht von der Treue des Gottes Israels; beide erfüllen und bewähren sich vielmehr im Wirken des Messias Jesus bis hin zu seinem Aufsteigen zum VATER in seiner Lebenshingabe:
Die Treue des Wortes Gottes ist die Voraussetzung für die Mission des Messias und für die Mission, mit der der Messias seine Schüler beauftragt. Ihre Sendung in oder unter die Weltordnung ist keine andere als die des Messias, und sie wird auch die gleichen Konsequenzen haben. Die Treue Gottes „heiligt“ sie, macht sie zu Menschen, die nicht von der Weltordnung her leben. Das ist nicht die neue Weltreligion, sondern es ist die unendlich verdichtete Tora einer isolierten Sekte unter völlig neuen Bedingungen, das neue Gebot.
Dass dieses „neue Gebot“ keinesfalls die Tora ersetzen soll (Anm. 501), sondern dass eine „unlösliche Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Gebot“ besteht, hat ein „Schüler des Johannes“ im 1. Johannesbrief 2,7-8 zu beschreiben versucht. Ton Veerkamp <1235> übersetzt diese Verse folgendermaßen:
2,7 Ihr, denen euch Solidarität erwiesen ist,
ich schreibe euch kein neues Gebot,
sondern ein Gebot von alters her,
das ihr hattet von Anfang an.
Das Gebot von alters her ist die Rede, die ihr gehört habt.
2,8 Wiederum ein neues Gebot schreibe ich.
Was vertrauenswürdig bei Ihm ist, ist es auch bei euch:
dass die Finsternis abgeschafft wird,
und das vertrauenswürdige Licht bereits scheint.
In seiner Auslegung des 1. Johannesbriefs erläutert Veerkamp auch, wie dort die Abschaffung der Finsternis in der Nachfolge des Messias Jesus vorzustellen ist, und zwar auch [42] in Abgrenzung von einer zur Zeit dieses Briefes massiv um sich greifenden „Feindschaft gegen alles Jüdische, das von einem Messias Jesus nichts hält“, und [40] die diesen jüdischen Brüdern mit Hass begegnet (1. Johannes 2,9-11) [41]:
Wie lebt man „im Licht“ oder „in der Finsternis“? Für jüdische Menschen kann es nur ein Leben geben: das Wahren der Gebote. Im Zentrum stehen die Begriffe Treue („Gottes“) und Solidarität („Gottes“). Die Halacha, der Gang durch das Leben, ist durch dieses Zentrum orientiert: Eine vertrauenswürdige Lebensweise, so heißt es dann konkret, sei ein Leben in der Solidarität. Das sei nichts neues, sondern das sei das „Gebot von alters her“. Neu aber ist die Lage: Die Finsternis wird abgeschafft, das Licht der Treue fängt zu scheinen an. Die Solidarität ist ein Gebot von alters her, Dtn 6,4f und Lev 19,18. Die Seele aller Gebote ist die Solidarität des „Gottes“ Israels mit seinem Volk und diese Solidarität zeigt sich überhaupt, „erfüllt“, in der Solidarität unter den Menschen.
Eine so verstandene Solidarität wird nach Johannes ermöglicht, indem der Messias Jesus mit seinem Tod am Kreuz die Inspiration der Treue des Gottes Israels seinen Schülern übergibt (Johannes 19,30 und 20,22), damit sie seine agapē leben können.
↑ Johannes 17,20-21: Jesu Bitte, dass alle zukünftig ihm Vertrauenden eins werden und auch der kosmos zum Vertrauen kommt
17,20 Ich bitte aber nicht allein für sie,
sondern auch für die,
die durch ihr Wort an mich glauben werden,
17,21 dass sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein,
auf dass die Welt glaube,
dass du mich gesandt hast.
[21. Dezember 2022] Die „neue Bitte“ in den Versen 20-21 leitet Jesus Klaus Wengst zufolge (W475) ein, „indem er sagt, dass er bitte und für wen er bitte“. Nunmehr werden „die das Evangelium Lesenden und Hörenden“ nicht nur „implizit mit einbezogen“, sondern „auch ausdrücklich in den Blick genommen“:
„Nicht für diese allein bitte ich jedoch, sondern auch für diejenigen, die durch ihr Wort an mich glauben.“ Der erste Teil der Bitte wiederholt in V. 11 Gesagtes: „auf dass sie alle einmütig zusammenwirken“. Die jetzt gemachte Betonung „alle“ lässt sich von daher verstehen, dass in der Einleitung zur Bitte über die Schüler Jesu hinaus die späteren Glaubenden in den Blick kommen. So geht es bei diesem einmütigen Zusammenwirken nicht nur horizontal um die in derselben Generation Lebenden, sondern auch um eine Wirk-Einheit durch die Generationen hindurch. Das aber heißt für die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde: Sie hat es zu gewärtigen, dass in ihr einmütiges Zusammenwirken die ihr vorangegangenen Generationen einbezogen sind. Sie, die Toten, sind aus der „Gemeinschaft der Heiligen“ nicht ausgeschlossen. Sie kommen zur Wirkung und wirken mit den Lebenden zusammen in deren Eingedenken – indem sie von diesen nicht vergessen, sondern erinnert werden.
Dass Wengst hier die Blickrichtung noch einmal umkehrt, indem er die „Gemeinschaft der Heiligen“ auch auf die „Toten“ der „vorangegangenen Generationen“ bezieht, passt zur Perspektive der rückblickenden Interpretation eines Theologen der christlichen Kirche, kommt aber nicht im Johannes-Text selbst zum Ausdruck.
Wieder übersetzt Wengst die Wendung hen ōsin {wörtlich: eins seien} mit „einmütig zusammenwirken“. Dieses war in Vers 11
damit begründet worden, „wie wir“ – Jesus und der von ihm angeredete Vater – „einmütig zusammenwirken“. Ähnlich heißt es jetzt in einer Parenthese: „wie Du, Vater, bei mir bist und ich bei Dir bin“. Auch das erinnert an schon Gesagtes (10,38; 14,10f.). Demnach ist Gott so bei Jesus, dass er in dessen Handeln zum Zuge kommt; und indem Gott in Jesu Handeln zum Zuge kommt, ist Jesus bei Gott. Darüber hinaus hieß es in 14,20, dass Jesu Schüler bei ihm seien. Das bedeutete, dass in ihrem Wirken Jesus zum Zuge komme, sein Werk sich in dem ihren auswirke. Nach dem zweiten Teil der Bitte, „auf dass auch sie bei uns seien“, soll die Gemeinde so ins Wirken Gottes durch Jesus hineingezogen werden, dass es in ihrem Leben und Handeln nach außen drängt, sich „äußert“. Das stützt die Annahme, dass es nicht um eine Wesenseinheit geht, sondern um ein gemeinsames Wirken.
Dazu verweist Wengst (Anm. 218) auf Calvins <1236> Kritik an vielen
„der Väter“, die „diesen Worten die kurze Erklärung gegeben (haben), Christus sei eins mit dem Vater, weil er ewiger Gott sei; doch haben sie sich durch ihren Kampf gegen die Arianer dazu hinreißen lassen, klare Sätze zu verdrehen und ihnen so einen ganz anderen Sinn abzugewinnen. Christus wollte aber etwas ganz anderes, als uns zu Grübeleien über seine verborgene Gottheit anzuregen“.
Alles Reden im Johannesevangelium über die Einheit Jesu mit dem Vater und ihre Einheit mit der Gemeinde läuft also auf folgenden schlichten Satz hinaus (W475):
Die Einheit ist vorgegeben im Handeln Gottes in Jesus; sie äußert sich und wird darin sichtbar, dass sich dieses Handeln Gottes im Handeln der Gemeinde auswirkt.
Wie ist aber der „dritte Teil der Bitte“ in Vers 21 zu verstehen: „auf dass die Welt glaube, dass Du mich gesandt hast“? Es war schon gesagt worden, dass die „in die Welt gesandte Schülerschaft Jesu … in ihrem Wirken auf die Welt bezogen“ bleibt und „sich nicht abschotten“ darf, aber Wengst bezweifelt, dass man „diese Zielbestimmung“ so wie Blank <1237> verstehen darf (W475f.):
„Die Einheit der Gemeinde ist etwas so Überzeugendes und Wunderbares, daß die ,Welt‘ dadurch zum Glauben an Jesus gebracht werden kann.“ Dass der Hauptsatz in dieser Weise als Feststellung formuliert werden kann und darf, erscheint doch sehr fraglich. Im Nebensatz besteht zwischen der Formulierung von Blank und der des Textes eine kleine Differenz. Blank spricht vom „Glauben an Jesus“, der Text hat an dieser Stelle: „glauben, dass […]“. Gewiss gibt es im Johannesevangelium viele Stellen, wo das „Glauben, dass […]“ ein „Glauben an […]“ einschließt. Aber ist das ein notwendiger Zusammenhang? Muss das auch an dieser Stelle so sein? Der Umstand, dass die späteren Glaubenden ausdrücklich in den Blick genommen werden und von ihnen „die Welt“, die „glauben möge, dass […]“, unterschieden wird, eröffnet jenseits der Alternative „Glaube oder Hass“ eine andere Möglichkeit des Verstehens. Das Leben und Handeln der Gemeinde möge auf Außenstehende einen solchen Eindruck machen, der sie zu der Annahme führt, dass da etwas „dran“ sei.
In den abschließenden Sätzen zu dieser Argumentation macht Wengst noch einmal sein Interesse deutlich, das er hier verfolgt, und er legt offen, dass er das Stichwort kosmos in diesem Zusammenhang vor allem als eine „jüdische Welt“ begreift:
Die tatsächlich gebrauchte Formulierung: „glauben, dass Du mich gesandt hast“, ergibt besonders dann einen Sinn, wenn „die Welt“ eine jüdische ist. Das sich aus Gottes Handeln in Jesus ergebende Wirken der Gemeinde soll so sein, dass Juden – ohne „an Jesus“ zu glauben – es erkennen und akzeptieren können, dass Menschen, die durch Jesus an Gott glauben, damit an keinen anderen Gott glauben als an Israels Gott.
Das ist eine im Blick auf den interreligiösen Dialog sympathische Interpretation, die aber in dieser Form sicher über die ursprünglichen Erwartungen des Johannes und seiner jüdisch-messianischen Gruppierung hinausgeht. Gerade weil sie das rabbinische Judentum noch nicht als fremdreligiöses Gegenüber betrachtete, fiel ihre Kritik an dessen Ablehnung des Messias Jesus um so schärfer aus, so dass eine abgestufte Erwartung, zwar vielleicht nicht selbst an Jesus zu glauben, aber doch irgendwie seine Sendung von Gott anzuerkennen, für sie gar nicht in Frage kommen konnte. Hinzu kommt die Frage, ob hier wirklich die „jüdische Welt“ oder nicht vielmehr doch die römische Weltordnung im Blick ist.
Hartwig Thyen (T698) betont zu Vers 20, in dem Jesus nicht nur „für die verbliebenen Elf, die bei ihm sind, sondern auch für die … den Vater“ anruft, „die nach seinem Weggang durch deren Wort an ihn glauben werden“, dass in ihm „das zeitlose und die Christen aller künftigen Generationen einschließende präsentische Partizip pisteuontōn {Glaubende}“ auf die am Ende stehende Wendung eis eme {an mich} bezogen werden muss.
Mit drei hina-Sätzen wird sodann in Vers 21 beschrieben, wozu das „Zeugnis der Jünger an die künftigen Glaubenden“ ergehen muss, nämlich
damit (hina) sie alle Eines seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, und damit (hina) auch sie in uns seien, damit (hina) die Welt glaube, daß du mich gesandt hast“. Zu den drei hina-Sätzen erklärt Bauer <1238> treffend, daß die ersten beiden koordiniert seien, während der Dritte die „bezweckte Folge“ des in den beiden ersten erbetenen Zustandes angebe.
Anders als Bultmann, <1239> der auf Grund „seiner Textumstellungen und seiner dadurch bedingten Auslegung von Joh 17, sowohl vor 13,34f als auch vor 15,9ff“, fragen muss, „warum von der Einheit der Liebe, wie sie in 1Joh als Konsequenz des Glaubens entwickelt wird, hier nicht die Rede ist“, vermisst Thyen „hier die Rede von der Einheit in der Liebe nicht“, denn er vermag ja „für Bultmanns Rearrangement keine überzeugenden Gründe zu erkennen“. Er sieht vielmehr umgekehrt (T699) im
wechselseitigen In-Sein des Vaters im Sohn und des Sohnes im Vater sowie der Glaubenden in ihnen beiden, und in der nachdrücklichen Wiederaufnahme des Stichwortes der Liebe in V. 23 Züge, die den Leser an bereits in 13,34f und 15,9ff Gesagtes erinnern sollen. Denn nicht darum geht es hier, sondern darum, daß dieses wechselseitige In-Sein das bleibende Zeugnis ist, das die Welt zu dem Glauben führen soll, daß Gott Jesus gesandt hat. Insofern ist Jesu Gebet für die Gemeinde und ihr in der Einheit von Vater und Sohn begründetes Einssein „zugleich auch eine Fürbitte für die Welt, in der die Gemeinde, wie schon V. 18 sagte, ihre Aufgabe hat“ [Bultmann 394].
Für Thyen stellt also die Aussage, dass „die Welt“ zum Glauben an die Sendung Jesu durch Gott geführt werden soll, keinerlei Problem dar, indem das Wort kosmos als die Menschenwelt aller Völker offenbar als das Missionsfeld der zukünftigen Gemeinde Jesu zu begreifen sein soll.
Nach Ton Veerkamp <1240> verlässt Johannes in Vers 20
die Zeitebene der Erzählung und begibt sich auf die Zeitebene derer, die Generationen später mit dieser und vor allem um diese Vision zu kämpfen haben. Für sie wünscht sich der Messias, dass diese sich alle in jener Einheit Israels finden, die die Einheit des Gottes Israels mit dem Messias Israels ist. In den folgenden Sätzen hören wir fünfmal das Wort „Eins“ oder „Einheit“ (hen). Johannes lässt den Messias die Einheit der messianischen Gemeinde beschwören, gerade weil sie innerlich zerrissen ist, weil sie durch die Fragen gequält wird, wie sie Thomas, Philippus, Judas stellten.
In seiner Anm. 494 zur Übersetzung von Johannes 17,21 weist Veerkamp darauf hin, dass „die großen Codices Sinaiticus, Alexandrinus, Ephraemi rescriptus und viele andere Handschriften“ in Vers 21 ein weiteres hen {eins} eingefügt haben, so dass der Anfang des Verses so zu übersetzen wäre (die Hervorhebung stammt von mir):
damit alle eins werden:
so wie du, VATER, mit mir und ich mit dir,
damit sie mit uns eins sind…
Veerkamp fährt in seiner Erläuterung fort:
… aber nicht weniger überzeugend ist die Weglassung durch P66, den Vaticanus und den Codex Bezae sowie einige andere. Nestle/Aland entscheidet sich für die Weglassung, weil der Zusatz ein Versuch der textlichen Harmonisierung zu sein scheint. Jedoch wird so eine theologische Auseinandersetzung geführt. Die Hersteller etwa des Codex Vaticanus dürften davor zurückgeschreckt sein, die „Einheit“ zwischen Gott und dem Messias mit einer „Einheit“ der Schüler „und uns“ gleichzusetzen.
Die Fortsetzung von Vers 21 ist in den Augen von Veerkamp, der das Wort kosmos in diesem Zusammenhang mit der römischen Weltordnung identifiziert,
ein fast unglaublicher Nebensatz: „Damit die Weltordnung vertraue, dass Du mich gesandt hast.“ Nach allem, was Johannes gesagt hat, etwa über die Inspiration der Treue, die die Weltordnung nicht annehmen kann, kann das nicht stimmen. Wird der Text hier widersprüchlich in sich? Nur wenn diese Weltordnung sich selbst dabei als diese Ordnung aufgibt, wird die Kohärenz gewahrt. Nur wenn die Welt nicht länger römische Weltordnung, nicht länger als Raum der pax Romana ist, sondern sich zum Lebensraum, zu einer Welt der Menschen findet, die der Treue Gottes zu Israel gemäß wäre, wenn sie zur pax messianica wird, kann sie darauf vertrauen, dass der Messias der Gesandte dieses Gottes sei.
Kann das aber von Johannes als eine reale Perspektive angenommen worden sein? Nach Veerkamp ist das tatsächlich vorstellbar, indem er auf eine biblische Zukunftshoffnung verweist, die er im dritten Teil des Jesajabuchs findet:
Auch das ist eine biblische Vision, Jesaja 66,18:
Und ich, um alle Nationen, alle Sprachgruppen zu holen aus ihrem Tun, aus ihren Planungen,
bin ich gekommen.
Und sie kommen, und sie sehen meine Ehre.Wenn die Weltordnung aller Nationen im Römischen Reich dem Messias vertraut, wird sie „herausgeholt aus ihrem Tun und ihren Planungen“. Dann ist sie eben nicht länger herrschende Weltordnung, kosmos. Diese Vision Israels aus den Zeiten des sogenannten Tritojesaja, wo Griechenland sich schon als Faktor bemerkbar gemacht hat (Jawan, Ionien), macht diesen unglaublichen Nebensatz verständlich.
Anders als Wengst bezieht Veerkamp das Wort kosmos also nicht auf eine jüdische Welt, die wenigstens zur Anerkennung der Sendung Jesu, wenn schon nicht zum Glauben an ihn bereit sein wird, und auch nicht wie Thyen auf die Menschenwelt als allgemeines Missionsfeld der Gemeinde Jesu, sondern auf eine prinzipiell dem Gott Israels gegenüber feindlich eingestellte Weltordnung, die durch die Praxis der in der messianischen Gemeinde geübten agapē, einer tatkräftigen solidarischen Liebe, angetrieben durch die Inspiration der Treue des Gottes Israels, ihre Gewalt- und Ausbeutungsstrukturen vollständig aufgeben kann – eine wahrhaft unglaubliche und bis heute nicht eingelöste Perspektive, an der gerade deswegen festzuhalten ist.
↑ Johannes 17,22-24: Jesu Ehre für die Seinen, damit sie eins sind und der kosmos, der selbst verworfen ist, die Solidarität des VATERS mit Jesus und den Seinen erkennt
17,22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben,
die du mir gegeben hast,
auf dass sie eins seien,
wie wir eins sind,
17,23 ich in ihnen und du in mir,
auf dass sie vollkommen eins seien
und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast
und sie liebst,
wie du mich liebst.
17,24 Vater, ich will,
dass, wo ich bin,
auch die bei mir seien,
die du mir gegeben hast,
damit sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast;
denn du hast mich geliebt,
ehe die Welt gegründet war.
[22. Dezember 2022] Nach Klaus Wengst (W476) enthalten die Verse 22-24 „mit der letzten Bitte … fast ausschließlich Motive und Aussagen, die bisher im Evangelium – und besonders in den Abschiedsreden und in diesem Gebet – schon begegnet sind“. Eigenartig findet es Wengst, „dass das, was nach dem Beginn des Rückblicks {in Vers 22} Jesus seinen Schülern gegeben hat – die ihm seinerseits von Gott gegebene Herrlichkeit -, schließlich {in Vers 24} als Ziel der Bitte erscheint“, denn damit sind „Voraussetzung und Ziel identisch“, woraus er den Schluss zieht: „Was immer schon als ‚gegeben‘ vorausgesetzt werden darf, muss doch immer wieder erst noch erstrebt und gewonnen werden.“
Aber wie deutet Wengst überhaupt die den Seinen übergebene doxa, von der Jesus in Vers 22 sagt: „Und die Herrlichkeit, die Du mir gabst, gab ich ihnen“? Jesus,
der im Blick auf seinen Tod um Verherrlichung gebeten hatte (V. 1.5), hat seinerseits Gott verherrlicht (V. 4), Gottes Namen bekannt gemacht (V. 6), Gottes Wort weitergegeben (V. 14) und damit auch die ihm gegebene „Herrlichkeit“, die ihm erwiesene „Ehre“. Wer sich auf das von ihm ausgehende ansprechende Wort einlässt, weiß sich von ihm „geehrt“.
Dieses Geehrtsein deutet Wengst mit einer Formulierung von Nicole Chibici-Revneanu <1241> (W476f.):
Den so Glaubenden ist „Ehre“, ist „Herrlichkeit“ gegeben „als ,Gesandten des Gesandten‘“. Begründet ist das in der „Stunde“, die in den Abschiedsreden ständig im Blick ist: Jesus, dem gerade als Gekreuzigtem das Gewicht Gottes zukommt, hat in seinem Wirken Gott alles Gewicht, ihm allein die Ehre gegeben. Als Ziel dessen erscheint noch einmal, „auf dass sie einmütig zusammenwirken wie wir“. Das Wirken Jesu gegenüber seiner Schülerschaft hat deren gemeinsames Wirken zum Ziel.
Die besondere Art der Beauftragung der Schülerschaft Jesu, die hier angesprochen wird (Anm. 222), erläutert Chibici-Revneanu [292f.] folgendermaßen:
„Die Weitergabe des Sendungsauftrages vollzieht sich nicht wie die Weitergabe einer Stafette beim Staffellauf (d. h. so, dass Jesus seinen Auftrag mit dessen Übergang an die Jünger völlig aus der Hand gegeben hätte), sondern als Hineinnahme in die dóxa und den Sendungsauftrag des Gebenden“.
Den Satz (W477), „auf dass sie einmütig zusammenwirken wie wir“, führt Jesus in Vers 23 weiter aus:
„Ich bei ihnen und Du bei mir.“ Wie Gott bei Jesus, so kommt Jesus bei seiner Schülerschaft zum Zuge, „auf dass ihr einmütiges Zusammenwirken vollendet sei“. „Wenn die Einheit Gabe des in der Gemeinde gegenwärtigen Christus ist, dann besagt dies auch, daß die Gemeinde ihre Einheit nicht als feste Größe je schon hat, sondern daß sie zugleich unterwegs zur Einheit ist, unterwegs zur vollendeten, vollkommenen Einheit.“ <1242>
Von entscheidender Bedeutung ist nun aber nach Wengst, dass das „gemeinsame Wirken der Schülerschaft Jesu, ihre so verstandene Einheit, … kein Selbstzweck“ ist, sondern „eine weitergehende Perspektive“ erhält:
„auf dass die Welt erkenne, dass Du mich gesandt und sie, die Du mir gabst, geliebt hast, wie Du mich geliebt hast“. Statt von „glauben“ ist jetzt von „erkennen“ die Rede. Daran zeigt sich, „daß die beiden Verben einander wechselseitig so interpretieren, daß der Glaube als verstehender und das Erkennen als glaubendes erscheinen“ {so Thyen 699}. Der Gegenstand des Erkennens ist nicht nur die Aussage von der Sendung Jesu durch Gott, sondern auch die von der Liebe Gottes zu Jesus und dessen Schülerschaft.
Dieses Erkennen der Welt wurde unter den Exegeten sehr unterschiedlich ausgelegt. Wengst erwähnt einerseits Bultmanns <1243> Auslegung, „‚sich für ihn (den ,Offenbarer‘) zu entscheiden‘, was der Gemeinde zugehörig macht“, andererseits aber Beckers <1244> Deutung im Sinne einer „Einsicht in die eigene Verlorenheit“, indem er (Anm. 226) an gleicher Stelle schreibt, die Welt werde „erkennen, wie Jesu Sendung an ihr vorbei sich als Liebe der Seinen realisiert“. Diese Deutung kann Becker nach Wengst aber „nur durchführen, indem er V. 20f. als einen Nachtrag von anderer Hand ausscheidet“.
Nach Wengst ist aber auch (W477)
hier ist ein anderes Verständnis möglich, das die im Text gewahrte Unterschiedenheit der Welt von der Gemeinde beachtet und doch nicht die Welt durch Ummünzen der positiven Aussage in eine negative für verloren erklärt. Das Wirken der Gemeinde soll die außerhalb ihrer lebenden Menschen positiv beeindrucken. Wiederum ist deutlich, dass sich diese Möglichkeit dann nahelegt, wenn die vom Text vorausgesetzte „Welt“ eine jüdische ist: Sie möge aus dem Leben und Handeln der Gemeinde schließen können, dass Gottes Liebe auch Jesus und den Seinen gilt.
In Vers 24 spricht schließlich
Jesus seinen „letzten Willen“ als Bitte an Gott aus: „Vater, von dem, was Du mir gabst, will ich, dass – wo ich bin – auch jene bei mir sind.“ Noch einmal taucht das in diesem Gebet schon mehrfach aufgenommene Motiv von der Gemeinde als „Gegebenheit“ Gottes auf. Vor allem aber klingt das Thema der Nachfolge an. Da zu sein, wo Jesus ist, bezeichnete nach 12,26 und 14,3f. die Nachfolge. Sie ist der Ort bleibender Verbundenheit mit Jesus.
Zum „Ziel der Bitte um die bleibende Verbundenheit mit seiner Schülerschaft, die sich in der Nachfolge vollzieht“, betont Wengst nochmals, dass „Johannes Jesus hier fast identisch mit V. 22 von der ‚Herrlichkeit, die Du mir gabst‘, sprechen lässt“ (W477f.) und darum „an keine andere als dort“ denkt:
„auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, die Du mir gabst“. … Wer sich auf die Nachfolge Jesu einlässt – und das wird nur tun, wem Jesus seine „Herrlichkeit gegeben“ hat, wem er „(ge)wichtig“ geworden ist -, wird schon merken, dass das eine „herrliche“ Sache, eine Sache von Gewicht ist. Ausgangspunkt und Ziel sind identisch. Was Jesus seiner Schülerschaft gab, wird nicht ihr Besitz, sondern ist je und je zu ergreifen. Es ist Voraussetzung – Vor-Gabe – ihres Wirkens und also auch ihrer Einheit, die als schon gegeben im einmütigen Zusammenwirken je und je immer wieder gewonnen werden muss. Sie ist kein Zustand, sondern ein Prozess.
Diese Worte klingen theologisch richtig, üben jedoch auf mich denselben Reiz aus, den die Lektüre weiter Teile des Johannesevangeliums früher bei mir bewirkte: gähnende Langeweile durch eine Vielzahl aufeinander bezogener Begriffe und Bilder, die alle mehr oder weniger verschwommen das Gleiche auszusagen schienen. Ob das mehr als religiöses Wortgeklingel ist, müsste sich in kirchlicher Praxis erweisen. Für die Exegese wichtiger ist, ob bereits Johannes das überhaupt so gemeint haben mag. Denn obwohl Wengst auf die Grundbedeutung „Gewichtigsein“ des Wortes doxa, hebräisch: kavod, Bezug nimmt, lässt er außer Acht, dass mit diesem Wort die Ehre des Gottes Israels bezeichnet wurde, die ganz und gar auf das Leben und die Befreiung seines Volkes Israel ausgerichtet bleibt, was ein Exeget wie Wengst, der doch von der bleibenden Erwählung Israels durch Gott überzeugt ist, durchaus in Betracht ziehen könnte, zumal (W478) der „abschließende Begründungssatz“ auf diesen Gott noch einmal ausdrücklich zu sprechen kommt. Dieser „verankert“ nämlich „Jesu Herrlichkeit in Gottes Liebe zu ihm“:
„weil Du mich vor Anfang der Welt geliebt hast“ … Was ihm – gerade als dem in den Tod am Kreuz Gehenden – Gewicht gibt, hat er allein von Gott her, der auch in diesem elenden Tod an ihm festhält. Wenn von dieser Liebe Gottes zu Jesus gilt, dass sie schon „vor Anfang der Welt“ bestand, wird sie damit als unumstößlich herausgestellt.
Damit wird das, was Jesus „Gewicht gibt“, in ziemlich allgemeiner Weise auf die „Liebe Gottes“ bezogen, die trotz Jesu Tod „unumstößlich“ bleibt, ohne allerdings zu fragen, welches konkrete Ziel diese Liebe Gottes nach wie vor im Auge hat: den Anbruch der kommenden Weltzeit des Friedens für Israel inmitten der Völker.
Hartwig Thyen (T699) sieht die Verse 22-23 in „nahezu völliger Parallelität“ zu den Versen 20-21 formuliert. Sie „variieren“ das dort
über das pisteuein {Glauben} Gesagte … unter dem Stichwort der doxa {Herrlichkeit}. Wieder wird hier, nachdem in zwei koordinierten hina-Sätzen das vollendete Einssein der Christen erbeten wurde, als dessen Zweck formuliert: hina ginōskē ho kosmos hoti sy me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas {damit die Welt erkenne, dass Du mich gesandt und sie, die Du mir gabst, geliebt hast, wie Du mich geliebt hast}. War dort von dem Glauben an Jesus derer die Rede, die durch das Wort seiner Jünger zu ihm finden sollten, und von ihrem Einssein in Jesus und dem Vater, damit die Welt glaube, daß Gott ihn gesandt hat, so heißt es nun, daß Jesus ihnen (autois) die Herrlichkeit gegeben habe, die der Vater ihm verliehen hat, damit die Welt erkenne, daß der Vater ihn gesandt und sie mit der gleichen Liebe wie den Sohn geliebt hat.
Da mit „den autois die durch das Zeugnis der Jünger zu Jesus Gekommenen“ gemeint sein müssen, spricht „Jesus hier wiederum als der bereits zum Vater Erhöhte“ mit einem Satz im „Perfekt“, das „als zeitloses verstanden“ werden muss, von der Herrlichkeit, die er ihnen gegeben hat.
Darauf, dass die parallel verwendeten Verben „pisteuein und ginōskein in den beiden Fügungen … einander wechselseitig so interpretieren, daß der Glaube als verstehender und das Erkennen als glaubendes erscheinen“ muss, hatte Wengst unter Bezug auf diese Stelle bei Thyen bereits hingewiesen. Weiter schreibt Thyen:
Wir kennen diese Konstellation von Glauben und Erkennen aus 6,68f. Da hatte Jesus, als alle anderen ihn verlassen hatten, die Zwölf gefragt, ob sie denn auch weggehen wollten, und Petrus hatte ihm die Gegenfrage gestellt: „Herr, wohin sollten wir denn gehen?“ Und dann hatte er als der Sprecher der Zwölf bekannt: „Du hast doch Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, daß du der Heilige Gottes bist“.
Indem Thyen dieses „Glauben und Erkennen“ als das letzte Ziel „der Sendung Jesu“ in den beiden Satzgefügen der Verse 20-21 bzw. 22-23 auf den kosmos bezieht, meint er mit diesem kosmos ausdrücklich „alle künftigen Christen“:
Wie damals das Petrusbekenntnis schon die österliche Gabe des Heiligen Geistes voraussetzte, so setzt nun die Weitergabe der Herrlichkeit, die der Vater Jesus verliehen hatte, an alle künftigen Christen auch deren Begabung mit dem Heiligen Geist voraus. Unter dem Geleit des Geistes sollen sie zur völligen Einheit gelangen (hina ōsin teteleiōmenoi eis hen). Das heißt, daß nicht nur Glauben und Erkennen einander wechselseitig interpretieren, sondern daß ebenso auch die vom Geist gewirkte Gabe des Glaubens und diejenige der Herrlichkeit einander entsprechen (s. o. zu 7,39).
Eine auf diese Weise in eine religiös-dogmatische Begrifflichkeit eingebaute doxa, „Herrlichkeit“, ist natürlich himmelweit entfernt davon, noch auf irgendeine Weise von der Ehre des Gottes Israels her verstanden zu werden, die mit Israels Befreiung statt mit der Einheit der späteren Christenheit in Verbindung gebracht werden könnte. Dementsprechend fragt sich Thyen weiter, wie diese christliche Einheit denn bewirkt werden kann. Bultmann [392ff.] gibt er darin Recht, dass (T699f.)
die Einheit der Gemeinde in der Einheit von Vater und Sohn und in Wort und Glauben ihren Grund hat und nicht „in natürlichen oder weltgeschichtlichen Gegebenheiten“, und daß sie auch „nicht durch Organisation, durch Institutionen oder Dogmen hergestellt werden“ kann, daß sie also eine eschatologische und keine empirische Größe ist… Wenn er dann aber erklärt, solche Gestalten und Institutionen könnten „echte Einheit höchstens bezeugen, sie … aber auch vortäuschen“, so erscheint uns darin die Formulierung „höchstens bezeugen“ doch entschieden zu schwach. Denn nicht zu irgendeinem Selbstzweck, sondern zu solchem Zeugnis vor dem kosmos ist die Gemeinde eigens berufen, darin besteht ihre doxa und an ihrer allen sichtbaren Praxis der Liebe zueinander soll doch jeder erkennen, daß sie Jesu Jünger sind (13,34f). Sind auch Glaube, Liebe und Hoffnung der Christen gewiß noch defizitär, so sind sie dennoch sichtbare sēmeia {Zeichen} und sollen es sein, damit die Welt dadurch zum Glauben finde, wie seine Jünger aufgrund der vielen Zeichen, die Jesus vor ihnen getan hat, geglaubt und erkannt haben, daß er der messianische Gottessohn ist (20,30f).
Nach Thyen (T700) ist, was Johannes Fischer „in kritischer Aufnahme der altkirchlichen Zwei-Naturen-Lehre über die beiden Erkenntnis-Einstellungen dem Christus gegenüber ausgeführt hat“, <1245> daher „auch auf die Christen anwendbar“, nämlich dass
mir im anderen Christen Empirisches und Eschatologisches ungetrennt und unvermischt begegnen. Als mein Gegenüber gehört der Andere durchaus in den Zusammenhang unserer intersubjektiv erschlossenen Welt, zugleich ist er aber transsubjektiv als Träger der doxa Jesu und als Teilhaber an ihr bestimmt, und will als der so Bestimmte wahrgenommen und entsprechend respektiert werden.
Gegen Bultmann [394], dem doch bewusst ist, dass die Gemeinde „sich nach 13,35 in dem allēlous agapan {einander lieben} bezeugen soll“, wendet sich Thyen,
wenn er auf die altprotestantische Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche zurückgreift und die echte Einheit der Gemeinde unsichtbar nennt, da sie als eschatologische „überhaupt kein weltliches Phänomen sei“. Sowenig sich der historische Mann Jesus auf das punctum mathematicum {nur in unendlicher Näherung erreichbarer Punkt} des „Bloßen-Daß-Seines-Gekommenseins“ reduzieren läßt, und so wenig sein Offenbarersein von Verhalten und Geschichte der konkreten Person dieses Juden aus Nazaret abstrahiert werden kann, so wenig kann von Glaube, Liebe und Hoffnung der Christen abgesehen von ihrer empirischen Existenz und Geschichte die Rede sein.
Die „abschließenden Bitten Jesu“ werden in Vers 24 durch die „erneute Vater-Anrede“ und „das dem erōtō {ich bitte} der vorigen Bitten gegenüber stärkere thelō (ich will)“ eingeleitet:
Zu dem fordernden thelō erklärt Bultmann [397], man dürfe es „auch nicht zu einem ,ich möchte‘ abschwächen; der Ausdruck ist sehr kühn: Jesus, der auf Erden nichts von sich hat, sondern nur den Willen des Vaters erfüllt …, stellt hier gleichsam eine Forderung an Gott. Es ist ein Ausdruck der Sicherheit des Glaubens, daß er als der Verherrlichte für die Seinen da ist“.
Worauf aber nun genau die Forderung Jesu zu beziehen ist, worin also konkret die Herrlichkeit besteht, die Jesu Gemeinde sehen soll, das ist offenbar gar nicht so einfach zu bestimmen, wenn man die folgende Auseinandersetzung Thyens mit entsprechenden Aussagen von Bultmann und Wengst betrachtet. Zunächst einmal geht Thyen davon aus, dass
Jesus, der hier wiederum als der bereits Erhöhte spricht, mit dem „wo ich bin“ (hopou eimi egō) nur sein Sein beim Vater meinen kann, und daß darum seine doxa, die die Seinen dort schauen sollen, nur diejenige sein kann, die er aufgrund der Liebe des Vaters schon pro katabolēs kosmou {vor Grundlegung der Welt} bei ihm hatte.
Damit lässt Thyen in meinen Augen aber die Frage in der Schwebe, in welcher Weise „die Seinen“ Jesu bei ihm sein können, wenn er bereits „beim Vater“ ist. Stellt er sich vor, dass sie nach ihrem Tode wie Jesus bei Gott im Himmel sind, oder blicken sie aus ihrem irdischen Leben in glaubender Verbundenheit mit ihm dorthin, wo er in der Einheit mit dem Vater lebt?
Von Bultmann [398] sagt Thyen, dass dieser es „aufgrund von Passagen wie 3,18f; 5,24f; und 11,25f“ für „ausgeschlossen“ hält, die fordernde Bitte Jesu im Sinne der „alten jüdisch-urchristlichen Eschatologie“ zu verstehen. Aber „seinem Entwurf einer rein präsentischen Eschatologie“ vermag er sie auch „nicht einzuordnen“ (T700f.):
Denn „wollte man danach V. 24 interpretieren, so würde man den paradoxen Charakter der Aussagen verkennen, die von der gegenwärtigen Schau der doxa {Herrlichkeit}, von der schon vollzogenen Entweltlichung der Gemeinde reden. Was die Gemeinde ist, das ist sie ja nicht in einer erfüllten gegenwärtigen Zuständlichkeit, sondern im Glauben als der ständigen Überwindung der Gegenwart, des Weltseins, in ständiger Überwindung des Anstoßes, daß die doxa nur an dem sarx genomenos {Fleischgewordenen} zu sehen ist. Aus der Zukunft lebt die Gemeinde, lebt der Glaubende; und der Sinn des Glaubens hängt daran, daß diese Zukunft nicht ein illusionärer Traum, nicht ein futurum aeternum {eine ewige Zukunft} ist. Daß sie sich realisiere, darauf geht die Bitte. … (Ihr) Sinn kann also nur der sein, daß ihre Trennung von ihm eine vorläufige sein soll, daß sie nach ihrer weltlichen Existenz mit ihm vereint sein sollen. Das ,mit ihm sein, wo er ist‘ ist etwas anderes als sein Sein ,in ihnen‘, von dem V. 23 redete; und die Schau der doxa, die V. 24 meint, ist eine andere als die von 1,14. Es ist die von der Hülle der sarx {Fleisch} befreite doxa, in die er selbst eingeht und in die ihm sein ,Diener‘ nach 12,26 folgen soll; er wird ja nach 14,3 wiederkommen und die Seinen zu sich holen. Es ist also die Schau gemeint, von der 1Joh 3,2 sagt: opsometha auton kathōs estin {wir werden ihn sehen, wie er ist}“.
Nachdem sich Thyen (T701) mit der knappen Bemerkung kurz auf Wengst bezieht, er bestreite „[w]egen der mit V. 22 ‚fast identischen Formulierung‘ …, daß in V. 24 von einer anderen doxa die Rede sei“, stellt Thyen im Blick auf Bultmann die Frage, ob dieser
mit seiner nahezu doketistisch {als ob Jesus nur ein Himmelswesen mit einem menschlichen Scheinleib gewesen wäre} erscheinenden Rede von der ,Hülle der sarx‘ hier nicht mit seiner eigenen treffenden Auslegung des kai ho logos sarx egeneto {und das Wort ward Fleisch} von 1,14 in Konflikt und in gefährliche Nähe zu Käsemanns konträrer Interpretation gerät. Kann das wir werden ihn sehen wie er ist von 1Joh 3,2 wirklich heißen, daß da ein fleischloser Logos gesehen würde, einer, dessen ,Fleischwerdung‘ nur eine Episode in der ewigen Geschichte eines logos asarkos {fleischlosen Logos} gewesen wäre? Trägt etwa der, dessen Schau den Jüngern hier verheißen wird, dann seine Wundmale nicht mehr, die allein ihn doch identifizierbar machen …?
Daran anschließend beschäftigt sich Thyen sehr ausführlich mit dem von Bultmann zitierten 1. Johannesbrief, den er insgesamt „als eine Art von intertextuellem Spiel mit dem Evangelium“ ansieht, ja, er fragt sich sogar mit Overbeck, <1246>
ob er womöglich tatsächlich keinerlei „selbständige Bedeutung“ haben sollte, weil er in seiner engen Anlehnung an das Evangelium wohl von vorneherein „nur im Zusammenhang mit diesem etwas bedeuten (sollte), etwa als begleitendes Erläuterungsschreiben“.
Und genau „das Textsegment 1Joh 2,28-3,3, aus dem Bultmann zitiert“, versteht Thyen „als eine Reinterpretation der Schlußpassage unseres Gebets Jesu zum Vater“ und übersetzt es folgendermaßen:
„Und jetzt meine Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, voller Zuversicht sind und bei seiner Parusie nicht beschämt vor ihm zurückweichen müssen. Wenn ihr wißt, daß er gerecht ist, dann erkennt ihr ja auch, daß jeder, der das Gerechte tut, aus ihm geboren ist. Seht doch, welch große Liebe der Vater uns erwiesen hat, daß wir Gottes Kinder heißen dürfen und das auch sind. Deshalb kennt uns der Kosmos nicht, weil er ihn nicht kennt. Geliebte, jetzt (schon) sind wir Gottes Kinder, und es ist noch nicht offenbar; was wir sein werden. Wir sind aber gewiß, daß wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder der von dieser Hoffnung auf ihn erfüllt ist, der heiligt sich selbst, wie auch er heilig ist“.
Die Worte „pas ho echōn tēn elpida tautēn ep‘ autō {jeder der von dieser Hoffnung auf ihn erfüllt ist}“ im letzten Vers dieses Abschnitts (1. Johannes 3,3) bringen Thyen zufolge auf den Begriff, was „Bultmann in der oben zitierten Passage über das Leben der Gemeinde ‚aus der Zukunft‘ sagt, um deren Realisierung Jesus hier bittet“. Von daher gilt auch
für Johannes … darum der Sache nach das paulinische: tē gar elpidi esōthēmen {denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin} (Röm 8,24). Ohne daß Lexeme wie elpizō {hoffen} oder elpis {Hoffnung} im Evangelium vorkämen, ist auch für Johannes die gewisse Hoffnung auf die endliche Realisierung der Eschata {letzten Dinge} notwendiges und konstitutives Moment des Glaubens. ,Gegenwärtig‘ sind die Eschata jetzt nur im Glauben und noch nicht im Schauen, ja sogar nur gegen allen Augenschein, alle Zweifel und alle Anfechtungen.
Keinesfalls darf nach Thyen (T701f.) das Gebet des Abschied nehmenden Jesus für seine ihm „treu gebliebenen Jünger“ und für
alle, die künftig durch ihr Wort an ihn glauben werden, … als ein argumentum e silentio {stillschweigendes Argument} dafür angesehen werden, daß er darüber sein Wort vergessen hätte, er sei nicht zur Verurteilung der Welt, sondern zu ihrer Erlösung erschienen.
Gegen Stimpfle, <1247> der genau das am entschiedensten behauptet und „die vermeintliche ,johanneische Gemeinde‘ als eine Sekte prädestinierter ,lnsider‘ ausmachen will und die Welt der ,Outsider‘ vergeblich auf eine Endzeitlösung hoffen läßt“, betont Thyen, dass
Jesus … nach V. 21 u. 23 seine Jünger eigens dazu erwählt und gesandt [hat], daß der kosmos durch ihr Zeugnis zum Glauben und zur Erkenntnis komme, daß er der eschatologische Gesandte des Vaters ist.
Aus diesem Grund bleibt Thyen mit Moule <1248> „im Blick auf die Passagen, die immer wieder für eine angeblich rein präsentische Eschatologie des Johannes herangezogen werden, der Meinung“, dass
„keine dieser bedeutungsschwangeren Verwendungen die Beibehaltung einer ‚normalen‘ Erwartung einer zukünftigen Vollendung ausschließt. Es handelt sich nicht um eine verwirklichte Eschatologie im Austausch für eine Zukunftsvision, sondern lediglich um eine Äußerung desjenigen Elements des Verwirklichten, das jeder christlichen Eschatologie innewohnt“.
In all diesen Auseinandersetzungen um das angemessene Verständnis der johanneischen Eschatologie scheint auch Thyen stillschweigend vorauszusetzen, dass Johannes sich die letzten Dinge bereits so wie die spätere christliche Kirche vorstellt, also nicht mehr wie die Propheten Israels das diesseitige Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker im Blick hat, sondern entweder diffuse Hoffnungen auf eine in weiter Ferne liegende Wiederkunft Christi, verbunden mit dem so genannten Jüngsten Gericht, oder die Erwartung eines Lebens nach dem Tod in Gottes Himmel für diejenigen, die an Jesus glauben.
Ton Veerkamps <1249> Auslegung von Johannes 17,22-24 setzt dagegen eine jüdisch-messianische Eschatologie voraus, derzufolge die Ehre Gottes und seines Messias Jesus in der Befreiung seines Volkes Israel besteht. Unter den Bedingungen der römischen Weltordnung ist diese Befreiung aber nur möglich, wenn diese selbst verwandelt und letzten Endes in ihrer Eigenschaft als Gewalt- und Unterdrückungsordnung abgeschafft wird. Im Zusammenhang mit Vers 21, in dem Jesus erhofft, dass „die Weltordnung vertraue, dass Du mich gesandt hast“, hatte Veerkamp bereits auf die Schriftstelle Jesaja 66,18 verwiesen, vor deren Hintergrund diese unglaubliche Aussage verständlich wird. Als Voraussetzung dafür, dass das möglich wird, nimmt Jesus in den Versen 22-23 ausdrücklich das Motiv der Ehre des Gottes Israels wieder auf und wiederholt in mehrfach betonter Weise sein Gebet um die Einheit der messianischen Gemeinde, in der sich der auf ihn vertrauende Rest Israels um ihn sammelt:
17,22 Und ich habe die Ehre, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben,
damit sie eins werden, wie wir eins sind.
17,23 Ich mit ihnen und du mit mir,
damit sie endgültig eins werden,
damit die Weltordnung erkennt,
dass du mich gesandt hast und solidarisch mit ihnen gewesen bist,
wie du auch mit mir solidarisch warst.
Eine Verwandlung der herrschenden Weltordnung bis hin zu ihrer Selbstaufgabe hängt für den johanneischen Jesus also Veerkamp zufolge
am Grundsatz: „Ich mit ihnen, Du mit mir, damit sie endgültig zur Einheit gelangt sind.“ Erst dann wird die Weltordnung erkennen, was Sache ist: Gott hat ihn gesandt und war solidarisch mit den Schülern, weil er mit dem Messias solidarisch war. Eine Weltordnung, die das erkennt, ist dann eine ganze andere. Und darum geht es hier, darum ging es Jesaja 66. Ziel der biblischen Politik ist eine andere Weltordnung, eine, die dem Messias vertrauen kann, weil sie dann messianische Konturen hätte. Hätte … Irrealis! Dazu muss die real existierende Weltordnung unterworfen werden. Sie ist bereits unterworfen, das werden wir in diesem Gebet noch hören.
Davon, dass die Weltordnung bereits unterworfen bzw. verworfen ist, handelt Veerkamp zufolge bereits der folgende Vers 24:
17,24 VATER:
Ich will, dass die, die du mir gegeben hast,
mit mir dort sein mögen, wo ich sein werde,
damit sie meine Ehre schauen, die du mir gegeben hast,
weil du mit mir solidarisch warst
vor der Verwerfung der Weltordnung.
Dieser Vers, wie Ton Veerkamp ihn auslegt, hat mir im Johannesevangelium am meisten Kopfzerbrechen bereitet, vor allem die letzte Zeile pro katabolēs kosmou, die Wengst (W461) mit „vor Anfang der Welt“, Thyen (T678) mit „schon vor der Grundlegung der Welt“ und die Lutherbibel 2017 mit „ehe die Welt gegründet war“, übersetzt. Veerkamp jedoch gibt diese Worte mit „vor der Verwerfung der Weltordnung“ wieder und widerspricht damit allen mir bekannten Bibelübersetzungen:
Wir haben in einer Anmerkung in der Übersetzung von 17,24 ausführlich begründet, warum wir hier „Verwerfung der Weltordnung“ und nicht „Grundlegung der Weltordnung“ schreiben. Welt ist immer konkrete Weltordnung, römisch organisierte menschliche Gesellschaft. Und diese Ordnung ist bei Johannes immer verwerflich. Das Verb kataballein („verwerfen“), das hinter katabolē steht, hat in der griechischen Fassung der Schrift ausschließlich negative Bedeutung. Johannes wählt das Wort, weil es zur Negativität der Weltordnung passt.
Die Anmerkung, auf die sich Veerkamp hier bezieht, begann in seiner Übersetzung des Johannesevangeliums aus dem Jahr 2005 mit dem Hinweis, dass in den biblischen Schriften „nicht die ‚Welt(ordnung)‘ Schöpfungswerk, ‚Gründung‘ Gottes“ ist, „sondern die Erde“. Alle weiteren damals angesprochenen Gesichtspunkte greift er in seiner Anm. 497 zur Übersetzung von Johannes 17,24 aus dem Jahr 2015 wieder auf und stellt sie in einer Liste von vier Punkten zusammen. Zu fragen ist nun, ob und inwiefern seine Argumentation stichhaltig ist. Dabei beginne ich mit seinem Punkt 2, der Analyse des Verbs kataballein, auf das das Substantiv katabolē zurückzuführen ist:
2. Das zugrunde liegende Verbum kataballein kommt in der LXX 44mal vor; alle Stellen haben einen Hintergrund von Gewalt. Die mit kataballein übersetzten neun hebräischen Verben sind bis auf laqach (einmal) Verben der Gewaltanwendung {Grundbedeutung von laqach: nehmen}. Und sogar laqach kann „töten“ bedeuten, nämlich „die Seele nehmen“ (Ezechiel 33,4). Deswegen ist zu fragen, ob man die 11 katabolē-Stellen in den messianischen Schriften nicht alle so übersetzen müsste, dass die finstere Färbung von katabolē deutlich wird.
Hinzu kommt nach Veerkamp, dass auch die beiden kataballein-Stellen in den messianischen Schriften, unserem „Neuen Testament“, in negativem Sinn zu übersetzen sind:
3. Orientiert an 2 Korinther 4,9 und Hebräer 6,1f., wo kataballein „unterwerfen“ bzw. „verwerfen“ bedeutet, kann man bei katabolē mit der Bedeutung „Unterwerfung, Verwerfung“ arbeiten.
Im Blick auf Hebräer 6,1-2 meldet sich bei mir allerdings Skepsis, wenn Veerkamp auch dort kataballomenoi, bezogen auf das Wort themelion, „Grundlegung, Fundament“, mit „verwerfen“ wiedergeben will. Nach gängigem Verständnis soll es ja umgekehrt darum gehen, über die Grundlagen der Lehre hinaus zur fortgeschrittenen Lehre zu gelangen und in diesem Zusammenhang nicht zum wiederholten Male den „Grund zu legen“. Unmöglich scheint aber auch Veerkamps Deutung nicht zu sein, über der fortgeschrittenen Lehre deren „Grundlegung“ nicht zu „verwerfen“.
Noch skeptischer betrachte ich Veerkamps Blick auf das Substantiv katabolē in der gesamten Bibel:
1. Katabolē kommt in den messianischen Schriften 11mal vor. Davon entfallen sechs bis sieben Belege (je nachdem, ob man Matthäus 13,35 mitzählt oder nicht) auf die Wendung apo katabolēs kosmou; dreimal finden wir hier pro katabolēs kosmou (nämlich außer in Johannes 17,24 noch in Epheser 1,4 und in 1 Petrus 1,20). In Hebräer 11,11 hat katabolē die spezielle Bedeutung des „Abgangs des Samens [Abrahams in Sara].“ In der LXX begegnet katabolē einzig in 2 Makkabäer 2,29 (ohne Präposition). Dort bedeutet es „Untergang“.
Hier finde ich kein überzeugendes Argument für Veerkamps Übersetzungsvorschlag. Die Makkabäerstelle muss Veerkamp missverstanden haben, denn wenn katabolē dort wirklich „Untergang“ bedeuten würde, wäre es die einzige Aufgabe des Architekten, der ein neues Haus baut, sich um den Abriss des alten Hauses zu kümmern, statt um die „Grundlegung“ oder den gesamten „Aufbau“ des neuen. Vielleicht wirft diese Stelle sogar Licht auf den Ursprung der Bedeutung von „Grundlegung“ für das Wort katabolē, denn um den Grund für ein neues Haus zu legen, muss zuvor ein altes Gebäude abgerissen werden oder es müssen Bäume gefällt, felsiger Boden geebnet werden.
Wenn die Bedeutung von „Grundlegung“ für katabolē aber erst einmal im Schwange war, kann sie auch im übertragenen Sinne für die Grundlegung der Welt im Sinne ihrer Schöpfung verwendet worden sein. Und genau das scheint an allen zehn neutestamentlichen Stellen, einschließlich Johannes 17,24, der Fall zu sein, wo katabolē in Verbindung mit pro oder apo verwendet wird. In meinen Augen ist es kaum möglich, an all diesen Stellen die Bedeutung „Verwerfung der Weltordnung“ nachzuweisen.
Ebenso liegt in Hebräer 11,11 „Grundlegung des Samens“ im Sinne der Hervorbringung von Nachkommenschaft als Übersetzung für katabolē spermatos näher als die von Veerkamp behauptete Bedeutung „Abgang des Samens“, zumal von Abraham gar nicht die Rede ist, sondern von der entsprechenden dynamis, also Kraft oder Befähigung, die Sara empfing.
Dennoch bleibt ein weiteres Argument für Veerkamps Deutung von katabolē kosmou als der „Unterwerfung der Weltordnung“ übrig, das ich zumindest im Blick auf seine Verwendung im Johannesevangelium für überzeugend halte, nämlich einen von ihm wahrgenommenen engen Zusammenhang zwischen den beiden biblischen Stellen Jeremia 4,23 und 1. Mose 1,2. Dass dem Schöpfungshandeln des Gottes Israels ein thohu wabohu vorausgeht, ist Veerkamp zufolge von der Jeremia-Stelle her so zu verstehen, dass bereits die Schöpfung von Himmel und Erde als grundlegende Unterwerfung der in der Welt herrschenden Todesmächte zu begreifen ist:
4. Apo katabolēs kosmou bedeutet dann: „seit der Unterwerfung des tohu-wa-bohu, der Weltordnung von Krieg und Untergang“; vgl. Jeremia 4,23ff. Pro tēs katabolēs kosmou hat eine ähnliche Tendenz. Für Johannes 17,24 ergibt sich somit der Sinn: Schon bevor die menschliche Ordnung – kosmos – verworfen war, ist Gott solidarisch mit dem bar enosch, mit dem MENSCHEN, vgl. Genesis 6-9!
Wie das zu begreifen ist, das erläutert Veerkamp in seiner Auslegung von 17,24 im Jahr 2007. Dazu erinnert er an den Vers 17,5, in dem schon einmal von der Ehre des Messias pro tou ton kosmon einai {wörtlich: vor dem ins-Sein-Kommen der Welt} die Rede war:
Bevor die Verhältnisse unter den Menschen so geordnet sind, dass sie unter ihnen leiden müssen, „bevor die Weltordnung ins Dasein kam“, 17,5, hatte der Messias die „Ehre bei Gott“ (17,5). Hier ist wieder von der „Ehre des Messias“ die Rede. Die Ehre hatte er, bevor es diese Ordnung gab, er wird sie haben, nachdem das Urteil über die Weltordnung, ihre katabolē, ihre Verwerfung, in Kraft getreten sein wird, und er hat die Ehre jetzt, wo das Urteil zwar gesprochen (kekritai, 16,11), aber nicht vollstreckt ist.
Die Frage „Warum?“, die Veerkamp im Anschluss an diese Ausführungen stellt, ist sehr berechtigt, weil diese Argumentation sehr kryptisch daherkommt. Sie ist nur verständlich, wenn wir nicht vergessen, dass der Messias Jesus nach Johannes den befreienden NAMEN des Gottes Israels nur insofern verkörpern kann, als er zugleich das Volk Israel selbst verkörpert. Die Antwort auf das „Warum?“ lautet also:
Weil der Gott Israels mit seinem Messias, seinem bar enosch, der „das Volk der Heiligen des Höchsten“ repräsentiert (Daniel 7,27), also mit Israel, solidarisch ist und das schon „vor der Verwerfung der Weltordnung“. Der Messias, also Israel, ist unter den herrschenden Bedingungen der Weltordnung nicht ehrlos und würdelos. Vielmehr ist die Stunde gekommen, wo der Messias, und mit ihm Israel, geehrt sein wird. Mit der Verwerfung der Weltordnung ist Israel, und mit ihm die ganze Menschheit, nicht verworfen, sondern wird geehrt sein. Es schließt sich der Kreis, der mit 17,5 geöffnet wurde.
An dieser Stelle bringt Veerkamp die Sintflutgeschichte ins Spiel, und zwar als das Urbild eines Gerichtshandelns Gottes, das mit der Absicht spielte, auf Grund der Verwerflichkeit der Weltordnung die gesamte Menschenwelt zu vernichten:
Gott handelt nicht, wie er dereinst gehandelt hat, Genesis 6,5ff.:
Der NAME sah,
dass sich die Bosheit der Menschheit mehrte auf der Erde,
dass alles Gebilde der Planungen ihres Herzens
nur noch böse war, alle Tage,
es war dem NAMEN leid,
dass er die Menschheit gemacht hatte auf der Erde,
es bekümmerte ihn in seinem Herzen.
Der NAME sprach:
Wegwischen werde ich die Menschheit, die ich schuf,
vom Antlitz des Erdbodens …Da die Hoffnung der Menschheit darauf beruht, dass die Zukunft nicht die Vernichtung ist, sondern dass durch den Messias alle auseinandergetriebenen Gottgeborenen der Solidarität Gottes teilhaftig werden, ist dieser Satz 17,24 der Hauptsatz der Lehre von der Befreiung (Soteriologie). Die Solidarität mit den Menschen gilt trotz der herrschenden Weltordnung, die Unterwerfung der Weltordnung ist nicht die Vernichtung der Welt, gemäß dem Schwur Gottes in 8,21b:
Nie mehr werde ich den Erdboden verfluchen um der Menschheit willen,
weil das Herz der Menschheit ein Abbild des Bösen war von Jugend auf,
nie mehr werde ich weiter alles Leben schlagen, das ich gemacht hatte.
Alles in allem geht es mir mit Ton Veerkamps Auslegung von Johannes 17,24 so ähnlich wie mit seiner Auslegung von Johannes 1,10. Schon dort war es um die Frage gegangen, ob der kosmos als Gottes Schöpfung angesehen werden kann, und ich war zu dem Schluss gekommen, dass Johannes zufolge die Lebenswelt der Menschen durchaus durch Gottes „Wort“ ins Dasein kommt, als ihre sehr gute Schöpfung (1. Mose 1,31) von Anfang an fortwährend der Finsternis und dem thohu wabohu abgerungen werden muss (1. Mose 1,2). Im Hintergrund stand schon dort die Einsicht, die auch Veerkamp nicht fremd ist, dass Johannes das Wort kosmos zwar weitgehend auf die römischen Weltordnung in ihrer Verwerflichkeit bezieht, aber eben nicht durchgehend. Er kann mit kosmos auch die Menschenwelt meinen, die von der Weltordnung, die auf ihr lastet, befreit werden muss. Daher kann ich mir vorstellen, dass Johannes in 17,24 für die Wendung pro katabolē kosmou zwar die Bedeutung „vor Grundlegung der (Menschen-)Welt“ voraussetzt, aber zugleich anklingen lässt, dass für die Grundlegung einer wahrhaft guten Schöpfung Gottes die Gewaltstrukturen der Weltordnung sozusagen „zu Grunde gerichtet“ sein müsssen.
Nach diesen langwierigen Erörterungen der Frage, wie von der katabolē als der die Weltordnung des thohu wabohu niederwerfenden Grundlegung des kosmos als einer befreiten Menschenwelt zu reden wäre, komme ich zurück auf den Anfangsteil von Johannes 17,24, in dem Jesus sehr betont seinen festen Willen für diejenigen ausspricht, die ihm von seinem VATER anvertraut wurden:
Ich will, dass die, die du mir gegeben hast,
mit mir dort sein mögen, wo ich sein werde,
damit sie meine Ehre schauen, die du mir gegeben hast…
Hier begreift Veerkamp die Bitte des Messias, „dass die Schüler dort sein mögen, wo der Messias sein wird“, anders als Thyen (T700) nicht von seinem „Sein beim Vater“ her, sondern eher in der Richtung von Wengst (W477), der die „Nachfolge“ als den „Ort bleibender Verbundenheit mit Jesus“ bestimmt. Für Veerkamp ist dieser Ort die konkret verwirklichte Einheit eines in der messianischen Gemeinde versammelten Rest-Volkes Israel, das die Einsicht und den Mut aufbringt, den Messias Jesus endlich „in Betracht“ zu ziehen: <1250>
Das Ziel ist (hina), dass sie „betrachten“ können, dass der Messias geehrt wird. Die Ehre des Messias ist die Einheit der messianischen Gemeinde als Urbild der kommenden Einheit Israels. Anders gesagt, sie mögen eine Situation erleben, wo der Messias und seine messianische Ordnung Maß aller Dinge sein wird. Hier hören wir wieder das Verb theōrein. Was sie jetzt nicht in Betracht ziehen können, 16,10; 16,16ff., das soll möglich und wirklich werden. Für die herrschende Weltordnung kommt Messias nicht „in Betracht“, in ihr ist das einzig Messianische die Solidarität der Schüler untereinander.
Auf diese Weise begreift Veerkamp die messianische Gemeinde als eine solidarische Kampfgemeinschaft, die der verwerflichen und spätestens durch den Tod des Messias am römischen Kreuz endgültig verworfenen herrschenden Gewaltordnung entgegensteht und das Ziel verfolgt, sie durch ihre Praxis der agapē von innen und unten zu überwinden.
↑ Johannes 17,25-26: Den VATER im NAMEN erkennen und aus seiner Solidarität leben
17,25 Gerechter Vater,
die Welt kennt dich nicht;
ich aber kenne dich,
und diese haben erkannt,
dass du mich gesandt hast.
17,26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan
und werde ihn kundtun,
damit die Liebe,
mit der du mich liebst,
in ihnen sei
und ich in ihnen.
[23. Dezember 2022] Zum Abschluss des Gebets Jesu (W478) stellt Klaus Wengst fest, dass Jesus hier „keine Bitte mehr“ ausspricht:
Nach einem kurzen Seitenblick auf die Welt blickt er wieder auf seine Schülerschaft und stellt noch einmal fest, was er für sie getan hat – und weiter tun wird – und beschließt das Gebet mit einer letzten Zielangabe. Auch sie betrifft nicht den „Himmel“, sondern das auf der Erde zu bewährende Leben der Gemeinde.
Die erneute Anrede Gottes in Vers 25 als „Vater“, die hier durch das Wort dikaie ergänzt wird, gibt er mit „gerechter Vater“ wieder. Damit wird er, wie Tholuck <1251> meint, als der angesprochen, der „jedem sein Recht gibt“.
Die folgende knappe Feststellung, dass die Welt Gott nicht erkannt habe, lässt sich im Zusammenhang so verstehen, dass noch nicht eingetreten ist, worauf Jesus in V. 21 und 23 jeweils als Ziel ausgeblickt hat: Gottes Handeln in Jesus möge wahrgenommen werden. Der Evangelist Johannes erfährt jedoch in seiner Zeit leidvoll das Gegenteil in Form von scharfer Ablehnung und Ausgrenzung. Diese Erfahrung lässt ihn seinerseits immer wieder schroff abgrenzend und auch ausschließend formulieren. Der Feststellung, die Welt habe Gott nicht erkannt, stellt er nicht einfach die Gotteserkenntnis der Schüler Jesu gegenüber. Vielmehr heißt es: „Ich aber habe Dich erkannt und diese haben erkannt, dass Du mich gesandt hast.“ Damit macht er deutlich, dass ihre Gotteserkenntnis eine durch Jesus vermittelte ist.
Der letztgenannte Gedanke wird in Vers 26 „nochmals betont“, indem der Rückblick von Vers 6 mit etwas anderen Worten wiederholt wird (W478f.):
„Und ich habe ihnen Deinen Namen kundgetan.“ Auf dem Weg Jesu, wie er im Evangelium geschildert ist, wird Gott immer wieder als der erkennbar, der – rettend und helfend – sein „Hier bin ich“ spricht. So hat Jesus den Namen Gottes und also Gott selbst kundgetan. Auf diese Kundgaben hat sich seine Schülerschaft eingelassen. Darauf kann sie sich weiter einlassen, weil es sie weiter geben wird: „Und ich werde ihn kundtun.“ Gottes rettende und helfende Gegenwart zeigt sich auf dem im Evangelium dargestellten Weg Jesu – und sie wird sich einstellen in der Erinnerung dieses Weges im Leben der Gemeinde.
Zur letzten Zielangabe des Gebets: „auf dass die Liebe, mit der Du mich geliebt hast, bei ihnen sei und ich bei ihnen“, zitiert Wengst (Anm. 229) einen Satz von Marie- Therese Sprecher: <1252>
„Signifikant ist, dass das Gebet nicht mit einem Aufruf zur Einheit endet, sondern die Liebe als Konsequenz aus und als Befähigung zu dieser Einheit in den Vordergrund und als stets anzustrebendes Ziel hinstellt“.
Damit stellt Johannes heraus (W479), dass
Jesus – und mit ihm die ihm erwiesene Liebe Gottes – … so unter seiner Schülerschaft [ist], … so in ihr zum Zuge [kommt], dass sie sein Vermächtnis, einander zu lieben, erfüllt. So schließt sich der Kreis zum Beginn der Abschiedsreden, an dem Jesus sein Vermächtnis formuliert hat.
In diesem Zusammenhang hebt Wengst hervor, dass mit „der Formulierung ‚die Liebe, mit der Du mich geliebt hast‘ … wiederum eine Aussage auf Jesus konzentriert“ ist, „die in der jüdischen Tradition <1253> von Israel im Ganzen gemacht wird“:
„Abba pflegte in den Sabbatnächten ein kurzes Gebet zu beten: ,Und aus Deiner Liebe, Ewiger, unser Gott, mit der Du Dein Volk Israel geliebt hast, und aus Deinem Mitleid, unser König, mit dem Du Mitleid gehabt hast mit den Kindern Deines Bundes, hast Du uns, Ewiger, unser Gott, den siebten Tag in Liebe gegeben, diesen großen und heiligen Tag.“
Anders als Wengst spricht Hartwig Thyen (T702) von den Versen 25-26 als von der „abschließenden Bitte“ Jesu, in der „Jesus Gott als pater dikaie {gerechter Vater}“ anredet. Und sehr viel ausführlicher als Wengst beschäftigt er sich mit dem Wortfeld dikaios und dikaiosynē {gerecht und Gerechtigkeit}, das im johanneischen Schrifttum „auffällig selten“ vertreten ist:
Das Nomen findet sich im Evangelium nur zweimal (s.o. zu 16,8 u. 10), sowie in der Wendung vom poiein tēn dikaiosynēn {Tun der Gerechtigkeit} in 1Joh 2,29; 3,7 u. 10. Das Adjektiv dikaios erscheint außer in unserer Gebetsanrede nur noch in 5,30, wo Jesus sein Richten als gerechtes bezeichnet (hē krisis hē emē dikaia estin {mein Gericht ist gerecht}) und in ähnlichem Sinn in 7,24. Der erste Johannesbrief gebraucht dikaios sechsmal: (1) in 1,9 heißt es, daß Jesus treu und gerecht sei, daß er unsere Sünden vergibt (pistos estin kai dikaios, hina aphē hēmin tas hamartias); (2) 2,1 versichert: „Wir haben einen Parakleten beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten“ (Iēsoun Christon dikaion); (3) 2,29 lautet: „Wenn ihr begreift, daß er gerecht ist, dann werdet ihr auch erkennen, daß jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist“; (4 u. 5) in 3,7 erscheint, wiederum mit dem Tun der dikaiosynē verknüpft, das Adjektiv gleich zweimal: ho poiōn tēn dikaiosynēn dikaios estin, kathōs ekeinos dikaios estin {Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist}; (6) endlich sagt 3,12 über die Werke Kains, der ek tou ponērou {von dem Bösen} war und seinen Bruder abschlachtete (esphaxen), daß er das tat, weil seine Werke böse waren, diejenigen seines Bruders aber gerecht (ta de tou adelphou dikaia).
Indem der Vers 25 das Verb ginōskein {erkennen} aus Vers 3 wieder aufnimmt, in dem „Jesus das ewige Leben und damit das Ziel seiner Sendung förmlich“ durch die Erkenntnis des Vaters und seines Gesandten „Jesus Christus“ definiert hatte, wird hier ein dort aufgespannter Bogen geschlossen:
,Gerechter Vater, auch wenn die Welt dich nicht kennt (se ouk egnō), so kenne ich dich doch (egō de se egnōn), und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast (kai houtoi egnōsan ktl.)‘.
In Vers 26 benennt Jesus mit dem Wort „gnōrizein (zu erkennen geben), das dem ginōskein korrespondiert, … sodann sein vergangenes ebenso wie sein künftiges Offenbarungswirken als den Grund solcher ,Erkenntnis‘ (T702f.):
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō, hina hē agapē ēn agapēsas me en autois ē kagō en autois {Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn ihnen auch weiterhin kundtun, damit die Liebe, mir der du mich geliebt hast, in ihnen sei, wie ich in ihnen bin} … Daß es sich bei dem Erkennen des einzig wahren Gottes nicht um die theoretische Einsicht in die Wahrheit des israelitischen Monotheismus handelt, sondern um die praktische Anerkennung dessen, der in der Vergangenheit seines Volkes ebenso wie in der Gegenwart durch den Mund und das Werk seines Gesandten immer wieder sein egō eimi {ICH BIN} gesagt und die Seinen damit seiner verläßlichen Gegenwart versichert hat und versichert, und daß Jesus – außer für uns Christen aus den Heidenvölkern – nicht der Zeuge eines bis dato unbekannten Gottes ist, sondern daß es in der Schrift, die doch nicht außer Kraft gesetzt werden darf (10,35), ebenso wie in unserem Evangelium der in Israel bekannte Gott ist, der für seinen unbekannten Sohn zeugt, haben wir schon des öfteren begründet (s. z.B. o. zu 14,6).
Den hina-Satz: „Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen“, der das Gebet Jesu abschließt, betrachtet Thyen zusammen mit Johannes 13,1-2 als „eine große Inklusion um die gesamten Abschiedsszenen“. In diesem Zusammenhang meint Thyen, die Worte en autois {in ihnen} von „Jesu neuem Gebot her, einander zu lieben (13,34f), … sicher in dem Doppelsinn von in und unter ihnen verstehen“ zu dürfen. Mit einem Zitat von Zahn <1254> beschließt Thyen seine Auslegung:
„Der kühne Gedanke, daß die Liebe Gottes, deren nächster Gegenstand Jesus gewesen ist und von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, in den Jüngern sei, hat zur Voraussetzung, daß die Liebe Gottes zu Jesus von vornherein auf die durch Jesus zu rettende Menschheit gerichtet war (Joh 3,16; 1Joh 4,91), daß dieselbe aber auch von den Gläubigen erfahren und empfunden wird (1Joh 3,1; 4,16c ff. Rm 5,5)“.
Ton Veerkamp <1255> erklärt in seiner Anm. 498 zur Übersetzung von Johannes 17,25 die Übersetzung von pater dikaie in Vers 25 mit „Vater, Wahrhaftiger“ vom hebräischen Wort zadiq, „bewährt“ her: „Der Gott Israels bewährt sich, deswegen ist er ein Bewährter oder Wahrhaftiger.“ Es ist dieser wahrhaftige Gott, den Jesus in den abschließenden Versen 25 und 26 seines Gebets nochmals in seinem absoluten Gegensatz zur herrschenden Weltordnung anspricht. Hier erhält das, was Veerkamp als den „Hauptsatz der Lehre von der Befreiung (Soteriologie)“ bezeichnet hatte, nämlich dass nach Vers 24 „durch den Messias alle auseinandergetriebenen Gottgeborenen der Solidarität Gottes teilhaftig werden“, noch eine Fortsetzung:
Die Weltordnung, so geht der Satz weiter, habe den VATER nicht erkannt, der Messias habe ihn erkannt, deswegen war der Gott Israels solidarisch mit dem Messias, nicht mit der herrschenden Weltordnung. Eine andere Deutung ist in diesem Zusammenhang kaum möglich. Das Erkennen Gottes beruht auf der Einsicht, dass der Messias Gesandter dieses Gottes ist. Der NAME ist das, was dieser Gott an Israel tut, diesen NAMEN hat der Messias bekanntgemacht. Der NAME heißt jetzt, so Johannes, dass Gott solidarisch mit dem Messias ist und der Messias mit diesen Menschen. Nur mit diesem Satz im Ohr kann man das, was Johannes in den nächsten beiden Kapiteln zu erzählen hat, ertragen.
↑ Es war aber Nacht: Verhaftung und Verhör des Messias (Johannes 18,1-28a)
[27. Dezember 2022] Gewöhnlich betrachtet man im Johannesevangelium die Erzählungen von der Gefangennahme Jesu und der Verleugnung des Petrus am Anfang von Kapitel 18 als den Beginn der Passionsgeschichte Jesu. Abweichend davon gehören nach Ton Veerkamp, <1256> der sich in seiner Gliederung der Kapitel 13 bis 20 strikt an den johanneischen Zeitangaben orientiert, wie in der Einleitung des Abschnitts Vor dem Pascha: Jesu Fußwaschung und der Verrat des Judas (Johannes 13,1-30a) zu lesen war, die Verse 18,1-28a noch zum großen Abschnitt „Es war aber Nacht“:
Wir hörten in 13,30: „Es war aber Nacht geworden“, Nacht des Messias. Diese Nacht hält so lange an, bis Jesus wirklich in die Hände der Römer ausgeliefert werden wird: „Es war aber früh am Morgen geworden“, 18,28b. Mit dem Gang in den Garten beginnt eine neue und entscheidende Phase der Nacht des Messias. Jesus ist nicht länger im Kreis der Schüler, sondern beginnt die Konfrontation mit der Weltordnung, öffentlich, und zwar zunächst mit den Kollaborateuren des Feindes, den führenden Priestern. Dieser letzte Abschnitt der Nacht des Messias, „Verhaftung und Verhör“, hat zwei Teile: 18,1-14 die Verhaftung und 18,15-28a das Verhör. Die eigentliche Passionserzählung beginnt erst in 18,28b. Es empfiehlt sich, den Abschnitt „Verhaftung und Verhör“ von der eigentlichen Passionserzählung zu trennen, wie Johannes das mit seinen Zeitangaben tut.
Aber was macht die Passionserzählung ab 18,28b zu einer „eigentlichen“ im Sinne des Johannes, wie ihn Veerkamp begreift?
Johannes verwendet traditionellen Stoff, aber er passt ihn an seine politischen Absichten an. Zwar liefert die Führung Judäas Jesus an die Römer aus, aber der Messias stirbt im Kampf mit Rom, nicht im Kampf mit den Judäern. Außer den Frauen und dem Freund unter dem Kreuz des Messias sind keine Kinder Israels mehr da. Jesus ist allein mit der römischen Soldateska. Das ist ein bedeutender politischer Unterschied zur Darstellung der Synoptiker. Auch in der nun folgenden Szene der Verhaftung und des Verhörs findet keine Auseinandersetzung mit den Judäern mehr statt. Jesus hat ihnen, so werden wir hören, alles gesagt, was zu sagen war. Jetzt geht es um den kosmos, um die Weltordnung als solche.
Dieser kosmos ist daher nicht im Blick als das Missionsfeld einer Völkerwelt, die für die Lehre Jesu gewonnen werden soll wie etwa bei Paulus, Lukas oder Matthäus, sondern als die römische Weltordnung, die durch Jesu Tod am römischen Kreuz überwunden wird, obwohl von diesem Sieg zunächst noch nichts zu sehen ist. Dennoch zielt das gesamte Johannesevangelium auf genau diese Überwindung hin und ist daher ganz und gar vom jüdischen Fest der Befreiung her zu verstehen, dem Passafest oder Pascha. Daher weist Veerkamp, bevor er mit der Auslegung des Kapitels 18 beginnt, nochmals darauf hin, dass alles, was „jetzt erzählt wird, … ganz und gar von der unmittelbaren Nähe des Pascha bestimmt“ ist:
Überhaupt ist Pascha immer „nahe“. Das Wort wird zehnmal verwendet, dreimal in Verbindung mit dem Wort nahe, dreimal mit Bestimmungen wie „vor“, „sechs Tage vor“, einmal als „Vorbereitung“ (paraskeuē). Zweimal war das Paschafest Anlass: 2,23 und 18,39. Einmal bedeutet Pascha das Paschalamm 18,28.
Dass dennoch nirgends im Johannesevangelium von einer Feier des Passafestes die Rede ist, hat nach Veerkamp einen ganz bestimmten Grund:
Weder Jesus noch die Schüler feiern in der Erzählung von Johannes das große Befreiungsfest. Pascha ist hier reine Zukunft. Befreiung kann erst gefeiert werden, wenn ganz Israel vom Messias in eine Synagoge zusammengeführt sein wird. „Ostern“ ist keine Vollendung, sondern, wie wir hören, Anfang, Anfang der Sendung der Schüler. Würden die Christen nach Johannes gehen, würden sie wohl etwas bescheidener sein müssen und ihr Ostern nicht als Paschasuperlativ auffassen.
Anders als Veerkamp sieht Klaus Wengst (W479) die Erzählung „von der Festnahme Jesu und seinen Vernehmungen über seine Verurteilung und Hinrichtung bis zu seinem Tod und seiner Beisetzung“ in den Kapiteln 18 und 19 als „einen in sich geschlossenen Zusammenhang“, dessen Inhalt „die Passion Jesu“ ist, die sich an einem einzigen Tag vollzieht, am „Rüsttag vor Pessach, zugleich Rüsttag vor einem Sabbat“:
Das hier berichtete Geschehen wurde im Evangelium schon lange und immer wieder vorbereitet. Johannes blickte häufig auf die Passion Jesu voraus. Er machte sie von Kap. 13 an zum alleinigen Thema und bot dabei seiner Leser- und Hörerschaft Hilfen, dieses Geschehen zu verstehen. Nun kann er es erzählen. Die vorher gebrachten Deutekategorien, dass Jesus „verherrlicht“ oder „erhöht“ wird, dass er „zum Vater geht“, bringt er jetzt nicht mehr, setzt sie aber so in Erzählung um, dass der leidende Jesus als dennoch Handelnder erscheint.
Trotzdem gesteht auch Wengst den innerhalb dieser Kapitel vorliegenden Zeitangaben eine gewisse Gliederungsfunktion zu, wobei er zu der Nacht, in der der erste Abschnitt beginnt, sogleich erwähnt, dass in sie (W479f.)
auch der vorige große Zusammenhang, das Zusammensein Jesu mit seinen Schülern anlässlich eines Mahles, hineinragt. Der Neueinsatz ist dadurch gekennzeichnet, dass Jesus mit seinen Schülern den Raum des Mahles verlässt und in einen Garten jenseits des Kidron geht (18,1). Der Hahnenschrei in 18,27 kündigt den Morgen an. Die Morgenzeit wird in 18,28 ausdrücklich angegeben, in 19,14 die Stunde der Mittagszeit vermerkt. Schließlich lässt 19,42 erkennen, dass der Tag zur Neige geht. Von diesen Zeitangaben her ergibt sich eine Gliederung des gesamten Zusammenhangs in drei Teile. Der erste Teil, noch in der Nacht, schildert die Festnahme Jesu und seine Überführung zu Hannas (18,1-14), die Vernehmung durch diesen (18,19-24) sowie – in zwei Abschnitten, die die Vernehmung umrahmen – die Verleugnung durch Simon Petrus (18,15-18.25-27). Der zweite Teil, vom frühen Morgen bis Mittag, spielt im ständigen Wechsel in und vor dem Prätorium. Pilatus, der Richter, muss zwischen dem Angeklagten im Prätorium und seinen Anklägern davor hin und her gehen (18,28-19,16a). Dieser Teil endet mit der Verurteilung Jesu zum Tod am Kreuz. Der dritte Teil, am Nachmittag, erzählt die Hinrichtung sowie die Ereignisse vor und nach Eintritt des Todes Jesu bis zu seiner Beisetzung (19,16b-42).
Ganz stimmt diese Gliederung aber nicht mit dem Erzählverlauf bei Johannes überein, denn die Erwähnung der sechsten Stunde des Rüsttages für das Passafest in 19,14 erfolgt bereits vor der „Verurteilung Jesu zum Tod am Kreuz“, was möglicherweise Auswirkungen auf die Deutung haben wird.
Dass Johannes in seiner Passionsgeschichte (W480) auf „Traditionen“ zurückgegriffen und sie „zu einer neuen Einheit gestaltet hat“, zeigt sich nach Wengst „schon an der großen Übereinstimmung mit den anderen Evangelien hinsichtlich des Stoffes.“ Er beteiligt sich aber nicht an den Versuchen,
einen vorjohanneischen Passionsbericht zu rekonstruieren und dessen Verhältnis zu einem möglichen vormarkinischen Passionsbericht und zu den Passionsberichten der synoptischen Evangelien zu bestimmen. … Als Ergebnis solcher Fragestellungen sind sehr unterschiedliche Hypothesen möglich. Darüber wird man nicht hinaus kommen. Der Ertrag für die Auslegung des johanneischen Textes scheint mir eher gering zu sein. Aber auch die Sicherheit anderer, wonach Johannes die drei synoptischen Evangelien benutzt habe, vermag ich nicht zu teilen. Das würde eine sehr eigenartige Benutzungsweise voraussetzen. Auch hier empfiehlt sich ein pragmatisches Vorgehen, das am jeweiligen Ort die Parallelen in den Blick nimmt und dabei das besondere Profil der johanneischen Darstellung zu erkennen versucht.
Auch Hartwig Thyen (T706) fasst die beiden Johannes-Kapitel 18 und 19 als die „Passionserzählung im engeren Sinn“ zusammen und bezeichnet sie in seiner Dramaturgie des Johannesevangeliums als dessen sechsten Akt. Genau wie bei den anschließenden „Ostererzählungen“ der Kapitel 20 und 21 handelt es sich um „kohärente Kompositionen aus der Feder des Evangelisten, die eng und vielfältig mit dem gesamten ihnen vorausgehenden Evangelium verknüpft sind.“ Damit wendet sich Thyen „auch für diese beiden letzten Akte“ gegen jeden Versuch, „besondere Quellen … zu rekonstruieren“, auf die sie vermeintlich zurückgehen sollen.
Erst recht sind die johanneischen Passions- und Ostererzählungen kein bloßes Rudiment der Tradition und nicht nur notwendiges Ausstattungsstück eines ,Evangeliums‘, das ansonsten nur von der Herrlichkeit Jesu wüßte und von einem naiven Doketismus {als ob Jesus als Himmelswesen nur vorübergehend einen Scheinleib besessen hätte} beherrscht wäre, wie Käsemann meint. Nein, von den Prologsätzen an, daß das Licht in der Finsternis scheint, die es aber trotz aller Anstrengungen nicht auszulöschen vermochte (1,5), und seit der den Tod Jesu einschließenden Aussage: „Das Wort ward Fleisch“ (1,14), ist unser Evangelium nicht mehr wie das des Markus eine ,Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung‘ (M. Kähler), sondern von Anfang an ein Passionsevangelium und allein als solches Zeugnis der Herrlichkeit Jesu.
Wie bisher bleibt Thyen also dabei, die Übereinstimmungen mit den „drei synoptischen Evangelien in ihrer überlieferten Gestalt“ auch in der Passionserzählung einfach darauf zurückzuführen, dass genau diese seine Prätexte waren, mit denen er intertextuell gespielt hat.
↑ Johannes 18,1-2: Jesus mit seinen Schülern im Garten jenseits des Baches Kidron, den auch Judas kennt
18,1 Als Jesus das geredet hatte,
ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron;
da war ein Garten, in den gingen er und seine Jünger.
18,2 Judas aber, der ihn verriet,
kannte den Ort auch,
denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern.
[28. Dezember 2022] Klaus Wengst zufolge (W482) erzählt nach „den vergeblichen Versuchen in Kap. 7 und 8, Jesus festzunehmen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war (7,30; 8,20)“, der Abschnitt 18,1-14 nun aber doch, „weil nun ‚die Stunde‘ da ist, die tatsächlich gelingende Festnahme.“ Dazu betont Wengst (Anm. 234), dass die Verse 12 bis 14 auf jeden Fall zu dieser Szene hinzugehören, „da die Festnahme“ erst in Vers 12 erfolgt und „unmittelbar mit der Abführung des Festgenommenen zu Hannas in V. 13 verbunden wird“. Vers 14 wiederum (W482) lässt mit der „Erwähnung des Kajafas“, Hannas‘ Schwiegervater, „an dessen in 11,49f. gegebenen Rat erinnern“.
Zwar greift Johannes hier auf Stoff zurück, den auch die synoptischen Evangelien enthalten, aber er hat ihn „profiliert neu gestaltet“:
Dort kündigt Jesus nach dem Hinausgehen an, dass seine Schüler sich zerstreuen werden und dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Diesen Stoff hat Johannes schon in anderer Weise an anderem Ort geboten (13,36-38; 16,32). Nach Erreichen des Zieles erzählen die synoptischen Evangelien von Jesu Bitten, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehe, und seinem Einwilligen, ihn zu nehmen, wenn Gott es so will. Hier hat Johannes noch stärker verändert. Diese Tradition erschien bei ihm schon in 12,27 in nur einem einzigen Vers. Auf sie spielt er im jetzigen Zusammenhang noch einmal kurz in V. 11b an.
In „welcher Gestalt auch immer Johannes seine Tradition vorfand“, Wengst kommt es darauf an, das besondere johanneische „Profil“ der von ihm ebenfalls stark veränderten „Darstellung der Festnahme Jesu“ herauszuarbeiten.
Schon die örtlichen Verhältnisse stellt Johannes in Vers 1 anders als die Synoptiker dar (W482f.):
„Nachdem Jesus das gesprochen hatte, ging er mit seinen Schülern hinaus auf die andere Seite des Wadi Kidron.“ Jesus verlässt mit seinen Schülern den Raum, in dem sie sich zum Mahl aufgehalten hatten. Sie verlassen auch die Stadt und durchqueren das Wadi Kidron. Nach den anderen Evangelien gehen sie zum Ölberg. Johannes erwähnt ihn nicht, aber zu ihm gelangt, wer den Kidron überschreitet. Josephus beschreibt die Lage des Ölbergs so: „[…] der im Osten der Stadt gegenüber liegt und von ihr durch eine genau in der Mitte verlaufende tiefe Schlucht mit dem Namen Kidron getrennt ist“. <1257>
Während in Matthäus 26,36 und Markus 14,32 als „genaueres Ziel … ein Getsemani genanntes Grundstück“ angegeben ist, belässt es (Anm. 236) Lukas „bei der allgemeinen Angabe ‚Ölberg‘“. Johannes aber „spricht von einem ‚Garten‘; ‚in den ging er hinein, er und seine Schüler‘.“ Das findet Wengst (Anm. 237)
in dreifacher Hinsicht auffällig. Allein er spricht auch vom Ort des Begräbnisses Jesu zweimal als von einem „Garten“ (19,41). Er erinnert in 18,26 bei der Verleugnung des Petrus an den „Garten“ der Festnahme und er lässt in 20,15 Mirjam annehmen, den „Gärtner“ vor sich zu haben.
Friedrich-Wilhelm Marquardt und Magdalene Frettlöh <1258> haben Wengst zufolge auf Grund dieser Beobachtung „gute und schöne theologische Einsichten gewonnen“, die durchaus „Anhalt am Text des Johannesevangeliums haben“, aber doch mehr auf seine „Zusammenschau … mit anderen Traditionen“ im Zuge seiner „Wirkungsgeschichte“ zurückzuführen sind, als dass sie wirklich „als Auslegung des Johannesevangeliums“ zu betrachten wären. Wengst hält also weder wie Marquardt das Stichwort „Gärtner“ für „ein[en] orts-übliche[n] Hoheitsname[n] Jesu in einer Paradies-Christologie“, noch meint er wie Frettlöh, dass daraus „eine ausgreifende ‚Gärtner-Christologie‘ zu entwickeln sei“. In Wengsts Augen ist entscheidend, dass „Jesus als Auferweckter … der Gekreuzigte“ bleibt, nicht dass „er Gärtner bleibe“.
Dass Jesus (W483) in diesem Garten „oft mit seinen Schülern zusammengekommen war“,
hat Johannes bisher nicht erzählt. Deshalb trägt er es hier zur Information der Leser- und Hörerschaft nach, um das Handeln des Schülers Judas und dessen Erfolg einleuchtend zu machen. Von diesem Schüler heißt es nun, dass er diesem Versammlungsort kannte und also wusste, dass Jesus nach Abschluss des Mahles dort hingehen würde. Nach 13,30 verließ Judas den Raum des Mahles, nachdem Jesus ihn aufgefordert hatte: „Was du tun willst, tu alsbald!“ (13,27) Daran wird erinnert, wenn jetzt Judas wieder auftritt, um diese Aufforderung auszuführen. Damit gibt Johannes aber auch zu verstehen, dass Jesus nicht nur gewohnheitsmäßig in den Garten geht; er tut es bewusst…
Zum griechischen Wort paradidonai, mit dem das Verhalten des Judas im Johannesevangelium bezeichnet wird, hebt Wengst hervor, dass zwei verschiedene Übersetzungen möglich sind:
An allen Stellen, an denen Judas begegnet, kennzeichnet ihn Johannes als den, der Jesus „ausliefern“ würde (6,71; 12,4; 13,2.21-30), bzw. „seinen Verräter“ – das ist eine in 18,2 mögliche Übersetzung. Hier wird deutlich, worin sein „Ausliefern“ bzw. „Verraten“ besteht: Er hat denjenigen, die Jesus festnehmen sollten, den Ort „verraten“, an dem sie ihn abseits der Öffentlichkeit finden könnten, sie dort hingeführt und ihn damit ihnen „ausgeliefert“. … Als Übersetzung empfiehlt sich das Wort „ausliefern“, weil es die Dimension offen hält, dass Gott aus diesem Bösen Gutes gemacht hat und so das paradidónai zugleich ein „Dahingeben“ durch Gott ist.
Zur Person des Judas deutet Wengst an, dass die „Motive … für sein Handeln“ möglicherweise auch edel gewesen sein mögen, worüber wir aber „schlechterdings nichts wissen“ können. Als (W484) „äußerst unheilvoll“ bezeichnet er es, „dass der Schüler, durch den Jesus ausgeliefert wurde, den Namen ‚Judas‘ trug“, was „zu einer Gleichsetzung ‚des Verräters‘ mit ‚den Juden‘“ führte, denn (Anm. 240) der in dieser Form ins Griechische übertragene Name geht auf den hebräischen Namen „Jehuda“ zurück.
Hartwig Thyen (T704) beschäftigt sich zu Johannes 18,1 zunächst mit der Frage, wie dieser Vers an das Vorangehende anschließt. Indem Johannes mit synoptischen Prätexten spielt, kann sich der hier geschilderte Aufbruch sowohl auf eine Stelle wie Markus 14,26 beziehen, also den Gang vom Ort des letzten Mahles zum Ölberg, als auch auf Markus 14,42, wo vom Weggang aus dem Garten Gethsemane zum Ort des Verrats durch Judas die Rede ist. Anders als bei den Synoptikern scheint Jesus Thyen zufolge im Johannesevangelium jedoch nicht nur auf der Erde unterwegs zu sein:
Nachdem Jesus in den Kap. 13 und 14 noch ganz als der Irdische zu seinen Jüngern geredet und ihnen für die Zeit nach seinem Weggang die Sendung des Heiligen Geistes als ihren anderen Parakleten versprochen hatte, sprach er in den Kap. 15-16 zu ihnen und in seinem Gebet zum Vater bereits als derjenige, der gleichsam schon unterwegs war zwischen den Schauplätzen seines irdischen Wirkens und den himmlischen Wohnungen im Haus seines Vaters (14,2f), ja, wie etwa 16,33 und 17,1ff und 17,11: „Ich bin nicht mehr in der Welt“ zeigen, spricht er hier gewissermaßen schon als der, der bereits am Ziel dieses Weges angekommen zu sein scheint …
Ob diese geläufige christliche Vorstellung, Jesu Aufenthaltsort nach seiner Auferstehung sei der Himmel, so selbstverständlich schon für Johannes vorauszusetzen ist, hatte Veerkamp in seiner Auslegung von Johannes 17,1 in Zweifel gezogen, insofern für jüdisches Denken der Himmel kein Ort ist, sondern die Verborgenheit Gottes markiert, in die der Messias zurückkehrt. Dass Jesu Weggang aber jedenfalls über rein irdische Ortsveränderungen hinaus auch seinen Abschied im Sinne des Gehens in den Tod meint, sieht Thyen richtig. In 18,1 wird die nächste Station auf diesem Weg bezeichnet:
Hieß es 14,31: ,Laßt uns von hier weggehen‘, so erfährt der Leser erst hier, wohin dieser Weg führen soll. Sein Ziel ist jener Garten (kēpos) jenseits des Baches Kidron, in dem Jesus oft mit seinen Jüngern zusammen war (V. 2).
Um „mit seinen Jüngern auf den Ölberg“ zu gelangen, muss Jesus das „östlich des Tempelbergs gelegene Tal des Kidronbaches überqueren, der nach Süden ins Tote Meer fließt.“ Nach dem Wörterbuch von Walter Bauer <1259> definiert Suidas das gewöhnlich mit „Bach“ übersetzte Wort cheimarros als „ho en tō cheimōni rheōn potamos; als ein[en] Fluß oder Bach also, der nur im Winter Wasser führt“; wir sahen oben, dass Wengst ihn in diesem Sinne korrekt ein Wadi nennt. Thyen sieht im Hintergrund der Erwähnung des Baches Kidron die Schriftstelle 1. Könige 2,36f., derzufolge König Salomo einen Mann namens Schimi am Leben lässt, der einen Fluch gegen Salomos Vater David ausgesprochen hatte:
Und der König sandte hin und ließ Schimi rufen und sprach zu ihm: Baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne dort und geh von da nicht heraus, weder hierhin noch dahin. An dem Tag, an dem du hinausgehst und den Bach Kidron überquerst – so wisse, dass du des Todes sterben musst; dein Blut kommt dann auf dein Haupt!
Warum vermeidet es Johannes nun aber, den „von Mk 14,32 und Mt 26,36 zur Bezeichnung eines Landstücks (chōrion) gebrauchten Eigennamen Gethsēmani“ zu erwähnen, wenn sich doch „bereits Joh 12,27ff als ganz offenkundiges intertextuelles Spiel mit der synoptischen Gethsemane-Szene erwies“ und auch „das Wort vom Trinken des Kelchs in V. 11“ auf diese „Szene seiner Prätexte (Mk 14,32-42; Mt 26,36-46; Lk 20,40-46)“ Bezug nimmt, und spricht stattdessen „nur von einem ,Garten‘ (kēpos) jenseits des Kidrontales“, in den „sich Jesus mit seinen Jüngern“ bereits zuvor „öfter zurück[ge]zogen (V. 2)“ hatte? Nach Thyen (T706) erschien ihm der Name Getsemane wohl
allzu eng mit Jesu Bitte verknüpft …: „Mein, Vater, wenn es möglich ist, so laß diesen Kelch an mir vorübergehen“. Denn, wie 12,27ff und Jesu an Petrus gerichtete Frage: „Soll ich denn etwa den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat?“ (V. 11), zeigen, widerspricht diese Frage seinem eigenen Jesusbild.
Ton Veerkamp <1260> erinnert im Zusammenhang mit Johannes 18,1-2 daran, dass
Johannes … im zweiten Teil seines Evangeliums den Messias als „den Verborgenen“ dargestellt [hat]. Das bezog sich nicht nur darauf, dass der Messias vom größeren Teil des Volkes als solcher nicht erkannt wurde, also ihm „verborgen“ blieb. Auch musste er sich immer wieder physisch verbergen (7,10; 8,59; 12,36).
Jetzt betritt Jesus den Ort, in dem er sich verborgen hielt, den Garten jenseits des Baches Kidron. Sie dienen der Beschreibung eines Verstecks, das nur Eingeweihten – unter ihnen Judas Iskariot – bekannt war.
In seiner Anm. 502 zur Übersetzung von Johannes 18,1 verweist Veerkamp zur Überquerung des Baches Kidron wie Thyen auf Schriftstellen aus den Vorderen Propheten, ohne allerdings genau die von Thyen genannte anzuführen:
Diese Ortsangabe weicht ab von dem, was wir in den Passionsberichten der anderen kanonischen Evangelien finden. „Jenseits vom Bach Kidron“ ist ein verhängnisvoller Ort. David musste seine Stadt nach dem Putsch des Absalom verlassen, indem er diesen Bach überquerte, 2 Samuel 15,23; im Tal Kidrons, 1 Könige 15,13, 2 Könige 23,4, verbrannten die Könige Asa und Josia hölzerne Bilder von Götzen.
Während nach der von Thyen genannten Stelle Johannes mehr auf den Tod anspielen würde, den Jesus jenseits des Kidron zu erwarten hat, geht es hier einerseits um den messianischen Königsanspruch, der Jesus verweigert wird, und andererseits um den Vorwurf gegenüber der Führung Judäas, sich (in Gestalt des römischen Kaisers, wie wir in Johannes 19,15 hören werden) einem fremden Gott zu unterwerfen.
↑ Johannes 18,3: Judas als Anführer einer bewaffneten römisch-judäischen Truppe
18,3 Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte
und Knechte der Hohenpriester und Pharisäer,
kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen.
[29. Dezember 2022] Nach Klaus Wengst (W484) erscheint Judas in Vers 3 einen „kleinen Augenblick … als Hauptfigur“:
Er „holte die Kohorte und Wachleute von den Oberpriestern und Pharisäern“. Nach Mt 26,47 kommen mit Judas „viele Leute mit Schwertern und Knüppeln, losgeschickt von den Oberpriestern und den Ältesten des Volkes“. Bei Johannes steht an erster Stelle eine Kohorte. „Nach 18,12 hat die Kohorte einen Chiliarchen als Hauptmann und ist von den jüdischen Dienern unterschieden. Also sind mit ihr römische Soldaten gemeint.“ <1261> Josephus gibt Mannstärken von Kohorten an: Er nennt welche, die aus je 1000 Fußsoldaten bestanden, und andere, zu denen je 600 Fußsoldaten und 120 Reiter gehörten.
Dazu gibt Wengst zu bedenken (Anm. 242):
Selbst wenn man speira nicht – wie üblich – einer Kohorte entsprechen lässt, sondern einem Manipel, ist der militärische Aufwand mit 200 Soldaten immer noch sehr groß vorgestellt. … In historischer Hinsicht ist es unwahrscheinlich, dass römische Soldaten an der Verhaftung Jesu beteiligt waren. Er wäre dann sofort zu Pilatus gebracht worden … In einer Hinsicht spiegelt allerdings die johanneische Darstellung die Wirklichkeit in römischen Provinzen durchaus wider, dass nämlich römische Besatzung und einheimische Oberschicht nahtlos zusammenwirkten, wenn es darum ging, potentielle Störenfriede der bestehenden Ordnung aus dem Weg zu räumen.
Diese „einheimische Oberschicht“ (W484) begegnet in ihrer „Zusammenstellung von ‚Oberpriestern und Pharisäern‘“ nach ihren Auftritten in 7,32.45 und 11,47.57 „hier zum letzten Mal“, indem ihre „Wachleute“ neben der römischen Kohorte aufmarschieren:
Die Pharisäer werden danach nicht mehr erwähnt. Auf der Gegenseite stehen außer der römischen Macht nur noch die Oberpriester. Judas „holte“ also die Kohorte und die Wachleute „und kam dorthin mit Laternen, Fackeln und Waffen“. Das Bild, das Johannes hier zeichnet, ist von einem außerordentlich starken Kontrast bestimmt. Ein einzelner Mensch soll festgenommen werden, der von nicht einmal einem Dutzend Schülern begleitet wird. Und dafür rückt eine unverhältnismäßig große Streitmacht an.
Nach Hartwig Thyen (T705) lässt Johannes in Vers 3 „nun sichtbar“ werden, „in welcher konkreten Gestalt der ,Fürst der Welt‘ kommen wird (14,31)“, den er „unter Rückgriff auf Mk 14,42 am Ende des 14. Kapitels“ ankündigt und zugleich
den Erzählfaden niederlegt, um ihn nach den langen Diskursen der Kap. 15 und 16, sowie nach dem Gebet Jesu in Joh 17 erst in 18,1ff wieder aufzunehmen. … Denn, angeführt von Judas, der, seit Jesus ihm beim letzten Mahl jenen eingetauchten Bissen gegeben hatte, vom Teufel besessen ist (13,27), erscheinen mit der römischen Kohorte unter ihrem chiliarchos {Befehlshaber} (V. 12) und den Dienern der Hohenpriester und Pharisäer die irdischen Archonten und Vollzugsorgane des archōn tou kosmou {Fürsten der Welt}. Als gälte es, einen Schwerverbrecher zu stellen, treten sie mit Laternen, Fackeln und als Bewaffnete auf.
Dabei will Thyen (T707f.) die
Wendung ho oun Ioudas labōn tēn speiran ktl. {Judas führte also die Kohorte usw.} … am besten rein funktional verstehen und so wiedergeben, daß Judas als der Ortskundige sich an die Spitze derer setzte, die Jesus verhaften sollten. Denn labōn kann hier ja schwerlich heißen, daß er sich nicht nur der hypēretai {Diener} der Hohenpriester und Pharisäer (s. o. zu 7,32.45), sondern darüber hinaus noch einer gesamten römische Kohorte samt ihres Befehlshabers (chiliarchos V. 12) als seiner Helfer bedient hätte … Eine Legion bestand aus zehn Kohorten (speirai), deren jede etwa fünf- bis sechshundert Soldaten umfaßte. Als der militärische Arm des römischen Präfekten, in unserem Fall also des Pilatus, war eine solche Kohorte in unmittelbarer Nähe des Tempels auf der Burg Antonia stationiert.
Den Umstand (T708), dass die Synoptiker (Mk 14,43-52; Mt 26,47-56; Lk 22,47-53) „nur von einem mit Schwertern und Knüppeln bewaffneten Haufen (ochlos)“ wissen, der „zur Festnahme Jesu“ ausrückt, und dass von einer römischen Kohorte „bei Markus und Matthäus erst die Rede“ ist, „nachdem das Synhedrium Jesus zum Tode verurteilt und ihn gefesselt an Pilatus überstellt hat (Mk 15,16; vgl. Mt 27,27)“, erklärt Thyen „als ein Spiel mit den genannten synoptischen Prätexten“:
Da nach Joh 11,47ff das Synhedrium unter Vorsitz und auf Anraten des Hohenpriesters Kaiaphas das Todesurteil gegen Jesus längst gefällt hat (11,47ff) – ein Urteil freilich, das, wie Nikodemus in 7,51 zu Recht erklärt hatte, darum torawidrig war, weil es in Abwesenheit des Verurteilten und ohne ihn zuvor anzuhören gefällt worden war -, findet nach der Gefangennahme Jesu statt eines Prozesses gegen ihn vor dem Synhedrium nur noch die Verhandlung vor Pilatus statt. Als der bereits zum Tode Verurteilte wird Jesus hier darum schon unmittelbar nach seiner Festnahme sogleich gefesselt abgeführt. Nach einer kurzen Befragung durch Hannas, den Schwiegervater des Kaiaphas und die graue Eminenz der Jerusalemer Priesterschaft, wird Jesus dann zu Kaiaphas gebracht, der ihn sogleich an Pilatus ausliefert. Deswegen mußte Johannes das Auftreten der speira {Kohorte} aus Mk 15,16 schon in unserem V. 3 vorwegnehmen. Zugleich läßt er anstelle des mit Schwertern und Knüppeln ausgerüsteten jüdischen ochlos {Volkshaufen} zur Festnahme Jesu neben einigen hypēretai {Dienern} der Priester und Pharisäer eine bewaffnete römische Kohorte mit Fackeln und Laternen anrücken.
Natürlich kann nach Thyen „historisch unmittelbar vor dem Passafest und angesichts der Masse von Festpilgern in Jerusalem gewiß nicht die gesamte römische Kohorte Jerusalems zur Festnahme eines einzigen Mannes ausgerückt“ sein. Mit dieser übertreibenden Darstellung bringt Johannes
aber zum Ausdruck, daß der Fürst der Welt mitsamt all seinen irdischen Repräsentanten keine Macht über Jesus hat, ja daß sie, wie die beiden folgenden Verse zeigen, nicht nur ohnmächtig vor ihm zurückweichen, sondern angesichts dessen, der hier sein göttliches egō eimi {ICH BIN} sagt, zu Boden fallen.
Da Ton Veerkamp <1262> bereits in seiner Auslegung von Johannes 8,44 klargestellt hatte, dass die Worte diabolos oder satanas sich im Johannesevangelium eindeutig auf die römische Weltordnung bzw. ihren Kaiser als den endzeitlichen Widersacher des Gottes Israels beziehen, der durch Jesu Tod am römischen Kreuz überwunden wird, kann er die Rolle des Judas in Johannes 18,3 mit folgenden sehr knappen und nichtsdestoweniger deutlichen Worten deuten:
Judas ben Simon Iskariot war unter den Zwölf ein Vertreter des Feindes, ein V-Mann der römischen Behörde und nicht der Tempeleliten, ein Satan, ein Feind, wie Johannes ihn nennt, 6,71. Dieser Mann führt eine gemischte Polizeitruppe aus Beamten der Selbstverwaltungsbehörde und römischen Soldaten in den Garten.
↑ Johannes 18,4-9: Jesus stellt sich der Truppe, die vor seinem ICH-BIN zu Boden fällt, und erwirkt den freien Abzug seiner Schüler
18,4 Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte,
ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr?
18,5 Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth.
Er spricht zu ihnen: Ich bin‘s!
Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen.
18,6 Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin‘s!,
wichen sie zurück und fielen zu Boden.
18,7 Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr?
Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth.
18,8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt: Ich bin‘s.
Sucht ihr mich, so lasst diese gehen!
18,9 Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte:
Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.
[30. Dezember 2022] Gegen den Anschein, den Vers 3 erweckt haben könnte (W485), als ob
Judas eine Hauptrolle spielen könnte, tritt danach sofort Jesus als der auf, der tatsächlich das Gesetz des Handelns in der Hand hält. Er weiß, „was alles auf ihn zukommen würde“. So geht er von sich aus seinen Häschern entgegen. Judas erhält keine Gelegenheit, ihn als den Gesuchten kenntlich zu machen. Nach der synoptischen Darstellung hat er mit den Häschern vereinbart, Jesus mit einem Kuss zu begrüßen, damit sie wüssten, wen sie ergreifen sollen; und so geschieht es. Hier jedoch ergreift der Gesuchte selbst die Initiative und fragt die Ankommenden: „Wen sucht ihr?“
So stellt Johannes in Vers 4 klar, wie Schnackenburg <1263> sagt: „Jesus ist nicht ein ohnmächtig Ausgelieferter, sondern der sich selbst Ausliefernde.“
In Vers 5 lautet die Antwort auf die Frage, „wen sie suchen“, auf Griechisch: Iēsoun ton Nazōraion, Jesus wird also (Anm. 246) als der „Nazoräer“ bezeichnet. Nach Wengst kann Johannes das „nur als Herkunftsangabe“ verstehen, da er „zu diesem Wort weder hier noch in V. 7 oder in 19,19 eine Erklärung bietet“, und zwar so, „wie Philippus in 1,45 gegenüber Natanael auch von ‚Jesus aus Nazaret‘ spricht.“ Schaeder <1264> zufolge ist das „auch von Anfang an die Bedeutung dieses Wortes“; in seinen Augen ist „die Ableitung von ‚Nazoräer‘ vom Namen des Ortes ‚Nazaret‘ ‚sprachlich und sachlich unangreifbar‘“.
Indem sich Jesus als den „Jesus aus Nazaret“ mit den Worten „Ich bin‘s“ zu erkennen gibt, liegt vordergründig „eine schlichte Selbstidentifizierung vor“, aber es „wird gleich deutlich“, dass „hintergründig sehr viel mehr gesagt ist“.
Dass Judas im Johannesevangelium ausdrücklich nicht „eine Hauptrolle zu übernehmen“ hat, deutet „ein letzter Seitenblick“ an, der auf ihn geworfen wird: „Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn auslieferte.“ Nach Johannes Schneider <1265> spielt er „nur noch die Rolle eines Statisten, der auf den weiteren Gang der Ereignisse keinen Einfluß mehr hat“.
Die Unterbrechung des Gedankengangs durch den Blick auf Judas erlaubt es Johannes, Jesu „Selbstidentifizierung“ in Vers 6 nochmals zu wiederholen, bevor er ihre „eigenartige Folge“ schildert:
„Wie er ihnen nun gesagt hatte: ,Ich bin‘s‘, wichen sie zurück und fielen zu Boden.“ Johannes zeichnet hier ein geradezu groteskes Bild, das alles historisch Vorstellbare radikal sprengt: Da kommt eine überaus zahlreiche Menge Bewaffneter, um einen einzigen Menschen, von wenigen begleitet, festzunehmen. Als der ihnen unbewaffnet entgegenkommt und sich als der Gesuchte zu erkennen gibt, weichen sie zurück und fallen zur Erde. Diesen Text als tatsächlich so erfolgten Geschehensablauf einsichtig machen zu wollen, geht an seinem Sinn vorbei.
Nach Wengst liegt in dieser Szene auf dem „Ich bin‘s“ Jesu das entscheidende „Gewicht“ (W485f.):
In ihm erklingt zugleich das „Ich bin‘s“ Gottes in der biblischen Tradition, der sich mit dem ins Leiden gehenden Jesus identifiziert. Seine Präsenz wird damit ausgesagt. „Daher fällt zum Zeitpunkt der Festnahme – gerade in dem Augenblick, da unter normalen Umständen Gott auf schreckliche Weise abwesend zu sein scheint – die Betonung auf die Gegenwart Gottes.“
So zitiert Wengst Thomas Brodie, <1266> der an derselben Stelle sagt: „Als ungeschminkte Historie macht die Erzählung keinen Sinn, aber als theologisches Porträt ist sie klar.“ Die theologische Deutung bezieht sich aber beiden zufolge (Anm. 250) auf „Gottes Gegenwart in Jesus“ und nicht, wie Hans-Ulrich Weidemann <1267> meint, auf „das göttliche Wesen Jesu“. Dazu erwähnt Wengst „eine rabbinische Analogie“, <1268> in der „die in Gen 42,24 erwähnte Festnahme Simeons als Geisel durch Josef erzählerisch weiter ausgestaltet“ wird:
Josef lässt 70 Kämpfer Pharaos kommen, die Simeon ins Gefängnis bringen sollen. „Als sie sich ihm näherten, schrie er sie an. Als sie seine Stimme hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und ihre Zähne zerbrachen.“ Dafür wird Hi 4,10 angeführt, wo im Bild vom Zerbrechen der Zähne von Löwen die Rede ist, bewirkt vom „Atem Gottes“. Damit aber ist implizit gesagt, dass im Schreien des Israeliten Simeon gegenüber den Ägyptern Gott zum Zuge kommt. Dass Gott in und durch Israel wirkt, ergibt sich auch aus der Fortsetzung dieser Erzählung. Denn was den 70 ägyptischen Kämpfern nicht gelang, führt anschließend Josefs Sohn Manasse durch, worauf Simeon gegenüber seinen Brüdern bekennt: Ihr sagt, ein Schlag Ägyptens sei das. Er war‘s nicht, sondern des Vaterhauses.“
Indem in Vers 7 Jesus „die zur Festnahme Gekommenen“ nochmals fragt: „Wen sucht ihr?“, und sie noch einmal antworten: „Den Jesus aus Nazaret“, kann er sich in Vers 8 zum dritten Mal mit denselben Worten selbst identifizieren: „Ich habe euch gesagt, dass ich‘s bin.“
Nun aber folgert er daraus eine Aufforderung: „Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen!“ Nach Mt 26,56b; Mk 14 50 haben alle Schüler Jesus bei dessen Verhaftung verlassen und sind geflohen. Nach Johannes flüchten sie nicht; Jesus verschafft ihnen freien Abzug. Die Erzählung setzt voraus, dass dem entsprochen wird, was Jesus fordert.
Diese Szene (Anm. 251) hat Calvin <1269> an das Kapitel 10 erinnert, da Jesus hier „als ein guter Hirte schützend für seine Herde eintritt. Er sieht den Angriff der Wölfe und wartet nicht, bis sie bei den Schafen sind“.
Nach Vers 9 erfüllt sich hier ein zuvor von Jesus selbst gesagtes Wort:
„Es sollte das Wort ausgeführt werden, das er gesprochen hatte: ‚Von denen, die Du mir gegeben hast, habe ich niemanden verloren gehen lassen.‘“ Die Einführungsformel zeigt: „Jesu Worte werden schon wie Zitate aus dem AT […] behandelt (vgl. 12,38; 13,18; 15,25; 19,24.36).“ {Schnackenburg [255]}. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn anders in Jesus „das Wort Fleisch ward“ (1,14), wenn anders Johannes schon mit dem Prolog die Leseanweisung gab, im Reden Jesu die Stimme Gottes selbst zu hören. Das jetzt wiedergegebene Wort Jesu bezieht sich – ohne wörtliches Zitat zu sein – zurück auf seine Aussagen in 6,39; 10,28f. und 17,12. Natürlich ist das durch Jesu Wort Erwirkte – der freie Abzug seiner Schüler – nicht Erfüllung der zuvor gemachten Aussagen schlechthin. Aber darin kommt symbolisch zur Darstellung, was sie enthalten: Er tritt stellvertretend für sie ein; ihn trifft es und sie kommen frei.
Auch Hartwig Thyen (T708) betont zu den Versen 4 bis 6, dass Jesus „[t]rotz der nahenden Übermacht … die Initiative“ behält. Zur (T709) „schwierigen und viel diskutierten Frage, ob die Bezeichnung Jesu als ho Nazōraios etymologisch überhaupt von einem Ortsnamen Nazaret abgeleitet werden kann, oder ob sie einst etwas anderes bedeutete und erst auf dem Wege einer Volksetymologie mit Nazaret als dem Heimatort Jesu in Verbindung gebracht wurde“, meint Thyen wie Wengst, „daß die beiden Lexeme Nazarēnos und Nazōraios im Neuen Testament Synonyma sind und beide dazu dienen, Jesus als denjenigen näher zu bezeichnen, der aus dem galiläischen Flecken Nazaret herkommt“. Obwohl der „Ortsname Nazaret … außerhalb des NT vor dem dritten Jahrhundert nirgendwo bezeugt“ ist, aber in „wechselnder Schreibweise, nämlich als Nazaret (4mal: Mk 1,9; Mt 2,23; Joh 1,45 und 46), als Nazareth (6 mal: Mt 21,11; Lk 1,26; 2,4; 2,39; 2,51 u. Act 10,38) und als Nazara (2mal: Mt 4,13 und Lk 4,16), … zwölfmal im NT“ begegnet und da „Josephus <1270> von 204 poleis kai kōmai {Städten und Dörfern} in Galiläa (Vit 235) weiß, von denen uns aber die meisten namentlich nicht bekannt sind, ist es mit Sicherheit weit überzogen, die Existenz eines galiläischen Ortes Nazaret und/oder die Herkunft Jesu aus diesem Ort zu bestreiten.“
Zur Rolle des Judas ergänzt Thyen über Wengst hinaus, dass es eines „Judaskusses“ nicht bedarf,
weil Jesus sich selbst als der Gesuchte zu erkennen gibt. Nach Jesu egō eimi {ICH BIN} kann Judas nur noch dabeistehen. Es wird nichts von seiner Reue erzählt oder davon, daß er irgendeinen Lohn für sein Ausliefern Jesu empfangen und diesen bekümmert zurückgegeben hätte; auch davon, daß Judas sich verzweifelt erhängt hätte (Mt 27,3ff) oder daß ein schreckliches göttliches Strafgericht über ihn gekommen wäre und ihn vernichtet hätte (Act 1,15ff), erfährt der Leser nichts.
Sowohl die Wiederholung „des egō eimi durch den Erzähler“ als auch „erst recht“ das „Zu-Boden-Fallen der Angeredeten“, das „eine typische Epiphanie-Reaktion {Reaktion auf eine göttliche Offenbarung}“ darstellt“, unterstreicht nach Thyen die „offenbarungs-theologische Bedeutung“ dieser Worte Jesu.
In den Versen 7 bis 9 läuft das Frage-und-Antwort-Spiel der vorherigen Verse auf Jesu Bitte hinaus: „Wenn ihr also mich sucht, dann laßt doch diese ziehen!“ Damit will Jesus „sein eigenes Wort“ erfüllen: „Keinen von denen, die du mir gegeben hast, habe ich verloren“ (6,39), wobei es Thyen für bezeichnend hält, dass er hier „anders als in seinem Gebet zum Vater“ (17,12) nicht vom „Sohn des Verderbens“ als davon ausgenommen spricht. Vielmehr
fällt auf, daß der Erzähler Jesus jetzt in Gegenwart des dabeistehenden Judas ohne jede Einschränkung erklären läßt, der habe keinen von denen verloren, die der Vater ihm gegeben habe.
An dieser Stelle (T710) blickt Thyen noch einmal zurück zur Auslegung von Johannes 17,12 und ergänzt zu „der Fügung ho hyios tēs apōleias {der Sohn des Verderbens}, die im Neuen Testament außer in Joh 17,12 nur noch in 2Thess 2,3 vorkommt“, folgende Einschätzung von Moloney: <1271>
„Die einzige Gestalt in der Geschichte, für die Jesus nicht ‚sorgen‘ konnte, ist Satan, der den Verrat plante (vgl. 13,2). Jesus wäscht Judas die Füße und teilt den Bissen mit ihm, ungeachtet der Pläne des Satans (vgl. 13,2). Dennoch drang Satan in Judas ein (vgl. 13,27), ‚damit die Schrift erfüllt werde‘ (17,12d; vgl. 13,18). Es gibt eine göttliche Ordnung in den Ereignissen des Lebens und des Todes Jesu, die sich seiner Kontrolle entzieht. Der Sohn des Verderbens entzieht sich der Kontrolle Jesu, aber er hat für seine Jünger gesorgt. Während ihrer Zeit bei ihm wurden sie durch sein Wort gereinigt (vgl. 13,10; 15,3), das sie gehalten haben (17,6), und sie haben geglaubt, dass er der Gesandte des Vaters ist (vgl. 16,30; 17,8). Er hat ihnen den Namen Gottes offenbart (vgl. 17,6). Jesus hat alle Jünger, die ihm vom Vater anvertraut wurden, bewahrt und für sie gesorgt, und das gilt auch für Judas. Dass der Sohn des Verderbens eingreift, ist Teil des größeren Plans Gottes, der sich in der Heiligen Schrift offenbart, doch ebenso offenbart sich die grenzenlose Liebe Gottes in der unerschütterlichen Liebe Jesu zu fragilen Jüngern (vgl. 13,18-20). Er bittet den Vater, allen Jüngern ,Vater‘ zu sein, auch Judas“.
Von diesen Überlegungen her interpretiert Moloney Thyen zufolge dementsprechend auch hier unseren Vers 18,9:
„Die in der Auslegung vertretene Auffassung, daß die Unbedingtheit des Anspruchs Jesu sowohl hier als auch in 17,12 Judas einschließt, ist ein weiteres Indiz dafür, daß ,der Sohn des Verderbens‘ in 17,12 nicht Judas, sondern Satan ist (vgl. 2Thess 2,3.8f)“.
Diese Frage, ob Jesus den Judas möglicherweise doch nicht verloren gegeben hat, ist dann von besonderem Interesse, wenn vorausgesetzt wird, dass sich diese Verlorenheit auf sein ewiges Schicksal nach seinem Tod beziehen würde. Wenn Johannes als jüdisch denkender Messianist aber gar nicht in jenseitig-religiösen Kategorien von Verdammnis und Erlösung denkt, sondern in diesseitig-politischen Kategorien von Versklavung und Befreiung, dann könnte Jesus in 18,9 deswegen darauf verzichten, den Judas wie in 17,12 ausdrücklich als „Sohn des Verderbens“ aus der Zahl seiner Schüler auszunehmen, weil Judas nach 18,5 hier ganz offensichtlich auf der Seite des römischen Widersachers steht und aufgehört hat, sein Schüler zu sein. Anders als Matthäus (27,3-10) und Lukas (Apostelgeschichte 1,16-20) zeigt Johannes am weiteren Schicksal des Judas kein Interesse.
Ton Veerkamp <1272> hebt zu den Versen 4 bis 9 zunächst hervor, dass hier erneut sehr betont in dreifacher Wiederholung das Wort zētein, „suchen“ auftaucht:
Jesus weiß, dass die Zeit der Verborgenheit vorbei ist, er weiß, „was alles auf ihn zukommt“. Wieder das Wort „suchen“. Er weiß, daß man ihn sucht, um ihn umbringen zu lassen.
Die Bezeichnung Jesu als „Nazoräer“ interpretiert Veerkamp im Rahmen der steckbrieflichen Suche nach Jesus anders als Wengst und Thyen:
„Jesus der Nazoräer“, so lautet der römische Steckbrief und so heißt er in der Urteilsbegründung des Pilatus. So wird er auch bei Matthäus und Lukas genannt, bei Johannes kommt der Nachname nur hier vor. Als „der Nazoräer“ (der Fürst) war er bei der Polizei bekannt.
Seine Wiedergabe des Wortes Nazōraios mit „Fürst“ begründet Veerkamp, indem er die Verwendung des Wortes in den synoptischen Evangelien betrachtet (Anm. 504):
Es gibt zwei Formen für diesen Nachnamen, Nazarenos und Nazōraios. Matthäus kennt nur die zweite Form und denkt dabei nicht an die Stadt Nazareth, sondern an das hebräische nezer, Spross, aus Jesaja 11,1 (Matthäus 2,23). Lukas hat diese zweite Form auch und denkt dabei an nasir, Fürst. Einem Blinden wird berichtet, Iēsous Nazōraios komme vorbei, und der Blinde ruft ihm zu „Sohn Davids“. Die Inschrift am Kreuz bezieht sich also auf jenen Jesus, den Fürsten, den König der Judäer (Jesus ho Nazōraios ho basileus tōn Ioudaiōn).
Durch das dreimalige egō eimi, mit dem Jesus sich denen, die ihn suchen, zu erkennen gibt, identifiziert er sich als der Messias zugleich mit dem Wollen und Wirken des befreienden NAMENs des Gottes Israels:
„ICH BIN ES“, sagt Jesus, mit der gleichen Emphase, mit der der NAME sich durch den Mund der Propheten Israels zu Wort meldete. Er ist für sie ein steckbrieflich Gesuchter (vgl. 11,57!), aber er ist mehr als das.
„Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen“ wird hier gesagt; er ist nur noch ein Teil der Polizeitruppe, nicht mehr. Und er wich mit den anderen vor dem majestätischen Selbstbewusstsein des Messias zurück und fiel wie von einem Blitz getroffen.
Mit besonderem Nachdruck begründet Veerkamp, warum Jesus nach Johannes so viel Wert darauf legt, das Leben seiner Schüler zu retten. Um das Leben der kommenden Weltzeit auf dieser Erde herbeizuführen, muss es messianisch handelnde Menschen geben, die diese grundlegend veränderte Welt tätig erwarten:
Noch einmal Frage, Antwort, Selbstbekenntnis. Das Spiel wiederholt sich nicht. Jesus hat nur ein Interesse daran, zu verhindern, dass seine Schüler mit ihm zu Tode kommen. Sie sind es, nur sie, die den NAMEN des Messias verkünden sollen, sie müssen am Leben bleiben, damit nicht mit Jesus jede Möglichkeit einer messianischen Existenz stirbt: „Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen.“ Für Johannes haben die Worte Jesu denselben Rang wie die der Schrift Israels: Sie werden „erfüllt“ bzw. müssen erfüllt werden; hier geht es um 6,39 und 17,12. An der Rettung der Schüler hängt die Zukunft der messianischen Bewegung. Um sie geht es Jesus. Darauf kommen wir bei der Verleugnung des Simon Petrus noch zu sprechen.
↑ Johannes 18,10-11: Jesus weist Simon Petrus zurecht, der zum Schwert greift
18,10 Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es
und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters
und hieb ihm sein rechtes Ohr ab.
Und der Knecht hieß Malchus.
18,11 Da sprach Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide!
Soll ich den Kelch nicht trinken,
den mir der Vater gegeben hat?
Nach Klaus Wengst (W486) verzögert in Vers 10, nachdem „Jesus sozusagen alles geregelt hat“, nun noch „ein retardierendes Moment“ seine „Festnahme“ (W486f.):
Johannes nimmt die Tradition auf, dass einer der Begleiter Jesu das Schwert zieht und dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abschlägt. Er bietet sie, um einmal im Gegensatz zu dieser Aktion die Freiwilligkeit Jesu im Gehorsam zu Gott zu betonen. Zum anderen gelingt es ihm, indem er den Schwertschläger mit Simon Petrus identifiziert, dessen Ankündigung von 13,37 zu illustrieren und damit den Kontrast zur anschließend erzählten Verleugnung umso schärfer herauszustellen.
Zu erwarten wäre eigentlich (W487), dass gegen „den mit dem Schwert schlagenden Simon Petrus … die beiden mit Waffen gekommenen Gruppen“ eingreifen. Das tun sie jedoch nicht, was Wengst zu Recht (Anm.253) als „historische Unmöglichkeit“ beurteilt. Stattdessen ist es Jesus, der ihn zurechtweist (W487):
„Stecke das Schwert in die Scheide!“ Begründet wird diese Aufforderung mit der rhetorischen Frage: „Sollte ich denn den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, nicht trinken?“ Wie schon in 12,27 liegt hier eine Reminiszenz an die Erzählung vom dreimaligen Beten Jesu vor, dass der Kelch des Todesleidens an ihm vorübergehe. Erscheint Jesus dort als angefochtener Mensch, der „sich in den Willen seines himmlischen Vaters erst hineinfinden, gleichsam ,hineinbeten‘ mußte“, <1273> so tritt er hier souverän als der im Auftrag Gottes Handelnde auf. Damit gibt Johannes zu erkennen, dass in diesem Geschehen der Festnahme Jesu, das zu seiner Hinrichtung führen wird, doch Gott sein Werk ausführt.
Außerdem verweist Wengst (Anm. 254) auf folgende prophetische Stellen zur „Rede vom Trinken des Kelches“: Jesaja 51,17, Jeremia 25,15f. und Hesekiel 23,32-34 sowie in den synoptischen Evangelien auf Matthäus 20,22 und Markus 10,38.
Hartwig Thyen (T710) spricht im Blick auf die Verse 10 und 11 nicht einfach von der Übernahme einer Tradition, sondern sieht „hier ganz fraglos wieder ein intertextuelles Spiel des Johannes mit seinen synoptischen Prätexten …, nämlich mit Mk 14,47ff; Mt 26,47ff und Lk 22,47ff.“ Die von Johannes abweichende Textfolge beschreibt er folgendermaßen, zunächst bei Markus:
Nach dem Judaskuß und der Festnahme Jesu zieht ein Ungenannter (heis de [tis] tōn parestēkotōn {einer von den Dabeistehenden}) das Schwert und schlägt dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr ab (ōtarion wie Joh 18,10), dem folgt Jesu Reaktion auf den Aufwand an Waffen und Personal zur Festnahme eines, der doch stets in ihrer Mitte im Tempel gelehrt hat und nach dem Verweis auf die Schriften … endlich die Jüngerflucht (14,47-52). Ähnlich ist die Textfolge bei Matthäus… Lukas läßt Jesus, nachdem Judas ihn geküßt hat, fragen: ,Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuß?‘ Nach der darauffolgenden Festnahme Jesu fragen die um Jesus Herumstehenden (hoi peri auton): ,Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?‘, und tatsächlich zieht einer von ihnen das Schwert und schlägt dem Knecht des Hohenpriesters das rechte Ohr ab (kai apheilen to ous autou to dexion: Lk 22,50). Doch Jesus gebietet den Seinen einzuhalten, berührt das Ohr und heilt den Knecht. Die Jüngerflucht und das Schriftzitat läßt Lukas aus.
Bei Johannes hat nunmehr „Jesu souveräne Selbsthingabe an seine Häscher und seine Forderung, den Jüngern freien Abzug zu gewähren“, die bei Markus und Matthäus „auf den Schwertstreich folgende Jüngerflucht“ vollends überflüssig gemacht.
Nach Thyen (T710f.) ergänzen sowohl Lukas als auch Johannes „die Formulierung bei Markus ,er hieb ihm das Ohr ab‘ (to ōtarion) – und nicht etwa artikellos ,ein Ohr‘ – … schwerlich zufällig beide“ mit der näheren Bestimmung: „to dexion {das rechte}“.
Daß Johannes nicht mehr einen der Herumstehenden, sondern den Sprecher der Jünger, Simon Petrus, zum Schwert greifen und dem Knecht des Hohenpriesters das rechte Ohr abschlagen läßt, entspricht ebenso seiner Vorliebe für Konkretisierungen und für sein Interesse am Verisimile {„dem Wahren ähnlich sein“} seiner Erzählung wie die Bemerkung, daß der Name jenes hohepriesterlichen Knechtes Malchus war … Mit seinem typischen oun {nun, aber} und mit dessen Doppelnamen führt er den Petrus in seine Erzählung ein: Simon oun Petros echōn machairan ktl. {Simon Petrus aber, der ein Schwert trug, usw.} Schon im Zusammenhang der Ankündigung seines Verleugnens Jesu hatte Petrus erklärt, daß er bereit sei, sein Leben hinzugeben für Jesus (13,36ff). … Anstelle des lukanischen ,Haltet ein!‘ gebietet Jesus bei Johannes allein dem Petrus: ,Stecke dein Schwert in seine Scheide!‘ (vgl. Mt 26,52), um ihn dann in einem ähnlichen Spiel mit der synoptischen Getsemane-Szene wie in 12,27ff zu fragen: ,Soll ich denn etwa den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat, daß ich ihn trinke?‘
Anders als Wengst und Thyen führt Ton Veerkamp <1274> die johanneische Identifikation des zur Verhinderung von Jesu Verhaftung zum Schwert greifenden Mannes mit Petrus auf eine bestimmte politische Aussageabsicht zurück:
Dieser freilich [Simon Petrus] zeigt, welche Politik er verfolgen will: die des offenen und bewaffneten Kampfes. Simon ist tatsächlich der Zelot. Die Synoptiker kennen einen zweiten Simon als einen der Zwölf und nennen ihn „Simon den Zeloten“ (Markus 3,18). Diesen Unterschied lässt Johannes nicht gelten, und er will zeigen, in welche Sackgasse die zelotische Politik des bewaffneten Kampfes die messianische Bewegung führt. Simon der Fels ist bei Johannes auch Simon der Zelot. Er hat von der tatsächlichen Situation nicht das Geringste begriffen. Er trägt den Kampf aus auf dem Feld, auf dem er verlieren muss, dem militärischen. Auf diesem Feld kann nur einer gewinnen, Rom.
An dieser Stelle beteiligt sich Veerkamp an der Diskussion, ob und inwiefern die Evangelien Jesu Haltung grundsätzlich als pazifistisch darstellen. Ihm zufolge ist nicht einmal die Bergpredigt des Matthäus <1275> in diese Richtung zu deuten; wohl aber ist Matthäus derjenige, der das von Veerkamp eben genannte
realistische Argument bringt …: „Alle, die das Schwert aufnehmen, werden durch das Schwert zugrunde gehen“, 26,52. Johannes argumentiert hier anders. Jesus ist auch bei ihm kein Pazifist, und erst recht giert er nicht nach einem blutigen Martyrium. Er muss, ob er will oder nicht, seinen Weg bis zum blutigen Ende gehen. An diesem Ende führt kein Weg vorbei. Das ist der Becher, der getrunken werden muss. Deswegen soll Simon sein Schwert wegstecken, nicht, weil Jesus prinzipiell „gegen Gewalt“ ist, sondern, weil der Weg zum Sieg über die wirklich zur Kenntnis genommene Niederlage führt. Das Volk der Judäer, im Lande, aber auch in der Diaspora, muss noch zweimal zur Kenntnis nehmen, dass das Schwert zum Untergang und die politisch bewusst angenommene Niederlage zum Leben führt: Diasporakrieg 115-117 und Bar Kochba Krieg 131-135. Es wird daraus aber vollkommen andere politische Konsequenzen ziehen als die Messianisten.
Diese Konsequenzen hatte Veerkamp bereits beschrieben: Während sich das rabbinische Judentum für ein Festhalten an der Tora unter den Bedingungen der Anerkennung als religio licita {erlaubte Religion} durch die römischen Behörden entschied, meinten die Juden, die auf den Messias Jesus vertrauten, durch ihre Praxis der agapē das Imperium selbst ins Wanken bringen zu können. Leider scheiterte dieser Versuch, und stattdessen wurde aus jüdischem Messianismus schon sehr rasch eine neue Religion, nämlich das Christentum. <1276>
↑ Johannes 18,12-14: Jesu Verhaftung und Überführung zu Hannas, dem Schwiegervater des Hohenpriesters Kaiphas
18,12 Die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden
nahmen Jesus und banden ihn
18,13 und führten ihn zuerst zu Hannas;
der war der Schwiegervater des Kaiphas,
der in jenem Jahr Hoherpriester war.
18,14 Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte,
es wäre gut, ein Mensch stürbe für das Volk.
[31. Dezember 2022] Klaus Wengst interessiert sich bei der in Vers 12 erzählten (W487) nun „tatsächlich erfolgende[n] Festnahme“ Jesu vor allem für diejenigen, die daran beteiligt sind:
„Da ergriffen die Kohorte und der Militärtribun sowie die jüdischen Wachleute Jesus und fesselten ihn.“ Außer Judas, der keine Rolle mehr spielt, treten die schon in V. 3 erwähnten Akteure auf, an erster Stelle wieder die Kohorte, deren Anführer jetzt ausdrücklich genannt wird. „Die Wachleute“, die „von den Oberpriestern und Pharisäern“ geschickt waren, erscheinen hier als – so wörtlich – „die Wachleute der Juden“. Wer für Johannes in der Passionsgeschichte „die Juden“ sind – da „die Pharisäer“ in ihr nicht mehr begegnen -, ist damit klar. Dementsprechend treten in 19,6 nur noch „die Oberpriester und die – nämlich ihre – Wachleute“ auf. Römische und jüdische Bewaffnete also nehmen Jesus fest, was in seiner Fesselung anschaulich zum Ausdruck kommt.
Vers 12 vermerkt weiter, dass „sie ihn zunächst zu Hannas“ brachten, und zwar in seiner Eigenschaft als „der Schwiegervater des Kajafas, der in jenem Jahr Hohepriester war.“ Dieser Hannas hatte in den Jahren 6-15 n. Chr. selber das Hohepriesteramt innegehabt. Daraus, (W488) dass nach Josephus „auch seine fünf Söhne alle Hohepriester wurden“ und aus der glaubwürdigen Angabe des Johannesevangeliums, dass der viele Jahre amtierende Kaiphas sein Schwiegersohn war, „ergibt sich, dass er auch weiterhin einflussreich gewesen sein muss.“ Die Stellen Lukas 3,2 und Apostelgeschichte 4,6 führt Wengst als zwei von mehreren Belegen dafür an, dass Hannas „der Hohepriester“ genannt wird,
obwohl er zu der Zeit, auf die sich die Erzählung jeweils bezieht, längst abgesetzt war. … Darin spiegelt sich wider, dass das Hohepriesteramt von der Tradition her auf Lebenszeit galt. Hat man diese Stellen im Blick, braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass Johannes in V. 19 und 22 Hannas ebenso als „den Hohepriester“ bezeichnet wie auch gleich danach in V. 24 Kajafas, den er in V. 13 – wie schon in 11,49 – als in jenem Jahr amtierenden Hohepriester eingeführt hat.
Da der Hohepriester als „Vorsitzender des Synhedriums … der jüdischen Selbstverwaltung“ vorstand und „diese somit auch gegenüber der römischen Provinzverwaltung“ vertrat, war diese Position mit erheblicher Macht verbunden. Seine „Ein- und Absetzung“ wurde in römischer Zeit „zuletzt auf König Agrippa II.“ übertragen:
Wenige führende Familien verstanden es, das hochpriesterliche Amt immer wieder aus ihren Reihen zu besetzen. Mittel für Machtgewinn und Machterhaltung waren auch Bestechung, Verleumdung, Rechtsbeugung, nackte Gewalt und Vetternwirtschaft. Darüber klagt eindrücklich ein rabbinischer Text…: <1277> „Abba Scha‘ul ben Batnit sprach im Namen Abba Josefs ben Chanin: ‚Wehe mir wegen des Hauses Boëthos, wehe mir wegen ihrer Lanze! Wehe mir wegen des Hauses Chanin (= Hannas), wehe mir wegen ihrer Flüsterer! Wehe mir wegen des Hauses Katros, wehe mir wegen ihres Schreibrohres! Wehe mir wegen des Hauses Jischmael ben Phiabi, wehe mir wegen ihrer Faust! Denn sie sind Hohepriester, ihre Söhne Schatzmeister, ihre Schwiegersöhne Tempelkuratoren und ihre Knechte schlagen das Volk mit Stöcken.‘“ Hier erscheint Hannas als Begründer eines hochpriesterlichen „Hauses“.
Dass Jesus im Johannesevangelium „‚zunächst‘ zu Hannas gebracht“ und „nach V. 24… an den amtierenden Hohepriester Kajafas“ weitergeleitet wird, „der ihn nach V. 28 seinerseits an den Präfekten Pilatus überstellt“, lässt Wengst vermuten, dass Hannas „als der unmittelbare Auftraggeber der Festnahme“ anzunehmen ist und dass der Evangelist möglicherweise über (W488f.) „entsprechende Informationen“ verfügte. In seinen Augen
spricht nichts dagegen, dass sie der historischen Wirklichkeit zumindest nahekommen: Jesus wurde im Auftrag des Hannas von im Tempel angestellten Waçhleuten festgenommen und zu ihm gebracht. Nach einer Vernehmung überstellte er ihn an den amtierenden Hohepriester Kajafas, damit der ihn offiziell an den römischen Präfekten ausliefere.
Indem Johannes (W489) an „die Erwähnung des Kajafas … eine Erinnerung an 11,49-53″ anschließt, wo Kajafas – wie es jetzt in Kurzfassung heißt – ‚geraten hatte, es sei zuträglich, dass einer für das Volk sterbe‘“, stellt er, wie Wilckens <1278> sagt,
„für die Leser […] nochmals den entscheidenden Aspekt heraus, unter dem sie als Glaubende das ganze Passionsgeschehen sehen dürfen und verstehen sollen. Es ist der paradoxe Kontrapunkt zu der Absicht der Feinde, Jesus durch die Hinrichtung am Kreuz aus der Welt zu schaffen.“ An dieser Stelle kann auch mitgehört werden, was Jesus in 16,7 gesagt hat, dass es seiner Schülerschaft nütze, wenn er weggehe.
Hartwig Thyen (T712) betont, dass „Jesus gefesselt … wie ein bereits Verurteilter… zunächst (prōton) vor Hannas geführt“ wird. Auch er hebt hervor, dass Hannas „nicht nur der Schwiegervater des damals amtierenden Hohenpriesters Kaiaphas“ war, „sondern … überhaupt die graue Eminenz innerhalb der tonangebenden Priesterschaft Jerusalems gewesen zu sein“ scheint. Über die Angaben von Wengst hinaus erwähnt Thyen, dass Hannas als „der Sohn eines Priesters Sethi … nicht zadokitischen Geschlechts“ war und „darum als illegitimer Hoherpriester“ galt und dass sein Sohn „Hannas der Jüngere um 62… als ein rigoroser Sadduzäer das Interim zwischen dem Tod des Festus und dem Eintreffen des Albinus in Jerusalem dazu nutzte, den Herrenbruder Jakobus hinrichten zu lassen“.
Aus der Bezeichnung des Hannas als archiereus {Hoherpriester} (Joh 18,19!) und der Reihe seiner Söhne sowie seines Schwiegersohns im hohepriesterlichen Amt sind sein Jahrzehnte währender Einfluß und seine Komplizenschaft mit dem römischen Präfekten unschwer zu erkennen.
Schließlich erwähnt Thyen (T712f.), dass „einige, freilich sehr späte Abschreiber die Textfolge nach V. 13 geändert“, also etwa den Vers 24 bereits nach Vers 13 eingefügt haben, um Kaiphas als den vernehmenden Hohenpriester erscheinen zu lassen und die Darstellung des Johannes mit den Passionserzählungen der Synoptiker „zu harmonisieren“, die „allesamt von dieser Befragung Jesu durch Hannas nichts wissen.
Ton Veerkamp <1279> findet in Vers 12 erwähnenswert, dass die zur Festnahme Jesu angerückte „Polizeitruppe … unter dem Kommando eines hohen römischen Offiziers steht – eines Militärtribuns, chiliarchos (tribunus)“. In seiner Anm. 503 zur Übersetzung von Johannes 18,12 bemerkt er, dass ein chiliarchos, von ihm mit „Tribun“ wiedergegeben, wörtlich ein „Führer von tausend Mann“ ist, und dass es „schwer“ ist, „die römischen Dienstgrade mit heute gebräuchlichen zusammenzubringen. ‚Oberst, Hauptmann‘ usw. sind daher nicht angemessen.“
Die „Kohorte und der Tribun sowie die Beamten der Judäer“ bringen also Jesus
gefesselt zu Hannas, dem Schwiegervater des amtierenden Großpriesters Kaiphas. Ihn haben wir schon in 11,47ff. kennengelernt, und er wird, was die judäische Obrigkeit betrifft, das letzte Wort haben, weil er das politische Interesse der Politik an Jesu Hinrichtung am deutlichsten formulierte.
Auffällig ist allerdings, dass Johannes den Kaiphas dieses „letzte Wort“ nicht ausdrücklich aussprechen lässt; es werden anonyme archiereis, Großpriester, sein, die nach Tagesanbruch mit Pilatus über die Aburteilung Jesu eine aufschlussreiche Verhandlung führen.
↑ Johannes 18,15-18: Petrus gelangt durch einen anderen Schüler Jesu in den Hof des Hohenpriesters und verleugnet Jesus gegenüber der Türhüterin
18,15 Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger.
Dieser Jünger war dem Hohenpriester bekannt
und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohenpriesters.
18,16 Petrus aber stand draußen vor der Tür.
Da kam der andere Jünger,
der dem Hohenpriester bekannt war, heraus
und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein.
18,17 Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus:
Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er sprach: Ich bin‘s nicht.
18,18 Es standen da aber die Knechte und Diener
und hatten ein Kohlenfeuer gemacht,
denn es war kalt, und sie wärmten sich.
Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich.
Nach Klaus Wengst (W489) teilt Johannes die in 13,38 von Jesus angekündigte „dreifache Leugnung“ des Simon Petrus „in zwei Szenen auf und umrahmt mit ihnen die Vernehmung Jesu durch Hannas“. In den Versen 15 und 16 führt er „neben Simon Petrus noch einen weiteren Schüler“ ein, durch dessen Vermittlung „Simon Petrus überhaupt in den Hof des Hohepriesters gelangen konnte“, weil er „mit dem Hohenpriester bekannt“ war, wovon zwei Mal die Rede ist. Wenn es in Vers 15 heißt: „Simon Petrus folgte Jesus“, so tut er Wengst zufolge, „was er nach 13,36 ‚jetzt‘ nicht kann – und er wird auch gleich versagen.“
Dass einige Exegeten (W490) wie Becker und Schlatter <1280> sich nur schwer „eine Frau als nächtliche Türhüterin“ vorstellen können, wobei Letzterer unterstellt, dass „ein Mann“ seine Aufgabe sicher besser erfüllt und Petrus nicht in den Hof gelassen hätte, entspricht nach Wengst nicht den Gegebenheiten in der Antike, wie etwa das Beispiel der Türhüterin Rhode in der Apostelgeschichte 12,13f. beweist.
Der „andere Schüler“ spielt in Wengsts Augen keine andere Rolle, als durch seine „Bekanntschaft mit dem Hohepriester … Petrus in den Hof zu bringen.“ Man sollte daher (Anm. 264) „auf Versuche zur Identifizierung dieses ‚anderen Schülers‘ verzichten.“ Gegen seine Identifizierung mit dem Schüler, „den Jesus liebte“, mit dem gemeinsam Petrus auch in 20,2f. auftritt, führt er an, dass eben diese „Näherbestimmung“ hier fehlt und dass er hier „im Unterschied zu dort nicht als ‚der andere Schüler‘ eingeführt wird, sondern als ‚ein anderer Schüler‘.“ Nun könnte es aber auch sein, dass dort mit dem bestimmten Artikel auf genau diesen anderen Schüler Bezug genommen wird, der hier mit dem unbestimmten Artikel eingeführt wurde. Und da hier seine Bekanntschaft mit dem Hohenpriester im Vordergrund steht, kann die Bezeichnung seiner Beziehung zu Jesus weggelassen worden sein. Da Johannes sich vorstellt, dass der geliebte Schüler Jesu Geschichte aufgezeichnet hat, mag er möglicherweise andeuten wollen, dass dieser als Augen- und Ohrenzeuge auch bei der Verleugnung des Petrus anwesend zu denken ist. Es passt einfach nicht zu Johannes, dass er irgendwelche Einzelheiten aus rein banalen Gründen erwähnt.
Wie dem auch sei (W490), nach Wengst nutzt Johannes in Vers 17 die
neu geschaffene Szene, dass Petrus an der Türhüterin vorbei in den Hof des Hohepriesters geführt wird, … für die Darstellung von dessen erster Verleugnung. Die Türhüterin vermutet, als „Magd“ gekennzeichnet: „Gehörst vielleicht auch du zu den Schülern dieses Menschen?“ Petrus verneint: „Ich gehöre nicht dazu.“ Die Szene ist schlicht erzählt: eine leicht zweifelnde Frage, eine Vermutung und eine einfache Verneinung. Johannes nimmt hier noch keine Wertung vor.
In Vers 18 erwähnt Johannes „die Knechte und die Wachleute“, die „ein Kohlenfeuer angemacht hatten und sich wärmten“ und bei denen sich nun auch Petrus aufhält. Aus dem Blickfeld (Anm. 266) „verschwunden“ ist dabei die „römische Kohorte“. Erst in Vers 25 wird der Evangelist (W491) diese Szenerie am Kohlenfeuer wieder aufnehmen, nachdem er zunächst „seine Leser- und Hörerschaft auf den zu Hannas gebrachten Jesus blicken“ lässt.
Hartwig Thyen (T713) geht davon aus, dass der „andere Jünger“ in Vers 15 „trotz des Fehlens seiner nahezu stereotypen Näherbezeichnung als „der Jünger, den Jesus liebte“ dennoch kein anderer als dieser sein kann“, was Neyrinck <1281> „vor allem unter Verweis auf die analoge Struktur der Wettlaufszene von Joh 20,3-8 sorgfältig und überzeugend begründet.“ Das „Quasi-Pseudonym“ des geliebten Jüngers ist vermutlich „hier ausgelassen …, weil es damit in eine fragwürdige Konkurrenz geraten wäre mit seiner für diese Episode um ihres Verisimile willen notwendigen Näherbestimmung als eines mit dem Hohenpriester Bekannten oder Befreundeten“. In dieser „Bekanntschaft unseres fingierten Jüngers/Erzählers mit dem Hohenpriester, der hier ja zudem nur dessen Schwiegervater Hannas sein könnte“, sieht Thyen allerdings keine „historische Nachricht“, sondern „vielmehr ein glänzend erfundenes Mittel der narratio verisimilis {der möglichen Wahrheit entsprechenden Erzählung}, das es erlaubt, den geliebten Jünger ungehindert eintreten zu lassen, damit er dann Petrus den Zutritt verschaffen kann“. Dagegen kann Thyen „Historisierungen so hochsymbolischer Texte wie Joh 18,15ff und 19,25ff nur als deren Banalisierung empfinden“:
Die Konstellation von Judas, dem geliebten Jünger und Petrus in 13,21ff, die Nähe unser Szene zu Jesu Weissagung der Verleugnung Jesu durch Petrus in 13,36ff und dabei zumal die Wiederaufnahme des Schlüsselwortes akolouthein {nachfolgen}, das Petrus schmerzhaft an seine Verleugnung am ,Kohlenfeuer“ (anthrakia) erinnernde ,Kohlenfeuer‘ in 21,9 und sein Gegenüber zum geliebten Jünger mit der ausdrücklichen Erinnerung an das letzte Mahl und die Petrusfrage: ,Herr, wer ist der, der dich ausliefern wird? (21,20ff), all das gibt u. E. dem Zweifel daran, daß der andere Jünger von 18,15f kein anderer sein kann als der geliebte, wenig Spielraum.
Hinzu kommen zahlreiche Anspielungen auf Johannes 10, die Thyen zufolge kaum zufällig hier auftauchen:
Zudem signalisieren die Umständlichkeit der Szeneneinführung und das hier kaum zufällig gehäufte Auftreten der Vokabulars der Hirtenrede von Joh 10 (aulē, thyra, thyrōros, akolouthein, eisagein, syneiserchesthai {Hof, Tür, Türhüter(in), nachfolgen, hineingehen, zusammen hineingehen}), daß die Szene voller symbolischer Obertöne ist. Darum könnte man ja fragen, ob oder inwieweit das möglicherweise auch von dem Bekanntsein des anderen Jüngers mit dem Hohenpriester gelten könnte. Denn immerhin läßt Johannes den Hohenpriester kraft seines ihm von Gott verliehenen Amtes ja Jesu Sterben für das Volk weissagen (11,47ff) und macht ihn so zum Mitvollstrecker von Gottes Heilsplan. <1282>
Die erste Verleugnung des Petrus in Vers 16 und 17 handelt Thyen recht kurz ab:
Während Petrus noch draußen vor der Tür steht, spricht der andere Jünger mit der Türhüterin und kann Petrus daraufhin hineinführen in die Aula. Gleich bei seinem Eintritt fragt ihn jedoch die als Türhüterin bestellte Magd: Bist du nicht auch einer der Jünger dieses Menschen? Und anders als sein Herr, der in großem Freimut gesagt hatte: egō eimi {ICH BIN} (18,5 u. 7), antwortet Petrus der Magd: ouk eimi {nicht bin ich‘s}.
Wohl mit Recht betont Thyen damit die genaue Entsprechung des betonten ICH-BIN-Wortes Jesu zum zurückhaltend knapp verneinten „nicht bin ich‘s“ des Petrus. Worin aber die Bedeutung dieser Entsprechung liegt, das lässt er hier noch offen.
Zu Vers 18 beschränkt sich Thyen auf folgende wiederholende Bemerkung:
Weil es draußen kalt war, hatten die Sklaven und die Diener (der Hohenpriester und Pharisäer V. 3) ein Kohlenfeuer (anthrakia) entzündet, um sich zu wärmen. Deshalb stand nun auch Petrus bei diesen Leuten. Das seltene Wort anthrakia findet sich im gesamten Neuen Testament nur hier und in 21,9.
Ton Veerkamp <1283> geht davon aus, dass mit dem anderen Schüler von Vers 15 derjenige gemeint sein muss, mit dem Petrus um die Wette zum Grab Jesu laufen wird und der zuvor auch bei der Kreuzigung Jesu anwesend ist, wo allerdings Petrus fehlt:
Zwei Schüler folgten der Polizeitruppe, wie man annehmen darf, in gebührender Distanz; Simon Petrus und „ein anderer Schüler“. Dieser andere Schüler ist der Schüler, der bei der Kreuzigung anwesend war. Für die Erzählung ist es notwendig, dass irgendein Schüler von der Wache vor dem Hof des Hannas als „Bekannter des Großpriesters“ erkannt wurde. Sonst wäre Simon der Zugang „mit Jesus“ kaum möglich gewesen. Der anonyme Schüler aus dem Umfeld der priesterlichen Eliten wird im entscheidenden Augenblick an der Seite Simons stehen, hier und am geöffneten Grab.
Entgegen der Einschätzung aller Übersetzungen und Kommentatoren, dass zunächst nur der andere Jünger den Hof betritt und danach wieder herauskommt, um die Türhüterin zu veranlassen, auch Petrus in den Hof zu bringen, setzt Veerkamp in seiner Auslegung im Jahr 2007 voraus, dass auch Petrus bereits mit Jesus in den Hof geht und der andere Jünger ihn danach in den Gerichtssaal selbst bringen will, was Petrus aber nach dem Wortwechsel mit der Türhüterin zu gefährlich erscheint:
Dieser hielt sich an der Zugangstür zum Verhandlungsraum auf, wo ein Dienstmädchen ein Auge auf das Publikum hielt. Alle Synoptiker kennen das Dienstmädchen, das Petrus auf seine Bekanntschaft mit Jesus ansprach. Hier ist sie Türhüterin. Sie äußert eine Vermutung, Petrus muss mit einer Verneinung antworten. Er zieht sich von der Tür zurück, weil sonst seine Aufdringlichkeit ihn verdächtig gemacht hätte. Das Feuer bietet eine gute Veranlassung für den Rückzug, „weil es kalt war“. Wir lassen uns von der Erzählung mitnehmen, die ganze Erzählung hat nicht nur eine Pointe, sie ist selbst die Pointe. Der Erzähler verfährt wie ein guter Filmregisseur. Szenenwechsel.
Diese Deutung, die Türhüterin habe nur den Zugang zum Gerichtssaal bewacht und der Hof habe zuvor von beiden Schülern zusammen mit Jesus betreten werden können, scheitert allerdings an der Singularform von syneisēlthen {ging zusammen [mit Jesus] hinein} in Vers 15. Im Jahr 2015 kehrt auch Veerkamp zur üblichen Übersetzung zurück:
18,15 Simon Petrus und ein anderer Schüler folgten Jesus.
Dieser Schüler war dem Hohepriester bekannt.
Er ging zusammen mit Jesus in den Hof des Hohepriesters,
18,16 Petrus aber war draußen bei der Tür stehen geblieben.
Der andere Schüler aber, der Bekannte des Hohepriesters, kam heraus;
er sagte etwas zur Türhüterin, und sie brachte Petrus hinein.
18,17 Die Dienstmagd aber, die Türhüterin, sagte zu Petrus:
„Bist du nicht auch einer von den Schülern dieses Menschen?“
Er sagt:
„Das bin ich nicht!“
↑ Johannes 18,19-21: Die Befragung Jesu durch den Hohenpriester Hannas über seine Schüler und seine Lehre vor dem kosmos
18,19 Der Hohepriester befragte nun Jesus
über seine Jünger und über seine Lehre.
18,20 Jesus antwortete ihm:
Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet.
Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel,
wo alle Juden zusammenkommen,
und habe nichts im Verborgenen geredet.
18,21 Was fragst du mich?
Frage die, die gehört haben,
was ich zu ihnen geredet habe.
Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe.
[1. Januar 2023] Klaus Wengst (W491) ist davon überzeugt, dass „Johannes und die Synoptiker“ in ihrer „Darstellung der Vernehmung Jesu vor jüdischen Instanzen … nicht harmonisierbar“ sind:
Johannes sagt nichts über einen jüdischen Prozess gegen Jesus. … [I]n Joh 11,47-53 … [ist v]on einem Prozessverfahren mit ‚formeller Verurteilung‘ … in keiner Weise geredet. Nach Jesu Festnahme berichtet Johannes lediglich eine kurze Vernehmung durch den nicht mehr amtierenden Hohepriester Hannas, … die Weiterleitung Jesu von Hannas zu Kajafas und die schließliche Überstellung von Kajafas zu Pilatus. … In 11,47-53 spricht er ausdrücklich von einer Sitzung des Synhedriums, auf der Kajafas den Rat gibt, an den V. 14 erinnert, und stellt die Entschlossenheit heraus, Jesus zu töten (11,53). Aber von einem offiziellen jüdischen Verfahren gegen Jesus lässt er nichts erkennen. Das von ihm dargestellte Handeln der jüdischen Autoritäten kann allenfalls als offiziös bezeichnet werden.
Damit bleibt die johanneische Darstellung insgesamt eher „im Rahmen des historisch Vorstellbaren“ als die Erzählung des „Matthäus und Markus … von einem – nach ihrer Chronologie in der Pessachnacht stattfindenden – Prozess des Synhedriums im Haus des Hohepriesters (Mt 26,57.59-68/Mk 14,53.55-65).“ Nach Wolfgang Stegemann <1284> ist es am wahrscheinlichsten, dass Jesus „ohne Beteiligung jüdischer Instanzen von Pilatus gekreuzigt worden“ ist. Vorauszusetzen ist auf jeden Fall:
„Jesu Schicksal in Jerusalem muß aus dem ordnungspolitischen Regime der römischen Besatzungsmacht in Judäa erklärt werden. Ob mit oder ohne jüdische Beteiligung – das Faktum der Kreuzigung Jesu deutet unvermeidlich auf dessen Hinrichtung aus ordnungspolitischen Motiven. Dies gilt auch für die Hypothese möglicher Beteiligung jüdischer Instanzen Jerusalems“.
Die „inhaltliche Darstellung der Vernehmung durch Hannas“ in Vers 19 hat nach Wengst jedoch kaum einen historischen Hintergrund in der Zeit Jesu (W491f.):
„Da befragte der Hohepriester Jesus über seine Schüler und über seine Lehre.“ Die Angabe dieser Gegenstände für die Vernehmung lässt wieder die Zeit des Evangelisten durchscheinen. Sie war vor allem auch in der Erzählung von der Blindenheilung in Kap. 9 deutlich hervorgetreten, wo von Vernehmungen die Rede war, in denen die Schülerschaft Jesu in Gegensatz zur Schülerschaft des Mose gesetzt wurde und das Bekenntnis zu Jesus zur Distanzierung von der synagogalen Gemeinschaft führte. Calvins Auslegung, von ihm jedoch auf die Zeit Jesu bezogen, dürfte ziemlich genau die Einschätzung treffen, mit der die erste Leser- und Hörerschaft des Evangeliums von der sie umgebenden jüdischen Mehrheit bedacht wurde: „Der Hohepriester stellt an Christus Fragen wie an irgendein Parteihaupt, das einen Jüngerkreis um sich geschart und damit die Gemeinde gespalten habe.“ <1285>
Zu Vers 20 (W492) verweist Wengst auf zwei auffällige Umstände, erstens, dass die „Antwort Jesu … die Schüler heraushält“ und dass Jesus damit fortfährt, seine Schüler zu schützen. „Für die lesende und hörende Gemeinde wird das zum Hinweis, bei Vernehmungen keine Angaben darüber zu machen, wer zu ihr gehört.“ Zweitens
geht Jesu Antwort auf die Lehre auch nur insofern ein, als sie die mit ihrer Öffentlichkeit gegebene Bekanntheit feststellt: „Ich habe öffentlich vor aller Welt geredet; ich habe stets in Synagogen und im Heiligtum gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Aber im Geheimen habe ich nichts geredet.“
Dass hier (Anm. 269) im „griechischen Text … ein artikelloser Singular (wörtlich: ‚in Synagoge‘)“ steht, verweist nach Wengst darauf, dass Jesu Rede „in der Synagoge von Kafarnaum“ (6,59) von Johannes „nicht als das einzige Auftreten Jesu in einer Synagoge verstanden ist.“
Da (W492) die „Synagogen und der Tempel … die Orte kleinst- und größtmöglicher Öffentlichkeit“ darstellen, „an denen ‚alle Juden zusammenkommen‘“, hat Jesus, indem er „dort lehrte, … ‚öffentlich vor aller Welt‘ geredet.“ Daraus zieht Wengst den Schluss, in „dieser Entsprechung zwischen ‚der Welt‘ und ‚allen Juden‘“ werde „es deutlich greifbar, dass für Johannes ‚die Welt‘ konkret die jüdische Welt ist“. In dieser Allgemeingültigkeit gilt diese Aussage aber nicht einmal nach Wengst für alle Stellen im Johannesevangelium, wo vom kosmos die Rede ist. Oft genug meint ja gerade er die „Welt“ als die Völkerwelt verstehen zu können, in die Johannes die Botschaft von Jesus über Israel hinaus hineintragen wolle.
Hier geht es allerdings einfach um das Thema, dass „hinsichtlich seiner Lehre Öffentlichkeit gegeben ist“, so dass „Jesus die Frage des Hohepriesters“ zurückweist:
„Was fragst du mich? Frage doch diejenigen, welche hörten, was ich zu ihnen geredet habe. Sieh doch, die wissen, was ich gesagt habe.“ Die Sache, um die es geht, ist bekannt; es bedarf keiner Vernehmungen.
Mit dieser Antwort Jesu kann der Hohepriester allerdings sicher nicht zufrieden sein, was Wengst mit einem Zitat von Hirsch-Luipold <1286> andeutet:
„Das Problem ist nicht […], dass jemand nicht wissen könnte, was Jesus gesagt hat: Das liegt offen zu Tage und man muss nur diejenigen fragen, die es gehört haben und bezeugen. Das Problem ist vielmehr, dass damit die Bedeutung dessen noch nicht klar ist, was er gesagt und getan hat.“
Hartwig Thyen (T714) vergleicht die Szene im und beim Anwesen des Hohenpriesters Hannas mit derjenigen „des Verhörs durch Pilatus“. Wie die Letztere
geschickt durch den Wechsel zwischen Drinnen und Draußen gegliedert ist, drinnen im Prätorium nämlich verhört Pilatus Jesus und draußen verhandelt er mit den Juden, die das heidnische Prätorium nicht betreten, um sich für das nahe Passamahl nicht zu verunreinigen, so wechseln auch hier die Schauplätze zwischen draußen und drinnen. Hatte Petrus seinen Herrn draußen soeben zum ersten Mal verleugnet, so macht der Erzähler seine Zuhörer/Leser in den Versen 19-23 (24) nun zu Zeugen der Befragung Jesu durch Hannas drinnen.
Inhaltlich erzählt Thyen einfach nur nach, was in den Versen 19 bis 21 steht:
Hannas befragt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Und mit dem betont vorangestellten egō {ich} antwortet Jesu ihm, er habe doch in aller Weltöffentlichkeit frei heraus geredet (egō parrhēsia lelalēka tō kosmō), allezeit habe er in der Synagoge und im Tempel gelehrt, dort also, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe er darüberhinaus überhaupt nichts gesagt. „Wozu befragst du mich also? Frag doch die, die gehört haben, was ich ihnen gesagt habe. Siehe, die wissen doch, was ich gesagt habe.“
Nach Ton Veerkamp <1287> kommt die inhaltliche Dürftigkeit der Befragung durch Hannas nicht zufällig zustande. Schließlich geht es nicht um ein religiöses Interesse für die Lehre Jesu, sondern um Jesu politische Gefährlichkeit und sein Umfeld:
Hannas fungiert hier als Untersuchungsrichter, der darüber befinden muss, ob ein weiteres Verfahren notwendig war. Richter wie Hannas fragen in der Regel nach Dingen, die ihnen längst bekannt sind. Die Befragung dient dem Schein der Rechtmäßigkeit des Verfahrens.
Hannas fragt Jesus nach seinen Schülern – in seinen Augen Komplizen – und nach seiner Lehre, also nach seinen politischen Absichten. Jesus lässt den Richter ins Leere laufen. Erstens sei Hannas alles längst bekannt, zweitens müsste er die befragen, die Jesus bei seinen öffentlichen Reden zugehört haben. Diese könnten objektivere Auskunft erteilen als er selbst.
Bis zu diesem Punkt dachte ich, zu den Versen 19 bis 21 sei alles Notwendige gesagt. Dann aber sah ich, dass Veerkamp in seiner Auslegung auf eine bestimmte Einzelheit nicht eingeht, die er in Vers 20 anders übersetzt als Wengst und Thyen:
18,20 Jesus antwortete ihm:
„Ich habe öffentlich über die Weltordnung geredet,
ich habe immer in der Synagoge und im Heiligtum gelehrt,
wo alle Judäer zusammenkommen,
im Verborgenen habe ich nichts geredet.
In seiner Anm. 505 zur Übersetzung von Johannes 18,20 schreibt Veerkamp zu den griechischen Worten „parrhēsia lelalēka tō kosmō {ich habe öffentlich über die Weltordnung geredet}“, dass sicher auch „die Übersetzung“ erlaubt ist:
„Ich habe öffentlich zu (aller) Welt geredet“, also zu allen möglichen Leuten. Aber im Rahmen der Auseinandersetzung, die Johannes führt, interessiert hier den Hohepriester doch wohl, was Jesus politisch geredet hat, welche politische Lehre er verkündet hat, vgl. 11,47-50.
Ich selber halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass tō kosmō wirklich mit „über die Weltordnung“ übersetzt werden kann, zumal Veerkamp ja eigentlich annimmt, dass Jesus den Untersuchungsrichter „ins Leere laufen“ lässt, indem er inhaltlich über seine Lehre rein gar nichts preisgibt.
Allerdings veranlasst mich Veerkamps Übersetzungsvorschlag zu der Frage, ob eine andere alternative Übersetzung nicht noch näher liegt. Müsste nicht tō kosmō in Entsprechung zu den Stellen Johannes 7,4 und 14,22 übersetzt werden, wo Jesus aufgefordert wurde, sich dem kosmos zu offenbaren, bzw. gefragt wurde, warum er sich dem kosmos gegenüber gerade nicht offenbart? Dann aber würde Jesus hier genau das behaupten, was er dort verweigert hat: „Ich habe öffentlich vor dem kosmos, zum kosmos geredet“. Will Jesus, wie Johannes ihn schildert, damit andeuten, dass die römische Weltordnung, mit der Hannas als die graue Eminenz der judäischen Hohepriesterschaft unter einer Decke steckt, genau darin, dass Jesus bewusst nur vor der jüdischen Öffentlichkeit aufgetreten ist, letzten Endes als der eigentliche Widersacher des Gottes Israels und seines Messias bloßzustellen ist? Da die Verwendung des Wortes kosmos bei Johannes keineswegs eindeutig zuzuordnen ist und da der Evangelist es liebt, mit begrifflichen Andeutungen zu spielen, ist es ihm durchaus zuzutrauen, in dem Dativ to kosmō eine solche verschlüsselte Botschaft auf dermaßen paradoxe Art und Weise zu verbergen, dass sie vor aller Augen offen da liegt und dennoch vollkommen übersehen werden kann.
↑ Johannes 18,22-24: Johannes 18,22-24: Jesu souveräne Reaktion auf seine Misshandlung und seine Überstellung zum Hohenpriester Kaiphas
18,22 Als er so redete,
schlug einer von den Dienern, der dabeistand,
Jesus ins Gesicht und sprach:
Sollst du dem Hohenpriester so antworten?
18,23 Jesus antwortete ihm:
Habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel ist;
habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich?
18,24 Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas.
Nicht der Hohepriester selbst reagiert Klaus Wengst zufolge (W492f.) auf „Jesu freimütige Verweigerung einer Antwort“:
„Als Jesus das gesagt hatte, gab ihm einer von den Wachleuten, der dabeistand, eine Ohrfeige und sagte: ,So antwortest du dem Hohepriester?‘“ Bevor der Wachmann redet, handelt er, indem er an Jesus Gewalt ausübt. Er begründet sein Handeln damit, dass Jesus in seiner Antwort nicht den gebührenden Respekt gegenüber der Autorität des Hohepriester gezeigt habe. Er, der es gelernt hat und darin eingeübt ist, sich der Autorität zu fügen, kann es sich hier herausnehmen, den als noch tiefer stehend eingeschätzten Gefangenen zur Räson bringen zu wollen und den vermissten Respekt handfest einzufordern.
Im Hintergrund dieser Szene (Anm. 272) steht nach Wengst wie in Apostelgeschichte 23,1-5, wo Paulus ausdrücklich darauf hinweist, die Schriftstelle 2. Mose 22,27. Dort heißt es: „einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen“. Das hebräische Wort ˀarar, „fluchen“, „gibt die Septuaginta … mit ‚frevelhaft reden‘ wieder“; wörtlich ist die Rede von kakōs legein {schlecht, böse, übel reden}. Es ist genau „dieselbe Wendung, die Jesus dann in V. 23 gebraucht“, um (W493) „den zur Rede“ zu stellen, „der ihn geschlagen hat: ‚Wenn ich frevelhaft geredet habe, weise mir den Frevel nach! Wenn aber recht, warum schlägst du mich?‘“ Damit lässt Johannes Jesus nicht nur „dem Hohepriester … aus der überlegenen Distanz dessen, der ‚von oben‘ kommt“ antworten, „obwohl er sich in einer Situation ganz unten befindet, wie die gerade erhaltene Ohrfeige unterstreicht“, sondern er besteht, wie Blank <1288> meint, auch gegenüber dem, der ihn misshandelt hat, „ohne sich provozieren zu lassen noch zu provozieren, einfach und bestimmt auf seinem Recht“.
Wer in diesem Verhalten Jesu (Anm. 273) einen Widerspruch zu Jesu Forderung erblickt, die andere Wange hinzuhalten (Matthäus 5,39 und Lukas 6,29), wird von Martin Luther <1289> folgendermaßen eines Besseren belehrt:
„Da sieh du den Text besser an! Christus spricht nicht: ich will den andern Backen nicht hinhalten. Er hält ja hernach den ganzen Leib hin. […] Den Backen herhalten und mit Worten strafen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ein Christ soll leiden, aber das Wort ist ihm in den Mund gelegt, damit er sage, was unrecht ist. […] Da muß man Hand und Mund von einander scheiden, die Hand mag nachgeben, aber das Maul soll ich nicht hingeben und nicht billigen“.
Nachdem Jesus (W493) sowohl gegenüber Hannas als auch gegenüber dessen Wachmann „das letzte Wort“ behalten hat, kommt erst in Vers 24 „Hannas wieder als handelnde Person in den Blick“, indem von ihm „nur noch vermerkt“ wird, „dass er ‚ihn gefesselt zu Kajafas, dem Hohepriester, sandte‘.“
Noch knapper als auf die vorigen Verse geht Hartwig Thyen (T715) auch auf die Verse 22 bis 24 ein:
Als Jesus das gesagt hatte, gab ihm einer der hohenpriesterlichen Diener, der dabei stand, einen Backenstreich und tadelt ihn wegen seiner ihm wohl allzu freimütig und zu wenig unterwürfig erscheinenden Rede mit der Frage: Redet man etwa so mit dem Hohenpriester? Aber Jesus weicht vor keiner menschlichen Autorität zurück und ebenso freimütig, wie er eben zu Hannas gesprochen hatte, entgegnete er jetzt dem, der ihn geschlagen hat: Wenn ich Böses gesagt haben sollte, dann beweise bitte, daß es Böses war. Habe ich aber die Wahrheit gesagt, warum schlägst du mich dann (ei de kalōs, ti me dereis?). Danach sandte Hannas Jesus gefesselt zu Kaiaphas, dem Hohenpriester.
Ton Veerkamp <1290> beschäftigt sich sehr viel ausführlicher mit der Misshandlung Jesu und beleuchtet ihre Bedeutung im Rahmen des Widerstands gegen ein autokratisches Regime. Er sieht sie zunächst einmal begründet in der selbstbewussten Reaktion Jesu auf die Befragung des Hohenpriesters:
Diese ruhige und gelassene Antwort Jesu entlarvt die ganze Veranstaltung und lässt Hannas in einem lächerlichen Licht erscheinen. Das fällt einem dienstbeflissenen Beamten des Hannas auf. Er schlägt Jesus ins Gesicht und begründet seine Handlung mit Jesu Insubordination. Die Reaktion Jesu soll unsere Empörung wecken. Tatsächlich fordert die Haltung Jesus Gewalt heraus. Die Erzählung über das Verfahren gegen Jesus ist eine zeitlose Erzählung; so erging es allen, die politischen Widerstand gegen ein autokratisches Regime leisteten und deshalb verhaftet wurden. Jesus ist ein politischer Gefangener unter den vielen anderen vor ihm und nach ihm, die keine Chancen hatten, gerecht behandelt zu werden.
Anders als Wengst betrachtet Veerkamp die Verse 22 und 23 nicht unter dem Gesichtspunkt der angeblichen Missachtung des Hohenpriesters im Licht von 2. Mose 22,27. Stattdessen findet er Hintergründe der Misshandlung Jesu, die mit den Worten rapisma und derein ausgedrückt wird, in den biblischen Schriften:
So weit, so gut, hätten wir nicht das Wort rapisma, Schlag ins Gesicht. Das Wort bedeutet eigentlich Peitschenhieb (übers Gesicht). In der griechischen TeNaK-Fassung, der „LXX“, ist das Wort selten. Das entsprechende Verb rapizein begegnet nur dreimal, rapisma selber nur in Jesaja 50,6. Das Verb für schlagen bzw. erschlagen ist im TeNaK nakha. Die LXX hat für dieses Verb vierzig verschiedene Wörter, aber nur zwei werden häufig verwendet, patassein und typtein.
Rapisma, rapizein finden wir in den messianischen Schriften nur in den Passionsberichten von Matthäus (26,67) und Markus (14,65). Die berühmte Stelle in der Bergpredigt 5,39 („Wenn man dich auf die rechte Backe schlägt …“) ist von der Verwendung in der Passion Jesu her zu deuten. Die Stellen bei Matthäus, Markus und Johannes rufen eindeutig eine Passage aus dem zweiten Gesang des „Sklavens des NAMENS“ bei Jesaja auf. Jesaja 50,5ff. lautet:
Mein Herr, der NAME, hat mir das Ohr geöffnet,
Ich war nicht widerspenstig, bin nicht zurückgewichen.
Meinen Rücken gab ich den Schlägern, meine Wangen ihren Fäusten [LXX: eis rapismata],
mein Gesicht habe ich nicht vor Hohn und Spucke verborgen.
Durch die Anspielung auf diesen Gottesknecht, wie er üblicherweise genannt wird, macht Johannes deutlich, welche Rolle Jesus „hier spielen muss“. Indem er sich schlagen lässt, später nochmals in „der Szene mit der Dornenkrone“, ist er der „Sklave des NAMENS“ und verkörpert auf genau diese Weise den befreienden NAMEN des Gottes Israels.
Zum Wort derein, das eigentlich „abhäuten“ bedeutet, schreibt Veerkamp, dass es „in der LXX sehr selten“ ist und „dort nur für das Abhäuten eines Opfertieres gebraucht“ wird. An der Stelle, die er dazu anführt, 3. Mose 1,6, erscheint allerdings das Verb ekderein, wie auch in 2. Chronik 35,11 und Micha 2,8; 3,3, das anscheinend dieselbe Bedeutung hat. Das Wort derein ohne Vorsilbe gibt es in der Septuaginta nur in 2. Chronik 29,34. Später ändert sich der Sinn des Wortes vom Abziehen der Haut in Richtung auf das bildlich gemeinte Gerben der Haut:
In den messianischen Schriften bedeutet es prügeln. Die Apostel haben damit Erfahrung machen müssen (Apostelgeschichte 5,40), und Paulus ließ in seinen Tagen als fanatischer Angehöriger der Peruschim seine Gegner deftig verprügeln (Apostelgeschichte 22,19).
Was der Beamte des Hannas hier tut, interpretiert Veerkamp als unwissende Ausführung einer prophetischen Handlung, die Jesus als den leidenden Gottesknecht kennzeichnet:
Hier fühlt sich der Beamte dazu ermächtigt, einer Ordnungsstrafe des Gerichtes vorzugreifen und sie gleich zu vollstrecken, ohne dass irgend jemand die Aussage Jesu als Verstoß gegen die Würde des Gerichtes gewertet hat. Die Reaktion Jesu beweist das. Ohne es zu wissen, handelt der Scherge des Hannas hier, um auf die Rolle Jesu als „leidenden Sklaven des NAMENS“ hinzuweisen. Der Untersuchungsrichter sieht indessen keine Entlassungsgründe und verweist die Sache an die nächste Instanz. Szenenwechsel.
↑ Johannes 18,25-27: Petrus verleugnet Jesus zwei weitere Male am Kohlenfeuer
18,25 Simon Petrus aber stand da und wärmte sich.
Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger?
Er leugnete aber und sprach: Ich bin‘s nicht.
18,26 Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters,
ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:
Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?
18,27 Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn.
Nach (W493) „der Wegführung Jesu von Hannas zu Kajafas“ erfolgt „wieder ein Bildschnitt“, indem Johannes in Vers 25 „den Blick zurück auf die Situation im Hof“ lenkt, so dass das jetzt Erzählte als gleichzeitig mit dem zuvor Erzählten erscheint:
„Simon Petrus stand da und wärmte sich.“ … „Da sagte man ihm: ,Gehörst vielleicht auch du zu seinen Schülern?‘“ Aus einer unbestimmten Anzahl derjenigen heraus, mit denen er zusammen am Feuer steht, bekommt er fast wörtlich dieselbe einen Verdacht äußernde Frage zu hören, die zuvor schon die türhütende Magd an ihn gerichtet hat.
Im Gegensatz zur dort (W494) „sozusagen nur protokollarisch“ festgestellten verneinenden Antwort des Petrus erfolgt in den Augen von Wengst
jetzt eine Wertung: „Der leugnete und sagte: ,Ich gehöre nicht dazu.‘“ Damit wird deutlich an die Ankündigung Jesu von 13,38 erinnert, dass Simon Petrus ihn dreimal verleugnen werde, bevor ein Hahn kräht. Sich als Schüler Jesu zu verleugnen, was Simon Petrus gegenüber der Türhüterin schon getan hat und jetzt noch einmal tut, ist also gleichbedeutend mit der Verleugnung Jesu. Das heißt für die Zeit des Evangelisten und seiner Leser- und Hörerschaft, dass sich die Zugehörigkeit zu Jesus in der Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde manifestiert, dass nicht zu Jesus gehören kann, wer sich nicht zur Gemeinde hält.
Wengst überträgt also das, was er Petrus hier tun sieht, in der Weise auf das Verlassen der Gemeinde Jesu durch ihre Mitglieder in späterer Zeit, dass er dieses mit seiner offensichtlich als verwerflich gewerteten Verleugnung Jesu identifiziert. Abgesehen von der Frage, ob schon das Wort arneomai {verneinen, bestreiten, leugnen} als solches in jedem Falle eine Wertung impliziert, ist zu fragen, ob sich die Situation des Petrus, wie Johannes sie darstellt, tatsächlich so einfach mit späteren Gemeindesituationen vergleichbar ist.
In den Versen 26 und 27 sieht Wengst die erzählte Situation durch Johannes „dramatisch“ gesteigert:
Einer der Knechte stößt nach. Er wird als Verwandter dessen vorgestellt, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hat. Er stellt seine Frage auch nicht zweifelnd, sondern ist sich ziemlich sicher: „Habe ich dich nicht bei ihm im Garten gesehen?“ Durch den ausdrücklichen Rückbezug auf die Szene im Garten wird auch deutlich, warum Johannes den mit dem Schwert dreinschlagenden Schüler mit Simon Petrus identifiziert: Sein waghalsiges Vorpreschen dort lässt seine Feigheit jetzt in der für ihn bedrohlich werdenden Situation umso schärfer hervortreten. Der Evangelist gibt ihm nicht mehr in direkter Rede das Wort, sondern stellt lediglich wertend fest: „Da leugnete Petrus wiederum“ und beschließt den Abschnitt mit der Angabe: „und sogleich krähte ein Hahn“.
Ohne jeden Zweifel beurteilt Wengst das Verhalten des Petrus hier als „Feigheit“. Allerdings erzählt Johannes nicht wie „die anderen Evangelisten …, dass Petrus sich“ durch den Hahnenschrei „an die ihm gegebene Vorhersage Jesu erinnert und weint. Wichtiger dürfte ihm sein, dass seine Leser- und Hörerschaft sich an dieser Stelle daran erinnert, was Jesus dem Simon Petrus in 13,38 angekündigt hat.“
Hartwig Thyen (T715) verzichtet auch im Blick auf die Verse 25 bis 27 auf eine Auslegung im eigentlichen Sinne und bietet lediglich eine nacherzählende Wiedergabe, die in ihrem einleitenden Nebensatz eine nicht ganz korrekte Angabe enthält, da er unmittelbar zuvor, Vers 24 zitierend, geschrieben hatte: „Danach sandte Hannas Jesus gefesselt zu Kaiaphas, dem Hohenpriester“. In Vers 28 dagegen wird von der Überstellung Jesu von Kaiphas zu Pilatus die Rede sein:
Doch ehe sie Jesus am frühen Morgen wirklich dorthin führen (V. 28), muß der Leser noch einmal nach draußen in den Hof blicken, wo Simon Petrus immer noch unter den Leuten stand und sich wärmte. Und anstelle der Türhüterin fragten die ihn jetzt: „Bist nicht auch du einer seiner Jünger?“ Und wieder leugnete er das mit seinem ouk eimi. Doch einer der Sklaven des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: „Habe ich dich denn etwa nicht im Garten bei ihm gesehen?“ Doch abermals leugnete Petrus und sogleich krähte der Hahn, wie Jesus ihm das 13,38 vorausgesagt hatte.
Ton Veerkamp <1291> beschreibt die zweite und dritte Verleugnung Jesu durch Petrus in einer verständnisvolleren Weise als Wengst, auf dessen Vorwurf der „Feigheit“ er ausdrücklich eingeht:
Simon Petrus wärmt sich und wird zum zweiten Mal als Schüler Jesu erkannt. Simon leugnet. Brenzlig wird die Sache, als ein Verwandter des von Simon verletzten Malchos sagt: „Habe ich dich nicht im Garten mit ihm gesehen?“ Der Verdacht wird jedes Mal in der Form einer Vermutung geäußert. Wegen der Dunkelheit konnte Simon überzeugend leugnen, zumindest konnte er sich so aus der Affäre retten.
Der Hahn kräht. Johannes geht nicht auf den Gemütszustand des Simon ein, anders als Matthäus. Was Simon hier tut, ist keine Glanzvorstellung, aber Johannes erspart sich Vorwürfe. Zu Recht. Jesus hatte nur vorhergesagt, daß Simon ihn dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht und den Morgen des Hinrichtungstages ankündigt. Wer hier, wie Wengst, von Feigheit redet, verfehlt die Pointe. Man muss vielmehr fragen, ob ein offenes Bekenntnis für Jesus in dieser Situation einen politischen Sinn gehabt hätte. Man hätte Simon gleich mit getötet. Im Widerstand war und ist es oberstes Gebot, Mitkämpfer nicht zu belasten, von Selbstbelastung nicht zu reden. Außerdem war Simon nicht feige; sonst hätte er sich im Garten davongemacht. Tatsächlich war er der einzige, der sich mit der Waffe in der Hand der Verhaftung Jesu widersetzt hat.
Wenn man aber die Verleugnung des Petrus nicht als Feigheit, sondern als der Situation angemessene Verhaltensweise beurteilt, worin besteht dann nach Veerkamp ihre tatsächliche Pointe? Kritik wird an Petrus ja auch im Johannesevangelium geübt; die Frage ist nur, worauf diese Kritik letzten Endes hinausläuft:
Für das korrekte Verständnis dieses Textes ist es notwendig, die Erzählung in seinem Kontext zu lesen. Simon Petrus war der unangefochtene Führer einer politischen messianischen Bewegung. Niemand stellte seine Führungsposition in Frage. Gleichwohl hat man nach dem jüdischen Krieg allgemein Kritik an ihm – und das heißt an der politischen Qualität seiner Führung – geübt. Für Paulus war bei Simon das Schwanken zwischen Toratreue und dem Überwinden dieser Treue zugunsten der Treue zum Messias kritikwürdig, Galater 2,11ff. Für Johannes besteht die Kritik an der Führung der Messianisten in ihrem Schwanken zwischen Zelotentum und Verleugnung. Die Erzählung der dreifachen Verleugnung, die in der ganzen messianischen Bewegung verbreitet war, ist bei Johannes eine kritische Bestandsaufnahme der messianischen Bewegung während des judäischen Krieges, die Loyalität zu Simon und harte Kritik an ihm vereint. Szenenwechsel.
Im Klartext heißt das: Nicht die Verleugnung ist das eigentlich Kritikwürdige an Petrus, sondern sein zelotischer Griff zum Schwert. Nicht Feigheit ist ihm vorzuwerfen, sondern gerade sein unerschrockener Einsatz militärischer Mittel in einem aussichtslosen Kampf gegen eine römische Kohorte. Die Peinlichkeit, sich gegenüber der Türhüterin und den Wachleuten am Kohlenfeuer nicht zu Jesus bekennen zu dürfen, wäre also als kluge Zurückhaltung eines Schülers Jesu zu beurteilen, der zu lernen beginnt, sich des zelotischen Überschwangs zu enthalten. In Johannes 21,18 wird sich nach Veerkamp diese Auslegung bestätigen.
So gesehen ist der Unterschied zwischen dem egō eimi Jesu und dem ouk eimi des Petrus bei Johannes nicht in moralisch verwerflichem Sinn als Feigheit vor dem Feind zu begreifen, sondern darauf zu beziehen, dass Petrus nun einmal tatsächlich nicht von Gott die Aufgabe übertragen bekommen hat, seinen befreienden NAMEN zu verkörpern und als solcher in seinem Tod am römischen Kreuz die Weltordnung zu überwinden und die Inspiration des NAMENS zu übergeben (19,30), damit seine Schülerinnen und Schüler sie empfangen und weitergeben können (20,17.22). Diese Aufgabe hat Gott nach Johannes allein dem Messias Jesus übertragen. Dass zu gegebener Zeit auch Petrus in eine Situation geraten kann, in der ein mutiges Bekenntnis erforderlich ist, das ihn das Leben kosten kann, steht auf einem anderen Blatt, von dem in Johannes 21,19 die Rede sein wird.
↑ Johannes 18,28a: Die Überführung Jesu von Kaiphas vor das Prätorium
18,28a Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium…
[2. Januar 2023] Für Ton Veerkamp <1292> gehört der erste Satz von Vers 28 noch als dessen Abschluss zum johanneischen Kapitel „Es war aber Nacht…“. Wie das Verhör Jesu durch Hannas von den beiden Szenen der Verleugnung des Petrus umschlossen und so deren Gleichzeitigkeit angedeutet wird, wird diese Gesamtszene im Palast des Hohenpriesters von der Darstellung der verschiedenen Instanzen umschlossen, denen Jesus nach seiner Festnahme vorgeführt wird:
Die vorletzte Instanz ist Kaiphas, der amtierende Großpriester. Von ihm hat Jesus nichts zu erwarten. Für Kaiphas war der Tod Jesu ein notwendiges politisches Opfer. Er hat die Sache gleich an die Zuständigkeit der Römer verwiesen.
Eingehend beschäftigt sich Veerkamp mit der Frage, wer eigentlich ganz genau die Akteure sind, die Jesus an den römischen Statthalter ausliefern und in der folgenden Szene mit Pilatus verhandeln werden:
Sie brachten ihn ins Prätorium, dem Verwaltungssitz des Prokurators der Provinz Jehuda. Sie: die Polizeigruppe und diejenigen, die beim Verhör durch Hannas und Kaiphas anwesend waren. Sie sind die Judäer der folgenden Abschnitte. Es handelt sich dabei um ganz bestimmte Judäer; für das Verständnis dessen, was folgt, ist dieses sie von entscheidender Bedeutung. Die Peruschim {Pharisäer} sind nicht dabei, auch nicht die Menge, die darüber streitet, ob Jesus der Messias war oder nicht. Vor dem Prätorium ist keine Menge (ochlos). Es sind ganz bestimmte Mitglieder des Volkes, die Jesus am Kreuz sehen wollen. Johannes war kein Antijudaist, gar Antisemit! Er war sehr wohl ein Feind der judäischen Führung und ihrer Trabanten.
Für Klaus Wengst (W497) setzt bereits mit dem Beginn von Vers 28 ein neuer Abschnitt ein, indem nach der „Verleugnung des Petrus … wieder Jesus in den Blick“ genommen wird: „Nun brachte man Jesus von Kajafas ins Prätorium.“ Auch Wengst interessiert sich für das „Subjekt des Überbringens“, das „nicht eigens genannt“ wird, und erschließt „aus dem Zusammenhang“, dass es sich um „vom Hohepriester Kajafas beauftragte Oberpriester samt Wachmannschaft“ handelt:
Sie bringen Jesus zum Prätorium, der Residenz des Statthalters der Provinz Judäa, während er sich in Jerusalem aufhält. Normalerweise residierte er in Cäsarea am Meer, kam aber zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem, wo wegen der großen Menschenansammlung besondere Vorsichtsmaßnahmen geboten waren. Zugleich gab ihm das Gelegenheit, dort Gericht zu halten. Als Residenz nutzte er den Herodespalast.
Ähnlich beschreibt Hartwig Thyen den Ort, wohin Jesus überführt wird (T716f.):
Seit Judäa im Jahre 6 n. Chr. römische Provinz geworden war, residierten die Statthalter Roms als Präfekten und/oder Procuratoren in Caesarea. Wenn sie von dort zeitweilig nach Jerusalem kamen, diente ihnen der an der westlichen Stadtmauer Jerusalems nahe beim Gennath-Tor gelegene einstige Palast der Hasmonäer, den Herodes der Große prächtig ausgebaut und mit drei mächtigen Türmen versehen hatte …, als Amtssitz, der mit dem griechischen Lehnwort als das praitōrion (praetorium) bezeichnet wurde …
Um Jesu Überführung von Kaiphas zu Pilatus ebenso wie die zuvor erfolgte Überstellung Jesu von Hannas zu Kaiphas zeitlich einzuordnen, nutzt Thyen die allerdings erst im zweiten Satz des Verses 28 auftauchende Zeitangabe: ēn de prōï {es war aber frühmorgens}. Um diese Zeit am Rüsttag zum Passafest geschieht ihm zufolge beides, also am
frühen Morgen (prōï) … Da läßt Hannas Jesus zu Kaiaphas, dem Hohenpriester, bringen, auf dessen Anordung er unverzüglich in das Prätorium überführt und vor Pilatus als seinen Richter gestellt wird.
Für Ton Veerkamp, wie gesagt, haben die Zeitangaben bei Johannes seit dem Kapitel 13 jedoch genau an der Stelle, an der sie stehen, eine gliedernde und damit auch inhaltliche Bedeutung. Wenn das zutrifft, ist es durchaus von Belang, dass erst nach der Überführung Jesu zum Prätorium die Nacht des Messias zu Ende geht und der Morgen anbricht.
↑ Frühmorgens: Jesus in der Konfrontation mit Pilatus und der priesterlichen Führung Judäas (Johannes 18,28b-19,13)
[3. Januar 2023] Was genau beginnt nun aber nach Johannes mit dem Aufgang der Sonne am Rüsttag zum Passafest, den wir den Karfreitag nennen? Nach Ton Veerkamp <1293> setzt erst hier die „eigentliche Passionserzählung, 18,28b-19,42“ ein. Sie
hat zwei Teile, gegliedert durch zwei Zeitpunkte: „Frühmorgens“ und „Es war ˁerev pascha, ungefähr die sechste Stunde.“ Der erste Teil beginnt mit der offenen Bloßstellung der Weltmacht, 18,28b-19,13. … Der zweite Teil der Passionserzählung, 19,14-42, beantwortet die Frage, wer der König Israels ist, und erzählt, wie der König stirbt und begraben wird.
Nach Veerkamp deutet Johannes das Sterben Jesu am römischen Kreuz also in doppelter Weise ausdrücklich im Licht des nun anbrechenden Tages: erstens, indem er der römischen globalen Versklavungsordnung schonungslos die Maske ihrer Wohlgeordnetheit und Friedfertigkeit als pax Romana vom Gesicht reißt, und zweitens, indem er die priesterliche Führung Judäas endgültig als Handlanger des römischen Widersachers des Gottes Israels entlarvt, als sie dem Kaiser als ihrem einzigen König huldigen und die Kreuzigung ihres toragemäßen Königs Jesus fordern.
Das heißt: Es kann keine Rede davon sein, dass Johannes ein antijüdisches Evangelium geschrieben habe. Vielmehr ist Johannes ein glühender Anhänger des Messias Jesus, der in seinen Augen angetreten ist, um diese Welt, diesen kosmos, diese römische Welt(un)ordnung, zu überwinden und dadurch das Leben der kommenden Weltzeit für Israel heraufzuführen. Was Johannes einfach nicht fassen kann, ist die Tatsache, dass die priesterliche Führung Judäas diesen Messias nicht anerkennt, sondern stattdessen mit Rom zusammenarbeitet und von Rom sogar die Verurteilung des Messias fordert.
Um dieses komplexe System von gegensätzlichen gesellschaftlichen Kräften in Judäa zu deuten, greift Veerkamp auf Begrifflichkeiten des marxistischen Philosophen Louis Althusser <1294> zurück:
Wenn irgendwo, dann zeigt sich dort die „Widerspruchstruktur mit Dominante“ (Althusser). Die Dominante ist der Widerspruch zwischen Jesus und Pilatus bzw. Rom. Sie dominiert die Gegnerschaft zwischen Judäern, hier von den führenden Priestern vertreten – die Peruschim {Pharisäer} spielen keine Rolle mehr -, und dem Messias Jesus.
Man mag den Marxismus für ein inzwischen überholtes Modell der Gesellschaftsanalyse und des gesellschaftlichen Wandels halten. Veerkamp ist der Überzeugung, dass das nur für die dogmatisch verhärteten und totalitär missbrauchten Formen gilt, in denen er in der realen Politik so gut wie überall gescheitert ist.
Ebenso vertritt Veerkamp die realistische Einschätzung, dass der Evangelist Johannes mit seiner Proklamation der Überwindung der römischen Weltordnung durch den Messias Jesus auch unter den damals herrschenden Bedingungen scheitern musste, so dass aus einer revolutionären jüdisch-messianischen Bewegung schließlich die heidenchristlich dominierte christliche Kirche wurde, die schon bald das Ziel der Befreiung Israels inmitten der Völker aufgab und stattdessen als ein neues „wahres Israel“ <1295> das Judentum all seiner religiösen Heilsgüter zu enterben trachtete.
Klaus Wengst (W495) betont zu Beginn seiner Beschäftigung mit dem Teil der Passionsgeschichte, den Johannes ab 18,28 bietet, dass er „eine Entsprechung in den synoptischen Evangelien (Mt 27,1-30; Mk 15,1-19; Lk 23,1-25)“ hat. Daraus ergibt sich (W496), „dass Johannes auf ihm überlieferte Tradition zurückgegriffen, zugleich aber, dass er sie sehr eigenständig ausgestaltet hat.“ So lässt Johannes nach der auch von Markus berichteten „Übergabe Jesu an Pilatus (Mk 15,1) … die jüdischen Ankläger vor dem Prätorium stehenbleiben, was dazu führt, dass Pilatus ständig hin und her gehen muss.“ Das bei Markus nur knapp dargestellte „Verhör Jesu durch Pilatus (Mk 15,2-5)“ weitet Johannes erheblich aus, während er die „bei Markus breit ausgestaltet[e]“ Szene mit Jesus und Barabbas (Mk 15,6-14) kürzer fasst. Weitere Unterschiede finden sich im Zusammenhang mit der Verurteilung sowie der „Auspeitschung und Verspottung Jesu“. Insgesamt bietet Johannes in den Augen von Wengst zum Prozess vor Pilatus
eine bewegte und bewegende, eine eindrucksvolle Szenenfolge … In ihr werden, bevor sich die Situation in der Verurteilung Jesu zuspitzt und auflöst, die entscheidenden Akteure der Handlung prägnant herausgearbeitet und zueinander in Beziehung gesetzt: Pilatus als der Richter, die jüdischen Ankläger und Jesus als der Angeklagte. Der Richter Pilatus erscheint als ein weltmännischer Spötter und vor allem als Zyniker der Macht, der sich schließlich als Gefangener der eigenen Macht erweist. Dass dieser hohe Herr ständig zwischen den Anklägern und dem Angeklagten hin und her gehen muss, gibt ihm zugleich einen Zug von Lächerlichkeit. Die jüdischen Vertreter der Anklage werden als Menschen dargestellt, die in ihrer Ablehnung Jesu alle Mittel dafür einsetzen, dass es zu einer Verurteilung komme, und sich dafür zu einem Bekenntnis zum Kaiser als ihrem einzigen König hinreißen lassen. Der angeklagte Jesus schließlich, ein geschundener Mensch, wird in seiner Ohnmacht als König verspottet und tritt doch als der wahre König auf.
Im Blick auf „die jüdischen Ankläger“ betont Wengst, dass Johannes trotz seiner mehrfachen Rede von „den Juden“ (18,31.38; 19,7.12.14) „doch nur bestimmte Juden im Blick“ hat:
Sie macht er in 19,6 ausdrücklich kenntlich als „die Oberpriester und die Leute“ und in 19,15 als allein „die Oberpriester“. An sie denkt er schon bei dem unbestimmten „man/sie“ in 18,28 als Überbringer Jesu von Kajafas zum Prätorium, Sie sind Beauftragte des Hohepriesters, Oberpriester als Vertreter der Anklage. Dem entspricht es, wenn Pilatus in 18,35 zu Jesus sagt: „Dein Volk und die Oberpriester haben dich mir übergeben.“ Das „und“ ist epexegetisch zu verstehen: „und zwar“. Denn dass das ganze Volk auftrete, erzählt Johannes nicht.
Insofern ist für Vers 19,6 die übersetzende Formulierung „die Oberpriester und die Leute“ auch nicht ganz korrekt; dort steht ja im Griechischen nicht das Wort ochlos {Volksmenge oder Leute}, sondern hypēretai, was Wengst (W495) in seiner zuvor gebotenen Übersetzung des Textes auch angemessen mit „Wachleute“ wiedergibt. Überhaupt deutet Johannes nach Wengst (W497) in der gesamten Passionsgeschichte „nichts von einer ‚Menge‘ an; nach ihm kommen ‚viele aus der jüdischen Bevölkerung‘ erst hinzu, als Jesus schon am Kreuz hängt (19,20).“ Das heißt: „Für Pilatus wird das Volk durch die im Auftrag des Hohepriesters handelnden Oberpriester repräsentiert: Es ist daher unangemessen, in der Auslegung von Joh 18,28-19,16a pauschal von ‚den Juden‘ zu reden.“
Zur „Einteilung der von Johannes geschaffenen Szenenfolge“ nutzt Wengst seinen Blick auf den „wechselnden Schauplatz im Prätorium und vor ihm“ mit den „jeweils beteiligten Akteuren“:
a) Einleitung: Überstellung Jesu ins Prätorium (18,28)
b) Ankläger und Richter: die Anklage (18,29-32)
c) Richter und Angeklagter: die Frage der Wahrheit (18,33-38a)
d) Ankläger und Richter: nicht Jesus, sondern Barabbas (18,38b-40)
e) Der Angeklagte: Auspeitschung und Verspottung (19,1-3)
f) Richter, Ankläger, Angeklagter: die Vorführung (19,4-7)
g) Richter und Angeklagter: die Frage der Macht (19,8-11)
h) Ankläger und Richter: die Schwäche des Mächtigen (19,12)
i) Richter, Ankläger, Angeklagter: die Verurteilung (19,13-16a)
Zur Szene e), „in der der Angeklagte allein – ohne Ankläger und Richter – auftritt“, schreibt Wengst, dass sie „genau in der Mitte [steht] (19,1-3): Der zutiefst Erniedrigte und zum Spottkönig Gemachte, gerade er, ist doch der König.“ Ganz allein ist Jesus allerdings nicht, er ist den Soldaten ausgeliefert, die ihren Spott mit ihm treiben.
Indem Wengst darauf hinweist, dass „die letzte Szene {i)} durch die genaue Ortsangabe und eine – nach 18,28 – erneute Zeitangabe“ hervorgehoben wird, macht er zugleich deutlich, dass er diese Zeitangabe nicht wie Veerkamp als Signal für die Eröffnung einer neuen Szene betrachtet. In seinen Augen beginnt die neue Szene erst in dem Augenblick, als der Prozess mit dem Urteilsspruch gegen Jesus beendet ist und er zur Kreuzigung abgeführt wird. Damit mag er, wovon Veerkamp überzeugt ist, die Gliederungsabsichten des Johannes verkennen und übersehen, worum es Johannes geht, wenn er die neue Szene bereits in 19,14 einsetzen lässt.
Hartwig Thyen verzichtet zu Beginn seiner Beschäftigung mit dem Prozess Jesu vor Pilatus auf längere einführende Bemerkungen, äußert sich aber, indem er auf Vers 3 zurückblickt, nochmals über die Zeit der Festnahme Jesu (T717):
Jesu Festnahme im Dunkel der Nacht illustriert der Erzähler trefflich dadurch, daß er die zu seiner Verhaftung Ausgesandten mit Fackeln und Laternen ausrüstet. Nach jüdischer Zeitrechnung beginnt der neue Tag stets nach dem Sonnenuntergang des Vortages mit dem Einbruch der Nacht. Danach wurde Jesus nach Johannes also zu Beginn jenes Tages verhaftet, der paraskeuē {Rüsttag} heißt, weil er der Zurüstung des Passafestes diente. Während Petrus seinen Herrn in dieser Nacht der paraskeuē draußen im Hof dreimal verleugnete, befragte Hannas ihn drinnen nach seiner Lehre und seinen Jüngern. Der dieser Nacht folgende Tag der paraskeuē ist wesentlich durch die rituelle Schlachtung der Passalämmer bestimmt, mit der Johannes Jesu Tod als das Sterben des Gotteslammes, das der Welt Sünde beseitigt (1,29), absichtsvoll synchronisiert. Erst nachdem die Sonne an diesem Rüsttag untergegangen ist, wird dann mit dem festlichen Verzehr dieser Lämmer das hohe Passafest beginnen.
Mit dem Sonnenaufgang dieses Tages beginnen also nun die Verhandlungen der Priester mit Pilatus über die Verurteilung Jesu.
↑ Johannes 18,28b: Am frühen Morgen gehen die Ankläger Jesu nicht ins Prätorium, um sich nicht unrein zu machen
18,28b [E]s war aber früh am Morgen.
Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium,
damit sie nicht unrein würden,
sondern das Passamahl essen könnten.
[4. Januar 2023] Im Rahmen seiner Auslegung von Johannes 18,28b (W497) schreibt Klaus Wengst zur Zeitangabe: „Es war früh am Morgen“, dass damit „der neue Abschnitt unmittelbar an den vorangehenden“ anschließt: „Dort war am Schluss ein Hahnenschrei genannt“. Das stimmt aber, wie gesagt, nicht ganz, denn dazwischen steht noch der Satz in Vers 18,a, der Jesu Überstellung von Kaiphas zum Prätorium vermerkt. Abgesehen davon sieht auch Wengst in dieser Zeitangabe „ein Signal zur Gliederung“:
Nach der Festnahme in der Nacht und dem, was mit ihr verbunden war, folgt nun als zweiter Teil bis zum Mittag der Prozess vor Pilatus. Der Beginn von Gerichtsverhandlungen am frühen Morgen war bei römischen Statthaltern üblich.
Während offenbar „Jesus als der Angeklagte ins Prätorium hineingeführt wird“, heißt es nun aber von denjenigen,
die ihn zum Prätorium brachten …: „Sie aber gingen nicht ins Prätorium hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Pessachlamm essen könnten.“ Die Wendung – so wörtlich – „das Pessach essen“ meint näherhin das Essen des Pessachlammes (vgl. 2. Chr 30,18 und im Neuen Testament Mt 26,17f.; Mk 14,12.14; Lk 22,11.15). Das muss im Zustand kultischer Reinheit geschehen. … Häuser von Nichtjuden standen im Verdacht, dass in ihnen Fehlgeburten begraben sein könnten. Sie zu betreten, würde daher Totenunreinheit bewirken und also für sieben Tage unrein machen (Num 19,14). Damit hat Johannes die Voraussetzung genannt, die es erforderlich macht, dass Pilatus im Folgenden ständig zwischen Jesus im Prätorium und seinen Anklägern vor dem Prätorium hin und her geht.
Dass (Anm. 282) ein „Statthalter vor seiner Residenz Gericht“ halten konnte, beschreibt Wengst zufolge
– bezogen auf den Prokurator Florus – auch Josephus: <1296> „Florus, der damals im Königspalast abgestiegen war, ließ am nächsten Tag vor dem Palast den Richterstuhl aufstellen und nahm darauf Platz; die Hohenpriester, die Vornehmen und überhaupt die Angesehensten der Bürgerschaft kamen herbei und stellten sich vor dem Richterstuhl auf“.
Die traditionelle Auslegung von Johannes 18,28 erfolgt nach Wengst (W499) „bis in die Gegenwart“ auf einer Linie, „die das Achten auf Reinheitsvorschriften antijüdisch akzentuiert“. Dazu zitiert er Calvin, Luther, Schenke und Dietzfelbinger. <1297>
Calvin erkennt zwar zunächst „die Gottesfurcht“ der Ankläger Jesu an, aber dann
schlägt er umso heftiger zu und schreibt u. a.: „Jene Heuchler aber meinen, ihnen drohe Gefahr nur von äußerer Verunreinigung! Dabei sind sie voller Bosheit, Ehrgeiz, Hinterlist, Grausamkeit und Habgier und vergiften beinah Himmel und Erde mit ihrem Gestank.“
Martin Luther zieht mit ähnlichen Beschimpfungen vom Leder:
[…] sie haben sich so heilig gestellt, daß sie nicht einmal in Pilatus Haus hineingehen wollten, um sich nicht zu beflecken und die lieben Osterfladen essen zu können. […] Aber daß sie Gottes Sohn kreuzigten, das war keine Sünde, sondern Heiligkeit! Da habt ihr die Juden recht und frei abgemalt. So tun die falschen Heuchler: ein klein Stücklein Heiligkeit wenden sie vor, und darnach durchbrechen sie alle 10 Gebote!“
In der Wortwahl etwas weniger aggressiv argumentiert heute Ludger Schenke:
„Sie tragen Mordgedanken im Herzen, sorgen sich aber um ihre kultische Reinheit! Sie legen Wert darauf, das jüdische Paschalamm zu essen, das jedoch nur ein Hinweis auf das echte Paschalamm Jesus ist […], ,das die Sünden der Welt wegträgt‘, also wirklich Reinheit vor Gott erbringt“.
Damit setzt Schenke voraus, dass schon Johannes das Essen des Passalammes als überholtes jüdisches Ritual angesehen hätte, ebenso wie Christian Dietzfelbinger:
„Es ist die kultische Korrektheit der ,Juden‘, die sie vom Hören der in Jesus geschehenen Offenbarung ausschließt. Man verkennt Jesus als das wahre Passalamm und hält an dem durch Jesus überholten Passabrauch fest, und damit versäumt man die wahre, in Jesus gewährte Befreiung (8,36)“.
In dieser Auslegungstradition fallen Wengst vor allem folgende drei Punkte auf:
die Pauschalisierung der vor dem Prätorium Stehenden zu „den Juden“, das Abqualifizieren ihres Achtens auf die Reinheitsvorschriften als ritualistisch und das Einschätzen ihrer Pessachfeier als überholt. Hier wirkt die in einer langen Auslegungsgeschichte eingeübte Perspektive der Völkerkirche in ihrer Abgrenzung vom Judentum sozusagen hinter dem Rücken der Ausleger und lässt sie in aller Selbstverständlichkeit voraussetzen, dass auch Johannes schon diese Perspektive gehabt habe. Aber warum sollte ein Jude oder eine Jüdin des ersten Jahrhunderts – selbst gegen dessen Ende hin -, die an Jesus als Messias glaubten, auf den Gedanken kommen, die Feier von Pessach und also die Erinnerung daran, dass Gott Israel aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat, sei überholt? Warum sollten jüdische Messiasgläubige damals nicht die für diese Feier überlieferten Vorschriften einhalten?
Wengst gesteht zwar zu, dass „der Text – rein literarisch für sich betrachtet – die Möglichkeit enthält, die Pessachlämmer samt dem mit ihnen verbundenen Fest und Jesus als endzeitliches Pessachlamm in eine antithetische Beziehung zueinander zu setzen“, aber er hält es für
äußerst fraglich, ob Johannes diese Möglichkeit im Auge hatte. Er gibt dafür keinerlei Signal. Die Annahme reicht völlig aus, dass er mit dieser Angabe die Szenerie der „zwei Bühnen“ erreichen wollte. Überhaupt keine Frage ist es mir allerdings, dass die eben genannte Möglichkeit der Auslegung im Hören auf jüdisches Selbstverständnis und im Blick auf die antijüdische Wirkungsgeschichte nicht mehr aktualisiert werden sollte.
Hartwig Thyen (T717) geht nur knapp darauf ein, dass „die Juden“ an „diese[m] heilige[n] Tag“ des Rüsttages zum Passafest,
mit dessen Sonnenuntergang das feierliche Passamahl das Fest eröffnen soll, … draußen vor dem Prätorium stehen [bleiben], um sich in diesem heidnischen Haus nicht zu verunreinigen und sich damit von der Teilnahme an ihrem hohen Fest auszuschließen.
Dass im Johannesevangelium „anders als in der synoptischen Chronologie“ der „Verzehr des Passalammes … am Abend dieses Tage noch bevorsteht“, geht nach Thyen
aus unserem Evangelium völlig eindeutig hervor (s. u. 19,31ff mit dem entsprechenden Zitat Ex 12,46 …). … Zugleich führt der Evangelist mit der Wendung alla phagōsin to pascha {sondern das Passamahl essen könnten} erneut das schon in 1,29.36 deutlich benannte Thema seiner Passatheologie ein …
Auf eine historische Einordnung der chronologischen Angaben des Johannesevangeliums verzichtet Thyen ausdrücklich:
Da wir hier mit der Kommentierung des Johannesevangeliums als eines literarischen Textes befaßt sind, braucht die schwierige und strittige historische Frage, ob Jesus, wie Johannes erzählt, am 14. Nisan, der paraskeuē {Rüsttag} des Passafestes, verurteilt und hingerichtet wurde, oder ob sein Prozeß und seine Kreuzigung der synoptischen Chronologie entsprechend am 15. Nisan, dem ersten und gewichtigsten Tag des Passafestes, stattfanden, hier nicht entschieden zu werden.
Für Ton Veerkamp <1298> ist mit der Überstellung Jesu zum Prätorium und der Zeitangabe ēn de prōï {es war aber frühmorgens} die
Nacht des Messias, des Verrats, des Abschieds, der Gefangennahme und des Verhörs … vorbei. Ab jetzt ist Jesus nur auf sich gestellt. Dieser Abschnitt ist so konstruiert, dass Jesus und der Prokurator im Gebäude, seine gegnerischen Landsleute, die Judäer und speziell die führenden Priester, vor dem Gebäude sind.
Als Grund für diese Konstruktion gibt Johannes nur an, das „Betreten des Prätoriums mache unrein“. Veerkamp lehnt es ab, aus „diesem Satz eine allgemeine Regel herzuleiten, nach der das Betreten jedes Gebäudes der Gojim {Nichtjuden} unrein macht“. Zwar bestätigen Mischnastellen wie (Anm. 513)
Mischna Ohalot 18,7-10 … die Unreinheit der Häuser der Gojim, nicht aber das Ausmaß der Unreinheit. Ein geringeres Maß an Unreinheit konnte durch ein Reinigungsritual vor dem Abend aufgehoben werden. Bei solchen Feinheiten hält sich Johannes nicht lange auf.
Im Blick auf den Prozess Jesu vor Pilatus ergibt sich aus dem Reinheitsthema eine ganz besondere Konstellation der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen in ihren gegensätzlichen Interessen:
Für die führenden Priester ist das Prätorium off limits {nicht erlaubt}; ein Judäer macht sich unrein, wenn er die Schwelle des Prätoriums überschreitet. Jesus dagegen ist in ihren Augen schon ein Unreiner, er sei kein Kind Israels mehr. Die Verweigerung, das Prätorium zu betreten, schafft eine politische Distanz zwischen ihnen und der römischen Behörde andererseits. Johannes hat eine politisch durchdachte Dramaturgie. Der Hauptwiderspruch ist und bleibt der zwischen Rom und dem judäischen Volk. Indem sie nun – formal auf ihre Reinheit und so auf die Distanz achtend – Pilatus für die Eliminierung eines Juden instrumentalisieren, werden sie jede Distanz zu Rom aufgeben müssen: „Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar.“ Ihre formale Distanz wird durch das politische Bekenntnis zum Cäsar Lügen gestraft. Nicht Jesus wird aus Israel ausgeschlossen, sie werden sich selbst aus Israel ausschließen. Bevor es soweit ist, muss noch einiges geschehen.
Damit eröffnet Veerkamp zusätzlich zu den von Wengst dargestellten Möglichkeiten, den Vers 28 entweder antijüdisch auszulegen oder im Sinne einer nicht aufgegebenen Wertschätzung des jüdischen Passamahls, eine weitere Deutungsalternative. Auch in seiner Anm. 512 zur Übersetzung von Johannes 18,28 stellt er klar, dass im Hinweis auf die beabsichtigte Teilnahme der jüdischen Ankläger Jesu am Passamahl durchaus scharfe Kritik impliziert sein kann, die aber nicht im Sinne einer pauschalen Ablehnung des Passa als ritualistisch oder überholt zu verstehen sein muss:
Dieser Vers bietet einen von Johannes beabsichtigten Kontrast zur politischen Komplizenschaft mit der römischen Behörde am Ende des Abschnitts in 19,15.
Vorausgesetzt ist dabei, dass nicht das Judentum und seine Rituale durch Jesu Tod am Kreuz überholt werden, sondern dass die führende judäische Priesterschaft, wie Johannes sie darstellt, den Messias des eigenen Volkes an die römische Weltordnung ausliefert und dass genau dadurch der Messias den Grund dafür legt, dass in der Zukunft das Passa als Fest der Befreiung Israels von der weltweiten Versklavung wieder im vollen Sinn gefeiert werden kann.
↑ Johannes 18,29-32: Zuständigkeitsgerangel zwischen Pilatus und Jesu Anklägern
18,29 Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen?
18,30 Sie antworteten und sprachen zu ihm:
Wäre dieser nicht ein Übeltäter,
wir hätten dir ihn nicht überantwortet.
18,31 Da sprach Pilatus zu ihnen:
So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Da sprachen die Juden zu ihm:
Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten.
18,32 So sollte das Wort Jesu erfüllt werden,
das er gesagt hatte, um anzuzeigen,
welchen Todes er sterben würde.
[5. Januar 2023] Im Abschnitt 18,29-32 treffen Klaus Wengst (W499) zufolge „die Ankläger und der Richter erstmals zusammen“. Obwohl schon in der nächsten Szene „ganz selbstverständlich eine klare politische Anklage“ vorausgesetzt wird, lässt Johannes (W499f.)
die Ankläger hier ganz anders sprechen. Sie geben keine klare Antwort, sondern wollen in dem bloßen Umstand, dass sie Jesus an Pilatus überstellten, einen hinreichenden Erweis dessen erkannt sehen, dass er ein Übeltäter sei. Warum stellt Johannes so eigenartig dar? Er hat hier ein doppeltes Interesse. Einmal will er deutlich machen, dass Jesus unschuldig ist. So lässt er von vornherein die Anklage als nicht stichhaltig erscheinen. Damit charakterisiert er zugleich – hier und im Folgenden – die Ankläger als solche, die vehement die Verurteilung des Angeklagten durch den Richter betreiben und so dessen Hinrichtung erreichen wollen. Zum anderen stellt er heraus, dass sich genau damit Jesu Wort von seiner Erhöhung erfüllt. Die diesbezügliche kommentierende Bemerkung in V. 32 ist der Zielpunkt dieser Szene.
In Vers 29 fällt auf (W500), dass Pilatus, der hier „in der Erzählung des Evangeliums zum ersten Mal“ auftritt, „bei der Leser- und Hörerschaft als bekannt“ vorausgesetzt wird. Zur Person des „Pontius Pilatus“ erwähnt Wengst unter anderem, dass er „von 26-36 n. Chr. Statthalter der Provinz Judäa“ war und „den Titel ‚Präfekt‘ trug“. Der jüdische Philosoph und Theologe Philon <1299> charakterisierte ihn
als „von Natur starrsinnig, von anmaßendem Trotz und unversöhnlich“ und als „argwöhnisch und aufbrausend“. Im Blick auf dessen Amtsführung nennt er „die Fälle von Bestechung, von Gewalttätigkeit und von Beraubung, die Misshandlungen, die Einschüchterungen, die Morde in schneller Folge und ohne Urteil und Recht sowie die unsagbare und außerordentlich schlimme Rohheit“.
Auf die Frage des Pilatus, die er den vor dem Prätorium stehenden Anklägern stellt: „Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor?“, schreibt Johannes in Vers 30 (W501)
den Anklägern die Aussage zu: „Wenn der kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn nicht an dich ausgeliefert.“ Die Übergabe selbst soll als Beweis ausreichen. Auf eine so vage Aussage hin lässt Johannes Pilatus das Verfahren an die jüdische Seite zurückverweisen: „Nehmt ihr ihn und richtet ihn eurem Gesetz gemäß!“
Damit scheint in Vers 31 „diese Möglichkeit der Rückverweisung einen Augenblick lang“ auf, aber nach Wengst ohne den geringsten Anhalt an einer historischen Wahrscheinlichkeit, denn (Anm. 284) einen „politisch Angeklagten hätte ein römischer Statthalter nicht ohne eigene Untersuchung aus der Hand gegeben.“ Johannes jedenfalls will (W501)
in der folgenden Antwort der Ankläger herauszustellen, worin er ihre eigentliche Absicht erblickt: „Wir sind nicht befugt, irgendjemanden hinzurichten.“ Das Verfahren muss bei Pilatus bleiben, damit es zur Kreuzigung Jesu komme.
Ausführlich beschäftigt sich Wengst mit der Frage, ob „die jüdische Selbstverwaltung unter römischer Herrschaft die Kapitalgerichtsbarkeit“ hatte. Er neigt zu der Auffassung, „dass die Angabe von Joh 18,31 historisch im Recht ist“. Insbesondere können ihm zufolge (W502) die in der Bibel
überlieferten Fälle von Hinrichtungen … den Beweis nicht tragen, die Selbstverwaltung habe unter römischer Herrschaft die Kapitalgerichtsbarkeit gehabt: a) Die in Joh 7,53-8,11 erzählte beabsichtigte Steinigung einer Ehebrecherin hat keinerlei historischen Wert (vgl. die Auslegung z. St.). b) Die Erzählung von der Steinigung des Stephanus spricht zwar davon, dass er vor das Synhedrium geführt wurde (Apg 6,12-7,2), aber von einem Urteil verlautet nichts. Die Schilderung der Steinigung lässt viel eher an eine tumultuarische Lynchjustiz denken (Apg 7,54-59). c) Die Hinrichtung des Zebedaiden Jakobus wurde, wie ausdrücklich festgestellt wird, durch König Herodes Agrippa I. veranlasst (Apg 12,1f.), als das Land Israel für kurze Zeit (41-44 n. Chr.) nicht unter direkter römischer Herrschaft stand.
In Vers 32 stellt Johannes mit „einer kommentierenden Bemerkung“ klar, warum
das Verfahren gegen Jesus bei Pilatus bleiben und es also zur Kreuzigung Jesu kommen muss: „Es sollte das Wort Jesu ausgeführt werden, das er gesagt hatte um anzuzeigen, durch welchen Tod er sterben würde.“ An der – schon in 18,9 gebrauchten – einleitenden Formulierung wird deutlich, dass das Wort Jesu die Qualität des Schriftwortes gewonnen hat. … Mit seiner Formulierung erinnert Johannes vor allem an 12,32-34, aber damit auch an die übrigen Stellen, die vom „Erhöhtwerden“ und „Erhöhen“ sprechen (3,14; 8,28). Damit gibt er zu verstehen, dass die nun unvermeidlich kommende Kreuzigung Jesu nicht blindes Schicksal ist. Jesus hat sie nicht nur schon im Blick gehabt, sondern sie ist zugleich auch seine „Erhöhung“: Gerade hier wird sich Gott als lebendiger und Leben schaffender Gott erweisen.
Nach Hartwig Thyen (T717) „darf man vermuten, daß Johannes Pilatus über den Fall Jesu informiert und mit dessen Festnahme nicht nur einverstanden denkt“, weil ja „die Kohorte mit ihrem Chiliarchen am Vorabend sicher nicht ohne Befehl von oben zur Festnahme Jesu ausgezogen war“. Daher ist in seinen Augen in Vers 29
seine Frage an die Juden als Zeugen in diesem Prozeß: ,Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?‘, wohl mehr eine formale Prozeßeröffnung und schwerlich dem bloßen Informationsbedürfnis des Präfekten entsprungen.
In der Erwähnung des Pilatus ohne jede kommentierende Einführung ist nach Thyen „wiederum deutlich erkennbar, daß Johannes bei seinen Lesern/Hörern die Kenntnis seiner synoptischen Prätexte voraussetzt.“
Nachdem (T718) in Vers 30 „die Juden Jesus einfach als Übeltäter bezeichnen“ und „Pilatus so die Antwort auf seine Frage schuldig“ bleiben, „wegen welcher konkreten Übeltat sie Jesus denn anklagen“, stellt Thyen im Blick auf Vers 31 die Frage: „Wie ist die Antwort des Pilatus darauf zu verstehen?“ Kann es denn sein, dass Pilatus
nun erst durch ihre Antwort, daß es ihnen doch von Roms Macht verboten sei, an einem Angeklagten die Todesstrafe zu vollstrecken … [erfährt], daß sie Jesus eines todeswürdigen Delikts für schuldig halten und ihn deshalb an Pilatus ausgeliefert haben?
Nach Thyen (T719) muss der Satz des Pilatus: „Nehmt ihr ihn doch mit und richtet ihn nach eurem Gesetz“, auf jeden Fall „als pure Ironie“ verstanden werden, „der die Juden schmerzlich an ihre Ohnmacht erinnert, was ihre Antwort denn ja auch sogleich demonstriert“, denn schon wegen der
engen Kooperation des Kaiaphas mit Pilatus, die durch das Auftreten der römischen Kohorte mit ihrem Chiliarchen bei der Verhaftung Jesu zusätzliches Gewicht gewönne, muß man wohl annehmen, daß Pilatus über den ,Fall Jesus‘ und den Wunsch des Kaiaphas, daß er ihn töten möge, bereits vor dessen Verbringung in das Prätorium gut informiert war.
Aber wie Wengst geht auch Thyen davon aus (T718), dass der Evangelist mit dem Frage-und-Antwort-Spiel zwischen Pilatus und den jüdischen Anklägern Jesu letzten Endes auf das Ziel hinaus will, das Johannes selber in seinem Kommentar zur „Auslieferung Jesu durch die Juden an Pilatus“ in Vers 32 angibt:
hina ho logos tou Iēsou plērōthē hon eipen sēmainōn poiō thanatō ēmellen apothnēskein {auf dass sich Jesu Wort erfülle, das er gesagt hatte, um damit anzuzeigen, was für eine Art von Tod er sterben müsse}. Der ,Logos‘, den Jesus ausgesprochen hat, muß darum ein Wort von der Heilsnotwendigkeit seines ,Erhöhtwerdens‘ sein, wie es etwa in 3,14 erklingt: houtōs hypsōthēnai dei ton hyion tou anthrōpou {so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden}. Wiederaufgenommen wird das in 12,32: kagō ean hypsōthō ek tēs gēs, pantas helkysō pros emauton {und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen}, wo es der Erzähler mit nahezu den gleichen Worten wie in 18,32 kommentiert: „Das sagte er aber, um anzudeuten, was für eine Art von Tod er erleiden sollte“ (12,33: sēmainōn poiō thanatō ēmellen apothnēskein). Die besondere Art seines Todes kann also nur seine ,Erhöhung‘ von der Erde durch seine Kreuzigung als eine spezifisch römische Weise der Exekution von Aufrührern sein.
Wie Wengst ist auch Thyen
der Meinung, daß sich an dem römischen Privileg des Präfekten, in seiner Provinz Judäa allein die Todesstrafe vollstrecken zu dürfen, seit der Umwandlung der Ethnarchie des Archelaus in die römische Provinz Judaea i.J. 6 n. Chr. und der Einsetzung des Coponius zum Präfekten, „eines Mannes aus römischen Ritterstand, … der vom Kaiser obrigkeitliche Gewalt einschließlich des Rechtes empfing, die Todesstrafe zu verhängen“ (Josephus, Bell II/117 {vgl. nach H. Clementz: Bell. 2,8,1}), bis zum Beginn der Aufstandes der Juden gegen Rom nichts geändert hat.
Ton Veerkamp <1300> diagnostiziert in den Versen 29-31 zunächst einmal ein ganz normales behördliches Zuständigkeitsgerangel:
Jede Behörde ist bestrebt, sich für nicht zuständig zu erklären, erst recht bei einem Fall, der ihr Scherereien bringt. Der Prokurator Pontius Pilatus fragt nach der Art des Verbrechens, wobei er zu verstehen gibt, dass er wohl nicht zuständig sei. Man sagte ihm, Jesus sei ein „Übeltäter“, d.h. ein Mensch, der Taten begeht, die von den Römern geahndet werden. Pilatus stellt sich stur, nicht er, sondern sie seien zuständig; sie haben ihre von Rom anerkannte Selbstverwaltung (Autonomie), nach den eigenen Gesetzen zu verfahren.
Anders als Wengst und Thyen beurteilt Veerkamp die Aussage der judäischen Ankläger Jesu, sie hätten „nicht das Recht, irgendeinen Menschen zu töten“, als „unrichtig“. Wie auch immer diese Frage historisch für die Zeit Jesu zu beurteilen sein mag, Johannes selbst berichtet mehrfach, dass jüdische Gegner Jesu ihn steinigen wollen:
Sie haben das Recht, Todesurteile zu vollstrecken, und sie versuchten das auch, 7,53ff.; 8,59; 10,31. Die politische Führung der Selbstverwaltung will aber zwei Ziele erreichen: erstens die Eliminierung eines innerjüdischen Gegners und zweitens den Nachweis ihrer politischen Zuverlässigkeit Rom gegenüber. Das ist eine politische Deutung des historischen Faktums des Kreuztodes des Jesus ben Joseph aus Nazareth, Galiläa, durch Messianisten wie Johannes. Um diese politische Deutung geht es, und deswegen wird der Prozess so erzählt, wie Johannes es tut.
Dabei betont Veerkamp sehr deutlich, dass hier keine historische Geschichtsschreibung vorliegt. Zwar kann man (Anm. 514) „wohl nicht bezweifeln“, dass Jesus gekreuzigt wurde, worauf Paulus als erster schriftlich hinweist, „der aber kein Augenzeuge war“,
aber wie die Hinrichtung zustande kam, wissen wir nicht und können wir so lange nicht wissen, bis nicht irgendein diesbezügliches historisches Dokument auftaucht. Das aber scheint völlig unwahrscheinlich.
Wie auch alle anderen Evangelisten bietet auch Johannes in seiner Erzählung letztlich
also fiction, keine reality, keine historische Dokumentierung . Wir haben keine Dokumente, keine Prozessakte, keinen Hinweis eines Augenzeugen, dass ein solcher Prozess stattgefunden hat. Es ist überhaupt fraglich, ob die Behörden, judäische und römische, mit irgendeinem in ihren Augen fanatischen Galiläer viel Federlesens gemacht hätten, etwa durch eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Römer pflegten überall mit mutmaßlichen Rebellen kurzen – also keinen – „Prozess“ zu machen. Wir wissen eben nichts.
Aber wir haben vier Erzählungen. Hier wird erzählt: Eine politische Führung liefert ein missliebiges Mitglied des Volkes einer Besatzungsmacht aus, um ihre Geschäftsgrundlage für ein ordentliches und wohl auch einträgliches Verhältnis mit der Besatzungsmacht nicht zu gefährden.
In diesem Zusammenhang stellt Ton Veerkamp klar, worin er die vorrangige Aufgabe der Auslegung des Johannesevangeliums erblickt:
Es ist nicht die Aufgabe einer Auslegung, historische Tatsachen zu ermitteln, zumal das Unterfangen aussichtslos wäre. Ihre Aufgabe ist, die Erzählung in ihren inneren Zusammenhängen zu deuten und sie in einen bekannten gesellschaftspolitischen Widerspruchskontext zu stellen. Das gilt für das Evangelium als Ganzes und erst recht für die Passionserzählung. Mehr kann sie nicht, aber zumindest das soll sie.
↑ Johannes 18,33-38a: Verhör Jesu durch Pilatus über Jesu Königtum der Treue
18,33 Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium
und rief Jesus und sprach zu ihm:
Bist du der Juden König?
18,34 Jesus antwortete:
Sagst du das von dir aus,
oder haben dir‘s andere über mich gesagt?
18,35 Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude?
Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet.
Was hast du getan?
18,36 Jesus antwortete:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Wäre mein Reich von dieser Welt,
meine Diener würden darum kämpfen,
dass ich den Juden nicht überantwortet würde;
aber nun ist mein Reich nicht von hier.
18,37 Da sprach Pilatus zu ihm:
So bist du dennoch ein König?
Jesus antwortete:
Du sagst es: Ich bin ein König.
Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen,
dass ich die Wahrheit bezeuge.
Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.
18,38 Spricht Pilatus zu ihm:
Was ist Wahrheit?
[6. Januar 2023] Sehr passend fügt es sich, dass ich mich ausgerechnet am traditionell so genannten Festtag der Heiligen Drei Könige mit dem Verhör Jesu durch Pilatus über die Art seines Königtums beschäftige.
Nach Klaus Wengst (W502) „stellt Johannes“ in Vers 33 „den Richter und den Angeklagten einander gegenüber“, indem er ihn im Prätorium zu sich rufen lässt. Allerdings (Anm. 286) hält er ein solches Verhör „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ für „historisch unwahrscheinlich“; er ist für Johannes ein literarisches Mittel zur „Gestaltung der Szenenfolge“.
Die Frage (W502), die Pilatus wie „in den synoptischen Evangelien“ an Jesus richtet, gibt Wengst folgendermaßen wieder: „Du bist der König des jüdischen Volkes?!“, womit er den Ausdruck ho basileus tōn Ioudaiōn {wörtlich: der König der Judäer} durchgehend umschreiben wird. Bei den Synoptikern antwortet Jesus darauf einfach: „Du sagst es“, und hält dadurch „die Antwort in der Schwebe“, denn (W502f.) die
gestellte Frage erwartet ein „Ja“ oder „Nein“. Mit einer ausdrücklichen Bejahung hätte Jesus die Vorstellung des Römers von einem „König des jüdischen Volkes“ im Blick auf seine Person bestätigt. Er kann sie aber auch nicht verneinen, da er den Evangelisten als ein König gilt. Indem die Antwort in der Schwebe bleibt, ist die Leser- und Hörerschaft gefordert, sie selbst zu geben; sie wird wissen, wie das Königtum Jesu zu verstehen ist. Wie gesagt: Johannes beginnt das Verhör Jesu durch Pilatus mit derselben Frage. Aber die Antwort Jesu: „Du sagst es“ bietet er innerhalb eines längeren Gesprächs, in dem er der Leser- und Hörerschaft deutlich macht, wie sie das Königtum Jesu verstehen soll.
Dass die Frage des Königtums Jesu (W503) „nun in der das Verhör des Angeklagten eröffnenden Frage in aller Selbstverständlichkeit vorausgesetzt“ wird, ist „keineswegs überraschend“, da sie „in der vorangehenden Darstellung des Evangeliums vorbereitet“ wurde: im Bekenntnis des „Natanael gegenüber Jesus“ (1,49), im Versuch, „Jesus zum König zu machen“ (6,15), und beim „Einzug Jesu in Jerusalem“ (12,12-19):
Dort hat er durch eine Zeichenhandlung, das Reiten auf einem Eselchen, dazu angeleitet, wie sein Königtum verstanden werden soll. Aber nach 12,16 verstehen das seine Schüler erst nach Ostern. Wie sollten es da seine Gegner zur Zeit des Geschehens verstehen? Aus ihrer Sicht war die Sache klar: In der königlichen Einholung manifestierte sich königlicher Anspruch. „Alle Welt ist ihm nachgelaufen“ und damit ist gemäß der realistischen Befürchtung von 11,48 Gefahr im Verzug und also Handeln geboten. Daher kommt der Rat des Kajafas von 11,50 nun zum Zuge. Wer diese in der Erzählung des Evangeliums auch gebotene Perspektive noch im Blick hat, ist also nicht überrascht über die die Anklage enthaltene Frage des Pilatus: „Du bist der König des jüdischen Volkes?!“
Wengst hält es aber für wesentlich, dass Pilatus „nicht vom ‚König Israels‘, sondern vom ‚König des jüdischen Volkes‘“ spricht (503f.):
Mit der Bezeichnung „König Israels“ lässt Johannes in 12,13.15 biblische Tradition anklingen und bringt damit das königliche Auftreten Jesu mit dem Handeln Gottes in Verbindung. Das interessiert Pilatus nicht. Er isoliert den Sachverhalt, vor den er sich gestellt sieht, auf ein politisches Problem, wie er es versteht, bei dem es ausschließlich um Machtfragen geht. Deshalb spricht er vom „König des jüdischen Volkes“. Ist Jesus ein Aufrührer, der das jüdische Volk oder Teile davon veranlasst haben könnte, sich gegen die römische Ordnung aufzulehnen?
Hier setzt Wengst ganz selbstverständlich eine Unterscheidung voraus, die er nicht begründet, nämlich dass nur Pilatus in politischen Kategorien denkt, während es auf der Seite Jesu ausschließlich um ein religiös zu verstehendes Königtum geht. Dass im Königtum des Gottes Israels, die der Messias Jesus verkörpert, politische Implikationen jedoch keineswegs auszuschließen sind, sollte zumindest nicht außerhalb jeder Erwägung bleiben. Zwar ist es richtig (W504), wie Schnelle <1301> schreibt, dass sich „Pilatus und Jesus … von Anfang an auf verschiedenen Gesprächs- und Verstehensebenen“ begegnen, aber es wird von den jüdischen Schriften her zu prüfen sein, inwiefern man wie Schnelle sagen kann: „Während für Pilatus die Frage nach dem ,König der Juden‘ eine Machtfrage ist, stellt sich für Johannes gerade hier die Wahrheitsfrage.“
Wie „Pilatus auf seine an die Ankläger gerichtete klare Frage von diesen keine klare Antwort bekommen“ hatte, „so erhält er sie auch jetzt nicht vom Angeklagten auf seine ebenso klare Frage“. Stattdessen stellt ihm in Vers 34
jetzt Jesus eine Gegenfrage. Das Seltsame geschieht, dass der Angeklagte seinerseits den Richter vernimmt: „Sagst du das von dir selbst aus oder haben es dir andere über mich gesagt?“ Was andere über Jesus dem Pilatus gesagt haben, kann die Leser- und Hörerschaft aus der bisherigen Darstellung erschließen: Jesu Wirken führte zum Auflauf einer großen Menge, die ihm als König akklamierte. Das bedroht die bestehende, durch Rom garantierte Ordnung der Provinz Judäa. Mit dieser Unruhestiftung will die Repräsentanz des Volkes nichts zu tun haben, sondern sie beseitigt sehen. Hat Pilatus diese Information für sich übernommen?
Indem Wengst weiter fragt: „Oder spricht er in eigener Person in der Weise, dass seine Frage auf eine andere Dimension zielt als die der Machtpolitik? Fragt er nach Jesu wirklichem Königtum?“, lässt er deutlich werden, wie er in seiner Anm. 287 auch ausdrücklich sagt, dass er Jesu Frage für „nicht leicht zu verstehen“ hält, zumal der „‚historische‘ Pilatus“ sich diese kaum hätte gefallen lassen. Offenbar erwägt Wengst nicht nur, dass durch sie „Jesus Gelegenheit erhält, die Art seines Königtums darzulegen“, sondern auch, ob Pilatus sich „in eigener Person“ für die „andere Ebene“ des Königtums Jesu interessieren könnte oder sollte.
Nach Vers 35 (W504) begibt sich Pilatus allerdings ausdrücklich nicht auf „diese andere Dimension“, was er „mit einer rhetorischen Gegenfrage“ klarstellt:
„Bin ich denn ein Jude?“ Nach dieser anderen Dimension zu fragen – das Folgende wird deutlich machen, dass es dabei um die Dimension Gottes geht -, hält er für „jüdisch“. Als Römer interessieren ihn nur Fragen der Machtpolitik. So spricht er im zweiten Teil seiner Antwort aus, wie sich ihm der vorliegende Sachverhalt darstellt: „Dein Volk, und zwar die Oberpriester, haben dich mir übergeben.“ Deshalb will er vom Angeklagten wissen: „Was hast du getan?“ Der Angeklagte soll seinerseits die Fakten benennen, die diese Anklage begründen, und sich zu ihnen verhalten.
Nach Wengst „entzieht sich Jesus“ diesem Ansinnen des Pilatus. In Vers 36 geht er wiederum
nicht direkt auf sein Gegenüber ein. Er beharrt auf der anderen Ebene. Zwar spricht er von seiner Herrschaft, seinem Königtum, stellt aber zunächst negativ heraus, dass dieses Königtum von anderer Art sei als das, nach dem Pilatus fragt: „Meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt“, „d. h. sie hat in dieser Welt nicht ihren Ursprung und ist deshalb nicht von der Art dieser Welt“. <1302>
Wichtig ist nun die Frage, welche Definition von kosmos {Welt} Johannes hier voraussetzt. Lässt er Jesus eine irdisch-diesseitige Welt von einer jenseitig-religiösen Dimension unterscheiden?
Aus den weiteren Ausführungen von Wengst geht hervor, dass er „Welt“ im Sinne von Pilatus als eine Welt der Stärke auf Grund von militärischer Gewalt begreift (W504f.):
Herrschaft „von der Art dieser Welt“ wird von seinem Gegenüber, von Pilatus, repräsentiert, eine Herrschaft, die über Truppen verfügt, die mit militärischer Gewalt errungen ist und mit militärischer Gewalt abgesichert wird. Der Stärkere setzt sich durch und behauptet sich. Das ist nicht die Herrschaft Jesu. Das hat sich gerade schon gezeigt: „Wenn meine Herrschaft von der Art dieser Welt wäre, hätten meine Wachleute gekämpft, damit ich den führenden Juden nicht ausgeliefert würde“. Hier ist an die Situation der Festnahme Jesu gedacht, die unmittelbar zur Überstellung an Hannas und Kajafas als den führenden Vertretern der jüdischen Selbstverwaltung führte. Bei dieser Festnahme hatte sich Jesus von sich aus gestellt; und als ein Schüler mit dem Schwert dreinschlug, ihm dessen weiteren Gebrauch sofort untersagt.
In diesem Zusammenhang hält es Wengst für möglich (Anm. 293), dass „Johannes bei den ‚Wachleuten‘, die für Jesus hätten kämpfen können, wie Mt 26,53 an ‚Legionen von Engeln‘“ denkt.
Wie unterscheidet sich nun (W505) Jesu Königtum von einem Königtum „dieser Welt“? Wengst betont dessen „völlig anderen Ursprung und Grund“ und muss damit den Gott Israels meinen. Hier klingen deutlich politische Implikationen an, nämlich dass auch Jesu Königtum „gegenwärtige Wirklichkeit in der Welt“ beansprucht und „der auf Gewalt gegründeten Herrschaft die Legitimität“ bestreitet:
Dennoch redet dieser ohnmächtige Angeklagte, der seiner Verurteilung zum Tode entgegengeht, von seiner Herrschaft, seinem Königtum. „Nun aber ist meine Herrschaft nicht von hier.“ Sie hat einen völlig anderen Ursprung und Grund als die Herrschaft Roms, beansprucht jedoch gleichwohl gegenwärtige Wirklichkeit in der Welt. Indem Jesus so seine Herrschaft – in ihrer Herkunft, Begründung und Art – betont in Gegensatz zur römischen Herrschaft bringt, tritt er ihr zwar nicht auf derselben Ebene entgegen, bestreitet damit aber der auf Gewalt gegründeten Herrschaft die Legitimität.
Damit bestreitet Wengst (Anm. 294), dass „der Text … nicht in der eines schiedlich- friedlichen Nebeneinanders der Herrschaft Jesu und der von Pilatus repräsentierten römischen Herrschaft“ zu lesen ist, wie das von Johannes Calvin bis Siegfried Schulz <1303> behauptet wird:
Nach Calvin „leugnet“ Jesus, „daß sein Reich im Gegensatz zur politischen Ordnung stehe“. In derselben Richtung interpretiert Schulz: „Sein Königtum trägt im Unterschied zu den römischen Cäsaren keinerlei weltpolitischen Charakter, stellt also keine Gefahr für Rom dar. Die apologetische Absicht ist deutlich: der römische Staat kann die Christen nicht verfolgen, weil ihre Lehre nicht das römische Staatsrecht tangiert“.
„Treffender“, so Wengst, nimmt dagegen Josef Blank <1304> zu dieser Frage Stellung:
„Jede Verbindung mit Gewalt und irdischer Macht kompromittiert die Verkündigung und das Wollen Jesu. Gleichwohl ragt dieses ,Reich‘ in die irdische Sphäre herein; ist es zwar nicht ,von dieser Welt‘, so ist es doch ,in dieser Welt‘ und erhebt in ihr seinen Anspruch. […] Es ist gerade der nichtwelthafte Charakter dieses Reiches, durch den es auch die gesamte politische Sphäre an ihrer Wurzel tangiert und in Frage stellt“.
Was genau hier mit „nichtwelthaft“ gemeint sein soll, bleibt dabei immer noch ungeklärt.
Da Pilatus Wengst zufolge (W505) „den in den Ausführungen Jesu enthaltenen Anspruch durchaus herausgehört“ hat, setzt er seine Befragung in Vers 37 folgendermaßen fort:
„Bist du also doch ein König?“ Wieder antwortet Jesus nicht mit einem klaren Ja oder Nein. Die zunächst gegebene Erwiderung hält die Antwort in der Schwebe: „Du sagst, dass ich ein König bin.“ Wie er sein Königtum verstanden wissen will, legt er anschließend positiv dar. Zugleich gibt er damit Antwort auf die Frage, die Pilatus ihm zuvor gestellt hat, was er „getan“ habe. Sein Tun besteht ganz und gar im Ausführen dessen, wofür er „da“ ist, im Erfüllen seines Auftrags, seiner Sendung: „Dazu bin ich geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis für die Wahrheit ablege.“
Mit Jesu Aussage, dass er „in die Welt gekommen“ ist, wird nach Wengst (Anm. 295) „zum Ausdruck gebracht, dass Jesus eine Sendung hat, die von jenseits der Welt, die von Gott kommt.“ Offen bleibt aber immer noch die Frage, wie dieses „jenseits“ zu verstehen ist. Bezieht es sich allein auf die Unverfügbarkeit des Gottes Israels oder auch auf eine jenseitige Dimension der messianischen Zukunft für die Menschen?
Das Stichwort alētheia, „Wahrheit“, versteht Wengst (W505) im Sinne des mit seiner Herrschaft „zum Zuge“ Kommens Gottes:
Vom Ablegen eines Zeugnisses für die Wahrheit war im Johannesevangelium schon in 5,33 die Rede. Dort sagte das Johannes der Täufer im Blick auf Jesus aus. Damit unterstrich er, worum es im Kontext ging, dass nämlich im Wirken Jesu Gott zum Zuge komme. Eben dafür ist Jesus da, dass in ihm Gott zum Zuge komme. Dass sich gerade darin Gottes Königtum erweist, ist die Wahrheit, für die Jesus einsteht. In seinem Wirken repräsentiert sich die Herrschaft Gottes.
Zur engen Verbindung (W506) von „Wahrheit und Gottes Königtum … in der biblisch-jüdischen Tradition“ verweist Wengst zunächst auf Jeremia 10,10:
„Und der Ewige, Gott, ist Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und König auf immer.“ Diese Stelle wird aufgenommen in jSan 1,1 (18a): <1305> „Was ist das Siegel des Heiligen, gesegnet er? Rabbi Bevaj im Namen Rabbi Re‘uvens: ,Wahrheit.‘ Was ist Wahrheit? Rabbi Bun sprach: ,Dass Er der lebendige Gott und König auf immer ist‘ (Jer 10,10). Resch Lakisch sprach: ,Alef steht am Anfang des Alfabets, Mem in seiner Mitte, Tav an seinem Ende. Das bedeutet: Ich, der Ewige, der Erste (Jes 44,6), weil ich von keinem anderen (die Gottheit) empfangen habe; und außer mir ist kein Gott (Jes 44,6), weil ich keinen Partner habe; und bei den Letzten bin ich, weil ich sie (die Gottheit) keinem anderen übergeben werde.‘“ Das ist die Wahrheit, die Orientierung gibt, dass Gott allein Gott ist und deshalb aller Vergötzung gewehrt wird.
Indem Resch Lakisch (Anm. 296) die hebräischen Buchstaben „Alef, Mem, Tav“ symbolisch deutet, greift er auf „die drei Buchstaben des hebräischen Wortes emét = ‚Wahrheit‘“ zurück.
Worin liegt nun nach Wengst (W506) in ihrem Kern die Bedeutung dieser „Wahrheit“, wie Jesus sie nach dem Johannesevangelium versteht und verkörpert?
Wie Gott in der biblisch-jüdischen Tradition seine königliche Wahrheit in der Treue und Beständigkeit gegenüber seinem kleinen und oft ohnmächtigen Volk Israel erweist, indem er sich mit ihm in jedes Exil führen lässt, so verbindet er sich hier mit diesem ohnmächtigen Angeklagten, der seiner Verurteilung zum Tod am Kreuz durch den Repräsentanten der römischen Macht entgegengeht. Die Wahrheit, für die Jesus einsteht, erweist sich so als in Antithese zu der auf Gewalt gründenden Macht stehend, die Pilatus repräsentiert. Diese Macht wird durch das Zeugnis „für die Wahrheit“ delegitimiert. Die „Wahrheit der Macht“ ist Lüge.
Indem Jesus gegenüber Pilatus der Beschreibung dessen, „was er ‚getan‘ hat“, nämlich „seines Königtums als eines Zeugnisses ‚für die Wahrheit‘“, noch „eine Folge“ hinzufügt, „die in diesem Tun enthalten ist“, und zwar: „Alle, denen an der Wahrheit liegt, hören auf meine Stimme“, wird „für die von Jesus beanspruchte Herrschaft“ ein konkreter „Ort“ angegeben:
Jesu Herrschaft, die „nicht von dieser Welt“ ist, „nicht von hier“, ist damit nicht ortlos; sie ist nicht „aus der Welt“. Sie hat ihren Ort bei denen, die sich auf die von ihm bezeugte Wahrheit einlassen. Ihr Ort in der Welt ist die Gemeinde.
Die Gegenfrage: „Was ist Wahrheit?“, mit der Pilatus in Vers 38a auf Jesu Antwort reagiert, ohne eine weitere Antwort abzuwarten, ist von den Exegeten auf die unterschiedlichsten Weisen verstanden worden:
Nach Schnelle [354] „vertritt (er) bewußt eine philosophische Gegenposition zum Wahrheitsanspruch Jesu“ … Nach Blank [87] „flüchtet (er) sich in die Entscheidungslosigkeit‘. Wie Johannes Pilatus darstellt, gibt dessen Frage eher dem Spott und Zynismus eines Machtmenschen Ausdruck. So Calvin [442]: „Daß Pilatus seine Worte spöttisch gemeint hat, wird daran deutlich, daß er sofort hinausgeht.“ Vgl. auch Luther: <1306> „Ich denke, es sind heidnische Possen aus einem frechen Gewissen. So ist der Welt Lauf: Wahrheit kann man nicht leiden; wer in der Welt leben will, verschweige die Wahrheit und bescheiße die Leute!“
Wengst selber verzichtet auf Spekulationen darüber, wie Pilatus auch immer, „in der Sicht des Johannes, seine Frage verstanden haben mag“, und meint:
[S]ein Weggehen zeigt: Er will darauf keine Antwort erhalten; sie hat abwehrende Funktion und soll das Gespräch beenden. Auf die von Jesus angesprochene Ebene will er sich nicht einlassen, sondern entzieht sich ihr. Er schlägt die Frage der Wahrheit aus, weil er sich bei der Macht sicher wähnt. Für ihn ist die Macht die entscheidende Wirklichkeit.
Nach Hartwig Thyen (T719) zeigt in den Versen 33 bis 35 schon die erste an den „angeklagten Jesus“ gerichtete Frage des Pilatus: „Bist du der König der Juden?“, mit der er „bis in den Wortlaut hinein seinen Prätexten … (Mk 15,2; Mt 27,11; Lk 23,3)“ folgt,
daß er weit mehr weiß, als seine anfängliche Frage an die Juden ahnen ließ. So antwortet Jesus ihm denn auch mit der rhetorischen Gegenfrage: Fragst du das von dir aus, oder haben dir das andere über mich erzählt? (V. 34). Und Pilatus entgegnet: Bin ich (betontes egō) denn etwa ein Jude? Dein Volk und seine Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert! Was hast du also getan?
Indem Thyen darauf hinweist, dass die „,Anderen‘, die ihm das gesagt haben, … ihm am Ende dieses Prozesses gottvergessen erklären“ werden: „ouk echomen basilea ei mē Kaisara {wir haben keinen König außer dem Kaiser} (19,15)“, will er wohl die Ironie andeuten, die darin besteht, dass ausgerechnet sie Jesus als ihren König bezeichnet haben sollen. Wenn allerdings
Pilatus sagt, nicht ich der Römer, sondern dein jüdisches Volk und seine Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert, so unterstellt er damit wohl zu Unrecht, daß das Synhedrium, das im Falle der Hinrichtung Jesu nach Mk 14,1; Mt 26,3ff doch einen Aufstand des Volkes befürchtet, dessen wahrer Repräsentant sei.
Zur Antwort, die Jesus in Vers 36 gibt, geht Thyen davon aus, dass er „sich sehr wohl als der ,König Israels‘ weiß (1,49)“:
Mein Königsein [oder mein Königtum: basileia] ist nicht von dieser Welt (ek tou kosmou toutou). Wäre mein Königtum nämlich ,von dieser Welt‘, dann hätten meine Diener (hypēretai!) darum gekämpft, so daß ich den Juden nicht ausgeliefert worden wäre. Aber Jesus hat keine hypēretai wie Pilatus und die Synhedristen … Er hat mathētai {Jünger, Schüler} und die hatte er beim Abschied meine Freunde genannt (15,15), und beim österlichen Wiedersehen wird er sie meine Brüder nennen (20,17). E contrario {aufgrund eines Umkehrschlusses} mußte das Petrus bestätigen, wenn er, als wäre er ein hypēretēs Jesu, denen mit dem gezogenen Schwert entgegengetreten war, die in Wehr und Waffen gekommen waren, Jesus zu verhaften, und dabei einem der Tempelpolizisten das rechte Ohr abgetrennt hatte (vgl. Lk 22,50f, wo Jesus den von einem der Seinen angerichteten Schaden freilich sogleich wieder heilt).
Da Thyen zufolge (T720) „Jesus sich ja freiwillig selbst in die Hände seiner Häscher begeben“ hatte, „damit er als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt beseitigt, endlich den Kelch trinke, den zu trinken sein Vater ihm aufgetragen hatte“, demonstrierte Petrus damit „noch einmal, daß er seinem Herrn jetzt noch nicht nachzufolgen vermag (13,36)“ und
mit seinem Schwertstreich in Wahrheit nicht den Feinden Jesu, sondern seinem Herrn selbst in den Weg getreten [war]. Bis er die besondere Art des Königseins Jesu wirklich begriffen haben wird, liegt darum noch ein langer Weg vor ihm, der sich erst 21,15ff vollenden wird.
Als Pilatus sich in Vers 37 „mit der fragenden Schlußfolgerung“ an Jesus richtet: „Also bist du ja wohl doch ein König?“, antwortet Jesus wie in Markus 15,2; Matthäus 27,11 und Lukas 23,3 mit den Worten: „sy legeis {du sagst es}“, und er ergänzt die Worte: „hoti basileus eimi“, was Bauer <1307> nach Thyen „treffend mit: ‚Gewiß, ich bin ein König‘ übersetzt“:
Worin aber dieses Königtum Jesu besteht, wie es begriffen sein will und was er als derartiger ,König‘ getan hat, erklären seine beiden folgenden Sätze: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich Zeugnis ablege für die Wahrheit. Wer aus der Wahrheit ist (ek tēs alētheias), der hört meine Stimme“.
Dass Jesus im ersten Teil dieses Verses „von dem Zweck seines Kommens in die Welt“ redet, muss nach Morris <1308> ziemlich sicher implizieren, „daß Jesus hier von seiner Präexistenz rede, … auch wenn Pilatus das schwerlich begreife“. Zum zweiten Teil bemerkt Brown <1309> Thyen zufolge
treffend, daß das Verbum akouein {hören} hier ebenso wie in 10,3 mit dem Genitiv tēs phōnēs {auf die Stimme} konstruiert ist und dadurch den Sinn von verstehendem Hinhören und Sich-Einlassen auf das Gesagte („listening with understanding and acceptance“) gewinne. Anders als in 8,43, wo akouein mit dem Akkusativ gebraucht ist (ou dynasthe akouein ton logon ton emon {ihr könnt mein Wort nicht hören}) und eher das physische Nicht-Hören-Können tauber und verstockter Ohren ausdrückt (vgl. 12,40), ist der Ton hier durchaus einladend, so daß hier mit Pilatus alle potentiellen Leser/Hörer des Evangeliums dazu aufgerufen werden, aufmerksam auf die Stimme Jesu, ihres guten Hirten, zu hören und ihm nachzufolgen.
Spannend ist nun die Art und Weise, wie Thyen unter Berufung auf Brown von dieser Stimme des guten Hirten her im Rückgriff auf die jüdischen Schriften auf Jesu Königtum, das „nicht von dieser Welt ist“, eingeht:
Da Jesu Rede vom guten Hirten, wie schon des öfteren begründet wurde (s. dazu o. zu Joh 10), wohl vor biblischem Hintergrund und zumal vor dem von Ez 34 gelesen werden will, hält Brown die Entsprechung zwischen 10,3 und 18,37 darum für bedenkenswert, weil in beiden Fällen ein Königtum im Spiel sei, das nicht von dieser Welt ist. Bei Ezechiel erklärt Gott, daß er selbst dem eigensüchtigen Regime der ungetreuen Hirten seines Volkes jetzt ein Ende bereiten und als der königliche Hirte seine zerstreuten Schafe in dem Land sammeln will, das er ihren Vätern gegeben hat. Und daß er ihnen als ihren treuen Hirten und gesalbten König seinen ,Knecht David‘ senden will. Auf dessen ihnen vertraute Stimme werden sie hören, ihm nachfolgen und gute Weidegründe finden.
Auf den ersten Blick könnte man auf Grund dieser Worte annehmen, dass Thyen zufolge Jesu Königtum insofern „nicht von dieser Welt ist“, als Gott selber durch ihn als seinen Messias sein Volk Israel sammeln und ihm das Leben der kommenden Weltzeit eröffnen wird. Allerdings scheint das, was sich nach Hesekiel/Ezechiel ganz diesseitig-politisch auf der Erde unter dem Himmel Gottes abspielen wird, bei Thyen dann doch wieder ziemlich religiös spiritualisiert oder gar verjenseitigt verstanden zu sein. Jedenfalls nehmen seine folgenden Ausführungen inhaltlich rein gar nichts aus dem Prätext Hesekiel 34 auf, sondern beschäftigen sich ausschließlich mit neutestamentlichen Paralleltexten (T720f.):
Das in den synoptischen Evangelien häufig vorkommende und prominente Lexem basileia {Königreich, Königtum} erscheint bei Johannes nur hier im Gespräch mit Pilatus und zuvor in Jesu nächtlicher Unterredung mit Nikodemus (3,3 u. 5). Aus der letzteren ist zu lernen, daß keiner die basileia tou theou {Königtum Gottes} sehen und in sie eingehen kann, der nicht zuvor ,von oben‘ und ,aus Wasser und Geist‘ neugeboren wurde. Und dem entsprechend heißt es in 1Joh 5,19f: „Wir wissen, daß wir aus Gott sind (hoti ek theou esmen) und daß die gesamte Welt im Bösen liegt (en tō ponērō keitai). Aber wir sind auch gewiß, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat (dedōken hēmin dianoian), den wahren (Gott) zu erkennen (hina ginōskōmen ton alēthinon), und wir sind (nun) in dem wahren (Gott) und in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahre Gott und das ewige Leben“.
Thyen nutzt also nicht die Chance, auf dem Hintergrund von Hesekiel 34 genauer zu klären, was mit dem wahren Gott Israels, dessen Wahrheit und Treue und dem ewigen Leben einerseits und der im Bösen liegenden Welt andererseits unter den Bedingungen der römischen Weltherrschaft konkret gemeint sein könnte.
Dass Thyen den Evangelisten Johannes eben nicht jüdisch-messianisch, sondern religiös-christlich auslegt, zeigt sich ganz offensichtlich in seiner weiteren Interpretation des Satzes: „pas ho ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs {Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme}“. Dieser Satz muss in seinen Augen
zugleich auch in umgekehrter Folge gelesen werden …: „Jeder, der auf meine Stimme hört, ist aus der Wahrheit“, ist und wird durch solches Hinhören neu und von oben geboren und der österliche Geist wird ihn in die ganze Wahrheit führen. Wir haben also das Paradox vor Augen, daß nur, wer gehorsam hört, aus der Wahrheit ist und daß zugleich allein, wer aus der Wahrheit ist, so zu hören vermag. Daß dieses in der Erfahrung des Glaubens gegründete Sprechen nicht in die Ontologie einer Lehre von einer vorzeitigen Prädestination der einen zum Heil und der anderen zum Unheil transformiert werden darf, haben wir bereits mehrfach begründet (s. o. zu 1,12f…).
Christlich-dogmatisch ist mir Thyens Haltung in dieser Hinsicht durchaus sympathisch; die Frage ist allerdings, ob schon Johannes derartige Spekulationen über das ewige Heil oder die Verdammnis der Menschen auf Grund ihres religiösen Glaubens an Jesus im Sinn hatte.
Zu Vers 38a, in dem Pilatus „dieses erste Verhör Jesu mit der skeptischen Frage: ti estin alētheia? {Was ist Wahrheit?}“ beendet, beschränkt sich Thyen in seiner Auslegung auf wenige Sätze, eingeleitet durch ein Zitat von Heinrich Schlier: <1310>
„Pilatus fragt … noch: ,Was ist Wahrheit?‘…. Er meint, die Wahrheit sei ein ,Was“. Er merkt nicht, daß er vor der Wahrheit in Person steht und diese ein basileus {König} ist, der die Herrschaft nicht ,aus dieser Welt‘ empfängt“. Da Pilatus mit seiner Frage auf den Lippen hinausgeht zu den wartenden Juden, erwartet er von Jesus keine Antwort mehr. Aber wenn Jesus ihm hier auch keine verbale Antwort auf seine Frage, was denn Wahrheit sei, mehr geben kann, wird er sie in der folgenden Erzählung durch die Tat der Vollendung seiner Liebe (13,1) in der Hingabe seines Lebens für seine Freunde (15,13) geben [vgl. Morris 771], denn die Wahrheit, von der Jesus spricht, hat ihren Grund und ihr Ziel in der Liebe.
Nach Ton Veerkamp <1311> fungiert Pilatus „hier als oberster Richter“. Auf seine Frage in Vers 33 an Jesus „ob er der König der Judäer sei“, antwortet Jesus in Vers 34
mit einer Gegenfrage. Er will wissen, woher Pilatus diese Information hat. Haben die Römer selber ermittelt oder sei er denunziert worden? Pilatus bestätigt {in Vers 35} letztere Vermutung. Er, Pilatus, sei kein Judäer, er hatte von sich aus keine Veranlassung gehabt, gegen Jesus vorzugehen.
Anders als Wengst unterstellt Veerkamp dem johanneischen Pilatus also kein eventuelles Interesse an der besonderen Art seines Königtums. Vielmehr geht es Johannes in Vers 34 um die Frage der Verantwortlichkeit für Jesu Verurteilung:
Bei der Verhaftung waren „Beamte der Peruschim“ (Pharisäer), der großen Gegner Jesu, beteiligt, bei der Gerichtsverhandlung vor dem römischen Gerichtshof sind sie nicht vertreten. Im Johannesevangelium stehen die Peruschim für das entstehende rabbinische Judentum. Sie waren und sind die Gegner der messianischen Gemeinde des Johannes. Aber er macht sie nicht für die Überstellung Jesu in römische Gerichtsbarkeit verantwortlich.
Dieses Argument e silentio {aus dem Stillschweigen} ist wichtig. Der ewige antisemitische Vorwurf, die Juden – und alles Judentum war bis in die Zeit der Moderne rabbinisches Judentum – haben Jesus getötet, findet bei Johannes keine Rückendeckung. Der Tötungsvorwurf des Evangeliums bezieht sich auf den Ausschluss der Messianisten um Johannes aus der Synagoge, wie wir oben, bei der Besprechung von 15,26-16,15, gesehen haben.
Nochmals benennt Veerkamp präzise die in Jesu Leidensgeschichte bei Johannes verwickelten Akteure, die sich nach Vers 35 in dieser Verhandlung gegenüberstehen:
Das Dreieck der Akteure in der Passionserzählung besteht also aus Pilatus (Rom), den führenden Priestern (die judäische Regierung) bzw. ihren Anhängern und Jesus. Die judäische Regierung hat Pilatus gesteckt, Jesus strebe nach politischer Macht, sprich Königtum. Für die Römer ist das eine interessante Information. Sie müssen als die eigentliche Obrigkeit wissen, wer unter Umständen die römische Macht herausfordern könnte, oder ob es sich um einen internen Streit um die Macht in der Selbstverwaltung handelt. Pilatus fragt also: „Deine Nation und die führenden Priester haben dich mir ausgeliefert, was hast du getan?“
Was Jesus „auf diese Doppelfrage“ in Vers 36 antwortet, „ist ein Dreizeiler“:
(1) „Mein Königtum ist nicht von dieser Weltordnung.
(2) Wäre mein Königtum von dieser Weltordnung, meine Beamten hätten gekämpft, damit ich den Judäern nicht ausgeliefert worden wäre.
(3) Nun ist aber mein Königtum nicht von dort.“
Von vornherein macht Veerkamp deutlich, dass Pilatus mit dieser Antwort „nichts anfangen“´kann, denn er kennt weder „die Königsgeschichte der jüngsten Zeit“ im Volk Israel noch „die Diskussion um das Königtum, die in Israel seit der Rückkehr aus Babel und vor allem in der makkabäischen Zeit geführt wurde.“ Aber auf diese bezieht sich Jesu Antwort.
Die Antwort hat drei Zeilen; die erste und die dritte sind fast identisch; das Königtum Jesu wird negativ bestimmt, es sei „nicht von dieser Weltordnung“. Hier ist kosmos eindeutig mit Weltordnung zu übersetzen. Die mittlere Zeile bringt die Definition eines Königtums dieser Weltordnung; es sei das Produkt eines militärischen Kampfes. Die Negation der dritten Zeile wird näher bestimmt durch die zweite Zeile, das zeigen die einleitenden Partikeln der dritten Zeile nyn de, nun aber. Das Königtum Jesu definiert sich also nicht vom Militär her.
Nach Veerkamp ist es nun aber nicht nur „Pilatus“, sondern es sind „nicht wenige von uns“, die „die Schrift“ nicht kennen. Deswegen weist er zur Deutung dieses Wortes Jesu „auf einige wichtige Stellen des TeNaK“, der jüdischen Bibel, hin, in denen glasklar beschrieben wird, wie ein König sein soll, der nicht von diesem kosmos ist, nicht von dieser Weltordnung der unterdrückenden Gewalt:
In der Tora kommt der König Israels nur an einer Stelle vor, Deuteronomium 17,13ff. Ein König muß nicht sein, erst recht nicht ein König „wie bei allen Völkern“ (ke-khol ha-gojim). Wenn die Menschen Israels aber unbedingt einen König wollen, dann sollen sie auf alle Fälle einen „König aus der Mitte der Brüder“ nehmen.
Die weitere Einschränkung eines eventuellen Königtums ist erstens: nicht zu viele Pferde = Rüstung, Kavallerie; zweitens: nicht zu viele Frauen = Bündnisse mit auswärtigen Mächten (vgl. 1 Könige 11,1ff.); drittens: nicht zu viel Silber und Gold = Ausbeutung der Untertanen. Nach der Tora ist die Aufgabe eines Königs, sich eine Abschrift der Tora – der Verfassung der Freiheit und des Rechtes – zu besorgen und auf dem Thron „darin zu lesen alle Tage seines Lebens“. Einen solchen König hat es noch nie gegeben.
Das führt uns wieder zum Psalm 72:
Gott, gib dein Recht dem König, deine Wahrheit dem Königssohn,
dass er dein Volk nach Wahrheit beurteilt, deine Unterdrückten nach Recht.
Die Berge tragen dem Volk Frieden zu, die Hügel Gerechtigkeit.
Er schaffe den Unterdrückten des Volkes Recht,
er befreie die Bedürftigen,
er zermalme den Ausbeuter.Die Kernaufgabe jedes Königs, also jedes Staates, jeder Regierung, ist nach diesem Text die Wahrheit und das Recht. Und zwar das Recht für den Erniedrigten und Bedürftigen (ˁanaw, evjon). Das Maß, mit dem man den König, den Staat, die Regierung misst, ist das, was in der Schrift zedaqa heißt, Wahrheit, Bewährung. Wahrheit hat in der Schrift das Recht als seinen wahren Inhalt. Der Zaddik ist ein Wahrhaftiger und so ein Gerechter. Das Recht bewahrheitet sich erst an dem, was mit den Erniedrigten und Armen eines Volkes geschieht.
Das ist Königtum, und dieses Königtum meint Jesus. Er, der Messias, ist der Königsohn, für den der Psalmist hier betet. Jesus als der messianische König unterscheidet sich auf der ganzen Linie und in seinem Wesen vom Königtum nach dieser Weltordnung, basileia tou kosmou toutou. Das Königtum Jesu ist eine radikale Alternative, aber es ist nichts Jenseitiges, rein Geistiges oder Innerliches. Es ist ein radikal diesseitiges, irdisches Königtum.
Dass sich fast alle Exegeten sehr schwer tun, das Johannesevangelium angemessen auszulegen, liegt in meinen Augen daran, dass sie auch die jüdischen Schriften, Altes Testament genannt, vorwiegend als religiöses Buch lesen und nicht beachten, in welchem Maße die Tora als eine „Verfassung der Freiheit und des Rechtes“ in erster Linie auf eine gesellschaftskritische, befreiungspolitische Zielsetzung hinausläuft:
Mit der Tora hat sich Israel von der Normalität der altorientalischen Unterdrückung und Ausbeutung, von der „Produktion“ von ˁanawim we-evjonim, von Unterdrückten und Bedürftigen, verabschiedet, „es sollen unter euch keine Bedürftigen sein“, Deuteronomium 15,4. Jesus knüpft mit seiner Antwort nur an der geheiligten Tradition der Torarepublik der alten Judäer an. Jesus will kein unerhört Neues; er will ein Königtum nach der Tora. Da es, wie gesagt, ein solches Königtum noch nie gegeben hat, will Jesus unerhört Neues. Gerade das Traditionelle ist das Novum!
Das Gegenbild zum Königtum Jesu, das „nicht von dieser Weltordnung“ ist, kann man Veerkamp zufolge im 1. Buch Samuel betrachten:
Die Umschreibung des „Königs von dieser Weltordnung“ auf hebräisch lautet: melekh ke-khol ha-gojim, König wie bei allen Völkern. Genau diesen verlangen die Eliten Israels von Samuel, 1 Samuel 8,4ff.:
Es versammelten sich alle Ältesten Israels.
Sie gingen zu Samuel in Ramat.
Sie sagten: „Da, du bist alt geworden, und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen.
Stelle doch jetzt einen König über uns an; er schaffe uns Recht wie bei allen Völkern.“
Böse war dieses Wort in den Augen Samuels,
weil sie sagten: „Gib uns einen König, dass er uns Recht schaffe.“
Samuel betete zum NAMEN.
Der NAME sagte zu Samuel:
„Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen.
Denn nicht dich haben sie verworfen.
Mich haben sie verworfen, dass ich König über sie sein soll.“Genau das wird auch hier wieder passieren, Johannes 19,15: „Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar!“ Samuel zeigt dann, was die Rechtsordnung des Königs (mischpat ha-melekh) ist, 1 Samuel 8,11:
Dies ist die Rechtsordnung des Königs, der über euch König sein wird:
Er wird eure Söhne nehmen und sie zu seinen Streitwagenfahrern und Soldaten machen,
dass sie vor ihm und seinen Wagen herlaufen.
Es wird sie zu Oberen über Tausend und zu Oberen über Fünfzig einsetzen.
Er wird sie sein Land pflügen und seinen Ertrag ernten lassen.
Er wird sie Kriegsgerät und Fahrgerät machen lassen.
Er wird eure Töchter nehmen als Kosmetikerinnen, Köchinnen, Bäcker.
Eure Felder wird er nehmen, eure Weinberge, Ölhaine, die guten,
er wird sie seinen Ministern geben …
… und ihr werdet seine Sklaven sein.
An jenem Tag werdet ihr aufschreien wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt.
Der NAME aber wird euch nicht antworten, an jenem Tag.
Ton Veerkamp zitiert „diese Texte so ausführlich“,
damit wir uns eine schriftgemäße Vorstellung über die basileia tou kosmou toutou {das Königtum dieser Welt} machen können. Das Königtum Gottes, in dem Jesus der messianische König ist, unterscheidet sich absolut von jener „Rechtsordnung des Königs (mischpat ha-melekh)“. Was Samuel beschreibt, passt auf sämtliche Großreiche der Antike, und es passt erst recht auf Rom. Das Königtum des Messias, die dritte Zeile, ist, gemäß der Tora und den Propheten, die absolute Alternative zur malkhut ke-khol ha-gojim {Königtum wie bei allen Völkern}, zu Rom.
Bereits ganz zu Anfang hat Veerkamp gesagt, dass Pilatus „das nicht verstehen“ kann. „Er versteht nur eins, Jesus sei irgendwie ein König.“ Seine nächste Frage in Vers 37: „Also ein König bist du doch?“ formuliert Pilatus
so, dass die Antwort positiv sein muss. Jesus reagiert klug. Klug, weil er sich nicht im Sinne der römischen Gerichtsordnung selbst belasten will: „Du sagst es [nicht ich!], dass ich ein König bin [aber nicht ein König, wie du denkst].“
Die gesamte Antwort Jesu in Vers 37 übersetzt Veerkamp folgendermaßen:
„Du sagst, dass ich ein König bin!
Ich bin dazu gezeugt worden und dazu in die Weltordnung gekommen,
dass ich die Treue bezeuge.
Jeder, der von der Treue her ist, hört auf meine Stimme.“
Dazu betont Veerkamp zunächst, dass wir in der zweiten Zeile
[z]weimal … eis touto, ‚dazu‘“ hören. Das kann sich auf das Vorangehende beziehen, auf das Königtum Jesu. Es kann sich auf das Nachfolgende beziehen, „Zeugnis geben über die Treue“. Beides ist gemeint. In Israel verkörpert der König von Psalm 72 die Treue Gottes zu Israel. Dazu ist er „gezeugt worden und in die Welt gekommen“, nämlich rechtschaffener, Recht schaffender Hirte des Volkes zu sein und die einzelnen Mitglieder des Volkes (die Schafe) zusammen zu halten. Die realen Könige der Völker und auch Israels taten und tun in der Regel das Gegenteil (vgl. Ezechiel 34).
Weiter stellt Veerkamp die Frage, warum der johanneische Jesus in einer so merkwürdigen Doppelung vom Gezeugtwerden und in-die-Welt-Kommen redet. Eine überzeugende Antwort findet er im 2. Psalm:
Warum „gezeugt worden“? „In die Welt gekommen“ würde völlig reichen (vgl. 11,27). Johannes ruft aber die Assoziation zu Psalm 2,6f. auf:
Ich habe dich ernannt zu meinem König,
über Zion, dem Berg meiner Heiligung.
Ich will es erzählen, den Beschluss:
Der NAME sprach zu mir: „Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt.“Mit den Worten „dazu bin ich gezeugt, dazu in die Welt gekommen“ hören wir zugleich, „wie die Völker toben“, wie „die Könige der Erde, ihre Erlauchten, eine Sitzung zusammenrufen / gegen den NAMEN und seinen Messias (‚Gesalbten‘, meschicho, christou autou)“. Genau das geschieht hier.
„Verlange, und ich gebe dir die Völker als Erbteil, zum Besitz die Ränder der Erde (das römische Imperium), du magst sie zerschmettern mit einem eisernen Stock, zerschlagen wie ein Gerät aus Ton.“ Das ist eine Sprache, die uns nicht gefällt. Aber die Erhöhung dieses Messias ist das Ende für Rom, die Zerschlagung dieses Reiches, die Vernichtung der mischpat ha-melekh, der Rechtsordnung des Königs. Dazu lässt uns Johannes Psalm 2 mithören. In Zeiten nach der katastrophalen Niederlage von 70 ist der zweite Psalm der Strohhalm, an dem sich die isolierte messianische Gemeinde des Johannes festklammert.
So kann eine Auslegung von Johannes 18,36-37 aussehen, die sich konsequent von den jüdischen Schriften leiten lässt und den jüdisch-messianischen Blick des Johannes auf diese Schriften ernst nimmt.
Anders als Wengst und Thyen übersetzt Veerkamp wie sonst auch das Wort alētheia nicht einfach mit „Wahrheit“, sondern mit „Treue“, da es zwar auch die Bedeutung „Wahrheit“ mit einschließt, aber hauptsächlich vom hebräischen Wort ˀemeth mit seiner Bedeutung der Verlässlichkeit und Treue her verstanden werden muss. Dass Pilatus von all dem nichts versteht, kommt daher in Vers 38a bezeichnenderweise in einer knappen Bemerkung über diese Wahrheit oder Treue zum Ausdruck:
Das Wort „Treue“ kommt ihm sowieso „spanisch“ vor. Treue hat in der Realpolitik nichts verloren. Politik ist ein Spiel der Intrigen, der Lügen, des Verrates und der falschen Freunde, die nur auf eine Gelegenheit warten, den Konkurrenten eine Falle zu stellen. Auch die Götter Griechenlands und Roms waren notorisch treulos. Aus diesem Umstand bezogen die großen Tragödiendichter ihren Stoff. „Was ist schon Treue?“ Pilatus wendet sich achselzuckend von Jesus ab und den Judäern vor dem Prätorium zu.
↑ Johannes 18,38b-40: Pilatus bietet der judäischen Führung den König der Juden statt des Terroristen Barabbas zur Freilassung an
Und als er das gesagt hatte,
ging er wieder hinaus zu den Juden
und spricht zu ihnen:
Ich finde keine Schuld an ihm.
18,39 Ihr habt aber die Gewohnheit,
dass ich euch einen zum Passafest losgebe;
wollt ihr nun,
dass ich euch den König der Juden losgebe?
18,40 Da schrien sie wiederum:
Nicht diesen, sondern Barabbas!
Barabbas aber war ein Räuber.
[7. Januar 2023] Klaus Wengst zufolge (W507) wendet sich in Vers 38b
Pilatus, der sich der Frage der Wahrheit nicht stellen will, … von dem Angeklagten ab, der ihn mit ihr konfrontiert hat, und geht wiederum hinaus zu den Anklägern vor dem Prätorium. Ihnen gegenüber stellt er fest: „Ich finde keine Schuld an ihm.“ Diese Erklärung ist von der vorangehenden Darstellung so motiviert, dass Pilatus auf der Ebene, von der her Jesus mit ihm gesprochen hat, keine Gefahr für die von ihm repräsentierte Macht erkennt. Dessen Reden hat für ihn keine Realität. Er wird den hochmütigen Träumer seine Macht schon noch spüren lassen. Vorerst treibt er seinen Spott mit den Anklägern.
Die Einschätzung (Anm. 300) von Barrett, <1312> Pilatus werde „als durchaus freundlich gegenüber Jesus dargestellt“, ist in den Augen von Wengst „ein Fehlurteil. Er inszeniert ein zynisches Spiel – sowohl gegenüber dem Angeklagten als auch gegenüber den Anklägern.“ Das stellt Pilatus in der folgenden Szene sofort unter Beweis (Anm. 301):
Wenn ein römischer Präfekt so dargestellt wird, dass er nach der ausdrücklichen Feststellung der Unschuld eines Angeklagten diesen nicht freilässt, sondern weiter ein böses Spiel mit dem Angeklagten und seinen Anklägern treibt, dann ist das – entgegen einer verbreiteten Behauptung – alles andere als eine Entlastung der römischen Seite im Prozess gegen Jesus.
Die Verse 39 und 40 enthalten das Amnestie-Angebot für Jesus im Austausch gegen Barabbas (Anm. 299) gegenüber „der breiten Darstellung dieser Szene in den synoptischen Evangelien … in einer sehr komprimierten Form.“ Wengst nimmt an, dass „Johannes hier Tradition vorgegeben“ war, man aber im Blick auf die „Gestalt der Tradition … über ein Raten nicht hinaus“ kommt.
Eigentlich (W507) müsste Pilatus, „nachdem er Jesus für unschuldig erklärt hat, … ihn freilassen.“ Stattdessen
macht er den Anklägern ein Angebot. Dabei bezieht er sich zunächst auf einen Brauch: „Ihr seid es gewohnt, dass ich euch an Pessach einen freigebe.“ Pilatus kommt also von sich aus auf diese Gewohnheit zu sprechen; er wird nicht von anderen dazu gedrängt.
Dass ein solcher „Brauch einer Pessachamnestie … nirgends sonst belegt und in sich unwahrscheinlich“ ist, spielt für die Darstellung des Johannes keine Rolle. Er verwendet in Vers 39 die ihm vorliegende Tradition sehr sparsam zu dem einzigen Zweck, die Ankläger Jesu zu verhöhnen (W508):
Unter Verweis auf seine Gewohnheit, ihnen an Pessach einen freizugeben, fragt Pilatus die Ankläger: „Wollt ihr also, dass ich euch den König des jüdischen Volkes freigebe?“ Er nennt nicht den Namen dessen, den er zur Freilassung anbietet, sondern gebraucht den Titel „der König des jüdischen Volkes“. Er behauptet die Unschuld Jesu – und bietet ihn im selben Atemzug den Anklägern als zu Amnestierenden unter der Bezeichnung an, mit der die Anklage formuliert war. Diese Bezeichnung hat Jesus im Gespräch mit Pilatus nicht negiert, wenn er auch auf einer anderen Ebene als der der Anklage sprach. So wie Pilatus formuliert, verhöhnt er die Ankläger, indem er den Angeklagten gerade als den anbietet, als den sie ihn ausgeliefert haben. Sie ihrerseits können sich unmöglich „den König des jüdischen Volkes“ freibitten, wollen sie nicht selbst als illoyal erscheinen. So ist das Angebot des Pilatus von vornherein darauf angelegt, abgelehnt zu werden.
Dass das Amnestie-Angebot, wie es in Vers 40 dargestellt wird, „einen Aufschrei der Ankläger“ provoziert, mag also sogar dem Kalkül des zynisch agierenden Machtpolitikers entsprechen. Wengst warnt davor (Anm. 302), das Schreien, kraugazein, im Sinne des entfesselten Wütens einer jüdischen Volksmenge aufzufassen, sondern vergleicht es mit dem „Aufschrei“ einer „jüdischen Delegation“, die Pilatus in einer von Philon in Legatio ad Gaium 300f. geschilderten Szene „um die Entfernung der am Herodespalast in Jerusalem angebrachten vergoldeten Schilde“ bittet: „Auf die schroffe Ablehnung des Pilatus hin – heißt es – „schrien sie auf“; und dann wird zitiert, was sie sagten. Philon gebraucht nicht dasselbe Wort wie hier Johannes, aber ein vergleichbares.“ Ähnlich wie dort hat auch „Johannes bei den jüdischen Anklägern nur die Oberpriester im Blick …, von einer Wachmannschaft begleitet“; er denkt „nicht an die Anwesenheit einer Volksmenge“.
Das Wort palin, gewöhnlich mit „wiederum“ übersetzt (Anm. 303), passt an dieser Stelle „nicht in den johanneischen Kontext“, denn die Ankläger haben bisher ja noch gar nicht geschrieen. Nach Wengst scheint es „bei den Abschreibern durch Einfluss von Mk 15,13 eingedrungen zu sein.“ Übersetzt man palin allerdings mit „dagegen“, erscheint das Wort dem Kontext durchaus angemessen.
Indem die Ankläger (W508) die Forderung stellen: „Nicht den, sondern Barabbas!“, nennen auch sie
nicht den Namen dessen, der ihnen zur Freilassung angeboten ist, nehmen aber selbstverständlich auch nicht den von Pilatus gebrauchten Titel auf, sondern bezeichnen ihn – sozusagen nur einen Seitenblick auf ihn werfend – mit einem Demonstrativpronomen. Für die Freilassung geben sie eine mit Namen genannte Alternative an: Barabbas. Johannes hat den Barabbas nicht vorher eingeführt.
Zur „abschließenden kommentierenden Bemerkung“ (W508f.): „Barabbas aber war ein Räuber“, erklärt Wengst (W509):
In 10,1 und 8 hatte er das Wort „Räuber“ parallel neben „Dieb“ gebraucht; und beide standen im Gegensatz zum guten Hirten: Die Ankläger erbitten sich einen Räuber frei, während sie den guten Hirten hingerichtet sehen wollen. Johannes hat seinerseits auf Barabbas nur einen Seitenblick geworfen und richtet die Aufmerksamkeit seiner Leser- und Hörerschaft sogleich wieder auf Jesus. Er vermerkt nicht, dass Pilatus den Barabbas tatsächlich freigelassen habe.
Obwohl Wengst weiß (Anm. 305), dass „Josephus … das hier mit ‚Räuber‘ übersetzte griechische Wort lestés zur Kennzeichnung der Angehörigen der Aufstandspartei“ gebraucht und dass Barabbas von „Markus und Lukas …, ohne das Wort lestés zu gebrauchen, ausdrücklich als ein Aufständischer bezeichnet“ wird, „der bei einem Aufruhr auch einen Mord begangen habe (Mk 15,7; Lk 23,19)“, sieht er es „durch nichts nahegelegt …, dass er demselben Sprachgebrauch wie Josephus folgt“. Hier kommt es entscheidend darauf an, ob man bereits im Hirtengleichnis (10,1.8) die Worte lēstēs und kleptēs tatsächlich einfach mit „Räuber“ und „Dieb“ zu übersetzen hat, oder ob nicht auch schon dort ein Zusammenhang mit den Aufständischen des Jüdischen Krieges vorauszusetzen ist.
Nach Hartwig Thyen (T721) erklärt Pilatus in Vers 38b „wieder draußen vor dem Prätorium“ mit „den Worten, daß er keinerlei Schuld an Jesus finden könne (… vgl. Lk 23,4!), … den wartenden Juden das Resultat seines Verhörs, das ihn von der politischen Irrelevanz und Unschuld dieses sonderbaren ,Königs der Juden‘ (vgl. Mk 15,9) überzeugt hat. Dabei bezieht auch Thyen wieder wie in Vers 31
die Wendung, daß Pilatus hinausgegangen sei pros tous Ioudaious {zu den Juden} zusammenfassend auf diejenigen …, die Jesus gefesselt vom Palast des Hohenpriesters Kaiaphas zum Prätorium vor Pilatus geführt hatten, und sicher nicht auf das gesamte jüdische Volk, unter dem Jesus ja zahlreiche Sympathisanten hatte.
Anders als Wengst geht Thyen beim nun folgenden Vorgehen des Pilatus in Vers 39 nicht von der Absicht einer zynischen Verhöhnung der Ankläger Jesu aus; vielmehr scheint er – mir völlig unverständlicherweise – das Amnestie-Angebot für Jesus als ein Zugeständnis an die Ankläger Jesu aufzufassen:
Pilatus hofft nun, sich dem Druck der auf Jesu Verurteilung zum Tode drängenden Juden dadurch entziehen zu können, daß er sie an einen bei ihnen bestehenden Brauch erinnert, daß er am Passafest einen der unter seiner Aufsicht gefangenen Delinquenten zu amnestieren pflege. Unter Berufung auf diesen angeblichen Brauch einer Passaamnestie fragt er sie nun: Wollt ihr, daß ich euch den ,König der Juden‘ freilasse? (vgl. Mk 15,91).
Was in Thyens Augen Pilatus nicht vorherzusehen vermochte, geschieht nun aber doch, nämlich dass Jesu Ankläger „dieses Angebot, zumal mit der Bezeichnung Jesu als des ,Königs der Juden‘, als zynisch“ empfinden. Daher reagieren sie
darauf mit dem Schrei: Nicht diesen, sondern Barabbas! Wozu der Erzähler nur knapp bemerkt: Barabbas aber war ein Räuber (lēstēs, ein Wort das Josephus häufig zur Bezeichnung der Zeloten gebraucht, um ihre terroristischen Ambitionen auszudrücken). Den wütenden Schrei: „Nicht diesen, sondern sondern Barabbas!“ erheben bei Johannes aber allein die draußen stehenden Ankläger Jesu, nämlich die von Kaiaphas zur Auslieferung Jesu an Pilatus ausgesandten Oberpriester samt ihrer Dienerschaft …
Mit dem bestimmten Artikel ton Barabbon {den Barabbas} wird dieser Mann,
der im gesamten Evangelium bisher überhaupt noch nicht genannt, geschweige denn näher charakterisiert worden ist, … gleichwohl… als eine den Lesern bekannte Figur eingeführt … Das bedeutet mit anderen Worten gesagt aber, daß wir hier wiederum ein intertextuelles Spiel unseres Evangelisten mit seinen synoptischen Prätexten vor Augen haben, an die auch die kurze nachgestellte Bemerkung: „Barabbas aber war ein Aufrührer“ (lēstēs) erinnern will.
Anders als Wengst setzt Thyen für lēstēs also eindeutig die Bedeutung „Aufrührer“ oder „Terrorist“ voraus, und er zieht zur weiteren Begründung das Hirtengleichnis heran:
Das Lexem lēstēs, gepaart mit kleptēs, hatte Johannes zur Bezeichnung der Gegenspieler des messianischen ,guten Hirten‘ schon 10,1 u. 8 {Thyen nennt versehentlich Vers 9} gebraucht. Wie zu Joh 10 oben ausgeführt, ist die Hirtenrede weithin ein intertextuelles Spiel mit Ez 34. Wohl ist sein Königreich, wie Jesus Pilatus versichert hatte (V. 36), nicht von dieser Welt. Dennoch greift aber die oft wiederholte Beteuerung von dessen unpolitischem Charakter entschieden zu kurz. Denn auch wenn Jesu Reich zwar nicht von und nach Art dieser Welt ist, „so ist es doch ,in dieser Welt‘ und erhebt in ihr seinen Anspruch. … Es ist gerade der nichtwelthafte Charakter dieses Reiches, durch den es auch die gesamte politische Sphäre an ihrer Wurzel tangiert und in Frage stellt“.
Mit diesem Zitat von Blank [83], das schon Wengst zur Auslegung von Johannes 18,36 angeführt hatte, unterstreicht somit Thyen, dass auch seine Sicht des Reiches Jesu, das nicht von dieser Welt ist, politische Implikationen zumindest nicht ausschließt. Thyen nutzt aber nicht die Gelegenheit eines Vergleichs von Jesus mit Barabbas, um sie hinsichtlich ihrer politischen Strategie zu unterscheiden, nämlich der agapē als einer gewaltfreien Praxis des freiwilligen Sklavendienstes füreinander auf der einen Seite und des zelotisch-terroristischen Aufstandes auf der anderen.
Nach Ton Veerkamp <1313> hat Pilatus
nicht verstanden, dass Jesus eine absolute Alternative zur römischen Weltordnung will. Und wenn er das schon verstanden hätte, kann er in ihm keine akute politische Gefahr erkennen. Jesus will weder Divisionen noch Legionen haben. Solche Weltverbesserer mögen lästig sein, gefährlich sind sie nicht. Am besten, man würde ihn negieren und ihn laufen lassen: „Ich finde keinerlei Grund für einen Prozess gegen ihn.“ Die Judäer sehen das anders. Sie wissen, welche Gefahr Jesus und ihm Ähnliche darstellen. Sie kennen die Schrift und wissen, welche politische Kraft der Traditionalismus in Judäa darstellt.
Damit bleibt Veerkamp dabei, auch die Gegner Jesu nicht von vornherein zu verteufeln, sondern in ihren Motiven ernst zu nehmen.
Das Amnestie-Angebot des Pilatus interpretiert er im Rahmen der politischen Interessenlage zwischen der Besatzungsmacht und einer ihr unterworfenen Nation, innerhalb derer es immer wieder auch um das Schicksal politischer Gefangener geht:
Pilatus kennt aber andererseits seine Judäer, und als gewiefter Politiker schlägt er ihnen einen Kuhhandel vor. Er hatte noch einen weiteren politischen Gefangenen, einen gewissen Barabbas, einen lēstēs, Terroristen. Markus 15,7 fügt hinzu, Barabbas sei anlässlich eines Aufruhrs, bei dem ein Mord begangen wurde, gefangen genommen worden. Barabbas war höchstwahrscheinlich ein Zelot, ein militanter Kämpfer für ein Judäa, wo die Tora uneingeschränkte Geltung haben wird. Pilatus beruft sich auf ein angebliches Gewohnheitsrecht, nach dem die Behörde einen Gefangenen freilassen kann. Dieses Gewohnheitsrecht behaupten unsere Evangelien, aber es gibt keinen weiteren Beleg für diese Behauptung. Für die Erzählung ist es aber ein wichtiges Element.
Die Grundbedeutung von lēstēs ist tatsächlich „Räuber“. Das Wort hat, wie Veerkamp in seiner Anm. 516 zur Übersetzung von Johannes 18,40 sagt, im „Munde der Obrigkeit … eine inkriminierende Konnotation.“ Deswegen übersetzt er mit „Terrorist“.
Der Name „Barabbas, Sohn des Vaters“, ist gebräuchlich. Veerkamp geht davon aus, dass Johannes den Namen bar abbas bewusst in seinem „Kontrast zu bar enosch {Sohn des Menschen}“ verwendet und so den am Kreuz der Römer getöteten Menschensohn dem mit tötender Gewalt agierenden Terroristen gegenüberstellt: „Johannes ist ein antizelotischer Text“.
In den Augen von Veerkamp hat die kurze Szene mit Barabbas für den Evangelisten also eine äußerst wichtige Funktion, nämlich die klare Absage der messianischen Bewegung an zelotische Umtriebe herauszustellen:
Rom stellt die Judäer vor die Wahl, einen harmlosen, nichtzelotischen, in Roms Augen „gewaltfreien“ Weltverbesserer, den sogenannten „Fürsten (Nazoräer), König der Judäer“, zu verlangen oder einen gewaltbereiten Freiheitskämpfer, der für sie eine weit größere Gefahr darstellt. Sie verlangen aber Barabbas. Die frommen Christen sind hier empört: Die Juden wollen einen erbarmungslosen Mörder statt eines sanften Gottessohnes. Aber der Text ist nicht moralisch, sondern politisch. Diese Judäer haben sich tatsächlich auf den bewaffneten Kampf eingelassen, sie haben tatsächlich Barabbas gewählt.
Die Messianisten, die sich auf Jesus beriefen, waren anderer Meinung, sagt Johannes. Das darf man bezweifeln, man muss es sogar, solange man auf der Ebene der Erzählung bleibt. Simon Petrus zog das Schwert, er wollte den Kampf, den bewaffneten Kampf. Erst nach dem katastrophalen Ausgang des judäischen Krieges, also erst in der Jetztzeit des Erzählers, sind die Wortführer dieser Messianisten, also Matthäus, Markus usw., von ihren Sympathien für die Zeloten endgültig geheilt worden. Deswegen flechten sie ihre Erzählung in den Vorfall um die Freilassung des Barabbas ein, um ihren Gemeinden jegliches Liebäugeln mit den Zeloten, die auch nach dem Krieg politisch aktiv waren, unmöglich zu machen.
↑ Johannes 19,1-3: Pilatus lässt Jesus geißeln und von seinen Soldaten als König der Juden verspotten und misshandeln
19,1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.
19,2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen
und setzten sie auf sein Haupt
und legten ihm ein Purpurgewand an
19,3 und traten zu ihm und sprachen:
Sei gegrüßt, König der Juden!,
und schlugen ihm ins Gesicht.
[8. Januar 2023] Nochmals wiederholt Klaus Wengst (W509), dass die Szene 19,1-3, „in der von den drei Hauptakteuren der Angeklagte allein ist, … in der Mitte der gesamten Komposition des Prozesses Jesu vor Pilatus“ steht. Damit ändert Johannes den Zeitpunkt der Auspeitschung, die nach „Mt 27,26b-30; Mk 15,15b-19 …, römischem ‚Recht‘ entsprechend, auf die Verurteilung zum Tode am Kreuz“ folgte, und stellt damit „den Zynismus der Macht heraus, mit dem Pilatus hier handelt.“ Aus dem Umstand (Anm. 307), dass Johannes mehrere Einzelheiten der Darstellung bei Markus nicht bietet, die „auch sehr gut in die Darstellung des Johannes gepasst“ hätten, meint Wengst den Schluss ziehen zu können, „dass er sie in seiner Tradition nicht vorfand … und dass er die synoptischen Evangelien nicht kannte“. Da Johannes allerdings häufig aus Prätexten übernommene Überlieferungen verkürzt, umformt und erweitert, ist dieses Argument nicht überzeugend.
Wörtlich wird die Geißelung Jesu in Vers 19,1 folgendermaßen dargestellt (Anm. 308):
„Daraufhin nahm Pilatus Jesus und peitschte ihn aus.“ Natürlich hat Pilatus Jesus nicht selbst ausgepeitscht und er hat ihn auch nicht „genommen“. Das „Nehmen“ betont, dass das Auspeitschen auf Veranlassung des Pilatus geschieht.
Indem Johannes (W509) „die Auspeitschung Jesu“ auf diese Weise nicht wie bei „Matthäus und Markus … nur beiläufig in einem Partizip erwähnt“, sondern „in einem eigenen Satz“ herausstellt, hebt er in besonderer Weise „die Verantwortlichkeit des Pilatus hervor“. In den Augen von Wengst ist es „in jedem Fall ein Willkürakt“, jemanden „auspeitschen zu lassen, den er gerade noch für unschuldig erklärt hat“. Keineswegs darf man laut Wengst (W510) dieses „brutale Geschehen der Auspeitschung, das schon zum Tode führen konnte“, als eine Handlung beurteilen, wie dies manche Exegeten tun, „mit dem Pilatus bei den Anklägern Mitleid mit dem Angeklagten erregen wollte, um ihn auf diese Weise freilassen zu können“. Carl Schneider <1314> beschreibt die „römische Geißel“ als „eine Ledergeißel mit eingeflochtenen Knochen und Metallstücken. Sie ist das grausamste Schlaggerät“. Bei einer Geißelung war „die Anzahl der Schläge … nicht festgelegt; man geißelte solange, bis das Fleisch in blutigen Fetzen herabhing. Geschlagen wurde von dazu angestellten Sklaven, der Verurteilte war dabei an eine Säule gebunden“.
Wenn Pilatus Jesus wirklich hätte freilassen wollen,
brauchte er nicht die Zustimmung der Ankläger – jedenfalls nicht in diesem Stadium des Prozesses, wie ihn Johannes bisher dargestellt hat. Wer einen Angeklagten, den er für unschuldig hält, so zurichten lässt wie Pilatus Jesus, legt einen solch menschenverachtenden Zynismus an den Tag, dass ihm auch die Erwartung menschlichen Mitgefühls bei anderen fremd sein muss. Er, der von der Wahrheit nichts wissen wollte, lässt den König „nicht von hier“, der für die Wahrheit Zeugnis ablegt und damit die Herrschaft nach Art dieser Welt hinterfragt, seine Macht spüren, indem er ihn zutiefst erniedrigt.
Dies wird auf die Spitze getrieben, indem nach Vers 2 und 3 der „durch die Auspeitschung gleichsam schon zum Tode Verurteilte … dem Mutwillen einer rüden Soldateska preisgegeben“ wird, die ihn (W511)
als König der Juden verspottet: „Dann flochten die Soldaten einen Kranz aus Dornen, drückten ihm den auf den Kopf und zogen ihm einen purpurfarbenen Mantel an, kamen zu ihm und sagten: ,Sei gegrüßt, du König des jüdischen Volkes!‘ Und sie gaben ihm Ohrfeigen.“ Die hier beschriebene Szene ist eine einzige Persiflage auf die Inthronisation eines Königs.
Indem Jesus „als ‚Huldigung‘“ von den Soldaten „Schläge ins Gesicht“ erhält, wird sein Anspruch, der „König des jüdischen Volkes“ zu sein, „lächerlich“ gemacht.
Auch Hartwig Thyen (T722) erläutert nach dem Wörterbuchartikel von Schneider die römische „Geißelung (verberatio)“ als „die auf ergangene Todesurteile stets folgende ,Begleitstrafe‘“ in ihrer ganzen Grausamkeit. Zur anschließenden Verspottung Jesu macht er mit Hart <1315> darauf aufmerksam, dass
man sich unter der Dornenkrone wohl ein Geflecht aus Zweigen der Dattelpalme vorstellen [muss]. Mit deren bis zu 30 cm langen Dornen ist sie die Karikatur der Strahlenkrone göttlicher Herrscher, so daß Jesus in dieser Szene als divus rex radiatus {göttlicher Strahlenkönig} erscheint … Das purpurne Obergewand ist wohl als eine entsprechende rote Toga zu denken. Nach Mt 27,30 drücken die Soldaten Jesus als königliches Zepter zudem noch ein Rohr (kalamos) in die Rechte und geben ihrer sarkastischen Verehrung dieses lächerlichen Judenkönigs dadurch Ausdruck, daß sie vor ihm auf die Knie fallen, ihm als dem König der Juden huldigen und ihm ins Gesicht schlagen.
Thyen teilt Wengsts Meinung nicht, das Fehlen einiger Einzelheiten weise darauf hin, dass Johannes „die synoptischen Evangelien nicht kannte“, sondern hält daran fest (T722f.), dass
Johannes im intertextuellen Spiel mit seinen synoptischen Prätexten … sowie mit dem Alten Testament und zumal mit dem Jesajabuch gelesen sein will. In Jes 50,6 spricht der Knecht JHWHs und erklärt: „Ich aber widerstrebte nicht und wich auch nicht zurück. Meinen Rücken bot ich den Schlagenden dar und meine Wangen den Raufenden. Ich verbarg mich nicht vor Schmähung und Bespeien“. Daß Pilatus den, den er soeben öffentlich für unschuldig erklärt hat, nun auspeitschen läßt, weist u.E. nicht auf eine andere Tradition, der Johannes hier folgte, sondern das entspricht, wie auch Wengst treffend sieht {siehe oben}, genau seinem Pilatusbild und dem „Zynismus der Macht“, die er den Römer hier ausüben läßt.
Ton Veerkamp <1316> interpretiert die Szene 19,1-3 wie Thyen auf dem Hintergrund des Buches Jesaja. Er denkt zunächst an das Kapitel 53:
Pilatus kommt mit seinem Kuhhandel nicht weiter, er macht eine Konzession. Er lässt Jesus auspeitschen. Die Strafe ist fast schon eine Todesstrafe. Viele überlebten die Tortur nicht. Die Geißelung Jesu ist, wie die ganze nachfolgende Szene, sicher als Erfüllung von Jesaja 53,4f. gemeint:
Er aber wurde durchbohrt wegen unserer Abtrünnigkeiten,
zerschlagen wegen unserer Verbrechen.
Gezüchtigt, uns zu befrieden,
durch seine Geißelstriemen wurden wir geheilt.Die Soldaten haben ihren Spaß an der Sache. Soll der sich wirklich zum König gemacht haben, dann werden wir ihn als König behandeln, mit Purpur und Krone ausstatten, „Heil dir, König der Juden“. Und sie schlugen ihn mit ihren Fäusten, rapismata, wie der Beamte des Großpriesters, 18,22.
In seiner Anm. 518 zur Übersetzung von Johannes 19,3 ergänzt Veerkamp, dass die Szene inspiriert ist
von Jesaja 50,4-9, besonders 50,6, wo in der Fassung der LXX beide Wörter, „auspeitschen“ (mastigoun) und „ins Gesicht schlagen“ (didonai rapisma) vorkommen: „Meinen Rücken gab ich hin den Peitschenden, meine Backen denen, die mich schlugen, mein Gesicht wende ich nicht ab, als sie mich verhöhnten und anspuckten.“
Indem Johannes hier auf das Schicksal des so genannten Gottesknechts aus dem Jesajabuch anspielt, entwickelt er nach Veerkamp „die antizelotische ‚Strategie‘ des Messias, die Johannes der Täufer schon ankündigte“. Dazu hatte er in seiner Anm. 73 zur Übersetzung von 1,29, wo es um „das Mutterschaf“ aus Jesaja 53,7 ging, „das verstummt vor seinen Scherern“, geschrieben:
Jesaja 53 handelt von einem Menschen, der Verantwortung für seine Stadt Jerusalem trug und von der Reichsregierung haftbar für die Rebellion der Stadtbewohner gemacht wurde. Das „Tragen der Sünden“ ist das Auf-sich-Nehmen der Folgen, die sich aus der Rebellion ergeben. Hier geht es um die Verirrung der Weltordnung, das heißt der Welt, die durch das Römische Reich geordnet wurde. Der „Menschensohn“ wird haftbar gemacht für diese Verirrung, er muss den Gang antreten, den der „Knecht Gottes“ in Jesaja 53 gehen musste. Es geht also nicht um moralische Verfehlungen der einzelnen Menschen, sondern um die Verirrung der ganzen Menschenwelt.
Um das freiwillig auf sich genommene Leiden des Messias als „Strategie“ der Überwindung der herrschenden Weltordnung begreifen zu können, muss man nach Veerkamp einsehen, was nach der jüdischen Bibel wirklich damit gemeint ist, dass „das Mutterschaf Gottes“ (ho amnos tou theou, gewöhnlich mit „Lamm Gottes“ übersetzt), die „Verirrung der Weltordnung“ (tēn hamartian tou kosmou {gewöhnlich mit „Sünde der Welt übersetzt“}) trägt:
Denn hamartia ist nicht eine individuelle moralische Fehlleistung (Sünde), sondern das, was eine ganze Gesellschaft in die Verirrung führt. Wenn man das berücksichtigt, kann man auch die Opfertexte des Buches Leviticus verstehen; wenn man etwas tut, was die Gesellschaft beschädigt, kaputt macht, kann man dem nur gerecht werden, indem man Dinge, Tiere vernichtet. Das Wort „Sünde“ ist viel zu religiös, um die schriftgemäße Dimension von chatath/hamartia zum Ausdruck bringen zu können.
Um aus der Welt zu schaffen, was die ganze Welt kaputt macht, genügen in den Augen des Johannes die bisherigen Sühneopfer nach dem 3. Buch Mose nicht mehr. Der Messias des Gottes Israels als die Verkörperung seines befreienden NAMENS muss dafür sein Leben freiwillig hingeben, indem er sich der schändlichsten Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz durch die Hände der römischen Weltordnung aussetzt.
↑ Johannes 19,4-5: Pilatus führt Jesus seinen Anklägern vor als „den Menschen“
19,4 Und Pilatus ging wieder hinaus
und sprach zu ihnen:
Seht, ich führe ihn heraus zu euch,
damit ihr erkennt,
dass ich keine Schuld an ihm finde.
19,5 Da kam Jesus heraus
und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand.
Und Pilatus spricht zu ihnen:
Sehet, welch ein Mensch!
[9. Januar 2023] In der Szene 19,4-7 treten Klaus Wengst zufolge (W511) zum ersten Mal „alle drei Hauptakteure zusammen“ auf. Zu Beginn eröffnet in Vers 4 das
Auftreten des Richters … die neue Szene: „Pilatus kam wieder heraus.“ Ohne es eigens erzählt zu haben, hat Johannes vorausgesetzt, dass Pilatus nach der Antwort auf sein Amnestieangebot ins Prätorium hineinging, um den Befehl zur Auspeitschung Jesu zu geben. Nun kommt er wieder zu den Anklägern heraus und kündigt ihnen an: „Passt auf! Ich lasse ihn euch herausbringen.“ In dieser Ankündigung gebraucht Pilatus zur Bezeichnung des Angeklagten nur das Personalpronomen und spricht – anders als in 18,39 – nicht vom „König des jüdischen Volkes“. Das braucht er hier auch nicht, obwohl er es genau so meint, wie die folgende Vorführung Jesu demonstrieren wird. Zuvor gibt er noch als deren Ziel an: „sodass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde“.
Wie bereits gesagt, kann Pilatus nicht die Absicht verfolgen, „mit der Vorführung Jesu … Mitleid bei seinen Anklägern zu wecken“. Wengst lehnt aber „auch die andere oft gegebene Deutung“ ab (W511f.),
Pilatus wolle die Ankläger zur Aufgabe ihrer Anklage bringen, um dadurch Jesus freizubekommen… Diese Deutung setzt voraus, Pilatus bedürfe der Zustimmung der Ankläger, wenn er Jesus freilassen wolle. Noch in der nächsten Szene wird er gegenüber Jesus feststellen, dass er Macht habe, ihn freizulassen oder kreuzigen zu lassen. Mit der Vorführung Jesu macht er in der Tat die Anklage lächerlich. Indem er einen von ihm für unschuldig Gehaltenen so vorführen lässt, verhöhnt er den Angeklagten und die Ankläger gleichermaßen.
In Vers 5 heißt es dann (W512):
„Da kam Jesus heraus.“ Er wird nicht gebracht, sondern er kommt selbst – ein leiser Hinweis auf seine Souveränität, die im Gespräch mit Pilatus in der folgenden Szene wieder klar hervortreten wird. Die Beschreibung Jesu erinnert an die vorangegangene Szene: „Er trug die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel.“ Da kommt eine elende Erscheinung, ein Opfer missbrauchter Macht und sadistischer Rohheit, zum Spott und Hohn als König ausstaffiert – „die Karrikatur eines Königs“. <1317>
Für die Aussage des Pilatus über Jesus: „Seht doch! Da ist der Mensch!“, hält sich nach Wengst die „nächstliegende und einfachste Erklärung … ganz eng an die dargestellte Situation, in der Pilatus seine Einschätzung des als Königsprätendenten angeklagten Jesus demonstrieren will.“ Wengst fragt sich aber, ob „damit im Blick auf die Leser- und Hörerschaft des Johannes schon alles gesagt“ ist:
Sie soll sich ja nicht die Einschätzung des Pilatus zu eigen machen. Sie kann in seiner Aussage mehr erkennen, als dieser in der erzählten Situation meint. Sicherlich sind solche Erwägungen verfehlt, die hier eine Darstellung des allgemein Menschlichen finden wollen, des Menschen überhaupt und schlechthin. Jesus ist hier der elende und erniedrigte Mensch. Wenn er „den Menschen“ repräsentiert, dann ist er Repräsentant der Erniedrigten und Beleidigten, der Geschlagenen und Gefolterten. Dass diese Dimension mitschwingen soll, ist im Blick auf die Situation der ersten Leser- und Hörerschaft alles andere als abwegig. Die von ihr erfahrene Bedrängnis hat gewiss nicht das hier an Jesus dargestellte Ausmaß. Aber in 15,18 hat er ihr gesagt: „Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.“ Ihm ist nicht fremd, was sie erfährt.
So gesehen (W513) kann die
dargestellte Szene mit dem Pilatus-Wort … späteren Leserinnen und Lesern die Augen öffnen für die lange Reihe derjenigen, die dieser Jesus repräsentiert – innerhalb und außerhalb der Kirche. Er ist hier ein zutiefst erniedrigter Mensch. An der Tatsächlichkeit dieser Erniedrigung gibt es nichts zu rütteln. Und doch sagt Pilatus mit seinem Wort: „Seht doch! Da ist der Mensch!“ zu wenig. Von dem er so spricht, ist kein anderer als derjenige, den Johannes schon im Prolog in die Dimension Gottes gerückt hat – eine Dimension, die er bei der Festnahme Jesu (18,4-6) und bei dem Gespräch mit Pilatus (13,36) wieder deutlich hat anklingen lassen. Beides ist nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammen zu sehen: In diesem geschundenen Menschen Jesus erkennt der Glaube den in die tiefste Niedrigkeit mitgehenden und sie überwindenden Gott.
Auch Hartwig Thyen (T723) hebt hervor, dass in Vers 4 „draußen vor dem Prätorium“ zum „ersten Mal … alle drei Parteien versammelt“ sind,
nämlich die Ankläger, der Richter und der Angeklagte. Pilatus tritt also vor die draußen versammelten Oberpriester und ihre Diener (V. 6) und erklärt ihnen, daß er ihnen Jesus jetzt vorführen werde, „damit ihr erkennt, daß ich keinerlei Schuld an ihm habe erkennen können“. Wie zuvor die Wendung: elaben ho Pilatos ton Iēsoun kai emastigōsen {Pilatus nahm Jesus und geißelte ihn} (V. 1) natürlich nicht sagen will, Pilatus persönlich habe Jesus ergriffen und ihn gegeißelt, sondern vielmehr, daß Pilatus die Ergreifung Jesu und seine Geißelung angeordnet habe, so muß auch das ide agō hymin auton exō verstanden werden: „Seht, ich lasse ihn euch vorführen“.
Wie Wengst ist auch Thyen davon überzeugt, dass „der Anblick des derart geschundenen und entstellten ,Narrenkönigs‘“ bei Jesu Anklägern gewiss kein Mitleid hervorrufen sollte, um seine Freilassung zu bewirken. Stattdessen will Pilatus, wie Thyen unter Berufung auf Blank <1318> meint, „ihnen so mit dem ihm eigenen Zynismus die Gegenstandslosigkeit ihrer Anklage demonstrieren“.
Indem Jesus in Vers 5 wie „schon bei seiner Verhaftung im Garten (18,2ff)… auch hier nicht von anderen ergriffen und vorgeführt“ wird, sondern selber herauskommt (exēlthen oun ho Iēsous exō), ist er
also auch hier noch Herr der Lage und tritt als der soeben verhöhnte König purpurfarben gewandet und mit einer Dornenkrone auf dem Haupt vor die Priesterschaft seines Volkes … Denn anders als in den synoptischen Prätexten (Mk 15,20; Mt 27,31) werden Jesus diese königlichen Insignien vor seinem Weg nach Golgatha nicht wieder ausgezogen und durch seine eigenen Kleider ersetzt, sondern Johannes läßt ihn diesen Weg als den mit Dornen Gekrönten und in Purpur Gekleideten gehen. Daß er auch darin noch Herr der Lage und unterwegs ist, sein Leben, das ihm keiner nehmen kann, freiwillig hinzugeben, markiert der Evangelist – wiederum in intertextuellem Spiel mit Mk 15,21 (Mt 27,32; Lk 23,26) – dadurch, daß in seiner Erzählung Jesus selbst sein Kreuz trägt (bastazōn heautō ton stauron: V. 16) und kein Simon von Kyrene von den zur Kreuzigung Jesu abkommandierten Soldaten dazu gezwungen werden muß, es zu tragen.
Das Ende von Vers 5 legt Thyen (T723f.) unter Rückgriff auf Bultmann [510] folgendermaßen aus:
Mit den Worten: idou ho anthrōpos, „Seht, da ist der Mensch!“, präsentiert Pilatus den Juden Jesus als einen ,Spottkönig‘, „als die Karikatur eines Königs … Da seht die Jammergestalt! Im Sinne des Evangelisten ist damit die ganze Paradoxie des Anspruchs Jesu zu einem ungeheuren Bilde gestaltet. In der Tat: solch ein Mensch ist es, der behauptet, der König der Wahrheit zu sein! Das ho logos sarx egeneto {das Wort ward Fleisch} ist in seiner extremsten Konsequenz sichtbar geworden“.
Gegen alle Exegeten (T724), die wie etwa Becker <1319> meinen, dass für den Evangelisten Johannes das Kreuz Jesu gerade „nicht Tiefpunkt in der Konsequenz der Inkarnation, vielmehr Rückkehr des Gesandten zum Vater, nicht paradoxe Einheit von Niedrigkeit und Verherrlichung, sondern nach der Sendung in die Welt der notwendige komplementäre Teil dazu, nämlich Jesu Erhöhung als Rückkehr zum Vater“ sei, hält Thyen mit Bultmann und Wengst daran fest, dass man „realistischer als Johannes … Jesu tatsächliche und totale Erniedrigung ja wohl kaum beschreiben“ könne:
Darin, daß die paradoxe Einheit von Erniedrigung und Verherrlichung keinesfalls zugunsten oder zu Lasten der einen oder der anderen Seite aufgelöst werden darf, besteht darum das unumstößliche Recht von Bultmanns Interpretation …
In der Verwendung des bestimmten Artikel „bei anthrōpos {der Mensch}“, der „hier den Charakter eines Demonstrativpronomens“ hat, sieht Thyen „kein Indiz dafür, daß ho anthrōpos hier als messianisches Prädikat … gebraucht wäre, wie das Richardson, Meeks und Schnackenburg <1320> unterstellen. Letzterer
und viele andere sehen in der Wortverbindung ho hyios to anthrōpou {der Sohn des Menschen} ein geläufiges apokalyptisch-messianisches Hoheitsprädikat, das der Erzähler Pilatus hier nur deshalb nicht gebrauchen lasse, weil diese semitische Wendung im Munde des Römers doch unpassend und seltsam klänge (vgl. Schnackenburg, Ecce homo 373).
Dass Thyen vom Rückbezug der johanneischen „Wendung ho hyios tou anthrōpou“ auf die Gestalt des Menschensohnes von Daniel 7 nichts wissen will, betont er erneut, ohne dieser Begründung neue Argumente hinzuzufügen.
Auch Ton Veerkamp <1321> beschreibt die Motive der Vorführung des geschundenen Jesus durch Pilatus in den Versen 4 und 5 ähnlich wie Wengst und Thyen:
Was Pilatus gedacht oder gefühlt haben mag, als er Jesus vorführte, hat uns Johannes nicht verraten. Seine Erzählfigur Pilatus ist nicht gerade eine humane Gestalt. Pilatus kann das Wort „Mensch“ nur geringschätzig meinen. Er will, dass die Menschen draußen vor dem Prätorium Jesus als klägliche Figur sehen, von der weder für sie noch für Rom Gefahr ausgehen kann.
Darin, dass er diese Jammergestalt hat auspeitschen lassen, mag er Veerkamp zufolge eine „Konzession“ zur Besänftigung seiner Gegner sehen und rechnet wohl damit, dass diese jetzt Ruhe geben. „Er sagt, er finde keinerlei Schuld bei Jesus, beweist seinen Zynismus“. Für nicht ausgeschlossen hält es Veerkamp, dass im Hintergrund dieser Darstellung der Geißelung und Vorführung Jesu ein Ereignis aus dem Jüdischen Krieg eine Rolle spielt:
Wir kennen aus der Darstellung des judäischen Krieges von Flavius Josephus {Bell. 6,5,3 in der Übersetzung von H. Clementz} einen Zwischenfall. Ein gewisser Jesus, des Ananus Sohn, lief im Jahr 62 durch die Stadt mit einem Wehruf: „Kampfgeschrei aus dem Osten, Kampfgeschrei aus dem Westen, Kampfgeschrei aus den vier Winden. Wehe Jerusalem, Wehe dem Heiligtum, wehe Bräutigam und Braut, wehe dem ganzen Volk“, wie Jeremia (7,34). Tag und Nacht schrie er, er ging den Leuten so auf die Nerven, dass sie ihn dem Prokurator Albinus auslieferten. Dieser ließ ihn auspeitschen, „bis auf die Knochen zerfleischt“. Er rief auch unter der Tortur weiter. Albinus, überzeugt, dass er es mit einem Verrückten zu tun hatte, ließ ihn laufen.
Wir wissen nicht, ob dieser Vorfall irgend etwas mit der Szene der Geißelung in unseren Evangelien zu tun hatte. Pilatus hätte aber mit Jesus ben Joseph so handeln können, wie sein Nachfolger Albinus dreißig Jahre später mit Jesus ben Ananus gehandelt hat.
Das hat Pilatus allerdings nicht getan, vielmehr wurde Jesus am Ende doch gekreuzigt. Zuvor lässt Johannes
Pilatus wieder die Rolle des bewusstlosen Propheten spielen, genauso wie er Kaiphas diese Rolle spielen ließ, 11,51. „Seht den Menschen“ ist, aus dem Munde des zynischen Römers, die Erfüllung des Schriftwortes Jesaja 53,3.
Genau in seinem menschenverachtenden Verhalten zeigt Pilatus,
ohne sich dessen bewusst zu sein, wie sehr Jesus eins mit dem Knecht des NAMENS aus Jesaja 53 geworden ist. Er führt Jesus in vollem Königsornat heraus, mit Purpur und Krone aus Dornen, und sagt: „Seht den Menschen!“ Er zitiert, ohne es zu wissen, Jesaja 53,3:
Verachtet, gemieden von Männern (ˀischim), ein Mensch (ˀisch) der Schmerzen,
der Krankheit bewusst, ohne Gesicht, verborgen vor uns,
verachtet, ihn schätzten wir nicht mehr.Im hebräischen Text ist die Rede von ˀisch, Mann; in der griechischen Fassung dagegen von anthrōpos, Mensch. Bei Johannes verweist das Wort auch auf den hyios tou anthrōpou, bar enosch, MENSCH. Pilatus kennt natürlich den bar enosch nicht. Aber die Zuhörer des Johannes müssen lernen, dass der MENSCH nicht wie bei Matthäus „auf den Wolken kommt“ (25,31), sondern er kommt in der Gestalt eines geschundenen, verächtlich gemachten Menschen. So, und nur so, geschieht Befreiung, sagt Johannes.
In dieser Weise sieht Veerkamp bei Johannes die messianische Vorstellung des Menschensohnes aus Daniel 7 mit der Gestalt des Gottesknechts aus dem Jesajabuch verbunden und durch sie entscheidend verändert. Obwohl also Johannes seine messianische Botschaft voll und ganz in den jüdischen Schriften verwurzelt, entfernt er sich erheblich vom überlieferten Messianismus:
Die Messiasvorstellung eines „leidenden Knechtes des NAMENS“ ist zwar traditionell, aber diese Tradition ist nicht populär. Jesus ist die totale und absolute Gegengestalt des zelotischen Messias. Viele werden mit dieser Befreiungsfigur große Probleme haben. Das Leiden rettet nicht, sagen sie, es führe nicht weniger als das zelotische Abenteuer 66-70 in die Vernichtung. Johannes sagt: Der MENSCH wird so, hier vor dem Prätorium, vorgeführt. Dieser ist der MENSCH.
An die Adresse der christlichen Kirche, die sich das Johannesevangelium als einen ihrer Grundtexte zu eigen gemacht hat, richtet Veerkamp in diesem Zusammenhang mahnende Worte:
Dennoch sollten es sich die Christen nicht allzu einfach machen mit dem Satz: „Durch seine Geißelstriemen wurden wir befreit.“ Das Christentum hat in seiner Geschichte eher auf das Schwert als auf das stellvertretende Leiden gesetzt.
Jede neue Generation sollte neu über diesen MENSCHEN als über unseren Messias und Befreier nachdenken. Diese theologische Aufgabe kann keine Auslegung des Johannesevangeliums vorwegnehmen. Auf alle Fälle kommt kein Messias Wundermann mehr, erst recht keiner mit dem Schwert. Was ist befreiend an dem MENSCHEN der Schmerzen, gesichtslos, verachtet? Was es auch sei, es ist das Ende aller Illusionen, dass man der Macht, die Pilatus repräsentiert, mit einer Macht gleichen Kalibers beikommen kann.
↑ Johannes 19,6-7: Die priesterliche Führung Judäas fordert Jesu Kreuzigung gemäß der Tora, weil er sich zu Gottes Sohn gemacht hat
19,6 Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen,
schrien sie: Kreuzige! Kreuzige!
Pilatus spricht zu ihnen:
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn,
denn ich finde keine Schuld an ihm.
19,7 Die Juden antworteten ihm:
Wir haben ein Gesetz,
und nach dem Gesetz muss er sterben,
denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.
[10. Januar 2023] In Vers 6 lässt Johannes Klaus Wengst (W513) zufolge nun „in der Passionsgeschichte zum Zuge kommen, was er schon in 5,18 angelegt und danach mehrfach zum Ausdruck gebracht hat“ (7,25.30.32,44f.; 8,40.59; 10,31.39):
„Als ihn nun die Oberpriester und die Wachleute erblickten, schrien sie: ,Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen!‘“ Der schon so sehr Gedemütigte soll ganz und gar zunichte gemacht werden. … An diesen Stellen wurde aber auch deutlich, dass die Festlegung der Gegner Jesu auf die Absicht, ihn zu töten, von den Auseinandersetzungen aus der Zeit des Evangelisten bestimmt ist. Dementsprechend kommt nun der Streit dieser Zeit um die Bedeutung Jesu ins Spiel, wie er sich ganz ähnlich schon in 5,18 zeigte, der ersten Stelle, die von der Absicht sprach, Jesus zu töten. Zuvor aber nimmt Pilatus zur Forderung, Jesus zu kreuzigen, Stellung: „Lasst ihr ihn doch kreuzigen! Ich finde nämlich keine Schuld an ihm.“ Das kann nach 18,31 kein ernst gemeinter Vorschlag sein, sondern Pilatus redet in sarkastischer Weise, indem er den Anklägern ihre Schwäche demonstriert und sie damit erneut verhöhnt.
Nachdem Pilatus mehrfach die „Unschuld Jesu“ erklärt hat, weisen in Vers 7 „die Ankläger“, wie Bernhard Weiss sagt, <1322> „die Unterstellung zurück, als ob sie den Tod eines Unschuldigen verlangen“:
„Wir haben ein Gesetz und gemäß diesem Gesetz muss er sterben; denn er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht.“ Jetzt rückt der Kontroverspunkt aus der Zeit der Abfassung des Evangeliums ins Blickfeld. Ihn hat Johannes in ähnlicher Form schon in 5,18 und 10,33.36 angesprochen.
Wengst meint also (Anm. 323), dass Johannes „den Streit seiner Zeit um die Bedeutung Jesu mit dessen tatsächlich erfolgter Hinrichtung“ verbindet, „die wahrscheinlich dadurch veranlasst wurde, dass führende Persönlichkeiten Jesus an Pilatus auslieferten.“ Zum Streit der johanneischen Gemeinde (W514) mit der „jüdischen Mehrheit“ ihrer Zeit macht Wengst noch einmal deutlich,
dass es in der biblisch-jüdischen Tradition durchaus möglich ist, Menschen als „Sohn Gottes“, sogar auch als „Gott“ zu bezeichnen. Entschieden abgelehnt aber wird ein solches Reden, wenn es eigenmächtig erfolgt, d. h. wenn der in ihm erhobene Anspruch der Gemeinschaft nicht ausgewiesen erscheint und von ihr nicht akzeptiert wird. Das ist bei der jüdischen Mehrheit hinsichtlich des für Jesus erhobenen Anspruchs der Fall. Er bezeichnet daher eine Grenze, aber keinen prinzipiellen Gegensatz.
Damit grenzt sich Wengst (Anm. 324) einmal mehr von Wilckens <1323> ab, der „die Gottessohnschaft Jesu als seine wesenhafte Einheit mit dem Vater“ versteht (wobei die Hervorhebung von Wengst stammt):
Sie entspreche „in der Sache dem Selbstverständnis Jesu“. Nicht weniger als der johanneische Jesus hebe „er sich, was die Legitimation seiner Sendung betrifft, aus dem Rahmen israelitisch-jüdischer Autoritätsbegründung heraus“. So markiert nach ihm „das Bekenntnis zu Jesus, dem Sohn Gottes, […] von Anfang an nicht nur die Grenze zwischen Christentum und Judentum, sondern einen tiefgreifenden Gegensatz“. Mir scheint, dass ein solches Reden, das exklusiv die Kategorie „ehrlich“ für sich beansprucht, aufgrund mangelnder Wahrnehmung gegenüber jüdischen Zeugnissen und aus einem nicht geführten Gespräch heraus erfolgt.
Nach Wengst (W514) hat das „Einspielen dieses Streitpunktes in die Darstellung des Prozesses vor Pilatus“ lediglich „episodischen Charakter“, ist in seinen Augen also nebensächlich „und dient in ihr vor allem dazu, ein weiteres Gespräch zwischen dem Richter und dem Angeklagten zu veranlassen.“ Damit wendet er sich (Anm. 325) gegen Gniesmer, <1324> der diesen Streitpunkt seines Erachtens „überzeichnet“, wenn er schreibt:
„Sie pochen auf das damals von Mose gegebene Gesetz Gottes, aber verpassen gerade so den lebendigen, sich gegenwärtig offenbarenden Gott (vgl. z. B. 9,28ff und auch 8,33ff). So bewirkt das Gesetz, das doch Leben bringen soll, den Tod. Die Juden meinen, Gott zu dienen im starren Festhalten am Wortlaut des Gesetzes, doch sein lebendiges, menschgewordenes Wort verfehlen sie gerade so. Auch ist es die gleiche Haltung einer unmenschlichen Frömmigkeit, die schon in der Einleitung der Prozeßerzählung (18,28c.d) in Erscheinung trat. Dort halten die Juden peinlichst genau an ihren Reinheitsgesetzen fest, aber scheuen sich nicht, ihre Hände mit dem Blut eines Unschuldigen zu beflecken“. In einer Anmerkung fügt Gniesmer hinzu: „Um nicht den Spuren einer antijüdischen Exegese zu folgen, sei nochmals darauf hingewiesen, daß es sich hier um die Nachzeichnung der (aus ihrem zeitgeschichtlichen Kontext zu beurteilenden) Sichtweise des Johannes handelt.“ Abgesehen davon, dass die Reflexion, wie mit einer solchen „Nachzeichnung“ umzugehen ist, m. E. zur Exegese gehört, scheint mir diese „Nachzeichnung“ in wichtigen Punkten weniger vom Text des Johannesevangeliums selbst als vielmehr von seiner antijüdischen Auslegung bestimmt zu sein.
In der Antwort (T725) des Pilatus auf die lauthals mit den Worten: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ geäußerte Forderung der „Oberpriester und ihre Diener …, Jesus zu kreuzigen“, erkennt Hartwig Thyen den „ihm eigenen Sarkasmus“:
Dann nehmt ihr ihn doch hin (labete auton hymeis) und kreuzigt ihn, denn ich (egō gar ktl.) finde keine Schuld an ihm. Deutlich markieren hier die pronomina den Abstand zwischen den Klägern und dem Richter.
Denn Pilatus weiß natürlich, „daß die Kreuzigung eine spezifisch römische Art der Hinrichtung ist und daß den Juden überhaupt jegliche Kapitalgerichtsbarkeit entzogen ist“.
Erst daraufhin und zum Erweis, daß sie von Pilatus nicht die Tötung eines Unschuldigen fordern [Weiss 584f.] offenbaren die Oberpriester Pilatus nun den wahren Grund ihrer Anklage mit den Worten: „Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muß er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht“. Wie in Mk 14,61-64 / Mt 26,63-66 das Svnhedrium sein Todesurteil auf Jesu in seinen Augen blasphemische und damit todeswürdige Aussagen über sich selbst stützte, so klagen die Oberpriester Jesus jetzt vor Pilatus der Blasphemie an.
Zur diesbezüglichen Bemerkung von Haenchen: <1325> „Daß wir uns hier im Bereich einer nachösterlichen Diskussion zwischen Christen und Juden befinden, ist deutlich“, meint Thyen, dass das „freilich kein johanneisches Spezifikum“ ist, sondern „bereits den genannten synoptischen Prätexten gegenüber“ gilt, „mit denen Johannes wie bereits beim Tempelweihfest (10,22ff) so auch hier spielt.“
Seine folgenden Erwägungen scheinen aber auch damit zu rechnen, dass bereits zur Zeit Jesu innerhalb der sadduzäischen Priesterschaft solche Themen eine Rolle gespielt haben können:
Als die konkrete Torabestimmung, auf die sich Jesu Ankläger berufen, wird in der Regel Lev 24,13 u. 16 genannt: „Wer den Namen JHWHs lästert, der soll mit dem Tod bestraft werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen“ (vgl. zur näheren Bestimmung der Gotteslästerung in der rabbinischen Literatur Billerbeck, <1326> der die Rabbinen darum bemüht sieht, „durch engste Fassung des Begriffs Gotteslästerung ein Todesurteil wegen dieses Vergehens so gut wie unmöglich zu machen“ (ebd. 1018…). Doch das Synhedrium, das vor der Tempelzerstörung von der sadduzäischen Priesterschaft beherrscht war, dürfte da wesentlich rigoroser geurteilt haben. Josephus erklärt, im Vergleich mit allen übrigen Juden seien die Sadduzäer die unbarmherzigsten Richter gewesen (eisi peri tas kriseis ōmoi para pantas tous Ioudaious: Ant XX/199 {vgl. nach H. Clementz: Ant. 20,9,1}). Der jetzt vorgebrachten Anklage Jesu, daß er sich selbst zum Sohn Gottes gemacht habe, entsprechen auch die in 5,18 und 10,33ff vorausgegangenen Vorwürfe gegen Jesus sowie das Urteil des Synhedriums unter der Ägide des Kaiaphas (11,47ff), und endlich die wiederholten Versuche seiner Gegner, ihn zu steinigen (10,31ff; 11,8; vgl. Mt 27,43).
Bis zu diesem Zeitpunkt schätzt Ton Veerkamp <1327> Pilatus immer noch so ein, dass er Jesus am liebsten freilassen und von den Judäern in Ruhe gelassen werden will:
Offenbar geht Pilatus davon aus, dass das Bild dieses geschundenen und verhöhnten Menschen ausreichen würde, die Menge vor dem Prätorium zu besänftigen. Das Gegenteil ist der Fall. Man will ihn ans Kreuz bringen. Pilatus ist es leid, er gibt nach.
Darauf, dass Pilatus den Judäern sagt: „Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn“, geht Veerkamp nicht ein; er beschäftigt sich stattdessen näher mit der Frage, welchen Schuldvorwurf Jesu Ankläger gegen Jesus erheben und welches politische Ziel sie damit gegenüber Pilatus verfolgen:
In einer Hinsicht bleibt er [Pilatus] stur, er will bei Jesus keine Schuld festgestellt haben. Das reicht den Eliten Jerusalems nicht aus. Nach ihrer Tora ist Jesus schuldig und muss sterben, er habe sich zum „Sohn Gottes“ gemacht. Das soll amtlich festgestellt werden. Die Tora sieht bei der „Antastung des NAMENS“ Steinigung als Todesstrafe vor, Leviticus 24,10. Überhaupt sieht die mündliche Tora nur vier Tötungsarten vor: Verbrennung, Enthauptung, Steinigung und Erwürgung, Mischna Sanhedrin 7,1. Kreuzigung gehört nicht dazu. Kreuzigen ist die römische Manier, mit Rebellen abzurechnen.
Wer sich „Sohn Gottes“ nennt, erfüllt den Tatbestand der Blasphemie im Sinne der Tora und des Hochverrats im Sinne Roms. Beides wollen sie festgestellt wissen. Das politische Kalkül der führenden Priester war die Bloßstellung Jesu als Verbrecher im Sinne Roms. Sie wollen einen politischen Prozess vor einem römischen Gericht. Im Falle einer Verurteilung bleibt nur das Urteil: Tod durch das Kreuz. Erst wenn Pilatus das Urteil „Tod durch Kreuzigung“ ausspricht, haben die führenden Priester ihn mit in ihr politisches Boot genommen.
Ton Veerkamp lässt an dieser Stelle also alle Erwägungen außen vor, die sich auf die Auseinandersetzung zwischen messianischen und rabbinischen Juden über Jesu Messianität beziehen, sondern konzentriert sich ganz auf den Blasphemievorwurf als einem politisch relevanten Mittel, das die priesterliche Führung Judäas im Prozess gegen Jesus vorbringt, um ihn aus dem Weg zu räumen und ihre eigene Position gegenüber Rom zu stärken.
↑ Johannes 19,8-11: Die Furcht des Pilatus und die Frage, ob und woher er Macht hat
19,8 Als Pilatus das hörte,
fürchtete er sich noch mehr
19,9 und ging wieder hinein in das Prätorium
und spricht zu Jesus:
Woher bist du?
Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
19,10 Da sprach Pilatus zu ihm:
Redest du nicht mit mir?
Weißt du nicht,
dass ich Macht habe, dich loszugeben,
und Macht habe, dich zu kreuzigen?
19,11 Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich,
wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.
Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde.
[11. Januar 2023] Klaus Wengst zufolge (W514) hat „Pilatus in seinem ersten Gespräch mit Jesus sich der Frage nach der Wahrheit verweigert und anschließend seine Macht ausgespielt“. In den Versen 8 bis 11 pocht er (W515) im
zweiten Gespräch mit Jesus ausdrücklich auf seine Macht, als ihm dieser die Antwort verweigert. Dass er Macht gegen ihn hat, ist augenscheinlich; aber es wird ihm die eigene Souveränität bestritten. Was Pilatus in Ausübung seiner Macht an Jesus tut, muss letztlich einem anderen Willen und einer anderen Absicht dienen.
In Vers 8 nimmt Johannes „das Motiv von der Furcht des Machthabers vor dem göttlichen Menschen auf“, durch das in Erzählungen der Antike „die Sache im Konfliktfall für die Menschen, in denen göttliche Kräfte vermutet werden, gut“ ausgeht, da „es den irdischen Machthabern als töricht und riskant erscheint, ‚gegen die Götter zu kämpfen‘“. Dazu verweist Wengst (Anm. 327) auf ein „anschauliches Beispiel“, das
Philostrat in seiner Schrift „Das Leben des Apollonios von Tyana“ [erzählt]. Im Rom Neros wird Apollonios wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht gestellt. Als die Anklageschrift aufgerollt wird, ist sie leer. Der Richter Tigellinus vernimmt daraufhin Apollonios außerhalb der Öffentlichkeit. Der antwortet unerschrocken. Die Szene endet: „Diese Worte klangen nun dem Tigellinus so dämonisch und übermenschlich, daß er, wie wenn er sich fürchtete, gegen die Götter zu kämpfen, ausrief: ,Geh, wohin du willst! Du bist zu stark, um unter Kontrolle gehalten zu werden!“ <1328>
Aber (W515) der „Ausgang bei Jesus wird ein anderer sein“, daher hat nach Wengst für Johannes „das aufgenommene Motiv nur die Funktion, zu einem zweiten Gespräch zwischen Jesus und Pilatus zu führen.“ Als ähnlich nebensächlich hatte Wengst ja bereit „die von den Anklägern gemachte Aussage“ beurteilt, „Jesus habe sich selbst zum Sohn Gottes gemacht“, auf die hin Pilatus folgendermaßen reagiert:
„Als nun Pilatus diese Aussage hörte, erschrak er noch mehr.“ Schon Calvin meinte, es „bemächtigte sich seiner die Furcht, er könnte in diesem zutiefst verachteten Menschen eine Gottheit beleidigen“. <1329> …
Auffällig ist die Aussage, dass Pilatus „noch mehr“ erschrak bzw. sich „noch mehr“ fürchtete. So wie er bisher dargestellt wurde, hat sein Handeln keine Furcht gezeigt, nicht vor dem Angeklagten und nicht vor den Anklägern. Wenn Johannes jetzt dennoch vermerkt, dass Pilatus sich noch mehr fürchtete, lässt er gerade dessen so machtbewusst erscheinendes Handeln aus Angst heraus getan sein. Die Angst, die Macht zu verlieren, führt dazu, sie demonstrativ zu gebrauchen – und zu missbrauchen.
Aber, wie gesagt, nach Wengst hat die „Furcht des Pilatus … also die Funktion, ein erneutes Gespräch mit Jesus zu veranlassen. So geht er nach Vers 9 wieder ins Prätorium. Dass Jesus dorthin gebracht wurde, ist vorausgesetzt. Pilatus fragt ihn: „Wo bist du her?“ Das ist nicht die schlichte Frage des vernehmenden Beamten nach dem Geburts- oder Wohnort. Wengst beschränkt sich zur Deutung dieses Verses auf Zitate von Tholuck, Blank und Brodie: <1330>
Nach Tholuck ist sie so zu verstehen, dass sie „die Qualität mit in sich befaßt (9,29)“. Was ist die „Qualität“ dieses Angeklagten? „Jesus aber gab ihm keine Antwort.“
Blank zufolge gibt es „auf seine Frage im Grunde keine andere Antwort als die, die ihm Jesus schon im ersten Gespräch gegeben hat (vgl. 18,36-37); aber diese hatte Pilatus ja völlig ignoriert.“ Und nach Brodie
„wirkt Jesu Schweigen als Indikator eines Geheimnisses, des Tatbestandes nämlich, dass letztlich sein Ursprung auf Gott zurückgeht.“ Die Leser- und Hörerschaft des Evangeliums weiß und soll es sich hier in Erinnerung gerufen sein lassen, dass derjenige, der „natürlich“ aus Nazaret (1,46), aus Galiläa (7,41.52) kommt, „von oben“ ist (3,31; 8,23), gleichsam „himmlische Qualität“ hat.
Anders als etwa (Anm. 331) „in Mt 27,13f.; Mk 15,4f. gegenüber Pilatus und Lk 23,9 gegenüber Herodes (Antipas)“ bricht (W516) das „Schweigen Jesu … hier das Gespräch nicht ab, denn in Vers 10 reagiert Pilatus
auf Jesu Schweigen mit Fragen, die den Angeklagten zurechtweisen und zugleich seine, des Richters, Macht hervorkehren: „Mit mir redest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht habe dich kreuzigen zu lassen?“ Er ist der Statthalter Roms; er vertritt dessen imperiale Macht in der Provinz Judäa. Das Leben dieses Angeklagten liegt in seiner Hand. Er kann ihn laufen lassen und er kann ihn hängen lassen. Indem Pilatus sich so auf seine Macht beruft, hat er das Recht suspendiert. Die rechtsfreie Macht erweist sich als Willkür. „Da er der Macht der Wahrheit nicht traut, sucht er jetzt seinen Rückhalt in der ,Wahrheit der Macht‘.“ [Blank 96]
„Die unerschrockene Antwort Jesu“, die er in Vers 11 gibt, „ist nicht die eines Angeklagten, ‚sondern eines Richters‘“, wie Brodie [538] diese Umkehrung der Rollen deutet:
„Du hättest keine Macht gegen mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Deswegen hat größere Sünde, wer mich an dich auslieferte.“ Jesus stellt zunächst die Aussage des Pilatus über seine Macht, die er ihm gegenüber habe, in einen anderen Bezugsrahmen: Wäre es ihm nicht von Gott eingeräumt, könnte er gar nichts gegen ihn tun. Damit wird es Pilatus bestritten, dass er souverän handelt. Er setzt mit seiner Macht im Falle Jesu, mit der bevorstehenden willkürlichen Hinrichtung, kein letztes Faktum. Gott nimmt dieses schlimme Handeln in Dienst, indem er es in der Auferweckung des Gekreuzigten wendet.
Nach Wengst (Anm. 337) ist in Vers 11a
genau auf die Formulierung des Textes zu achten: Er spricht im Vordersatz von der „Macht gegen mich“ und hat im Nachsatz eine neutrische Form, nicht eine feminine. Es heißt nicht: „wenn sie (die Macht) dir nicht von oben gegeben wäre“, sondern: „wenn es (das bestimmte gegen Jesus gerichtete Handeln) dir nicht von oben gegeben wäre“. Diese vom Text gesetzte Akzentuierung, „daß nur an die faktische Gewalt gedacht werden kann“ [Tholuck 422…], spricht dagegen, hier eine grundsätzliche Reflexion über staatliche Macht zu sehen.
Bultmann <1331> dagegen vertritt in seinem Kommentar genau diese Sichtweise, die er allerdings später im „Ergänzungsheft (1957, 54) … revidiert“ hat: „Seine (Jesu) Worte besagen, daß die Autorität des Staates nicht aus der Welt stammt, sondern durch Gott begründet ist“. Darauf wird Wengst etwas später noch einmal zurückkommen.
Die Art und Weise, wie Gott die willkürliche Machtausübung des Pilatus in seinen Dienst nimmt, wird Wengst zufolge (Anm. 338) von Haenchen <1332> in „jeder Beziehung schief“ gedeutet, wenn er schreibt, dass es „zuletzt der Wille Gottes“ ist, „der alle Versuche des Römers, Jesus freizubekommen, scheitern lässt“:
Abgesehen davon, dass von einer Absicht des Pilatus, Jesus freizulassen, erst in V. 12 die Rede ist, begibt sich diese Deutung gleichsam in die Perspektive Gottes und verharmlost die tatsächlich erfahrene Geschichte zum Marionettentheater. In dem Wort Jesu jedoch kommt die Dimension Gottes als Widerspruch, als Protest gegen die Anmaßung der Gewalt zum Zuge. Vgl. auch die Auslegung zu 10,17f.
Zur Aussage Jesu in Vers 11b (W516f.): „Deswegen hat größere Schuld, wer mich an dich auslieferte“, gesteht Wengst (Anm. 339), dass er „die Überleitung mit ‚deswegen‘ nicht“ versteht:
Zudem erscheint mir der Komparativ als problematisch. Wieso sollte die Verfehlung des Richters, der einen Unschuldigen zum Tode verurteilt, geringer sein als die Verfehlung dessen, der ihm den Unschuldigen ausliefert und anklagt?
Immerhin meint Wengst (W517):
So problematisch der Komparativ ist, er impliziert jedenfalls, dass der Angeklagte auch dem Richter Schuld zuweist. Es gibt hier „keine Entlastung des Pilatus“ [Calvin 447].
Hier kommt Wengst auf „Bultmanns Auslegung der Stelle“ [513] zurück, denn sie
kann dem „Deswegen“ gerecht werden, indem sie sich auf V. 11a als eine grundsätzliche Aussage über staatliche Macht bezieht. Aber das führt auf eine seltsame Spur: „Der Staat vollzieht, sofern er wirklich als Staat handelt, seine Handlungen ohne persönliches Interesse; handelt er sachlich, so kann von einer hamartía („Schuld“, „Sünde“, „Verfehlung“) bei ihm überhaupt nicht die Rede sein. Handelt er unsachlich, indem er sich von der Welt für ihre Wünsche mißbrauchen läßt – wie Pilatus zu tun in der Gefahr ist und dann auch wirklich tut -, so behält sein Handeln doch immer noch etwas von seiner Autorität; noch ist wenigstens die Form des Rechtes gewahrt und damit die Autorität des Rechtes anerkannt, sodaß sich der ungerecht Verurteilte zu fügen hat […]. Der Staat kann, so lange er noch in irgendeinem Grade staatlich handelt, nicht mit der gleichen persönlichen Feindschaft, mit dem gleichen leidenschaftlichen Haß handeln, wie es die Welt tut […]. Und im vorliegenden Falle ist es klar: Pilatus hat gar kein persönliches Interesse am Tode Jesu; er verfolgt ihn nicht mit dem Haß wie die Juden, die ihm Jesus überliefert haben. Sie tragen die größere Sünde, die eigentliche Verantwortung. Und ihre Sünde ist sozusagen doppelt, weil zu ihrem Haß gegen Jesus noch der Mißbrauch des Staates für ihre Zwecke kommt“.
Mit diesen Sätzen kommt Wengst der Auslegung von Emanuel Hirsch <1333> aus dem Jahr 1936 nahe, der sich als Deutscher Christ und aktiver Befürworter der Ideologie und Politik der NSDAP hervortat. Bultmanns Johannes-Auslegung ist
1941 veröffentlicht worden, als ein kaltblütiger staatlicher Vernichtungsapparat zur „Endlösung der Judenfrage“ vorbereitet wurde, an dem die einzelnen Täter ohne Hass beteiligt sein konnten und sich später, wenn sie zur Rechenschaft gezogen wurden, auf staatlichen Befehl beriefen. Das wusste Bultmann beim Schreiben dieser Sätze noch nicht. Es gereicht ihm zur Ehre, dass er diesen Passus im Ergänzungsheft gestrichen und durch andere Ausführungen ersetzt hat. Die Unterscheidung von „Staat“ und „Welt“ behielt er jedoch bei (Ergänzungsheft 1957, 54).
Nach Wengst bleibt zu Vers 11b noch eine Frage zu beantworten:
Wem aber wird „größere Sünde“ zugewiesen? Wer ist „der Auslieferer“? In der bisherigen Darstellung des Evangeliums war wiederholt Judas als der bezeichnet worden, der Jesus auslieferte, und in 13,2.27 galt seine Tat als teuflisch. Aber Judas hat Jesus nicht an Pilatus ausgeliefert. Nach 18,30 sprachen die Ankläger, also die Oberpriester, zu Pilatus davon, dass sie ihm Jesus auslieferten. In 18,35 gab Pilatus selbst die Oberpriester als diejenigen an, die das taten. An sie muss also gedacht sein, wenn in 19,11 von der Auslieferung Jesu an Pilatus die Rede ist. Wenn Johannes dennoch singularisch formuliert, erinnert er damit zugleich auch an Judas und seine Tat. Sie begegnete im Evangelium erstmals im Rahmen des Erzählens vom Abfall vieler Schüler (61,66-71). Das hatte sich als transparent für die Situation des Evangelisten und seiner Gemeinde erwiesen, der die Abwendung von der eigenen Gruppe als Verrat an Jesus deutet. Das dürfte der Hintergrund sein, der ihn die größere Schuldzuweisung an die Ankläger vornehmen lässt.
Die Steigerung (T725) der „Furcht des Pilatus (mallon ephobēthē {noch mehr fürchtete er sich})“ durch die „Anklage der Priesterschaft, daß Jesus sich selbst zu Gottes Sohn erklärt habe und darum nach ihrem Religionsgesetz getötet werden müsse“, ausgedrückt mit dem „Komparativ mallon“, zeigt nach Hartwig Thyen, dass „Pilatus in dieser heiklen Sache von Anfang an von Furcht beherrscht war.“ Nach Bauer <1334> bereitet Vers 8 (T725f.)
in zweifacher Hinsicht „Schwierigkeiten, formell, weil mallon in der Luft“ stehe, und sachlich, weil nicht klar sei, „vor wem sich Pilatus“ fürchte. Zum Sachlichen fragt er, ob es etwa „der Fanatismus der Juden“ sei, den Pilatus fürchte, oder „die römische Obergewalt, die ihren Organen Beschützung der religiösen Gefühle der unterworfenen Völker zur Pflicht machte“, oder ob er sich jetzt gar vor Jesus fürchte, den er nach der letzten jüdischen Anklage vielleicht „nicht mehr (für) einen Unschuldigen, sondern (für) ein höheres Wesen“ hielt.
Auch Bauer verweist dazu, wie Wengst es getan hat, „auf das Verhalten des Tigellinus dem vor seinem Richterstuhl stehenden Apollonius gegenüber“:
Zwar paßte diese letztere Erklärung glänzend zu der nun folgenden Frage des Pilatus nach dem Woher Jesu, mit der er in V. 9 sein neues Verhör eröffnet, dennoch bleibt sie aber insofern unbefriedigend, als sie das mallon nun wirklich in der Luft hängen lassen muß. Brown <1335> sucht das dadurch zu vermeiden, daß er erklärt: „Pilatus hat Angst, denn es wird immer deutlicher, dass er nicht umhin kommt, ein Urteil über die Wahrheit zu fällen“.
Wie Wengst verweist auch Thyen auf ein Zitat von Blank [96], der im Rückblick
auf die skeptische Frage des Pilatus „Was ist Wahrheit?“ (18,38) … erklärt: „Da er der Macht der Wahrheit nicht traut, sucht er jetzt seinen Rückhalt in der ,Wahrheit der Macht‘“. Man wird also die drei von Bauer genannten möglichen Motive der Angst des Präfekten nicht als Alternativen ansehen müssen, zwischen denen zu wählen wäre, sondern als ein unauflösliches Geflecht in das sich noch die Angst vor dem Zusammenbruch der eigenen Karriere mischt. Wenn Johannes vermerkt, daß Pilatus sich jetzt noch mehr fürchtete, „läßt er gerade dessen so machtbewußt erscheinendes Handeln aus Angst heraus getan sein. Die Angst, die Macht zu verlieren, führt dazu, sie demonstrativ zu gebrauchen – und zu mißbrauchen“ {so Wengst, siehe oben}.
Indem Pilatus in Vers 9 „[w]ieder drinnen im Prätorium … Jesus also die Frage nach seinem Woher“ stellt: „pothen ei sy {Woher bist du?}“,
legt der Erzähler dem Heiden Pilatus die seinen Lesern/Zuhörern seit langem vertraute, genuin johanneische Frage danach in den Mund, ob einer ek tēs sarkos {aus dem Fleisch} geboren ist oder ek tou pneumatos {aus dem Geist}, ob er ek tēs gēs {von der Erde} bzw. ek tōn katō {von unten} oder aber ek tou ouranou {vom Himmel} bzw. ek tōn anō {von oben} ist (vgl. 3,3ff; 8,23 u. ö.). Wenn Jesus ihm auf diese Frage jetzt „keine Antwort“ gibt – denn dazu hatte er sich in 18,36ff ja schon eingehend geäußert -, so bricht er damit, wie der Fortgang zeigt, das Gespräch nicht ab, sondern verbirgt in seinem Schweigen beredt das Geheimnis seines Gekommenseins ek tou ouranou {vom Himmel}.
Thyen bezweifelt allerdings, ob
deshalb freilich dieses paradoxe Geheimnis der Gegenwart Gottes in, mit und unter Jesus, dem Mann aus Nazaret, in der Sprache der heidnischen Ontologie als dessen wesenhafte Einheit mit dem Vater deklariert werden darf, die „von Anfang an nicht nur die Grenze zwischen Christentum und Judentum, sondern einen tiefgreifenden Gegensatz“ markiere {so Wilckens [286], wie ihn Wengst im vorigen Abschnitt zu Vers 7 zitiert} …
Auf „Jesu Schweigen“ reagiert Pilatus in Vers 10, indem er fragt (T726f.):
„Mit mir (vorangestelltes emoi!) redest du wohl nicht?“ Und dann versucht er Jesu Schweigen durch das Ausspielen seiner Macht zu brechen, indem er ihn fragt, ob er denn etwa nicht wisse, daß allein er die Macht (exousia) habe, ihn freizulassen oder ihn zu kreuzigen? Blank [96] bemerkt dazu: „Da er der Macht der Wahrheit nicht traut, sucht er jetzt seinem Rückhalt in der ,Wahrheit der Macht‘“. Doch nicht wie ein Angeklagter, sondern als der wahre Richter in diesem Prozeß [Brodie 538] antwortet Jesus ihm {Vers 11}: „Du hättest jedoch keinerlei Macht über mich, wenn es (dedomenon!) dir nicht von oben (anōthen) gegeben wäre“. Mag Pilatus dieses Von-Oben auch auf seine Bevollmächtigung als provinzialer Repräsentant des Caesar beziehen, so ist jedem Leser aus dem Kontext des Evangeliums ja deutlich, daß sich in diesem anōthen Jesu verweigerte Antwort auf die Frage nach seinem Woher verbirgt.
In diesem Zusammenhang geht Thyen (T727) wie Wengst auf die „problematischen Ausführungen zu V. 11 in der ersten Auflage“ von Bultmanns Kommentar (1941, S. 512f.) ein, „wo Bultmann den Vers noch als grundsätzliche Aussage über die gottgegebene Macht des Staates begriff, demgegenüber, sofern er sachlich handele, ‚von einer hamartia {Sünde} … überhaupt nicht die Rede sein‘ könne“. Diese hat er
in seinem Ergänzungsheft (S. 54) ganz entschieden korrigiert. Einmal hat er nämlich … richtig gestellt, daß es nicht abstrakt die staatliche Autorität ist, die Pilatus von Gott gegeben wäre, weil es dann anstelle von dedomenon {ein Gegebenes, Neutrum} ja dedomenē {eine gegebene, Femininum, auf exousia, Macht, Autorität bezogen} heißen müßte, sondern daß Jesus dem Pilatus durch Gottes Fügung in die Hand gegeben ist, damit der als Gottes Werkzeug den göttlichen Ratschluß ausführe. Und zum anderen begreift er Jesu Antwort jetzt als Korrektur des Machtverständnisses des Präfekten. Dessen Macht resultiert nach Jesu Wort nicht aus seiner amtlichen Stellung, sondern sie ist ihm für diesen spezifischen Fall von Gott gegeben. Die im Blick auf das Johannesevangelium u. E. anachronistische Unterscheidung eines quasi neutralen Staates von der Welt, die dagegen ek tou ponērou {von dem Bösen} ist, behielt Bultmann jedoch auch in dieser Neubearbeitung bei…
Zu Vers 11b: „Darum hat der, der mich dir ausgeliefert hat, größere Sünde“, fragt Thyen: „Wen meint er mit diesem paradous {dem Ausliefernden}?“ Obwohl „Judas bereits in 6,64.71; 12,4; 13,2.11.21 und 18,2.5 als derjenige bezeichnet“ wurde,
der Jesus ausliefern sollte…, hat Judas ihn aber ja nicht an Pilatus ausgeliefert, sondern das hat erst Kaiaphas getan, der Hohepriester (18,28), auf dessen Anordnung es die Oberpriester mit ihren Dienern dann ausgeführt haben (18,30: soi paredōkamen auton {wir haben ihn dir ausgeliefert}). Und dementsprechend erklärte Pilatus dann ja dem verhörten Jesus: Dein Volk hat dich mir durch seine archiereis {Oberpriester} ausgeliefert (18,35). Auch wenn der Erzähler das singularisch formuliert, ist also zunächst an diese, und dann an Kaiaphas und an Judas zu denken. Immerhin zeigt aber der Komparativ meizona hamartian {größere Sünde}, daß Jesus hier auch seinen Richter als Sünder verklagt.
Ton Veerkamp <1336> begreift die Furcht des Pilatus in Vers 8 nicht vor einem „magisch-religiösen“, sondern „politischen“ Hintergrund, der sich auf die „Beschuldigung“ durch die judäische Führung bezieht, „Jesus habe sich für den Sohn Gottes ausgegeben“. Diese
ist auch für Römer sehr viel ernster als die Beschuldigung, Jesus hielte sich für den König der Judäer. Mit der Tora hat Pilatus nichts zu tun, wohl aber mit einem, der die göttliche Würde für sich beansprucht. Dieses Recht hat nur der oberste Dienstherr des Pilatus, der Kaiser des Römischen Reiches, der reale „Sohn Gottes“, einer wie-Gott. Die Furcht des Pilatus ist nicht magisch-religiösen, sondern politischen Ursprungs. Er muss um so mehr fürchten, dass hinter diesem Gefangenen mehr steckt als irgendein lokaler Narr. Vielleicht ist er doch jemand, der als „Gottes Sohn“ den Kaiser herausfordert und hinter dem eine ernst zu nehmende politische Bewegung steht. Dann würde der Kaiser ihn, Pilatus, haftbar machen, dass er einen Widersacher des Kaisers selbst laufen ließ.
Diese Zusammenhänge lässt Wengst außer Acht, wenn er sowohl den Vorwurf, Jesus mache sich zu Gottes Sohn, als auch die Reaktion des Pilatus mit Furcht als lediglich erzählerisch-funktional motiviert einschätzt. Veerkamp hält es für wohlbegründet, dass Pilatus meint, „der Sache auf den Grund gehen“ zu müssen (Verse 9-10):
Er will, wie beim ersten Mal, die Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen. Wiederum lässt er Jesus ins Prätorium führen und fragt: „Woher bist du?“ Diese Frage wurde Jesus oft gestellt, gerade von seinen Gegnern, 8,25. Er schweigt.
Der Römer plustert sich auf, er habe die Macht, Jesus kreuzigen zu lassen oder ihn zu entlassen. Dass ein geschundener, fast zu Tode geprügelter Mensch eine solche Souveränität zeigen kann, wie Jesus es tut, ist schwer vorstellbar, aber es hat in der jüngsten Geschichte solche Beispiele gegeben. Johannes will deutlich machen, dass Jesus „die Weltordnung (Rom) besiegt hat (16,33)“ und dass der „Führer der Weltordnung (der Kaiser) herausgeworfen worden ist (12,31)“.
Die Frage, wie Jesu Aussage in Vers 11 über die Macht des Pilatus zu verstehen ist, veranlasst Veerkamp zu einem „kleinen textkritischen Exkurs“, in dem er auf zwei Versionen des Verbs echein {haben} eingeht, die in unterschiedlichen Handschriften vorliegen. In seiner Anm. 521 zur Übersetzung von Johannes 19,11 aus dem Jahr 2015 schreibt er:
Der Vers ist schwierig. Es gibt zwei Textversionen. Erstens echeis, Präsens, „du hast“; zweitens eiches, Imperfekt, „du hättest“. Wählt man, wie üblich, die zweite Version, entscheidet man sich für den Irrealis; man hat dann das Problem, das Fehlen der Partikel an zu erklären. Man erhält dann: „Du hättest gar keine Macht gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.“ Das läuft auf die Sanktionierung der römischen Macht (gegen den Messias!) durch Gott hinaus. Wählt man die erste Version, und diese erste Version (א, A, D, L, N, Ψ, 054, 23, 565 1241 al.) ist besser bezeugt als die zweite (B, W, Θ, f1.13, al., der die lateinischen Versionen folgen), dann wählt man einen Hauptsatz im Indikativ: „Du hast gar keine Macht“ und einen Einschränkungssatz: „es sei denn, sie wäre dir von oben gegeben worden“ (ei mē = hebräisch ki-ˀim oder bilti ˀim, vgl. Genesis 32,27). Gedanklich muss man dann ergänzen: „Aber du hast keine Macht“, denn sie ist ihm eben von oben (anōthen) nicht gegeben. Genau dieses „oben“ ist im Johannesevangelium eindeutig, 3,3.7.31 und vor allem 8,23, wo der Messias sagt: egō ek tōn anō eimi, „ich bin von oben“. Pilatus hat keine Ahnung von dem, was sich wirklich abspielt.
Dass die textkritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments von Nestle/Aland als Parallelstelle zu Vers 11 „auf Römer 13,1“ verweist,
ist typisch. Sie wählen eiches und entscheiden sich politisch-theologisch für die Verordnung der Staatsmacht durch Gott. Das kann u.a. wegen Johannes 16,33 („lch habe die Weltordnung (deren Repräsentant Pilatus ist) besiegt“) nicht sein. Der Konflikt zweier Versionen ist politischer Natur und wurde quer durch die Textgruppen spätestens seit dem 4. Jh. geführt. In der ersten Version wird Rom/Pilatus jeden Anspruch auf Macht abgesprochen, in der zweiten Version hat Rom allenfalls zeitweise (Römer 13,1) einen Machtspielraum; das wäre die Situation des Augustinus, aber mitnichten die des Johannes. In beiden Versionen ist Menschenmacht immer Verirrung (hamartia).
Das heißt, ähnlich wie Wengst und Thyen wendet sich Veerkamp gegen die Auffassung Johannes hätte hier grundsätzlich jede staatliche Macht als von Gott gegeben legitimiert, allerdings mit anderen Argumenten. Was Veerkamp übersehen hat, nämlich dass das Wort dedomenon {gegeben} sich als Partizip im Neutrum nicht direkt auf das feminine Wort exousia {Macht, Vollmacht, Autorität} beziehen kann, stützt seine Argumentation noch zusätzlich. Er meint ja, dass man übersetzen muss: „Du hast (echeis) über mich keinerlei Vollmacht, es sei denn, sie wäre dir von oben gegeben worden“, korrekter ist die Übersetzung: „… es sei denn, es wäre dir von oben gegeben“, also sozusagen zugestanden worden. Um so mehr ergibt sich
die logische Fortsetzung: „Die Macht ist dir nicht von oben gegeben worden, also hast du auch keinerlei Macht über mich.“ Auch die Polizeitruppe hatte keine Macht über Jesus (18,5).
Abwegig ist daher die Vorstellung, Gott habe Pilatus Vollmacht gegeben. Pilatus hatte vielleicht einen Spielraum, aber keine Macht. Er hätte seinen Spielraum nützen und Jesus freilassen müssen, er nützt ihn nicht. Das ist eine Verirrung („Sünde“).
Von dieser hamartia {Sünde, Verirrung} spricht Jesus aber nun in der Weise, dass er gegenüber Pilatus demjenigen, „der mich dir auslieferte“, eine noch „größere Verirrung“ zuschreibt. Dazu fragt sich Veerkamp:
War hier Judas lskariot gemeint? Wohl kaum. Es war Kaiphas, der Jesus der römischen Gerichtsbarkeit überstellte, 18,28, und zwar einzig und allein aus politischen Gründen, 11,50. Pilatus selber sagt: „Deine Nation und die führenden Priester haben dich mir ausgeliefert“, 18,35. Sie begehen die größere Verirrung. Hier zeigt sich, was chataˀ, eigentlich ist. Kaiphas zeigt sich hier weniger als ein moralisch verwerflicher Mensch, vielmehr begeht er einen unverzeihlichen und katastrophalen Irrtum, er liefert mit Jesus sein Volk ganz und gar in die Hände der Römer. Das werden wir noch deutlicher hören.
Ton Veerkamp <1337> unterbricht nun seine Auslegung, um ausführlich auf die Frage einzugehen, ob man biblisch die staatliche Obrigkeit als von Gott eingesetzt beurteilen kann. Indem er dabei pauschal auf „die ideologische Voreingenommenheit der Theologen“ hinweist, mag er allerdings unzulässigerweise verallgemeinern, denn wir haben ja gesehen, dass zumindest Wengst und Thyen im Blick auf Johannes 19,11 diese Frage ebenfalls verneinen. Zu Recht wendet sich Veerkamp jedenfalls dagegen, unseren Vers 11 von Römer 13,1 her zu interpretieren:
Der Seitenverweis von Nestle-Aland, 27. Ausgabe, lautet: Römer 13,1. Sie gehen davon aus, dass staatliche Macht von Gott (exousia … hypo theou) sei. Die real existierende Staatsmacht (ousai) sei von Gott geordnet (hypo theou tetagmenai). Abgesehen davon, dass man hypo hier nicht mit „von“, sondern mit „unter“ übersetzen soll, konstruieren die Theologen einen staatstheoretischen Einheitsbrei im sogenannten Neuen Testament. Den gibt es nicht, und die Haltung des Johannes Rom gegenüber unterscheidet sich eindeutig von der des Paulus. <1338>
Interessant finde ich, dass Veerkamp das, was gewöhnlich als lutherische Staatsfrömmigkeit bezeichnet wird, in dieser Form gar nicht auf Luther selbst zurückführt:
Luther hatte aus seiner Sicht gute politische (weniger theologische!) Gründe, das kommunistische Experiment Thomas Münzers radikal abzulehnen, um das übergeordnete Experiment der Reformation nicht zu gefährden. Dazu brauchte er die theologische Verankerung der real existierenden Staatsmacht als in diesen Umständen von Gott gewollt.
Er fügt hinzu (Anm. 525), dass
Luther selber … ein politischer Mensch“ war „und alles andere als staatsfromm… <1339> So wie die meisten Christen den „Christus“ nicht verstanden haben, haben die meisten Lutheraner den Luther nicht verstanden.
Als Beispiel für diejenigen Theologen, die Johannes 19,11 so auslegen, dass „Gott … jedem Staat und also auch Rom die Macht gegeben“ habe und Pilatus „in seinem Bereich diese von Gott gegebene Macht legitim“ ausübe, Jesus „sich daher dieser göttlichen Verordnung“ füge, bezieht sich Veerkamp wie Wengst und Thyen auf Rudolf Bultmann [513], an dessen Ausführungen er mit der Frage herangeht: „Wozu dann aber ‚Sünde‘ oder, wie wir sagen, ‚Verirrung‘?“, und den er wie folgt zitiert:
„Auf die eigentümliche Zwischenstellung des Staates zwischen Gott und Welt weist auch die Fortsetzung des Wortes Jesu hin: „Deshalb hat der mich dir überliefert hat, größere Sünde.“ Der Staat vollzieht, sofern er wirklich als Staat handelt, seine Handlungen ohne persönliches Interesse; handelt er sachlich, so kann von einer hamartia (Sünde) bei ihm überhaupt nicht die Rede sein. Handelt er unsachlich, indem er sich von der Welt für ihre Wünsche mißbrauchen läßt – wie Pilatus zu tun in der Gefahr ist und auch wirklich tut -, so behält sein Handeln doch immer noch etwas von seiner Autorität; noch ist wenigstens die Form des Rechtes gewahrt und die Autorität des Rechtes anerkannt, sodaß sich der ungerecht Verurteilte zu fügen hat [folgt ein Hinweis auf das Beispiel des Sokrates]. Der Staat kann, solange er noch in irgendeinem Grade staatlich handelt, nicht mit der gleichen persönlichen Feindschaft, mit dem gleichen leidenschaftlichen Haß handeln, wie es die Welt tut, – wie sehr er auch durch Unsachlichkeit seine Autorität ruinieren mag. Er kann der Welt verfallen; aber seine Motive sind nie mit denen der Welt identisch. Und im vorliegenden Falle ist es klar: Pilatus hat gar kein persönliches Interesse am Tode Jesu; er verfolgt ihn nicht mit Haß wie die Juden, die ihm Jesus überliefert haben. Sie tragen die größere Sünde, die eigentliche Verantwortung. Und ihre Sünde ist sozusagen doppelt, weil zu ihrem Haß gegen Jesus noch der Mißbrauch des Staates für ihre Zwecke kommt.“
Nicht einmal (Anm. 524) im Jahr 1957, als Bultmann folgenden Satz aus seiner Auslegung von 1941 [512] gestrichen hat: „Seine [Jesu] Worte besagen, daß die Autorität des Staates nicht aus der Welt stammt, sondern durch Gott begründet ist“, sah er sich dazu veranlasst,
seine Ansicht zu revidieren, nach der „die Juden“ die größere (und doppelte!) Sünde begingen. Inzwischen fangen wir an, die Judenfeindschaft der evangelischen Theologie zu sehen und zu bekämpfen. Die lutherische Staatsfrömmigkeit aber ist in den Kirchen – nicht nur den evangelischen! – mehr als sechzig Jahre später immer noch quicklebendig.
In seiner Auslegung des Johannesevangeliums geht es Veerkamp aber
weniger um die lutherische Staatsfrömmigkeit und die vom Hitlerstaat geforderte Judenfeindlichkeit Bultmanns. Sie mögen für sich selbst sprechen. Uns geht es darum, dass der Exeget Bultmann das eigentliche Anliegen des Johannesevangeliums auf der ganzen Linie verfehlt hat. Hätte er sich damals von Bildern des Widerstands leiten lassen, hätte er das Evangelium völlig anders gelesen. Er hätte dann die Variante echeis gewählt.
Pilatus hatte keine Macht über Jesus. Er konnte ihn vernichten, aber er hatte keine Macht über ihn. Der Gestaposcherge, der Sophie Scholl verhörte, hatte keine Macht über sie. Er musste ihr sogar eine goldene Brücke anbieten: „Verrätst du mir deine Komplizen, dann werde ich dafür sorgen, dass du deinen Kopf aus der Schlinge ziehen kannst.“ Sophie Scholl wies das Ansinnen zurück, und in diesem Augenblick hatte die Gestapo keinerlei Macht (oudemia exousia) über sie.
Oder man denkt an ein berühmtes Bild. Ein hünenhafter SS-Mann hat sich vor einem schmächtigen Gefangenen aufgebaut. Dieser Gefangene war Carl von Ossietzky. Der SS-ler konnte Ossietzky mit einem Schlag wie eine Fliege totschlagen, aber er hatte keine Macht über ihn.
Vor diesem Hintergrund kann Veerkamp eine Auslegung von Johannes 19,11b ansteuern, die nicht wie diejenige Bultmanns von Judenfeindschaft geprägt ist:
Solche Gefangene könnten darüber nachdenken, wer die größere „Sünde“ hatte, der Staat, von dem man nichts anderes erwarten konnte, oder der Verräter bzw. der Kollaborateur, die sie dem Staat auslieferten. Jesus war letzterer Ansicht. Daraus ein Recht eines verbrecherischen Staates – und für Johannes und viele Messianisten war Rom ein verbrecherischer Staat – abzuleiten, wie Bultmann und die Herausgeber von Nestle-Aland offenbar taten und tun, mag den ideologischen Scheuklappen des deutschen Protestantismus geschuldet sein, mit Johannes hat es nichts zu tun.
Einen letzten Gedankengang zu diesem Thema widmet Veerkamp dem Kirchenvater Augustin: <1340>
Augustin hat Johannes gelesen. Seine Methode ist nicht unsere Methode, aber er hat Johannes besser verstanden als Bultmann & Co. Augustin sieht Rom, wie Johannes Rom sah: „Remota igitur iustitia quid sint regna nisi magna latrocinia? Was sind ohne Gerechtigkeit Königreiche anderes als große Räuberhöhlen?“ Legitimer Staat leitet sich hier von Gerechtigkeit, und zwar biblischer Gerechtigkeit, und nicht umgekehrt, Gerechtigkeit von dem jeweils real existierenden Staat her. Für Augustin war Rom nie „eine von Gott verordnete Obrigkeit“, sondern in seiner ganzen Geschichte ein Staat des Unrechts und des Dämonenglaubens. Was ihn nicht daran hinderte, staatliches Eingreifen eines inzwischen christlich gewordenen Staates gegen die Donatisten und die radikalen Circumcellionen zu fordern. Aber weder bei Augustin noch bei Luther ist der Staat ein Theologoumenon {etwas von Gott Festgesetztes}.
↑ Johannes 19,12-13: Pilatus wird als Freund des Kaisers erpresst, Jesus nicht freizulassen, und setzt sich auf den Richterstuhl
19,12 Von da an trachtete Pilatus danach,
ihn freizulassen.
Die Juden aber schrien:
Lässt du diesen frei,
so bist du des Kaisers Freund nicht;
wer sich zum König macht,
der ist gegen den Kaiser.
19,13 Da Pilatus diese Worte hörte,
führte er Jesus heraus
und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte,
die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata.
[12. Januar 2023] Klaus Wengst (W518) scheint davon überzeugt zu sein, dass Pilatus in Vers 12 erst als „erstaunliche Reaktion des Richters auf das Urteil des Angeklagten“ sein Urteil zugunsten Jesu fällen will:
„Daraufhin suchte Pilatus ihn freizulassen.“ Erst jetzt spricht Johannes von einer solchen Absicht. Dass er sie im Vorangehenden implizit vorausgesetzt hätte, ist durch nichts nahegelegt und wird durch die jetzt ausdrücklich getroffene Feststellung mit dem einleitenden „Daraufhin“ ausgeschlossen.
Aber kann es sein, dass er, wie Wengst meint, das Urteil Jesu „akzeptiert … und … die Konsequenz daraus ziehen“ will? Jedenfalls kommt es nicht dazu, denn in
dem Augenblick, als Pilatus es endlich unternehmen will, Jesus freizulassen, verfängt er sich genau in dem, was er bisher ausgespielt hat: in seiner Macht. Gerade die Bindung an die Macht verhindert es, dass er seine jetzt beschlossene Absicht auch ausführen kann. …
Auf die bloß referierte Absicht des Pilatus hin, Jesus freizulassen, lässt Johannes sofort die Ankläger reagieren. Um dieser unmittelbaren Konfrontation im Text selbst willen, die das Einlenken des Pilatus gegenüber Jesus nur einen Augenblick lang aufblitzen lässt, verzichtet er auf alle szenischen Bemerkungen und setzt das Herauskommen des Richters zu den Anklägern und deren Kenntnis seiner Absicht einfach voraus. Wie schon in 18,40 und 19,6 wird ihr Reden als „Schreien“ und damit als besonders eindringlich charakterisiert: „Wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers.“
Ein philos tou Kaisaros, „Freund des Kaisers“, zu sein, bildet nach Epiktet (Dissertationes IV, 1,45-48) „unter dem, was man ‚werden‘ kann – lässt man den Kaiser außen vor -, die höchste Stufe“. Nach Sueton waren
[d]ie „Freunde des Kaisers“ … ein Beratungsgremium des Princeps. Ein solcher „Freund des Kaisers“ war der Ritter Pontius Pilatus, Präfekt einer kleinen Provinz, mit Sicherheit nicht. … Wesentlich näher liegt die Annahme, dass Johannes bei seiner Formulierung beeinflusst ist durch den häufigen Gebrauch des Adjektivs philokaísar (etwa „kaiserliebend“, „kaiserfreundlich“), mit dem Angehörige einheimischer Eliten in den Provinzen und abhängigen Vasallenreichen ihre Loyalität gegenüber dem Princeps bekundeten. … Diesen Sprachgebrauch nimmt Johannes so auf, dass er die Ankläger die Loyalität des Pilatus gegenüber dem Kaiser in Frage stellen lässt.
Indem Jesu Ankläger (W519) diese Loyalität in Frage stellen, „erpressen jetzt die Ankläger den Richter“, und zwar gerade „im Blick auf sein bisheriges Handeln, das seine Macht demonstrierte: „Wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.“
Trotz seiner Unschuldserklärungen hatte Pilatus Jesus als Königsprätendenten auspeitschen, verspotten und vorführen lassen. Damit hat er ein Faktum gesetzt, bei dem er jetzt gepackt wird. Lässt er Jesus nun frei, setzt er sich einer Anklage der Begünstigung eines Aufrührers und also der Illoyalität gegenüber dem Kaiser aus. Das würde für ihn den Verlust der Macht bedeuten, was er auf keinen Fall will. So ist Pilatus in seiner Macht gefangen.
Mit Vers 13 lässt Wengst die „Schlussszene“ der Verhandlung vor Pilatus beginnen, die ihm zufolge bis Vers 16a reicht und in der „noch einmal alle drei Hauptakteure versammelt“ sind:
Jetzt kommt der Prozess mit der Übergabe Jesu zur Kreuzigung an sein Ende. Der Anfang ist in auffälliger Parallele zum Anfang von V. 8 formuliert. Dort ging Pilatus auf das Wort der Ankläger hin, Jesus habe sich zum Sohn Gottes gemacht, irritiert ins Prätorium, um erneut mit Jesus zu sprechen. Jetzt, auf die implizite Drohung der Ankläger hin, ihn bei Freilassung Jesu der Illoyalität gegenüber dem Kaiser zu bezichtigen, geht er nicht nochmals hinein zum Angeklagten, sondern lässt diesen herauskommen. „Als nun Pilatus diese Worte gehört hatte, ließ er Jesus herausführen.“ Um der Leser- und Hörerschaft den offiziellen Charakter deutlich zu machen, den das Handeln des Pilatus hat, vermerkt Johannes: „Und er setzte sich auf den Richterstuhl.“
Dieser „Richterstuhl“, griechisch béma (Anm. 343), war genauer „ein Podest für Richter oder Redner; das für Beamte errichtete hatte Stufen und oben einen Sitz“. <1341>
Die Wendung ekathisen epi bēmatos heißt nach Wengst nichts anderes, als dass sich Pilatus auf den Richterstuhl setzte, und wendet sich damit gegen „die – grammatisch mögliche, aber nicht gerade wahrscheinliche – immer wieder vertretene These, Pilatus habe nicht sich, sondern Jesus auf den Richterstuhl gesetzt“. Zwar ist in Epheser 1,20 davon die Rede, dass Gott Jesus zu seiner Rechten im Himmel setzt, aber in der Regel hat das „Sitzen“, kathizein, wie schon Zahn <1342> schlüssig argumentiert hat, „in ‚gleichartigen Verbindungen‘ vom Sitzen auf dem Thron, dem Katheder und zur Rechten … ‚stets intransitive bzw. reflexive Bedeutung‘“ und heißt „nichts anderes … als sich setzen“.
Dass Johannes (W519) am Ende von Vers 13 „den Ort näher benennt“ und am Anfang von Vers 14 „die genaue Zeit angibt“, dient Wengst zufolge lediglich dazu, dass „die Bedeutung der jetzt erzählten Situation“ unterstrichen wird. Er erwägt nicht, die Zeitangabe als Signal für den Beginn eines neuen Erzählabschnitts zu deuten.
In der doppelten Benennung des Ortes, der auf Griechisch Lithostrōtos, „,Mosaikboden‘ heißt, auf Hebräisch ,Gabbata‘“, erkennt Wengst die eine Bezeichnung nicht als die „Übersetzung der anderen“, denn wo Johannes (W519f.)
Übersetzungen vornimmt, nennt er zuerst das hebräische oder aramäische Wort. Hier steht die griechische Bezeichnung voran. Es liegen also unterschiedliche Benennungen desselben Platzes vor. Sie werden als Namen eingeführt. Johannes gibt nicht zu erkennen, dass er diesen Namen Bedeutung abgewinnen will. Sie haben ihre Funktion darin, die Besonderheit der erzählten Situation hervorzuheben.
Obwohl (W520) der aramäische Name „Gabbata“ sich „weder bei Josephus noch in der rabbinischen Literatur“, sondern „nur hier“ findet, wird Johannes ihn durchaus korrekt benannt haben, was Wengst aus „der Ortskenntnis Jerusalems“ schließt, „die Johannes an anderen Stellen zeigt“.
Hartwig Thyen (T727) äußert sich zum Sinneswandel des Pilatus in Vers 12 zurückhaltender als Wengst:
Auch wenn Pilatus bisher mehrfach die Unschuld Jesu beteuert hat (18,38; 19,4 u. 6), ist – im Gegensatz zu Lk 23,14ff. 20 u. 22) – bei Johannes erst jetzt (ek touto {daraufhin}) davon die Rede, daß er nun tatsächlich danach trachtet, Jesus freizulassen. Wie auch immer, jedenfalls müssen die draußen stehenden Ioudaioi von dieser Wende erfahren haben, denn daraufhin protestieren sie erneut mit lauter Stimme (ekraugasan): „Wenn du diesen freiläßt, dann bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der widersetzt sich (antilegei) dem Kaiser!“
Wie Wengst hält es auch Thyen für „höchst unwahrscheinlich“, dass „der dem Ritterstand entstammende Pontius Pilatus, der durch die Gunst des allmächtigen Prätorianer-Kommandanten Seianus zum Präfekten Judäas aufgestiegen war und das bis zum Sturz seines Förderers blieb, den offiziellen Titel eines philos tou Kaisaros geführt und damit zum engsten Beraterkreis des Caesar gehört hätte“. Stattdessen (T728) verfällt Pilatus, als er beschlossen hat, „Jesus freizulassen“, wie Thyen mit einem Zitat von Beasley-Murray <1343> erläutert,
der Erpressung der Priester, die ihn mit einer Denunziation beim Caesar bedrohen: „Die Drohung, Pilatus vor Cäsar zu denunzieren, wenn er Jesus freilässt, ist offensichtlich. Und das war wirklich etwas, was Pilatus fürchten musste! Denn Tiberius war notorisch misstrauisch gegenüber allen, die seine Position bedrohten, und er ging rücksichtslos und brutal gegen sie vor. Pilatus wusste, dass die Anschuldigung, einen revolutionären König im unruhigen Palästina zu unterstützen, höchst gefährlich sein würde. Er saß in einer Falle, die er selbst gestellt hatte und aus der er nicht entkommen konnte“.
In treffender Weise als „grotesk“ bezeichnet Blinzler <1344> die Situation, dass
hier Roms höchster Repräsentant in Judäa fürchten muß, ausgerechnet durch die Vertreter eines Volkes, das leidenschaftlicher als alle übrigen Völker des Imperiums vom Haß gegen das römische Joch beseelt ist, der Illoyalität dem Caesar gegenüber angeklagt zu werden…
Diese Erpressung ist der Anlass, dass Pilatus in Vers 13 „Jesus nun erneut aus dem Prätorium nach draußen“ bringt:
Zum zweiten Mal steht der Angeklagte so zwischen seinem Richter und seinen Anklägern, die ebenso wie die Leser erwarten, daß Pilatus nun wohl endlich sein Urteil verkünden wird.
Indem Thyen im nächsten Satz bereits auf die Äußerung des Pilatus aus Vers 14b eingeht: „Seht, da ist er, euer König!“, die er als Hinauszögern des Urteils interpretiert, lässt auch er erkennen, dass er die Zeitangabe in Vers 14a nicht als Auftakt zu einer weiteren Erzähleinheit einschätzt. Wie Wengst sieht er darin, dass Johannes „eindrucksvoll Ort und Stunde dieses Geschehens benennt“ einfach eine Hervorhebung des „außerordentliche[n] Gewicht[s] dieses Augenblicks“.
Anders als Wengst will Thyen „eine transitive Bedeutung des Verbums ekathisen“ nicht ausschließen, für die bereits Harnack <1345> unter „Berufung auf Fragmente des apokryphen Petrusevangeliums … plädiert“ hatte, „so daß Pilatus nicht sich selbst, sondern Jesus als den königlichen Richter auf das bēma gesetzt hätte“ (T729):
Zwar überwiegt der intransitive Gebrauch des Verbums kathisen im Sinne von sich setzen seinen transitiven Gebrauch (jemanden setzen oder jemanden Platz nehmen lassen) im griechischen Schrifttum bei weitem. Intransitiver Gebrauch liegt auch in Joh 8,2 und 12,14 vor.
Im Johannesevangelium aber ist dies allerdings außer in der „sekundären Erzählung von Jesu Begegnung mit der Ehebrecherin“ in 8,2 nur in 12,14 der Fall, wo
Jesus sich selbst auf jenes onarion {Eselchen} setzte, um so die Schrift zu erfüllen. Doch dieser einmalige intransitive Gebrauch von kathizō kann kein Indiz dafür sein, daß das auch in 19,13 der Fall sein müßte. Zumal wegen der Stellung von ton Iēsoun {den Jesus} zwischen dem ēgagon exō {führte hinaus} und dem ekathisen epi bēmatos {setzte auf den bēma} könnte man den fraglichen Satz ja rein sprachlich durchaus auch so übersetzen: Und er führte Jesus hinaus und ließ ihn auf dem bēma Platz nehmen … Das bēma wäre dann nicht ein einzelner Richterstuhl, sondern, wie häufig in griechischen Texten, das Podest, auf dem sich das Tribunal versammelte, also eine ,Tribüne‘. Dazu paßte das Wort: ide ho basileus hymōn {seht, euer König}, das Pilatus in der entscheidenden sechsten Stunde an die Ioudaioi {Juden} richtet, trefflich. Denn es setzt doch voraus, daß Jesus ihnen allen sichtbar gegenüberstehen oder -thronen muß. Da sie ihn nicht als ihren König haben wollen, erscheint er vor ihnen als ihr Richter.
So fasst Thyen „die Pointe von de la Potteries <1346> eingehender Analyse unserer Szene“ zusammen,
in der er die bisher wohl stärksten Argumente für diese transitive Deutung des ekathisen vorgetragen hat. Und im Blick auf das Hochartifizielle und Symbolische der gesamten Pilatusszene mit ihrem ständigen Ortswechsel zwischen dem Draußen bei den Anklägern und dem Drinnen mit Jesus, für das es ja gewiß keinen Augenzeugen, sondern nur einen gegeben haben dürfte, der erzählt, wie es gewesen sein könnte, sowie unter dem Aspekt ihrer theologischen Pointe ist de la Potteries Deutung durchaus denkbar.
Zu dem „Lithostrōtos (Steinpflaster oder Mosaikboden) genannten Platz …, den die Juden auch Gabbatha nannten“, stimmt Thyen der Einschätzung von Wengst zu (T730), dass es ihn in Jerusalem gegeben haben könnte. Er bezweifelt aber mit guten Gründen, dass dieser Ort auf dem Gebiet der „unmittelbar beim Tempel jenseits von dessen nördlicher Mauer“ gelegenen „Burg Antonia“ zu finden sei, das seit „dem zwölften Jahrhundert … als die Szenerie des Prozesses Jesu verehrt“ wurde. Er ist somit auch dagegen, anstelle „des ehemaligen Herodespalastes auf dem Westhügel Jerusalems … die Burg Antonia als den Ort des Prätoriums“ anzunehmen.
Ton Veerkamp <1347> nimmt nicht an, dass Pilatus das von Jesus ausgesprochene Urteil über seine Verfehlung vor Gott in irgendeiner Weise ernst genommen haben könnte:
Pilatus kann „von oben“ nur als „von Rom“ verstehen. Von Jesus scheint für ihn keinerlei Gefahr auszugehen. Aus diesem Grund (ek toutou) versucht er ihn zu entlassen. Das hängt aber nicht von ihm ab.
Zur Erpressung des Pilatus durch die Priester schließt Veerkamp es nicht aus, dass der Präfekt tatsächlich den Titel „Freund des Kaisers“ getragen haben könnte:
Die führenden Priester spielen nun ihre beste Karte aus, sie erpressen Pilatus genau dort, wo er erpressbar ist, seine Beziehung mit der römischen Zentrale, mit dem Kaiser. Ihr Argument ist bestechend einfach und logisch. Wer sich – offenbar gegen den Willen Roms – zum König macht, begibt sich in einen Widerspruch (antilegei) mit Rom, ist ein Feind des Cäsars. Wer den fast amtlichen Titel „Freund des Cäsars“ trägt, kann auf einträgliche Posten in den Provinzen hoffen. Wer jemanden unterstützt, der sich in Widerspruch mit Rom befindet, setzt seine Freundschaft mit dem Kaiser und so seine Funktion aufs Spiel. Einer, der jemanden entlässt, der sich Rom widersetzt, sei kein Freund des Cäsars, sagen seine Gegner vor dem Prätorium. Wenn die Selbstverwaltung auf ein Todesurteil besteht, müsse er, Pilatus, entsprechend handeln, sonst werden sie gegen ihn eine Beschwerde bei der Zentrale einreichen.
Anders als Wengst sieht Veerkamp die Situation des Pilatus, in die ihn die Priester bringen, nicht nur davon bestimmt, dass er (W519) „in seiner Macht gefangen“ ist, vielmehr wird er
seine Gegner dafür, dass sie ihn in die Enge zu treiben versuchen, einen hohen Preis zahlen lassen. Sie wollen ein Gerichtsurteil? Nun, sie sollen es haben, aber anders als sie denken. Er setzt sich auf den Richtersitz, bēma, eine gemauerte Tribüne, Lithostrōtos, Gabbatha. Johannes wählt seine Worte mit Bedacht. Es handelt sich tatsächlich um einen Richtersitz, den die aramäisch sprechenden Bewohner Jerusalems als Gabbatha kannten, was Johannes für seine griechisch sprechenden Zuhörer übersetzen muss: dort war es, genau dort! Pilatus wird als Freund Cäsars, mehr noch als Vertreter Cäsars, handeln, er wird das Vertrauen, das Kaiser Tiberius in ihn gesetzt hatte, nicht enttäuschen.
So sieht Veerkamp anders als Wengst und Thyen das Wort Lithostrōtos doch einfach als Übersetzung des aramäischen Wortes Gabbatha, und er verzichtet auf Erwägungen, ob Johannes etwa hätte sagen wollen, dass Pilatus eigentlich Jesus auf den Richterstuhl setzte.
Da Veerkamp die Zeitangabe in Vers 14a als Signal betrachtet, das Johannes bewusst einsetzt, um den Beginn einer neuen Erzähleinheit anzuzeigen, darf nun mit Spannung erwartet werden, wie Pilatus als der Richter Jesu urteilen und wie er auf die Erpressung durch die judäische Führung reagieren wird.
↑ Rüsttag des Pascha: Jesus als der gekreuzigte König Israels (Johannes 19,14-42)
[13. Januar 2023] Da Wengst und Thyen die Szene der Gerichtsverhandlung vor Pilatus erst beendet sehen, wenn Jesus zur Kreuzigung abgeführt wird, kommen Sie nicht auf die Idee, zwischen den Versen 13 und 14 im Kapitel 19 einen tiefen Einschnitt zu erkennen. Nach Ton Veerkamp <1348> denkt Johannes anders als in den uns gewohnten dramaturgischen Szeneneinteilungen, die sich vorwiegend an den auftretenden Personen oder an einer bestimmten zeitlich-linearen oder geographischen Abfolge orientieren. Sein Gliederungskonzept hatte sich im zweiten Teil eng an eine ganze Reihe judäischer Feste angelehnt und im dritten Teil – seit Johannes 13,30b – an Zeitangaben innerhalb eines einzigen Tages, nämlich des Rüsttages zum Passafest, der jetzt zu seinem Höhepunkt gelangt:
Was jetzt, ab der sechsten Stunde bis zum Sonnenuntergang am Vorbereitungstag des Pessachfestes, geschieht, ist tatsächlich die Vorbereitung auf das Fest der Befreiung. Nirgendwo im Evangelium ist Pessach, nie. Wir sind immer nur in der „Nähe zum Pessach“, aber wir kommen über ˁErev Pascha, den Vorabend des Pascha, nicht hinaus. Wie das Schlachten des Paschalamms die notwendige Vorbereitungstat war, um das Pascha feiern zu können, so ist das, was jetzt erzählt wird, die notwendige Vorbereitung auf das messianische, ultimative Pascha.
Diese Vorbereitung wird nach Veerkamp in drei voneinander unterschiedenen Abschnitten erzählt:
Am ˁErev Pascha geht es um den König Israels (14-21), um das Ziel, das der König am Kreuz erreicht hat (22-37), und um seine Beerdigung (38-42). In allen drei Abschnitten von 19,14-42 wird ausdrücklich daran erinnert, das dies alles am ˁErev Pascha geschieht. Die Anerkennung des Königs, Sein Tod und seine Beerdigung: das, und nur das, ist für Johannes Vorbereitung des Paschafestes, ˁerev pessach.
Schon jetzt weist Veerkamp darauf hin, dass mit dem, was wir Christen „Ostern“ nennen, zwar definitiv eine neue Schöpfungswoche beginnt, aber auch dieser Tag steht noch im Zeichen des „noch nicht“:
Auch das, was „am Tag eins der Schabbatwoche“ erzählt wird, gehört zum Auftakt des messianischen Pascha. „Noch nicht“ wird der Messias Jesus Maria aus Magdala sagen.
Tatsächlich ist ja bis heute das Leben der kommenden Weltzeit, das für Israel Frieden in Gerechtigkeit und Freiheit inmitten der Völker gebracht hätte, noch nicht angebrochen, und die römische Gewaltordnung ist zwar grundsätzlich in ihrer Legitimität aufgehoben, aber im Lauf der Geschichte bisher lediglich durch andere Formen der Gewaltherrschaft und nicht durch ewigen Frieden abgelöst worden.
↑ Johannes 19,14-16a: Die Führung Judäas erreicht die Kreuzigung des ihr von Pilatus präsentierten Königs der Juden und bekennt sich zum Kaiser als ihrem König
19,14 Es war aber der Rüsttag für das Passafest,
um die sechste Stunde.
Und er spricht zu den Juden:
Sehet, euer König!
19,15 Sie schrien aber:
Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn!
Spricht Pilatus zu ihnen:
Soll ich euren König kreuzigen?
Die Hohenpriester antworteten:
Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
19,16 Da überantwortete er ihnen Jesus,
dass er gekreuzigt würde.
[15. Januar 2023] Klaus Wengst (W520) deutet die Zeitangabe in Vers 14a: „Es war der Rüsttag zu Pessach; etwa die sechste Stunde war es“, als Hinweis auf die genaue Zeit der Verurteilung Jesu „um 12 Uhr mittags am Tag vor Pessach“.
Mit dem Abend werden der neue Tag und also das Fest beginnen. Der Tag vor Pessach ist nach ihm in diesem Jahr zugleich der Tag vor einem Sabbat. Diese Zeitangabe ist bedeutungsvoll: „[…] das war die Stunde, in der sich an jenem Freitag die Hausväter in Jerusalem etwa anschickten, ihr Passahlamm zur Schlachtung nach dem Tempel zu schaffen.“ <1349>
Damit (Anm. 345) datiert „Johannes … den Tod Jesu wie die synoptischen Evangelien an einem Freitag. Bei ihm aber ist es nicht der 15. Nissan, der erste Festtag, sondern der 14. Nissan.“ Auf diese Weise (W520) werden die
Verurteilung Jesu, sein Gang nach Golgota und seine Hinrichtung … der Hinführung der Pessachlammer zum Tempel und ihrer Schlachtung parallelisiert. So erscheint Jesus als endzeitliches Pessachlamm. Das wird das biblische Zitat in 19,36 bestätigen. Damit schlägt der Evangelist einen weiten Bogen zurück zum Anfang seines Werkes, wo Johannes der Täufer über Jesus sagte: „Seht doch! Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt!“ (1,29)
Die „Vorstellung des zur Spottfigur gemachten Jesus“ durch Pilatus gegenüber seinen Anklägern in Vers 14b mit den Worten: „Seht da! Euer König!“, interpretiert Wengst als höhnische Rache (W520f.) „für die gerade – erfolgreich – geübte Erpressung, mit der sich hinsichtlich dieses ‚Königs‘ die jüdischen Ankläger dem Kaiser gegenüber loyaler gaben als der römische Richter.“ In diesem Worten (Anm. 347) eine letzte Bemühung des Pilatus zu erkennen, Jesus freizubekommen, was viele Exegeten meinen, erscheint Wengst „als abwegig“, denn die „Verspottung der Ankläger ist unverkennbar.“ Dennoch (W521)
sagt Pilatus wiederum mehr, als er selbst in der erzählten Situation zu sagen meint. Er, der in 18,38 mit der von Jesus bezeugten Wahrheit nichts zu tun haben wollte, sagt, ohne es selbst zu wissen, die Wahrheit: Dieser geschundene Mensch, der gekreuzigt wird, ist in der Tat der wahre König.
Daraufhin beginnen die Ankläger in Vers 15 erneut zu schreien:
Gemäß ihrer zuvor gegebenen Einschätzung Jesu als eines, der sich selbst zum König gemacht hat und sich damit dem Kaiser widersetzt, verlangen sie, dass mit ihm geschieht, was mit einem solchen zu geschehen hat: „Weg mit ihm! Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen!“
Diese Antwort lässt Pilatus wieder Oberwasser gewinnen, indem er seinen Spott fortsetzt und die Frage stellt:
„Euren König soll ich kreuzigen lassen?“ Er war für den Fall der Freilassung Jesu, die er kurz erwogen hatte, der Illoyalität bezichtigt und damit erpresst worden. Indem er jetzt hartnäckig dabei bleibt, von Jesus als „eurem König“ zu reden – und ihren König kann und darf er selbstverständlich nicht freilassen! -, stellt er sie im Spott unter das Verdikt der Illoyalität. Von daher ist die Antwort der – jetzt wieder ausdrücklich als „die Oberpriester“ benannten – Ankläger zu verstehen, mit der sie in stärkster Weise ihre Loyalität bekunden: „Wir haben keinen König außer dem Kaiser.“ Auf dieser Bekundung politischer Loyalität liegt im Kontext der Ton. Abgegeben wird sie von den Oberpriestern, also Vertretern der führenden Kreise.
Energisch wendet sich Wengst gegen die Verallgemeinerung, daraus „eine Absage des Judentums an seine messianischen Hoffnungen“ zu folgern, wie dies in „der Auslegung … fast durchgängig“ getan wird, zum Beispiel (Anm. 350) von Bultmann, Schnelle und Zumstein. <1350> Nach Rudolf Bultmann gibt diese Antwort „den messianischen Anspruch des Volkes preis, und damit gibt das jüdische Volk sich selbst preis“. Udo Schnelle meint:
„Damit geben die Juden ihren wahren König preis und zugleich ihre messianischen Hoffnungen auf. Sie unterwerfen sich einem Kaiser, der eine Verehrung als Gott fordert“ – als wenn ihm Juden die jemals erwiesen hätten. Nach Zumstein gar „sagen sich die ‚Juden‘ schließlich von ihrem eigenen Gott los. Nicht nur die Messiashoffnung wird zerstört, sondern überdies die Alleinherrschaft Gottes über sein Volk verworfen“.
Demgegenüber betont Wengst nochmals (W521f.):
Gegenüber dem von Johannes genannten Subjekt des Satzes – „die Oberpriester“ – ist in jedem Fall die Pauschalität verfehlt, in der hier in der Auslegung von „den Juden“ und „Israel“ geredet wird. Dass eine für die Gegenwart abgegebene Erklärung politischer Loyalität, wie Johannes sie die Oberpriester geben lässt, eine grundsätzliche Absage an messianische Hoffnungen einschließt, ist zumindest nicht zwingend. Aber wenn im Text in dieser Richtung gedacht sein sollte, dann muss erstens mit Schnackenburg <1351> beachtet werden, dass „die Äußerung der Hohenpriester […] aus der Sicht des Evangelisten formuliert (ist), der nur einen Messias kennt: Jesus, den Sohn Gottes (20,31)“. Es läge dann eine in den Auseinandersetzungen seiner Zeit gezogene zwanghafte Folgerung vor. Und zweitens und vor allem wäre mit Schnackenburg zu betonen, dass das tatsächlich weiter existierende Judentum – unbeschadet dessen, dass in unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten politische Loyalität zu erweisen war – sowohl an Gott als seinem alleinigen König als auch an seinen messianischen Hoffnungen festgehalten hat.
Indem Wengst dem Evangelisten hier eine zeitgebundene „zwanghafte Folgerung“ vorwirft, scheint er zu bedauern, dass Johannes nicht die Möglichkeit nutzte, seine jüdischen Gegner ohne falsche Unterstellungen zu beurteilen: als Juden, die zwar den Messias Jesus nicht anerkennen, aber dennoch an ihren messianischen Hoffnungen und vor allem an ihrem Glauben an den einen Gott Israels festhalten. Da er das Johannesevangelium letzten Endes als Vermittlung des Vertrauens auf den Gott Israels an die Völker durch den Messias Jesus versteht und nicht als eine vor allem anderen an das auf Jesus vertrauende Rest-Volk Israel gerichtete Botschaft, nimmt er allerdings nicht ernst genug, dass der Evangelist tatsächlich nicht anders kann, als eine politische Führung Judäas, die an Stelle ihres Gottes bzw. seines Messias einen Fremdling zu ihrem König macht, als götzendienerisch zu brandmarken.
Als den „Schluss dieser Szene und der ganzen Darstellung des Prozesses Jesu vor Pilatus“ betrachtet Wengst Vers 16a, in dem „Johannes lapidar“ feststellt:
„Danach nun lieferte er ihn ihnen aus, dass er gekreuzigt würde.“ Dass damit nicht die Oberpriester – oder gar „die Juden“ – als solche hingestellt werden sollen, die nun die Exekution ausführen, zeigt sich einmal schon daran, dass Johannes im Nebensatz im Passiv formuliert. Zum anderen werden in V. 23 „die Soldaten“, womit nur römische gemeint sein können, ausdrücklich als diejenigen genannt, die die Kreuzigung ausführten. Dass „er ihn ihnen auslieferte“ – „was heißt es anders als daß Pil(atus) nach ihrem Wunsche das Todesurteil sprach …?“ <1352>Das Urteil ist gesprochen; die Exekution wird sofort vollzogen.
Wengst geht nicht darauf ein, dass das Todesurteil nicht ausdrücklich, sondern nur indirekt in dem Satz: paredōken auton autois {er lieferte ihn ihnen aus} ausgesprochen wird. Im Grunde haben die judäische Führung und die römische Oberherrschaft Jesus einander gegenseitig ausgeliefert, so dass Jesus als ihr Spielball im Dienst politischer Interessen und Intrigen sterben muss. Will Johannes andeuten, dass von einer rechtskräftigen Verurteilung in keinem Sinne die Rede sein kann?
Hartwig Thyen (T728) sieht in der Präsentation Jesu vor „den gespannt Wartenden“ mit den Worten des Pilatus: „Seht, da ist er, euer König!“, eine bewusste Verzögerung des Urteilsspruches, zu dem sich Pilatus doch auf die Richtertribüne begeben hat. „Der Erzähler hebt das außerordentliche Gewicht dieses Augenblicks dadurch hervor“ (T729), dass er ihn „genau lokalisiert“ und seine „Stunde an jenem Rüsttag des Passa benennt“. Also „mittags gegen zwölf Uhr“ auf dem Gabbatha genannten „Steinpflaster oder Mosaikboden“ wird durch Pilatus weniger die Verurteilung Jesu als seine Proklamation zum König ausgesprochen:
Soeben zum Opfer der Erpressung durch die jüdischen Ankläger Jesu geworden, „die sich dem Kaiser gegenüber loyaler gaben als der römische Richter“, rächt sich Pilatus an ihnen nun dadurch, daß er ihnen mit höhnischer Ironie erneut den geschundenen, purpurgekleideten und dornengekrönten Jesus mit den Worten präsentiert: „Seht her! Da ist euer König“. Wie zuvor Kaiaphas, weil er zu der Zeit Hoherpriester war, ohne es selbst zu wissen, die Wahrheit gesagt hatte (eprophēteusen), denn Jesus sollte ja tatsächlich für das jüdische Volk sterben, ja nicht nur für dieses allein, sondern darüber hinaus dafür, daß er alle in der Welt zerstreuten Gotteskinder zur Einheit versammele (11,49ff), so bezeugt jetzt Pilatus, als derjenige, dem es ‚von oben‘ aufgegeben ist, Jesus zum Kreuzestod zu verurteilen (19,11), ebenfalls unwissend eben die Wahrheit, von der er in 18,38 doch nichts wissen wollte: „Dieser geschundene Mensch, der gekreuzigt wird, ist in der Tat der wahre König“ {so Wengst, siehe oben}.
Als die Ankläger, die „das natürlich nur als blanken Hohn begreifen“ können, in Vers 15 „abermals laut ihre Stimmen“ erheben „und schreien (ekraugasan): ‚Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn!‘“, setzt Pilatus
mit der Gegenfrage: „Euren König soll ich kreuzigen (lassen)?“, … ihre Verhöhnung fort und fordert damit die Oberpriester (hoi archiereis!) zu dem fragwürdigen Loyalitätsbekenntnis heraus: „Wir haben keinen König, außer dem Kaiser!“ Wie die Wende im Verhalten des Pilatus dadurch verursacht war, daß die Oberpriester ihn mit dem Vorwurf mangelnder Loyalität dem Kaiser gegenüber erpreßbar gemacht hatten, so muß auch ihre erneute Antwort auf seine höhnische Frage, ob er denn etwa ihren König kreuzigen lassen solle, als Bekundung ihrer politischen Loyalität verstanden werden.
Wie Wengst geht auch Thyen auf Kommentatoren ein (T730f.), die „in dieser Aussage eine ‚Absage des Judentums‘ an das alleinige Königtum Gottes und die Preisgabe seiner messianischen Hoffnungen“ sehen (T731):
In diesem Sinne sieht Bultmann [515] in dieser Antwort nicht nur die Preisgabe des messianischen Anspruchs Israels, sondern zugleich seine Selbstpreisgabe besiegelt … Gegen alles, was wir aus der weitergehenden Geschichte Israels wissen, erklärt Wilckens, <1353> die Juden hätten ihre Messiashoffnung „zugunsten einer totalen Unterwerfung unter die Gewalt des heidnischen Imperators preis(gegeben)“; nach Schnelle [281ff.] unterwerfen sie sich damit gar „einem Kaiser, der seine Verehrung als Gott fordert“. Gegen solche und ähnliche Pauschalurteile über ,das Judentum‘, das seinen Glauben an Gottes alleiniges Königtum und seine messianische Hoffnung zugunsten seiner Unterwerfung unter den römischen Caesar preisgegeben habe, zitiert Schnackenburg [308] zu Recht aus dem bis heute in allen Synagogen täglich gebeteten Achtzehngebet: „Laß zurückkehren unsere Richter wie früher und unsere Ratgeber wie am Anfang; nimm von uns Trauer und Seufzen; Du allein, Adonaj, sei König über uns in Freundlichkeit und Erbarmen, und rechtfertige uns im Gericht! Gesegnet seist Du, Adonaj, König, der du Recht und Gerechtigkeit liebst!“ (Benediktion 11) Und: „Den Sproß Davids, Deines Knechtes, laß schnell ersprießen, und erhöhe sein Horn durch Deine Hilfe! Ja, auf Deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Gesegnet seist Du, Adonaj, der Du das Horn der Hilfe ersprießen läßt“ (Benediktion 15). Solchen Gebeten gegenüber kann von einem Abrücken vom Glauben an Gottes alleiniges Königtum und von der Preisgabe der messianischen Hoffnungen Israels nicht entfernt die Rede sein.
In dieser Argumentation ist Thyen gegen die pauschale Verurteilung des Judentums durch Wilckens und Schnelle Recht zu geben. Die Frage ist aber, wie er konkret die Haltung des Evangelisten Johannes einschätzt, der ja als jüdischer Messianist tatsächlich die judäische Führung des praktischen Götzendienstes gegenüber dem römischen Kaiser bezichtigt. Zunächst zitiert er Wengst {siehe oben}, der
gegen solche Pauschalurteile über ,die Juden‘ oder ,das Judentum‘ zu Recht ein[wendet], daß das ausdrücklich noch einmal genannte Subjekt der fraglichen Aussage doch die archiereis {Oberpriester} seien, weshalb sich jegliche Pauschalität verbiete, „in der hier in der Auslegung von ,den Juden‘ und ,Israel‘ geredet wird“.
Im Folgenden betont Thyen, dass die judäische Hohepriesterschaft tatsächlich dazu neigte, mit der römischen Besatzungsmacht zu kollaborieren (T732):
Da es die römischen Statthalter waren, die den Hohenpriester ein- oder absetzten, war die Versuchung natürlich groß, daß der sich oft als deren verlängerter Arm gerierte und sich in seiner Loyalität dem Caesar gegenüber kaum überbieten ließ.
Und es ist wohl kaum ein Zufall, dass der Evangelist Johannes dem Hohenpriester Kaiphas eine besondere Rolle im Hintergrund der Verurteilung Jesu durch Pilatus zumisst (T731):
Im Blick auf die häufige und zuweilen höchst willkürliche Absetzung und Neueinsetzung von Hohepriestern durch die römischen Präfekten des Imperiums, die in der Antonia auch die hohepriesterlichen Kultgewänder unter Verschluß hielten, verstand es Kaiaphas, der im Jahre 18 n. Chr. von Valerius Gratus in dieses Amt eingesetzt worden war, sich ungewöhnlich lange darin zu halten, nämlich 19 Jahre lang.
Mit diesen Ausführungen bezieht Thyen die johanneische Schilderung der judäischen Führung auf die politische Situation zur Zeit Jesu.
Zu Vers 16a (T732): „tote oun paredōken auton autois hina staurōthē {Daraufhin lieferte er ihn an sie aus, daß er gekreuzigt werde}“, den auch Thyen als den „letzte[n] Satz unserer Szene“ betrachtet, hebt er hervor, dass dieser „nur implizit das Todesurteil des Pilatus“ ist. Es ist nicht
eines, das er souverän von seinem bēma {Richterstuhl} herab verkündet hätte, sondern eher Ausdruck seiner Kapitulation vor der Erpressungsdrohung der priesterlichen Ankläger Jesu (paredōken auton autois). Denn auch wenn die Wendung ,er lieferte ihn an sie aus‘ – grammatisch an die archiereis {Oberpriester} – so aussehen mag, als seien es die Priester, die Jesus nun kreuzigen sollten, zeigt doch das Passiv hina staurōthē {dass er gekreuzigt werde} deutlich, daß das Urteil jetzt durch die Kreuzigung und damit durch die römischen Instanzen exekutiert werden soll. Statt ,Er lieferte ihn an sie aus‘, könnte es also geradezu heißen, er unterwarf sich ihrer Drohung und lieferte damit sich selbst ihrem Drängen aus.
Nach Ton Veerkamp <1354> zeigt Pilatus in den Versen 14 und 15,
dass er nun doch der ausgebufftere Politiker war. Er stellt sich einer Volksversammlung, die keine war. Die Peruschim {Pharisäer}, die offizielle Opposition, fehlen. Anwesend sind nur die priesterlichen Eliten und ihr Personal. Das Ganze ist ein demokratisch verbrämtes Schmierentheater.
Jetzt sagt er nicht: „Seht den Menschen“, jetzt sagt er: „Da, euer König“. Sie brüllen: „Hinauf, hinauf, <1355> kreuzige ihn.“ Pilatus verlangt die „demokratische“ Legitimation des Todesurteils: „Euren König soll ich kreuzigen?“ Er hat sie, wo er sie haben wollte. Die führenden Priester – nicht das Volk der Judäer – sagen: „Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar.“ Was sie wohl nicht realisieren, ist, dass sie damit feierlich erklären, dass sie einen melekh ke-khol-ha-gojim {König wie alle Völker}, basileia tou kosmou toutou, einen König nach dieser Weltordnung haben wollen. Das ist der politische Preis, den Pilatus von ihnen fordert. Sie zahlen ihn.
Um „den Vorgang zu begreifen“ setzt sich Veerkamp mit der Deutung von Jürgen Becker <1356> auseinander. Er
beschreibt Pilatus als einen, der „zwischen den Juden draußen und Jesus drinnen hin- und herlaufen“ muss. „Ein demonstratives Stück Lächerlichkeit! Mit den Juden kommt er nicht klar …“. Genausowenig wie Petrus „feige“ ist, ist Pilatus „lächerlich“. Pilatus macht seinen „Job“ im Auftrag Roms nicht schlecht. Zwar lässt er einen Menschen, dem er kein Gewicht beimisst und den er eigentlich laufen lassen möchte, hinrichten, aber er erzwingt ein politisches Bekenntnis der judäischen Selbstverwaltung zu Rom. Der Kaiser würde mit ihm zufrieden sein. Wir neigen immer dazu, Politiker, die wir verabscheuen, lächerlich zu machen. Verständlich als psychisches Entlastungsinstrument, politisch oft unklug. Johannes nimmt Pilatus (Rom) sehr ernst. Die Auslegungen sollten das auch tun.
Was ist also nach Veerkamp die Aussageabsicht des Evangelisten Johannes?
Johannes erzählt ein Ereignis, das mindestens zwei Generationen zurückliegt, und passt es in seine eigene politische Situation ein. Er will zwei Dinge klarmachen. Erstens, dass der Messias durch Rom hingerichtet oder ermordet wurde, also durch das, was er kosmos, Weltordnung, nennt. Zweitens, dass der Repräsentant dieser Weltordnung durch die politische Führung in Jerusalem dazu gedrängt wurde, einen innenpolitischen Gegner dieser Führung umzubringen. Die Führung tut das deswegen, weil sie Teil dieser von ihr bejahten Weltordnung ist: der Kaiser ist ihr König, und sie sind jetzt ein Element der kaiserlichen Weltordnung.
Johannes weiß, wie das Ränkespiel zwischen Priestern und römischer Behörde funktioniert, er weiß, was Politik ist: ein Feld, auf dem Argwohn, Zynismus, Theater, Massenmanipulierung die entscheidenden Faktoren sind: „Was ist schon Treue“, lässt er Pilatus fragen. Beide Parteien erreichen ihr Ziel: der Messias wird eliminiert, Pilatus zwingt die Selbstverwaltung zu einem Bekenntnis der unbedingten politischen Loyalität.
Wie beurteilt Veerkamp in diesem Zusammenhang das Kräfteverhältnis zwischen den beteiligten politischen Akteuren und die Verantwortung jüdischer Akteure im Besonderen? Das Verhalten der judäischen Führung ist seiner Ansicht nach am Königsgesetz der Tora im 5. Buch Mose zu messen (Anm. 533):
„Einsetzen sollt ihr, einsetzen einen König, den der NAME, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder magst du einen König über dich einsetzen. Du darfst dir nicht einen auswärtigen Mann über dich [als König] geben, der nicht dein Bruder ist“, Deuteronomium 17,15.
Von daher ist der
eigentliche Gewinner dieses üblen Spiels … die römische Behörde. Die Priester haben mit ihrem Bekenntnis zu einem Goj {Nichtjuden} als zu ihrem König – in flagranter Schändung der Tora – ihre Legitimation verspielt. Indem sie sich gegen den Messias entschieden haben, entschieden sie sich notwendig für Cäsar als ihren König und für Rom als ihren Gott. Notwendig: ein Drittes wird ausgeschlossen. So deutet Johannes das Verhalten der priesterlichen Führung. Sie haben sich aus dem Israel, das Johannes will, endgültig verabschiedet.
Einschränkend meint Veerkamp allerdings im Blick auf die Gesamtheit der Juden:
Ganz so einfach macht sich das Johannes nicht. Das Prinzip des „ausgeschlossenen Dritten“ würde bedeuten, dass jeder, der sich gegen den Messias entscheidet, sich ipso facto für die Weltordnung (kosmos) entscheidet. Es wäre eine Kleinigkeit gewesen, in seiner Erzählung des Todesurteils als Gesinnungsgenossen der Priester auch die Peruschim {Pharisäer} auftreten zu lassen. Auch die Peruschim lehnen Jesus als Messias vehement ab. Auch sie wollen die Ausschaltung eines politischen Gegners, aber nicht zu dem Preis, dass sie das politische Bekenntnis mitsprechen müssen: „Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar.“ Deswegen lässt Johannes sie hier nicht auftreten. Diese Leerstelle in seiner Erzählung ist vielsagend: Die Peruschim sind und bleiben politische Gegner im Kampf um Israel, aber sie sind nicht der Feind, sie gehören nicht ohne Wenn und Aber zum kosmos, zu Rom. Deswegen lässt Johannes sie aus dem Spiel. Nach der Verhaftung treten sie nirgendwo mehr auf.
Johannes kennt sich im politischen Geschäft aus, er weiß, was er sagen und was er nicht sagen muss. Erinnern wir uns an die Schilderung des Auftretens des Kaiphas, als er seine Kollegen im Sanhedrin für die Eliminierung Jesu zu gewinnen suchte, 12,50ff. Kein messianischer Schriftsteller hat die politischen Vorgänge zwischen Besatzungsmacht und kollaborierenden lokalen Eliten so gnadenlos ausgeleuchtet wie Johannes.
↑ Johannes 19,16b-18: Jesus trägt das Kreuz nach Golgatha, wo sie ihn in der Mitte zwischen zwei anderen kreuzigen
19,16b Sie nahmen ihn aber,
19,17 und er trug selber das Kreuz
und ging hinaus zur Stätte,
die da heißt Schädelstätte,
auf Hebräisch Golgatha.
19,18 Dort kreuzigten sie ihn
und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,
Jesus aber in der Mitte.
[17. Januar 2023] Nach Klaus Wengst besteht (W523) von „der Übernahme Jesu durch die Soldaten zur Kreuzigung bis zu seiner Bestattung … ein einheitlicher Erzählzusammenhang“, der „örtlich um die Hinrichtungsstätte zentriert“ ist und „zeitlich den Nachmittag des Rüsttages vor Pessach“ umfasst. Anders als bei den Synoptikern hat „der Weg zu ihr … kein eigenes Gewicht“, und erst (W524) „mit der neuen Zeitangabe in 20,1, der frühe Morgen des übernächsten Tages“, findet sich zeitlich ein weiterer „deutlicher Einschnitt“. Wie bereits gesagt, hat Johannes aber den Beginn des Erzählzusammenhangs, in dem es um Jesus als den König der Juden geht, wohl bereits mit der Zeitangabe in Vers 14a markieren wollen.
Zur Darstellung der Kreuzigung Jesu schreibt Wengst vorab:
Johannes erzählt die Fakten nüchtern und kurz. Das Sterben Jesu am Kreuz wird weder dramatisch ausgemalt noch wird es „vergoldet“.
Als ein „unzutreffendes Urteil“ bezeichnet Wengst (Anm. 355) die einseitige Einschätzung von Blank, <1357> das Kreuz sei für Johannes das „Siegeszeichen des Glaubens“, womit eine „Reduktion des Widerspruchs, des Skandalons, des wirklichen Leidens, Versagens und Scheiterns Jesu“ einhergehe:
Als ein wesentliches Moment der Begründung ist es wohl gedacht, wenn Blank zu Beginn des Absatzes ausführt: „Für eine Verspottung des Gekreuzigten, wie wir sie bei Markus kennengelernt haben, ist bei Johannes kein Platz mehr. Sie paßt in sein Konzept von Jesu Sieg und Verherrlichung nicht hinein“. Die sehr drastische Verspottung Jesu als König hatte Johannes im Prozess vor Pilatus gerade ausführlich und mehrfach gebracht. Sie passte offenbar durchaus „in sein Konzept von Jesu Sieg und Verherrlichung“. Man sollte vorsichtig sein mit weitreichenden Schlüssen aus etwas, das nicht dasteht. Wer kann denn mit Gewissheit sagen, dass bewusstes Weglassen vorliege? Und dass Johannes die Kreuzigung Jesu als eine glanzvolle darstelle, dass er die harten Fakten übermale, trifft nicht zu. Der Vergleich mit den synoptischen Evangelien wird daher auch hier behutsam geführt werden, ohne harsche Urteile zu fällen.
Obwohl also Johannes die Kreuzigung in keinster Weise verharmlost, lässt er Wengst zufolge (W524)
in der Darstellung mit unterschiedlichen Mitteln immer wieder die Dimension Gottes aufscheinen und gibt so seiner Leser- und Hörerschaft zu verstehen, dass in diesem schlimmen Geschehen doch Gott wirkt.“ So wird im ersten Abschnitt (V. 16b-22) die Kreuzigung recht schnell erzählt und relativ lang bei der Aufschrift am Kreuz Jesu verweilt. Johannes lässt erkennen, dass mit ihr, die Jesus „König“ nennt, mehr und anderes gesagt ist, als dass Jesus um eines politischen Anspruches willen hingerichtet wurde.
Problematisch finde ich die letztere Formulierung deswegen, weil Wengst weder definiert, was er mit dem „politischen“ Anspruch meint, noch genauer bestimmt, worin dieses „mehr und anderes“ bestehen soll, das mit der Aufschrift am Kreuz gemeint sein soll. Übergibt Jesus, indem er gekreuzigt wird, die Inspiration der Treue Gottes seiner Schülerschaft (19,30 und 20,22) und bringt so den befreienden NAMEN des Gottes Israels zur Geltung und zumindest auch politischen Wirksamkeit, dann geht es hier um einen Widerstreit verschiedener politischer Ansprüche und Zielsetzungen und nicht um einen Gegensatz etwa zwischen Politik und Religion.
Die Bemerkung in Vers 16b: „Da nahmen sie Jesus“, leitet die knappe Darstellung der „Exekution“ Jesu ein, die unmittelbar der „Verurteilung zum Tode folgt“ und nach Wengst auch ebenso unmittelbar „an die vorige Szene“ anknüpft. In meinen Augen könnte man darin allerdings auch bestätigt sehen, dass die neue Szene eben nicht hier, sondern bereits mit der Zeitangabe in Vers 14a einsetzt (W524f.):
Nachdem Pilatus Jesus „ausgeliefert“ und damit das Todesurteil gesprochen hat, wird dieser zur Hinrichtung abgeführt. Dass das Subjekt dieses Übernehmens und der folgenden Hinrichtung römische Soldaten sind, entspricht dem, was die Leser- und Hörerschaft aus ihrer Erfahrung kennt, und wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Soldaten werden erst ausdrücklich erwähnt, wenn über sie mehr gesagt werden soll (V. 23f.).
In Vers 17 (W525) ist der
von den Soldaten übernommene Jesus … wieder Subjekt, ohne allerdings mit dem, was er hier tut, besonders hervorgehoben zu werden: „Indem er sich selbst das Kreuz trug, ging er hinaus“, nämlich aus der Stadt. Dass der zum Tode am Kreuz Verurteilte selbst das Kreuz – bzw. den Querbalken, während der Pfahl schon eingerammt war – zur Hinrichtungsstätte tragen musste, war üblich. Im Blick auf Jesus wird hier also nichts Ungewöhnliches festgestellt.
Ungewöhnlich (Anm. 357) war demgegenüber eher die Darstellung der Synoptiker, „nach der Simon von Kyrene gezwungen wurde, für Jesus das Kreuz zu tragen (Mt 27,32; Mk 15,21; Lk 23,26)“:
Setzt man voraus, Johannes habe die Synoptiker gekannt, kann man eine „bewußte Korrektur der synoptischen Darstellung“ vermuten. So tut es z. B. Blank [114], der fortfährt: „Jesus wird ,heroisiert‘.“ Er tut aber hier nichts, was ihn von irgendeinem anderen Delinquenten unterscheiden würde, der gezwungen wird, sein Kreuz zum Richtplatz zu tragen.
Dieser Richtplatz wird bezeichnet als (W525)
„der ,Schädel‘ genannte Ort, was auf Hebräisch Golgota heißt“. Hier entspricht der aramäische Name in seiner Bedeutung dem griechischen. Der Ort wird seinen Namen von daher bekommen haben, „daß eine kahle Felsbildung an einen Schädel erinnerte“.
Dazu erläutert Wengst (Anm. 358), dass auf
Hebräisch gulgólet, aramäisch gulgultá bzw. gulgaltá … „Schädel“, „Kopf“ [bedeutet]. Als Bezeichnung eines Ortes vor der Stadtmauer Jerusalems begegnet dieses Wort nur in den Evangelien.
Indem Johannes in Vers 18 (W525f.) das „Faktum der Kreuzigung Jesu … in äußerster Knappheit nur in einem Nebensatz“ feststellt: „wo sie ihn kreuzigten“, beschreibt er
den Vorgang nicht, schon gar nicht malt er ihn aus. Er war der Leser- und Hörerschaft aus ihrer Erfahrungswelt bekannt. Aus 20,20.25.27 kann sie erschließen, dass Jesus an den Händen am Kreuz angenagelt worden ist.
Der Verzicht auf dramatisierende Einzelheiten kann also nicht dem Zweck dienen, den grausamen und erniedrigenden Tod Jesu am Kreuz zu verharmlosen (Anm. 360):
Die Kreuzigung war übliche römische Hinrichtungsart an Sklaven und in den Provinzen vor allem an Aufständischen. Der Delinquent wurde nackt … an den Händen am Querbalken angebunden oder angenagelt und dann am schon stehenden Pfahl hochgezogen und die Füße an diesem befestigt.
Dass (W526) wie „in der synoptischen Darstellung … auch nach Johannes nicht allein gekreuzigt“ wird, sondern „mit ihm zwei andere auf beiden Seiten, Jesus in der Mitte“, lässt (Anm. 361) bereits hier und nicht erst in Vers 23 deutlich werden, worauf schon Weiss <1358> hinweist, dass „römische Soldaten die Exekution vornahmen“ und nicht etwa Beauftragte der jüdischen Priesterschaft (W526):
Bei Matthäus und Markus werden die beiden anderen als „Räuber“, bei Lukas als „Verbrecher“ bezeichnet. Demgegenüber ist die johanneische Formulierung erstaunlich; sie spricht schlicht von „zwei anderen“ – Opfer römischer Gewaltherrschaft wie Jesus. Sowohl die Synoptiker als auch Johannes teilen mit, dass die beiden anderen links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Darüber hinaus hebt Johannes noch eigens hervor, dass Jesus den Platz in der Mitte hat – den königlichen Ehrenplatz. <1359> Dass der, dem diese zweifelhafte Ehre zuteilwird, allerdings König ist, stellt die Fortsetzung des Abschnitts deutlich heraus.
Hartwig Thyen (T733) verbindet bereits mit Vers 16b Spekulationen über die Identität des Soldaten, der nach Vers 34 mit einer Lanze in Jesu Seite stechen wird. Er geht davon aus, dass zwar „[g]rammatisch … jene autoi {sie}, denen Pilatus Jesus zur Kreuzigung übergeben hatte, nämlich die in V 15 genannten archiereis {Oberpriester}, auch das in dem parelabon {sie übernahmen} implizierte Subjekt sein“ müssten:
Sachlich ist das jedoch nicht möglich, da die Kreuzigung ja eine römische Art der Hinrichtung zum Tode Verurteilter ist und deshalb auch von römischen Instanzen exekutiert werden muß. Wegen Jesu Rede von der größeren Sünde dessen oder derer, die ihn Pilatus ausgeliefert haben (V. 11), hat der Erzähler das Subjekt von parelabon vermutlich absichtsvoll im Unbestimmten der Doppeldeutigkeit belassen und diese autoi erst in der Episode von der Verteilung der Kleider des Gekreuzigten (V. 23f) zunächst als hoi stratiōtai {Soldaten} des Hinrichtungskommandos bezeichnet, um dann implizit noch zu sagen, daß dieses Kommando, den vier Teilen der Kleidung Jesu entsprechend, aus vier Soldaten bestand.
Mehr als blühende Phantasie ist es Thyen zufolge offenbar, wenn er sich auf Grund johanneischen Spiels mit Markus 15,39 und altkirchlicher Traditionen zu weiteren Schlussfolgerungen veranlasst sieht:
Wie stets beim Militär muß einer dieser vier die Verantwortung für die Exekution getragen und das Kommando geführt haben. Vermutlich war das jener kentyriōn {Centurio}, der in Mk 15,39 unter dem Kreuz Jesu stand und bekannte: Dieser Mensch ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Jedenfalls hat die Tradition diesen ,Hauptmann‘ alsbald mit dem Soldaten von Joh 19,32ff identifiziert, der, bewehrt mit einer Lanze, Jesu Seite durchbohrt und bezeugt hat, daß daraus sogleich Blut und Wasser herausgeströmt seien. Die späte Legende hat den Lanzenbewehrten Longius genannt und ihn wegen seines Bekenntnisses unter dem Kreuz als frühen Christen verehrt. Da wir, wie unten begründet werden muß, in Joh 19,32ff ein intertextuelles Spiel mit Mk 15,39 sehen, hat die Tradition den Mann mit der Lanze wohl nicht nur zufällig mit dem bekennenden Centurio von Mk 15,39 identifiziert.
Ebenso ausführlich geht Thyen (T734) auf die knappe Formulierung in Vers 17 ein:„Er selbst ging, sein Kreuz tragend, hinaus an den sogenannten ,Ort des Schädels‘, der hebräisch Golgotha heißt“. Sie setzt im Unterschied zu seinen synoptischen Prätexten (etwa Markus 15,22) voraus, dass Jesus sich „nicht durch andere dahin bringen läßt“ und (T733) auch nicht an seiner Stelle „der gerade von seinem Feld kommende Simon von Kyrene von den Soldaten gezwungen worden sei, Jesu Kreuz zur Hinrichtungsstätte zu schleppen (Mk 15,20f; Mt 27,32; Lk 23,26).“ Damit bleibt Jesus, wie Brown <1360> schreibt, „bis zuletzt der Handelnde und ‚alleiniger Herr seines Schicksals‘“. Gerade die Souveränität, in der Jesus sein Kreuz selbst trägt, spricht nach Thyen dagegen, das Johannesevangelium gnostisch misszuverstehen. Da nämlich (T733f.), wie Irenäus es darstellt,
die Gnostiker im Bann der Ontologie griechischer Philosophie die Gottheit Jesu nur als dessen wesenhafte Leidensunfähigkeit zu denken vermochten, ließ etwa Basilides jenen Simon aus Kyrene nicht nur Jesu Kreuz tragen, sondern ihn aus Unwissenheit und Irrtum der irdischen Mächte dann auch noch an {734} Jesu Stelle gekreuzigt werden, während Jesus, der zuvor sein Aussehen mit dem Simons vertauscht hatte, neben dessen Kreuz stand und lachte (Irenaeus, adv. haer, I/ 24,4 …).
Nach Johannes dagegen wird Jesu Weg dadurch (T734), dass er
selbst sein Kreuz trägt, … zum hypodeigma {Vorbild} für seine Jünger: hina kathōs egō epoiēsa hymin kai hymeis poiēte {denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe} (13,15) und zur Motivierung ihres Weges der Nachfolge: „Wenn einer mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, und so wird er mir nachfolgen“ (Mk 8,34; Mt 16,24; Lk 9,23).
Außerdem macht Thyen darauf aufmerksam, dass viele „Kirchenväter … in Isaak, der an der Seite seines Vaters Abraham mit dem Holz für seine eigene Hingabe als Brandopfer beladen den Berg Moria bestieg, den Jesu Kreuzweg vorabbildenden Typos“ sahen. Er hatte schon zu Johannes 1,29 ausgeführt, dass „die Weisen Israels seit den Tagen der makkabäischen Märtyrer diesen Weg Isaaks als dessen freudiges Selbstopfer begriffen haben, das alle Sünden des Gottesvolkes sühnt“:
Nach Gen 22,8: ho theos opsetai heautō probaton eis holokarpōsin {Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer}, sahen sie in Isaak das von Gott selbst ersehene Opferlamm, an das alle folgenden Schlachtungen von Opfertieren Gott nur erinnern sollen und aus dem sie ihre sühnende Kraft beziehen. Das gilt auch für die Schlachtung der Passalämmer. Wie einst Isaak das Holz für seine holokarpōsis trug, so trägt jetzt Jesus sein Kreuz. Da die aufrechten Balken bereits fest im Boden der Hinrichtungsstätte verankert waren, mußten die Verurteilten als ,ihr Kreuz‘ wohl nur dessen Querbalken tragen, an den sie mit ausgestreckten Armen angenagelt oder angebunden wurden …
Leider übernimmt Thyen hier einfach die Art, wie die Kirchenväter das alttestamentliche Urbild oder den Typos des Isaak auf Jesus hin interpretiert haben, so dass Jesu Opfer letzten Endes das Opferwesen der jüdischen Religion ablöst und überflüssig macht. Außer Acht bleibt dabei die Frage, ob der Evangelist Johannes nicht von der Tora her Jesus als die Verkörperung Isaaks und somit Israels als des einziggezeugten Sohnes verstanden hat, so dass Jesu Tod in seinen Augen vor allem dem Ziel der Sammlung und Befreiung Israels dienen sollte (vgl. dazu Veerkamps Auslegung von Johannes 3,16).
Zum Ort der Hinrichtung Jesu schreibt Thyen:
Der in Joh 19,17 ebenso wie zuvor schon bei Markus durch den qualitativen Genitiv kraniou {Schädel} näherbestimmte topos {Ort}, dürfte ein Hügel gewesen sein, dessen Gestalt an eine Schädelkalotte erinnerte, und keinesfalls ein Ort, wo die Schädel zuvor Hingerichteter herumlagen. Zur Lokalisierung dieses Platzes hilft auch sein hebräischer bzw. aramäischer Name Golgotha nicht weiter, da er als Ortsbezeichnung abgesehen von Mk 15,22; Mt 27,33 und Joh 19,17 nirgendwo belegt und zudem nichts anderes ist als ein Derivat des aramäischen Lexems gulgulthaˀ (hebräisch gulgoleth] = Schädel, Kopf). … Als Stätte der Hinrichtung muß der ,Schädelberg‘ nach Num 15,35 … außerhalb Jerusalems und seiner Mauern gelegen haben. Da auch die Toten nur außerhalb der Stadt begraben werden durften, wird der Garten mit dem Grab Jesu in unmittelbarer Nähe von Golgotha gelegen haben. Auch wenn die topographischen Zeugnisse für die Lage jenes Platzes Golgotha nicht hinter Eusebs Vita Constantini (III/25ff) zurückreichen, dürfte der etwa 300 Meter nordnordöstlich des Prätoriums und damit außerhalb der herodianischen Stadtmauern gelegene Platz, an dem Konstantin um 326 einen Venustempel bis in dessen Fundamente hinein abreißen und an seiner Stelle die Grabeskirche errichten ließ, die wahrscheinlichste Lage von Golgotha sein …
Auch zu Vers 18 greift Johannes Thyen zufolge (T736) auf seine synoptischen Prätexte zurück, die erzählen, dass
Jesus zusammen mit zwei anderen, die Markus und Matthäus als Aufrührer (lēstēs) und Lukas als Übeltäter (kakourgoi) bezeichnen, und in deren Mitte gekreuzigt wird… (Mk 15,27; Mt 27,38; Lk 23,33). Brown [900] bemerkt dazu, daß auch dabei der Passionspsalm 22, sowie Jes 53,12 im Hintergrund stehen könnten. In Ps 22,17 klagt der Beter, daß ihn eine Versammlung von Verbrechern umgeben habe (LXX: synagōgē ponēreuomenōn perieschon me), und in dem von Johannes immer wieder assoziierten Jesajabuch lautet der letzte Vers des vierten Liedes vom Gottesknecht: „Darum will ich ihm die Vielen als Anteil geben, und die Mächtigen fallen ihm als Beute zu dafür, daß er sein Leben in den Tod dahingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt ward, während er doch die Schuld der Vielen trug und eintrat für die Sünder“ …
Auf weitere Unterschiede der Kreuzigungsdarstellung bei Johannes gegenüber den Synoptikern geht Thyen an dieser Stelle vorausblickend und zusammenfassend ein:
Während bei Markus und Matthäus dem Akt der Kreuzigung die Gabe gewürzten Weines (esmyrnismenos oinos: Mk) bzw. mit Galle gemischten Weines (oinon meta cholēs memigmenon: Mt) an den Verurteilten vorausgeht und allein Lukas die Soldaten dem bereits Gekreuzigten aus Spott Essig reichen läßt (oxos prospherontes autō: 23,36), hat Johannes diesen Zug zu einer Jesu Sterben unmittelbar vorausgehenden eigenen Episode gestaltet (19,28-30). Das gilt auch für das Verteilen und Verlosen der Kleidung Jesu unter die Soldaten. Waren hier schon die Prätexte im intertextuellen Spiel mit Ps 22,19 begriffen, so hat Johannes auch diesem Zug ein eigenes Gewicht verliehen: Vier Soldaten teilen sich Jesu Kleider und über seinen ungenähten Leibrock werfen sie das Los. Und das erhält seine besondere Beleuchtung durch andere Vier, nämlich Jesu Mutter, die beiden Marien und den geliebten Jünger (23-24 u. 25-27; s. u. z. St.). Endlich hat Johannes auch aus der in den Prätexten bloß mitgeteilten Kreuzesinschrift eine eigene Episode gemacht, in der es erneut zum Zusammenstoß der Ankläger Jesu mit Pilatus kommt (19-22).
Recht knapp legt Ton Veerkamp <1361> die Verse 16b bis 18 aus, indem er sein Augenmerk ganz auf die Art richtet, in der Jesus als der König Israels für eben dieses Volk Israel Frieden und Befreiung bewirken kann:
Wir verlassen das Prätorium und das Hin und Her zwischen Rom, der judäischen Regierung und dem Messias. Aber auch auf dem Weg zwischen dem Lithostrōtos, Gabbatha, dem römischen Richterstuhl, zur Schädelstätte, Kraniou Topos, Golgotha, bleibt das Thema des Königs das Leitmotiv. Der König trägt das Instrument seiner Hinrichtung selbst. Johannes betont das, nicht nur, weil die Verurteilten ihr Kreuz selber schleppen mussten, sondern vor allem um anzuzeigen, dass Jesus genau das will. Jesus hatte keinen Hang nach dem Märtyrertum, er ist kein Selbstmordtäter. Dennoch wählt er selbst und völlig bewusst den Weg von Gabbatha nach Golgotha, weil dieser der einzige ist, auf dem das Volk seinen Frieden und Heilung von seinem politischen Abenteurertum findet: „Trug er nicht so die Verirrung der vielen?“, fragte Deuterojesaja, Jesaja 53,12. Der Mensch, dieser Mensch als König. Er wird zwischen zwei anderen gekreuzigt. Auch hier erklingt das Lied des leidenden Sklaven: „Er entblößte bis zum Tode seine Seele, unter den Aufständischen wurde er gerechnet“, Jesaja 53,12.
↑ Johannes 19,19-22: Die umstrittene Urteilsbegründung am Kreuz Jesu: Jesus der Nazoräer, der König der Juden
19,19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift
und setzte sie auf das Kreuz;
und es war geschrieben:
Jesus von Nazareth, der Juden König.
19,20 Diese Aufschrift lasen viele Juden,
denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde,
war nahe bei der Stadt.
Und es war geschrieben
in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.
19,21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus:
Schreibe nicht: Der Juden König,
sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König.
19,22 Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
[23. Januar 2023] Zu Vers 19 schreibt Klaus Wengst (W526), dass Johannes „in Übereinstimmung mit den synoptischen Evangelien (Mt 27,37; Mk 15,26; Lk 23,38)“ vermerkt: „Pilatus ließ auch eine Tafel schreiben und an das Kreuz heften.“ Mit dem Wort „Tafel“ übersetzt Wengst das griechische Wort titulus, wozu er auf einige Fälle verweist, die belegen, dass „die Schuld eines Verurteilten mit einer Tafel (titulus) öffentlich gemacht wurde“:
Am aufschlussreichsten ist die Angabe bei Cassius Dio, Römische Geschichte 54, 3,7, über einen Vorfall zur frühen Zeit des Augustus, weil hier die Aufschrift der Schuld mit einer Kreuzigung verbunden ist: Ein Herr ließ einen Sklaven „mitten über das Forum mit einer Aufschrift (grámmata) führen, die den Grund seiner Hinrichtung anzeigte, und anschließend kreuzigen“. Was geschah mit einer solchen Tafel, wenn der Verurteilte am Kreuz angebracht war? Was lag näher, als sie ebenfalls ans Kreuz zu heften? Sie erfüllte dann weiter dieselbe Funktion, die sie beim Gang zur Richtstätte hatte. Berichtet wird ein solches Verfahren allerdings nur in den Evangelien im Falle Jesu. Das spricht nicht gegen seine Historizität, da es sich fast von selbst ergab.
Auch zum Inhalt der Tafel, der „sich außer in Mt 2,2 nur im Zusammenhang des Verhörs durch Pilatus und auf dem titulus“ findet, meint Wengst, es sei „jedenfalls historisch wahrscheinlich“, dass „Jesus aus römischer Perspektive als ‚König des jüdischen Volkes‘, als messianischer Aufrührer, hingerichtet wurde“:
Nicht christologisches Nachdenken hat nach Ostern diese Bezeichnung samt dem titulus produziert, sondern die historisch im Prozess vor Pilatus und in der Kreuzigung verankerte Bezeichnung hat das christologische Denken angeregt und beeinflusst: Als wer Jesus hingerichtet worden ist, als „König des jüdischen Volkes“, als messianischer Prätendent, als der ist er durch die Auferweckung von den Toten vonseiten Gottes erwiesen worden. Von daher ist es verständlich, dass der Titel christós („Gesalbter“, „Messias“) und der zur königlichen Messianologie gehörige Titel „Sohn Gottes“ schon in vorpaulinischen Formeln im Zusammenhang der Deutung des Todes Jesu begegnen …
Mit der Aufschrift auf der Tafel (W527): „Jesus aus Nazaret, der König des jüdischen Volkes“ wird nach Wengst „aufgenommen, was sich in 18,33 als Inhalt der Anklage ergab und womit Pilatus in 19,14f. Jesus den Anklägern zum Spott vorstellte“, aber „der weitere Text, der keine Parallelen bei den Synoptikern hat“, wird betont herausstellen, dass Johannes „durch Pilatus mehr geschrieben sein“ lässt, „als dieser damit sagen wollte.“ Wengst wehrt sich aber dagegen, diese Aussage in einem „grundsätzlich antijüdischen“ Sinn zu interpretieren, wie dies etwa Bultmann <1362> tut, demzufolge
„durch diese Inschrift demonstriert [wird], daß die Verurteilung Jesu zugleich das Gericht über das Judentum ist, das seine Hoffnung, die seiner Existenz ihren Sinn gab, preisgegeben hat“. Der antijüdische Charakter dieser Aussage wird nicht aufgehoben, wenn Bultmann verallgemeinernd fortfährt: „- das Gericht über die Welt, die um der Sicherheit der Gegenwart willen ihre Zukunft preisgibt“, weil damit das Judentum auf die negativ qualifizierte Welt festgelegt ist.
Natürlich wendet sich Wengst zu Recht gegen diese verallgemeinernde Judenfeindlichkeit, scheint aber außer Acht zu lassen, dass der jüdische Messianist Johannes tatsächlich die priesterliche Führung Judäas in ihrer Kollaboration mit der gottwidrigen römischen Weltordnung als gerichtet ansieht. Keineswegs ist in seinen Augen damit jedoch eine Verurteilung ganz Israels verbunden, dessen Leben der kommenden Weltzeit der Messias Jesus durch seinen Tod am Kreuz anbrechen lassen wird.
In Vers 20 bestätigt sich nach Wengst, dass sich Johannes
beim Prozess vor Pilatus und bei der Kreuzigung nicht eine große Menschenmenge als anwesend vorstellt. Erst jetzt, da Jesus und die beiden anderen schon am Kreuz hängen, kommen „viele aus der jüdischen Bevölkerung“. Ihr Kommen wird mit der Nähe der Hinrichtungsstätte zur Stadt motiviert. Als auslösender Faktor dafür gilt – als selbstverständlich vorausgesetzt -, dass die Gekreuzigten von der Stadt her gesehen werden können. So schreibt Johannes: „Diese Tafel lasen nun viele aus der jüdischen Bevölkerung, da der Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, nahe bei der Stadt lag.“
Durch die weitere Angabe: „Auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch stand es geschrieben“, betont der Evangelist Wengst zufolge, „dass die allseitige Lektüre intendiert ist und dass die Tafel auch von allen gelesen werden kann“, denn mit
„Hebräisch“ dürfte das im Land gesprochene Aramäisch gemeint sein, Lateinisch war die Sprache der römischen Verwaltung und Griechisch die im gesamten Imperium allgemein gebräuchliche Verkehrssprache. Wichtige Dekrete wurden lateinisch und griechisch abgefasst.
Diese (W528) öffentliche „Wirkung, die die Tafel erzielt“, führt zu einem weiteren Auftritt der „Oberpriester“, die sich in Vers 21 mit der Forderung an Pilatus wenden:
„Lass nicht geschrieben sein: ,der König des jüdischen Volkes‘, sondern; ,Der hat gesprochen: Ich bin der König des jüdischen Volkes‘.“ Was auf der Tafel steht, soll nicht als Proklamation missverstanden werden können, sondern als Anmaßung des Hingerichteten deutlich sein. Dieser Forderung gegenüber erweist sich Pilatus jetzt {Vers 22}, da es zu spät ist, als standfest, indem er schlicht feststellt: „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“ Was er geschrieben hat, steht nun da und bleibt stehen. Auf die dadurch ermöglichte Proklamation kommt es Johannes an. Seine Leser- und Hörerschaft soll es wahrnehmen, dass Pilatus, der sich vorher von der Wahrheit abwandte, nun unfreiwillig die Wahrheit bezeugt: Der hier am Kreuz Sterbende ist „der König des jüdischen Volkes“.
In der „hier von den Oberpriestern an Pilatus gerichtete Forderung“ sieht Wengst eine ernst zu nehmende „Anfrage“ jüdischer Menschen an „uns als Christenheit“:
Wie können und dürfen wir von „Jesus als König des jüdischen Volkes“ reden? Johannes hat das als Jude getan in einer Zeit, in der noch nicht ein Christentum dem Judentum gegenüber stand. Können und dürfen wir den von Johannes als „König des jüdischen Volkes“ bezeugten Jesus heute Jüdinnen und Juden als von ihnen zu akzeptierenden Messias vorhalten? Müsste nicht vielmehr diese Rede – in Verbindung mit V. 20b – so aufgenommen werden, dass sich dieser Messias aus Israel als „Retter der Welt“ (vgl. zu 4,42) erwiesen hat?
Hier macht Wengst unübersehbar deutlich, dass er das Johannesevangelium dadurch vom Vorwurf des Antijudaismus freisprechen will, indem er es letzten Endes, anknüpfend an Paulus/Lukas oder Matthäus, umzudeuten versucht, nämlich so, dass sich Jesu Anspruch nicht auf das Judentum bezieht, sondern auf die Völkerwelt. Dem Johannesevangelium wird er damit jedoch nicht gerecht. Es bleibt ein jüdisch-messianisches Evangelium, das das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker eindeutig an das Bekenntnis zum Messias Jesus bindet, und zwar in erster Linie für ein Rest-Israel, das sich in der messianischen Gemeinde sammelt. Dass das Johannesevangelium heidenchristlich umgedeutet und missbraucht wurde, ist in der Auslegung zu brandmarken. Dass es in seiner ursprünglichen Zielrichtung gescheitert ist und bezüglich der Erhaltung der Identität Israels als auf die Tora hörendes Gottesvolk inmitten der Völker gegenüber dem rabbinischen Judentum im Unrecht war, ist realistisch festzustellen. Dennoch mag es angebracht sein, die diesseitsbezogene Hoffnung auf die Überwindung der Gewaltordnungen dieser Welt vom Vertrauen auf den befreienden NAMEN des Gottes Israels her zu bewahren und im Zusammenklang mit den anderen messianischen Schriften dann auch auf die Befreiung der Völker der Welt von den Ordnungen, die auf ihnen lasten, zu beziehen – und das (nunmehr in vollem Einverständnis mit Wengst) auch im respektvollen Dialog mit Vertretern des Judentums.
Hartwig Thyen (T735) betont zu Vers 19, dass Pilatus „die Kreuzesaufschrift … natürlich nicht selbst geschrieben“ hat, aber sie geht nach Johannes „ausdrücklich auf die Anordnung durch Pilatus zurück“:
Die Inschrift oder vielleicht die sie tragende Tafel, von der dann das darauf Geschriebene (gegrammenon) zu unterscheiden wäre, bezeichnet Johannes mit dem Lexem titlos, einem Lehnwort nach dem lateinischen titulus, das sich im gesamten Neuen Testament nur hier findet. Möglicherweise hat er anstelle des gebräuchlicheren Lexems epigraphē {Aufschrift} seiner Prätexte das seltene titlos gewählt, weil es einerseits zwar terminus technicus für eine beschriebene Tafel ist, die Namen und Verbrechen des Verurteilten angibt und ihm auf dem Gang zur Exekution umgehängt oder vorangetragen wird, andererseits aber dient das Wort titulus in der Regel der Bezeichnung von Ruhmes- oder Ehrentiteln, so daß es in diesem Kontext absichtsvoll doppeldeutig sein könnte…
Gegenüber den Hinweisen auf „den Grund der Hinrichtung“ bei den Synoptikern heißt es Thyen zufolge bei Johannes
[s]ehr viel ,dokumentarischer‘ und ,titularer‘ …: Iēsous ho Nazōraios ho basileus tōn Ioudaiōn {Jesus, der Nazoräer, der König der Juden}. Anzumerken ist hier freilich, daß wir jenseits des Neuen Testaments und der darauf bezogenen Literatur keinen einzigen Beleg für den Brauch haben, daß ein derartiger titulus je zu Häupten von Hingerichteten an deren Kreuzen angebracht worden wäre.
Da diese Inschrift nach Vers 20 „dazu noch in drei Sprachen, nämlich hebräisch, lateinisch und griechisch“ abgefasst wurde, „nämlich in der Volkssprache, in der lateinischen Amtssprache (Rōmáïsti) und auf griechisch, jener Sprache, die seit dem Alexanderzug zur lingua franca {Verkehrssprache eines größeren mehrsprachigen Raums} der alten Welt geworden war“, und weil „Jesu Kreuz offenbar an einer belebten Straße stand, die in die Stadt Jerusalem führte, gingen viele Juden daran vorüber und lasen die Inschrift.“
Diese öffentliche Aufmerksamkeit wiederum erweckte nach Vers 21
den zornigen Widerspruch der Oberpriester. Sie wandten sich also an Pilatus und forderten, er müsse die Inschrift revidieren. Das drückt er negierte Imperativ Präsens mē graphē aus…. Pilatus dürfe den Nazarener Jesus doch nicht als König der Juden proklamieren, sondern müsse stattdessen schreiben lassen: ,Dieser (Mann) hat behauptet: Ich bin der König der Juden“. Doch Pilatus weicht nun nicht noch einmal vor ihnen zurück {Vers 22}, sondern erklärt: ,Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben‘. Wiederum unwissend macht sich der Statthalter Roms mit dieser unabänderlichen Inschrift zum Zeugen der Wahrheit Jesu, von der er doch im Verhör noch nichts wissen wollte, wie seine skeptische Frage: ,Was ist Wahrheit?‘ verriet. Ja, die Dreisprachigkeit der Inschrift macht ihn ironischerweise nolens volens zum ersten Missionar Jesu über die Sprachgrenzen Israels hinaus.
Ton Veerkamp <1363> erläutert in seiner Anm. 530 zur Übersetzung von Johannes 19,19, warum er titlos als einen Begriff „aus der lateinischen Gerichtssprache“ mit „Urteilsbegründung“ umschreibt. Zwar kann das Wort „Titel“ auch im Deutschen eine auf das Recht bezogene Bedeutung haben, aber „‚Schuldtitel‘ hat bei uns hauptsächlich mit Geldschuld zu tun.“
Die in Vers 20 erwähnte Mehrsprachigkeit der Urteilsbegründung nimmt Veerkamp nicht wie Wengst und Veerkamp zum Anlass, Johannes die Neigung zu einer Völkermission zu unterstellen, zumal in diesem Vers lediglich von vielen jüdischen Menschen die Rede ist, die sich für sie interessieren. Schon zu Johannes 11,52 hatte Veerkamp ja herausgestellt, dass er unter den „auseinandergejagten Gottgeborenen“ die in alle Welt versprengten Diasporajuden versteht und nur am Rande auch Gottesfürchtige aus den nichtjüdischen Völkern.
Was genau geschieht nun nach Veerkamp mit der Kreuzigung Jesu als des Königs der Judäer?
Genau an diesem Punkt setzt sich der Messias gegen Rom und gegen seine judäischen Gegner durch. Der Grund, weshalb Rom Jesus hinrichten ließ, ist die Tatsache, dass er König der Judäer ist. Damit ist das Königtum Jesu, der absolute Widerspruch zum Königtum Roms, amtlich besiegelt, und zwar in drei Sprachen, aramäisch, lateinisch, griechisch. Viele der Judäer – aus aller Herren Länder, denn es war Pascha – lasen diese Begründung.
Das kann die politische Führung Judäas nicht tatenlos hinnehmen (Vers 21):
Aber die führenden Priester der Judäer ahnten politisches Ungemach. Es muss klargestellt werden, dass es sich um einen illegitimen Anspruch Jesu handelte. Sonst würde eine solche Begründung die Legitimität der Macht führender Eliten in Frage stellen. Pilatus solle das berichtigen.
Ungewöhnlich ist nach Veerkamp, dass die von den Priestern angemahnte Veränderung des titlos lautet: „Jener hat gesagt: König bin ich der Judäer“. In seiner Anm. 531 zur Übersetzung von Johannes 19,21 weist er darauf hin, dass die „führenden Priester“ auf diese Weise „durch eimi das Wort basileus von tōn Ioudaiōn“ trennen. Aber sie können Pilatus nicht noch einmal in die Enge treiben:
Jetzt setzt sich Pilatus gegen die führenden Priester durch. … Pilatus weist das Gesuch barsch zurück, was er geschrieben habe, habe er geschrieben. Es bleibt dabei: Jesus aus Nazareth ist König der Judäer, die Priester selber haben seine Kreuzigung verlangt, jetzt haben sie keinen anderen König mehr als nur den Cäsar! Sie sind keine legitime Obrigkeit mehr, denn sie haben die Kreuzigung ihres wahren Königs verlangt. Das ist keine schäbige Retourkutsche des Pilatus, der das Spiel gegen die Priester verloren haben soll. Nein, er bleibt dabei: Jesus ist der messianische König, und Rom bringt ihn auf Verlangen der Führung der priesterlichen Eliten um.
Nach Veerkamp scheint es so, als dürfe Pilatus an dieser Stelle einen Sieg über die judäische Führung und erst recht über einen unbedeutenden Möchte-gern-König verzeichnen:
Die Autorität Roms scheint jetzt definitiv gefestigt, die Führung erkennt Cäsar als ihren einzig legitimen König an, Rom hat gewonnen. Hat es?
↑ Johannes 19,23-24: Vier römische Soldaten teilen Jesu Kleider und werfen das Los über sein Gewand
19,23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten,
nahmen seine Kleider und machten vier Teile,
für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock.
Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück.
19,24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen,
sondern darum losen, wem er gehören soll.
So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19):
„Sie haben meine Kleider unter sich geteilt
und haben über mein Gewand das Los geworfen.“
Das taten die Soldaten.
[24. Januar 2023] Aus den Worten in Vers 23 (W528): „Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile – für jeden Soldaten ein Teil“, ergibt sich nach Klaus Wengst nebenbei
die Anzahl von vier Soldaten, die die Hinrichtungen ausgeführt haben und nun Wache halten, damit niemand versuche, einen der Gekreuzigten abzunehmen und zu retten. Ihnen kommt zu, was die zum Tode Verurteilten auf dem Leib trugen. Dabei erwähnt Johannes hier nur die Hinterlassenschaft Jesu, nicht die der Mitgekreuzigten.
Da die „Aufteilung der Hinterlassenschaft eines Hingerichteten … selbstverständlich“ war, geht Wengst davon aus, dass der auch in den „synoptischen Evangelien“ enthaltene entsprechende Bericht nicht erst auf Grund der „Lektüre des Psalms“ 22,19 erfunden wurde:
Aber dass sie im Falle Jesu erwähnt und wie sie erzählt wird, gründet im Lesen der Schrift. In dem im Psalm ausgesprochenen Leiden des Gerechten entdeckte man die Geschichte Jesu. Indem ihr schreckliches Ende mit der Schrift erzählt werden kann, kommt Gott ins Spiel – und damit wird für die Geschichte Jesu eine Perspektive offen gehalten, die über dieses Ende hinaus reicht.
Während die Synoptiker darauf verzichten, „das Zitat ausdrücklich kenntlich zu machen (W529), macht Johannes in Vers 24
den Bezug auf die Schrift ausdrücklich. „So sollte die Schrift ausgeführt werden: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über meine Kleidung das Los geworfen.“ Hier wird nun deutlich, wie die Lektüre der Schrift auch erzähltes Geschehen produziert. Während die Synoptiker in Aufnahme des Psalmverses die Verteilung der Kleider durch Losen geschehen lassen, ordnet Johannes jeder Zeile des ganz zitierten Verses einen eigenen Vorgang zu.
Das geschieht bereits vor der Zitierung des Psalmverses am Ende von Vers 23 und am Anfang von Vers 24:
Nachdem er schon berichtet hat, dass die Soldaten die Kleider in vier Teilen nahmen, fügt er noch an: „Auch den Hemdrock“. Er beschreibt ihn näher: „Der Hemdrock war ohne Naht, von oben an ganz durchgewebt.“ Diese Beschaffenheit lässt die Soldaten erwägen: „Wir wollen ihn nicht zerreißen, sondern darüber losen, wessen er sei.“ Was Johannes über den Hemdrock sagt, erklärt sich also hinlänglich aus dem Interesse, das sich in der Anführung des Zitates zeigt. Wenn zu einem schlimmen Geschehen eine Entsprechung in der Schrift gefunden wird, ist es nicht mehr nur schrecklich, ist es vor allem nicht mehr fatal, sondern dann verbindet sich damit die Hoffnung, dass in ihm – trotz allem – Gott zum Zuge komme.
Zur Bedeutung des Wortes chitōn {Hemdrock} bezieht sich Wengst (Anm. 370) auf Billerbeck, <1364> demzufolge es „ein langes, mit Ärmeln versehenes Kleid“ war, „meist aus Wolle oder Leinwand gefertigt“, und als „Untergewand … entweder auf der bloßen Haut oder über einem leinenen Hemd“ getragen wurde.
Wie steht es (W529) mit dem „Hemdrock ohne Naht“? Wengst meint (Anm. 371):
Der vergleichende Blick auf die Synoptiker legt den Schluss von Blank <1365> nahe, „daß der ,Leibrock ohne Naht‘ von Johannes erst aufgrund der Schriftstelle erfunden worden ist“. Ich würde allerdings lieber formulieren: „in der Schriftstelle gefunden“. Dass dann ein entsprechender Rock auch in der Wirklichkeit gefunden wurde und bis heute in Trier verwahrt wird, ist eine andere Geschichte.
Er schließt aber nicht aus, „dass hier auch eine hohepriesterliche Funktion des sterbenden Jesus anklingen soll“, denn nach Josephus (Ant 3, 161, vgl. bei H. Clementz Ant. 3,7,4) besteht der „Hemdrock (des Hohepriesters) … nicht aus zwei Teilen, so dass er an den Schultern und an den Seiten entlang genäht wäre, sondern er ist als einziges langes Stück gewebt“. Auch trug Mose nach zwei rabbinischen Stellen <1366> „die sieben Tage bei der Einweihung des Zeltes der Begegnung ‚einen weißen Hemdrock ohne Naht‘.“ Wie der Hohepriester in der biblisch-jüdischen Tradition wirkt Jesus „Versöhnung – in dem in 11,50-52 und 18,14 hintergründig gemeinten Sinn.“
Ein weiterer Aspekt dieser Szene wird sich „erst im Zusammenhang mit der folgenden“ ergeben, zu der Johannes „ausdrücklich eine Verbindung“ herstellen wird.
Nach Hartwig Thyen (T736) geht erst aus Vers 23 hervor, dass „vier Soldaten mit der Kreuzigung Jesu beauftragt waren, also die kleine militärische Einheit eines tetradion“, von der auch in Apostelgeschichte 12,4 die Rede ist. Zu Vers 24 schreibt er:
Während alle drei Synoptiker bei der Schilderung der Verteilung der Kleidung Jesu unter die Soldaten an Ps 22,19 nur anspielen (Mk 15,24; Mt 27,35; Lk 23,34), wählt Johannes hier mit dem wörtlichen Zitat des LXX-Textes von Ps 22,19 die unmittelbarste Form der Intertextualität. Selbst dieses Tun der Soldaten, das dem christlichen Leser makaber erscheinen mag, aber wohl das Gewohnheitsrecht der zur Hinrichtung kommandierten Soldaten war, muß bei ihm noch der Erfüllung der Schrift dienen, die da sagt: diemerisanto ta himatioa mou heautois / kai epi ton himatismon mou ebalon klēron {Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand}. Der dem Schriftzitat unmittelbar nachgestellte Satz: „Das taten die Soldaten damals“, zeigt, daß auch sie ihren Part hatten bei der Vollendung von Gottes Plan, die Welt durch die Hingabe seines Sohnes zu erlösen…
Ein weiterer Unterschied zur Aufnahme des Psalmzitats durch die Synoptiker besteht bei Johannes darin, dass er „die beiden Glieder dieses parallelismus membrorum {Nebeneinanderstellung zweier parallel gebauter Sätze} nicht als synonym“ begreift (T736f.):
Er unterscheidet darin vielmehr das Verteilen der Kleider (ta himatia) von der Verlosung des Untergewandes (himatismos), das er als den chitōn bezeichnet. Die Angabe, daß dieser chitōn nahtlos und von oben bis unten aus einem Stück gewebt war, dient auf der Ebene der Erzählung allein der Begründung des Umstandes, daß das Los entscheiden sollte, wer dieses unteilbare Stück bekomme. Ob dieser Zug der Erzählung darüberhinaus noch einen symbolischen Sinn haben könnte, ist umstritten und schwer zu entscheiden.
Thyen sieht jedenfalls (T737) anders als Wengst und viele andere Kommentatoren „seit der Zeit der Kirchenväter … in der ausdrücklichen Beschreibung dieses Gewanes“ nicht unbedingt einen Hinweis auf das „Hohepriestertum Jesu“, für das im Johannesevangelium ansonsten „keinerlei Indizien“ zu entdecken sind, „nicht einmal die entfernteste Andeutung“. Für äußerst unwahrscheinlich hält Thyen
auch die seit Cyprian (de cathol. eccl. Unitate 7) öfter wiederholte Deutung des ungenähten Untergewandes Jesu auf die Einheit der Kirche. Angesichts eines durch das Los an einen der heidnischen Soldaten gefallenen Kleidungsstückes ist sie nicht plausibel.
Anders als Wengst und Thyen bezieht Ton Veerkamp <1367> den Hintergrund der Verse 23 und 24 im 22. Psalm nicht auf den Umstand, dass hier trotz allem Gott zum Zuge kommt bzw. die Rolle römischer Soldaten in Gottes Plan der Erlösung der Welt beschrieben wird. Er legt Wert darauf, sich den gesamten Psalm 22 vor Augen und Ohren zu stellen, um der tatsächlichen Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz nachzuspüren:
Römische Söldner wurden nicht üppig entlohnt, deswegen hielten sie sich an der Nachlassenschaft eines Verurteilten schadlos. Die Nachlassenschaft Jesu bestand nur aus den Kleidern an seinem Leib. Für die messianische Erzählung ist dieses Detail wichtig, weil es eine Erfüllung der Schrift – hier des 22. Psalms – ist. Der Psalm ist einer der erschütterndsten Lieder Israels. Wir können ihn nicht besprechen, bitten aber die Lesenden, an dieser Stelle den ganzen Psalm zu lesen. Sie werden verstehen, warum die messianischen Gemeinden in diesem Lied eines verzweifelten Kindes Israels den Messias Jesus gesehen haben. Der Psalm beginnt (2-9):
Mein Gott, mein Gott, warum verlässt du mich?
Ich brülle, fern ist meine Befreiung.
Mein Gott, ich rufe am Tage und du antwortest nicht,
nachts, und ich kann nicht schweigen.
Bist du doch der Heilige, wohnst im Lobgesang Israels.
An dir fanden unsere Väter Sicherung,
sicher waren sie, denn du ließest sie entkommen.
Zu dir riefen sie, du ließest sie entfliehen,
deiner waren sie sicher, sie wurden nicht beschämt.
Ich aber bin nur ein Wurm und kein Mensch,
Hohn den Menschen, verachtet vom Volk.
Alle, die mich sehen, verspotten mich,
sie spitzen die Lippen, schütteln den Kopf:
„Schieb es auf den NAMEN, mag er ihn entkommen lassen,
mag er ihn retten, wenn er lustig ist!“Die Synoptiker lassen die Schaulustigen am gekreuzigten Messias vorbeiziehen und sagen: „Andere hat er befreit, sich selbst kann er nicht befreien. Der Messias, der König Israels steige ab von seinem Kreuz, dann vertrauen wir ihm …“, Markus 15,31ff. Diese bibelfesten Schaulustigen fehlen bei Johannes; hier sind nur Gojim {Nichtjuden}. Weiter heißt es im Psalm, V. 17bff.:
In den Staub des Todes ziehst du mich.
Denn mich umzingeln Hunde,
umkreist mich der Verein der Bösen,
sie fesseln mich an Hand und Fuß,
ich kann all meine Knochen zählen.
Die gucken zu, besehen mich,
teilen sich meine Kleider,
über mein Gewand werfen sie das Los …Die Kommentatoren teilen Wissenswertes mit über den Leibrock ohne Naht. Johannes weicht vom Psalm ab. Er lässt sie nüchtern überlegen: „Es wäre schade, das gute Stück zu zerreißen, lasst uns würfeln.“ Johannes will zeigen, dass sie tatsächlich „nicht wissen, was sie tun“. Für ihn ist das Ganze ein Teil ihres blutigen Jobs. Hinter dem Rücken der Täter vollzieht sich das große Drama, in dem sie bewusstlos mitspielen: Rom erfüllt hier die Schrift. Der Messias Israels ist nicht der strahlende Heerführer des Endzeitsieges, er ist der Sklave aus Jesaja 53, er ist der Geschundene von Psalm 22.
An dieser Stelle stellt Veerkamp eine Frage, die sich aufdrängt, wenn man möglichst unbefangen (also ohne die christliche Gewohnheit, die Schrecken der Kreuzigung von einem triumphal verstandenen Osterereignis her zu verharmlosen) die Erzählung von der Kreuzigung Jesu zu lesen versucht:
„Was hab‘ ich davon?“ Diese Frage nach dem Erlösungs- oder Befreiungswert dieses blutigen Spektakels ist immer wieder die Frage, auf die wir stoßen.
Die Antwort, die Veerkamp auf diese Frage andeutet, bezieht sich auf die Hoffnung, die der Psalm 22 selbst für Israels Zukunft inmitten der Völker formuliert, wenn die Ausbeuter und Gewaltherrscher der Erde ihre Macht verlieren und sich vor dem befreienden NAMEN verneigen müssen:
Der Psalm endet freilich so (28-32):
Sie werden gedenken, sie kehren um zu ihm, dem NAMEN,
alle Ränder der Erde.
Sie werden sich deinem Angesicht verneigen,
alle Geschlechter der Völker,
denn dem NAMEN ist das Königreich,
Er waltet über die Völker.
Die das ganze Fette der Erde fressen,
verneigen sich,
sie gehen auf die Knie vor ihm, alle,
die zum Staub herabgesunken sind –
und ihre Seele bleibt nicht am Leben.
Der Same aber darf ihm dienen.
Erzählt wird von meinem Herrn dem kommenden Geschlecht,
und meldet seine Bewährung dem nachgeborenen Geschlecht,
was Er getan hat.In Israel ist kein Untergang endgültig. Deswegen muss der Psalm 22 bei jeder Erzählung über die Passion des Messias mitgebetet werden.
„Das also machen die Soldaten“, sagt Johannes.
↑ Johannes 19,25-27: Jesu letzter Wille für seine Mutter und den geliebten Schüler in Anwesenheit zweier weiterer Frauen als Zeuginnen
19,25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu
seine Mutter
und seiner Mutter Schwester,
Maria, die Frau des Klopas,
und Maria Magdalena.
19,26 Als nun Jesus seine Mutter sah
und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte,
spricht er zu seiner Mutter:
Frau, siehe, das ist dein Sohn!
19,27 Danach spricht er zu dem Jünger:
Siehe, das ist deine Mutter!
Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
[25. Januar 2023] Die letzten Worte von Vers 24 (W530), hoi men oun stratiōtai tauta epoiēsan, übersetzt Klaus Wengst wörtlich mit: „Das zwar hatten nun die Soldaten getan“, das heißt, er versteht sie nicht einfach als „den Abschluss der Szene über die Verteilung der Kleider Jesu“, sondern nimmt ernst, dass „mit dieser Bemerkung eine Zwar-Aber-Konstruktion beginnt“ und „eine neue Szene“ eröffnet, indem „Johannes zusammenfassend auf das Tun der Soldaten“ zurückblickt:
Das darin Erzählte verbindet Johannes auf diese Weise mit dem Tun der Soldaten und stellt es ihm gegenüber. Während diese das Wenige an sich brachten, was Jesus auf dem Leib trug, wird nun gezeigt, wie vom Kreuz Jesu her sein Vermächtnis erfüllt wird. Dazu nimmt Johannes die Tradition auf, die mit der Kreuzigung Jesu die Anwesenheit von Frauen verbindet, und gestaltet sie aus. So erstellt er – noch nicht ganz vollständig – die Szenerie für das, was er nun erzählen will: „Es standen aber beim Kreuz seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, die Mirjam des Klopas und Mirjam aus Magdala. Jetzt, in der Todesstunde, sind es Frauen, die Jesus am nächsten stehen.
Unwesentlich ist dabei in den Augen von Wengst (Anm. 373), „wie viele Frauen hier vorgestellt sind“, was sich auch „nicht mit Sicherheit klären“ lässt:
Es kann auch an nur drei Frauen gedacht sein, wenn „die Mirjam des Klopas“ als Näherbezeichnung der „Schwester seiner Mutter“ verstanden ist.
Auch hier ist deutlich (Anm. 374), „dass Johannes … Tradition aufnimmt“, denn schon„die synoptischen Evangelien erwähnen Frauen im Zusammenhang der Kreuzigung Jesu (Mt 27,55f.; Mk 15,40; Lk 23,49).“ Über die von allen Evangelisten genannte Maria Magdalena hinaus finden sich die „Mutter Jesu, deren Schwester und die Mirjam des Klopas“ nur bei Johannes:
Die Mutter Jesu und – im folgenden Vers genannt – der Schüler, den Jesus liebte, kommen unter das Kreuz zu stehen, weil er gerade diese beiden für das braucht, was er in dieser Szene sagen will. Deshalb schauen die Frauen hier auch nicht – wie in den synoptischen Evangelien – „von fern“ zu, sondern stehen beim Kreuz.
Zur „Mutter Jesu“ erwähnt Wengst weiter (W530), dass sie „im Johannesevangelium nie mit Namen genannt“ und „in 6,42 von Außenstehenden nur eben erwähnt“ wird:
Sie trat aber schon zu Anfang des Evangeliums auf, als Jesus zum ersten Mal von seiner „Stunde“ sprach, die noch nicht gekommen war (2,4). Jetzt ist diese Stunde da und auch die Mutter ist wieder anwesend. Johannes stellt sie der Aufzählung der Frauen beim Kreuz voran, weil er von ihr gleich mehr erzählen will. Die aufgenommene Tradition bildet den Rahmen, innerhalb dessen er nun ein eindrückliches Bild zeichnet.
Zu den drei oder vier in Vers 25 erwähnten Frauen tritt in den Versen 26 und 27 eine vierte Person hinzu:
Jetzt führt Johannes auch noch den Schüler, den Jesus liebte, als beim Kreuz stehend an. Jesus wendet sich jeweils an seine Mutter und ihn und weist sie einander zu: „Als nun Jesus seine Mutter erblickte und den Schüler, den er liebte, bei ihr stehen, sagte er seiner Mutter: ,Frau, sieh doch, dein Sohn!‘ Danach sagte er dem Schüler: ,Sieh doch, deine Mutter!‘“
Indem diese „Zuweisung“ (W531) „zugleich den Charakter eines Gebotes“ hat und als „das Letzte, was Jesus vor seinem Tod gebietet, … den Charakter eines Vermächtnisses“ bekommt, beschreibt Jesus klar und deutlich, was es mit „Jesu Stunde“ auf sich hat, von der Jesus „nach 13,1 wusste, dass sie gekommen sei“ und die „mit Jesu Tod ihren Höhepunkt“ erreicht. Dem von Jesus ausgesprochenen Vermächtnis
wird sogleich entsprochen: „Und von jener Stunde an nahm sie der Schüler bei sich auf.“ … Von dieser Stunde an, vom Kreuz Jesu her, nimmt der Schüler die Mutter Jesu bei sich auf, verhält er sich ihr gegenüber solidarisch. Es ist das genau gegenteilige Verhalten zu dem vorher geschilderten der Soldaten. Während sie den kärglichen Besitz Jesu an sich rafften, wird hier sein Vermächtnis erfüllt, einander zu lieben. Dieses Vermächtnis hat Jesus – im Wissen, dass seine Stunde gekommen sei – seinen Schülern in 13,34f. gegeben. Vom Kreuz herab konkretisiert er es jetzt gegenüber der Mutter und dem Schüler. So entsteht ein eindrückliches Bild dessen, worauf das Vermächtnis Jesu zielt: dass von seinem Kreuz herkommend solidarisch gehandelt wird. So ist dieser namenlose Schüler der ideale Schüler, mit dem sich alle identifizieren können und sollen.
Wenn „man diese Absicht“ wahrnimmt, ist es nach Wengst (Anm. 375)
weder angebracht, diese Gestalt in irgendeiner Weise zu historisieren, noch Überlegungen darüber anzustellen, wieso nicht ein Bruder Jesu mit der Sorge für die Mutter betraut wird. Völlig abwegig ist die Deutung der Mutter Jesu auf das Judenchristentum und des Schülers auf das Heidenchristentum bei Bauer und Bultmann <1368> – als wäre dieser weniger als Jude vorzustellen als jene als Jüdin.
Das ist richtig; dennoch ist eine symbolische Deutung dieser beiden wohl mit Absicht namenlosen Gestalten im Johannesevangelium nicht auszuschließen, auf die ich im Zusammenhang mit Thyens und Veerkamps Auslegungen zu sprechen kommen werde.
Dass der Schüler, „den Jesus liebte, … an dieser Stelle nicht in einem unmittelbaren Gegenüber zu Simon Petrus“ steht, schließt Wengst zufolge „eine implizite Gegenüberstellung mit der Szene“ nicht aus, „in der dieser Jesus verleugnet. Dagegen harrt der ideale Schüler unter Jesu Kreuz aus und lässt sich von da einweisen in die geschwisterliche Gemeinde (vgl. 20,17).“
Nach Hartwig Thyen (T737) stehen nach den Vollstreckern der Kreuzigung Jesu in den Versen 25 bis 27 „nun der Gekreuzigte selbst und die Seinen im Zentrum.“ Auch er macht darauf aufmerksam, dass nach der Vers 24 abschließenden Bemerkung des Erzählers über das „Tun der Soldaten, mit dem sie, ohne es zu wissen, die Schrift erfüllt hatten, … die folgende Episode dann mit der bei ihm seltenen Adversativ-Partikel de {aber} eröffnet“ wird, womit er deutlich macht, „daß sie als Kontrast zur vorausgegangenen begriffen sein will.“ Inhaltlich geht Thyen zunächst auf die Darstellung dieser Szene in den synoptischen Prätexten ein. Dort
wird erzählt, daß die Frauen, die Jesus bereits von Galiläa an nachgefolgt waren (Mk 15,40; Mt 27,55; Lk 23,49), das Geschehen auf Golgotha nur von fern (apo makrothen theōrousai) beobachteten. Lukas fügt diesen bei ihm namenlosen Frauen noch ,alle Bekannten Jesu‘ hinzu. Namentlich nennt Markus unter diesen Frauen die Magdalenerin Maria, daneben eine weitere Maria, nämlich die Mutter der Brüder Jakobus des Kleinen und des Joses sowie endlich eine Salome. Die letztere fehlt bei Matthäus oder sie ist mit der von ihm ohne Namen genannten Mutter der Zebedaiden identisch.
Im Unterschied dazu lässt Johannes (T737f.) wegen „der Intimität der letzten Worte des Gekreuzigten an seine Mutter und an den Jünger, den er liebte, … die Frauen… unmittelbar unter das Kreuz treten.“ Noch auffälliger ist jedoch,
daß er unter den Frauen an erster Stelle die Mutter Jesu (hē mētēr autou) nennt, von deren Gegenwart seine synoptischen Prätexte nichts wissen. Wie bei ihrem ersten Auftreten bei der Hochzeit zu Kana, wo sie einfach als hē mētēr tou Iēsou bezeichnet wurde (s. o. zu 2,1ff), so wird ihr Name auch hier nicht genannt. Und wie damals in Kana redet Jesus sie auch hier mit der für einen Sohn doch ungewöhnlichen Anrede gynai an.
Darin sieht Thyen – ganz anders als Wengst – ein klares Indiz dafür (T738), „daß wir es mit einer fiktionalen und hochsymbolischen Szene zu tun haben. Es wird durch ein zweites Indiz bestätigt, nämlich „die gleichzeitige und doppelt überraschende Gegenwart des geliebten Jüngers unter dem Kreuz seines Herrn“:
Doppelt überraschend nennen wir diese Gegenwart deshalb zum einen, weil dieser Jünger, ohne daß er wie die Frauen erst eingeführt worden wäre, plötzlich einfach da ist neben Jesu Mutter. Das erinnert an seine explizite Einführung in das Evangelium in 13,21ff, wo von ihm als einem der Jünger Jesu gesagt wird, daß er beim letzten Mahl an der Brust seines Herrn gelegen habe. Und zum anderen überrascht seine Gegenwart in dieser Stunde, weil keiner der Prätexte von der Gegenwart eines der Zwölf in der Stunde der Kreuzigung weiß, sie sind im Gegenteil alle geflohen und haben ihren Herrn allein gelassen (vgl. 16,32f). Und als Teilnehmer am letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern muß er doch einer der Zwölf sein.
Eine andere Frage beurteilt Thyen wie Wengst, nämlich ob insgesamt „vier Frauen als das Gegenüber der vier Soldaten“ aufgezählt werden oder nur „drei Frauen …, die mit dem geliebten Jünger ja ebenfalls eine Vierergruppe bildeten“:
Entweder hat der Evangelist wie die Mutter Jesu auch deren Schwester namenlos gelassen, oder diese Schwester ist Maria, die Frau des Klopas. Jedenfalls aber war Maria, die Magdalenerin, wenn auch nur als Zuschauerin von fern, ja schon von Mk und Mt genannt. Johannes übernimmt ihre Gegenwart aus diesen Prätexten und führt damit zugleich seine erste Osterzeugin in sein Evangelium ein (s. u. zu 20,1ff). Da die Frauen als Augenzeuginnen des Sterbens Jesu hier nur zur Vervollständigung des Quartetts neben den Hauptpersonen der Episode stehen, nämlich neben der Mutter Jesu und dem geliebten Jünger, muß die Frage nach ihrer Zahl und Identität nicht entschieden werden.
Was hier über Jesu Mutter ausgesagt ist, sieht Thyen in engem Zusammenhang mit ihrem ersten Auftreten bei der Hochzeit zu Kana (T738f.):
Die erneute Gegenwart der auch hier anonymen Mutter Jesu läßt den Zuhörer zurückdenken an ihr erstes Auftreten bei der Hochzeit in Kana und an das von ihr herausgeforderte Weinwunder als den Ursprung der Zeichen Jesu. Denn von hier aus erscheint auch dieses in neuem Licht, in dem sichtbar wird, daß die Fülle des Weines von damals nicht nur Symbol der anbrechenden messianischen Zeit war, sondern zugleich das konkrete Zeichen des am Kreuz für das Leben der Welt vergossenen Blutes Jesu. Obgleich sich die Mutter Jesu in Kana – in einer wohl nicht nur zufälligen Umkehrung der Frage der Witwe von Sarepta an den Propheten Elia: ,Was habe ich denn mit dir zu schaffen, du Mann Gottes?‘ (1Kön 17,18) – von Jesus fragen lassen mußte: ,Frau, was habe ich denn mit dir zu schaffen?‘ und so ihres unendlichen Abstandes von diesem Sohn inne werden mußte, bleibt sie die treue und auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen wartende Zeugin des Sinaibundes, wenn sie in Abwandlung der Worte von Ex 19,8 den Dienern aufträgt: ,Alles, was er euch sagt, das tut!‘ (2,5…).
Daraus zieht Thyen völlig zu Recht den Schluss, dass man in der Mutter Jesu wie „in Johannes dem Täufer (1,19ff), in Abraham (8,56ff), in Mose (5,45ff) und in Jesaja (12,41) … eine Gerechte des alten Gottesvolkes Israel und dessen Repräsentantin sehen“ muss. Die Auslegung Bultmanns [529f], „wonach Jesu Mutter die Repräsentantin des noch an die Tora gebundenen Judenchristentums sein soll, während der geliebte Jünger den wahren Glauben des endlich vom Gesetz befreiten Heidenchristentums repräsentiere“, hält Thyen dagegen für
von Grund auf verfehlt. Das hatte schon Bultmanns Schülerin Eva Krafft <1369> gegen ihren Lehrer eingewandt. Denn so wie Bultmann denkt Johannes nicht über die Tora. Auch wenn die Gnadengabe der Wahrheit des Fleischgewordenen sie übertrifft, bleibt sie doch Gottes durch seinen Knecht Mose vermittelte gnädige und verbindliche Gabe (s. o. zu 1,17). Darum gibt es für einen Streit zwischen Judenchristen und Heidenchristen um die Verbindlichkeit von Gottes Gesetz im gesamten Evangelium keinerlei Indiz, ja nicht einmal eine vage Andeutung. Nicht innerchristliche Querelen, sondern die Auseinandersetzung mit der Synagoge um die Messianität Jesu ist sein bestimmender Zug. Und nach Jesu letztem Willen darf diese Auseinandersetzung nicht in einer Trennung enden, sondern sie muß dem Ziel dienen, „daß sie alle Eines seien“ (17,11), daß sie alle „eine Herde unter dem einen guten Hirten werden, der hier sein Leben hingibt für seine Schafe (10,11). Indem Jesus seiner Mutter seinen geliebten Jünger als neuen Sohn gibt, macht er sie zur Mittlerin zwischen der alten und der neuen Familie Gottes.
Unter Berufung auf Paul Minear <1370> sieht Thyen mit „dem geliebten Jünger … zugleich alle Christen, für die er spricht und für die er dieses Evangelium ‚geschrieben hat‘ (21,24)“, dazu „aufgefordert, Jesu ,Mutter‘, nämlich das messianische Volk Israel, wahrzunehmen und in ihrer eigenen Gemeinschaft willkommen zu heißen“:
„Sie müssen weiterhin die Versöhnung mit ihren Feinden in den Synagogen und Tempeln suchen. Sie müssen sich weigern, am endgültigen Erfolg dieser Mission zu verzweifeln. Von dieser Stunde an müssen sie diesem Wort als Befehl ihres Königs gehorchen: ,Seht! Dies ist eure Mutter!‘ Die Ausrufezeichen sind völlig gerechtfertigt. Der Gehorsam des geliebten Jüngers verpflichtet die Gemeinschaft zum gleichen Gehorsam… . In ihrem Akt der Gastfreundschaft wird die vergangene Geschichte des Gottesvolkes mit seiner zukünftigen Geschichte versöhnt. Dies ist kein leerer Traum. Das ist es, was in der Todesstunde Jesu geschah. Dies ist ein Hinweis auf die Kraft, die durch diesen Tod freigesetzt wurde. Der geliebte Jünger nahm die geliebte Mutter des Messias in die Gemeinschaft derer auf, die als Kinder Gottes wiedergeboren wurden. Das Wort des Gekreuzigten hebt den Antisemitismus unter seinen Jüngern durch ein pro-semitisches Gebot auf, ein unausweichliches ,Liebt eure Feinde!‘“
Diese symbolische Deutung der Mutter des Messias auf das Gottesvolk Israel ist in meinen Augen nachvollziehbar. Ob Johannes allerdings den geliebten Jünger bereits als Repräsentanten der „Christen, … für die er dieses Evangelium ‚geschrieben hat‘“, im Gegenüber zur „alten … Familie Gottes“ betrachtet, wage ich zu bezweifeln. Zwar steht er für Menschen, die auf den Messias Jesus vertrauen, aber auch bei diesen hat Johannes doch in erster Linie Juden im Blick und nicht Vertreter der Völkerwelt oder gar das Christentum als eine vom Judentum unterschiedene Religion.
Zu Recht wendet sich Thyen jedoch dagegen, den Jünger (T739f.),
der in 18,15 um des Verisimile der Erzählung willen als ein Bekannter des Hohenpriesters beschrieben wurde (ēn gnōstos tō archierei), nun zu einem Jerusalemer Hausbesitzer [zu] erklären, in dessen Haus Jesu Mutter fortan gelebt habe. So gewiß man diese symbolische Szene nicht zur Allegorie für ganz Anderes machen darf, und darum daran festhalten muß, daß Jesus seine Mutter nicht unversorgt in einer feindlichen Welt zurückläßt, sondern seinen geliebten Jünger mit der Verantwortung für sie betraut, so gewiß liegt ihr Akzent doch auf ihren symbolischen Obertönen, die Minear so feinsinnig herausgehört und expliziert hat.
Letztendlich erzählt Thyen zufolge (T739) Johannes „die ganze Episode wohl nur“ zu dem Zweck, den geliebten Jünger „und sein Evangelium zu autorisieren“, denn es ist ja allein er, der „dadurch, daß er Jesu Mutter zu sich nimmt, auf dessen Wort: ,Siehe, die ist deine Mutter!‘, reagiert und den in diesem Vermächtnis seines Herrn implizierten Auftrag sogleich wahrnimmt“.
Ton Veerkamp <1371> beschreibt zunächst die in den Versen 25 bis 27 anwesenden bzw. handelnden Personen, wobei er besonders hervorhebt, dass Jesus bei Johannes auf seinem Weg in den Tod anders als bei den Synoptikern nicht von allen männlichen Schülern verlassen ist:
Die Frauen, die Jesus gefolgt sind, wahren bei den Synoptikern große Distanz. Immerhin folgten sie ihm auf seinem Weg in den Tod. Die männlichen Schüler glänzen durch totale Abwesenheit. Bei Johannes gibt es diesen Unterschied nicht. Vier derer, die Jesus nahe stehen, sind im Augenblick des Todes da, drei Frauen und ein Mann. <1372> Von diesen vier Menschen spielen drei eine wichtige Rolle in der Erzählung. Über Maria von Klōpas wissen wir weiter nichts.
Maria aus Magdala dagegen ist eine bekannte Persönlichkeit der frühen messianischen Gemeinden gewesen. Sie wird die erste sein, die den Schülern und so der Menschheit die Botschaft des Noch-Nicht bringen soll, 20,17f.
Der Schüler, dem Jesus freundschaftlich verbunden war, ist der Schüler, der sich an die Brust Jesu lehnte, 13,25, der am offenen Grab sah und vertraute, 20,8, der den Herrn erkannte, 21,7, der bleibt, bis der Messias kommt, 21,22, und er könnte auch identisch mit dem „anderen Schüler“ gewesen sein, der im Gerichtshof des Hannas war, 18,16.
Nach Veerkamp repräsentiert die Mutter des Messias im Johannesevangelium, wie bereits bei der Hochzeit zu Kana deutlich wurde, ein messianisches Israel, das bereit ist, sich dem Messias Jesus anzuvertrauen und auf ihn zu hören:
Die Mutter des Messias vermittelt zwischen den Hochzeitsgästen (Israel) und Jesus. Dort ging es um den fehlenden Wein, um das, was die Hochzeit zur messianischen Hochzeit machen sollte. Die Mutter Jesu hat bei Johannes keinen eigenen Namen; wir hören bei ihm nie, dass sie Maria(m) heißt. Das muss eine Bedeutung haben, denn der Name des Vaters Jesu wird von Johannes angegeben (1,45; 6,42). Die Mutter des Messias hatte Jesus dazu gebracht, zum ersten Mal seine Ehre öffentlich zu zeigen, und zwar, indem sie den „Diensthabenden“ (diakonoi) sagt, sie sollen tun, was Jesus ihnen sagen wird. Sie ist also die Mahnende, die immer die messianische Gemeinde dazu anhalten soll, das zu tun – und nur das –, was Jesus sagt.
In der Szene am Kreuz Jesu steht nun diese Repräsentantin Israels als der messianischen Gemeinde nicht symbolisch einer wie auch immer zu verstehenden christlichen Gemeinde gegenüber, sondern dem geliebten Schüler als dem Repräsentanten aller Schülerinnen und Schüler Jesu:
Die Mutter des Messias soll den „geliebten“ Schüler Jesu als Sohn annehmen, dieser jene als Mutter. Auch der Name des geliebten Schülers wird nicht erwähnt. Beide Namenlosen, die Mutter des Messias und der geliebte Schüler, sind buchstäblich Prototypen. Die Mutter repräsentiert die messianische Gemeinde als solche, der geliebte Schüler den Schüler (und die Schülerin) als solche(n).
Die Mutter des Messias, die messianische Gemeinde, ist die Mahnende: „Was er euch sagen wird, das sollt ihr tun!“ Als Mahnende ist sie die autoritative Instanz dem Schüler gegenüber. Der Schüler muss sie, die Gemeinde, als Mutter, eben als jene autoritative Instanz, annehmen. Die beiden anderen Frauen dienen hier als Testamentzeugen: Es handelt sich also um die letzte Verfügung des Messias.
Angesichts des Problems, dass die Mehrheit der Kinder Israels Jesus als ihren Messias nicht annimmt, müssen nach Johannes diejenigen, die Jesus als Schülerinnen und Schüler nachfolgen, den Ort bilden, wo sich Israel um den Messias sammeln kann:
„Ab dieser Stunde nahm der Schüler sie zu eigen, eis ta idia.“ Das bedeutet wohl kaum so etwas wie „mit nach Hause“, und es bedeutet erst recht nicht die leibliche Versorgung der alten und schutzlosen Mutter. Das wäre frommer Kitsch. Der Verfasser des Prologs sagt: „In das ihm Eigene (ta idia) kommt es [das Wort], aber die Eigenen (hai idioi) nehmen es nicht an.“ Die Eigenen sind die Kinder Israels, die Judäer, aber sie haben das Wort nicht angenommen, 1,11. Diese Menschen sind das, was das eigentliche Milieu des Wortes ausmacht, eben das Eigene. Dieses Eigene ist ab jetzt der Ort, wo sich Israel um den Messias sammeln wird, die messianische Gemeinde. Sie, das neue messianische Israel: Mutter des Messias!
Bis zu diesem Punkt weicht zwar Veerkamps Auslegung bereits erheblich von derjenigen Wengsts und Thyens ab, aber in einem längeren Exkurs oder, wie er es nennt, seinem „Scholion 9“ unter dem Titel „Der Friede unter den messianischen Gemeinden“, <1373> fügt er weitere Gesichtspunkte hinzu, die in seinen Augen eine idyllisierende Sicht des Geschehens am Kreuz Jesu in Frage stellen. Der „Sinn dieser ‚letzten Verfügung‘ des Messias“ hat nämlich „etwas mit dem sehr schwierigen Verhältnis zwischen den einzelnen messianischen Gemeinden zu tun“. Er geht dabei zunächst von der Jerusalemer Gemeinde aus, die von leiblichen Brüdern Jesu geleitet wurde und „um die Mitte des ersten Jahrhunderts … sicher eine führende Rolle inne“ hatte, denn „Paulus musste sich von dort seine Legitimation für die Verkündigung des Messias unter den Völkern holen“, was aus Apostelgeschichte 15,12ff. hervorgeht. <1374>
Einen solchen Führungsanspruch und überhaupt „so etwas wie eine Ranking-competition zwischen den verschiedenen Gemeinden“ lehnen die „synoptischen Evangelien“ in den Jahrzehnten nach dem Judäischen Krieg „vehement ab: ‚Unter euch sei das nicht so‘, mahnen sie ihre Gemeinden (Lukas 22,24ff., Markus 10,42ff., Matthäus 20,25ff.)“. Dazu ruft Veerkamp
ein Fragment aus dem Markusevangelium in Erinnerung …, 3,31; wir hatten diese Stelle bei der Besprechung von Johannes 2,1ff. kurz erwähnt:
Es kam seine Mutter, auch seine Brüder.
Sie standen draußen, und sie sandten zu ihm, ließen ihn rufen.
Eine Menge saß um ihn herum.
Sie sagten zu ihm:
„Da, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwester stehen draußen und suchen dich.“
Er antwortete und sagte zu ihnen:
„Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder?“
Und er sah um sich die Menge, die rings um ihn saß, und sagte:
„Da, meine Mutter und meine Brüder.
Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter.“
Aber auch Johannes hielt nichts von den Brüdern Jesu, wie sich in Kapitel 7,1ff. zeigt:
Diese Aversion ist eindeutig eine Ablehnung der messianischen Gemeinde in Jerusalem, auf alle Fälle ihres Führungsanspruches, den Jakob, „der Bruder des Herrn“, erhob, vgl. Apostelgeschichte 15,13; Galater 2,12ff. Die Gemeinde des Johannes, in der die Mutter Jesu eine wichtige Rolle gespielt haben muss, muss daher den Vorrang vor der Gemeinde in Jerusalem gehabt haben, denn die Mutter Jesu war auch die Mutter Jakobs, des „Bruders des Herrn“.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Veerkamp hier wirklich meint, dass ein solcher Vorrang tatsächlich bestand. Vermutlich will er sagen, dass die Gruppierung um Johannes einen solchen Anspruch erhob und daher zwar die Kritik an den Brüdern Jesu, nicht aber an seiner Mutter teilte.
Die Situation der messianischen Bewegung insgesamt, aus der später die christliche Kirche hervorging, skizziert er folgendermaßen:
Manche reden von der messianischen Bewegung als von einer einheitlichen Befreiungsbewegung. Dass es einen Unterschied zwischen der „hellenistischen Gemeinde“ und dem sogenannten „Judenchristentum“, den Messianisten aus Israel, gab, war schon im 19. Jahrhundert aufgefallen. Dieses „Judenchristentum“ war aber ein völlig heterogenes Gebilde, und die Idyllen, die in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter dem Label Jesusbewegung gehandelt wurden, waren linker Kitsch; links wegen der angeblichen Verwandtschaft mit den Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts, aber dennoch Kitsch. Die „Jesusbewegung“ war eher ein Sammelsurium zerstrittener Gruppen und Grüppchen.
Die Hauptschüler Jesu, die Zwölf, kommen in allen Evangelien nicht besonders gut weg. Sie haben die messianische Bewegung in eine Sackgasse geführt, mit der Folge, dass sie nach 70 völlig orientierungslos war. Die Gemeinden, die aus der Tätigkeit des Paulus hervorgegangen sind, mögen in einer anderen Lage verkehrt haben, für die messianischen Gemeinden im syrisch-palästinischen Raum war die Lage trostlos. Die Gemeinden, die sich in irgendeiner Weise hervortaten, indem sie Familienmitglieder des Messias in ihren Reihen hatten, wurden durch die Worte Jesu, wie sie Markus überlieferte und Lukas und Matthäus übernahmen, in die Schranken gewiesen.
Lukas versuchte sie im zweiten Teil seiner Erzählung, der „Apostelgeschichte“, zusammenzuführen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten hielten sie, so will seine Erzählung, alle durch, „einmütig (homothymadon) im Gebet“, die Zwölf „mit den Frauen und Maria, Jesu Mutter, und seinen Brüdern“, Apostelgeschichte 1,14, alles Andeutungen der verschiedenen messianischen Gruppen. Offenbar war Lukas der Ansicht, dass das Sektierertum für den Messianismus politisch katastrophal war und dass alle diese sich streitenden Gemeinden sich in Erwartung der Inspiration des Messias gefälligst zusammenzuraufen hatten. Deswegen erfand er als Ergebnis dieses sich Zusammenraufens die Vorstellung einer einheitlichen (urchristlichen) „Urgemeinde“.
Eine solche Urgemeinde hat es nie gegeben. Es gab Kerne in Jerusalem und in Galiläa. Und die Gemeinden haben sich eher auseinander als aufeinander zu bewegt. Die Vorstellung, alle Völker müssen radikale toratreue Judäer werden, wie sie Matthäus vorschwebt, musste für Johannes, wohl auch für Markus und erst recht für Paulus völlig abwegig gewesen sein. Es gab viele Urgemeinden und die um Johannes war eine von ihnen. Ein Vorstadium eines einheitlichen Christentums ist allenfalls bei Lukas zu erkennen.
Von dieser Gesamtschau her wird verständlich, wie Veerkamp die Funktion des letzten Kapitels im Johannesevangelium einschätzt:
Johannes war von diesem Einheitsstreben noch weit entfernt. Erst spät muss die Gruppe um Johannes zur Einsicht gekommen sein, dass sie nur eine politische Chance hat, wenn sie sich der Führung des Petrus unterwirft, das heißt, sich den anderen Gemeinden aus dem syrisch-palästinischen Raum anschließt (Johannes 21).
Setzt man diese Zusammenhänge voraus, muss man Johannes 19,25-27 anders interpretieren, als dies gewöhnlich geschieht:
Im Lichte dieses Hintergrundes ist die Szene am Kreuz wenig erbaulich. Wir müssen hier unsere Gefühle ausschalten. Es geht nicht um die Pietät des Sohnes, der die vereinsamte Mutter einem geliebten Schüler anvertraut. Wo sie im Evangelium auftritt, macht sie nicht den Eindruck, auf solche Fürsorglichkeit angewiesen zu sein. In der Konkurrenz der messianischen Gemeinden untereinander galt: Wer die Mutter des Messias „hat“, hat im Ranking der messianischen Gemeinden einen Vorsprung. Dem, der den „Wert“ der Mutter des Messias herabsetzt, wie Markus in 3,31ff., sei mit dieser Szene gesagt, dass die Mitgliedschaft der Mutter Jesu in der Gemeinde des „geliebten Schülers“ vom Messias selbst und in einem dramatischen Augenblick angeordnet wurde. Da die Mutter Jesu auch die Mutter der „Brüder des Herrn“ war, habe die messianische Gemeinde des Schülers, mit dem Jesus befreundet war, einen Anspruch auf besonderen Respekt. <1375>
So gesehen mag zwar Wengst zu Recht annehmen, dass Johannes hier die von Jesus geforderte solidarische Liebe beispielhaft verwirklicht sieht und Thyen sogar die Feindesliebe gegenüber einer jüdischen Mehrheit, die den Messias Jesus ablehnt und seine Gemeinde verfolgt, aber nach Veerkamp verfolgt Johannes zugleich die Absicht, die Position der eigenen Gruppierung innerhalb der messianischen Bewegung zu stärken:
Was Johannes sagt, bleibt Menschenwort und ist als solches nicht frei von eigenen Interessen. Gleichzeitig aber lehrt Johannes uns auch, dass die messianische Gemeinde und in ihrer Nachfolge die allgemeine (katholische, nicht römisch-katholische) Kirche und die Gemeinden, in denen diese Kirche existiert, nur das zu tun haben, was der Messias sagt, und nichts anderes. Indem der Schüler die Mutter des Messias zu eigen nimmt, nimmt er die Stimme der Frau auf, die sagt: „Was er euch sagt, das sollt ihr tun.“ Diese Art von Mariologie – nicht das ganze Brimborium, das die römisch-katholische Kirche daraus gemacht hat – gehört zum Wesen der messianischen, katholischen Kirche weltweit. Insofern wird aus dem gruppenegoistischen, interessengeleiteten Testament des Messias messianisch inspiriertes Wort Gottes. Johannes ist dann mehr als Johannes! Aber das gilt für die ganze Heilige Schrift.
Auf diese Weise legt der ursprünglich römisch-katholische Theologe und Priester Ton Veerkamp ein beeindruckendes Zeugnis für eine Lehre von der Mutter des Messias ab, die wahrhaft der Bibel entspricht. Zugleich lässt er erkennen, in welcher Weise eine weltweit, also „katholisch“ {allumfassend}, wirkende Kirche vom Heiligen Geist geleitet (also vom Gott Israels und seinem Messias her „inspiriert“) sein müsste, um im Hören auf den Messias Jesus den Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit tätig erwarten zu können.
↑ Johannes 19,28-30: Der dürstende Jesus am Kreuz erreicht sein Ziel, indem er die Schrift erfüllt und das pneuma {Geist, Inspiration} übergibt
19,28 Danach, als Jesus wusste,
dass schon alles vollbracht war,
spricht er, damit die Schrift erfüllt würde:
Mich dürstet.
19,29 Da stand ein Gefäß voll Essig.
Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig
und legten ihn um einen Ysop
und hielten ihm den an den Mund.
19,30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht.
Und neigte das Haupt und verschied.
[27. Januar 2023] Die nun folgende Szene (W531), von Klaus Wengst mit „Der Tod Jesu“ überschrieben, knüpft in Vers 28
mit „danach“ an die vorangehende an und verbindet so das nun erwähnte Wissen Jesu mit dem dort Beschriebenen: Jetzt, da das in 13,34f. gegebene Vermächtnis sich vom Kreuz her in der gegenseitigen Zuweisung von Mutter und Schüler zu realisieren beginnt, weiß Jesus, „dass schon alles vollbracht ist“. Dass er die Seinen nach 13,1 „vollends bis zuletzt liebte“, wirkt sich nun aus.
Dabei entsprechen (Anm. 376) im „griechischen Text“ die Worte eis télos {wörtlich: bis zum Ende, Ziel}, die Wengst in 13,1 mit „vollends bis zuletzt“ übersetzt hat, sogar buchstäblich dem Wort tetélestai {vollenden, ein Ziel erreichen} in 19,28.
Zum hier erneut betont herausgestellten Wissen Jesu schreibt Wengst (W531f.):
Bisher bezog sich sein Wissen immer auf das, was auf ihn zukommen und was er tun würde, sodass er als Souverän des Geschehens, und gerade auch des eigenen Geschicks, dargestellt wurde. Jetzt bezieht es sich auf das schon vollendete Geschehen, das in seinem Sterben zum Ende und zum Ziel kommt. … In 4,34 hat er es als seine „Speise“ bezeichnet, „dass ich den Willen dessen tue, der mich geschickt hat, und sein Werk zu Ende führe“. Er führt es zu Ende, er vollendet es mit seinem Sterben am Kreuz. In 5,36 hat er von „den Taten“ gesprochen, „die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie zu Ende führe“. Damit hat er deutlich gemacht: In seinem Handeln und dann auch in seinem Erleiden und Sterben vollzieht sich der Wille Gottes. In 17,4 hat er proleptisch von der Vollendung des Werkes gesprochen. Nun weiß er, dass es „vollbracht“ ist.
Dieses Vollbrachtsein von Jesu Werk wird hier aber nicht (Anm. 377) mit dem an diesen drei Stellen 4,34; 5,36 und 17,4 verwendeten Verb „teleióo (‚vollenden‘, ‚vollziehen‘)“ ausgedrückt, sondern mit dem verwandten Verb „teléo – hier mit ‚vollbringen‘ übersetzt“. Interessant ist (W532), dass auch das erstere Verb im selben Vers ausdrücklich aufgenommen wird, indem
Jesus noch einmal spricht, „sodass die Schrift vollzogen würde“. Es ist dies die einzige Stelle, an der Johannes statt vom „Ausführen“ der Schrift vom „Vollziehen“ spricht. Indem er so das in 4,34; 5,36 und 17,4 gebrauchte Verb aufnimmt, zeigt er an: In dem gleich erwähnten Vollzug der Schrift bringt Jesus nun, da er am Kreuz stirbt, sein Wirken zu Ende, kommt der in seiner Sendung sich auswirkende Wille Gottes zum Ziel.
Gegen Weidemann <1376> hebt Wengst hervor (Anm. 379), dass es hier
[s]elbstverständlich … um den in der Schrift bezeugten und also in Israel bekannten Gott [geht] – bekannt aufgrund seiner Geschichte, die er mit Israel hatte und hat. Weidemann sieht dagegen in der Weise „die Schrift Israels ,vollendet‘“, dass „sie nicht von der Geschichte Israels, sondern ausschließlich vom irdischen Jesus Christus zeugt“. Hier wird Johannes ein Schriftverständnis unterstellt, wie es sich später im Barnabasbrief findet, dessen Verfasser sich dafür in starkem Maß gedanklich verrenken muss. Das tut Johannes nicht.
Damit spricht sich Wengst für ein Schriftverständnis aus, im Zuge dessen alles, was vom Messias Jesus ausgesagt wird, von den jüdischen heiligen Schriften her zu begreifen ist, statt umgekehrt, wie es seit Barnabas üblich wurde, das Alte Testament allein auf einen nunmehr völlig unjüdisch verstandenen Jesus Christus hin auszulegen.
Wie setzt Wengst nun selbst (W532) dieses Schriftverständnis praktisch in die Tat um?
Auch jetzt, wo er zum letzten Mal agiert, erscheint Jesus, obwohl ohnmächtig am Kreuz hängend, als Souverän. Er gibt gleichsam das Stichwort, damit die anderen am Geschehen Beteiligten ihren Part übernehmen: „Ich habe Durst.“ Wie das Folgende zeigt, wonach Jesus mit Säuerling getränkt wird, denkt Johannes an Ps 69,22. Dort sagt der leidende Gerechte: „Sie gaben Gift in meine Speise, für meinen Durst tränkten sie mich mit Säuerling.“
Zur üblichen Übersetzung (Anm. 380) des hebräischen Wortes „chómetz, in Septuaginta Ps 68,22 durch óxos wiedergegeben, mit ‚Essig‘“ betont Wengst, dass sie „bei uns falsche Vorstellungen“ hervorruft, „da der antike ‚Essig‘ längst nicht die Säurekonzentration hatte wie der heutige. Nach Num 6,3 war er trinkbar. Gegenüber dem Wein galt er aber als minderwertiges Getränk.“
Während die Synoptiker (W532) „die zweite Hälfte“ von Psalm 69,22 lediglich „in Erzählung“ umsetzen (Matthäus 27,48; Markus 15,36; Lukas 23,36), macht Johannes ausdrücklich den „Schriftbezug kenntlich“. Damit kommt nach Wengst wie
schon beim Verteilen der Kleider … Gott ins Spiel. Die Darstellung bei Johannes, dass Jesus in der Schrift Gesagtes sozusagen inszeniert, nimmt der Tatsächlichkeit seines Leidens nichts weg, sondern bringt zum Ausdruck, dass gerade in diesem Geschehen doch Gott sein Werk ausführt und zu Ende bringt.
Dazu (Anm. 382) stellt Culpepper <1377> eine Verbindung mit Johannes 18,11 her,
wo Jesus rhetorisch fragt, ob er den Kelch nicht trinken solle, den der Vater ihm zu trinken gibt: „Er ist bereit, den letzten Schluck von dem Kelch zu trinken, der ihm gegeben ist. Nur im Johannesevangelium trinkt Jesus tatsächlich den sauren Wein und indem er das tut, trinkt er symbolisch den Kelch des Leidens, als er stirbt“.
In Vers 29 ist nun (W532), nachdem „Jesus seinen Durst ausgesprochen hat“, genau von dem Getränk die Rede, auf das eben mit dem Schriftbezug auf Psalm 69,22 angespielt wurde: „Es stand da ein Gefäß voll Säuerling.“ An dieser Stelle ergänzt Wengst seine bisherigen Erläuterungen zu diesem Stichwort durch ein Zitat aus dem „Wörterbuch von Bauer“. <1378> Dieses nennt (W532f.)
für das hier gebrauchte Wort óxos … die Bedeutungen „d(er) saure Wein, d(er) Weinessig“ und merkt dazu an: „Er war zum nachhaltigen Stillen starken Durstes geeigneter als Wasser und, weil billiger als der eigentl(iche) Wein, bei einfachen Leuten sowie solchen v(on) bescheideneren Lebensgewohnheiten beliebt […], bes(onders) auch Soldatengetränk.“ Die Situation ist also so vorgestellt, dass die Soldaten dieses Getränk bei sich hatten.
Seltsam ist die Art und Weise, in der Johannes nun von der Darstellung der Synoptiker abweicht (W533):
Johannes fährt fort: „Nachdem sie nun einen Schwamm voll Säuerling auf Ysop gesteckt hatten, reichten sie ihn an seinen Mund.“ Bei Matthäus und Markus wird der Schwamm auf einen Rohrstab gesteckt. Johannes erwähnt stattdessen Ysop. Bei dieser Pflanze handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den wilden Majoran (Oregano), der als Stab nicht gerade geeignet ist. Wenn Johannes ihn dennoch erwähnt, verbindet er mit ihm eine besondere Aussageabsicht. Da er sie nicht ausspricht, kann nur gefragt werden, an was mit der biblisch-jüdischen Tradition Vertraute denken konnten.
Wengst denkt dabei insbesondere an den Traktat ShemR 17,2, <1379> in dem „die biblischen Vorkommen von Ysop miteinander verbunden und einer bestimmten Deutung zugeführt“ werden:
„Und so gibt es Dinge, die als niedrig erscheinen, und doch hat der Heilige, gesegnet er, geboten, mit ihnen viele Gebote zu verrichten. Der Ysop erscheint dem Menschen als überhaupt nichts; und doch ist seine Kraft groß vor Gott. Denn er hat ihn an vielen Stellen mit der Zeder verglichen: bei der Reinigung des Aussätzigen (Lev 14,4.6) sowie beim Verbrennen der roten Kuh (Num 19,6) und in Ägypten gebot er, ein Gebot mit Ysop zu verrichten. Denn es ist gesagt (Ex 12,22): Und nehmt ein Büschel Ysop. Und so sagt sie (die Schrift) von Salomo (1. Kön 5,13): Und er redete über die Bäume – von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der an der Wand wächst, um dich zu lehren, dass das Große und das Kleine gleich sind vor dem Heiligen, gesegnet er, und er mit kleinen Dingen Wunder tut. Sogar durch den Ysop, der niedrig ist unter den Bäumen, hat er Israel erlöst.“ Der Niedrigkeit des Ysop entspricht die Niedrigkeit Jesu in der erzählten Situation – und doch hat Gott ihn zum „Retter der Welt“ (4,42) gemacht, zum „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“ (1,29).
Zu Vers 30 hebt Wengst zunächst die Bedeutung des hier nochmals verwendeten Wortes teleō hervor, das er mit „vollbringen“ übersetzt:
Was als Wissen Jesu festgestellt war, spricht er als letztes Wort vor seinem Tod aus: „Als dann Jesus den Säuerling genommen hatte, sagte er: ,Es ist vollbracht.‘“ In 13,1 hieß es vorgreifend, dass Jesus die Seinen bis zum télos, bis zum Ende und ganz und gar, geliebt hat. Dieses Ziel ist nun erreicht. Wie es sich auswirkt, hat die vorige Szene schon gezeigt. „Es ist vollbracht“, sagt Jesus, der sterbend am Kreuz hängt.
Die den Vers beschließenden Worte kai klinas tēn kephalēn paredokēn to pneuma gibt Wengst folgendermaßen wieder:
„Und er neigte das Haupt und übergab seinen Lebensgeist.“ Nach Matthäus und Markus stirbt Jesus mit einem lauten Schrei (Mt 27,50; Mk 15,37). Bei Johannes schreit Jesus nicht; in beiden Verben ist er wiederum handelndes Subjekt. Die Wendung vom Neigen des Hauptes weckt die Assoziation ans Einschlafen.
Dazu verweist Wengst (Anm. 383) auf Matthäus 8,20 und Lukas 9,58, „wo diese Wendung die Bedeutung hat, sich zum Schlafen niederzulegen.“
Auf Psalm 31,6 und Jesaja 53,12 verweist Wengst als Hintergrund zur „abschließenden Formulierung vom Übergeben ‚des Lebensgeistes‘“ (W533f.):
Der Psalmvers lautet: „In Deine Hand übergebe ich meinen Lebensgeist (rúach): Du hast mich erlöst, Ewiger, du treuer Gott.“ Das mit „übergeben“ übersetzte Wort hat auch die Bedeutungen „deponieren“, „anvertrauen“. In Jes 53,12 heißt es vom Gottesknecht: „Er hat seinen Lebensatem (néfesch) dem Tod hingegeben.“
Dazu vermerkt Wengst (Anm. 385), dass die „Septuaginta … hier im Passiv“ übersetzt und „néfesch, wie meistens, mit psychē“ wiedergibt. In seinen Augen zeigen beide Stellen, „dass sowohl rúach und néfesch als auch pneúma und psyché als ‚Lebensatem‘/‚Lebensgeist‘ verstanden werden können.“
Damit nimmt Johannes (W534) „in der Beschreibung des Todes Jesu sachlich auf, was er ihn in 10,17f. hat sagen lassen, dass er nämlich von sich aus sein Leben einsetzt.“ Zwar ist (Anm. 386) „dort von der ‚Seele‘ (psyché), verstanden als ‚Lebensatem‘“, die Rede, „hier aber vom ‚Lebensgeist‘ (pneúma)“, das ist aber nach Wengst „durch die Anspielung an Ps 31,6 bedingt und macht sachlich keinen Unterschied.“
Keiner Erwägung wert hält es Wengst, in welchen Bedeutungszusammenhängen die Worte pneuma und paradidomi im Johannesevangelium an anderen Stellen verwendet werden – das Wort pneuma im Zusammenhang mit dem Geist der Wahrheit bzw. Treue des Gottes Israels als des Parakleten, den die Schüler Jesu in 20,22 empfangen werden, und das Wort paradidomi als Bezeichnung der Übergabe oder Auslieferung Jesu an die römischen Behörden zur Kreuzigung.
Hartwig Thyen (T740) wirft zu Vers 28 eine umstrittene Frage auf, auf die Wengst nicht eingegangen ist: Ist „der hina-{damit-}Satz“, der angibt, worauf sich die Erfüllung der Schrift richtet, „dem ihm folgenden legei {spricht er} oder aber dem ihm vorausgehenden tetelestai {vollbracht war} zuzuordnen“?
Für die erstere Option hatte schon Zahn <1380> plädiert und unseren Vers dann so paraphrasiert: „Nach diesen Dingen wußte Jesus, daß …; und damit die Schrift erfüllt werde sprach er“. Er muß dazu dem ausdrücklichen panta {alles} freilich widersprechen. Schwerlich zu Recht folgen dieser Interpretation bis heute zahlreiche Kommentatoren und identifizieren die graphē {Schrift}, die erfüllt werden mußte, dann mit dem singulären Psalmvers: kai edōkan eis to brōma mou cholēn kai eis tēn dipsan mou epotisan me oxos {Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst} (Ps 69,22 = LXX 68,22).
Dieser Interpretation ist auch Wengst ganz selbstverständlich gefolgt, ohne die von Thyen genannte Alternative in Erwägung zu ziehen. Gleichwohl hat dieser das Vollzogensein des folgenden Schriftzitats durch die Verwendung des Wortes teleioō dennoch ganz eng mit dem zuvor durch das Wort teleō ausgedrückten Vollbrachtsein aller Werke Jesu verbunden gesehen. Thyen dagegen bezieht mit Bergmeier <1381> „den hina-{damit-}Satz auf den ihm vorausgehenden hoti-{dass-}Satz, den er präzisierend erläutert“, und gibt Vers 28 dementsprechend folgendermaßen wieder:
,In der Gewißheit, daß bereits alles realisiert war und die Schrift dadurch ihre Erfüllung gefunden hatte, sagte Jesus nach diesen Worten (an seine Mutter und an seinen geliebten Jünger): Mich dürstet!‘
Zur Begründung verweist Thyen darauf, dass das Wort teleioō {vollenden} bei Johannes (T740f.)
vorwiegend auf das ergon {Werk} des Vaters bezogen [ist], das Jesus nach dessen Willen ausführen muß (4,34), bzw. auf die erga, die zu vollbringen der Vater ihm aufgetragen hat (5,36; 17,4). Auf das Offenbarungswerk Jesu und seine Sendung vom Vater bezieht sich auch das Vorkommen des Lexems in der Form des Part. Pass. Perf. teteleiōmenoi in 17,23. Und endlich gilt auch für das teleiōthē {endgültig erfüllt} unseres Verses, daß dadurch das, was durch das Tun und Sagen des Sohnes vollbracht ist (tetelestai), seinen Grund in der Schrift und in dem hat, was Mose über ihn geschrieben hat (5,46f). Dagegen kommt das Lexem teleō {vollbringen} im gesamten Evangelium nur in der Passivform tetelestai {es ist vollbracht} und einzig hier und gleich danach im gleichen Sinne noch einmal in V. 30 vor. – Wenn es gilt, von der Erfüllung eines konkreten Einzeltextes der Schrift oder eines bestimmten Wortes Jesu zu reden, gebraucht Johannes nahezu technisch das Verbum plēroō {erfüllen}, zumeist in der Wendung hina plērōthē ktl. {damit erfüllt werde usw.}; vgl. 12,38; 13,18; 15,25; 17,12; 18,9.32; 19,24.36. Niemals verwendet er dagegen das Lexem teleioō, wenn von dem Erfülltsein eines Einzeltextes der Schrift die Rede sein soll. Dieser Sprachgebrauch läßt es darum wenig plausibel erscheinen, daß die finale Bestimmung hina teleiōthē hē graphē {damit die Schrift endgültig erfüllt werde} sich auf Jesu isoliertes Wort dipsō {mich dürstet} bezieht und auf Ps 69,22 verweisen will. Denn dazu wäre die die Formulierung: hina plērōthē hē graphē {damit die Schrift erfüllt werde} mit einer entsprechenden Näherbestimmung zu erwarten.
Nicht einleuchten will mir allerdings (T741), dass Thyen zwar eine „fraglose Intertextualität mit Ps 69,22, die wohl schon die synoptischen Prätexte bestimmt“, für den Vers 29 voraussetzt, dass diese aber „bei Johannes nicht schon durch Jesu bloßes Wort ,mich dürstet‘ ins Spiel kommt, sondern erst durch die gesamte Szene 19,28f, in der Jesus durch sein dipsō das Handeln der Soldaten auslöst“, was Thyen zufolge Brawley <1382> „sehr klar erwiesen“ hat. Kann es nicht doch sein, dass Johannes mit seiner Vorliebe für Worte mit annähernd gleicher Bedeutung genau in diesem Augenblick der Vollendung des Werkes Jesu zur Bestätigung dieser Vollendung auch ein Schriftzitat mit einer darauf bezogenen einmalig abweichenden Formulierung einleitet?
Interessant ist nach Thyen schließlich die Beobachtung von Bergmeier,
daß die Sätze 6,15 und 13,1 syntaktisch in nahezu völliger Analogie zu unserem V. 28 gebaut sind. Wie 19,28 die Sterbeszene Jesu eröffnet, so dient 13,1 der Eröffnung der gesamten Passionserzählung bis hin zu diesem Ende (eis telos ēgapēsen autous {bis zur Vollendung liebte er sie}). Beide Verse beginnen mit einer Zeitbestimmung, nämlich hier mit dem meta touto {danach}, das auf das Vermächtnis Jesu an seine Mutter und den geliebten Jünger zurückweist, und dort – dem Gang und Stand der Erzählung entsprechend – mit den vorausweisenden Worten: pro de tēs heortēs tou pascha {vor dem Passafest}. Hier wie dort schließt sich daran die Wendung eidōs ho Iēsous {wusste Jesus} an. Und in beiden Fällen folgt darauf ein hoti-{dass-}Satz, der sogleich durch einen hina-{damit-}Satz näherbestimmt wird: hoti ēlthen autou hē hōra, hina metabē ek tou kosmou toutou pros ton patera, agapēsas tous idious tous en tō kosmō eis telos ēgapēsen autous {dass seine Stunde nun gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen; und wie er die Seinen, die in der Welt sind, geliebt hatte, so erwies er ihnen nun seine Liebe bis zur Vollendung}. Nicht nur formal, sondern zumal auch inhaltlich bilden so der Satz, mit dem in 13,1 die Passionserzählung eingeleitet wird, und unser Vers 19,28 eine Inklusion, die sie umschließt…
Holtzmann <1383> hatte bereits darauf hingewiesen, dass der Vers 29 einleitende Satz: skeuos ekeito oxous meston, „Da stand … ein mit oxos gefülltes Gefäß“, mit demselben Verb wie in Johannes 2,6 formuliert ist, in dem es um die Wasserkrüge bei der Hochzeit zu Kana ging. Den oxos erklärt Thyen wie Wengst unter Berufung auf Bauer als das Getränk, über das die Soldaten verfügten, „die, wie die folgende Episode 19,31ff zeigt, zur Bewachung der Gekreuzigten am Ort bleiben mußten“. Diese sind es nun, die, „[n]achdem sie einen Schwamm damit getränkt und auf einem Ysopzweig befestigt hatten, … ihm den zum Munde“ reichten:
Anstelle der Bitte Jesu um einen Trank (dipsō) bieten die Prätexte Mk 15,36 und Mt 27,48 f Jesu Ps 22,2 folgenden Gebetsruf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ Auf diesen Ruf hin, auf den die Soldaten mit der Bemerkung reagieren: ,Der ruft Elia zu Hilfe!‘, stecken sie einen Schwamm auf ein Rohr (kalamos) und setzen bei Lukas mit der Gabe dieses Trankes nur ihre Verspottung Jesu fort (vgl. Lk 23,36). Johannes, bei dem Jesus seinen Jüngern beim Abschied ausdrücklich versichert hatte: ,Wenn ihr mich auch alle verlassen werdet, so bin ich dennoch nicht allein, denn der Vater ist ja bei mir‘ (16,32), hat Jesu Gebet von seiner Gottverlassenheit darum durch seinen Ausruf: ,Mich dürstet!‘ ersetzt. … Außerdem ist bei Johannes an die Stelle des ,Rohres‘ der Ysopzweig getreten.
Da nach Meinung vieler Exegeten ein solcher Zweig als ungeeignet erschien,
einem Gekreuzigten damit einen Trank zu reichen, hat wohl zuerst Camerarius (um 1550) trotz der nahezu einhelligen Überlieferung der Lesart hyssōpō vorgeschlagen sie zu hyssō (lat. pilum, der etwa zwei Meter lange mit eiserner Spitze versehene Wurfspieß der römischen Legionäre) zu konjizieren {als vermutlich ursprüngliche Lesart zu ersetzen}. … Aufgrund der breiten und frühen handschriftlichen Überlieferung sowie der gewiß nicht zufälligen symbolischen Obertöne, die der Gebrauch von Ysop hier assoziieren läßt, folgen wir dieser Verlockung jedoch nicht, zumal das pilum erst mit den regulären römischen Legionen im jüdischen Krieg nach Palästina gekommen sein dürfte, und bleiben beim Ysop. Haenchen <1384> weist im übrigen darauf hin, daß „der Gekreuzigte nicht, wie es viele Bilder darstellen, hoch über der Menge (hing), sondern (daß) seine Füße dicht über der Erde“ waren.
Außerdem zitiert Thyen zustimmend die bereits von Wengst angeführte Talmudstelle Shemot Rabba 17,2 (siehe oben) und schließt daran weitere Überlegungen zur symbolischen Deutung des Ysop an:
Da Jesus bei Johannes in ebender Stunde stirbt, in der im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden, halten wir die durch den Gebrauch des Ysop bewirkte Assoziation an das Passalamm keineswegs wie Bultmann für „kaum glaublich“ und auch nicht wie Schnackenburg <1385> für „weit hergeholt und dem Vorgang nicht entsprechend“, zumal die Identifikation Jesu mit dem Passalamm durch des Zitat von Ex 12,10 in V. 37 gleich darauf ja ausdrücklich vollzogen wird.
Ausführlich geht Thyen auf eine besondere Form der Ironie ein, die darin enthalten ist, dass Jesus nach Vers 30 das ihm angebotene Getränk tatsächlich zu sich nimmt:
Für Jesu Ausruf dipsō {Mich dürstet}, den nach Becker <1386> schon der von ihm postulierte ,vorjohanneische Passionsbericht‘ enthalten haben soll, schlägt er die folgende Interpretation vor: Mit diesem dipsō habe Jesus „nicht eigentlich um einen Trank gebeten, weil er Durst hatte, sondern damit seine Passion für den gläubigen Betrachter einer Deutung zugeführt werden könne, die es erlaubt, darin göttliches Planen am Werk zu sehen“. Daran ist zwar richtig, daß Jesu Bitte um einen Trank die Soldaten in die entsprechende Aktivität versetzt und sie ironischerweise zu unwissenden Vollstreckern der Schrift als der Zeugin von Gottes Heilsplan macht. Aber daß der zunächst gegeißelte und danach gekreuzigte Jesus nicht wirklichen physischen Durst gehabt, sondern ihn nur simuliert haben soll, erscheint uns denn doch als eine doketistische {von eben der folgenden Annahme geleitete} Leugnung der Grundaussage unseres Evangeliums, daß in Jesus Christus das ewige Wort tatsächlich Fleisch geworden ist, Fleisch, das es nun einmal an sich hat, Hunger und Durst zu haben und unter Mangel zu leiden.
Thyen betrachtet nun weiter „die johanneische Ironie“ im Licht der grundsätzlichen Aussage von Amante, <1387> die „von allem ironischen Sprechen gilt:
„Ironie ist eine Sache der Wahrnehmung, und sie muss, um in Erscheinung zu treten, von einem Beobachter gesehen werden, sonst existiert sie nicht.“
Diese Ironie erfährt
mit dieser letzten Bitte Jesu einen paradoxen Zusammenbruch … Denn bisher war es ja stets so, daß die erzählten Personen – wie Nikodemus, die Samaritanerin am Jakobsbrunnen, die wunderbar gesättigte Menge am See von Tiberias oder die unverständigen Jünger – in den Augen des vermeintlich mehr wissenden Lesers Opfer der Ironie geworden waren.
Dazu verweist Thyen auf den „plötzlichen Übergang von der wörtlichen zur figürlichen Rede über das Wasser“ in Johannes 4,7ff., (T744) auf Nikodemus als ein „Opfer der Ironie …, als er Jesus gefragt hatte, ob einer denn etwa in den Leib seiner Mutter zurückkehren könne, wenn er doch von neuem (oder: von oben) geboren werden müsse (3,4)“, und auf
die Masse der am See von Tiberias wunderbar Gesättigten …, die statt das ,Zeichen‘ wahrzunehmen, das Jesus getan hat, sich nur satt gegessen haben und Jesus daraufhin zum König machen wollte (6,14f). Ebenso vermögen auch die Jünger Jesu wörtliche Rede (en paroimiais {in Bildrede}) nicht von dem zu unterscheiden, was er en parrhēsia {offen} sagt (16,25.29).
Dass das „natürliche Wasser“, indem Jesus „der samaritanischen Frau“ ein anderes Wasser „als unversiegbaren Quell verheißt, … zugleich Symbol des österlichen und in alle Wahrheit leitenden heiligen Geistes“ ist,
erfährt im übrigen auch der Leser erst bei Jesu Auftreten auf dem Laubhüttenfest, wo er erneut die Durstigen zu sich ruft und der Erzähler dem Leser erklärt: „Das sagte er aber über den Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben würden. Denn noch gab es den Geist ja nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war“ (7,37ff).
Aus diesem Grund müssen nun „in der Szene der Kreuzigung als der Verherrlichung Jesu die Themen von Durst und Trinken in einem denkwürdigen Echo ihres ersten Vorkommens in Joh 4 aufs neue“ erscheinen, und zwar in einer für die Leserschaft unerwarteten paradoxen Wendung:
Waren, zumal seit 4,10ff, alle Erwartungen des Lesers/Zuhörers stets vom Irdischen weg und auf das Himmlische gerichtet worden, so erscheint Jesus, die Quelle des Geistes als des himmlischen ,Wassers‘, nun unvermittelt den Bedingungen ganz irdischen Dürstens unterworfen. Und erst nachdem sein Durst gestillt ist, erreicht die Szene mit seinem Ausruf tetelestai {Es ist vollbracht} ihre Klimax {Höhepunkt}.
Was hier geschieht, erläutert Thyen unter Berufung auf Moore <1388> folgendermaßen:
„Die Ironie, die auf der sauberen Trennung von Fleisch und Herrlichkeit, irdisch und himmlisch, materiell und geistig, buchstäblich und bildlich, Wasser und ,Wasser‘ beruhte, ist nun im Paradox zusammengebrochen.“ Und anstelle der erzählten Personen versetzt dieser Kollaps jetzt den vermeintlich überlegenen Leser in ein ironisches Dilemma und wirft die Frage auf: „Aber wer nimmt das ironische Dilemma des Lesers in der Todesszene wahr?“ Das kann ja nur ein zweiter Leser sein, der seine eigene Lektüre erneut liest und dabei endlich begreift, daß er mit seiner Trennung des Irdischen vom Himmlischen auf dem Holzwege war, daß vielmehr, dem Chalcedonense {dem Glaubensbekenntnis des Konzils von Chalcedon} folgend, in Christus jenseits aller Ontologie Fleisch und Geist asynchytōs und atreptōs, sowie adiairetōs und achōristōs {unvermischt und unveränderlich, ungetrennt und unteilbar} wahrgenommen sein wollen.
Am Ende von Vers 30 folgen Thyen zufolge „Jesu letztem Wort tetelestai {Es ist vollbracht} … nur noch zwei stumme Gesten: kai klinas tēn kephalēn paredōken to pneuma {er neigte des Haupt und gab den Geist hin}.“ Die erstere, das „Neigen des Hauptes“, interpretiert er vor dem Hintergrund synoptischer Worte vom Menschensohn:
Das im gesamten Neuen Testament nur siebenmal vorkommende Verbum klinō findet sich bei Johannes nur hier. Wie in dem synoptischen Wort vom Menschensohn, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen könnte: pou tēn kephalēn klinē (Mt 8,20 / Lk 9,58), ist auch hier das Neigen des Hauptes nicht Ausdruck der Schwäche eines Sterbenden, sondern – zumal es der aktiven Hingabe des Geistes vorausgeht – willentliches Tun Jesu, der bis zuletzt die Initiative behält … Kanonisch {im Zusammenhang biblischer Schriften} gelesen heißt das: Erst am Kreuz hat der daran erhöhte Menschensohn den Ort gefunden, wo er sein Haupt niederlegen kann.
Zur letzten Handlung Jesu, der Hingabe seines Geistes, nach dem Johannesevangelium hebt Thyen den in seinen Augen sicher nicht zufälligen „Unterschied zu den Prätexten“ hervor, „wo Jesus mit einem gewaltigen Schrei den Geist aufgibt (phōnē megalē aphēken to pneuma: Mt 27,59; bzw. exepneusen: Mk 15,37)“, während Johannes die Formulierung wählt: „paredōken to pneuma (er gab den Geist hin)“:
Als Ausdruck zur Beschreibung des Sterbens eines Menschen ist sie in der gesamten griechischen Literatur ohne Parallele. Mag man sie im Blick auf den Kontext auch als einen, wenn auch befremdlichen, Euphemismus für das Sterben Jesu lesen können, so erschöpft sie sich darin doch schwerlich.
Dazu verweist Thyen auf die „wegen der Verwendung des prominenten Lexems paradidonai {übergeben} … absichtsvolle Doppeldeutigkeit der Wendung“, die von Hoskyns, Brown, Swetnam <1389> und anderen „wohl treffend beschrieben“ wurde (T744f.):
Denn diese Hingabe des Geistes durch den am Kreuz Erhöhten muß den Leser ja daran erinnern, daß es abgesehen von jenem Geist, der seit der Stunde seiner Taufe auf Jesus geblieben war (1,32), zu dessen Lebzeiten den verheißenen Geist noch nicht gab (oupō gar ēn to pneuma). Der sollte vielmehr erst in der Stunde der Verherrlichung Jesu in die Welt kommen (7,39) und in die ganze Wahrheit führen (16,13)…
Dazu erwägt Hoskyns, <1390> ob die ungewöhnliche Formulierung von der „Hingabe des Geistes“ nicht einfach nur „noch einmal die Souveränität Jesu und die Freiwilligkeit seines Sterbens“ unterstreicht, sondern
ob der Leser sich nicht vorstellen solle, daß Jesu Mutter und der geliebte Jünger noch unter dem Kreuz stehen, so daß Jesus ihnen als den Repräsentanten des Alten wie des Neuen Gottesvolkes sein Haupt zugeneigt und ihnen den Geist übergeben habe. Dazu erklärt er: „Dies ist keine phantastische Exegese, denn die V. 28-30 geben die feierliche Erfüllung von 7,37-39 wieder. Der Durst der Gläubigen wird durch die Ströme lebendigen Wassers, die aus dem Leib des Herrn fließen, gestillt, wobei der Verfasser bereits darauf hingewiesen hat, dass es sich um die Gabe des Geistes handelt. Die hier beschriebene Ausgießung des Geistes muss in engem Zusammenhang mit der Ausgießung des Wassers und des Blutes (V. 34) verstanden werden. Die ähnliche Verbindung von Geist und Wasser und Blut in 1Joh 5,8: ‚Drei sind es, die Zeugnis geben, der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein‘, scheint diese Auslegung nicht nur möglich, sondern notwendig zu machen.“
Swetnam <1391> wiederum sieht Thyen zufolge
sehr klar, daß bei Johannes angesichts der Verse 19,30 und 20,22f von einer zweifachen Verleihung des Geistes gesprochen werden muß. Beide seien sie bezogen auf das paredōken to pneuma {er gab den Geist hin} des Gekreuzigten: „die den Höhepunkt der Kreuzigung darstellt. Diese Verleihung konstituiert den Geist sozusagen als Jesu ‚Nachfolger‘, während die Verleihung in 20,22 den Geist als Jesu ‚Gegenwart‘ zu konstituieren scheint“. Doch auch wenn Joh 20,22f mit der Sendung der Jünger und ihrer Bevollmächtigung, Sünden zu vergeben oder aber sie zu ‚behalten‘, eine spezifische Funktion des Geistes thematisiert (s. u. z. St.), darf man die Passage nicht wie Swetnam als die Verleihung eines spezifischen Amtscharismas exklusiv an die Zwölf verstehen, vielmehr repräsentieren die da um Jesus versammelten Zehn (an der Zwölfzahl fehlen ja Judas und Thomas!) alle potentiellen Jesusjünger auch unter den späteren Lesern des Evangeliums.
Typisch für Thyen sind einige weitere Überlegungen, die er unter Bezug auf Swetnam im Blick auf christologische Fragen anstellt:
Mit Recht nennt Swetnam die ,klassische Christologie‘, wonach Jesus als göttliche Person, weil er eine menschliche Natur besaß, zwar sterben muß, doch kraft seiner göttlichen Natur zugleich auch nicht sterben kann, im Blick auf unser Evangelium anachronistisch. Widersprechen müssen wir ihm aber, wenn er dann fortfährt: „Zu leugnen, dass die Grundlage für ein solches Denken in der Passionsgeschichte, die er sorgfältig ausgearbeitet hat, vorhanden ist, würde jedoch den sprachlichen Belegen zuwiderlaufen. Die sprachlichen Belege sind indirekt und anspielungsreich. Dies erklärt, zumindest teilweise, die instinktive Abneigung, die der normale, in die biblische Sprache vertiefte Mensch hat, wenn er den Höhepunkt des vierten Evangeliums in einer Terminologie sieht, die eine explizite Ontologie beinhaltet“. Denn auch eine indirekte und evokative linguistische Evidenz dafür, daß Johannes die allein dem Glauben erschlossene transsubjektive Wahrheit des Wortes Gottes in die Sphäre der von der Ontologie beherrschten intersubjektiven Verifizierbarkeit verlagert hätte, vermögen wir nicht zu erkennen. Weder implizit, geschweige denn explizit ist Ontologie in seiner Terminologie involviert. Vielmehr wollen, wie bereits des öfteren gesagt, Fleisch und Geist in dem Menschen Jesus Christus jenseits aller Ontologie asynchytōs und atreptōs, sowie adiairetōs und achōristōs {unvermischt und unveränderlich, ungetrennt und unteilbar} wahrgenommen sein …
Nach Ton Veerkamp <1392> deuten die Synoptiker
den Tod des Messias als das Zeichen der Gottverlassenheit des Volkes Gottes: Sein Heiligtum zerstört, seine Stadt vernichtet, sein Land von fremden Mächten in Besitz genommen. Johannes weist diese depressive Darstellung des Markus zurück. Er kennt den Psalm 22 und deutete ihn, als die Soldaten die Kleider Jesu unter sich verteilen: der Messias ist von seinem Volk verlassen. Aber er ist nicht von Gott verlassen.
Johannes lässt den Messias nicht die erste Zeile des Psalms 22 beten: „Mein Gott, mein Gott, warum verlässt du mich?“ Er sagt vielmehr {Vers 28}: „Ich habe Durst.“ Jesus betet einen anderen Psalm. Die Kommentare verweisen alle auf Psalm 69. In V. 22 hören wir: „Sie geben Gift in meine Nahrung, meinen Durst löschen sie mit Essig.“
In seiner Anm. 540 zur Übersetzung von Johannes 19,28 beschreibt Veerkamp auch diesen Psalm wie „das Lied Psalm 22“ als „ein Klagelied jener Kinder Israels, die wegen ihrer Treue zur Sache Gottes verhöhnt, verfolgt und getötet wurden.“
Nach Vers 29 hören die
Umstehenden … das Wort „Durst“ und erfüllen die Schrift, indem sie einen Schwamm mit saurem Wein tränken und ihn Jesus reichen, Barrett <1393> bemerkt zu Recht, dass der Ysopbüschel für die Darreichung des Schwammes nicht geeignet ist. Der Ysop diente dazu, das Blut des Pessachlammes an die Tür zu schmieren, damit der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeigeht, Exodus 12,21ff. Markus hat diesen Zusammenhang nicht, denn er lässt den Schwamm an einen Rohrstock befestigen (15,36). Johannes habe, so Barrett, die Darstellung des Markus geändert, um Jesus als das wahre Pessachlamm darzustellen. Aber diese Deutung ist schwierig, denn von Blut ist an dieser Stelle nicht die Rede. Ansonsten ist Ysop ein Element im Reinigungsritual (Leviticus 14, Numeri 19, Psalm 51,9). Eine wirklich einleuchtende Erklärung für den Gebrauch des Ysops finden wir nicht.
Um das Dürsten Jesu zu verstehen, muss man nach Veerkamp aber auch an Psalm 42,2-4 denken:
Wie der Hirsch schmachtet nach dem Wasserlauf,
so schmachtet meine Seele nach Dir, Gott.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach der Gottheit des Lebens.
Wann darf ich kommen, darf ich gesehen werden vor dem Antlitz Gottes?
Tränen sind mir zum Brot geworden, Tag und Nacht,
weil sie den ganzen Tag sagen: „Wo ist dein Gott?“Das Dürsten hat im Johannesevangelium wie auch das Hungern eine spezielle Bedeutung. Wir hörten das Wort im Gespräch mit der samaritanischen Frau, Johannes 4,13ff., in der Rede über das Brot vom Himmel in der Synagoge zu Kapernaum, 6,35 und in der Rede Jesu während des Sukkotfestes, 7,37. Der Durst nach Gott erfüllt Jesus ganz. Sein ganzes Leben war nie etwas anderes als Durst nach seinem Gott, dem Gott Israels. Johannes ruft uns beide Psalmen in Erinnerung. Psalm 69 endet so:
Denn Gott wird Zion befreien, Er wird die Städte Judas aufbauen;
Sie werden dort wiederkehren, sie werden sie ererben.
Der Samen Seiner Knechte wird sie als Eigentum haben,
die Seinen Namen lieben, werden dort wohnen.Der Tod des Messias wird die Befreiung Zions und der Wiederaufbau Judas sein. Deswegen sagt Jesus {Vers 30}, „nachdem er den sauren Wein genommen hatte: tetelestai, das Ziel ist erreicht“.
Dieselbe Form des Wortes teleō wird auch schon in Vers 28 verwendet, um die „Erzählung vom Tod des Messias … mit der Einleitung der Erzählung von der Fußwaschung“ zu verknüpfen,
und zwar mit den Worten eidōs, im Bewusstsein, und dem Wort telos, Ziel. Die Solidarität mit den Schülern kam ans Ziel, hier wird erzählt, wie das Ziel erreicht wurde. Dazu verwendet Johannes das zum Wort telos gehörende Verb telein, und zwar im Perfekt-passiv, tetelestai. Der Tod des Messias ist bei Johannes ein vollkommen bewusster Prozess. Durch den Tod wird das Ziel der Solidarität verwirklicht. Die Verwirklichung des Ziels ist die Übergabe der Inspiration.
Alles sei getan, was getan werden musste, alles sei „vollbracht“, wie das Perfekt tetelestai meistens übersetzt wird. Die Stunde, in der der Messias dorthin geht, woher er gekommen war, zu seinem Gott, der der Gott Israels ist, ist die Stunde der Einheit mit Gott, nicht die Stunde der Gottverlassenheit.
Zur Begründung seiner Auffassung, dass der Satz „Es ist vollbracht“ noch besser mit „Das Ziel ist erreicht“ übersetzt werden sollte, beschäftigt sich Veerkamp eingehend mit den drei von Johannes verwendeten Verben für „vollenden“: teleioun, telein und teleutan. Das Letztere (Anm. 543) heißt: „durch den Tod vollenden“, und Johannes gebraucht es nur ein einziges Mal im „Partizip Perfekt teteleutēkotos“ für den verstorbenen Lazarus als den „Vollendeten“ (11,39). Hier in der Szene am Kreuz soll genau das von Jesus „nicht gesagt werden.“ Aber die beiden anderen Verben tauchen gemeinsam in Johannes 19,28 auf.
In seiner Anm. 539 zur Übersetzung von Johannes 19,28 weist Veerkamp darauf hin, dass teleioun „in der dritten Zeile von 19,28“ im Blick auf die Erfüllung der Schrift „als Synonym für plēroun, ‚erfüllen‘“, steht und ansonsten bei Johannes
hauptsächlich mit dem Wort ergon, Werk, gebraucht [wird], 4,34; 5,36; 17,4. Es bedeutet dann: „ein Werk vollenden, vollbringen“. In 17,23 ist etwas Ähnliches suggeriert; die Einheit der Schüler ist das Werk, das vollbracht werden muss. Telein bedeutet: „das Ziel erreichen“; das zugehörige Substantiv telos bedeutet „Ziel“. Telein weist auf den Endpunkt einer Bewegung hin, teleioun auf die Vollendung einer Aufgabe. In 19,28 kommen beide Verben vor, telein und teleioun (die Schrift erfüllen). In 19,28 und in 19,30 verwendet Johannes das Verb telein. Hier wird ein Verb reserviert, um das Einmalige wiederzugeben, das am Kreuz geschieht.
Das Perfekt deutet bei Johannes immer Endgültiges, Definitives, an. Jesus hat im Moment seines Todes das Ziel erreicht, das der VATER ihm vorgegeben hat. Die Übersetzung: „Es ist vollbracht“ – geheiligt durch die Tradition und durch die Musik aus Bachs Johannespassion – ist impliziert in dem, was das Perfekt tetelestai sagen will. Im Vollbringen (teleioun) des Werkes, das der VATER ihm aufgegeben hat, ist das politische Lebensziel Jesu erreicht (telein). Deswegen schreibt Johannes nicht teleiōtai, „es ist vollbracht“, sondern tetelestai, „das Ziel ist erreicht“.
Um diesen Augenblick ging es. Der Messias erreicht das Ziel, das der Psalm 69 angibt: die Befreiung Zions. Der Tod ist nicht das Ende oder die Vollendung Jesu, dieser Tod ist das Ende Roms. Durch Jesu Tod wird „der Führer dieser Weltordnung hinausgeworfen“, 12,31. Jesus hat in und durch diesen Tod hindurch Zukunft, denn sein Tod heißt, dass er seine Inspiration über- und weitergibt. Diese Inspiration wird dafür Sorge tragen, dass von Jesus als Messias (Christus) durch die Jahrtausende hindurch die Rede sein wird und die Menschen in seinem Namen und durch diese Inspiration „Werke tun“, die „größer“ als Jesu Werke sein werden, 14,12. Rom hat aber keine Zukunft mehr.
Das sagt und hofft Johannes.
Im letzten Satz von Vers 30 heißt es zu Beginn: „Jesus neigte seinen Kopf (klinas tēn kephalēn)“. Dazu beschränkt sich Veerkamp auf folgende Bemerkung:
.. Der Ausdruck kommt in der griechischen Fassung der Schrift nicht vor; in den messianischen Schriften begegnet er nur in Matthäus 8,20 und der Parallelstelle in Lukas 9,58: „Die Füchse haben Höhlen, die Vögel Nester, aber der MENSCH hat nichts, wo er sein Haupt hinneigen kann (tēn kephalēn klinē).“ Der Ausdruck muss also nicht sterben bedeuten.
Sehr viel ausführlicher konzentriert sich Veerkamp auf die Auslegung der letzten drei Worte in Vers 30: paredōken to pneuma, von ihm mit „er übergab die Inspiration“ übersetzt:
Für den finalen Lebensakt Jesu verwendet Johannes den Ausdruck „die Inspiration (to pneuma) ausliefern bzw. übergeben (paradidonai)“. Nach allem, was wir über das pneuma, die Inspiration, gerade bei Johannes gelernt haben, müssen wir diesen Ausdruck aus dem Gesamtzusammenhang erklären.
Matthäus hat „die Inspiration entlassen“ (aphienai to pneuma), Markus „entgeisten“ oder „exspirieren“ (ekpneuein). <1394> Lukas übernimmt das ungebräuchliche Wort des Markus und erklärt es mit einem Psalmzitat, 31,6. <1395> Offenbar hat es Schwierigkeiten bereitet, hier das richtige Wort zu finden. Was hier geschieht, ist für alle Evangelisten mehr als sterben. Das Verb, das Johannes verwendet, paradidonai, bedeutete bis zu dieser Stelle ein politisches bzw. polizeiliches Ausliefern. Der paradidous par excellence ist Judas Iskariot. Was Jesus mit seinem Sterben tut, muss sowohl mit seiner Ankündigung, die Inspiration als Anwalt zu senden, als auch mit der Auslieferung an die Römer in Zusammenhang gebracht werden. Er tut genau das Gegenteil von dem, was Judas Iskariot und die politische Führung der Judäer bezwecken: die Eliminierung des Messias. Indem Jesus stirbt, wird seine Inspiration wirksam, werden seine Schüler „inspiriert“. Als inspirierte Menschen werden sie die Befreiung von Rom – genau das Gegenteil vom Ausliefern an Rom – bewirken. Dieser Tod ist das „Weggehen“ des Messias, 16,7, und genau dies ist die Bedingung für die Inspiration.
Abschließend geht Veerkamp auf den „Ausdruck ‚den Geist aufgeben‘“ ein, „der in der alltäglichen Sprache verwendet wird“ und „aus einer oberflächlichen Auslegung von Johannes 19,30“ stammt (Anm. 545): „So kann man von einem Automotor sagen: ‚Er hat seinen Geist aufgegeben.‘“ Ernsthaft schreibt Veerkamp:
„Den Geist (über)geben“ ist auch sterben, aber zugleich viel mehr als sterben. Wir müssen warten bis zur Besprechung von 20,22, wo das „Übergeben der Inspiration“ (paradidonai to pneuma) als die eine, das „Nehmen der Inspiration“ (lambanein ton pneuma) als die andere Seite einer Wirklichkeit sichtbar wird. Wir werden das in der folgenden Szene noch deutlicher sehen.
↑ Johannes 19,31-37: An Jesus wird kein Bein gebrochen, aber ein Lanzenstich durchbohrt ihn, so dass Blut und Wasser herauskommt, was der treue Zeuge bezeugt
19,31 Weil es aber Rüsttag war
und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über
– denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag –,
baten die Juden Pilatus,
dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden.
19,32 Da kamen die Soldaten
und brachen dem ersten die Beine
und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt war.
19,33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen,
dass er schon gestorben war,
brachen sie ihm die Beine nicht;
19,34 sondern einer der Soldaten
stieß mit einer Lanze in seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus.
19,35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,
und sein Zeugnis ist wahr,
und er weiß, dass er die Wahrheit sagt,
damit auch ihr glaubt.
19,36 Denn das ist geschehen,
damit die Schrift erfüllt würde:
„Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.“
19,37 Und ein anderes Schriftwort sagt (Sacharja 12,10):
„Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben.“
[29. Januar 2023] Auch in der Darstellung dessen, was dem Tod Jesu folgt, fährt Johannes Klaus Wengst zufolge (W534) damit fort,
die herausragende Bedeutung des Todes Jesu seiner Leser- und Hörerschaft vor Augen zu führen. Die drei miteinander Gekreuzigten erfahren nun eine unterschiedliche Behandlung. Sie sind jedoch am Beginn dieser Szene gemeinsam im Blick „der führenden Juden“, die erneut bei Pilatus vorstellig werden.
Es werden erneut „die Oberpriester“ sein, die es nach Vers 31 nicht wollen, „dass die Leichen der Gekreuzigten hängen bleiben“, da nach 5. Mose 21,22f. „ein zum Tode Verurteilter und Hingerichteter und dann Aufgehängter nicht über Nacht hängen bleiben, sondern noch am selben Tag beigesetzt werden“ soll:
Bei Josephus wird diese Vorschrift so aufgenommen: „Wer Gott gelästert hat, soll gesteinigt und dann den Tag über aufgehängt sowie ehrlos und unbemerkt beigesetzt werden“ (Ant 4, 202 {vgl. Ant. 4,8,6 nach H. Clementz}). An anderer Stelle merkt er an, dass „die Juden so sehr um die Beisetzung besorgt sind, dass sie sogar die zum Tod verurteilten Gekreuzigten vor Sonnenuntergang herunternehmen und beisetzen“ (Bell 4, 317 {vgl. Bell. 4,5,2 nach H. Clementz}). Das Problem im Falle Jesu und der mit ihm Gekreuzigten besteht nun darin, dass diese Hinrichtungen in römischer Verantwortung erfolgten und die Verfügungsmacht über die Hingerichteten daher bei Pilatus liegt. Übliche römische Praxis war es jedoch, Gekreuzigte hängen zu lassen, sodass sich aasfressende Vögel über sie hermachten.
Nach Philon, wie er in seinem Werk In Flaccum 83 berichtet (engl. Übersetzung: Flaccus), gab es aber Ausnahmen von dieser Regel, weil ein besonderer Feiertag bevorstand, etwa „der Geburtstag des Kaisers“. Aus solchen Anlässen wurden
„einige von den Gekreuzigten… abgenommen und ihren Verwandten übergeben…, um eines Grabes gewürdigt zu werden und so das dem Brauch Gemäße zu erlangen. Denn auch die Toten müssen von den Geburtstagen des Kaisers Nutzen haben und zugleich muss die Würde des Festes gewahrt werden“.
Das ist nach Wengst (W534f.)
der Hintergrund dafür, dass Johannes am Beginn des Abschnitts den anstehenden Sabbat als einen großen Feiertag betont: Dieser Sabbat fällt mit dem ersten Festtag von Pessach zusammen. Innerjüdisch würde es im Blick auf Dtn 21,22f. natürlich keine Rolle spielen, welcher Tag ansteht. Aber gegenüber Pilatus bedarf es einer besonderen Argumentation. Die Situation ist also so vorgestellt, dass die jüdischen Vertreter Pilatus auf die besondere Koinzidenz von Sabbat und erstem Feiertag von Pessach hinweisen und ihn bitten, durch Abnahme der Gekreuzigten darauf Rücksicht zu nehmen.
Zugleich setzt Johannes voraus (W535), dass sein Publikum über das Mittel des crurifragium Bescheid weiß, um „das Verfahren der Hinrichtung zu beschleunigen“, nämlich dass den „Gekreuzigten … die Schenkel zerschlagen werden“:
In der erzählten Situation wird erwartet, dass durch das Zerschlagen der Beine bei den Gekreuzigten der Tod zeitig genug eintritt, um ihre Leichen noch vor Ende des Tages wegschaffen zu können.
Dieses Mal hat „die Intervention der jüdischen Vertreter bei Pilatus … Erfolg“, wie aus Vers 32 hervorgeht: „Die Soldaten gingen nun hin und zerschlugen dem ersten die Schenkel, auch dem anderen mit ihm Gekreuzigten.“ Da aber „Jesus bereits gestorben ist“, muss das in seinem Fall nicht mehr geschehen (Vers 33): „Als sie aber zu Jesus kamen, zerschlugen sie ihm, wie sie sahen, dass er schon tot war, die Schenkel nicht.“ Da aber der „Augenschein … täuschen“ kann (Vers 34), „prüft ein Soldat, ob Jesus tatsächlich tot ist: ‚Vielmehr stieß ihn einer der Soldaten die Lanze in die Seite.‘“ In seiner Biographie von Kleomenes erzählt Plutarch
von einer Situation, in der eine solche Prüfung auf analoge Weise durchgeführt wurde. Gegen Ende seiner Darstellung des Lebens des Kleomenes berichtet er von einem kollektiven Selbstmord einer Gruppe von Spartanern in Alexandria. Von demjenigen, der sich als letzter umbringen sollte, heißt es, dass er, „während sie schon alle dalagen“, sie durchging „und im Vorbeigehen jeden einzeln mit dem Kurzschwert berührte und so prüfte, ob einer etwa noch unbemerkt am Leben sei. Als er nun auch den Kleomenes beim Knöchel anstieß und sah, dass er das Gesicht verzog […].“ Der Stich mit der Lanze in die Seite Jesu dient also der Vergewisserung dessen, dass er tatsächlich schon gestorben ist, und soll nicht seinerseits den – eventuell noch nicht eingetretenen – Tod herbeiführen. Hätte Jesus noch Lebenszeichen gezeigt, wäre auch an ihm das crurifragium vorzunehmen gewesen.
Der Lanzenstich (W536) bestätigt „für die Soldaten, was sie schon gesehen zu haben meinten…, dass nämlich Jesus tot ist“, so dass sie ihm nicht die Beine brechen, zugleich aber hat er „noch eine weitere Folge, die für Johannes bedeutungsvoll ist: ‚Und sogleich kam Blut und Wasser heraus.‘“ Dazu betont Wengst nochmals (Anm. 392), dass dies „nicht als Beleg für den tatsächlich erfolgten Tod anzusehen“ ist, denn der
Beleg dafür ist schon implizit mit der Erzählung des Stiches gegeben worden: Wer noch lebt und gestochen wird, empfindet Schmerz und wird den auch zeigen. Wer darauf nicht mehr reagiert, ist tot. Das ist hier als selbstverständlich vorausgesetzt.
Dass (W536) „bei einer Verletzung Blut und Wasser austreten“, ist „nach antik-jüdischer Vorstellung“ selbstverständlich zu erwarten; es ist nur deshalb „des Erzählens wert“, weil Johannes damit mehr verbindet:
In 6,53-58 hatte Jesus vom Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes gesprochen. Das ließ sich so verstehen, dass die Gemeinde in der Feier der Eucharistie vom Tode Jesu „zehrt“. Sie hat ihr Leben von ihm im Zuspruch der Vergebung – wie es dann in 1. Joh 1,7 formuliert wird: „[…] und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde“. In 7,38 hatte Jesus angekündigt, dass von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden, was Johannes als die kommende Gabe der Geisteskraft interpretierte. Diese Aussagen des Evangeliums verdichten sich in dem jetzt gezeichneten Bild, sodass mit Barrett <1396> gesagt werden kann: „Höchstwahrscheinlich sah Joh(annes) dann in dem Austreten von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Christi ein Symbol für die Tatsache, daß von dem Gekreuzigten jene lebendigen Ströme ausgingen, durch welche die Kirche lebt.“ Darin sind auch eingeschlossen und in zweiter Linie mit im Blick Taufe (vgl. 3,5) und Eucharistie.
Es ist diese symbolische Bedeutung von Blut und Wasser, auf die Johannes in Vers 35 „eine Aussage und eine Zielangabe“ formuliert (W536f.):
„Und der es gesehen hat, hat es bezeugt […], damit auch ihr glaubt.“ Für das bloße Faktum, dass Blut und Wasser aus der Wunde austraten, bedarf es keines Zeugen. Das ist ja das ganz und gar zu Erwartende. Auf dieser Ebene wäre Zeugenschaft erforderlich, hätte es sich anders verhalten. Ginge es bloß um das Bezeugen dieses Faktums, wäre die Zielangabe seltsam: „damit auch ihr glaubt“. Dass Blut und Wasser austreten, ist keine Frage des Glaubens. … Der Zeuge, der gesehen hat, ist selbst ein Glaubender; im Zeugnis gibt er seine „Sicht“ wieder. Dass er ein Glaubender ist, zeigt sich auch daran, dass es in der Zielangabe heißt: „damit auch ihr glaubt“.
Mit den Bemühungen (W537), „diesen Zeugen zu identifizieren“, beschäftigt sich Wengst nur am Rande. Er will es ernst nehmen,
dass Johannes das Subjekt des Sehens und Bezeugens nicht benennt; er lässt es sozusagen noch anonymer sein als den „Schüler, den Jesus liebte“. Wer hier Zeugnis ablegt, ist – wie im ganzen Evangelium – der Autor. Wie in 20,31 gibt er hier das Ziel seines Bezeugens an. Wie dort spricht er auch hier nicht in der ersten Person. Er formuliert hier so, dass er exemplarisch für die Glaubenden spricht. Was er „gesehen“ hat – nämlich seine „Sicht“ des gekreuzigten Jesus -, sollen sie sich zu eigen machen und damit ihrerseits Zeugen werden.
Zwischen der bisher besprochenen „Aussage und Zielangabe“ stehen eingeklammert noch zwei weitere Sätze, in denen „Johannes ‚die Wahrheit‘, die Zuverlässigkeit dieses Zeugnisses“, unterstreicht:
Ihr erster Satz beteuert: „Und sein Zeugnis ist verlässlich.“ Im Blick auf das bloße Faktum gibt es weder etwas zu deuteln noch irgendetwas auszusagen; es ist von schlichter Einfachheit – um nicht zu sagen: Banalität. Ob das Zeugnis von Jesu Tod verlässlich, ob es „wahr“ ist, wird von der Erfahrung derer zu beantworten sein, die sich darauf einlassen und es in ihrem Leben erproben, dass von seinem Tod Lebensströme ausgehen. Der zweite Satz der Parenthese stellt die Gewissheit, die Selbstgewissheit des Zeugen hinsichtlich dessen heraus, was er sagt: „Und jener weiß, dass er die Wahrheit sagt.“ Er weiß es, weil er die im Zeugnis vermittelte Sicht des gekreuzigten Jesus selbst schon erprobt hat.
Mit zwei Schriftzitaten (W538) blickt Johannes in den Versen 36 und 37 auf „das zuvor erzählte Geschehen“ zurück:
Wie Johannes beim Verteilen und Verlosen der Kleidung Jesu und bei dessen Aussage, er habe Durst, auf die Schrift hinwies, so tut er es jetzt auch bei dem, was unmittelbar nach Jesu Tod mit seinem Leichnam geschieht bzw. nicht geschieht. Auch das erfolgt nicht losgelöst vom Willen Gottes. Dabei klingt im ersten Zitat noch eine spezifische Aussage an, die in Verbindung mit vorangehenden Stellen des Evangeliums steht. Es knüpft an den Bericht darüber an, dass Jesus die Schenkel nicht zerbrochen wurden: „Das nämlich geschah, sodass die Schrift ausgeführt wurde: Kein Knochen von ihm darf zerbrochen werden.“ Ex 12,46 heißt es von dem im Haus zu verzehrenden Pessachlamm, dass nichts von seinem Fleisch hinausgetragen werden darf. Daran schließt sich die weitere Mahnung an: „Und keinen Knochen an ihm dürft ihr zerbrechen“ (vgl. Num 9,12). Die Entsprechung Jesu zum Pessachlamm wurde schon durch die Zeitangabe in V. 14 vorbereitet. Von hier aus führt ein Bogen zurück auf das Täuferwort von 1,29 über Jesus als „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“.
Ein weiterer Bogen wird nach Wengst in diesem Zusammenhang von der Befreiungserfahrung Israels her zur Öffnung des Glaubens der Völker an den Gott Israels gespannt:
Dem Pessachlamm, das Israel einst Schutz bot und ihm Befreiung aus dem Sklavenhaus erwirkte, dessen sich die Judenheit in der Pessachfeier im Lobpreis Gottes erinnert, entspricht Jesus als „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“ – und das damit so wirkt, dass Menschen aus den Völkern durch es den Weg zum Gott Israels fanden und finden.
Wengst wendet sich aber dagegen (Anm. 400), dass in „der Auslegung … oft an die Stelle der Entsprechung nur allzu leicht die Ablösung“ tritt, wenn zum Beispiel Bultmann <1397> sagt: „Das Ende des jüdischen Kultes bzw. die Nichtigkeit seines ferneren Vollzuges ist damit behauptet“, und schon Luther <1398> betont:
„[…] in Christus hört das alte Passah auf […]. Wenn die Weissagung erfüllt ist, so ists aus, gilt nicht mehr und ist nicht mehr weiter für Weissagung zu halten. […] So halten die Juden noch jetzt ihr Passahlamm, aber es ist Götzendienst und Lüge; denn was von dem Passahlamm geweissagt ist, ist jetzt vollbracht“. Die Vorstellung, an Jesus als Messias glaubende Jüdinnen und Juden im 1. Jh. hätten die Feste ihres Volkes für überholt angesehen und nicht mehr an ihnen teilgenommen, ist pure Rückprojektion aus späterer Zeit, als die Abgrenzung so scharf geworden war, dass sie gezwungen wurden, ihre jüdische Identität aufzugeben, wollten sie in der – dominant nichtjüdisch gewordenen – Kirche bleiben.
Das zweite Zitat in Vers 37 bezieht sich auf den Lanzenstich (W538f.):
„Und wiederum eine andere Schriftstelle lautet: Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben.“ Johannes bezieht sich hier auf Sach 12,10. Dort heißt es nach dem hebräischen Text in Gottesrede: „Und sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben.“ Dieses Zitat leistet dasselbe wie die anderen Schriftzitate im Evangelium, gerade und besonders auch in der Passionsgeschichte: Es bringt das erzählte Geschehen mit Gott in Verbindung. Das hier Berichtete, der Lanzenstich in Jesu Seite, wird damit als von Gott in Dienst genommen qualifiziert und sozusagen seiner Autonomie beraubt. Diese Absicht zeigt sich auch in dem im Hauptsatz des Zitats gebotenen Verb für „sehen“ (ópsontai; in der Septuaginta steht epiblépsontai = „blicken auf“). Wo Johannes es, bezogen auf Jesus als Objekt, im Evangelium gebraucht, geht es nicht um ein bloßes Hinblicken, sondern um ein Sehen Jesu, dass zugleich damit Gott als den in ihm und durch ihn Wirkenden wahrnimmt.
An Beispielen für dieses besondere Sehen Jesu führt Wengst (Anm. 402) die Stellen „1,46.50f.; 11,40; 14,7-9; 20,18.20.25“ an. Das (W539) „Objekt des Sehens“ nennt Johannes „im Zitat nicht – wie das im masoretischen Text der hebräischen Bibel der Fall ist – in der ersten Person, sondern in der dritten“, denn er will ja „von Jesus als dem ‚Durchbohrten‘ reden“:
Die erzählte Ebene vom Lanzenstich wird vom Zitat gleichsam überblendet, in dem Gott der Durchbohrte ist. Damit bringt das Zitat ein, dass Gott den Tod Jesu auf sich zieht. Weil es aber Gott ist, der das tut, ein Gott des Lebens, wird damit zugleich über die erzählte Situation hinausgeblickt und angedeutet, dass der Tod und das noch zu berichtende Begräbnis nicht das Letzte sind, was über diesen Gekreuzigten gesagt werden kann.
Da die griechische Septuaginta (Anm. 401) in ihrer Übersetzung des hebräischen Textes von Sacharja 12,10 darauf verzichtet, von Gott als dem „Durchbohrten“ zu reden, hält es Wengst für naheliegend, „dass er selbst den hebräischen Text übersetzt“ und ihn auf seine Weise in den neuen Zusammenhang eingepasst hat.
Zu Vers 31 fügt Hartwig Thyen (T746) dem, was Wengst über das „Zerschmettern“ der Schenkel der Gekreuzigten sagt, nichts Wesentliches hinzu. Die (T747) „ganze Szene“, die in den Versen 32 bis 37 folgt, ist in seinen Augen ebenso
wie die Episode mit Jesu Vermächtnis an seine Mutter und an den Jünger, den er liebte, … fiktional und hochsymbolisch. Wie jene hat sie keine unmittelbare Analogie in den synoptischen Prätexten. … Der Umstand, daß Jesus die Beine nicht zerschlagen wurden, wird ebenso wie der Lanzenstich in seine Seite … als die Erfüllung konkreter und ausdrücklich zitierter Schriftstellen gedeutet …
Wie Wengst bezieht auch Thyen das „erste der Zitate“ in Vers 36: „Kein Bein soll ihm gebrochen werden“ hauptsächlich auf „Ex 12,10.46 (vgl. Num 9,12)“, obwohl
darüberhinaus möglicherweise noch das Psalmwort mit anklingen mag, das über den Gerechten sagt, auch wenn er viel leiden müsse, rette ihn daraus doch der Herr, „der alle seine Gebeine behütet, daß keines von ihnen zerbrochen wird“ (kyrios phylassei panta ta osta autōn, hen ex autōn ou syntribēsetei: Ps 34,20f). Jedenfalls sollte man aber zwischen Ex 12,46 und Ps 34,20f keine Alternative konstruieren. Denn in der jüdischen Art der Bibellektüre, in der Johannes zu Hause ist, werden derartige Stellen stets aufeinander bezogen. Für Johannes ist Jesus gerade als der leidende Gerechte, als Gottes Knecht und Sohn, von dem es bei Jesaja heißt: idou synēsei ho pais mou kai hypsōthēsetai kai doxasthēsetai sphodra {Siehe, meinem Knecht wird‘s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein} (52,13), das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt… Wie einst in Ägypten das Blut des Lammes dem Todesengel die Tür zu den Kindern Israels verschlossen hatte, so verschließt ihm nun das vergossene Blut Jesu den Zutritt zu allen, die an ihn glauben, und eröffnet ihnen den Weg zum Vater und den Einzug des Vaters und des Sohnes bei ihnen.
Ebenso, wie auf diese Weise „das Exoduszitat nicht als isolierter ,Schriftbeweis‘ verstanden sein will, sondern vom Leser fordert, das Geschehen in der Stunde des Todes Jesu im Lichte der gesamten Stiftung, Geschichte und Praxis des Passafestes wahrzunehmen“, muss nach Thyen dann auch das „zweite Schriftzitat“ in Vers 37, „das nun auf den Lanzenstich in die Seite Jesu bezogen ist: opsontai eis hon exekentēsan {sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben}“ aus „dem Sacharjabuch (12,10) … als intertextuelles Spiel mit seinem Kontext (Sach 12f) begriffen werden“, denn hier erfüllt (T748)
sich symbolisch Sacharjas Weissagung von Jerusalems Bedrängnis und Erlösung: „An jenem Tage werde ich … alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem heraufgezogen sind. Aber über das Haus David und die Bewohner Jerusalems werde ich einen Geist der Erbarmung und des Gebets ausgießen, und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben; ihn werden sie betrauern, wie man trauert um den einzigen Sohn, und bitter werden sie um ihn klagen, wie man klagt um den Erstgeborenen. … An jenem Tage wird ein Quell sich öffnen für das Haus David und die Bewohner Jerusalems gegen Sünde und Befleckung“ (Sach 12,9f u. 13,1). lm hebräischen Text von Sach 12,10 erklärt JHWH in der Gottesrede: „Sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben“ (wɘhibijtu ˀelaj ˀeth ˀascher-daqaru – LXX: kai epiblepsontai pros me anth‘ hōn katōrchēsanto). Johannes dürfte diese Textgestalt gekannt haben. In der Person seines gekreuzigten Sohnes ist der egō eimi {ICH BIN} der Durchbohrte. Zugleich mit Sacharjas Weissagung erfüllt sich hier auch noch Jesu eigenes Wort an die Juden, von denen daraufhin viele von ihnen an ihn glaubten (8,30): „Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, daß ich (es) bin“ (tote gnōsesthe hoti egō eimi: 8,28; s. o. z. St.).
Erst nach der Beschäftigung mit den Schriftzitaten wendet sich Thyen ausführlich der symbolischen Bedeutung von Vers 34b und seiner Deutung in Vers 35 zu:
„Und sogleich strömten Blut und Wasser hervor. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Ja, jener weiß, daß er die Wahrheit sagt, damit auch ihr an dem Glauben festhaltet“.
Mit der letzteren Übersetzung entscheidet sich Thyen an Stelle der von der Mehrheit der Handschriften bezeugten Lesart pisteusēte {damit ihr glaubt bzw. zum Glauben kommt} für „die schwierigere Lesart {pisteuēte}, die aber zugleich einen Grundzug unseres Evangeliums markiert, nämlich das Festhalten und Bleiben am und im Glauben, daß Jesus der messianische Gottessohn ist“.
Außerdem versucht Thyen zu begründen, dass derjenige, der das Hervorströmen von Blut und Wasser gesehen hat und bezeugt, der Lanzenstecher selbst sein muss:
In dem Sacharjatext ist der Sache nach deutlich von Umkehr und Reue die Rede: Vom Geist der Erbarmung und des Gebets erfaßt, werden Mörder umkehren und den, den sie durchbohrt haben, wie einen einzigen Sohn betrauern. Da das Sacharja-Zitat den Lanzenstich und seine Folgen deuten soll, kann derjenige, der das gesehen und bezeugt hat, nur der Soldat sein, der den Lanzenstich ausführte, keinesfalls aber der geliebte Jünger. Denn das Zitat fordert, daß diejenigen, die ihn durchbohrt haben, mit denen identisch sind, die jetzt, erfaßt vom Geist des Erbarmens, auf ihn schauen…
Zwar will Thyen (T749) nicht wie Sabbe <1399> „die markinische Szene“ vom Hauptmann unter dem Kreuz als „Quelle von Joh 19,33-37 … im Sinne der älteren Literarkritik“ betrachten, sieht diese aber dennoch als den entscheidenden Prätext, mit dem Johannes hier intertextuell spielt. Dadurch verliert allerdings der geliebte Jünger durchaus nicht seinen Platz in diesem Vers und unter dem Kreuz, denn „die Wendung ekeinos oiden {jener weiß}“ ist
nicht einfach ein emphatischer Rückverweis auf den heōrakōs {der das gesehen hat}, sondern bei dem ,Wissenden‘ und bei dem ,Sehenden‘ muß es sich um zwei verschiedene Personen handeln [vgl. Sabbe 49]. Diesen durch ekeinos {jener} markierten Subjektwechsel innerhalb von V. 35 haben bereits die griechischen Kirchenväter deutlich wahrgenommen. Und in diesem Sinne fragt Bultmann [526] denn auch treffend: „Wer ist der ekeinos? Der Augenzeuge selbst kann es ja nicht sein, sondern nur ein Anderer, der in der Lage ist, für die Wahrheit des Zeugnisses zu bürgen“. Wenn Bultmann dann jedoch fortfährt: „Dann aber kann doch nur Jesus selbst gemeint sein“, so ist ihm zu widersprechen, denn nicht der tote Jesus, sondern nur der von ihm soeben autorisierte geliebte Jünger und Evangelist kann der um die Wahrheit des Zeugnisses des Soldaten Wissende sein. Bestätigt wird das durch 21,24, wo der geliebte Jünger als der fiktionale Evangelist in seine einladenden Worte: kai oidamen hoti alēthēs autou hē martyria estin, das Zeugnis des Soldaten von 19,35 erkennbar mithineinnimmt. Darum hegen wir mit Sabbe keinen Zweifel daran, daß der wissende Andere nur der geliebte Jünger sein kann. Wie auch sonst im Evangelium behält er sein Wissen jedoch für sich, bis er es als der, „der dies geschrieben hat“, in seinem Evangelium öffentlich bezeugen wird, „damit auch ihr (so wie dieser Zeuge unter dem Kreuz) glaubt. Die Notwendigkeit, zwischen dem heōrakōs und dem ekeinos zu unterscheiden, wird auch aus der fundamentalen Bedeutung des biblischen Zeugenrechts von Dtn 19,15 für unser Evangelium klar. Selbst Jesu eigenes Zeugnis verlöre seine Wahrheit, wenn er nur für sich selbst zeugte (5,31; 8,16f u.ö.). Weil es stets des übereinstimmenden Zeugnisses zumindest zweier Zeugen bedarf, wird auch Joh 19,35 die Wahrheit des Zeugnisses des Einen erst durch den Anderen verbürgt. Diese Deutung bewahrt endlich auch das Rätsel um den geliebten Jünger, der im gesamten Corpus des Evangeliums nie als der öffentliche Zeuge seines Herrn hervortritt. Dieses ihm bestimmte Zeugenamt tritt er erst im Epilog (Joh 21) an; und zwar zunächst noch innerhalb der Erzählung dem engeren Jüngerkreis gegenüber (21,7) und am Ende vor aller Welt durch sein geschriebenes Evangelium (21,24).
Das Hervorströmen des Wassers aus dem Leib Jesu betrachtet Thyen als die Erfüllung von Johannes 7,37-39:
Wir haben oben zu 7,37f eingehend begründet, daß Jesu Einladung an alle Durstigen so zu gliedern ist: „Wenn einen dürstet, so komme er zu mir. / Und es trinke, wer an mich glaubt. / Wie die Schrift sagt: Aus seinen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers entspringen“. Die Schrift verheißt danach also, daß aus seinem Leib – nämlich aus dem Leib Jesu und nicht etwa aus den Leibern der Glaubenden – Ströme lebendigen Wassers hervorgehen sollen. Zugleich hatte der Erzähler diese Wasserströme dann als Symbol des österlichen Geistes identifiziert und dessen Ausgießung in die Stunde der Verherrlichung Jesu datiert (7,39).
Damit geht (T750), wie Bultmann [229] treffend urteilt, eine „deutliche Bezugnahme auf eschatologische Weissagungen“ wie Jesaja 12,3; Hesekiel 47,1ff.; Joel 4,18; Sacharja 13,1 und 14,8 einher, die Thyen zufolge
das heilszeitliche Entspringen eines unversieglichen Quells lebendigen Wassers aus dem Tempel oder aus Jerusalem verheißen. … Weil die in der kritischen Forschung ‚Deutero-Sacharja‘ genannten Kapitel Sach 9-14 schon früh zur prophetischen Haphtara des Laubhüttenfestes geworden sind …, und weil innerhalb der erzählten Welt unseres Evangeliums Jesu Verheißung, daß aus seinem Leibe Ströme lebendigen Wassers entspringen werden, mit der Szene vom Lanzenstich und dem Hervorströmen von Blut und Wasser aus seiner durchbohrten Seite, für das eigens ein Augenzeuge aufgeboten wird (19,33-37), ihre förmliche Erfüllung erfahrt, haben wir oben als die primäre Quelle der in 7,37 zitierten ,Schrift‘ Sach 13,1 und 14,8 identifiziert: „An jenem Tage (nämlich am Tage, da sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben und alle um ihn trauern) öffnet sich ein Quell für das Haus David und alle Bewohner Jerusalems gegen Sünde und Unreinheit“ (13,1) und: kai en tē hēmera ekeinē exeleusetai hydōr zōn ex Ierousalēm ktl. {Und an jendem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen usw.} (Sach 14,8)… Im übrigen ist Sach 14 wohl seinerseits ein intertextuelles Spiel mit Ez 47, wobei Sacharja statt des einen Stromes, der selbst das ,Tote Meer‘ mit Leben erfüllt, gleich deren zwei aus Jerusalem hervorgehen läßt.
Abschied nimmt Thyen von einer Deutung, die das „Hervorgehen von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu“ als Erweis seiner „wirkliche[n] Leiblichkeit“ bzw. seines „tatsächliche[n] Gestorbensein[s]“ betrachtet (T750f.):
Denn einen Zeugen für den jedermann sichtbaren tatsächlich eingetretenen Tod Jesu oder für seine in der antiken Welt aus dem Herausfließen von Blut und Wasser aus seiner Wunde angeblich einfach diagnostizierbare menschliche Natur würde Johannes schwerlich mit der emphatischen Wendung: kai ho heōrakōs memartyrēken {Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt} eingeführt und als endzeitliche Erfüllung der Schrift ausgezeichnet haben. Mit den Worten: kagō heōraka kai memartyreka hoti houtos estin ho hyios tou theou {Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn}, die wohl kaum zufällig an das Bekenntnis des synoptischen Hauptmanns unter dem Kreuz anklingt, hatte er bereits die Martyria {das Zeugnis} des Johannes beschrieben (1,34), und ebenso erweisen Joh 3,11 und 32f dieses Syntagma {Satzgefüge} als geprägten Ausdruck. Wo es erscheint, wird nicht eine jedermann sichtbare Banalität des Alltags bezeugt, sondern die allein dem Glauben sichtbare himmlische Welt …
Indem „die Ströme von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu“ Thyen zufolge „unterscheidbar zu sehen gewesen sein“ müssen, kann man diesen Vorgang zu Recht „als ein ,Wunder‘“ bezeichnen. Zum „Wasser als Symbol des Geistes“, das im Johannesevangelium häufig vorkommt, hat er „oben bereits das Nötige gesagt“. Das Wort haima {Blut} kommt dagegen
bei Johannes nur selten vor. Abgesehen von dem neutralen Gebrauch des Lexems in 1,13, wo der seltsame Plural haimata in der Konnotation mit thelēma sarkos {Fleischeswille} und dem thelēma andros {Manneswille} der Charakterisierung derer dient, die nicht ,aus Gott‘ und ,von oben‘ geboren, sondern ek tou kosmou {aus der Welt} sind, ist vom haima als dem Blut Jesu außer in unserer Passage nur noch in dem Abschnitt 6,51-58 die Rede. In diesem Abschnitt, der auf seine Weise mit den überlieferten verba testamenti {Bundesworten} spielt, erscheint haima aber in auffälliger Häufung, nämlich gleich viermal. Jesu Hingabe seines Fleisches, die nach dem Kontext natürlich mit dem Vergießen seines Blutes verbunden ist, geschieht nach 6,51ff hyper tēs tou kosmou zōēs {für das Leben der Welt} (s. o. z. St.).
Ton Veerkamp <1400> geht zu Vers 31 genauer auf die Satzkonstruktion ein:
Die vorletzte Szene in der Erzählung über Jesu Tod beginnt mit einem einfachen Satz: „Die Judäer fragten nun Pilatus, ob sie…“ Zwischen dem Subjekt und dem Verb schaltet Johannes einen Zwischensatz. Dieser Zwischensatz ist auf den ersten Blick recht holprig. Zwischen zwei Bestimmungen des Tages „es war Vorbereitungstag (ˁerev pascha)“ und „es war sogar ein großer Schabbat“, zitiert Johannes die Tora, Deuteronomium 21,12f. (vgl. Mischna Sanhedrin 6,4):
Wenn an einem Mann eine Verirrung, eines Todesurteils würdig, gefunden wird,
ihr ihn an einem Baumstamm aufgehängt habt,
bleibe dessen Leiche nicht über Nacht,
sondern begraben sollt ihr ihn, begraben am Tag selbst.
Denn ein Gehängter ist dem NAMEN ein Fluch.Jesu Leiche darf daher nicht über Nacht am Kreuz hängen bleiben. Die Judäer sind bei der Hinrichtung nicht anwesend, sie bleiben in der Nähe des obersten Repräsentanten Roms, Pilatus. Johannes will die Vollstreckung des Todesurteils als eine Sache darstellen, die sich ausschließlich zwischen dem Messias und Rom abspielt.
Nach Johannes fiel der Pascha-Schabbat auf den siebten Tag der Woche, daher „großer Schabbat“. Die Toravorschrift hat an sich weder mit dem Schabbat noch mit dem Tag vor Pascha zu tun, aber der Umstand, dass der große Schabbat des Pascha unmittelbar bevorsteht, macht es um so dringlicher, die Leichen vor Sonnenuntergang von ihren Kreuzen zu holen. Dazu müssen die Verurteilten erst einmal tot sein. Also treten Soldaten vor, um das Urteil endgültig zu vollstrecken. Was nachher mit den Leichen der Hingerichteten geschieht, entscheidet das Gericht, das das Todesurteil gesprochen hatte, in diesem Fall Pilatus. Der Zwischensatz dient dazu, die Verbindung zwischen dem Pessachfest und der Erhebung des Messias durch den Tod am Kreuz deutlich zu machen. Der ganze Abschnitt 11,55-19,42 wird von der Nähe zum Paschafest bestimmt. Wir näherten uns schrittweise dem Fest, sechs Tage vor dem Fest (11,55), vor dem Fest (13,1) und schließlich am Vorbereitungstag vor dem Fest, 19,14. Zum ersten Mal hörten wir das Wort paraskeuē in dem Augenblick, als das römische Gericht das Todesurteil gegen Jesus spricht. Jetzt hören wir es zum zweiten Mal.
Bedeutungsvoll ist die Erwähnung dieses Rüsttages, ˁerev pascha, für Johannes deswegen, weil damit die Bedeutung Jesu als des am Kreuz geschlachteten Passalammes herausgestellt wird. Diese Schlachtung wird in Vers 34 durch den Lanzenstich eines römischen Soldaten quasi amtlich bestätigt:
Wir wissen, dass der Vorbereitungstag zugleich der Tag ist, an dem das für das Pessachfest vorgesehene Lamm geschlachtet wird. Johannes will beides, das Schlachten des Pessachlamms und das, was nach dem Tod Jesu geschieht, miteinander verknüpfen. Jesus ist tot, und ein – römischer! – Soldat stößt seine Lanze in die Brust Jesu – „der ist hin“, will er damit sagen, „macht euch keine Mühe“. Man kann das als „amtliche Feststellung des Todes“ auffassen. Etwas anderes kann ein römischer Soldat von sich aus nicht tun. Aber er tut für die Zuhörenden des Johannes mehr. Er tut das, was in allen messianischen Gemeinden schon sehr lange zum Grundwissen über den Messias gehört. Paulus schrieb mindestens eine Generation früher: „Unser Pascha(lamm) ist geschlachtet: der Messias“, 1 Korinther 5,7. Mit seiner bewusstlosen Tat „erfüllt“ der Soldat „die Schrift“. Alles in der Schrift läuft nach Johannes auf diesen Augenblick hinaus. Das ist die Schriftauffassung des Johannes: „Jener (Mose) hat über mich (Jesus) geschrieben“, 5,46.
Durch die dritte Wiederholung des unscheinbaren Wortes euthys {sofort} wird in Veerkamps Augen der Vers Johannes 19,34 mit den Stellen 13,30 und 32 verknüpft:
Dann kommt: „Und sofort kam (exēlthen euthys) Blut und Wasser heraus.“ Wir hören dieses Wort euthys zum dritten Mal. Judas Iskariot nahm den eingetauchten Bissen und ging sofort hinaus (exēlthen euthys). Gepflegte Sprache verlangt, dass die beiden Wörter in umgekehrter Reihenfolge stehen sollen: euthys exēlthen. Deswegen „verbesserten“ einige nicht unwichtige Handschriften die Reihenfolge. Aber beide Stellen sind durch die gleiche Wortfolge aufeinander zu beziehen, 13,30 und 19,34. Die Ehrung des Messias ist ein Prozess, eingeleitet durch den „sofortigen Weggang“ des Judas ben Simon: „Und sofort wird er (Gott) ihn (den MENSCHEN bar enosch) ehren“, 13,32. Dieser Prozess geht weiter im sofortigen (euthys) Weggang (exēlthen) von Wasser und Blut.
Zum symbolischen Bezug des Wassers auf den Geist Gottes schreibt Veerkamp:
Was mit Wasser gemeint ist, wissen wir aus 4,14 und 7,38. Der samaritanischen Frau wird Wasser verheißen, das in ihr „zum Brunnen wird, aufspringend zum Leben der kommenden Weltzeit“. Deutlicher wird das im zweiten Zitat. Jesus spricht im Heiligtum während des Sukkotfestes von „Strömen lebenden Wassers aus seiner Seite“. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügt Johannes hinzu: „Das sagte er von der Inspiration, von der jene nehmen sollten, die ihm vertrauten. Es gab aber noch keine Inspiration, da Jesus noch nicht zu seiner Ehre gekommen war“, 7,38f. Die Stunde seines Todes ist die Stunde seiner Ehre. Sofort geht von Jesus die Inspiration aus. Unsere Deutung des Todes Jesu als die Übergabe der Inspiration wird somit bestätigt.
Damit die Inspiration von Jesus ausgehen kann, muss er jedoch als das neue Passalamm sterben, dafür steht symbolisch das Blut:
Blut kennen wir aus der großen Rede Jesu in der Synagoge zu Kapernaum: „Wer mein Fleisch kaut und von meinem Blut trinkt, erhält das Leben der kommenden Weltzeit, und ich werde ihn aufstehen lassen am Tag der Entscheidung. Denn mein Fleisch ist Essen, dem man vertrauen kann, mein Blut Trank, dem man vertrauen kann“, 6,54f. Das Wort Blut kommt bei Johannes nur hier und in der Rede in der Synagoge von Kapernaum vor (wenn wir von der Stelle 1,13 absehen). Es geht hier um die Inspiration, die Befähigung zum Leben der kommenden Weltzeit. Und dies geschieht durch den Tod (das Blut) des Messias. Das Blut ist das Blut des Paschalammes. Es rettete damals vor dem Tod in Ägypten; das Blut des Messias rettet jetzt vor dem Tod an der herrschenden Weltordnung. Der Tod des Messias ist zu verstehen als die Schlachtung des Paschalammes: notwendige Voraussetzung dafür, dass das endgültige Fest der Befreiung begangen werden kann. Tod ist in beiden Fällen Voraussetzung für Pascha, nämlich Pascha selber. Pascha ist, was einmal geschehen wird, Pascha ist noch nicht. Deutlich wird das erst in 20,17.
Nach Veerkamp ist nun derjenige, der in Vers 35 als Zeuge dessen benannt wird, was hier geschieht, einfach der Evangelist selbst. Ähnlich wie Wengst zieht er Spekulationen über mögliche Identifikationen dieses Zeugen mit dem geliebten Schüler oder gar mit dem römischen Lanzenstecher nicht einmal in Erwägung. Stattdessen hebt er die Bedeutung des Schriftbeweises für die Beglaubigung seines Zeugnisses hervor:
Für Johannes ist dies der eigentliche Höhepunkt seiner Erzählung. Er benennt sich selbst zum Augenzeugen; er, der Verfasser unseres Textes, appelliert an seine Zuhörer, dem hier berichteten Geschehen Vertrauen zu schenken. Vertrauenswürdig ist im Evangelium ein Zeugnis, wenn es durch den Schriftbeweis bestätigt wird.
Der Messias ist das Paschalamm, deswegen „sollten seine Knochen nicht gebrochen werden“. Der Satz kommt in der hebräischen Fassung der Pessachsatzung nur einmal vor, Exodus 12,46, zweimal in der griechischen Fassung, 12,10.46. Heute, scheint Johannes zu sagen, geschieht Befreiung nicht mehr durch die traditionelle Schlachtung des Paschalammes, die genau am Vorbereitungstag des Pascha im Heiligtum stattfindet, sondern ist bereits durch den amtlich besiegelten Tod des Messias geschehen.
Dieses erste Schriftzitat in Vers 36 wird Veerkamp zufolge durch ein zweites in Vers 37 noch klarer politisch zugespitzt:
Johannes geht aber noch einen Schritt weiter. Er fasst seine Erzählung vom Tod des Messias als Midrasch zu Sacharja 12 auf. Das zweite gibt dem ersten Schriftzitat eine politische Orientierung. Denn die Gleichsetzung Paschalamm = Messias erlaubte in einem gnostischen Milieu eine symbolische Ausrichtung; das Neue an der Befreiung wäre dann eine innere Erlösung. Aber bei Johannes ist die Befreiung der Menschen und ihrer Welt von der Ordnung, die auf ihr lastet. Deswegen ist Sacharja 12,10 in seinem Zusammenhang zu lesen, 12,1-4.9-11:
Lastwort, eine Anrede des NAMENS über Israel:
Verlautbarung des NAMENS.
Der die Himmel ausbreitet, die Erde begründet,
der im Inneren dem Menschen Atemgeist bildet:
Ich setzte Jerusalem ein als Taumelbecken für alle Völker ringsum,
auch über Juda bei der Belagerung Jerusalems.
Es wird geschehen an diesem Tag:
Ich setze Jerusalem ein als Stein der Last für alle Völker,
die ganze Last, daran sollen sie sich wundscheuern, ja, wundscheuern,
die ganzen Weltmächte, die sich zusammenschließen.
An diesem Tag – Verlautbarung des NAMENS –
schlage ich die ganze Kavallerie mit Verwirrung,
die ganzen Streitwagen mit Irrfahrt.
…
Es wird geschehen an diesem Tag:
Ich suche auszurotten alle Weltmächte, die gegen Jerusalem kamen.
Ich gieße aus über das Haus David, über alle Bewohner Jerusalems,
Inspiration der Gnade und der Begnadigung.
Dann werden sie zu mir aufblicken.
Über den, den sie durchstochen haben, werden sie trauern,
wie mit der Trauer über den Einzigen,
verbittert sein seinetwegen, wie mit der Verbitterung wegen des Erstgeborenen.
An diesem Tag wird die Trauer groß sein, die Trauer in Jerusalem,
wie die Trauer um Hadadrimon im Tal Megiddon.
Zwar sind „[b]ekanntlich … die letzten sechs Kapitel des Buches Sacharja schwer zu deuten“, und niemand „weiß genau, wen Sacharja mit dem ‚Erstochenen‘ meinte und welche politische Lage im Hintergrund stand“. Dennoch macht es Sinn, so Veerkamp, dieses Stichwort im Rahmen des Buches Sacharja auf die Zukunft Israels zu beziehen:
Der Erstochene, über den getrauert wird, ist der „Einzige“ (jachid). Das ruft Isaak in Erinnerung, der in Genesis 22,2 nach der Septuaginta agapētos genannt wird, wie in Sacharja 12,10. Der Kontext ist das Haus Davids, die Ortsangaben <1401> suggerieren den König Josia, den Reformkönig, dessen Politik Jeremia so leidenschaftlich verteidigte. Dessen Tod bedeutete das Ende aller Bemühungen, die Zukunft der Stadt zu sichern. „Einziger“ und „Erstgeborener“ sind Chiffren für das einzige, das Zukunft verheißt.
Johannes zitiert die Stelle weder nach dem hebräischen Text noch nach der Septuaginta, sondern „frei“: „Sie werden aufblicken zu dem, den sie erstochen haben“, und wendet den Satz auf Jesus an: er ist der „Einzige“ und der „Erstgeborene“, er ist die Zukunft Israels, ihn hat man erstochen. Wie immer, ruft ein kurzes Zitat den unmittelbaren Kontext auf, den die Zuhörer im Ohr haben. Wir haben bei der Besprechung des Einzugs in Jerusalem (12,12ff.) schon feststellen können, dass die messianischen Gemeinden den letzten Teil des Buches Sacharja intensiv studiert haben. Unmittelbar vor dem Zitat redet Sacharja vom „Ausgießen der Inspiration (schafakh ruach, ekchein pneuma)“. Johannes verbindet das Geschehen am Kreuz mit der Lage der Stadt, gegen die „die Völker ringsum“ – Rom – aufgezogen sind, und er kündigt mit diesem Zitat implizit die Gabe der Inspiration an.
Damit bezieht Veerkamp ähnlich wie Thyen das Schriftwort in Vers 37 auf eschatologische, endzeitliche Hoffnungen, jedoch sehr viel konkreter auf das zukünftige Leben Israels inmitten der Völker und auf die Befreiung der Welt von der versklavenden Weltordnung, die auf ihr lastet.
↑ Johannes 19,38-42: Josef von Arimathäa und Nikodemus bestatten Jesus als den König der Juden in einem neuen Grab in einem nahe gelegenen Garten
19,38 Danach bat Josef von Arimathäa,
der ein Jünger Jesu war,
doch heimlich, aus Furcht vor den Juden,
den Pilatus,
dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe.
Und Pilatus erlaubte es.
Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab.
19,39 Es kam aber auch Nikodemus,
der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war,
und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund.
19,40 Da nahmen sie den Leichnam Jesu
und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien,
wie die Juden zu begraben pflegen.
19,41 Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde,
ein Garten und im Garten ein neues Grab,
in das noch nie jemand gelegt worden war.
19,42 Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden,
weil das Grab nahe war.
[31. Januar 2023] Bevor sich Klaus Wengst (W539) mit den einzelnen Versen des Abschnitts 19,38-42 beschäftigt, in dem wie „in den synoptischen Evangelien … auch von Johannes die Passionsgeschichte mit dem Erzählen von Jesu Beisetzung abgeschlossen“ wird, zollt er den beiden hier agierenden Männern den ihnen gebührenden Respekt. Dem von den Synoptikern erwähnten „Josef von Arimatäa“, den Johannes (W539f.) „einen heimlichen Schüler Jesu nennt, der sich vor den führenden Juden fürchtet“, steht hier „die Gestalt des Nikodemus zur Seite“, der bereits zuvor im Johannesevangelium mehrfach aufgetreten ist. Obwohl die beiden zu denjenigen gehören, die „nach 12,42“ als „Bessergestellte, die an Jesus glaubten, kein offenes Bekenntnis“ wagten, wird ihr jetziges Verhalten
aber nicht negativ gewertet. Sie bezeugen mit ihrem Tun dem toten Jesus ihre Verehrung. Das führt sie nicht dazu, offen bekennende Schüler Jesu zu werden. In den Ostergeschichten werden sie nicht auftauchen; sie stoßen nicht zur Gemeinde hinzu. Auch Jesu Schüler fürchten sich vor den führenden Juden und halten sich deshalb hinter verschlossenen Türen auf (20,19). Aber Jesus tritt lebendig in ihre Mitte und sie empfangen die Geisteskraft des auferweckten Gekreuzigten (20,22), die sie Jesus als Herrn bekennen lässt (20,25.28). Das tun Josef und Nikodemus nicht. Sie machen sozusagen vor Ostern Halt. Aber sie erweisen dem toten Jesus die letzte Ehre und bezeugen so seinem Leben und Werk, wie sie es ohne die österliche Perspektive verstehen, ihren Respekt. Ihr Tun wird in der Darstellung des Johannes gewürdigt. Er kennt doch nicht nur das harte Entweder-Oder. Damit deutet sich eine andere Möglichkeit des Verhältnisses zwischen den an Jesus Glaubenden und den „anderen“ an, als sie Johannes sonst im Evangelium beschreibt.
Keinesfalls darf man also nach Wengst (Anm. 404) das Verhalten dieser beiden Männer in ähnlicher Weise negativ werten wie die Haltung der führenden Priesterschaft. Von einer inhaltlichen „Spannung“ zwischen „diesem Abschnitt und dem vorangehenden“ kann ebenfalls keine Rede sein, obwohl Haenchen, Brodie und Blank gegen Weiss <1402> diese Auffassung vertreten:
Haenchen meint: Das Fortschaffen „in V. 31 und dasselbe Verb in V. 38 vertragen sich nicht“. Vgl. auch Brodie: „Josef fährt damit fort zu tun, was die Juden bereits getan haben – die Erlaubnis von Pilatus zu erhalten, um den Leib fortzuschaffen (V. 31.38). Das Ergebnis ist ein offensichtlicher Widerspruch“. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Die bei Pilatus intervenierenden Oberpriester wollen, dass die Leichname von den Kreuzen verschwinden; Josef will den Leichnam Jesu, um ihn ehrenvoll zu bestatten. Dass er „mit seiner Bitte dann wohl zu spät gekommen (wäre)“ (so Blank), trifft ebenfalls nicht zu. Schon Weiss hat festgestellt, dass „nach dem Crurifragium doch noch das völlige Ableben der beiden Missethäter abgewartet werden musste“. Damit soll selbstverständlich nicht behauptet werden, dass die johanneische Erzählung den tatsächlichen historischen Ablauf wiedergäbe, sehr wohl aber, dass sie in sich stimmig ist.
Dass mit Vers 38 ein neuer Abschnitt beginnt, wird durch das Wort meta de tauta, „danach“, kenntlich gemacht:
Der schon eingetretene Tod Jesu ist festgestellt. Den beiden Mitgekreuzigten zerschlugen die Soldaten die Schenkel. Sie kommen fortan nicht mehr in den Blick. Wie sie von den Kreuzen fortgeschafft werden, interessiert Johannes nicht. Seine Erzählung ist nur darauf ausgerichtet, dass Jesus eine ehrenvolle Beisetzung zuteilwird. „Danach bat Josef aus Arimatäa […] Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe.“ In einer Parenthese charakterisiert Johannes diese Gestalt: „Der war ein Schüler Jesu, jedoch ein heimlicher aus Furcht vor den führenden Juden.“ Er erscheint damit als einer der Ratsherren von 12,42, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, aber aus Furcht vor der Distanzierung von der synagogalen Gemeinschaft kein offenes Bekenntnis wagten. Nun setzt er sich für den toten Jesus ein. Seine hohe Stellung ergibt sich auch daraus, dass er bei Pilatus vorsprechen kann, um den Leichnam Jesu abzunehmen. „Und Pilatus erlaubte es ihm. Er ging nun hin und nahm seinen Leib ab.“
Die Auslegung dieser Aussage durch Schenke <1403> beurteilt Wengst (Anm. 405) als „[a]ußerordentlich seltsam“:
„Gleichwohl handelt er im Interesse der gegnerischen Juden, denen daran liegt, daß um ihres Paschafestes willen das wahre Paschalamm verschwindet und die Erhöhung am Kreuz rückgängig gemacht wird.“
Deren Bitte von Vers 31 hatte sich aber „gleicherweise auf alle drei Gekreuzigten“ bezogen.
„Unvermittelt tritt“ nach Wengst in Vers 39 nun auch „Nikodemus in dieser Szene auf“, der der johanneischen „Leser- und Hörerschaft“ bereits bekannt ist (W540f.):
„Auch Nikodemus kam, der das erste Mal nachts zu ihm gekommen war.“ Mit dieser Erinnerung ist derselbe Zusammenhang noch einmal angesprochen, den schon die Erwähnung der heimlichen Schülerschaft Josefs aufgerufen hatte. Dass Johannes das dann erzählte gemeinsame Tun von Josef und Nikodemus kritisiere, lässt sich nicht erkennen. Wie sollte es auch negativ gewertet werden, dass sie den hingerichteten Jesus so ehrenvoll beisetzen?
Von dieser Einschätzung her überdenkt Wengst (W541) seine eigene kritische Sicht auf Nikodemus „bei der Auslegung von 3,1“ noch einmal neu, denn sie ist „nicht die einzig mögliche.“ Er erwägt, ob die Haltung des Nikodemus „durch die Trauer über den Fanatismus der Radikalen bestimmt sein“ könnte,
die alles und alle in sich ausschließende Alternativen zwingen wollen. Indem er sich der klaren Parteinahme verweigert, eröffnet sich ihm hier die Möglichkeit humanen Handelns, die anderen in solcher Situation verwehrt ist oder die sie nicht ergreifen wollen.
Allerdings meint Wengst nicht (Anm. 406), „dass das dritte Erscheinen dieser Gestalt im Evangelium die Frage lösen müsse, ob sie nun glaube oder nicht glaube.“
Nachdem Josef den Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen hat, kommt Nikodemus
„mit einer Mixtur aus Myrrhe und Aloe von ungefähr hundert Litra“ {vgl. 12,3}. Wie aus V. 40 hervorgeht, sind Myrrhe, ein Harz, und Aloe, ein Holz, in zerstampfter oder pulverisierter Form vorzustellen. Es handelt sich um außerordentlich wertvolle Duftstoffe, die hier in verschwenderisch großer Menge gebracht werden. Die Zusammenstellung von Myrrhe und Aloe kann Ps 45,9 einspielen – und damit wieder die königliche Dimension aufscheinen lassen -, wo es vom König heißt: „(Von) Myrrhe und Aloe, (von) Kassia (duften) alle deine Kleider.“
Dass Johannes (Anm. 409) „in dieser Weise … positiv noch einmal die königliche Dimension auch des hingerichteten Jesus betont“, liegt Wengst zufolge näher,
als dass er eine Bloßstellung des Nikodemus beabsichtige, wie Meeks <1404> meint. „Die lächerlichen ,hundert Pfund‘ Myrrhe und Aloe, die er für die Einbalsamierung mitbringt, sind ein deutlicher Hinweis darauf, daß er das ,Auffahren‘ des Menschensohns nicht verstanden hat“. Ähnlich Schenke [364]: „Der Leser dagegen weiß, daß der Aufwand, den Nikodemus treibt, gar nicht nötig ist. Er wird die Darstellung mit Befremden lesen, zumal er sich erinnert, daß Jesus bereits für den Tag seines Begräbnisses gesalbt wurde (12,7).“ Nach V. 40 lässt Johannes Nikodemus und Josef den Leichnam Jesu weder salben noch einbalsamieren. Er hat in seiner Darstellung nicht vergessen, dass das Salben Jesu für sein Begräbnis schon in 12,3 geschehen ist. Deshalb berichtet er hier nichts von dem, was nach mShab 23,5 <1405> unter den ersten Dingen bei der Versorgung eines Leichnams zu tun ist: Salben und Waschen.
Dass (W542) „die als Spezereien von Nikodemus mitgebrachte Mixtur nicht als Salbe oder Öl vorzustellen ist“, sondern als zwischen die Leichenbinden gestreutes Pulver, geht aus dem gemeinsamen Handeln von Josef aus Arimatäa und Nikodemus in Vers 40 hervor:
„Da nahmen sie den Leib Jesu und umwickelten ihn samt den Spezereien mit Leinenbinden, wie es bei jüdischen Bestattungen Brauch ist.“ … Die Kennzeichnung ihres Tuns als bei jüdischen Bestattungen üblicher Brauch bezieht sich selbstverständlich nicht auf die außerordentliche Menge der verwendeten Duftstoffe, vielleicht nicht einmal auf diese überhaupt – ihr Gebrauch wird ja vom jeweiligen Vermögen abhängen -, sicher aber auf das Einwickeln des Leichnams in Leinentücher. … So war auch in 11,44 der aus dem Grab kommende Lazarus als „umwickelt mit Tüchern an Füßen und Händen“ geschildert worden, dazu „sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden“.
Ein solches (Anm. 412) „Schweißtuch wird in 19,40 nicht erwähnt; es ist aber vorausgesetzt, wie dann 20,17 zeigt.“
Als Beisetzungsort (W542) erwähnt Johannes in Vers 41 „einen Garten“, womit „die Szene zwischen Mirjam aus Magdala und dem ‚Gärtner‘ in 20,14f. vorbereitet“ ist:
„An dem Ort, wo er gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten und im Garten ein neues Grab, in dem noch niemand beigesetzt war.“ … Die Beschreibung des Grabes als eines neuen und bisher nicht gebrauchten hebt die Besonderheit des Toten hervor, der jetzt in ihm beigesetzt werden soll.
Nachdem nun (W542f.) alle Voraussetzungen für „ein ehrenvolles Begräbnis“ geschildert sind, schließt Johannes in Vers 42
die Erzählung ab: „Dort nun setzten sie Jesus bei wegen des jüdischen Rüsttags, weil das Grab in der Nähe war.“ Dass dieses Grab Josef gehört, wird nicht gesagt. Wichtig ist allein seine Nähe. Sie macht es möglich, dass Jesus noch am Rüsttag beigesetzt werden kann. … Johannes erzählt nicht, dass das Grab mit einem Rollstein verschlossen wurde, setzt das aber nach 20,1 voraus.
Damit ist zwar dieser Abschnitt der Darstellung des Johannes beendet, aber nicht sein ganzes Evangelium (W543):
Mit der Darstellung des Begräbnisses endet üblicherweise die literarische Nachzeichnung des Lebens eines Menschen. In den Evangelien ist das anders. Es folgt noch ein Teil, der nicht ein Anhang ist, sondern der Zielpunkt der ganzen vorangehenden Darstellung, und der als solcher auch schon diese Darstellung bestimmt und ihr die Perspektive vorgegeben hat, stärker noch als in den anderen Evangelien. So folgen Erzählungen, die vom auferweckten Gekreuzigten Zeugnis geben.
Hartwig Thyen (T748) weist auf die „Szene des Begräbnisses Jesu durch Joseph von Arimathaia und Nikodemus“ mit den Worten hin, dass sie „mit ihrem Tun und den hundert Pfunden kostbarer Narde tatsächlich um ihn trauern, wie um einen einzigen Sohn, und klagen, wie um einen Erstgeborenen“. Den (T752f.) „aus den synoptischen Prätexten bekannten Joseph von Arimathaia“ führt der Erzähler in Vers 38
als einen ein, der aus Furcht vor den Juden verbirgt, daß er ein Jünger Jesu ist. (Derart furchtsame und sich ins Verborgene zurückziehende Jünger [kekrymmenoi mathētai] zum öffentlichen Bekenntnis zu Jesus, zu wechselseitiger Bruderliebe und zur offenen Teilnahme an der gemeinsamen Kultgemeinschaft zu ermutigen, erscheint uns als der Hauptzweck des ersten Johannesbriefes). Johannes folgt hier wieder der Markuskomposition …, doch er spielt intertextuell zugleich auch mit den synoptischen Parallelen. Denn während Markus unseren Joseph nur als einen ,angesehenen Ratsherrn‘ bezeichnet und erklärt, daß er das Gottesreich erwartet habe (15,43), und Lukas ihn wie Markus einen Ratsherrn (bouleutēs) nennt und hinzufügt, er sei ein guter und gerechter Mann gewesen (23,50), sagt nur Matthäus über diesen Joseph, den er als einen ,reichen Mann‘ und Besitzer jenes neuen Grabes bezeichnet (27,60), daß er zum Jünger Jesu geworden sei (hos kai autos emathēteuthē tō Iēsou: 27,57). Wie einst Tobias, der seine toten Brüder, die einfach hinter die Mauern Ninives geworfen worden waren, und auch die von Salmanassar Hingerichteten in Treue zur Tora begrub (Tob 1,17ff), so erbittet nun der fromme Arimathaier Joseph den Präfekten Pilatus um die Freigabe des Leichnams Jesu, damit er ihn begraben könne. Pilatus gewährte ihm die Bitte, und er ging hin und nahm Jesu Leichnam vom Kreuz ab (kai ēren to sōma autou).
Auch weiterhin geht Thyen davon aus (T753), dass „Johannes seinen potentiellen Lesern wohl“ zumutet, „sein intertextuelles Spiel mit Mt 27,57-61 zu durchschauen.“
Denn was Mt 27,61 explizit erklärt, daß nämlich Maria von Magdala und die andere Maria Zeuginnen der Grablegung Jesu waren und darum die Lage des Grabes kannten, das setzt Johannes offenbar stillschweigend voraus, wenn er sich die Magdalenerin dann in in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche zielsicher auf den Weg dorthin machen läßt. Sie findet aber den Verschlußstein des Grabes entfernt und das Grab leer. Da Johannes diesen Stein aber in seiner Bestattungs-Szene gar nicht erwähnt hat, setzt er auch hier voraus, daß seine Leser seine Prätexte kennen, nach denen Joseph die Grablegung Jesu damit beschließt, daß er das Felsengrab mit einem riesigen Stein verschließt (kai proskylisas lithon megan tē thyra tou mnēmeiou: Mt 27,60; vgl. Mk 15,46).
In Vers 39 erscheint der bereits mehrfach im Johannesevangelium erwähnte „Nikodemus zur Bestattung Jesu … und bringt zur Salbung des Leichnams Jesu ungefähr ,hundert Pfund‘ (hōs litras hekaton; das sind etwa 33 kg) eines kostbaren Gemischs aus Myrrhe und Aloe mit.“ Dazu betont Thyen, dass
jener erste Dialog mit Jesus wohl nicht unfruchtbar geblieben ist. Darum darf man wohl auch in Nikodemus einem heimlichen Jünger Jesu sehen; freilich einen, der, ebenso wie der Arimathaier Joseph, mit seinem Barmherzigkeitswerk des Begräbnisses Jesu gerade dabei ist, diesen Status der Heimlichkeit und der Furcht vor den Juden hinter sich zu lassen … So vertreten diese beiden gerechten Juden hier Jesu Jünger, die sich jetzt, als wären sie nun ,heimliche Jünger‘, aus Furcht vor den Juden irgendwo hinter verschlossenen Türen verschanzt haben (20,19). Daß die exorbitante Menge des kostbaren Salböls dagegen Ausdruck vermeintlicher johanneischer Ironie wäre und Nikodemus als einen darstellen wollte, für den mit dem Tode alles aus ist, ist dem Text nicht zu entnehmen.
In diesem Zusammenhang zitiert Thyen ablehnend dieselben Stellen von Meeks und Schenke wie Wengst und fügt hinzu (T754):
Doch was diese Ausleger Nikodemus ankreiden, das muß dann ja wohl auch und erst recht von Jesu Jüngern gelten, die doch erst im Licht der Begegnung mit dem Auferstandenen und unter der Gabe des österlichen Geistes begreifen werden, was hier geschah! Zudem ist dieses Bild von Nikodemus schon darum unglaubhaft, weil der doch gleich bei seinem ersten nächtlichen Auftreten als ein anthrōpos ek tōn Pharisaiōn vorgestellt worden war (3,1). Und daß in der Glaubenswelt der Pharisäer, im Gegensatz zu derjenigen der Sadduzäer, die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten eine zentrale Rolle spielt, ist doch bekannt (vgl. Mk 12,18ff par. und die Kommentare dazu). Eher weisen das hier geschilderte Begräbnis Jesu und die Menge des Salböls sowie das neue Grab im Garten, in dem noch kein Toter jemals gelegen hatte (vgl. Lk 23.53!), im Blick auf den Kontext doch darauf hin, daß hier tatsächlich der „König der Juden“ bestattet wird, und daß Joseph und Nikodemus hier stellvertretend für „alle Bewohner Jerusalems“ um den „Durchbohrten trauern, wie um einen einzigen Sohn und den Erstgeborenen“ (Sach 12,10ff).
In Vers 40 wird nach Thyen beschrieben, dass Joseph und Nikodemus nun vollenden, was Maria bei der Salbung in Bethanien (12,7) bereits vorwegnehmend getan hat:
Wie es jüdischer Begräbnissitte entspricht (kathōs ethos estin tois Ioudaiois entaphiazein) umwickeln Joseph und Nikodemus nun den Leichnam Jesu mit Leinenbinden samt den Aromen (othoniois meta tōn arōmatōn). entaphiazein heißt: einen Leichnam für die Bestattung bereiten.
Die Menge des von Maria verwendeten (und in den Augen von Judas verschwendeten) Salböls wird durch die beiden Männer noch einmal ins Unermessliche gesteigert:
Statt einer Litra, deren Wert Judas auf dreihundert Denare schätzte, verwenden sie nun deren hundert! Und wenn schon der Duft der einen Litra des Salböls das ganze Haus erfüllte (12,3), wie müssen dann die Hundert das Grab erfüllt haben! Wie die immense Menge des Weins bei der Kanahochzeit, die Speisung der Fünftausend oder die 153 großen Fische (21,11), so ist auch diese Menge der Gewürzmischung ein Zeichen der messianischen Fülle …
Abwegig erscheint Thyen angesichts der „fiktionalen Szene“ der Versuch, „genauer zu ergründen“, ob eine „pulverisierte Substanz aus Myrrhenharz und Aloe vera zwischen die Grabbinden gestreut worden sei“; stattdessen stimmt er „Wengsts Erwägung“ zu, „daß die Zusammenstellung von Myrrhe und Aloe ein intertextuelles Spiel mit Ps 45,9 sein könnte, wo vom König gesagt wird; vor seinen Genossen habe JHWH ihn mit Freudenöl gesalbt, Myrrhe, Aloe und Kassia seien alle seine Gewänder“ (siehe oben). Entgegen (T754f.) der schroffen Erklärung von Haenchen [556]: „Der Schreiber dieses Verses kannte weder die jüdischen Bestattungssitten, noch wußte er über das Einbalsamieren Bescheid“, betont Thyen, dass Johannes über „die gründliche rituelle Waschung des Leichnams“ sicher Bescheid wusste (T755), worauf „die dafür eintretende merkwürdige Waschung der Füße Jesu durch die bethanische Maria (12,3)“ hindeutet. Am Ende von Kapitel 19 wird
aber nur das Außergewöhnliche dieser Bestattung des messianischen Königs [erzählt]. … Denn wenn hier nicht Irgendeiner, sondern ein König bestattet wird, dann sollte man auf entsprechende Texte schauen, wie den über die Bestattung des Königs Asa von Juda (2Chr 16,14) oder über die Herodes des Großen (Josephus, Ant XVII, 199 {vgl. Ant. 17,8,3 nach H. Clementz}).
Zum Stichwort othonion {Leinentuch}, dass außer in Vers 40 und in „den darauf bezogenen Versen 20,5.6 u. 7 … im Neuen Testament nur noch in Lk 24,12“ erscheint, hebt Thyen hervor:
Da wir die Szene vom Wettlauf des Petrus und des geliebten Jüngers (20,3-10), wie unten zu begründen ist, für ein intertextuelles Spiel mit Lk 24,12 halten, dürfte auch das Lexem othonion aus diesem Vers stammen. Die gleiche Art der Bereitung eines Leichnams zur Bestattung zeigt auch die Lazaruserzählung. … Anstelle des Plurals othonia gebraucht Johannes hier den für derartige Totenbinden gebräuchlicheren Plural von keiria.
Anders als Wengst geht Thyen davon aus, dass „es sich bei dem von Nikodemus mitgebrachten Gemisch von Myrrhe und Aloe wohl um Salböl handeln wird“ und nicht um Pulver, was „dessen Bezeichnung als arōmata“ nahelegt:
Nach Mk 16,1 hatten die Frauen derartige arōmata gekauft, um Jesu Leichnam damit früh am Ostermorgen zu salben: ēgorasan arōmata hina elthousai aleipsōsin auton. Sie kamen aber zu spät und fanden Jesus nicht mehr in seinem Grabe. Darum läßt Johannes Joseph und Nikodemus diese Salbung zur rechten Zeit durchführen. Endlich erinnert der V. 42 noch einmal daran, daß Jesu Bestattung in unmittelbarer Nähe der Stätte seiner Kreuzigung erfolgen mußte, weil sich mit dem Untergang der Sonne der Tag der Bereitung auf Passamahl und -fest seinem Ende neigte. Und weil die Nacht des Passamahles und der erste Passatag in jenem Jahr auf einen Sabbat fiel, stand ein ganz besonderes Passa vor der Tür.
Ton Veerkamp <1406> findet in der Darstellung der Bestattung Jesu in 19,38-42 zwei Umstände der besonderen Hervorhebung wert, erstens die Art, wie die römische Weltordnung gewöhnlich mit einem Gekreuzigten umging, und zweitens das Stichwort der „Furcht vor den Judäern“, phobos tōn Iouaiōn:
Wenn Rom sich eines Menschen bemächtigt, um ihn hinzurichten, gehört ihm dieser Mensch auch noch nach dessen Tod. Der Akt der Pietät einem Verstorbenen gegenüber war in der Antike unbedingte Pflicht. Diese Pietät wurde einem Hingerichteten verweigert; er wurde buchstäblich als ein Stück Dreck entsorgt. Der Schüler mit dem Namen Joseph aus dem Ort Ramatajim wollte zumindest das verhindern.
Es handelt sich um einen „verborgenen Schüler“. Grund war „die Furcht vor den Judäern“. Den Ausdruck hörten wir schon in 7,13, wo man sich nicht traute, öffentlich über den Messias Jesus zu reden. Zwei Tage nach dem Tod und der Grablegung werden wir die Schüler in einem Raum antreffen, der „aus Furcht vor den Judäern“ verschlossen war. Die messianische Gemeinde des Johannes konnte sich keine Situation vorstellen, in der man Schüler des Messias Jesus sein konnte, ohne Furcht vor den Judäern haben zu müssen. Bei Johannes sind alle Schüler verborgene Schüler. Das Wort phobos, Furcht, gibt es bei Johannes nur in Verbindung mit den Judäern. Zum zweiten Mal hören wir „Furcht vor den Judäern“, zum dritten Mal begegnet uns Nikodemus, der Prototyp des verborgenen Schülers. Das ganze Begräbnis ist von dieser Furcht bestimmt.
Auch Veerkamp verweist auf den Zusammenhang der für die Beisetzung Jesu verwendeten Duftstoffe mit der Erzählung von der Salbung Jesu durch Maria von Bethanien:
Sie wickelten die Leiche Jesu sorgfältig in Tüchern ein, zusammen mit „an die hundert Pfund Myrrhe und Aloe“. Die ungewöhnlich große Menge der Balsamkräuter korrespondiert mit dem „sehr wertvollen Pfund Nardebalsam“, den Maria, die Schwester des Lazarus, für die vorweggenommene Beerdigung Jesu verwendete, 12,3ff. Die Ausstattung des Begräbnisses Jesu ist die Ausstattung beim Begräbnis eines Königs.
Schließlich betont Veerkamp, dass Jesus „nach dem Brauch der Judäer“ bestattet wurde und „noch in seinem Tod … ein Kind Israels“ blieb, und er weist darauf hin, dass sich das nun zu Ende erzählte Geschehen am Rüsttag des Passafestes zwischen zwei besonderen Gärten abgespielt hat, während das Passafest der Judäer unerwähnt bleibt:
Da wegen der vorgerückten Stunde Eile geboten war – der große Schabbat des Paschafestes, das in jenem Jahr mit einem gewöhnlichen Schabbat zusammenfiel, fing mit Sonnenuntergang am Tag der Vorbereitung an -, wurde Jesus in einem neuen Grab in einem Garten in der Nähe beigesetzt. Zwischen beiden Gärten, dem Garten des Verrats und dem Garten des Grabes, vollzog sich das dramatische Geschehen am ˁerev pascha, der paraskeuē jenes Paschafestes. An diesem „Pascha der Judäer“ geht Johannes schweigend vorbei. Zurück bleibt die Leiche, in Tücher gewickelt.
↑ „Tag eins“ der neuen Schöpfung (Johannes 20,1-31)
[7. Februar 2023] Nachdem er die Beisetzung Jesu als des Königs der Judäer erzählt hat, beginnt Johannes das Kapitel 20, das „aus vier Erzählungen und einem Schlusswort“ besteht, mit einer weiteren Zeitangabe, die nach Ton Veerkamp <1407> „mit einer ausführlichen sprachlichen Darstellung“ zu erläutern ist:
Die hebräische Sprache unterscheidet zwischen der Ordinalzahl rischon („erst“) und der Kardinalzahl ˀechad („eins“); bei der Zahl 1 hat die Kardinalzahl eine andere Wurzel als die Ordinalzahl. <1408> Der hebräische Text der Schrift schreibt in speziellen Fällen die Kardinalzahl, wo wir eine Ordinalzahl erwarten würden, z.B. bei der Angabe für die Tagzahl eines Monats: „Es geschah im dreißigsten Jahr, im vierten [Monat] am fünf[ten] des Monats.“ Die Wochentage werden mit normalen Ordinalzahlen angegeben.
Für die Zeitangabe in Johannes 20,1 ist ein bestimmter biblischer Hintergrund von wesentlicher Bedeutung, nämlich die „Erzählung über die Schöpfung von Himmel und Erde“, die gerade nicht, wie es in der Lutherbibel oder der katholischen Einheitsübersetzung heißt, auf den „erste[n] Tag“ der Schöpfung hinausläuft:
<Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.
Und die Erde war Irrsal-und-Wirrsal <1409> geworden,
Finsternis über der Fläche des Chaos,
Sturmwind brauste über der Fläche des Chaos.
Gott sprach:
Es werde Licht.
Gott sah das Licht – dass es gut war –
Und Gott trennte zwischen dem Licht und der Finsternis.
Gott rief dem Licht zu: Tag.
Der Finsternis rief er zu: Nacht.
Es wurde Abend, es wurde Morgen:
Tag eins (jom ˀechad).Die weiteren Schöpfungstage werden mit Ordinalzahlen gekennzeichnet: jom scheni, jom schlischi, jom reviˁi usw. Der erste Tag ist aber nicht „erster Tag“, jom rischon, sondern „Tag eins“, jom ˀechad. Die griechische Übersetzung hat sich dieser Anomalie angeschlossen. Auch sie zählt hemera mia (nicht wie üblich prōtē), dann wie üblich weiter hēmera deutera, hēmera tritē, hēmera tetartē usw. Nicht anders die Vulgata: dies unus (nicht, wie üblich, primus), dies secundus, dies tertius, dies quartus usw. Im berühmten Torakommentar des Rabbi Salomo ben Isaak, genannt Raschi, aus dem späten 11. Jahrhundert lesen wir:
jom ˀechad (eins). Nach der gewöhnlichen Sprachordnung in diesem Kapitel hätte man schreiben müssen: jom rischon (erster). Warum wird ˀechad, eins, geschrieben? Das ist deswegen geschehen, dass der Heilige, gesegnet sei Er, allein (jachid) in seiner Welt war, weil die Engel nicht vor dem zweiten Tag geschaffen wurden, wie in Bereschit Rabba [eine Midraschsammlung aus dem 5. Jahrhundert – T. V.] erklärt wurde.“ <1410>
Man muss dieser Erklärung nicht beipflichten, aber das Problem wurde bereits früh gesehen. Alle wichtigen Übersetzungen aus der spätklassischen Zeit haben die Anomalie stehenlassen. <1411>
Weiter hat nach Veerkamp nicht erst Johannes, sondern es haben alle Evangelien
für den Tag nach dem Pascha-Schabbat, an dem Jesus im Grabe war, diesen theologischen Sprachgebrauch von Genesis 1 übernommen. Wie bei der Schöpfung der Tag der Schöpfung des Lichtes nicht nur ein „erster“ Tag in einer Reihe von ähnlichen Tagen war, sondern ein Tag, der Voraussetzung für alle kommenden Tage ist, so ist für alle messianischen Gemeinden der Tag nach jenem großen Schabbat nicht nur ein „erster“ Tag einer neuen Woche, sondern Voraussetzung für alle kommenden Tage. Unsere Übersetzungen müssen diesem Umstand Rechnung tragen. Wie der Tag der Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis alle kommenden Unterscheidungen, etwa Himmel/Erde, Meer/Trocknes, normiert, so normiert der Tag eins der Schabbatwoche das ganze Leben aller Schüler Jesu.
Die Übersetzungen, die uns geläufig sind, übersetzen tē mia tōn sabbatōn mit „am ersten Tag der Woche“. Sachlich ist das auf den ersten Blick korrekt. Der „große Schabbat“ – das Pessach der Judäer – wird übersprungen, es beginnt eine neue Woche. Dass wir es mit einem absolut neuen Tag zu tun haben, zeigt der Ausdruck mia tōn sabbatōn. Nun ist mia die weibliche Form einer Kardinalzahl. Die Ordinalzahl würde prōtē lauten.
Mit seiner Zeitangabe befindet sich Johannes mitten im Mainstream des Messianismus. Wie die anderen Evangelisten überspringt auch Johannes den großen Schabbat. Er wird nicht gefeiert.
Veerkamp verwahrt sich aber mit guten Gründen gegen eine antijüdische Schlussfolgerung aus dieser Auslegung:
Das große Schweigen am Schabbat bedeutet keine Abwertung des Pessachfestes. Vielmehr ist und bleibt das Fest der Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus das Fundament. Israel ist aber, so sagen alle messianischen Gemeinden, heute im Sklavenhaus. Es muss noch einmal – und diesmal definitiv – befreit werden.
Diese definitive Befreiung wird am Tag eins der Schabbatwoche offenbar, wie diejenigen meinen, die in Jesus den Messias Israels sahen, sozusagen eine neue Zeitrechnung. Das ist durchaus in Übereinstimmung mit dem TeNaK. Auch das Buch Jeremia kannte das Überbieten des Pessachfestes, 23,7f. Paulus redet in 2 Korinther 5,17 von neuer Schöpfung (kaine ktisis, beria chadascha). Man muss Johannes 20 und Genesis 1 zusammenlesen.
Von vornherein betrachtet Ton Veerkamp also das, was wir Christen gewohnt sind, als Ostergeschichten zu verstehen, vor dem Horizont der jüdisch-messianischen Erwartung einer weltweiten Befreiung Israels von der versklavenden Weltordnung, die auf Israel und den anderen von ihr unterworfenen Völkern lastet. Diese Befreiung wird mit dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten möglich!
Klaus Wengst (W543) sieht die „Erzählungen, die den gekreuzigten Jesus als auferweckten und also lebendigen erkennen lassen“ und die „den zweiten Teil des Evangeliums“ beschließen, „vom Vorangehenden durch die Zeitangabe in 20,1“ abgegrenzt, „die mehr als einen ganzen Tag Zwischenraum voraussetzt“, aber der besonderen „Ausdrucksweise im griechischen Text“ misst er keine inhaltliche Bedeutsamkeit bei, obwohl er andeutet (W545, Anm. 417), dass sie „ganz und gar vom hebräisch-aramäischen Sprachhintergrund geprägt“ ist und der „Wendung: ‚am (Tag) eins des Schabbat‘“ entspricht. <1412>
Wengst betont zur „Ostergeschichte bei Johannes“ zunächst, dass sie „keine starken Berührungen mit den synoptischen Evangelien“ hat, sondern
in großer Eigenständigkeit ausgeprägt ist. Sie besteht aus vier Erzählungen, die aber nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern eine profilierte Einheit bilden:
- Mirjam aus Magdala und die beiden Schüler am leeren Grab (V. 1-10)
- Die Begegnung Jesu mit Mirjam aus Magdala (V. 11-18)
- Die Begegnung Jesu mit seinen Schülern (V. 19-23)
- Die Begegnung Jesu mit Thomas (V. 24-29)
Zu den zeitlichen und örtlichen Beziehungen dieser Erzählungen zueinander stellt Wengst einen „engen Zusammenhang“ fest (W543f.):
Zeitlich sind sie einander so zugeordnet, dass die erste auf den frühen Morgen des ersten Wochentages gelegt ist, die zweite sich unmittelbar anschließt. Die dritte spielt gegen Abend desselben Tages, die vierte genau eine Woche später. Örtlich erfolgt in den ersten ein doppelter Wechsel zwischen dem Grab und dem Aufenthaltsort der Schüler. Die zweite ist am Grab lokalisiert, die dritte und vierte im Versammlungsraum der Schüler.
Als inhaltlichen Schwerpunkt dieser Erzählungen bezeichnet Wengst recht allgemein das Thema „Zeugnis und Glaube“. Diesen Glauben bezieht er auf den aus dem Tode erweckten gekreuzigten Jesus, ohne ihn in den Zusammenhang einer übergreifenden Perspektive für Israel oder die Schöpfung zu stellen:
Bei der Entdeckung des leeren Grabes heißt es nur von dem Schüler, den Jesus liebte, dass er glaubte. Aber dieser Glaube bleibt folgenlos. Sowohl von ihm als auch von Simon Petrus sagt der Schluss dieser Erzählung: „Also gingen die Schüler wieder zu sich zurück“ (V. 10). In der Erzählung von der Begegnung Jesu mit Mirjam aus Magdala im Garten lernt sie, dass sie ihn so, wie sie ihn kannte loslassen muss, um seine Gegenwart neu zu erfahren. Sie erhält einen Auftrag gegenüber den Schülern und bezeugt ihnen: „Ich habe den Herrn gesehen.“ In der dritten Erzählung, der Erscheinung Jesu vor den Schülern, werden auch sie beauftragt und gesandt sowie mit der Geisteskraft ausgestattet, um so Zeugen Jesu zu sein. Dass für Johannes der Glaube an den auferweckten Gekreuzigten das übergreifende Thema in diesem Teil ist, zeigt die vierte Erzählung. Wie Mirjam es ihnen gegenüber getan hat, so bezeugen die anderen Schüler gegenüber Thomas, der am Osterabend nicht anwesend war: „Wir haben den Herrn gesehen.“ Thomas aber findet erst zum Bekenntnis, als er von Jesus selbst zum Glauben gebracht wird. Dessen letztes Wort jedoch gilt den Glaubenden jenseits der hier vorgestellten Situation, den Glaubenden zur Zeit des Johannes, für die er sein Evangelium schreibt: „Glücklich, die nicht gesehen haben und doch zum Glauben kommen!“ (V. 29)
Bei Hartwig Thyen (T757) findet sich vor seiner Auslegung der Ostererzählungen keine Einleitung, die sich auf das gesamte Kapitel 20 beziehen würde. Lediglich zu den Versen 20,1-18 hält er es für angebracht, unter Berufung auf Frans Neirynck <1413> „alle literarkritisch orientierten Versuche“ zurückzuweisen,
hinter diesem Text von den Synoptikern unterschiedene und von ihnen unabhängige Quellen zu eruieren, die der Evangelist – und/oder ein sein Evangelium nachträglich bearbeitender Redaktor – seinem Werk einverleibt haben soll. Da wir Neiryncks glänzende Analyse hier nicht wiederholen wollen, fassen wir nur ihre wichtigsten Resultate zusammen. (1) „Die knappe Christophanie-Erzählung bei Matthäus (Mt 28,8-10) ist kein Traditionsstück, das der Evangelist vorgefunden und mit seiner Bearbeitung von Mk 16,1-8 nur verbunden hätte, sondern ganz und gar seine eigene Invention. Denn inhaltlich sagt sie der vorausgehenden Angelophanie gegenüber nichts Neues, zu deutlich ist die Hand des ersten Evangelisten in ihr erkennbar, und es ist kaum vorstellbar, daß sie je für sich tradiert wurde. (2) Lukas 24,12, gerade in der diesem Vers eigenen, gleichsam schwebenden Position im Kontext, ist ein textkritisch gesicherter Bestandteil des Lukasevangeliums (vgl. Lk 24,24!). Mit diesen beiden Stellen in ihren jeweiligen Kontexten (!) ist das Material genannt, aus dem Joh 20,1-18 gebaut ist. Da beide Stellen redaktionelle Bildungen ihres jeweiligen Evangelisten sind, ist deutlich, daß Johannes intertextuell mit unseren kanonischen Evangelien spielt und nicht etwa mit deren vermeintlichen Quellen oder Traditionen. Außer diesen synoptischen Texten noch irgendwelche anderen Quellen für Joh 20,1-18 anzunehmen, ist nicht nötig und daher nach dem Gesetz, das äußerste Sparsamkeit im Gebrauch von Hypothesen verlangt, auch nicht zulässig.
Auf die Besonderheit der Zeitangabe tē de mia tōn sabbatōn {aber am [Tag] eins der Sabbatwoche} (Johannes 20,1) mit ihrem Anklang an die Formulierung hēmera mia {Tag eins} der Schöpfungserzählung (1. Mose 1,5) geht Thyen mit keinem Wort ein; er würdigt sie nicht einmal als gliederndes Element der Erzählung und spricht einfach von „der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche“, in der sich „die Magdalenerin“ auf den Weg zum Grab Jesu macht.
↑ Johannes 20,1-2: Maria Magdalena findet an „Tag eins“ den Stein von Jesu Grab weggenommen und informiert Petrus und den geliebten Schüler
20,1 Am ersten Tag der Woche
kommt Maria Magdalena früh,
als es noch finster war, zum Grab
und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war.
20,2 Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus
und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte,
und spricht zu ihnen:
Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab,
und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
[8. Februar 2023] Klaus Wengst (W544) beurteilt die „erste von vier Ostererzählungen“ in Johannes 20,1-10 als „ein eigenartiges Vorspiel“, das „keinen Fortschritt erkennen“ lässt (W544f.):
Denn die zweite Erzählung beginnt wieder mit genau der Szenerie, die in der ersten schon im ersten Vers erreicht war: mit Miriam aus Magdala am Grab Jesu. Dass das Grab leer sei, ist dort nur Annahme, aber durch den Fortgang der Erzählung gesichert. Deutlich wird auch, dass das Grab nicht deshalb leer ist, weil es einen Leichenraub gegeben hätte. Als zutreffende Antwort auf das Phänomen des leeren Grabes scheint kurz der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten auf. Das alles lässt Johannes erkennen, indem er vom Laufen zweier Schüler zum Grab und dessen Inspektion durch sie berichtet. Sie erscheinen dabei in einer gewissen Konkurrenz – und reden kein Wort miteinander und reden auch nicht danach. Das macht ihren Besuch beim Grab völlig folgenlos. Dadurch wird diese Erzählung zum Vorspiel, das nach Fortsetzung verlangt.
Trotzdem will Wengst (W545) dieses „Vorspiel … als Teil des Gesamtzusammenhangs von Kap. 20“ und als „von Johannes so gewollte Einheit“ auslegen und nicht, wie viele Ausleger es tun, „von seiner vermuteten Entstehungsgeschichte her“ zu erklären versuchen, denn (Anm. 416) „Letzteres führt nur allzu leicht dazu, Textphänomene unterschiedlichen Ebenen zuzuweisen und nicht nach ihrem Verständnis im gegebenen Zusammenhang zu fragen.“
Zur Zeitangabe in Vers 1 ist in der Einleitung zu Kapitel 20 schon viel gesagt worden. Wengst hebt hervor (W545), dass zuletzt „in 19,42 der zu Ende gehende Rüsttag genannt“ wurde und dass der „Sabbat, in jenem Jahr zugleich der erste Festtag von Pessach“, mit Schweigen übergangen wird:
Nun heißt es: „Am ersten Wochentag kam Mirjam aus Magdala frühmorgens […] zum Grab.“ In 19,25 hat Johannes sie als eine der Frauen beim Kreuz Jesu angeführt. Nun wird er mehr über sie erzählen. Ein Motiv dafür, weshalb sie zum Grab geht, nennt er nicht. Es ergibt sich aus dem Anfang der zweiten Erzählung: Sie sucht den Ort auf, an dem Jesus beigesetzt ist, um dort ihre Trauer festzumachen. Dem entspricht die Näherbestimmung der Zeit am frühen Morgen: „als es noch dunkel war“. In Mk 16,2 dagegen heißt es: „als die Sonne aufging“. Dort wird damit sozusagen schon das Osterlicht angedeutet. Bei Johannes bricht es an dieser Stelle noch nicht durch. Die Wahrnehmung dessen, dass das Grab leer ist, belässt Mirjam aus Magdala im Dunkeln; erst Jesus selbst wird ihre Trauer wenden (V. 16).
Anders als (Anm. 418) nach Markus 16,1 und Lukas 24,1 kommt Maria Magdalena also nicht gemeinsam mit anderen Frauen zum Grab, um „Jesu Leichnam zu salben“. Nach Johannes ist Jesus ja „schon in 12,3 für sein Begräbnis gesalbt und nach 19,39f. sein Leichnam reichlich mit Duftstoffen versehen worden.“
Als Maria nun den „Stein, der das Grab verschloss und der bei der Beisetzung nicht eigens erwähnt wurde, ‚vom Grab weggenommen‘“ sieht, wird ihr das nach Vers 2,
ohne das Grab selbst in Augenschein genommen zu haben, zum Anlass, sofort einen Schluss daraus zu ziehen und entsprechend zu reagieren: „Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Schüler, den Jesus liebte, und sagte ihnen: ,Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo man ihn beigesetzt hat.‘“ Die Wahrnehmung, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt ist, lässt sie also sogleich wieder in Eile vom Grab aufbrechen und Schüler Jesu aufsuchen, und zwar Simon Petrus und den nicht mit Namen Genannten, „den Jesus liebte“.
In der (W546) auffälligen Wiederholung der Präposition: Sie „kam zu Simon Petrus und zu dem Schüler, den Jesus liebte“, sieht Wengst unter Berufung auf Brodie <1414> einen Hinweis darauf, dass die beiden Schüler erst „durch Mirjam aus Magdala zusammengebracht“ werden:
Wie beim ersten Auftreten des Schülers, den Jesus liebte (13,23-26) stehen sich damit dieser Schüler und Simon Petrus gegenüber. Wie dort werden sie im Folgenden in eine eigenartige Beziehung zueinander gesetzt. Dass dem Petrus eine besondere Stellung vorgegeben ist, war schon bei seiner ersten Erwähnung im Evangelium deutlich (1,40-42), aber auch, dass Johannes dessen Stellung einebnet und diesen Schüler in die Gemeinschaft der Schüler Jesu einordnet. Ein deutlicher Kontrast zwischen beiden Schülern ergibt sich, wenn beachtet wird, was er jeweils zuletzt über sie im Evangelium erzählt hat. Während Simon Petrus, nach 18,25-27 Jesus zum zweiten und dritten Mal verleugnete, erfüllte der andere nach 19,26f. vom Kreuz Jesu her dessen Vermächtnis.
Was nun „Mirjam aus Magdala“ den beiden Schülern mitteilt, ist zunächst das, „was sie als feste Annahme aus ihrer Beobachtung schließt: ‚Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen.‘“ Ihre Annahme (Anm. 420) „dass das Grab leer sei“, lässt sie also „hier nicht auf die Auferweckung Jesu“ schließen,
sondern darauf, dass sein Leichnam entfernt wurde. Das war auch die These Außenstehender, und zwar in der Zuspitzung, die Schüler Jesu hätten seinen Leichnam weggebracht. Sie findet sich zuerst Mt 27,64; 28,11-15. Demgegenüber wird hier dargestellt, eine Anhängerin Jesu hätte zunächst selbst angenommen, der Leichnam sei aus dem Grab entfernt worden.
Wengst nimmt daher an, dass „in dieser Erzählung auch eine apologetische Dimension“, nämlich die der Verteidigung gegen Argumente von Außenstehenden, mitschwingt. Unbestimmt bleibt (W545), wer den „Leichnam Jesu aus dem Grab entfernt“ haben könnte.
„Auffällig“ findet es Wengst, dass Maria
jetzt schon – und nicht erst in 20,18 – von Jesus als „dem Herrn“ spricht. Das geschah im Evangelium bisher nur in 6,23 und 11,2 in bestimmten Zusammenhängen. In den Ostergeschichten wird das nun öfter der Fall sein. In ihnen ist „dieser Titel mit einer besonderen Aura umgeben; es herrscht eine eigenartige Schwebe zwischen Vertrautheit und Distanz, eine gleichsam feierliche Verlegenheit. Der Auferstandene gehört von Anfang an nicht mehr zu ‚dieser Welt‘.“
Mit dem zuletzt angeführten Zitat von Blank <1415> deutet Wengst ein Verständnis von Jesu Auferstehung an, das in seinem Übergang in eine jenseitige Wirklichkeit besteht, womit zugleich eine Definition von kosmos {Welt} vorausgesetzt ist, die „diese Welt“ als diesseitige Wirklichkeit von einer jenseitigen unterscheidet.
Indem Johannes Mirjam aus Magdala schon hier von Jesus als „dem Herrn“ reden lässt, deutet er für seine Leser- und Hörerschaft an, dass die getroffene Annahme falsch ist: Wie sollte man „den Herrn“ wegnehmen können?
Der zweite Satz, den Maria den beiden Schülern gegenüber ausspricht, ergibt sich für sie „als Effekt“ aus „der Annahme der Entfernung des Leichnams Jesu aus dem Grab“:
„Und wir wissen nicht, wo man ihn beigesetzt hat.“ Anders als gegenüber den beiden Fremden in V. 13 schließt sie sich in dem „Wir“ mit den beiden Schülern als Mitbetroffenen zusammen.
Die Erklärung des Plurals ouk oidamen {wir wissen nicht} erscheint aber im Zuge ihrer Information der Schüler wenig plausibel. Wenn sie deren Nichtwissen, wo Jesu Leichnam ist, bereits voraussetzt, müsste sie es gar nicht erwähnen. Da sie ihnen gegenüber aber das Nichtwissen eines „Wir“ erwähnt, müssen damit andere Personen gemeint sein. Wengst schließt aber eine solche Auslegung aus (Anm. 422). Der älteren Exegese, die wie Weiss <1416> „in dem von Mirjam gebrauchten Plural“ zu erkennen meinte, „dass sie ihre (nicht erwähnten) Begleiterinnen einschliesst“, hält er vor, dass sie „auf historische Harmonisierung mit den synoptischen Evangelien“ bedacht war, für „[k]einen Deut besser als diese ‚konservative‘ Exegese“ hält er aber
die „kritische“, die den Plural traditions- oder literarkritisch von daher erklärt, dass in der vom Evangelisten benutzten Fassung der Geschichte von einer Mehrzahl von Frauen die Rede war. <1417> Man traut ihm zu, dass er zwar bewusst die Anzahl der Frauen auf eine reduziert, dann aber sofort bewusstlos einen Plural stehen lässt – und das bei einem Satz, der nicht einmal als Tradition beweisbar ist. Beiden Zugangsweisen ist gemeinsam, dass sie die besondere Form des vorliegenden Textes als vom Verfasser gewollte nicht ernst nehmen, sondern es besser wissen. Nicht überzeugend empfinde ich auch Thyens {T757} Ausführungen, wenn er aufgrund der Voraussetzung des „intertextuellen Spiels“ mit den Synoptikern meint, dass einerseits „Maria allein hier die Frauen vertreten (muß), die am Ostermorgen das Grab Jesu besuchten (Mk 16,1ff parr.)“, und dann andererseits „der Erzähler seine Zuhörer hier durch den unvermittelten Pluralgebrauch im Munde Marias (daran erinnert)“.
Den drei Anliegen von Wengst ist zwar zuzustimmen: Weder kann es darum gehen, die vier Evangelien historisch zu harmonisieren, noch die literarischen Fähigkeiten des vierten Evangelisten herabzusetzen, vielmehr ist der Text in der Weise ernst zu nehmen, wie er ihn gestaltet hat. Aber gerade deswegen ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass Johannes sehr bewusst sich sowohl auf die eine Zeugin Maria Magdalena am Grab Jesu konzentriert als auch daran erinnert, dass nach anderen Auferstehungsberichten weitere Frauen an diesem Zeugnis beteiligt waren.
Als Begründung dafür verweist Hartwig Thyen darauf (T757), dass Johannes in Johannes 20,1-18 wie auch „sonst oft … eine namentlich genannte Einzelperson zur Antagonistin“ macht,
jetzt also Maria von Magdala, die der Leser ja schon von der Szene unter dem Kreuz Jesu kennt; vgl. das Auftreten von Nikodemus, Malchus und nachher von Thomas (20,24ff), der die Zweifler: hoi de edistasan, von Mt 28,17 repräsentiert. So muß auch Maria allein hier die Frauen vertreten, die am Ostermorgen das Grab Jesu besuchten (Mk 16,1ff parr.). Daran erinnert der Erzähler seine Zuhörer hier durch den unvermittelten Pluralgebrauch im Munde Marias, als sie Petrus und dem Jünger berichtet: „Sie haben den Herrn aus dem Grab weggebracht, und wir (!) wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben“.
Weiter argumentiert Thyen, wie von Wengst erwähnt, mit seiner Vermutung, dass bereits
die Beerdigungs-Szene als intertextuelles Spiel mit Mt 27,57-61 verstanden sein will. Matthäus nennt da in V. 61 ausdrücklich die beiden Marien als Augenzeuginnen der Grablegung und damit als Kennerinnen der Lage des Grabes Jesu. Die Kenntnis dieses Berichts setzt Johannes bei seinen Lesern wohl voraus, denn nur, wenn sie weiß, wo das Grab Jesu zu finden ist, kann Maria sich in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, als es noch finster war, zielsicher auf den Weg dorthin machen. Und weil Johannes sich die Magdalenerin offenbar auch als Zeugin der üppigen Salbung des Leichnams Jesu durch Joseph und Nikodemus vorstellt, kann er die vergebliche Salbungsabsicht der Frauen am Ostermorgen übergehen (Mk 16,1; Lk 24,1ff).
Damit wäre erklärt, warum die Magdalenerin nicht zum Grab kommt, um Jesus zu salben. Im Johannesevangelium hat sie dafür einen anderen Grund, und zwar denselben wie „die andere Maria, die Schwester des Lazarus, von der die Juden, die zum Trauern in ihr Haus gekommen waren, glaubten, daß sie zum Grab des Bruders gegangen sei“, nämlich um (T758) „dort um ihn zu trauern (hina klausē ekei: 11,31)“. Zu diesem Zweck
hat sich nun Maria von Magdala tatsächlich zum Grab Jesu begeben: hina klausē ekei {um dort zu trauern}. Und dann findet sie das Grab leer und den Stein, der es verschloß, weggerückt! Sie fürchtet das Schlimmste! Denn als sie bei Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, angekommen ist, klagt sie ihnen: Sie haben (oder: man hat) den Herrn aus dem Grab geraubt, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben!
Zur Auslegung des Beginns von Johannes 20 durch Ton Veerkamp <1418> sei zunächst auf Eigentümlichkeiten seiner Übersetzung hingewiesen:
20,1 Am Tag eins der Schabbatwoche kommt Maria von Magdala
– früh, Finsternis ist noch –
an das Grab;
sie sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen ist.
20,2 Sie rennt also weg,
sie kommt zu Simon Petrus und zum anderen Schüler,
mit dem Jesus befreundet war,
sagt zu ihnen:
„Sie haben den HERRN aus dem Grab weggenommen,
wir wissen nicht, wo sie ihn beigesetzt haben.“
In der Einleitung zur Auslegung dieses Kapitels habe ich bereits auf den für die Zeitangabe „Tag eins“ wesentlichen Hintergrund der Schöpfungserzählung hingewiesen. In seiner Anm. 557 zur Übersetzung von Johannes 20,1 erläutert Veerkamp weiter zu dem Einschub skotias eti ousēs, dass die Übersetzung „Es war noch dunkel“ zwar naheliegt, aber die Bedeutung verfehlt,
die „Finsternis“ (skotia, hebräisch choschekh, Genesis 1,2) bei Johannes hat, vgl. Johannes 1,5 (zweimal); 6,17 (zweimal); 8,12; 12,3; (zweimal); 12,46. „In der Finsternis gehen“ heißt „leben ohne Messias und ohne die messianische Inspiration“. Deswegen die spröde Übersetzung: „Finsternis ist noch“.
Zu Maria von Magdala merkt Veerkamp zunächst an (Anm. 558), dass sie in 19,25 und 20,1.11 Maria genannt wird, in 20.16.18 jedoch Mariam. Mit ihrer Rolle „in allen Evangelien“ beschäftigt er sich eingehend:
Sie ist ständige Zeugin der Auferstehung. Bei Johannes ist sie die einzige Frau, die die entscheidende Nachricht bringt. Warum es Frauen sind, die die Evangelien als Kronzeugen für die Auferstehung anführen, hat wohl wenig mit plötzlichen feministischen Bekehrungen zu tun.
Paulus kennt nur eine Überlieferung, nach der der „aufstehende“ – wir werden erklären, warum wir nicht „auferstandene“ sagen – Messias ausschließlich Männern erschienen ist, darunter „fünfhundert Brüdern“ (!), (1 Korinther 15,1-10). Von Frauen keine Spur.
Die „männliche“ Überlieferungstradition der Auferstehung stammt aus der Zeit vor dem judäischen Krieg, die „weibliche“ Tradition aus der Zeit danach. Hier müsste man ansetzen. Diejenigen, die in den messianischen Gemeinden weniger als die männlichen Apostel galten, werden hier die Evangelistinnen der eigentlichen Botschaft. Die Führung der messianischen Gemeinden hatte vor und in dem großen Krieg versagt, und sie hatte keine Antwort auf die Katastrophe des Jahres 70. Jetzt werden andere die Trägerinnen der entscheidenden Botschaft. Sie sahen als erste „die Ehre des Messias“, wie es Jesus Martha am Grabe des Lazarus, Israels, ankündigte, 11,40.
Damit verbindet Veerkamp jedoch „keine Illusionen“ über „die Position der Frauen in den messianischen Gemeinden“, denn die „patriarchalische Durchformung aller gesellschaftlichen Verhältnisse in der Antike wird vor den messianischen Gemeinden kaum haltgemacht haben.“ Dass dennoch in „der Erzählung über Jesus … auf einmal die eine Schlüsselrolle“ spielen, „die sonst nur für die Nebenrollen vorgesehen waren“, ist auf die „radikal neue Situation“ zurückzuführen,
die durch die oben erläuterte Zeitangabe wiedergegeben wird. Jetzt spielen nicht die in 1 Korinther 15 erwähnten Kephas, die Zwölf, die fünfhundert Brüder, Jakobus, der Bruder des Messias, alle Apostel und zuletzt die „Missgeburt unter den Aposteln“ (1 Korinther 15,8), Paulus, die Rolle der Protagonisten der Auferstehungserzählung, sondern die in allen messianischen Gemeinden bekannten Frauen.
Die messianische Bewegung wurde geführt von den in 1 Korinther 15 Genannten. Der judäische Krieg bedeutete zugleich eine Existenzkrise der Gemeinden im Aramäisch sprechenden Raum, Syrien-Palästina. So, wie es bis dahin war, konnte es nicht weitergehen, und deswegen muss die Auferstehung völlig neu und völlig anders erzählt werden.
In diesem Zusammenhang verweist Veerkamp auf die durchwegs positive Art und Weise, in der Johannes schon bisher in seinem Evangelium von Frauen erzählt hatte:
An wichtigen Stellen spielten bei Johannes bis zum „Tag eins“ vier Frauen eine Schlüsselrolle: die Mutter des Messias bei der messianischen Hochzeit in Kana/Galiläa, das lebende Wasser und die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen bei Sychar in Samaria und die beiden Schwestern Maria und Martha bei der Belebung Lazarus‘ = Israel sowie bei der messianischen Mahlzeit in Bethanien.
Jetzt kommt die fünfte Frau, Maria aus Magdala. Sie hat bei Johannes keine Vergangenheit. Von den sieben Dämonen, die nach Lukas Jesus aus Maria austrieb (8,2), ahnt Johannes nichts. Ihre Rolle besteht zunächst darin, festzustellen, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt ist. Sie kann das Ereignis nicht deuten, sie bringt die Nachricht der Führung der messianischen Bewegung.
Mit dem Stichwort „Führung der messianischen Bewegung“ deutet Veerkamp bereits an, innerhalb welchen Bezugsrahmens er den sich nun anschließenden Wettlauf zwischen „Simon Petrus“ und dem „Schüler, mit dem Jesus befreundet war“, interpretieren wird.
↑ Johannes 20,3-10: Der Wettlauf von Petrus und dem anderen Schüler zu Jesu Grab
20,3 Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus,
und sie kamen zum Grab.
20,4 Es liefen aber die beiden miteinander,
und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus,
und kam als Erster zum Grab,
20,5 schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen;
er ging aber nicht hinein.
20,6 Da kam Simon Petrus ihm nach
und ging hinein in das Grab
und sieht die Leinentücher liegen,
20,7 und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte,
nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben,
zusammengewickelt an einem besonderen Ort.
20,8 Da ging auch der andere Jünger hinein,
der als Erster zum Grab gekommen war,
und sah und glaubte.
20,9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht,
dass er von den Toten auferstehen müsste.
20,10 Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück.
[9. Februar 2023] Nachdem Maria Magdalena ihre Nachricht an Petrus und den geliebten Schüler ausgerichtet hat, spielt sie (W547) „in dieser ersten Erzählung“ keine Rolle mehr:
Von nun an handeln nur diese Schüler, die durch die ihnen gegebene Mitteilung veranlasst werden, selbst zum Grab zu gehen, Johannes nennt beide noch einmal nacheinander beim Aufbruch und dann gemeinsam beim Gehen zum Grab: „Da ging Petrus hinaus, auch der andere Schüler, und sie gingen zum Grab.“ Im Folgenden aber stellt er differenziert dar, wie sich dieses Gehen vollzieht. Zunächst charakterisiert er es näher. Es war {Vers 4} kein gemächliches, sondern erfolgte in Eile, wie er schon von Mirjam sagte, dass sie „lief“: „Die beiden liefen miteinander.“ Wie zuvor befindet sich auch hier Simon Petrus mit dem Namenlosen auf einer Ebene – doch nur zunächst. „Aber der andere Schüler lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab.“ Der Namenlose lässt also Petrus hinter sich und kommt ihm zuvor.
Von diesem heißt es in Vers 5, dass er sich bei der Ankunft am Grab „[vor]beugte … und … da die Leinenbinden liegen“ sah, womit sich bestätigt, „dass Jesus selbst nicht mehr im Grabe ist.“
Wie geht Wengst damit um (Anm. 423), dass Lukas 24,12 genau das, was „hier von dem Schüler, den Jesus liebte, erzählt wird“, von Petrus berichtet? Dort heißt es:
„Petrus aber stand auf und lief zum Grab, beugte sich vor und sah allein die Leinenbinden, ging zu sich zurück und wunderte sich über das Geschehene.“ Bei Johannes ist er, als der andere die Leinenbinden sieht, noch gar nicht am Grab. Das Motiv der liegen gebliebenen Leinentücher findet sich nicht in der synoptischen Erzählung vom leeren Grab in Mt 28,1-7; Mk 16,1-8. In Lk 24,12 taucht es unvermittelt auf.
Nach Wengst kann man über „die Beziehung zwischen Lk 24,12 und Joh 20,5 … nur Vermutungen anstellen.“ Er schließt weder aus, dass Lukas 24,12 eine später ins Lukasevangelium eingeschobene Stelle sein könnte, noch dass „Johannes eine Lk 24,12 entsprechende Tradition kannte“. Im letzteren Fall „ist es umso deutlicher, wie er den Namenlosen dem Simon Petrus zuvorkommen lässt.“ Dass Johannes einfach den Text des Lukasevangeliums kennen könnte und mit ihm intertextuell spielt, zieht er nicht in Erwägung.
In der Beziehung der beiden Schüler stellt Wengst sodann „ein retardierendes Moment“ fest, wenn es „hinsichtlich des Schülers, den Jesus liebte“, am Ende von Vers 5 heißt: Er „ging jedoch nicht hinein“. Das gibt nach Vers 6
Simon Petrus Gelegenheit, nicht nur mit dem anderen gleichzuziehen, sondern ihm nun seinerseits voranzugehen. Indem Johannes ihn das tun lässt, betont er dabei aber noch einmal, dass Petrus dem anderen „gefolgt“ war: „Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein und sah da die Leinenbinden liegen.“ Dass er zuerst ins Grab geht, könnte ein verhaltener Reflex auf die Tradition von der Ersterscheinung des auferweckten Jesus vor ihm sein (vgl. 1. Kor 15,5; Lk 24,34).
Auch Simon Petrus sieht im Grab „zunächst nicht mehr, als was der andere schon von außen wahrgenommen hatte: die Leinenbinden“, nach Vers 7 macht er jedoch
eine weitere Beobachtung: „Auch das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gewesen war, sah er da liegen, aber nicht zusammen mit den Leinenbinden, sondern getrennt für sich zusammengewickelt an einem besonderen Platz.“ Dass Simon Petrus angesichts seiner Beobachtungen Folgerungen angestellt hätte, erzählt Johannes nicht. Aber die Leser- und Hörerschaft des Evangeliums soll doch wohl aus dem hier Berichteten ihre Schlüsse ziehen.
Eine solche Folgerung, die sich bereits in „altkirchlicher Auslegung“ findet, formuliert Calvin <1419> (W548):
„Es war nämlich unwahrscheinlich, daß man den Leichnam entkleidet hätte, um ihn anderswohin zu bringen. Weder Freund noch Feind hätte das getan“. So schließt Calvin weiter, „Christus habe die Zeichen des Todes von sich geworfen, um zu bezeugen, daß er sich mit dem seligen und unsterblichen Leben bekleidet hatte“. Den das Evangelium Lesenden und Hörenden drängt sich auch der Vergleich mit der Beschreibung auf, wie der von Jesus angerufene Lazarus aus dem Grab herauskommt (11,44): „Der zum irdischen Leben auferweckte Lazarus muß von den Leichenbinden befreit werden, der wahrhaft auferstehende Jesus befreit sich von ihnen und läßt sie als Zeichen seiner Auferstehung zurück.“ <1420>
Nach Wengst sagt Johannes aber nicht, dass „Simon Petrus solche Schlüsse zöge“. Stattdessen lässt er in Vers 8
nun den „anderen Schüler“ seinen Mitschüler nicht nur wieder einholen, indem auch dieser ins Grab geht und sieht, was jener zusätzlich gesehen hatte, sondern ihn auch überholen. Dabei erinnert er noch einmal daran, dass dieser der Erste beim Grab war: „Dann ging nun auch der andere Schüler hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte.“
Überholt wird Petrus von dem anderen Schüler also Wengst zufolge eindeutig, was seinen Glauben betrifft, denn (Anm. 427) diese „Art der Darstellung schließt es aus, dass die Glaubensaussage implizit auch für Simon Petrus gelten soll, wie es in der Auslegung immer wieder behauptet wird.“
Aber was hat den Glauben des geliebten Schülers ausgelöst (W548)?
Was er „sah“, sind die Leinenbinden und das Schweißtuch ohne den Leichnam Jesu. Diese Szenerie des leeren Grabes begreift er als Zeichen des Auferstehung Jesu. Was also von den Lesenden und Hörenden bei ihrer Wahrnehmung dieser Aussagen erwartet wird, das tut innerhalb der Erzählung „der Schüler, den Jesus liebte“. „Er kann [so Schnackenburg 368] gleichsam die Spuren und Zeichen seines Herrn lesen; darin ist er der ideale Jünger mit einem exemplarischen Glauben“. Mit diesem Namenlosen können und sollen sich die Lesenden und Hörenden identifizieren. Tun sie es, ist er ihr Repräsentant. Aber in der Erzählung blitzt der Glaube hier nur eben auf – als Hinweis für die Leser- und Hörerschaft, wie sie das Erzählte aufnehmen soll. Innerhalb der Erzählung bleibt dieser Glaube, wie das Weitere zeigt, völlig folgenlos. Damit es zum Osterzeugnis und Osterglauben komme, dazu bedarf es eines anderen Anstoßes.
Völlig falsche Schlüsse ziehen nach Wengst (Anm. 429) aus diesem Vers 8 die Exegeten Blank und Frey. <1421> So meint Blank, indem er eine These Bultmanns aufnimmt, dass „im Grunde … der Osterglaube nach Johannes auf die Ostererscheinungen verzichten“ kann, und Frey formuliert ähnlich:
Der Glaube dieses Schülers „entsteht aus dem bloßen Anblick der geordneten Verhältnisse im Grab. Er ,braucht‘ weder eine Engelsbotschaft noch Erscheinung des Auferstandenen noch einen Beweis aus der Schrift, sondern glaubt aufgrund des als ,Zeichen‘ fungierenden Grabes. So wird er zum ersten und paradigmatischen Zeugen des Auferstehungsglaubens“. Davon steht nichts im Text; die beiden folgenden Verse sagen das Gegenteil. Johannes weiß hier nichts von einem Zeugnis. Er hält es für nötig, anschließend gleich drei Erscheinungsgeschichten zu erzählen. Der Glaube entsteht offenbar nicht als Folgerung aus konstatierbaren Realien.
In Vers 9 gibt Johannes eine Erklärung dafür (W548f.),
warum der Glaube des einen nur eben aufblitzt und über den anderen in dieser Hinsicht gar nichts zu sagen ist, warum also das hier Berichtete für die weitere Erzählung folgenlos bleibt: „Sie hatten freilich noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten aufstehen müsse.“
Für seine Übersetzung des griechischen Wortes gar nicht mit „denn“, sondern mit „freilich“, der die Tragweite der Bedeutung des vorangehenden Verses zumindest einschränkt, beruft sich Wengst auf das Wörterbuch von Bauer. <1422> Dass (Anm. 430) nach Frey <1423> mit dieser Aussage „zunächst an Petrus gedacht sein“ wird, der „- im Gegensatz zum Lieblingsjünger – offenbar noch nicht glaubt“, hält Wengst für „vom Text her ausgeschlossen. Die 3. Person Plural meint von V. 3 an die beiden genannten Schüler und ebenso auch im folgenden V. 10.“
Was Johannes in 20,9 aussagen will, erinnert Wengst zufolge (W549)
an die in 2,22 und 12,16 gegebenen Hinweise. Danach sollen die Schüler die Geschichte Jesu in der Schrift entdecken, wenn dieser auferweckt ist. Die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde versteht Jesu Geschichte bereits im Licht der Schrift. Und sie hat auch in der Schrift gefunden, dass Jesus „von den Toten aufstehen muss“.
Nicht in Frage kommt es für Wengst (Anm. 432), „als die in V. 9 gemeinte Schriftstelle Lk 24,7, vielleicht in Verbindung mit Mk 9,9 oder Lk 24,46, zu identifizieren“, wie es Wolter <1424> tut, der annimmt, der
Evangelist nehme hier „auf einen schriftlichen Text Bezug […], der ihm aus der synoptischen Jesusüberlieferung bekannt gewesen ist“ (352). Allein von dieser Schriftstelle könne er „schreiben, dass Petrus und der Lieblingsjünger sie am Ostermorgen ‚noch nicht kannten‘ weil es sie zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht gab“ (ebd.). Aber wieso würde in diesem Fall die kommentierende Bemerkung des Evangelisten in V. 9 „die Rückkehrnotiz von V. 10 erklärend vor[…]bereiten“ (344)?
Dem von Wolter zur Begründung angeführten Argument, dass oida, „das Verb des Hauptsatzes von V. 9“, nicht mit „verstehen“, sondern ausschließlich mit „,wissen‘ oder ,kennen‘“ übersetzt werden darf und „von gínósko als ‚erkennen‘ (348)“ unterschieden werden muss, widerspricht Wengst unter Hinweis auf die „von ihm in Anm. 29 angeführte Stelle Mk 4,13“, denn
oída und ginósko stehen sich dort nicht ‚gegenüber‘, sondern in genauer Entsprechung zueinander; sie werden synonym gebraucht. Natürlich trifft die Aussage zu, dass Jesu Schüler nach dieser Stelle nicht „den parabolischen Sinn“ des „in V. 3-8 erzählten Gleichnisses“ kennen, aber zugleich damit verstehen sie nicht dessen Text.
Weiter betont Wolter, „dass der Singular graphé {Schrift} sich auf eine einzelne Schriftstelle beziehen müsse“, was er „für eine ganze Reihe von Stellen im Johannesevangelium eindeutig machen“ kann. Aber nach Wengst schwingt zugleich
bei diesem Begriff doch sehr viel mehr mit, nämlich die Dimension einer kanonischen Vorgabe. Es geht immer um Stellen der jüdischen Bibel. Das ist besonders deutlich in 10,35. Im vorausgehenden Kontext ist zwar eine einzelne Psalmstelle im Blick. Aber wenn formuliert wird: „Die graphé darf nicht aufgelöst werden“, kann sich das nicht isoliert auf diese eine Stelle beziehen. Kraft hat das Argument doch nur deshalb, weil diese einzelne Stelle zur Schrift – als Bibel – gehört, die nicht aufgelöst werden kann. Von daher ist es auch völlig unwahrscheinlich, dass graphé in Joh 20,9 nur eine geschriebene Textstelle ohne kanonische Dignität (352) bezeichne.
Wenn ich es richtig sehe, weist Wengst damit zwar überzeugend die von Wolter vorgetragene These ab, bringt aber selbst keinen einzigen eigenen Vorschlag, worauf ganz konkret in den jüdischen Schriften sich Vers 9 beziehen könnte. In den folgenden Sätzen suchen wir jedenfalls vergeblich eine Antwort auf die Frage (W549), wo genau „in der Schrift“ die Schülerschaft Jesu gefunden hat, dass Jesus „von den Toten aufstehen muss“:
Die Schüler in der Erzählung jedoch befinden sich gleichsam noch in der vorösterlichen Situation, obwohl Jesus schon auferweckt ist. Es bedarf noch dessen, dass der Gekreuzigte sich selbst als Auferweckter erweist, dass er sich im Glauben derer ausprägt, denen er in seiner Lebendigkeit eindrücklich geworden ist. Davon werden die Erscheinungsgeschichten erzählen und dort kommt es dann auch zum Zeugnis und zum Bekenntnis. Der ausgesagte Glaube ist auf der Ebene der Erzählung exzeptionell – vor allem auch in der Weise, dass er nicht zum Zeugnis führt. Das stellt Johannes gleich deutlich heraus.
Als Fazit der Erzählung vom Wettlauf der beiden Schüler ergibt sich für Wengst also im Blick auf Vers 10 die Schlussfolgerung, dass hier von einem völlig folgenlosen Geschehen die Rede ist (W549f.):
Standen beide Schüler – trotz der vorangehenden Differenzierungen – nun wieder nebeneinander, so ist das auch in der diese Erzählung abschließenden Aussage der Fall: „Da gingen die Schüler wieder zu sich zurück.“ Noch einmal sei betont: Diese beiden Männer, die nach der vorangehenden Darstellung in einer gewissen Konkurrenz zueinander erschienen, haben in dieser Erzählung kein einziges Wort miteinander gewechselt. Johannes berichtet auch nicht, dass sie irgendjemandem sonst etwas gesagt hätten. Was sie getan und erlebt haben, bleibt somit völlig folgenlos. Trotz des von dem einen ausgesagten Glaubens wird er nicht zum Zeugen – anders als Mirjam aus Magdala in 20,18 und alle Schüler in 20,25, nachdem ihnen Jesus als lebendig erschienen ist. Diese beiden kehren zu sich zurück, gehen ihrer Wege – als wäre nichts geschehen.
Warum aber sollte Johannes auf derart umständliche Weise von der Beziehung dieser beiden Schüler zueinander erzählen, wenn er damit keine weiteren Absichten verbinden würde?
Hartwig Thyen (T758) beschreibt, bevor er zunächst die Verse 3 bis 7 auslegt, noch einmal die bisherige Beziehung von Petrus und dem geliebten Jünger:
Mit Ausnahme der Szene unter dem Kreuz, wo die Mutter Jesu das Gegenüber des geliebten Jüngers ist, erscheint dieser wie hier stets neben und in Interaktion mit Petrus. Eindrucksvoll hatte die Szene des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern die besondere Nähe dieses anonymen Anderen zu seinem Herrn demonstriert: Da ruhte er en tō kolpō {an der Brust} seines Herrn, so wie der als der einzige Sohn an der Brust seines Vaters ruht (1,18), und der Erzähler bezeichnete ihn hier zum ersten Mal als den ,Jünger, den Jesus liebte‘ (13,21ff). Diese Bezeichnung erscheint danach fast wie der feste Name jenes Anonymen. Beim Mahl hatte Petrus ihn gebeten, Jesus doch nach der Identität dessen aus ihrem Kreis zu fragen, der ihn an seine Feinde ausliefern sollte. Doch mit dem geliebten Jünger erfuhr da nur der implizite Leser, nicht aber der Fragesteller Petrus, daß Judas gemeint war. Danach war es dann wieder der geliebte Jünger, der Petrus den Eintritt in die hohepriesterliche Aula des Hannas verschaffte, wo der seinen Herrn dreimal verleugnen sollte (18,15ff).
Diese beiden machen sich nach Vers 3 auf „die bestürzende Nachricht Marias hin … unverzüglich auf den Weg zum Grabe Jesu“, ohne dass zunächst weiter von Maria die Rede ist. Nach Vers 4 wird unter
ihren Füßen … der Weg zum Grab zu einem förmlichen Wettlauf. Der geliebte Jünger läuft schneller als Petrus und erreicht die Grabstätte als erster. Weil er zugleich der allwissende Erzähler dieses Evangeliums ist, der ja detailliert auch die Szene der Beerdigung Jesu beschrieben hat, kennt er natürlich die Lage des Grabes Jesu. Da der Evangelist aber erst ganz am Ende seines Werkes (21,24) verrät, daß es der geliebte Jünger war, der darin die Geschichte Jesu erzählt hat, kann das einstweilen nur ein Leser wissen, der das Buch nicht zum ersten Male liest.
Als nach Vers 5 der also zuerst am Grab angekommene
geliebte Jünger sich vor dem Grabe bückt, sieht er darin die Leinenbinden liegen (mit denen der Leichnam Jesu umwickelt war). Doch er geht noch nicht in die Gruft hinein, sondern überläßt dem nun dazukommenden Petrus den Vortritt.
Der wiederum betritt nach Vers 6 „unmittelbar nach seiner Ankunft Jesu Grab und sieht dort aus größerer Nähe, was der Andere schon von außen gesehen hatte.“ Nach Vers 7 sieht er (T758f.)
da nämlich nicht nur die Leichenbinden Jesu liegen, sondern darüberhinaus auch noch das Schweißtuch, das Jesu Haupt verhüllt hatte. Es lag sorgsam zusammengefaltet an einer anderen Stelle der Gruft… Dieses soudarion erinnert wohl nicht nur zufällig an die Art der Beerdigung und an die Auferweckung des Lazarus; vgl. 11,44.
Als (T759) den „Prätext dieser Szene“ betrachtet Thyen die Erzählung Lukas 24,1-12. In ihr
finden die Frauen Jesu Grab geöffnet und leer, doch zwei Engel (andres dyo epestēsan autais en esthēti astraptousē {zwei Männer traten zu ihnen in glänzenden Kleidern}: V 4) verkünden ihnen, daß Jesus auferstanden sei, wie er es doch schon in Galiläa vorausgesagt habe (Lk 9,22). Mit dieser Botschaft kehren sie nun zu den ,Aposteln‘ zurück. Doch die halten ihre Worte für leeres Gerede und glauben ihnen nicht (V. 11). Dann heißt es in V. 12 aber, daß allein Petrus sich von der Wahrheit der unglaublichen Botschaft der Frauen zu überzeugen suchte: ho de Petros anastas edramen epi to mnēmeieon kai parakypsas blepei ta othonia mona, kai apēlthen pros heauton thaumazōn to gegonos {Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war}.
Gegen die Auffassung, dass dieser Vers Lukas 24,12 „ein später Eindringling in das Lukasevangelium aus Joh 20“ sei, weshalb er „bis zur 25. Auflage im Text von Nestle“ fehlte, sprechen nach Thyen vor allem
die Worte der beiden Emmaus-Jünger, die dem unerkannt mit ihnen wandernden Jesus sagen: Einige ihrer Frauen hätten sie mit ihrem Bericht von einer Engelerscheinung am Grabe und von der Botschaft der Engel, daß Jesus lebe, in Bestürzung versetzt. Die beiden Jünger fügen dem dann in Übereinstimmung mit dem strittigen V. 12 noch hinzu, daraufhin seien einige der Ihren (tines tōn syn hēmin: Lk 24,24) zum Grabe gegangen und hätten dort alles so vorgefunden, wie die Frauen es gesagt hätten. Ihn selbst hätten sie jedoch nicht gesehen (24,22-24).
Irgendeine andere Tradition anzunehmen, in der „der ,andere Jünger‘ … einen Vorläufer gehabt haben könnte“, hält Thyen unter Berufung auf Neyrinck <1425> „für höchst unwahrscheinlich“, denn (T759f.)
der ,Jünger, den Jesus liebte‘, oder wie in 18,15: ,der andere Jünger‘, ist eine literarische Fiktion, von unserem Evangelisten eigens dazu erfunden, daß er ihn am Ende seines Werkes seinen Lesern als den verläßlichen Augenzeugen und Erzähler der Geschichte Jesu präsentieren kann. Wie in Joh 13,21ff und 18,15f, wo er ihn den Petruserzählungen seiner synoptischen Prätexte einfach hinzugefügt hat, damit er an dem bekannten Petrus sein besonderes Profil gewinne, so gilt auch für die Erzählung vom Wettlauf der beiden Jünger zum Grabe Jesu: „Die vergleichende Untersuchung von Joh 20,3-10 und Lk 24,12 führt zu dem Schluss, dass dies auch in der Erzählung vom leeren Grab des Johannes geschehen ist“. Gegen alle Hypothesen eines Proto-Lukas hat Neirynck u. E. im übrigen überzeugend begründet, daß Mk 16 die einzige Quelle ist, die Lukas für seine Erzählung vom leeren Grabe Jesu bearbeitet hat.
In Vers 8 wird erzählt (T760), dass „nach Petrus nun auch der ,andere Jünger‘ die Gruft“ betritt, obwohl dieser „doch zuerst das Grab erreicht hatte – woran der Erzähler ausdrücklich noch einmal erinnert!“ Ausdrücklich wird nun „nur über den Jünger, den Jesus liebte, nicht aber über Petrus gesagt …: Er sah und glaubte.“ Nach Thyen stellt Byrne <1426>
mit Recht die Frage, was der geliebte Jünger denn nach seinem Eintritt in die Gruft Jesu gesehen und ihn zum Glauben veranlaßt habe. Das könne nach dem Duktus der Erzählung ja wohl nur das sorgfältig zusammengefaltete und an einen besonderen Platz gelegte soudarion {Schweißtuch} (V. 6f) gewesen sein. Das habe er, als er von außen in die Gruft hineinblickte und darin nur die othonia {Leinenbinden} liegen sah, noch nicht wahrnehmen können. Damit er es als das seinen Glauben gründende sēmeion sehen kann (vgl. 20,31), läßt der Erzähler ihn nach Petrus nun auch noch die Gruft betreten: kai eiden kai episteusen {und er sah und glaubt}. Und dafür gibt der Erzähler dann sogleich diese höchst merkwürdige Begründung: Denn noch kannten sie die Schrift ja nicht, daß er von den Toten auferstehen müsse (oudepō gar ēdeisan tēn graphēn hoti dei auton ek nekrōn anastēnai).
Dieser „verwunderliche Satz“ kann in den Augen von Thyen
nur das außergewöhnliche Wunder dieses anachronistischen Glaubens des geliebten Jüngers begründen wollen: Ohne den Auferstandenen selbst gesehen zu haben, glaubt er aufgrund dieses für ihn untrüglichen Zeichens schon jetzt im Vollsinn des Wortes. Daß er auch hier seine Glaubenserkenntnis nicht an Petrus weitergibt, sondern sie – anders als dann Maria, die Jesus ja ausdrücklich als die Botin seines neuen Lebens zu den Jüngern senden wird – für sich behält, entspricht seinem im Evangelium seit 13,21ff absichtsvoll gezeichneten Bild. Zum Verkündiger der Glorie seines Herrn wird er erst im letzten Kapitel (21,7) und vor allem dann und dadurch werden, daß er die Feder in die Hand nimmt und Jesu ganze Geschichte in festen Buchstaben schreibt (21,24).
Damit beklagt Thyen nicht wie Wengst die Folgenlosigkeit des Glaubens dieses Schülers, sondern er bettet sein Verhalten ein in seine Gesamtschau des geliebten Jüngers als des getreuen Zeugen des Evangeliums, wie er es niederschreiben wird. Auf welche konkrete Aussage der Schrift sich Vers 9 beziehen könnte, hält er keiner Erwägung für wert.
Als „völlig verfehlt“ beurteilt Thyen eine von Minear <1427> geforderte
„radikale Revision der üblichen Exegese von Vers 8“. Er bezieht den Satz vom Glauben dieses Jüngers zu Unrecht auch auf Petrus und sieht beide Jünger dem gleichen ,Mißverständnis‘ und derselben Ratlosigkeit verfallen, wie zuvor die Magdalenerin. Nach ihm glauben die beiden Jünger, nachdem sie das leere Grab Jesu in Augenschein genommen haben, jetzt lediglich den Worten Marias und teilen deren Bestürzung: „Sie ‚glaubten‘ nun Marias Bericht und stimmten in ihr Geständnis der Unwissenheit ein: ‚Wir wissen nicht, wo‘“.
„Erwägenswert und weiterführend“ findet Thyen
dagegen die Bemerkung von D. A. Lee, <1428> daß die Erzählung von den beiden Jüngern und ihrem Wettlauf, zumal wegen des scheinbaren Widerspruchs zwischen den V. 8 und 9, nämlich noch unvollendet sei, und daß dieses Rätsel seine Lösung vielmehr erst im folgenden Kapitel 21 finde.
Er schließt daran seine Überlegung an (T760f.), dass Petrus hier wie „in dem hier assoziierten lukanischen Prätext … über das Gesehene verwundert und ebenso ratlos wie zuvor Maria neben dem bereits vom Wunder des Glaubens eingeholten geliebten Jünger nach Hause geht“, wobei aber Johannes die lukanische Wendung „thaumazōn to gegonos {über das Geschehene verwundert} wegen der Gegenwart des glaubenden geliebten Jüngers nicht zufällig“ weglässt. Der „geliebte Jünger“ dagegen ist in den Augen von Thyen (T761) als
der Erzähler der Geschichte Jesu, „der dies geschrieben hat“ (21,24), und zwar dazu geschrieben hat, damit auch seine potentiellen Leser ebenso wie er selbst aufgrund der Zeichen, die Jesus getan hat, am dem Glauben festhalten, daß Jesus der messianische Gottessohn ist, und so am ewigen Leben teilgewinnen (20,31), … von Anfang seines Erzählens an einer, der als Jesu Zeuge vom österlichen Geist erfüllt und vom Parakleten in die ganze Wahrheit eingewiesen ist. Seine zahlreichen das Geschehen von seinem Osterglauben her kommentierenden Parenthesen und Kommentare erweisen ihn als einen, der bereits aus dem Licht des Ostermorgens kommt und sich noch einmal als Nachfolger seines Herrn auf die Wege des irdischen Jesus gemacht hat … Er ist nicht einer der erzählten Mißverstehenden, sondern derjenige, der deren Mißverständnisse durch seine Kommentare überhaupt erst erkennen läßt, und seine Hörer/Leser so zum lebendig machenden Glauben führt.
Abschließend kommt Thyen in der Auslegung dieses Abschnitts auf die Frage von Byrne <1429> zurück, „inwiefern denn das an separater Stelle liegende Schweißtuch (soudarion) eine derart entscheidende Rolle für das Glauben des geliebten Jüngers spielen kann“. Die Antwort findet er in „der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus“, deren Zeuge „der geliebte Jünger als fiktionaler Erzähler und Verfasser des gesamten Evangeliums natürlich auch“ gewesen ist „und davon im elften Kapitel erzählt hat.“ Allerdings „darf man ihn“ nach Thyen „schwerlich mit einem ,historischen Lazarus‘ identifizieren, wie das manche Autoren vorschlagen. Denn wie unser Erzähler ist ja auch der aus Lk 16,19ff bekannte Lazarus nur eine erzählte Figur.“ Für die Erklärung von 20,7-8 ist es nun wichtig, dass Jesus auf
dem Höhepunkt der Lazarus-Erzählung … dem toten Freund in seinem Grabe mit lauter Stimme zu[ruft]: ,Lazarus komm heraus!‘. Und dann heißt es: ,Und der Tot-Gewesene kam heraus an Händen und Füßen gefesselt mit den Totenbinden und sein Angesicht war verhüllt unter einem soudarion‘ (43f). „Das säuberlich gefaltete und separat liegende soudarion weist darauf hin, dass Lazarus bei seiner Wiedererweckung völlig passiv war und sich ganz auf den Befehl Jesu verließ und andere brauchte, um das Gesichtstuch zu entfernen und so sein volles menschliches und soziales Leben wiederherzustellen, während Jesus sich selbst aktiv aufgerichtet hat. Das fein säuberlich gefaltete, separat abgelegte Gesichtstuch scheint der krönende Abschluss dieser völlig selbstbeherrschten, majestätischen Handlung Jesu zu sein.“
Dazu verweist Byrne „treffend auf 10,18“, wie Thyen meint. Anders als Thyen hält Byrne allerdings „Joh 21 zu Unrecht für eine sekundäre Ergänzung“ und (T761f.) vermag daher „natürlich auch den geliebten Jünger als den Erzähler von Joh 11 nicht wahrzunehmen und muß ihn erst am leeren Grab Jesu zum Glauben kommen lassen.“
Mit all dem sieht Thyen durch die Erzählung vom Wettlauf mit Petrus sowohl seine besondere Sicht des geliebten Jüngers bestätigt als auch seine Überzeugung, dass der gottgleiche Jesus, der nach Johannes 5,26 wie Gott in sich selber das Leben hat, aus eigener Kraft von den Toten auferstehen konnte.
Nach Ton Veerkamp <1430> spiegeln sich in der Erzählung vom Wettlauf der beiden Schüler die Kräfteverhältnisse in der Führung der messianischen Bewegung zur Zeit des Johannesevangeliums wider:
Für Johannes besteht die judäische Bewegung aus zwei Komponenten. Die eine wird vertreten durch Simon Petrus (Kephas), die andere durch „den Schüler, mit dem Jesus freundschaftlich verbunden war“, die Zentralfigur der Gruppe um Johannes. Maria aus Magdala setzt diese zwei Protagonisten des judäischen Messianismus in Bewegung – und wie: „Die zwei liefen (etrechon) zusammen“ und dann „rannten sie (edramon)“, der eine Schüler schneller als der andere, der von allen anerkannte Führer des judäischen Messianismus, Simon Petrus. Das ganze Dreieck handelnder Personen bringt kaum verklausuliert die komplizierten Verhältnisse in der messianischen Bewegung ans Licht. Der Lehrling kommt als erster ans Grab, ist der erste Augenzeuge, lässt aber Petrus den Vortritt. Begründet wird das erst im Anhang, 21,15ff. Die letzten beiden Kapitel unseres Textes erzählen auch, wie die ziemlich isolierte Gruppe sich in die messianische Bewegung als Ganzes ein- und der Führung durch Simon Petrus unterordnete.
Aber obwohl für Veerkamp das „Rennen zum Grab … ein deutliches Zeichen“ ist, ist nicht von vornherein klar, worauf es denn hindeuten soll. Aus seinem Vergleich der johanneischen Erzählung mit den Synoptikern geht jedenfalls hervor, dass er die Fassung des Johannes nicht auf ein Spiel mit Lukas 24,12 zurückführen würde:
Warum wird dieses Bild – die zwei liefen gemeinsam, der eine rannte schneller – gewählt? Das Verb trechein, laufen, rennen, kommt in drei Auferstehungserzählungen vor; Markus hat das Verb hier nicht, und bei Lukas dürfte 24,12 später unter dem Einfluss des Johannesevangeliums eingefügt worden sein. Die Nachricht vom leeren Grab macht zunächst den Eindruck einer Schreckensnachricht. Maria findet das offene Grab und rennt zu Simon; Simon und der andere Schüler rennen, um sich vom geöffneten Grab und dem Verschwinden der Leiche zu überzeugen.
Alle drei gehen von einem Grabraub aus. Die akribische Beschreibung des Zustandes – Leichentücher und Schweißtuch liegen getrennt und nicht auf einem Haufen, letzteres sorgfältig zusammengelegt – suggeriert, dass hier keine Räuber am Werke waren; Diebe und Räuber haben es immer eilig. Das Ganze mutet wie „Spurensicherung“ an.
Welche Schlüsse werden aus einer solchen Erhebung der Spuren innerhalb der Erzählung gezogen?
Was Simon sich denkt, ist nicht überliefert; der andere Schüler, der nach Simon die Grabstelle betritt, „sah und vertraute“ – nämlich der Ankündigung Jesu in 2,19 und der Erklärung 2,21-22 dazu. Dieser Schüler – und wohl auch Simon Petrus und nach ihm Maria aus Magdala – musste zunächst sehen, um vertrauen zu können. Auf diese Dialektik von Sehen und Vertrauen kommt Johannes noch ausführlich zu sprechen. Das Vertrauen in den Messias setzt das Verstehen der Schrift voraus, die sorgfältig zusammengelegten Tücher sind allenfalls eine Bestätigung dafür, dass hier kein Grabraub stattgefunden hat. Hier wie in 2,22 ist das Nicht-Verstehen der Schrift die Ursache für das mangelnde Vertrauen in den Messias.
Im Unterschied zu Thyen sieht Veerkamp also Schlussfolgerungen aus dem anders als bei der Erweckung des Lazarus vom Gesicht des Toten entfernten und zusammengefalteten Schweißtuch nicht als ausreichend an, um das Auferstehen Jesu in seinem vollen Sinne zu begreifen. Hinzukommen muss auf jeden Fall, wie auch Wengst meint, ein Verstehen auf Grund der Schrift. Während Wengst aber keine konkreten Stellen in der Schrift gesucht hat, auf die sich Johannes beziehen könnte, stellt Veerkamp die Frage:
Um welche Schriftstelle handelt es sich? Viele Psalmen sind Lieder von verlorenen Menschen, die dem Untergang nahe waren und von Gott aus der Todesgefahr befreit wurden. Aber das Lied Jesaja 53 ist wohl die Schriftstelle par excellence. Wir haben es bei der Besprechung von 1,29 („Lamm Gottes“), 12,37f. („Blendung Israels“) und 19,5 („Seht den Menschen“) zitiert und gedeutet. Auch hier drängt sich das Lied auf, 53,9ff.:
Man gab ihm sein Grab bei den Verbrechern, seinen Tod bei den Reichen, <1431>
obwohl er nie Gewalt getan hat, nie Betrug in seinem Mund war.
Der NAME wollte ihn zermalmen, ihn krank machen,
damit Er seine Seele als Schuldopfer einsetzen kann.
Aber der wird noch Samen sehen, seine Tage verlängern.
Das will der NAME: ihn durch Seine Hand retten.
Ohne Schmerz für seine Seele wird er sehen, wird sich sättigen,
Durch diese Erkenntnis wird er sich für die vielen bewähren
– Bewährter, mein Knecht -,
weil er die Last ihrer Verfehlung trug …
Erneut weist Ton Veerkamp in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, die Bedeutung Jesu und dessen, was mit ihm geschah, von den jüdischen heiligen Schriften her zu verstehen, und dass es nicht darum gehen kann, ein im Grunde überholtes Altes Testament in dem Sinne auf Jesus hin zu interpretieren, dass es jegliche eigenständige und fortwirkende Bedeutung verliert:
Alle messianischen Gemeinden aus Israel mussten versuchen, von der Schrift her zu verstehen, was geschehen war und geschehen musste. Der Messias Israels war sowohl der bar enosch, der MENSCH, als auch der leidende Vertreter seines leidenden Volkes. Auch das ist Gemeingut in allen messianischen Gemeinden. Was immer die Konsequenz der Auferstehung ist, auf alle Fälle beginnt in den messianischen Gemeinden eine neue Lektüre der Schrift.
Der geheimnisvolle Gast der Schüler von Emmaus „legte ihnen, beginnend bei Mose und bei den ganzen Propheten, in der ganzen Schrift aus, was über ihn selbst (geschrieben war)“. Erst nachdem sie den Gast „beim Brechen des Brotes erkannt“ hatten, wurde ihnen bewusst, „dass unser Herz brennend war, als er auf dem Weg zu uns redete, als er uns die Schriften erschloss“ (Lukas 24,27.32).
Weitverbreitet war die Auffassung der Peruschim, dass am Tage des Weltgerichtes die Toten aufstehen würden, aber niemand rechnete damit, dass einer vor dem Tag des Endgerichtes aus den Toten erweckt wurde. Eine Konstante in allen Auferstehungserzählungen ist die Tatsache, dass die Auferstehung Jesu vollkommen unerwartet war. Die Juden lesen die Schrift – z.B. Jesaja 53 – nicht auf Jesus hin.
Biblische Theologie ist der Nachweis, dass der von den Toten aufstehende Messias von den Schriften her – und nur von ihnen her – verständlich ist. Das ist etwas völlig anderes als die traditionelle Schriftauslegung der Christen „auf Jesus hin“. Die Große Erzählung hat ein offenes Ende und bleibt für jede Überraschung gut. Zum Beispiel nährt sie das Vertrauen darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, erst recht nicht der Tod Jesu, verordnet durch den Vertreter des Prinzipals (archōn) der herrschenden Weltordnung.
Entscheidend ist in dieser Argumentation der Satz, dass die „Große Erzählung … ein offenes Ende“ hat. <1432> Die unerwartete Auferstehung Jesu stellt seinen Nachfolgern nicht einfach ihre eigene Auferstehung am Ende der Tage in Aussicht (auf die sie auf Grund von Daniel 12,2 bereits hoffen konnten), sondern die Erfüllung aller Hoffnungen der Propheten und Apokalyptiker Israels auf eine radikale Veränderung aller Weltverhältnisse. Mit Jesu Tod und seinem Aufsteigen zum VATER ist nach Johannes die weltweite Versklavung unter die Gewaltherrschaft des römischen Imperiums bereits überwunden; in der Praxis der von ihm geforderten agapē, einer tatkräftigen solidarischen Liebe, kann der Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit tätig erwartet werden.
Mit diesen Ausführungen Veerkamps ist aber ein bestimmtes
Element dieser ersten Erzählung des Tages eins … noch immer nicht erklärt. Was bedeutet das Laufen der zwei Schüler und die Angabe, daß der „andere Schüler“ schneller rannte? Eine nette und lebhafte Schilderung der Ereignisse? Bei Johannes muss man nicht vorschnell auf nebensächliche Details zwecks gefälliger literarischer Ausschmückung schließen.
Es gibt im zweiten Buch Samuel eine merkwürdige Erzählung. Der Aufstand gegen David war niedergeschlagen worden, Absalom, Urheber des Aufstandes, war dabei umgekommen. Achimaaz, der Sohn des Priesters Zadok, wurde beim Heerführer Joab vorstellig; er möchte gern David das „Evangelium“ des Sieges bringen (ˀavaßera, euangeliō, „ich will verkünden“, 2 Samuel 18,19). Joab riet ihm dringend ab. Statt dessen schickte Joab den äthiopischen Söldner, er solle David die Botschaft bringen. Der Äthiopier lief, aber Achimaaz lief hinterher und schneller als er. Das „Evangelium“ des Sieges über Absalom war zwar wirklich „gute Nachricht“, aber nicht nur. Für David, dessen Königtum gerettet wurde, hat der Sieg einen fast unerträglichen Preis, den Tod des geliebten Sohnes: „Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Was hätte ich gegeben, wenn ich an deiner Statt gestorben wäre, Absalom, mein Sohn, mein Sohn“, 2 Samuel 19,1. Das „Evangelium“ (beßora) war nicht nur „frohe Botschaft“; auch die beßora des leeren Grabes ist nicht nur eine „frohe Botschaft“. Wie jetzt berichtet wird.
Gegen diese Erzählung als Hintergrund für den Wettlauf der beiden Schüler Jesu könnte eingewendet werden, dass sie stumm bleiben und überhaupt keine Botschaft ausrichten. Vielleicht ist es aber gerade die Absicht des Evangelisten Johannes, auf Fragwürdigkeiten eines Wettkampfs hinzuweisen, den es innerhalb der messianischen Gemeinde gegeben haben mag: Wessen Glaube ist der tiefste, wer liefert das überzeugendste Auferstehungszeugnis? Stoßen Menschen, die in dieser Weise miteinander um die Wette laufen, überhaupt zum Kern dessen vor, worum es im Johannesevangelium geht? Bleiben sie nicht vielmehr ratlos am oder im Grab Jesu stehen, um dann nach Hause gehen zu müssen? Welche Hoffnung mit dem Auferstehen Jesu tatsächlich eröffnet ist, die Hoffnung auf ewige Seligkeit im Himmel nach dem individuellen Tod oder auf das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker, darauf ist in der bisherigen Erzählung noch keine Antwort gegeben worden.
↑ Johannes 20,11-13: Maria weint am Grab Jesu und sieht zwei Engel, denen sie die Frage beantwortet, warum sie weint
20,11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.
Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein
20,12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen,
einen zu Häupten und den andern zu den Füßen,
wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.
20,13 Und die sprachen zu ihr:
Frau, was weinst du?
Sie spricht zu ihnen:
Sie haben meinen Herrn weggenommen,
und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
[10. Februar 2023] Nach Klaus Wengst (W550) wurde bereits „im vorigen Abschnitt das leere Grab zum Zeichen der Auferstehung“, aber nur für „die das Evangelium Lesenden und Hörenden“, indem in
der Gestalt des Schülers, den Jesus liebte, … der Glaube, der ihnen Perspektive geben soll, kurz auf[blitzte], was aber innerhalb der Erzählung folgenlos blieb. Der Auferweckte selbst muss sich erst noch so erweisen, dass Glaube entsteht, der dann auch das Zeugnis zur Folge hat. Das kommt jetzt in der zweiten Erzählung von Kap. 20 zur Darstellung.
Indem diese „zweite Erzählung … noch einmal sozusagen von vorn beginnt, womit schon die erste begonnen hat: mit Mirjam am Grab“, tritt in Vers 11 die „Folgenlosigkeit der ersten … augenfällig zu Tage…: ‚Mirjam stand draußen beim Grab und weinte.‘“ Nach Wengst (Anm. 433) ist es „also nicht erzählerisches Ungeschick oder Ergebnis notdürftig verbundener Traditionen“, dass „Mirjam in V. 11 wieder unvermittelt am Grab Jesu steht“, vielmehr ist es ein „überlegt eingesetztes literarisches Mittel.“
Ausführlich beschäftigt sich Wengst (W550f.) mit der Trauer der Maria Magdalena, in der sich ihm zufolge die Gefühlslage der johanneischen Gemeinde widerspiegelt:
Sie trauert; sie ist wie selbstverständlich am Grab Jesu. Das ist der Ort, an dem der Abschied sich weiter vollzieht und an dem ihre Erinnerung sich festmachen kann, der Ort stärksten Gedenkens. Sie steht am Grab Jesu und weint. Dieses Bild ist transparent für die Situation der Gemeinde des Evangelisten. In der weinenden Mirjam kann diese bedrängte Gemeinde sich wiedererkennen; sie wird von dieser Frau repräsentiert. In ihrem Weinen erfüllt sich innerhalb der Erzählung des Evangeliums die Trauer, die Jesus seinen Schülern in den Abschiedsreden angekündigt hatte: „Amen, amen, ich sage euch: Weinen und klagen werdet ihr, die Welt aber wird sich freuen“ (16,20). Johannes ließ Jesus seinen Schülern für die Zeit unmittelbar nach seinem Tod solche Erfahrungen ankündigen, wie sie die Gemeinde zu seiner eigenen Zeit macht. Zugleich aber hat er Jesus von seiner neuen Gegenwart kraft des Geistes sprechen lassen, der in alle(r) Wahrheit leitet und an alles erinnert. Und so stand neben der Ankündigung der Trauer sofort auch die einer heilvollen Wende: „Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer soll zur Freude werden“ (16,20). Mit dieser Darstellungsweise machte Johannes deutlich: Die Trauer der Gemeinde, die schon jenseits der Zeit des Abschieds Jesu und also zur Zeit der Geisteskraft lebt, ist im Grunde anachronistisch. Aber er tadelt seine Gemeinde nicht, so wenig wie er die zum Grab gehende Mirjam tadelt. Beide haben Grund zur Trauer; es besteht Anlass zum Weinen. Das ist die Situation, sie wird nicht übersprungen. Johannes kritisiert Mirjam nicht. Sie wird am Ort ihrer Trauer abgeholt und weitergeführt – wie die Gemeinde auch, deren Trauer und Klage nicht der Einbildung entspringt, sondern erfahrener Wirklichkeit Ausdruck gibt. In der Gestalt der weinenden Mirjam, die in der unerwarteten Begegnung mit dem lebendigen Jesus zu dessen Zeugin wird, will Johannes auch seine Gemeinde diesen Weg führen.
Nach (W551) ihrem ersten „Gang zum Grab“ wurde Marias Trauer noch „verstärkt, weil sie aus dem vom Grab weggenommenen Stein auf die Entfernung des Leichnams Jesu schließen musste.“ Zurückgekehrt ist sie, weil sie hofft, an „dem Ort, an dem sich Jesu Spur verloren hat …, diese Spur wieder zu finden. Nachdem Jesus umgebracht worden ist, soll nicht auch noch sein Leichnam spurlos verschwunden sein.“
Auf seltsame Weise spricht Johannes nun von Engeln, die in „der synoptischen Erzählung vom leeren Grab … die Osterbotschaft“ verkünden. Bei Matthäus (28,5f.) und Markus (16,6) ist es einer, bei Lukas (24,5-7) sind es zwei. „Nichts dergleichen geschieht hier.“ Stattdessen beschreibt Johannes in Vers 12 zunächst einfach, dass „Mirjam … die Engel“ sieht:
„Während sie nun weinte, beugte sie sich vor zum Grab und sah da zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen beim Kopf und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.“ … Indem Johannes das erzählt, soll seine Leser- und Hörerschaft selbstverständlich erkennen: Dass der Platz leer ist, den sie jetzt markieren – der Platz, an dem der tote Jesus gelegen hat -, ist durch himmlisches Eingreifen bedingt. Aber wie für Mirjam schon der weggenommene Stein nicht zum Zeichen der Auferstehung wurde, so wird es ihr auch nicht die Anwesenheit der Engel.
Bultmann <1433> hat nach Wengst (Anm. 434) als „ein Argument für traditionskritische Scheidungen“ angeführt,
„daß Maria beim Blick in das Grab die Engel sieht, die die Jünger nicht gesehen haben, und ,die doch auch vorher schon zu sehen gewesen sein mußten‘ (Wellh[ausen])“ – als handle es sich bei ihnen um Möbelstücke. Demgegenüber hat schon Weiss <1434> Recht: „Thöricht ist die Frage, wo die Engel bei der Anwesenheit des Petrus und Joh(annes) in der Gruft gewesen seien […], da Engelerscheinungen natürlich nur für den da sind, dem sie zu Theil werden sollen“.
Jedenfalls scheint sich (W551f.) die „Aktivität“ der Engel fast in „bloßer Anwesenheit“ zu erschöpfen. Sie verkündigen nicht, in Vers 13 fragen sie Maria lediglich:
„Frau, warum weinst du?“ Mirjam antwortet darauf mit fast denselben Worten, die sie schon gegenüber den beiden Schülern gebraucht hat: „Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo man ihn beigesetzt hat.“ Damit wiederholt sie „den Irrtum, mit dem sie den Leichnam Jesu für Jesus selbst genommen hatte“. <1435> Sie ist keinen Schritt weiter gekommen. Indem ihr nicht einmal Engel helfen können, stellt Johannes umso deutlicher heraus: „Zum Osterglauben kommt es erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst.“ <1436>
Hartwig Thyen (T762) beschränkt sich zur Auslegung der Verse 11 und 12 auf den Hinweis, dass Johannes auch hier „intertextuell mit seinen als bekannt vorausgesetzten Prätexten spielt und sie sich nicht in der Weise einfach einverleibt hat, wie das Matthäus und Lukas weitgehend mit dem Markustext getan haben“. Wer das verkennt und „unnötigerweise immer wieder nach vermeintlichen von den Synoptikern unabhängigen Quellen“ fahndet, unterschätzt damit „die poetische Kraft unseres Evangelisten“:
Wußte Markus (16,5) nur von einem Grabesengel (neaniskos {Jüngling}), der mit einem weißen Gewand bekleidet war, zu berichten, worin Matthäus ihm auf seine Weise folgt (28,2-6), so läßt Lukas den Frauen deren zwei erscheinen: „Und siehe da traten zwei Männer in strahlenden Gewändern zu ihnen“ (24,4), auch darin dürfte Johannes Lukas folgen.
Zu Vers 13 referiert Thyen einfach nur knapp dessen Inhalt und hebt mit einem Ausrufezeichen hervor, dass sie nun im Singular von ihrem Nichtwissen spricht:
Die beiden Engel fragen Maria, warum sie weine, und darauf weiß sie nur zu wiederholen, was sie zuvor schon Petrus und dem anderen Jünger geklagt hatte: Sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich (!) weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.
Auch Ton Veerkamp <1437> gibt nur den Inhalt der Verse 11 bis 13 in wenigen Worten wieder und weist darauf hin, dass die Magdalenerin den geliebten Toten nicht einmal beweinen kann, da sie einen Grabraub annimmt, und erst recht nicht auf die Idee kommt, Jesu könnte auferstanden sein:
Maria war den beiden Männern gefolgt. Diese hatten sich vom Grab entfernt, und Maria war allein am Grab. Auch sie bückte sich und sah, was die Männer nicht gesehen hatten: zwei Boten.
Maria weinte, nicht aus Trauer um den Toten, sondern aus Verzweiflung darüber, dass man ihr die Möglichkeit genommen hatte, das zu tun, was Menschenpflicht im antiken Orient war: das Beweinen der Toten. Dass Jesus auferstanden sein sollte, kam ihr nicht in den Sinn, nicht einmal, nachdem die Boten sie gefragt hatten, weshalb sie weinte. Sie bleibt bei ihrer Meinung.
↑ Johannes 20, 14-16: Maria hält Jesus für den Gärtner und erkennt ihn erst als ihren Lehrer, als er sie mit Namen anspricht
20,14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um
und sieht Jesus stehen
und weiß nicht, dass es Jesus ist.
20,15 Spricht Jesus zu ihr:
Frau, was weinst du?
Wen suchst du?
Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm:
Herr, hast du ihn weggetragen,
so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?
Dann will ich ihn holen.
20,16 Spricht Jesus zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich um
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!,
das heißt: Meister!
[11. Februar 2023] Bevor es aber nach Klaus Wengst (W552) zur Begegnung mit Jesus selbst kommt, baut Johannes in Vers 14 „ein retardierendes Moment“ in seine Erzählung ein:
„Nachdem sie das gesagt hatte, wandte sie sich um, zurück.“ Sie ist bisher nicht nur keinen Schritt vorangekommen; jetzt wendet sie sich sogar „zurück“. Ein solches „Zurück“ stand in 6,66, als viele Schüler an Jesus Anstoß nahmen: Sie „gingen weg, zurück, und zogen nicht mehr mit ihm“. Das war transparent für die Situation der Gemeinde, die Abfall erlebte. Als Mirjam selbst ihre Trauer an nichts mehr festmachen kann, wendet sie sich „zurück“. Dem resignierenden Rückzug stellt sich jedoch der lebendige Jesus selbst entgegen. Anders, scheint es, ist dieser Rückzug nicht aufzuhalten: „Und sah da Jesus stehen“, heißt es weiter. Dass er nicht mehr an seinem Platz im Grab „liegt“, hat Mirjam wahrgenommen. Aber er ist auch nicht irgendwo anders „beigesetzt“, „hingelegt“ worden. Sich auf die Füße zu stellen und also zu „stehen“, ist Ausdruck der Lebendigkeit.
Dieses Stehen Jesu interpretiert Wengst so (Anm. 437) auf dem Hintergrund der Totenerweckung in Hesekiel 37,10, die ebenfalls mit dem Wort „stehen, stellen“ umschrieben wird (hebräisch ˁamar, griechisch histēmi).
Aber (W552) obwohl Maria auf der Suche nach dem „toten Jesus … nun unverhofft dem lebendigen“ begegnet, wird von ihr zunächst gesagt: sie „wusste nicht, dass es Jesus war.“ Daraufhin stellt Jesus ihr in Vers 15
zunächst dieselbe Frage wie vorher schon die Engel: „Frau, warum weinst du?“ Dann aber richtet er eine weitere Frage an sie, die erkennen lässt, dass er mehr weiß, als ein Unbeteiligter wissen kann: „Wen suchst du?“ Als wüsste er nicht, dass sie ihn sucht! Indem der lebendige Jesus sie so fragt, erscheint ihre Suche nach dem toten geradezu als absurd. Aber auf diese Suche ist sie noch fixiert. So ist das, was sie nun sagt, zum dritten Mal zu Wort kommend, nur eine Variante ihrer bisherigen beiden Aussagen (V. 2.13). Sie meint, es mit dem Gärtner zu tun zu haben. Das ist naheliegend; wer sonst sollte auch zu dieser frühen Stunde im Garten sein? Mit dieser Erwähnung werden die das Evangelium Lesenden und Hörenden daran erinnert, dass das Grab Jesu in einem Garten liegt (19,41), wie auch schon seine Festnahme in einem Garten erfolgte (18,1).
Da „der ‚Gärtner‘ der von den Toten auferweckte Jesus“ ist, „‚die Erstlingsfrucht der Entschlafenen‘ (1. Kor 15,20), der Repräsentant endzeitlicher Neuschöpfung“, wird hier „eine weitere mögliche Dimension“ eingespielt, „nämlich die Erinnerung an den Garten Eden am Anfang der Bibel“, die Jürgen Ebach <1438> als „erhoffte Vergangenheit“ bezeichnet. Das ist aber eine „Einsicht“, die Maria „noch verstellt“ ist (W552f.):
Sie hofft, in der Person des mit ihr Redenden, den sie für den Gärtner hält, einen Anhalt zu haben, mit ihrer Suche nach dem toten Jesus doch noch zum Ziel zu kommen. Das wird sie auch, aber ganz anders, als sie denkt. Sie nennt keinen Namen, sondern spricht nur von „ihm“: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sage mir, wo du ihn beigesetzt hast, sodass ich ihn holen kann.“ Gegenüber den beiden Schülern und den Engeln hatte sie Nichtwissen darüber bekundet, wo Jesus beigesetzt ist. Das soll nun der vermeintliche Gärtner beenden.
Zur Anrede dieses Gärtners als „Herr“ weist Wengst (Anm. 440) darauf hin, dass es sich wie bereits in Johannes 12,23, „wo Philippus als ‚Herr‘ angeredet wird“, um eine „bloße Höflichkeitsanrede“ handelt, <1439> wie schon Calvin meinte: „Herr nennt sie ihn, weil das in ihrem Volke so üblich ist. Denn die Hebräer reden auch Bauern und andere einfache Leute mit ,Herr‘ an.“
Mit Susanne Ruschmann <1440> geht Wengst davon aus (Anm. 441), dass Marias „Anliegen ironisch ad absurdum geführt und der Grund für die Notwendigkeit ihres Scheiterns aufgedeckt“ wird, indem „Maria den Auferstandenen selbst nach dem ,Ort‘ des Irdischen fragt“. Dieses Anliegen der Maria beschreibt Wengst folgendermaßen (W553):
Ihre Trauer soll nicht im unbestimmten Raum umherirren, sondern einen festen Ort haben, einen Halt bekommen an der Stelle, wo der Leichnam beigesetzt ist. Sie will sich dieses Halts in stärkster Weise vergewissern, indem sie sagt, den Leichnam geradezu „holen“ zu wollen. Sie will die denkbar größte „Reliquie“. Damit – mit dem, was nach ihrer Meinung von Jesus nach seinem Tod übriggeblieben ist – kann sie die Erinnerung an ihn bewahren, seiner gedenken, lebt sie in der Gemeinschaft mit dem Toten. Der Fortgang der Geschichte zeigt, dass das, was sonst verständlich und angemessen ist, in diesem Fall nicht ausreicht, zu wenig ist. Es geht hier nicht um die Erinnerung an einen Toten, sondern um ein Gedenken, das Jesus kraft des Geistes als Lebendigen gewärtigt.
Aber bis dahin ist Mirjam noch nicht durchgestoßen.
Dass dieser Text in besonderer Weise „in der Schwebe hält“, was er zugleich „eindeutig benennt“, zeigt sich nach Wengst,
wenn er in Spiel umgesetzt werden soll. Mittelalterliche Osterspiele fanden unterschiedliche Lösungen für die Rolle Jesu, die hier ein Problem darstellt, das nicht befriedigend gelöst werden kann. Entweder trat Jesus als herrscherliche Person auf oder als Gärtner oder zunächst als Gärtner und dann – in einem schnellen Wechsel der Rollen – als herrscherliche Person. Jedes Mal aber ist die Eigenart des Textes, die er auch nur als Text haben kann, aufgelöst, die Eigenart nämlich, dass die Leser- und Hörerschaft von vornherein Bescheid weiß, die am Geschehen direkt beteiligte Person aber nicht. Mirjam meint, den Gärtner vor sich zu haben. Aus ihrer Perspektive betrachtet, wird von einer Begebenheit im Rahmen des Üblichen erzählt. Genau da erfolgt nun eine sie überraschende Wendung.
Diese Wendung wird nach Wengst in Vers 16 dadurch hervorgerufen, dass Jesus, der „ihr begegnet, … nun nicht mehr“ tut, „als dass er sie mit ihrem Namen anredet: ‚Mirjam‘“. Darauf, dass Johannes in seinem griechischen Text hier nicht mehr die Namensform Maria verwendet, sondern sie (wie auch in Vers 18) Mariam nennt, geht Wengst nicht ein. Er fährt fort, indem er das nochmalige Umwenden der Maria zu Jesus zur Situation der johanneischen Gemeinde in Beziehung setzt (W553f.):
In 10,3f. hat Jesus über den „Hirten der Schafe“ gesagt, dass er „seine Schafe Name um Name ruft“ und sie ihm folgen, „da sie seine Stimme kennen“. Als mit Namen von Jesus Angesprochene erkennt Mirjam Jesus und wendet sich ihm zu. Obwohl bereits von Mirjam gesagt war, dass sie sich umwandte und dann Jesus gegenüberstand, heißt es nun, nachdem Jesus sie mit Namen angeredet hat, noch einmal: „Sie wandte sich um.“ Dass sie sich zwischenzeitlich wieder abgewandt habe, ist durch das Gespräch ausgeschlossen. Sollte Johannes nicht auch hier wieder sehr hintergründig formulieren? Mirjam hat gemeint, es mit dem Gärtner zu tun zu haben. Erfolgt dann nicht hier die Wendung vom „Gärtner“ zu Jesus selbst, als sie dessen Anrede vernimmt? Und sollte mit all dem Johannes nicht auch die eigene Zeit im Blick haben, in der es geschehen kann, ja in der es darauf ankäme, die Anrede Jesu in Gestalten und Situationen zu gewärtigen, in denen man es nicht erwartet? Wenn die weinende Mirjam am Grab Jesu die Gemeinde repräsentiert, wenn die Gemeinde sich in Mirjam wiedererkennen kann und soll, wenn sie liest und hört, dass Jesus schon da ist, obwohl Mirjam es noch nicht merkt, dann soll sie merken und erkennen, dass er auch in ihrer Gegenwart da ist.
Auf die Anrede Jesu antwortet Maria wiederum (W554), indem sie „ihrerseits Jesus mit einem einzigen Wort an[redet], das Johannes auf Hebräisch bietet: ‚Rabbuni.‘ Er übersetzt es sofort mit ‚Lehrer‘.“ Zu dem Wort „rabboní oder rabbuni‘ = ,mein Herr‘“, das auf „rabbón“, eine „Nebenform von rabbán, … ,Lehrer, Herr‘“, zurückgeht, erwähnt Wengst, dass es „sich im rabbinischem Schrifttum öfter als Anrede an Gott“ findet. Außerdem erinnert er daran, dass „Johannes … in 1,38 rabbí mit didáskale (‚Lehrer‘) wiedergegeben“ hat. „Dasselbe tut er hier mit rabbuní. Für ihn besteht also zwischen ‚Rabbi‘ und ‚Rabbuni‘ sachlich kein Unterschied.“ Daher hält Wengst es für „[u]nbegründet und unzutreffend …, wenn Schnelle <1441> ausführt, im Gegensatz zu rabbí habe rabbuní ‚einen Bekenntnischarakter‘“.
Hartwig Thyen (T762) gibt wie Vers 13 auch die Verse 14 und 15 inhaltlich wieder:
Kaum hat sie das gesagt, da wendet sie sich um und sieht nun Jesus vor ihr stehen. Doch trotz ihrer Wendung weg von Grab und Tod zu dem Lebendigen, der ihr gegenübersteht, begriff sie noch nicht, daß dieses Gegenüber Jesus war. Der redet sie nun mit den gleichen Worten an, wie zuvor die beiden Engel, indem er sie fragt: Frau, warum weinst du? Wen suchst du denn? Und sie, in dem Glauben, daß er der Gärtner sei, erwidert ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir doch, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen.
Als „ein produktives Mißverständnis“ will es Thyen in diesem Zusammenhang bezeichnen, dass „Maria ihren Herrn für den Gärtner hält“,
denn als der Herr des kēpos {Gartens} (vgl. 18,1 {Thyen zitiert versehentlich 18,14}; 19,41f) – im Alten Testament traditionell der Ort der Königsgräber und zumal des Davidsgrabes – ist Jesus in der Tat nicht nur der kēpouros {Gärtner}, sondern zugleich auch der, der den Toten weggeschafft hat. Sein Garten ist der Ort des Lebens, wie denn dieser ,Gärtner‘ allein die Vollmacht hat, sein Leben hinzugeben, so hat er allein auch die Vollmacht es wieder an sich zu nehmen (10,18) und es, wie einst Gott dem ersten Menschenpaar, den Seinen einzuhauchen (20,22). So ruft dieser Garten wohl nicht zufällig den Garten Eden in Erinnerung.
Zu Vers 16 weist Thyen ausdrücklich darauf hin, dass Jesus Maria „in ihrem eigenen Idiom“ anredet, nämlich auf Aramäisch (T762f.):
Mirjam (Mariam). Und daran erkennt sie nun in ihm ihren Herrn wieder. Er ist der gute Hirte, dessen Stimme ihr vertraut ist und der alle seine Schafe namentlich kennt und sie zu sich ruft (10,3ff.2f). Wie er sie mit ihrem hebräischen Namen Mirjam genannt hat, so antwortet sie ihm jetzt in der ihnen gemeinsamen Muttersprache mit der Anrede: rabbouni, was der Erzähler durch die Bemerkung kommentiert, das heißt: mein Meister. Mit dieser Anrede erweist Maria, daß sie jetzt zur reifen Meisterschülerin ihres Lehrers geworden ist, und erst mit diesem intimen Wortwechsel ist der Bann des Todes gebrochen, der auf ihr lastete …
Ton Veerkamp <1442> nimmt den Umstand, dass Maria Jesus zunächst nicht erkennt, zum Anlass für grundsätzliche Erwägungen über seine Art und Weise einer politischen Lektüre biblischer Texte:
Sie kann von sich aus Jesus nicht selbst sehen, und wenn er selber da wäre. Sie hält ihn für einen Gärtner, der für die Ordnung im Garten zuständig war und der am Tag nach dem Pascha die vor dem großen Schabbat eilig bestattete Leiche weggeschafft hatte. Jesus ist nicht zu erkennen, wenn er sich nicht selbst zu erkennen gibt. Das gilt nicht nur für Maria, es gilt allgemein. Man kann unsere Texte so politisch – ja, materialistisch – lesen und erklären, wie man will, dem Außenstehenden bleibt die Große Erzählung verschlossen. Die Indizien im verlassenen Grab sind eben nicht mehr als das, Beweise gibt es hier nicht. Für jeden Menschen, auch für Maria, war der Tod Jesu wie der Tod jedes anderen Menschen auch einfach das letzte Wort. Es gibt eben nur den Gärtner, der auch nicht mehr weiß als Maria und nur fragen kann: „Frau, warum weinst du, wen suchst du?“ Etwas anderes als den Gärtner kann hier niemand sehen.
An dieser Stelle zeigt sich jedoch, dass das, was Ton Veerkamp im Rückgriff auf Begriffe aus der marxistischen Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse als politische oder materialistische Exegese versteht, ihn nicht daran hindert, als biblischer Theologe Einsichten zu formulieren, die Jesus als den einzigartigen vom Gott Israels autorisierten Lehrer ernst nehmen, durch den allein gewährleistet ist, dass die „Große Erzählung“ Israels mit ihren Hoffnung auf die radikale Veränderung dieser Welt nicht einfach ein Sammelsurium leerer Versprechungen darstellt:
Jesus gibt sich erst zu erkennen, indem er den Namen Marias ausspricht. In dem Augenblick, wo sie sich angesprochen weiß, kann sie ihn als ihren Lehrer erkennen. Das Verhältnis zwischen Jesus und Maria aus Magdala hat zu den wüstesten Phantasien Anlass gegeben. Bei Johannes ist das Verhältnis klar: Er ist der Lehrer, sie die Schülerin. Johannes erklärt sein aramäisches rabbuni ausdrücklich durch das griechische didaskale, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Sie wird durch den Lehrer und seine Lehre angesprochen, und sie lässt sich ansprechen. Aber auch das geschieht nur, weil er sie anspricht, nicht weil sie sich auf ihn einlässt. Glauben, Vertrauen, ist kein „Werk“, sondern Vertrauen wird erweckt, indem die Vertrauende selbst, mit ihrem Namen, von dem, dem das Vertrauen gilt, angesprochen wird.
↑ Johannes 20,17-18: Jesus beauftragt Maria Magdalena mit der Botschaft an seine Brüder, dass er, der „noch nicht“ zum VATER aufgestiegen ist, zu ihm aufsteigt
20,17 Spricht Jesus zu ihr:
Rühre mich nicht an!
Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater,
zu meinem Gott und eurem Gott.
20,18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern:
„Ich habe den Herrn gesehen“,
und was er zu ihr gesagt habe.
[12. Februar 2023] Nachdem (W554) Maria Magdalena „Jesus erkannt“ hat und, „wie die Anrede zeigt, den vertrauten Umgang mit ihm wieder aufnehmen“ will, „entzieht sich Jesus“ Wengst zufolge nach Vers 17 „solch rückgreifendem Zugriff“:
Sie muss lernen, dass seine Gegenwart nach seinem Tod eine andere ist als vorher. Es verhält sich hier ganz analog wie in der Erzählung von den beiden Schülern auf dem Weg nach Emmaus, denen sich Jesus als von ihnen unerkannter Mitwanderer zugesellte (Lk 24,13-35). Als sie ihn am Brotbrechen endlich erkannten, „wurde er vor ihnen unsichtbar“. Vor Mirjam wird Jesus zwar nicht unsichtbar, aber er entzieht sich ihr. Er sagt: „Halt mich nicht fest!“ In der Lutherübersetzung steht: „Rühre mich nicht an!“
Da Jesus „nicht nur vermeintlich tot“ war und „auch nicht in das Leben vor dem Tod zurückgekehrt“ ist, „sondern zu einem Leben aufgeweckt, das den Tod nicht noch einmal vor sich hat, sondern ein für alle Mal hinter sich“, kann die
Wirklichkeit dieses neuen Lebens … nicht mit den Kategorien der alten Welt erfasst werden. Jesu Aufforderung, ihn nicht anzurühren, steht im griechischen Text im Präsens. Der verneinte Imperativ Präsens „bezeichnet den Abbruch einer bereits im Gange befindlichen Handlung, manchmal auch die Unterlassung einer beabsichtigten Handlung“. <1443> Gemeint ist also: „Halt mich nicht fest!“ oder noch zugespitzter: „Lass mich los!“ Mirjam muss lernen – und mit ihr soll die Gemeinde es lernen -, das Bild des irdischen Jesus loszulassen. Es geht nicht um die Beschwörung des Vergangenen, sondern um seine wirksame Vergegenwärtigung. Es geht nicht um die Pflege des Andenkens an einen Toten, sondern darum, ihn als Lebendigen zu gewärtigen.
Mit zwei Zitaten (Anm. 445) von Marquardt und Ruschmann <1444> unterfüttert Wengst diese Interpretation, die die Beziehung zum auferweckten Jesus in ihrer besonderen Dimension der bestehen bleibenden „Entzogenheit“ beschreibt. Friedrich-Wilhelm Marquardt schreibt:
„Das neue Leben ist geschützt davor, je noch einmal unterworfen zu werden. Es hat, was dies betrifft, einen Charakter der Entzogenheit. […] Realistische Beziehung zum Auferweckten muß nicht nur Abstand wahren, sie kann nur Beziehung in jener Entzogenheit sein, die ein Sein ,bei meinem Vater und bei eurem Vater‘ bedeutet (Joh 20,17b).“
Und Susanne Ruschmann betont, dass
der Auferstandene … den Weg in eine andere Art der Gemeinschaft [weist]. Doch um den Weg in dieses dauerhafte Beieinander-Bleiben voranzugehen, muss er, nach menschlichen Kategorien, losgelassen werden.“ „Sie ,lässt los‘ bzw. wendet sich vom Grab ab und geht den Weg in die Verkündigung. In dieser Wende vollzieht sie selbst eine Auferstehung von der trauernd Suchenden zur Verkündigerin der Osterbotschaft“.
Was Maria Magdalena hier erfährt, läuft nach Wengst (W555) darauf hinaus, dass „es Johannes auf die Präsenz Jesu in der Gegenwart der Gemeinde ankommt“. Das
zeigt sich daran, wie er Jesus seine Aufforderung begründen lässt: „Denn noch bin ich nicht hinaufgestiegen zum Vater.“ In dem Auftrag an Mirjam, was sie Jesu Schülern ausrichten soll, sagt Jesus im Präsens: „Ich steige hinauf.“
Was will Wengst damit aber sagen? Geht man unbefangen an diese beiden Sätze heran, deutet zwar das „noch nicht“ vollzogene Aufgestiegen-Sein darauf hin, dass Jesus sich sozusagen noch im Diesseits befindet, in dem die Gemeinde lebt, aber das im Aufsteigen-begriffen-Sein würde einer solchen Vorstellung dann doch wieder entgegenstehen. Keinesfalls will Wengst, wie es beispielsweise Schnelle <1445> tut, aus „diesen Aussagen auf einen „Zwischenzustand“ Jesu … schließen“, denn das „wäre der Versuch, etwas zu verobjektivieren, was nicht verobjektivierbar ist.“
Zum Verständnis des „noch nicht“ lehnt sich Wengst an einen Vorschlag von Bultmann an, der in ähnlicher Form bereits von Luther <1446> formuliert wurde:
Wenn von Jesus als Auferwecktem, der nicht in das Leben vor dem Tod zurückgekehrt ist, in Begegnung mit Menschen erzählt wird, kann das nicht anders geschehen, als dass er dabei in einer eigenartigen Schwebe bleibt. Bultmann hat sachlich Recht, wenn er meint, das „noch nicht“ gelte „im Grunde nicht von Jesus, sondern von Maria: sie kann noch nicht in Gemeinschaft mit ihm treten, ehe sie ihn als den erkannt hat, der, den weltlichen Bedingungen enthoben, beim Vater ist“.
Weiter erinnern nach Wengst die
Aussagen Jesu, dass er noch nicht zum Vater hinaufgestiegen sei und dass er hinaufsteige, … an frühere Ausführungen – vor allem in den Abschiedsreden -, die er im Blick auf seinen Tod gemacht hat: Dass er dahin aufsteige, wo er vorher war (6,62); dass er zum Vater gehe (14,12, 16,5). Mit dieser Ankündigung verbunden war die Verheißung der Geisteskraft als Beistand (14,16f.; 16,7), der Jesus „wieder-holen“ wird im erinnernden Zeugnis (14,26, 15,26). Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass diese Ankündigung sich vollzieht. Aber die Schüler wissen es noch nicht. Dazu, dass sich das Verheißene realisiert, bedarf es ihres Glaubens, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz kein ein für alle Mal Gescheiterter und Erledigter ist, sondern als ihr Herr lebendig gegenwärtig. Daher kann Jesu Aussage, noch nicht zum Vater hinaufgestiegen zu sein, auch in der Weise zugespitzt werden: Bevor er sich in seiner Lebendigkeit ihnen nicht eindrücklich gemacht und sich in ihrem Glauben ausgeprägt hat, ist er auch „noch nicht zum Vater hinaufgestiegen“.
Dieses „noch nicht“ ist also nach Wengst nicht auf ein Geschehen zu beziehen, das sozusagen objektiv noch nicht vollzogen ist, sondern das bisher subjektiv von den auf Jesus Vertrauenden noch nicht nachvollzogen wurde. Damit Letzteres ermöglicht wird,
erhält Mirjam einen Auftrag. Zu ihr, die den gestorbenen Jesus loslassen soll, um für den kraft des Geistes begegnenden lebendigen offen zu sein, der doch kein anderer ist als der, der gelebt hat, wird gesagt: „Doch geh zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich steige hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott.“
Mit einem Zitat (Anm. 448) von Jürgen Ebach <1447> deutet Wengst einen Grund an, warum ausgerechnet Maria mit dieser Botschaft betraut wird:
„Wenn unter allen Maria den Auftrag bekommt, die Gemeinde in eine neue Beziehung zum Auferstandenen hineinzurufen, eine Beziehung, in der er in der geschwisterlichen Liebe in der Gemeinde präsent ist, dann doch vielleicht auch, weil sie, der das Loslassen schwer fällt, verbürgt, daß in der neuen Beziehung die alte bewahrt bleibt“.
Aus dem Umstand (W555), dass „Jesus hier einer Frau die grundlegende Zeugenfunktion zuweist und diese damit den Schülern Jesu nicht nur voraus ist, sondern gerade ihnen gegenüber zur Zeugin wird“, zieht Wengst den Schluss (W555f.),
dass Frauen in der Gemeinde des Johannes dieselben Rollen wahrnahmen wie Männer und dass Johannes nichts dagegen einzuwenden hatte – im Unterschied zu späteren Auslegern.
Zur Frage, ob das in dieser Allgemeingültigkeit zutrifft, verweise ich auf die Überlegungen Veerkamps, die er in seiner Auslegung von Johannes 20,1-2 zur Rolle der Frauen im Gegenüber zur männlichen Führung der messianischen Gemeinden anstellt. Zu Recht stellt Wengst allerdings fest, dass Johannes die ausschließlich auf Männer beschränkte Funktion der Verkündigung massiv in Frage stellt. Interessant ist die Art und Weise (Anm. 449), in der der Reformator Calvin <1448>
sehr wohl [bemerkt], welche Konsequenzen in dem Auftrag Jesu stecken, aber er schiebt ihnen ganz schnell einen Riegel vor: „Sie sollen (Calvin nimmt in Harmonisierung mit den synoptischen Evangelien mehrere Frauen an) den Aposteln verkünden, was diese später – und damit übten sie ein ihnen übertragenes Amt aus – der ganzen Welt bekanntmachten. Darum jedoch sind diese Frauen nicht etwa weibliche Apostel. Deshalb wäre es falsch, dieser einmaligen Anordnung Christi ständige Gültigkeit zuzuschreiben und den Frauen das Taufen zu erlauben. Wir wollen uns damit begnügen, daß Christus in ihnen den unermeßlichen Reichtum seiner Gnade sichtbar werden ließ, indem er sie ein einziges Mal zu Lehrerinnen der Apostel machte. Zur Regel werden lassen wollte er es nicht“.
In der Formulierung (W555) der Botschaft, die Jesus durch Maria übermitteln lässt: „Doch geh zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich steige hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott“, macht Wengst darauf aufmerksam, dass Jesus hier erstmals im Johannesevangelium von Gott auch als vom Vater seiner Schüler und von den Schülern als seinen Brüdern spricht:
In seinem Auftrag an Mirjam unterscheidet Jesus nicht zwischen seinem Gott und Vater und dem Vater und Gott seiner Schüler. Als seine Brüder sind sie Kinder Gottes. An keiner Stelle vorher im Johannesevangelium hat er seine Schüler als seine Brüder bezeichnet. Das tut er erst jetzt, da sie ihn nach seinem Tod neu gewärtigen sollen. Mit seinem Tod hat er ihnen die Liebe Gottes vermacht und ihnen als sein Vermächtnis das Gebot gegeben, einander zu lieben (13,34f.). Die geschwisterliche Gemeinde wäre dann auch der Ort, an dem die lebendige Gegenwart Jesu erfahren werden könnte.
Auf die Frage, ob das Stichwort „Brüder“, das ja im Johannesevangelium hier keineswegs zum ersten Mal auftaucht, wirklich im Sinne dieser Geschwisterlichkeit auszulegen ist, komme ich im Zusammenhang mit Veerkamps Auslegung der Stelle zurück.
Zur Frage, ob sich Jesu Verhältnis zu Gott als dem Vater in grundlegender Weise von dem Verhältnis anderer Gotteskinder zu Gott unterscheidet, setzt sich Wengst zu Recht kritisch mit Frey, Wilckens und Zumstein <1449> auseinander (Anm. 450):
Nach Frey wird hier „betont, daß sein (Jesu) eigenes Sohnesverhältnis von dem der Gotteskinder bleibend kategorial unterschieden“ sei. Das kann ich an dieser Stelle nicht finden. Es ist dieselbe Metaphorik, in der Jesus in Bezug auf sich und in Bezug auf die Schüler spricht. Der behauptete kategoriale Unterschied ergibt sich nicht von diesem Text, sondern nur, wenn man unter der Hand eine Teilnahme Jesu am „Wesen“ Gottes in ihn einliest. Wilckens schreibt zu dieser Stelle: „Indem er zu seinem Vater geht, wird sein Vater zum Vater der Seinen, und sein Gott (dessen ,einziggeborener Sohn‘ er ist 1,14) zu ihrem Gott (worin sich die große Verheißung zu Anfang des Dekalogs allererst wirklich erfüllt ,Ich bin J[…] (von W. ausgeschrieben), dein Gott“, Ex 20,2)“ (ähnlich Zumstein: „der Gott Jesu wird zum Gott der Jünger“). Damit wird die im ersten Gebot ausgesprochene konkrete Bindung Gottes an sein Volk Israel gelöst und es zugleich unsichtbar gemacht, dass Jesu Gott kein anderer ist als der Gott Israels. Dazu kommt es, weil eine Verheißungsaussage, die den sich auf Jesus Beziehenden Gewissheit geben soll, durch ihn mit Gott verbunden zu sein, dogmatisch gelesen und exklusiv verstanden wird.
Nach Vers 18 ist (W556f.) „die geschwisterliche Gemeinde“ Wengst zufolge
jedenfalls der Ort, an den Mirjam aus Magdala sich gewiesen weiß: Sie „ging und meldete den Schülern: ,Ich habe den Herrn gesehen‘ – und dass er ihr das gesagt hatte.“ In der eigenartigen Struktur des Schlusses, dass Johannes zunächst Mirjam in direkter Rede sprechen lässt, dann aber zu indirekter Rede übergeht, ist ein Doppeltes ausgedrückt: Einmal entledigt sich Mirjam ihres Auftrags; das wird in indirekter Rede summarisch mitgeteilt. Zum anderen und vor allem aber formuliert sie die ihr widerfahrene Begegnung mit Jesus selbst aus in einem bekennenden Zeugnis: „Ich habe den Herrn gesehen.“ Sie wird zur Zeugin der Gegenwart Jesu, indem sie ihn als lebendigen Herrn bekennt. Und das heißt zugleich, dass die Herrschaftsansprüche anderer Herren abgewiesen werden. Unter der Herrschaft dieses einen Herrn gewinnt Geschwisterlichkeit Raum. Gegenüber all den vielen Herrschaftsansprüchen schafft das Bekenntnis zu ihm Raum, indem es mit ihnen aufräumt; und darin gewinnt dieser Herr selbst Raum, ist er da. Mirjam ist die erste Zeugin solcher Gegenwart Jesu: „Ich habe den Herrn gesehen.“
Die Geschwisterlichkeit (W557), die hier unter der Herrschaft Jesu als des Herrn entsteht, zeigt sich nach Wengst bereits darin, dass
Mirjam, eine Frau, … in diesem Kapitel mehrfach die Erste [ist]. Sie ist die Erste am Grab und sieht, dass der Stein weggenommen ist. Erst auf ihre Nachricht hin folgt der seltsame Wettlauf zum Grab zwischen Petrus und „dem anderen Schüler, den Jesus liebte“. Aber die Konkurrenz der Männer bleibt folgenlos. Mirjam ist die Erste, der Jesus nach seinem Tod begegnet; und sie ist die Erste, die ihn bezeugt. Erst danach erscheint er den Schülern. Deren anschließendes Zeugnis gegenüber dem abwesenden Thomas lautet nicht anders, als es Mirjam ihnen gegenüber ausgesprochen hat: „Wir haben den Herrn gesehen.“ Schon in dieser Darstellung zeigt es sich, wie unter der Herrschaft dieses einen Herrn patriarchale Herrschaftsansprüche zerbrechen und Geschwisterlichkeit entsteht. Die summarische Mitteilung in indirekter Rede – „und dass er ihr das gesagt hatte“ – bereitet zugleich die nächste Erzählung vor. In dieser Mitteilung steckt, dass sich das in den Abschiedsreden Angekündigte nun zu vollziehen beginnt.
Mir scheint, dass Wengst zu blauäugig formuliert. Mag der Evangelist Johannes auch patriarchale Herrschaftsansprüche anknacksen wollen, im Kreis der männlichen Schüler, zu denen Maria gesandt wird und die wiederum von Jesus mit einem allgemeinen Sendungsauftrag betraut werden, spielen weder Maria noch andere Frauen eine Rolle. Und auch im Schlusskapitel agieren nur Männer, und es ist der Apostel Petrus, der von Jesus unwidersprochen die Führungsrolle zugesprochen bekommt.
Hartwig Thyen (T763) sieht in der Aufforderung Jesu an Maria in Vers 17:
mē mou haptou …: „Halte mich nicht fest!“ oder: „Halte mich nicht auf, denn noch bin ich nicht aufgefahren zu meinem Vater“, … erkennbar ein Spiel mit dem Verhalten der Frauen in dem matthäischen Prätext: ekpatēsan autou tous podas {sie umfassten seine Füße} (Mt 28,9). Denn der Gebrauch des verneinenden mē mit dem nachfolgenden Imperativ Präsens fordert zum Abbruch einer andauernden Handlung auf und spricht nicht etwa ein grundsätzliches Berührungsverbot aus, wie das die meisten Kommentatoren behaupten. mē mou haptou heißt also nicht: ,Rühr mich nicht an!“ (Noli me tangere!), sondern: ,Halte mich nicht auf!‘, in dem sprichwörtlichen Sinn, daß man Reisende nicht aufhalten soll. Maria und mit ihr alle potentiellen Leser müssen es lernen, in Jesu Abschied einzuwilligen, denn nur so wird seine Gegenwart fortan erfahrbar bleiben (vgl. Wengst {siehe oben}). Wie die Fortsetzung zeigt, ist Jesus bereits unterwegs zu seinem Vater.
Thyen geht also davon aus, dass sich „Jesu Auferstehen aus dem Grabe und sein Aufstieg zu seinem Vater, also Ostern und Himmelfahrt, … – ebenso wie die pfingstliche Anhauchung mit dem Heiligen Geist (V. 22f) – am gleichen Tage“ ereignen:
Von einem erneuten, vierzig Tage währenden, irdischen Wirken des auferstandenen Jesus (di‘ hēmerōn tesserakonta {vierzig Tage lang}: Act 1,3) und seiner erst danach erfolgenden Himmelfahrt will Johannes offenbar nichts wissen. … Für irgendeinen „Zwischenzustand“ Jesu [so Schnelle 303] ist jedenfalls bei Johannes kein Platz. Auch als Auferstandener ist und bleibt Jesus der unter Pontius Pilatus gekreuzigte Jude aus Nazaret, in dem der ewige logos Fleisch geworden ist. Und diese Fleischwerdung ist keine Episode in der Geschichte eines ewigen Geistwesens …
Für problematisch hält Thyen die Auffassungen von Wilckens und Bultmann hinsichtlich der Bedeutung der Ostererzählungen im Johannesevangelium:
Wilckens [309f.] erklärt, Johannes, der in Wahrheit nicht nur Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten zusammenfallen lasse, sondern diese drei auch noch mit der Kreuzigung Jesu identifiziere, handle gegen seine eigene theologische Überzeugung, wenn er überhaupt von Ostern erzähle! Und wenn er das dennoch tue, so habe das seinen Grund darin, daß er die „die Geschehenswirklichkeit der Auferstehung des Gekreuzigten“ keinesfalls preisgeben wolle. Sei die Auferstehung aber ein wirkliches Geschehen, dann müsse sie auch erzählbar sein. Darum sei es nicht nur (!) seine Reverenz vor der kirchlichen Tradition, die ihn die Ostergeschichten – wenn auch auf seine spezifische Weise – erzählen lasse, sondern das liege durchaus auch in seinem eigenen theologischen Interesse. Freilich müsse er dabei von Ostern im Widerspruch zu seinem eigenen Verständnis der Auferstehung Jesu erzählen. Und so komme es dann in 20,17 „zu der eigenartigen Aussage Jesu, daß er zwar auferstanden, also verherrlicht ist und in seiner geistlichen Existenzweise Maria erscheint, in der sie ihn nicht mehr leibhaft berühren kann, wie in der Zeit vor seinem Tod, – daß er aber gleichwohl noch nicht zum Vater aufgestiegen ist“. Darin folgt er in gewisser Weise Bultmann, der ebenfalls Karfreitag und Ostern identifiziert, die Ostererzählungen für ,eigentlich‘ überflüssig hält und in ihnen darum nur symbolische Illustrationen des Kreuzigungsgeschehens sieht. Aber auch wenn sich das Recht kaum bestreiten läßt, daß für Johannes Jesu Kreuzigung als seine Erhöhung sowie seine Auferstehung und Auffahrt zu seinem Vater zwei Seiten nur einer Medaille sind, so bleiben sie doch auch für ihn zwei unverwechselbare und nicht zu identifizierende Seiten. Und daß Maria Jesus nicht mehr leibhaft berühren kann (Wilckens), sagt der Text ja gar nicht. Sie soll ihn vielmehr loslassen, und das kann ja nicht heißen, daß er jetzt zu einem unberührbaren Geistwesen geworden wäre!
Thyens eigene Auffassung scheint also darauf hinauszulaufen, dass es der Mensch Jesus selbst ist, der als der Gekreuzigte am Tage seiner Auferstehung den Aufstieg zum Vater vollzieht.
Dass der Evangelist Johannes einer Frau die Rolle als erste Osterzeugin überlässt, ist nach Thyen besonders hervorzuheben (T763f.):
Seinen Jüngern zu verkünden, daß sie Jesus gesehen hat, daß er lebt und jetzt auffährt zu seinem und ihrem Vater, sendet er die Magdalenerin Maria als die erste Zeugin seiner neuen österlichen Gegenwart. Wie der geliebte Jünger zuvor Petrus den Vortritt in das Grab Jesu überließ, so überläßt er mit seinem Schweigen über sein Glauben nun auch der zur Jüngerin Jesu gewordenen Maria den Vorrang, als erste Osterzeugin vor die männlichen Jünger zu treten. Im Gegensatz zu Paulus, der 1Kor 15,5ff Petrus als den ersten Osterzeugen benennt, und nahezu der gesamten kanonischen Tradition ist dieses bei Johannes mit Maria eine Frau!
Da Thyen davon ausgeht (T764), dass Jesus an diesem Tag bereits in den Himmel aufsteigt, wird er dann
[v]om Himmel her … am Abend dieses Tages zu seinen Jüngern kommen und auch ihren Todesbann lösen und ihnen an seinem Sieg teilgeben, mit dem er die Welt überwunden hat (16,33). Und am folgenden Sonntag – zur Zeit, da das Evangelium geschrieben wurde, sicher bereits der Tag der Feier seiner Auferstehung – wird er auch seinem vom Zweifel geplagten Jünger Thomas erscheinen, so daß der aus vollem Herzen bekennen kann: „Mein Herr und mein Gott“ (V. 28). Insofern besteht also zwischen dem mē mou haptou und der Aufforderung an Thomas, er solle doch seinen Finger in Jesu Nägelmale und seine Hand in seine durchbohrte Seite legen, auch überhaupt kein Widerspruch …
Dass „Jesu Sendungsauftrag an Maria“ an die Brüder Jesu gerichtet ist, veranlasst Thyen zu Erwägungen, die in eine ähnliche Richtung gehen wie bei Wengst mit seiner Betonung der Geschwisterlichkeit der Gemeinde:
Wohl dürfte auch der Auftrag: „geh hin und sage meinen Brüdern“ dem Prätext Mt 28,10 entstammen, wo Jesus den Frauen gebietet: „Geht hin und verkündet meinen Brüdern“. Doch damit folgt der Evangelist nicht einfach einer Quelle. Vielmehr ist Jesu bei ihm hier erstmals erscheinende Bezeichnung seiner Jünger als meine Brüder – im Gegensatz etwa zu Mk 3,31ff / Mt 12,49f – die große Überraschung. Schon in der Stunde seines Abschieds hatte Jesus ihnen erklärt, fortan seien sie nicht mehr blinde Sklaven, die nicht wüßten, was ihr Herr im Sinn hat, sondern seine Freunde, die er dazu erwählt habe, daß sie auch untereinander als Freunde bis zur Konsequenz der Lebenshingabe füreinander verantwortlich seien (15,12-17). Doch erst jetzt, nachdem Jesus das ihm aufgetragene Werk des Vater sterbend vollbracht und die Schrift erfüllt hat, sind seine Freunde zu seinen Brüdern geworden.
Wie Wengst lässt Thyen dabei allerdings außer Acht, dass Johannes selbst bereits in 2,12 von Jesu Brüdern in deutlicher Unterschiedenheit von seinen Schülern gesprochen hat, als ob er sie als eine gesonderte Gruppe bezeichnen wollte, und dass Jesus mit eben dieser Gruppe im Zusammenhang mit dem Aufstieg nach Jerusalem beim Laubhüttenfest (7,3.5.10) einen Konflikt auszufechten hatte. Da Thyen selbst die Stellen Markus 3,31ff. und Matthaus 12,49f. erwähnt, in denen es ebenfalls um eine Auseinandersetzung mit Jesu leiblichen Brüdern geht, ist es um so erstaunlicher, dass er die bisherigen Erwähnungen dieser Brüder Jesu im Johannesevangelium selbst in seine Überlegungen überhaupt nicht einbezieht.
Zu der Formulierung, die Maria den Brüdern Jesu ausrichten soll: „Ich steige (jetzt) hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott“, hebt Thyen hervor, dass er damit „Gott, den er bisher in einer auffälligen Exklusivität stets nur als ,meinen Vater‘ bezeichnet hatte, nun auch ihren Vater und ihren Gott“ nennt. Dabei scheint er Dorothy Lee <1450> zuzustimmen, die zwischen der Vaterbeziehung Jesu und seiner Schüler zu Gott Nuancierungen feststellt:
„Diese Sprache drückt das starke Empfinden der Identifikation zwischen Jesus und seinen Jüngern im Verhältnis zu Gott aus. Aber sie ist auch sorgfältig nuanciert, um den Unterschied im Status zwischen Jesus und seinen Jüngern zu verdeutlichen. Die Bundesbeziehung, in der die Gläubigen zu Gottes ‚Familie‘ werden, hängt von Jesus als Sohn ab (14,5; auch 10,7.9).“
Zu weit geht in den Augen von Thyen aber Wilckens [310], wenn er meint, dass sich nach dem Johannesevangelium
mit Jesu Wort von ,eurem Vater und Gott‘ „die große Verheißung zu Anfang des Dekalogs allererst wirklich erfüllt (habe): ‚Ich bin Jahwe, dein Gott‘, Ex 20,2“ …, denn „damit wird die im ersten Gebot ausgesprochene konkrete Bindung Gottes an sein Volk Israel gelöst und zugleich unsichtbar gemacht, daß Jesu Gott kein anderer ist als der Gott Israels“. Zudem ist natürlich auch Jesu Reden von ,eurem Gott‘ Verheißung, die wahrgenommen sein will, und kein Garantieschein {dazu Wengst, siehe oben).
Den Vers 18 referiert Thyen so knapp, wie dieser selbst ihm zufolge erzählt:
In äußerster Knappheit, und ohne daß Maria Jesu Auftrag an die Jünger vor ihnen noch einmal wörtlich wiederholte, berichtet der Erzähler am Ende dieser Szene nur noch, daß Maria ihren Auftrag erfüllt und den über das Leersein des Grabes verängstigten Jünger verkündet: „Ich habe den Herrn gesehen!“ und das Folgende habe er ihr gesagt: kai tauta eipen autē.
Dem fügt Thyen nur noch die Bemerkung an (T764f.), dass „es in diesem Evangelium auch erst jetzt nach Jesu Rede von ,meinem Vater und eurem Vater‘ an der Zeit“ wäre, „daß er seine neuen Brüder das Vater-Unser lehrte. Vielleicht hat Johannes auch darum dieses Gebet durch sein intertextuelles Spiel mit ihm in Jesu großem Gebet von Joh 17 ersetzt.“
Nach Ton Veerkamp <1451> ist die Auslegung des Wortes oupo {noch nicht} in Johannes 20,17 von entscheidender Bedeutung für seine politische Lektüre des Evangeliums. Und schon die ersten Worte: mē mou haptou, „Berühre mich nicht“, betrachtet er unter völlig anderen Gesichtspunkten als alle mir bekannten Ausleger und Auslegerinnen dieses Verses. So bestechend die von Wengst und Thyen vorgetragene Auffassung ist, hier gehe es darum, dass Jesus von Maria fordert, ihn nicht festzuhalten, nicht aufzuhalten auf seinem Weg des Aufstiegs zum Vater, sondern loszulassen, ist eine solche Bedeutung des Wortes haptein in der Bibel sonst überhaupt nicht belegt. In aller Regel gibt es das hebräische Wort nagaˁ wieder, das „anfassen, anrühren, antasten“ bis hin zum „schlagen“ meinen kann. Veerkamp bringt es in Verbindung mit dem strikten jüdischen Verbot der Berührung eines Leichnams:
Johannes erzählt nicht, dass Maria im Begriffe war, niederzufallen und seine Knie zu umklammern. Eine Reihe von Manuskripten fand das unlogisch und ergänzte: „Sie lief heran, um ihn zu berühren.“ Es handelt sich aber um ein absolutes Verbot, das auch begründet wird: „Denn ich bin noch nicht aufgestiegen zum VATER.“
Wir müssen hier die Torastellen Leviticus 11 und Numeri 19 besprechen. In Leviticus 11,24ff. wird gesagt, dass das Berühren von Tierleichen (thnēsimaion, nevela) unrein macht. Die Berührung verursacht „Unreinheit bis zum Abend“. Numeri 19,11ff. sagt:
Wer ein totes Menschenwesen, wer auch immer, berührt,
wird sieben Tage unrein.
Wer sich so verunreinigt hat, mache sich frei von Verirrung
am dritten Tag und am siebten Tag;
er wird rein.
Macht er sich nicht frei von Verirrung am dritten Tag und siebten Tag,
wird er nicht rein.
Jeder, der einen Toten, eine gestorbene Menschenseele, berührt
und sich nicht frei von Verirrung macht:
der hat die Wohnung des NAMENS verunreinigt.
Ausgerottet wird diese Seele aus Israel …Das Verb haptesthai, nagaˁ, „berühren“, recht häufig bei den Synoptikern, findet sich bei Johannes nur an dieser einen Stelle 20,17. Der Unberührbare ist der ganz und gar vom Tod gezeichnete Messias. Nicht anders wird er sich den Schülern zeigen.
Zwei Argumente lassen diese Auslegung Veerkamps von vornherein als abwegig erscheinen: Erstens, dass Thomas später dann doch von Jesus die Erlaubnis bekommt, ihn zu berühren, und zweitens, dass es unserem christlichen Empfinden zutiefst widerstrebt, den auferstandenen Jesus als den Inbegriff neuen, österlichen, vollkommenen Lebens nicht anders zu betrachten als eine Leiche, die man auf Grund ritueller Verbote nicht anfassen darf. Ich war zeitweise geneigt, zwar Veerkamps Auslegung des „noch nicht“ als überzeugend zu betrachten, aber mich gegen seine Sicht des „Berühre mich nicht“ zu entscheiden. Inzwischen frage ich mich aber doch, ob unsere christliche Vorstellung von der Auferstehung Jesu tatsächlich der Sichtweise des jüdischen Messianisten Johannes entspricht. Wenn er, was ja auch Wengst und Thyen nicht bestreiten, tatsächlich als ein toratreuer Jude gelebt hat und sogar bestattet wurde, und wenn er an seinen Wundmalen bleibend als der Gekreuzigte zu erkennen ist, dann ist es zumindest nicht völlig von der Hand zu weisen, dass der Versuch, diesen Gekreuzigten anfassen wollen, mit dem Toraverbot der Berührung eines Leichnams in Konflikt kommt. Das bezieht sich sicher erst recht auf die Absicht, den ermordeten Jesus als den Menschen, der er war, festhalten zu wollen, und vielleicht sogar auf Vorstellungen, ihn in einem jenseitigen Himmel, von dem Johannes die gesamte Bibel nirgends etwas zu berichten weiß, wiedersehen zu können.
Wenn solche Vorstellungen nicht die Sache des Johannes sind, worin besteht dann seine hoffnungsvolle Osterbotschaft?
Der Befehl und seine Begründung erklären sich gegenseitig. Beim Tod am Kreuz beginnt unaufhaltsam die Ehrung des Messias, beginnt unaufhaltsam der Aufstieg zum VATER. Wir haben das bei der Besprechung 12,28ff. gesehen. Der Tod und die Auferstehung sind aber keine Vollendung. Das Perfekt, das Johannes für vollendete Tatsachen verwendet, wird hier bestimmt durch das noch nicht: „Noch bin ich nicht hinaufgestiegen“ (oupō anabebēka). Das Perfekt ist, wie wir gesehen haben, bei Johannes die Wiedergabe einer in der Vergangenheit abgeschlossenen Handlung. Das noch nicht bezieht sich nicht auf das Verb selber, sondern auf die Zeitform, auf das Perfekt; nicht das Aufsteigen selber, sondern das Perfekt wird negiert.
Mit dieser negativen Botschaft wird Maria aus Magdala als erste Evangelistin zu den Brüdern Jesu geschickt: „Noch bin ich nicht zum VATER hinaufstiegen“, Perfekt, aber dann doch mit der entscheidenden positiven Botschaft: „Ich steige auf“, Präsens.
Im Klartext: Wenn die Ehre des Gottes Israels, also die Ehre des befreienden NAMENS, und damit auch die Ehre des Messias im Leben des Volkes Israel inmitten der Völker besteht und diese Ehre mit dem Aufstieg des Messias zum VATER beginnt, dann ist dieses Aufsteigen nicht einfach ein Ortswechsel vom Diesseits zum Jenseits, von der Erde zu einem als Aufenthaltsort Gottes verstandenen Himmel. Anders gesagt: Jesu irdisches Leben ist nicht einfach eine Zwischenstation zwischen seinem vorherigen und nachmaligen Leben im Himmel, in den er zurückkehren würde, ohne dass sich an Israels Schicksal der Versklavung unter eine weltweite Gewaltherrschaft irgendetwas ändern würde. Das heißt: Jesu Aufstieg zum VATER ist nicht beendet, bis nicht jede Gewaltherrschaft auf Erden von der Herrschaft seiner agapē überwunden und abgelöst worden ist.
Im Blick auf die Brüder Jesu, zu denen er Maria ausdrücklich entsendet, nimmt Veerkamp ernst, was bisher im Johannesevangelium von diesen gesagt war. Der Konflikt Jesu mit diesen Brüdern besteht nach Johannes gerade darin, dass diese mit dem hier von Jesus ausgesprochenen „noch nicht“ große Schwierigkeiten haben. Sie hatten Jesus beim Laubhüttenfest zur öffentlichen Wirksamkeit gedrängt, die Veerkamp im Sinne zelotisch-messianischer Aktionen gegen die römische Besatzungsmacht interpretiert:
Die – leiblichen – Brüder Jesu gehörten zur ursprünglichen messianischen Gemeinde, 2,12. Dort wird ein Unterschied zwischen „den Brüdern“ und „den Schülern Jesus“ gemacht. Dieser Unterschied wird deutlich in der Auseinandersetzung Jesu mit seinen Brüdern anlässlich des Aufstiegs nach Jerusalem zum Sukkotfest. Tatsächlich geht Maria, wie es im folgenden V.18 heißt, zu allen „Schülern“; dass Jesus sie seine „Brüder“ nennt, unterstreicht deutlich, wie sehr in den Augen des Johannes die führenden Kreise der messianischen Gemeinde in Jerusalem nach wie vor zelotisch infiziert waren. Ihnen muss gesagt werden: „Ich steige auf.“
Das Präsens ist ein semitisches Präsens, es deutet eine Handlung an, die begonnen wurde und die bis in die Zukunft fortdauert. Auch wenn das Grab Jesus nicht halten kann, bleibt er, der Lebende, dennoch ein Toter, eine lebende Leiche, die man nicht berühren darf – beides! Deswegen wäre das Perfekt fehl am Platze. Die Bewegung zum VATER beginnt am Tag eins. Das ist das Einzige, aber es ist alles. Es gibt keine Garantien, aber am Tag eins ist die Todesgeschichte der herrschenden Weltordnung wieder offen.
Auf der Ebene der Erzählung, also der Situation des Johannes nach dem Jahr 70, heißt das: Der Gemeinde der Brüder Jesu, die in der Zeit vor dem Krieg eine herausragende Position unter den messianischen Gemeinden hatte bzw. noch immer eine solche für sich in Anspruch nimmt, muss gesagt werden: „Nichts ist abgeschlossen; weder Kreuz noch Auferstehung schließen die Bewegung ab.“ Offenbar beinhaltet das Präsens eine deutliche Kritik an der Politik der Gemeinde der Brüder Jesu.
Anders als Wengst und Thyen sieht Veerkamp in Jesu Erwähnung der Brüder in Johannes 20,17 also nicht als Anspielung auf Geschwisterlichkeit in der Schülerschaft Jesu. Dass Jesus Maria zu seinen Brüdern schickt und sie seine Botschaft den Schülern ausrichtet, dass also die Grenzen zwischen beiden Gruppierungen verschwimmen, mag vielmehr andeuten, dass Johannes trotz aller Kritik an zelotischen Neigungen in der unter dem Einfluss der Brüder Jesu stehenden Jerusalemer Gemeinde es nicht für ausgeschlossen hält, dass sie für die Botschaft Jesu ansprechbar bleibt:
Aber das Präsens und die Kritik heben die fundamentale Gemeinsamkeit nicht auf. Jesus bleibt trotz aller heftigen Auseinandersetzungen (7,1ff.) mit der Gemeinde in Jerusalem verbunden: „Mein VATER, euer VATER, mein Gott, euer Gott“. Der Konflikt ging damals, 7,1ff., um den kairos {richtiger Zeitpunkt}. Dieser kairos ist jetzt gekommen, aber ganz anders als die Brüder Jesu dachten. Johannes rückte sie in die Nähe des zelotischen Abenteuers einer illusionären Machtergreifung. Der Nachfolgerin der Gemeinde der Brüder Jesu nach dem Krieg ist zu sagen: Der Kairos ist der Anfang eines Prozesses, unaufhaltsam vielleicht, aber nicht abgeschlossen.
Ton Veerkamp selbst ist sich dessen bewusst, wie ungewöhnlich seine Auslegung ist, die von der Unabgeschlossenheit des Aufsteigens Jesu zum VATER ausgeht. Daher beschäftigt er sich in seinem 10. und letzten lehrhaften Exkurs oder Scholion <1452> mit der Frage, ob denn der Tod und die Auferstehung des Messias nicht etwas beschreiben, das „ein für allemal“ für alle geschehen ist, die auf Jesus vertrauen. So jedenfalls scheint es der „Autor des Hebräerbriefes … zu unterstreichen: Anders als beim jährlichen Feiern und Erleben der Paschanacht sei der Tod des Messias ein Geschehen ‚ein für allemal‘ (ephapax, Hebräer 7,27; 9,12; 10,10; vgl. Römer 6,10).“
So groß sind in den Augen von Veerkamp die Unterschiede des christlichen Osterfestes zum jüdischen Passa aber gar nicht, zumindest wenn man es wie der Evangelist Johannes jüdisch-messianisch als Fest der weltweiten Befreiung interpretiert:
Während der jüdischen Feier der Paschanacht muss der Sohn den Vater fragen: „Warum ist diese Nacht verschieden von anderen Nächten? … Und je nach dem Auffassungsvermögen des Sohnes unterweist ihn der Vater. Er beginnt mit der Gnadenlosigkeit und beschließt mit der Ehre“, Mischna Pessachim 10,4. Jährlich wird diese Nacht durchlebt und gefeiert.
Die Christen verfahren nicht anders, zumindest nicht, wenn die jährlich wiederkehrende Liturgie der Osternacht einigermaßen schriftgemäß ist. Das Ephapax ist wie die Befreiung Israels. Wenn das Volk einmal und einmalig aus der Hand des Pharaos befreit wurde, bestimmt dieses einmalige Geschehen die ganze Geschichte des Volkes. Gleichzeitig musste diese Befreiung immer wieder erkämpft werden, und damit sie erkämpft werden kann, muss ihrer immer wieder gedacht werden.
Das klassische Dokument des immer wieder ist das Buch der Richter: da finden immer wieder Befreiungen statt, aber es wurde in jener Zeit nie das Pascha gefeiert, 2 Könige 23,22! Das Pascha der Juden ist wie das Ostern der Christen: Was einmal geschah, steht immer noch aus. Pharao wurde besiegt und Pharao regierte weiter. Rom ist besiegt, und Rom herrscht weiter. Die Nacht des Messias ist ohne die Nacht, in der der Todesengel an den mit dem Blut des Paschalamms beschmierten Türen vorbeiging, undenkbar.
Wenn man das, was am „Tag eins“ der Sabbatwoche ein für allemal geschieht, nicht einfach als die Rückkehr Jesu in den Himmel, sondern als Auftakt zur Befreiung der Welt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, betrachtet, dann muss man nach Veerkamp den
distanzierenden Ausdruck des Johannes: pascha Ioudaiōn, das Pascha der Juden (2,13; 6,4; 11,55), … mit großer Vorsicht behandeln. Hier wird kein jüdisches Pascha abgeschafft, sondern unter ganz neuen, römischen Verhältnissen dasselbe Pessach zugespitzt: als Verheißung für alle Völker. Deswegen ist das christliche Ostern nicht der Ersatz für das jüdische Pascha. Diesen Unterschied dürfen wir nicht unterschlagen.
Zur Begründung dafür, dass Johannes mit Jesu Auferstehung kein neuer christlicher Bund beginnt, der den alten Bund Gottes mit Israel ablöst, beruft sich Veerkamp auf den Propheten Jeremia:
Auch wenn Johannes nach unserer Lektüre des Evangeliums seine messianische Mission auf das weltweit zerstreute Israel inklusive der zehn verlorenen Stämme (Samaria) beschränkt hat, sieht er sich in der Tradition von Jeremia 31,31. Dort schließt der NAME mit Israel einen „neuen Bund“ (berith chadascha). Ein „Neues Testament“ mit einer neuen Zeitrechnung war keine christliche, sondern eine jüdische Erfindung! Vom Paschafest sagt Jeremia, 23,7f.:
Deswegen:
Da, Tage kommen, Verlautbarung des NAMENS,
da sagt man nicht länger:
Es lebe der NAME,
der die Söhne Israels hinaufgebracht hat aus dem Land Ägypten.
Nein! Es lebe der NAME,
der hinaufgebracht hat, der kommen ließ,
den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens,
aus den Ländern, wohin sie verschlagen wurden,
und wohnen werden auf ihrem Boden.Genausowenig wie Jeremia die Befreiung aus Ägypten überholt sah, genausowenig überholt der Tod des Messias die Befreiung aus dem Sklavenhaus Pharaos.
Allerdings sehen „Paulus und Lukas, wohl auch … Matthäus und letztlich auch … die Schule des Johannes“ das von Jesus durch seinen Tod und sein Aufsteigen zum VATER bewirkte Passa ausgeweitet zu einer „Verheißung für die Völker“, und genau an dem Punkt gingen nach Veerkamp die christliche Kirche und das rabbinische Judentum, „Ekklesia und Synagoge“, auseinander. Damit ist aber zunächst noch keine Absage an das Ziel der Befreiung Israels inmitten der Völker verbunden, keine Verjenseitigung solcher Hoffnungen auf ein Leben nach dem Tod mit Jesus im Himmel:
Der Tod des Messias macht Befreiung zu einer weltweiten Perspektive für alle Völker, nicht irgendeine Befreiung, sondern die Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus: Der Gott der Christen ist der Gott, dessen NAME nur ausgesprochen werden kann als der, „der Israel hinausführte aus dem Land Ägypten, aus dem Haus des Sklaventums“, Exodus 20,2. Die Eröffnung dieser Perspektive ist „ein für allemal“ geschehen. Hinter dieses „ein für allemal“ können und dürfen wir nicht zurück. Israel und die Völker, die Juden und die Christen, müssen freilich mit der Schule des Johannes sagen, 1 Johannes 3,2f., dass
noch nicht offenbar sein wird, was wir sein werden.
Wir wissen: Wenn er (der Messias) offenbar sein wird,
werden wir ihm gleich sein,
weil wir ihn dann sehen, wie er ist.Das Entscheidende ist geschehen, das ist die Botschaft des Johannes, aber dieses Entscheidende ist durch das noch nicht bestimmt. Der Aufstieg zum VATER bedeutet die Befreiung der Welt. Das ist der Augenblick, der kairos, auf den wir warten. Gerade der kairos des Messias „ist noch nicht erfüllt“, 7,8. Damals musste der Aufstieg zum Fest „nicht öffentlich (phanerōs), sondern im verborgenen (en tō kryptō)“ erfolgen, 7,10. Auch der auferstehende Messias bleibt der verborgene Messias. Die beiden Stellen 7,8 und 20,17 setzen sich gegenseitig voraus.
An dieser Stelle wird überdeutlich, welche Konsequenzen es hat, wenn Ausleger von Johannes 20,17 es vermeiden, diese Stelle im Zusammenhang mit Johannes 7,2-8 auszulegen.
Abschließend zu seiner Auslegung von 20,17 verweist Veerkamp auf den engen Zusammenhang, in dem auch im Vertrauen auf Christus das „ein für allemal“ mit dem „noch nicht“ und mit einem „immer wieder“ stehen:
„Noch nicht“ freilich hat „immer wieder“ als Konsequenz. Nikos Kazantzakis hat nach dem zweiten Weltkrieg einen Roman über einen jungen Hirten geschrieben, der versuchte, wie Christus zu leben, und der wie Christus ermordet wurde. Der Titel des Romans ist: Ho Christos xanastaurōnetai, Christus wird wieder gekreuzigt. <1453> Der Roman ist eine Parabel; er spielt in den Bergen von Westanatolien kurz vor der Vertreibung der Griechen aus Kleinasien durch Atatürk. Der Hirte Manolios, der Held des Romans, ist mehr als irgendein Grieche in einem bestimmten Augenblick der griechischen Geschichte. Christus erscheint ihm, sagt ihm, er solle seinen Leuten sagen: „Ich bin hungrig, gehe an die Türen des Dorfes und bitte um Almosen.“ Und Manolios sagt, was er sagen soll.
Er ist immer wieder unter uns, der Messias. Und Menschen wie Manolios werden immer wieder gekreuzigt, bis „offenbar sein wird, was wir sein werden“ (1 Johannes 3,2). Das Entscheidende ist, dass dieser ermordete Messias immer wieder unter uns ist, weil er noch nicht aufgestiegen ist. Im Roman Kazantzakis‘ weht der Wind der messianischen Inspiration.
Weil alles entschieden ist, müssen und können wir immer wieder von vorne anfangen. Der Messias ist da als der und die von ihm Inspirierte. Sie leben, weil und insofern sie vom Messias inspiriert sind. Ihr Leben ist jetzt schon und noch nicht das „Leben der kommenden Weltzeit“. Es ist nicht offenbar, es ist verborgen, wie der Messias verborgen ist.
In diesem Augenblick wird das klar, erzählt uns Johannes. Hinter diesen Augenblick kann niemand zurück. Deswegen ephapax, „ein für allemal“.
↑ Johannes 20,19-20: Jesus gibt sich den Schülern hinter verschlossenen Türen als der Gekreuzigte zu erkennen
20,19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche,
da die Jünger versammelt
und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden,
kam Jesus und trat mitten unter sie
und spricht zu ihnen:
Friede sei mit euch!
20,20 Und als er das gesagt hatte,
zeigte er ihnen die Hände und seine Seite.
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.
[13. Februar 2023] Zum Abschnitt Johannes 20,19-23 beschreibt Klaus Wengst (W557) einleitend, worauf seiner Ansicht nach die Auferstehung Jesu hinausläuft:
Das in den Abschiedsreden Angekündigte schloss ein, dass als Frucht des Todes Jesu Gemeinde entstehen würde. Die vorige Erzählung hat an der Gestalt Mirjams gezeigt, dass es der auferweckte Jesus selbst ist, der Einzelnen zum Glauben verhilft. Sie wurde daraufhin zu seiner ersten Zeugin. In der jetzigen Erzählung wird deutlich, dass Jesus selbst auch die Entstehung von Gemeinde bewirkt, indem er als Lebendiger inmitten seiner Schüler auftritt und handelt, die in ihrer Gesamtheit die Gemeinde repräsentieren.
Außerdem geht Wengst auf „einige Berührungen“ ein, die es zwischen „Joh 20,19-23 und Lk 24,36-43 gibt“, obwohl beide Erzählungen „aber auch deutlich voneinander“ abweichen:
Folgende Punkte sind gemeinsam: 1. Jesus erscheint vor allen Schülern. 2. Der Auferweckte tritt plötzlich und unvermittelt inmitten seiner Schüler auf. 3. Er entbietet ihnen den Friedensgruß. 4. Die Schüler freuen sich (bei Lukas allerdings verbunden mit Unglaube und Verwunderung). Der Punkt, der darüber hinaus noch angeführt werden könnte, markiert zugleich einen gewichtigen Unterschied: Nach Joh 20,20 zeigt Jesus seinen Schülern seine Hände und seine Seite, nach Lk 24,39f. seine Hände und Füße. Bei Johannes geht es bei diesem Motiv darum, dass der Auferweckte seine Identität an den Wundmalen des Gekreuzigten ausweist. Bei Lukas sind die Wundmale nicht im Blick.
Stattdessen (W557f.) konzentriert sich die „lukanische Erzählung“ ganz und gar auf den „Erweis seiner Leibhaftigkeit im Unterschied zu einem Geistwesen“, indem Jesus „auf seine Hände und Füße als die unbekleideten Körperteile“ hinweist, seine Schüler auffordert, „ihn zu betasten, damit sie sich von Fleisch und Knochen überzeugen“, und schließlich „seinen Schülern demonstrativ etwas vorisst (Lk 24,41-43)“. Wegen dieses erheblichen Unterschieds will Wengst (W558) zum „literarische[n] Verhältnis“ beider Texte zueinander keine „Mutmaßungen“ anstellen, sondern nur „ihr jeweiliges besonderes Profil“ herausstellen.
Schließlich hebt Wengst hervor, dass der Abschnitt in Vers 19 „mit einer neuen Zeitbestimmung“ beginnt:
Zuletzt war in V. 1 der frühe Morgen des ersten Wochentages angegeben worden. Unmittelbar anschließend spielten die ersten beiden Erzählungen dieses Kapitels. Nun erfolgt ein zeitlicher Sprung auf den Abend desselben Tages. Es ist noch nicht Nacht und also nicht der Beginn des neuen Tages vorausgesetzt. Die Schüler Jesu werden als an einem – nicht benannten – Ort im Haus versammelt vorgestellt. Das scheint das Zeugnis Mirjams bewirkt zu haben, dass sie sich nun versammelt haben. Aber die Türen sind „verschlossen aus Furcht vor den führenden Juden“. Jesu Schüler haben ihre eigene Ostererfahrung noch vor sich. Für sie ist bisher nur die Ankündigung Jesu von 16,33 eingetreten: „In der Welt werdet ihr bedrängt.“ Und das lässt sie Furcht haben. Die danach folgende Aufforderung haben sie noch nicht realisiert: „Aber habt Mut! Ich habe die Welt besiegt.“ Sie sind noch gelähmt vom Eindruck harter, leidvoller Realität. Dass Jesus ihr nicht unterworfen geblieben und so auch ihnen eine Perspektive eröffnet ist, hat sich noch nicht in ihrer Lebenswirklichkeit niedergeschlagen. Wieder einmal mehr parallelisiert Johannes die Situation seiner Gemeinde mit der Situation der Schüler Jesu vor ihrer Ostererfahrung.
Interessant ist, dass Wengst von einer Annahme ausgeht, die im Text nicht genannt ist, nämlich dass die Schüler Jesu sich erst auf Grund von Marias Zeugnis in einem nicht näher bezeichneten Haus versammeln. Der griechische Texte spricht nicht einmal ausdrücklich von einer Versammlung, sondern verwendet zwei Mal Formen des Wortes eimi {sein}, um den inzwischen eingetretenen Abend und die Befindlichkeit der Schüler hinter verschlossenen Türen aus Furcht vor den Juden auszudrücken. Die Betonung liegt also in keinster Weise darauf, dass hier eine Gemeinde im Entstehen begriffen ist.
Die „verschlossenen Türen“ betrachtet Wengst nicht näher unter dem Gesichtspunkt des Grundes, warum sie verschlossen sind, außer dass er in der Übersetzung der Wendung ton phobon tōn Ioudaiōn klarstellt, dass diese Furcht vor den Juden sich allein auf die „führenden Juden“ bezieht, die für Jesu Verurteilung mitverantwortlich waren. Sein Augenmerk liegt auf der Frage, wie Jesus trotz verschlossener Türen seine Schüler aufsuchen konnte:
„Da kam Jesus und trat mitten unter sie“ – ungebeten und unvermittelt. Überlegungen darüber, wieso er das könne und wie es vorzustellen sei, dass er trotz verschlossener Türen doch leibhaftig da ist, helfen nicht weiter. Johannes erzählt es, weil er Jesus in seiner lebendigen und gegenwärtigen Wirksamkeit bezeugen will.
Mit (Anm. 452) zwei Zitaten von Blank <1454> deutet Wengst an, dass hier symbolische Sprache vorliegt:
„Man muß bei diesem Text ganz von der literarischen Ebene ausgehen. […] Der Evangelist stand vor dem Problem, von etwas völlig Unfaßlichem doch auf eine faßliche und verständliche Weise sprechen zu müssen.“ Blank schreibt weiter: „Mögen auch Angst und Verschlossenheit noch so groß sein, der Auferstandene hat die Fähigkeit, durch verschlossene Türen zu dringen. […] Auf diese Weise kommt der Auferstandene immer wieder in eine ,verschlossene Welt‘, um sie durch seine Wirksamkeit zu einer ,offenen Welt‘ zu machen“.
Auffällig ist im zweiten Zitat, dass der konkrete Bezug der verschlossenen Türen völlig aus dem Blick gerät und sie allgemein als Symbol für die Verschlossenheit der Welt betrachtet werden.
Eine noch weiter reichende symbolische Auslegung der verschlossenen Türen bietet Wengst zufolge Martin Luther, <1455> indem er sie auf die Öffnung verschlossener Herzen durch die christliche Predigt bezieht:
„Durch verschlossene Türen tritt er ein und versehrt sie nicht. Solch Stehen ist nichts andres als daß er in unserem Herzen steht wie dazumal inmitten der Jünger. Wenn er mitten in unserem Herzen steht, dann hören wir die Stimme: Friede sei mit dir, deine Sünden sind vergeben, Teufel und alle Gewalt kann dir nicht schaden. […] Er geht durch verschlossene Türen und zerbricht sie doch nicht. Das geschieht durch die Predigt, die niemand verachten soll. Man soll das Wort nicht vom Himmel erwarten. […] Sein Kommen ist die Predigt, sein Stehen in uns ist der Glaube.“
Zu dem Gruß (W558): „Friede sei mit euch!“, mit dem Jesus, in „ihre Mitte getreten, … seine Schüler“ begrüßt, zitiert Wengst den Reformator Calvin <1456> (W558f.):
„Das ist der übliche Gruß der Hebräer: Friede bedeutet bei ihnen alles Günstige, was man sich für ein glückliches Leben zu wünschen pflegt. Dieser Ausdruck bedeutet also etwa: Möge es euch gut gehen!“ Zugleich ist damit aber auch die Zusage von 14,27 aufgenommen und so daran erinnert, dass sich der von Jesus zugesprochene Friede in der Erfüllung seines Vermächtnisses, in Erfahrungen von Solidarität einstellen wird.
In Vers 20 ist dann (W559) „von einem weiteren Handeln Jesu“ die Rede, das den bereits erwähnten charakteristischen Unterschied zu Lukas 24,39-40 aufweist, wo Jesus seinen Schülern seine Hände und Füße zeigt:
„Nachdem er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.“ Die Erwähnung der Seite Jesu erinnert an den in 19,34 genannten Stich mit der Lanze. Das Zeigen von Seite und Händen weist daher die Wundmale vor. Das wird sich eindeutig aus V. 25 und 27 ergeben. Der Auferweckte erweist also seine Identität sofort an den Wundmalen des Gekreuzigten; sie gehören unablösbar zu ihm. Sie bestimmen bleibend, wer er ist: der Gekreuzigte.
Zur Auslegung dieser Stelle setzt sich Wengst (Anm. 454) kritisch mit Bultmann, Calvin und Zahn <1457> auseinander:
Nach Bultmann „überrascht“ dieser Identitätsausweis Jesu „nicht nur in Joh überhaupt, sondern ist auch innerhalb der vorliegenden Erzählung unmotiviert“. Er kann zu dieser Behauptung nur kommen, weil er die auf das Kreuz zulaufende Erzählung des Evangeliums nicht wahrnimmt und in dem – formal verstandenen – Paradox „Das Wort ward Fleisch“ schon alles enthalten sieht. Calvin findet es „lächerlich […], wollte jemand daraus schließen, Christi Seite sei noch immer durchstochen, seine Hände seien noch immer durchbohrt. Gewiß waren die Wunden nur für kurze Zeit von Nutzen: bis nämlich die Apostel fest davon überzeugt waren, Christus sei vom Tod erstanden“. Auch Zahn meint, Johannes habe nicht „den erhöhten Jesus beständig mit den Wundmalen behaftet vorgestellt“. Doch geht es nicht um unsere – in gewisser Weise immer kindlich bleibenden – Vorstellungen, sondern um die Frage, was Jesu Identität ausmacht. Er ist bleibend als Verwundeter gekennzeichnet.
Von der im vorigen Abschnitt dargelegten Auslegung Veerkamps her ist allerdings zu fragen, ob Wengst hier unsere kindlichen Wünsche, sich trotz allem den verwundeten Jesus doch immerhin im Himmel als lebendig vorstellen zu können, tief genug in Frage stellt. Veerkamp denkt ja, dass Jesu Aufsteigen zum VATER nicht als bloße Verlagerung seines Aufenthaltsortes in den Himmel zu verstehen ist und dass sein Abschied auch in dem Sinne ernst zu nehmen ist, dass kein Messias mehr kommen wird, der eine handstreichartige militante Veränderung der Weltverhältnisse zum Guten bewirken könnte. Stattdessen erwartet der Evangelist Johannes vom Tod Jesu am Kreuz und von seinem Aufsteigen Jesu zum VATER die Übergabe der Inspiration des Gottes Israels an seine Schülerschaft, durch die allein sie in den Stand gesetzt wird, das Leben der kommenden Weltzeit in der Praxis der agapē tätig zu erwarten.
Wengst interpretiert Johannes 20,20 nicht vor diesem politischen Horizont der Befreiung Israels inmitten der Völker, sondern von seiner Vorstellung der johanneischen Gemeinde her, deren eigene Situation er „als verstellt erfahrene Welt“ beschreibt, die von „Klage und Trauer“ bestimmt ist und in der sich „doch auch schon Freude Bahn“ bricht:
Nachdem Jesus sich so ausgewiesen hat, heißt es weiter: „Da freuten sich die Schüler, weil sie den Herrn sahen.“ Hier werden in der Erzählung des Evangeliums die positiven Ankündigungen von 16,20.22 als sich vollziehend dargestellt, dass ihre Trauer sich in Freude wenden wird. … Dort war deutlich, dass Johannes transparent für die Situation der Gemeinde schreibt. Von Ostern her müsste ihre als verstellt erfahrene Welt aufbrechen, wie er es hier für die Schüler darstellt. In der Erfahrung der Gemeinde gibt es eine Gleichzeitigkeit von Trauer und Freude, allerdings nicht ausgewogen, sondern von Ostern her wird die Freude die Trauer überwinden. Die Schüler freuten sich ja, „als sie den Herrn sahen“. Johannes formuliert nicht einfach, dass sie Jesus sahen. Vom unmittelbar vorangehenden Kontext her ist damit gesagt, dass sie den Gekreuzigten so sahen, dass sie ihn als Herrn erkannten. Wo in verstellter und niederschmetternder Situation gerade der Gekreuzigte, das Opfer brutaler Gewalt, doch als Herr erkannt und bekannt wird, wo also diese Situation – und wer oder was alles in ihr herrscht – nicht mehr dominiert, da bricht sich mitten in Klage und Trauer doch auch schon Freude Bahn.
Auch Hartwig Thyen (T765) nimmt wie Wengst an, dass der Grund für die Versammlung fast aller Schüler Jesu (außer „Thomas, wie wir in V. 24 nachträglich erfahren“) „am Abend des Ostertages … wohl in der nahezu gemeindegründenden Osterbotschaft Maria Magdalenas als ihrer ‚Osterapostelin‘“ <1458> zu erkennen ist, obwohl, wie gesagt, an dieser Stelle von einer sich versammelnden Gemeinde jedenfalls nicht ausdrücklich die Rede ist. Auch die von Thyen vorausgesetzte Annahme, Maria habe die Schüler erst zusammenrufen müssen, beruht auf reiner Vermutung, zumal er selber weiß, dass Johannes eine Erzählung von der Flucht aller Jünger nach der Verhaftung Jesu aus den synoptischen Evangelien gerade nicht ausdrücklich aufgreift:
Ohne daß das eigens erzählt worden wäre, hatten die Jünger – mit Ausnahme dessen, den Jesus liebte – ihren Herrn nach 16,32 nach seiner Festnahme im Garten allein gelassen und waren zerstreut worden ,ein jeder in das Seine‘.
Zu den hier und im Folgenden handelnden Personen erläutert Thyen (T765f.):
Wie zuvor diese eine namentlich genannte Maria aus dramaturgischen Gründen die Frauen der Prätexte repräsentieren mußte, so muß nachher der eine Jünger Thomas alle zweifelnden Jünger und potentiellen Leser (hoi de edistēsan {einige aber zweifelten}: Mt 28,17) vertreten. Da Jesu Jünger ja allzumal Juden sind und das auch zeitlebens bleiben werden, können die Ioudaioi, vor denen sie sich aus Angst hinter verschlossenen Türen verschanzt haben, ja nur solche sein, die der Hörer/Leser aus zahlreichen Szenen (vgl. etwa 7,13; 9,22; 19,38) und zumal aus der Passionserzählung bereits als Feinde Jesu kennengelernt hat; Wengst spricht darum treffend von den „führenden Juden“ {siehe oben}.
Im Blick (T766) auf das Erscheinen Jesu bei seinen Schülern und seinen Friedensgruß beschränkt sich Thyen auf wenige Bemerkungen:
Durch die verschlossene Tür tritt der Auferstandene mit den Worten eirēnē hymin in die Mitte seiner Jünger. ,Friede sei mit euch!‘ (schalom ˁalejkhem) ist „der übliche Gruß der Hebräer“ {vgl. Wengst, siehe oben}, wobei schalom als Heil und Heilsames mehr ist als das Schweigen der Waffen und Frieden im landläufigen Sinn. Darüberhinaus ist dieser Wunsch von Heil und Frieden im Munde Jesu durch seine beim Abschied gesagten Worte definiert {14,27 und 16,33}… Diese abschiedlichen Verheißungen Jesu finden hier ihre Erfüllung.
In dieser Kürze kann Thyen allerdings kaum auch nur ansatzweise ausloten, worin die Tragweite „dieser Gabe der eschatologischen eirēnē {Friede}“ besteht und in welcher Weise sie sich verwirklichen kann und soll.
Dazu, dass „Jesus den Jüngern seine von den Malen der Nägel gezeichneten Hände und seine von der Lanze des Soldaten durchbohrte Seite“ zeigt und „seine Jünger von Freude erfüllt“ wurde, „weil sie ihren Herrn erkannten“ erkannten, schreibt Thyen, dass Wengst (siehe oben) „zu Recht auf die unübersehbaren Berührungen von Joh 20,19-23 mit Lk 24,36-43 aufmerksam“ macht. Den dabei vermerkten Unterschied, dass „die Jünger“ bei Lukas zwar „von Freude erfüllt“ werden (Lukas 24,41), aber verbunden „mit Unglauben und Verwunderung“, kommentiert Thyen so:
Doch weil er mit dem Vater des epileptischen Jungen aus Mk 9,24 weiß, daß auch Glaubende nur beten können: ,Ich glaube, hilf meinem Unglauben!‘, wird Johannes diesen zweifelnden Unglauben in der folgenden Erzählung ja eigens thematisieren. Wiederum muß da der einzelne Thomas alle apistountes {Ungläubigen} unter den Jüngern (und Lesern!) repräsentieren: mē ginou apistos alla pistos {sei nicht ungläubig, sondern gläubig!} (20,27).
Dass „Jesus bei Johannes den Jüngern seine Hände und seine Seite, ihnen nach Lukas aber seine Hände und seine Füße zeigt“, widerspricht Thyen zufolge keineswegs gegen „ein literarisches Verhältnis der beiden Texte zueinander“, denn es entspricht durchaus den „theologischen Interessen des Evangelisten“ Johannes, im „intertextuelle[n] Spiel mit dem Lukastext“ dessen Formulierung so zu ändern, dass sich Jesus eindeutig „als der Gekreuzigte zu erkennen gibt“:
Denn daß die Jünger Jesus für ein Gespenst halten, hatte Johannes schon in der Erzählung vom Seewandel Jesu (6,16ff) überspielt (s. o. z. St.), und daß bei ihm an die Stelle der Füße Jesu als ein johanneisches Spezifikum dessen durchbohrte Seite getreten ist, deren Ursprung wohl in Sach 12,10 zu suchen sein dürfte (s. o. z. St.), läßt sich auch plausibler als ein absichtsvolle Spiel mit dem existierenden Lukastext als durch das Postulat irgendeiner verlorenen Quelle erklären.
Die Empfehlung von Wengst (T767) (siehe oben), „im Vergleich der vorliegenden Texte ihr jeweiliges besonderes Profil herauszustellen“, entspricht allerdings „auf seine Weise“, wie Thyen meint, „in etwa“ seiner „intertextuellen Fragestellung“.
In der in Vers 20 beschriebenen Freude der Jünger darüber, „daß sie ihren kyrios sahen“, erfüllt sich nach Thyen „Jesu abschiedliche Verheißung: ,Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und eure Herzen werden von Freude erfüllt werden, und eure Freude wird euch keiner trüben können‘ (16,22)“, obwohl diese Freude damit nicht aufhört, „selbst wiederum Verheißung zu sein, die wahrgenommen und eingeholt sein will“:
Zwar werden mit dem Osterglauben Trauer und Verzweiflung samt ihren vielfältigen Anlässen nicht einfach aus der Welt verschwunden sein, aber „mitten im unbegreiflichen, sinnlosen Leid der Welt“ bricht er doch immer wieder der freudigen Hoffnung auf dessen endliche Überwindung Bahn [Blank 171].
Wie Wengst hebt Thyen weiter hervor, dass „die Jünger“ Jesus nicht anders „als ihren kyrios {Herrn} erkennen“ können als „an seinen Wundmalen“:
Auch wenn Calvin [475] es lächerlich findet, wenn jemand aus dieser Wiedererkennungs-Szene schließen wollte, „Christi Seite sei immer noch durchstochen, seine Hände seien immer noch durchbohrt“ (ähnlich Zahn [678]), erklärt Wengst treffend, daß es hier doch nicht um unsere ,kindlichen‘ Vorstellungen, sondern darum gehe, „was Jesu Identität ausmacht. Er ist kein heiler Siegertyp, <1459> sondern bleibend als Verwundeter gekennzeichnet“. Die großen Maler scheinen das besser begriffen zu haben als viele große Theologen, wenn sie selbst den Weltenrichter als den Durchbohrten erscheinen lassen.
Ton Veerkamp <1460> überschreibt seine Auslegung von Johannes 20,19-23 mit den Worten „Die geschlossenen Türen“ und sieht auch die folgende Thomas-Szene durch diese für ihn überraschende Rahmenbedingung entscheidend geprägt:
Dass eine messianische Gruppe mit einer weltweiten Perspektive sich in einem Raum mit geschlossenen Türen wiederfindet, ist in sich absurd. Die Situationsbeschreibung „geschlossene Türen“ bleibt in der nächsten Szene erhalten. Die Gruppe befindet sich in einer politischen Isolation, die totaler nicht sein kann. Der Grund ist „die Furcht vor den Judäern“. Darüber sollten wir nachdenken.
Dass Wengst und Thyen dieses Problem nicht näher erörtert haben, liegt sicher daran, dass sie die Konzentration des jüdisch-messianischen Johannesevangeliums auf die Zukunft Israels inmitten der Völker nicht ernst genug nehmen. Für Veerkamp liegt hier ein Problem, das die gesamte von Johannes beabsichtigte Perspektive zum Scheitern verurteilen kann:
Die Abgrenzung von den Judäern, a fortiori {erst recht} von Israel, muss zur politischen Isolation führen. Die Gruppe isoliert sich genau von denen, die Jesus in „eins zusammenführen“ (11,52), in einer einheitlichen Synagoge versammeln wollte, und verkehrt sein eigentliches Ziel ins Gegenteil. Der aufstehende Messias durchbricht zwar die Isolation von außen, die Schüler durchbrechen sie aber nicht von innen. Trotz der Tatsache, dass Jesus sich zweimal von den Schülern sehen lässt, bleiben sie innerhalb eines geschlossenen Raumes gefangen.
Es wird sich zeigen, dass diese Isolation erst im nachgetragenen Kapitel 21 durchbrochen wird. Hier, in Kapitel 20, bleibt es zunächst dabei, dass Jesu Erscheinen bei seinen Schülern noch keine nachhaltige Veränderung ihres Gemütszustandes herbeiführt oder gar ihren sofortigen Aufbruch, um öffentlich Zeugnis für Jesus und die von ihm geschenkte und geforderte agapē abzulegen:
„Jesus kam und stellte sich in die Mitte.“ Er sagt: „Friede mit euch!“ Das ist mehr als ein orientalisches „Guten Tag“ – schalom bzw. salam ˁalaikum. Der Friede des Messias steht in schroffem Gegensatz zum „Frieden“, den die Weltordnung durchzusetzen pflegt, 14,27. Deswegen zeigt er ihnen die klaffenden Wunden in seiner Seite und in seinen Händen. Es geht ihm um mehr als um einen Identitätsnachweis. In der Tat, der aufstehende Messias ist noch vom Tod gezeichnet. Friede in einem geschlossenen Raum voller angstgeschüttelter Menschen ist in der Tat ein Widerspruch in sich! Die Schüler freuen sich dennoch. Die Freude wird sich in Grenzen gehalten haben, denn, wie wir hören werden, werden die Türen auch die kommenden acht Tage geschlossen bleiben.
↑ Johannes 20,21-23: Die Sendung und Belebung der Schüler Jesu mit heiliger Inspiration zur Aufhebung der Verirrung der Menschen oder ihrer Verstockung
20,21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen:
Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
20,22 Und als er das gesagt hatte,
blies er sie an
und spricht zu ihnen:
Nehmt hin den Heiligen Geist!
20,23 Welchen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen;
welchen ihr sie behaltet,
denen sind sie behalten.
[14. Februar 2023] Bevor Jesus seine Schüler aussendet, wiederholt er in Vers 21 Klaus Wengst zufolge nochmals den Friedensgruß (W559f.):
„Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: ,Friede sei mit euch!‘“ … Der Zuspruch des Friedens rüstet sie für ihre Sendung aus und zugleich realisiert sich dieser Friede doch nicht anders, als dass sie sich gesandt sein lassen: „Wie mich der Vater gesandt hat, schicke auch ich euch.“ Dass Jesus vom Vater gesandt ist, wurde im Evangelium wieder und wieder gesagt. Gott kommt im Wirken Jesu zum Zuge. Und jetzt sendet Jesus ganz entsprechend seine Schüler. Das hat er proleptisch schon 17,18 ausgesprochen (vgl. 13,16.20). In der Sendung seiner Schüler wirkt er weiter, kommt er selbst zum Zuge.
Ganz selbstverständlich nimmt Wengst an (W560), dass die
hier von ihm beauftragte Schülerschaft … die Gemeinde [repräsentiert], die sich insgesamt als von Jesus gesandt begreifen soll. Die Gemeinde wird sich dann als von Jesus gesandt erweisen und sein Werk in rechter Weise zur Wirkung kommen lassen, wenn sie sich an seinem Handeln orientiert, wie es Johannes paradigmatisch in der Szene von der Fußwaschung beschrieben hat (13,1-20).
Überhaupt nicht selbstverständlich ist es allerdings nach Wengst, dass „es überhaupt zur Sendung kommt“, wie in Vers 22 deutlich wird, denn
dazu bedarf es des kräftigen Anstoßes, dazu bedarf es dessen, dass sich die Schüler Jesu von seiner Geisteskraft ergreifen und bewegen lassen. Deshalb erzählt Johannes weiter: „Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte: ,Empfangt heilige Geisteskraft!‘“ Die Formulierung vom Anhauchen erinnert an Gen 2,7, wo es von Gott im Blick auf den von ihm gebildeten Erdenkloß adám, das Menschenwesen, heißt: „[…] und er hauchte in seine Nase Lebensatem. Da wurde der Mensch zur lebendigen Person.“ Nach Ez 37,9 soll der Prophet den Geistwind, die Geisteskraft auffordern: „Komm von den vier Winden, Geisteskraft, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie leben.“ Das wird hier zum Bild für den neuen Exodus aus dem Exil in Babel als neue Schöpfung.
Obwohl allerdings Wengst den Hintergrund dieser Schriftstellen und ihren Bezug auf die Befreiung Israels wahrnimmt, zieht er diese Linie nicht weiter aus, um sie auf die Situation der neuen und in diesem Fall weltweiten Versklavung unter die römische Weltordnung zu beziehen und auf den neuen Exodus aus diesem Sklavenhaus, den Jesus mit der Übergabe der Geisteskraft des Gottes Israels an seine Schülerschaft in Gang setzt. Nur andeutungsweise ist das, was Wengst aus der Schrift folgert, offen auch für eine solche Interpretation:
Auf solchem Hintergrund zeichnet Johannes, indem er den endzeitlich auferweckten Jesus Geisteskraft vermitteln lässt, die Entstehung von Gemeinde als endzeitliche Neuschöpfung. Die Formulierung vom Empfangen heiliger Geisteskraft nimmt die Aussagen von 7,38f. und 14,16f. auf. Was dort – und in den übrigen Verheißungen von der Gabe heiliger Geisteskraft in den Abschiedsreden – angekündigt war, vollzieht sich nun und wird sich weiter vollziehen. Das führt die jetzt beschriebene Szene bildhaft-anschaulich vor Augen.
Bevor in Vers 23 das Thema der Sündenvergebung ausdrücklich angesprochen wird, geht Wengst darauf ein, dass „Gabe des Geistes und Sündenvergebung sowie neue Schöpfung und Sündenvergebung … schon traditionell miteinander verbunden“ sind. Dazu führt er neben einigen Belegen aus dem Schrifttum von Qumran folgende biblischen Stellen an:
In Ez 36,25-27 ist zwar nicht terminologisch von Sündenvergebung die Rede, aber der Sache nach ist sie da, wenn von „reinigen“ gesprochen wird. Vgl. auch Ps 51,3-14, wo das Bekenntnis der Sünde, die Bitte um Vergebung und die Bitte um Geisteskraft zusammen stehen. … In 1. Kor 6,9-11 beschließt Paulus den Hinweis auf einstiges Lasterleben mit der Aussage: „Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus, des Gesalbten, und durch die Geisteskraft unseres Gottes.“ Für den festen Zusammenhang von Taufe, Sündenvergebung und Geistempfang sei nur noch auf Apg 2,38 verwiesen. Die Verbindung von neuer Schöpfung im Gesalbten, Versöhnung und Nicht-Anrechnung der Übertretungen bezeugt Paulus in 2. Kor 5,17-19.
Außerdem spricht eine rabbinische Quelle <1461>
von Gottes rechtfertigendem Handeln im Zusammenhang von Umkehr, Sühne und neuer Schöpfung …: „Und macht ein Brandopfer für den Ewigen! (Num 29,2) Und an anderer Stelle sagt sie (die Schrift): Und bringt ein Brandopfer dar für den Ewigen! (Num 29,36) Und hier: Und macht! Rabbi Jizchak sagte: ‚Warum Und macht!? Der Heilige, gesegnet er, sagte zu Israel: Macht Umkehr in jenen zehn Tagen zwischen Neujahr und dem Versöhnungstag, und ich rechtfertige euch am Versöhnungstag und erschaffe euch als neue Schöpfung.“
Von daher ist es Wengst zufolge (W561) „nicht überraschend“, dass Johannes in Vers 23 „den Gedanken der Sündenvergebung“ ausdrücklich anführt, denn „sowohl die Gabe des Geistes als auch die damit verbundene Vorstellung neuer Schöpfung implizieren“ ihn bereits,
auch wenn das terminologisch nur an dieser Stelle des Evangeliums geschieht: „Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“ Das hier Gesagte ist im Evangelium sachlich verankert in dem großen Bogen zwischen 1,29 und 19,14.33.36, nach dem der gekreuzigte Jesus als endzeitliches Pessachlamm zu verstehen ist, „das die Sünde der Welt trägt“. Von dem so auf das Kreuz zugespitzten Weg Jesu „inspiriert“ zu werden, kann nur bedeuten, als Versöhnte Versöhnung zu praktizieren.
Ganz selbstverständlich setzt Wengst auch hier voraus, dass „die Schülerschaft Jesu … die Gesamtgemeinde“ repräsentiert:
„Die Vollmacht zur Sündenvergebung ist also der ganzen Kirche zugesprochen, so daß alle Glieder der Kirche an dieser Vollmacht Anteil haben.“ <1462>
Daraus ergibt sich nach Wengst weiter die notwendige Schlussfolgerung,
dass Vergebung wechselweise erfolgt und dass sie nicht eintritt, wo sich ihr verweigert wird. Deshalb ist auch vom „Behalten“ der Sünden die Rede. In mJom 8,9 <1463> heißt es: „Übertretungen des Menschen gegen Gott sühnt der Versöhnungstag; Übertretungen des Menschen gegen den Mitmenschen sühnt der Versöhnungstag nicht eher, bis dass er seinen Mitmenschen begütigt hat.“ Jesus hat im Vaterunser zu beten gelehrt: „Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben“ (Mt 6,12). Die eigene Vergebung gegenüber anderen gilt beim Beten dieser Bitte als schon vollzogen. Die Bitte an Gott um Vergebung der Schuld können die Bittenden gar nicht anders aussprechen, als damit ihrerseits denen schon vergeben zu haben, die ihnen gegenüber schuldig geworden sind. In Joh 20,23 stehen Vergeben und Behalten von Sünden nebeneinander. Aber die Reihenfolge scheint nicht gleichgültig zu sein. Intendiert ist das Vergeben; das Behalten ist das Ergebnis verweigerter Versöhnung. Als versöhnte Gemeinschaft wirken Jesu Schüler in ihrer Sendung als ein Ferment der Versöhnung und des Friedens.
Wie sehr Wengst davon überzeugt ist, dass das ganze Evangelium des Johannes auf dieses Versöhnungswirken der Gemeinde Jesu Christi hinausläuft, zeigt seine folgende abschließende Bemerkung zur Auslegung dieses Verses:
An dieser Stelle könnte das Evangelium beendet sein. Ähnlich wie das Matthäusevangelium wäre es dann mit der Sendung der Schüler abgeschlossen. Aber Johannes fügt noch eine weitere Erzählung über eine Begegnung mit dem auferweckten Jesus an. Das Zeugnis, dass der Gekreuzigte lebt, ist dermaßen unglaublich und also Zweifel so naheliegend, dass Johannes solchem Zweifel Raum gibt.
Nach Hartwig Thyen (T767) eröffnet Jesus in Vers 21 mit
dem wiederholten Segenswort eirēnē hymin {Friede mit euch} … seine weltweite Sendung der Jünger: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch!“ Als Entsprechung der Sendung des Sohnes durch den Vater ist das Ich Jesu als des Senders der Jünger hier nachdrücklich betont: kagō pempō hymas {auch ich sende euch}. Wir nannten diese Sendung ,weltweit‘, weil jetzt die Stunde der Sammlung auch der über die Welt zerstreuten Gotteskinder gekommen ist (11,51f). Jetzt, da das Weizenkorn in die Erde gefallen und gestorben ist, können auch die ,Griechen‘ zu Jesus kommen (12,24). Proleptisch hatte Jesus diese Sendung seiner Jünger schon in seinem großen Gebet vor seinen Vater gebracht und ihm versichert, daß er sich für sie heiligen werde, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien (17,18f).
Ebenso selbstverständlich, wie Wengst hier die christliche Gemeinde mit einem Sendungsauftrag Jesu betraut sieht, meint Thyen ohne weitere Begründung die „Sammlung auch der über die Welt zerstreuten Gotteskinder“ auf die Mission der Völkerwelt beziehen zu können, auf die in seinen Augen das Kommen einiger Griechen zu Jesus (12,20) hingedeutet hatte.
Die beiden Verse 22 und 23 legt Thyen in engem Zusammenhang miteinander aus, wobei er zunächst wie Wengst auf die in ihnen enthaltene Anspielung auf die Schöpfungsgeschichte aufmerksam macht:
Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und erklärte ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen auch immer ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen ihr sie aber behaltet, denen bleiben sie behalten. Gewiß nicht absichtslos versetzt der mit der Gabe des Heiligen Geistes verbundene Hauch Jesu die Hörer/Leser dieser Erzählung in die Atmosphäre der Genesis, wo Gott dem aus Erde geformten Adam seinen Lebensodem einhauchte, so daß er zu einem lebendigen Wesen wurde (Gen 2,7f -…). Wir haben hier also den Anfang der neuen Schöpfung vor Augen.
Aus diesem Grund sieht Thyen wie Wengst die gesamte Gemeinde Jesu mit der Sündenvergebung beauftragt und hält
es gegen Swetnam <1464> auch für wenig wahrscheinlich, daß die Gabe des Geistes und der ,Schlüsselgewalt‘ (vgl. Mt 16,18f; 18,18) als die Verleihung eines besonderen Amtscharismas an einen entsprechend begrenzten Kreis von Jüngern verstanden werden darf (s. o. zu 19,30).
Aber warum war (T768) „von der Sündenvergebung als Gabe des Geistes nicht schon in den Verheißungen des Parakleten (siehe aber 16,7-10) und explizit auch nicht in 19,30 die Rede“? Den Grund dafür sieht Thyen
einmal darin …, daß sich für Johannes in Jesu Sterben primär die Liebe Gottes zum kosmos vollendet …, zum anderen aber vor allem darin, daß es dazu erst der Hingabe des Fleisches des Sohnes des Menschen für das Leben der Welt bedurfte (6,51). Denn was Jesus am Kreuz erworben hat, das sollen seine Jünger nun weitergeben.
Hier ist deutlich erkennbar, in welcher Weise Thyen die traditionelle christliche Deutung des Kreuzestodes Jesu als Voraussetzung für die Sündenvergebung teilt, wobei Sünde als individuell zurechenbare Verfehlung bzw. mangelndes Vertrauen auf Gott oder Jesus zu verstehen wäre.
In einer gewissen Spannung stehen dazu allerdings seine weiteren Ausführungen, die sich auf die jüdischen heiligen Schriften beziehen:
Gleichwohl ist aber implizit auch schon in 19,30 von Sünde und Vergebung die Rede. Denn die Ströme lebendigen Wassers, die nach dem Zeugnis der Schrift aus dem Leib des Erhöhten fließen sollen, hatte der Erzähler in Joh 7,39 als Symbol des österlichen Geistes identifiziert. Und dabei hatten wir als die primäre Quelle jenes Zeugnisses der Schrift Sach 12,10ff und 14,8 ausgemacht (s.o. z. St.). Deshalb hat uns die Lektüre der Szene vom Lanzenstich und dem Hervorströmen von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu (19,33-37) nahegelegt, sie als die förmliche Erfüllung jener Verheißungen Sacharjas zu begreifen: „An jenem Tage (nämlich am Tage, da sie auf den Durchbohrten schauen und alle um ihn trauern werden) wird sich ein Quell öffnen für das Haus David und alle Bewohner Jerusalems gegen Sünde und Unreinheit“ (Sach 13,1); und: „An jenem Tage wird lebendiges Wasser aus Jerusalem hervorquellen (Sach 14,8).
Nimmt man diesen Bezug auf das Sacharjabuch ernst, muss man fragen, ob die Beseitigung von „Sünde und Unreinheit“ dort tatsächlich auf die Vergebung individueller Verfehlungen zu beziehen ist oder nicht vielmehr auf die Ausrottung der „Götzen“ (Sacharja 13,2), in deren Namen Unterdrückung und Ausbeutung in und über Israel geherrscht haben, und auf das Ziel der Befreiung Israels, so dass „das ganze Land verwandelt“ und „Jerusalem ganz sicher wohnen“ wird (14,10-11). Thyen beteiligt sich also an der üblichen christlichen Art und Weise, alttestamentliche Stellen auf eine ganz andere neutestamentliche Bedeutung hin auszulegen, statt die Aussagen der messianischen Schriften von ihren jüdischen Wurzeln her zu begreifen.
Das gilt auch für den Rückbezug auf Hesekiel 37, wo „die Wiederbelebung der Totengebeine zum Bild für den neuen Exodus des Gottesvolkes aus dem babylonischen Exil als neue Schöpfung“ wird“, was nach Wengst, den Thyen hier zitiert (siehe oben) bei Johannes auf „die Entstehung von Gemeinde als endzeitliche Neuschöpfung“ hinausläuft. Sicher ist Thyen und Wengst darin Recht zu geben, dass unter anderem nach Hesekiel 36,25ff. „die Gabe der Sündenvergebung schon traditionell mit derjenigen des Geistes sowie mit der neuen Schöpfung verbunden ist“. Aber was „[a]ngesichts der Talebene voller Totengebeine“ in Hesekiel 37,1ff. die Aufforderung des NAMENS an Hesekiel letzten Endes bedeutet (37,9), „er solle dem Geist zurufen: ‚Komm, o Geist, komm aus den vier Windrichtungen und wehe diese Erschlagenen an, daß sie lebendig werden‘“, lassen beide Exegeten unberücksichtigt. Dem jüdisch-messianischen Evangelisten Johannes, der in Kapitel 4 und 11,57 die Sammlung ganz Israels einschließlich der verlorenen zehn Nordstämme und der unter die Völker zerstreuten Diasporajuden als das Ziel des Messias Jesus formuliert, ist es zuzutrauen, dass er mit der Anspielung auf dieses Hesekiel-Kapitel gerade auch dessen Schlussverse 37,21-28 in den Blick nimmt (nach Luther 2017):
21 So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen
22 und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen einzigen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche.
23 Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
24 Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun.
25 Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer, und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein.
26 Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer.
27 Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein,
28 damit auch die Völker erfahren, dass ich der HERR bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird.
Die Völker spielen hier zwar eine Rolle für Israel, aber nicht in der Weise, dass sie durch eine Völkermission praktisch zum Hauptadressaten der befreienden Wirksamkeit des NAMENS werden, vielmehr kann ganz Israel inmitten der Völker im Frieden wohnen. Der einzige Zug dieser Verheißung Hesekiels, den Johannes in dieser Form nicht aufnimmt, ist das Königtum Davids, das in seinen Augen offenbar zu sehr mit einer zelotisch-militanten Strategie messianischen Aufstands gegen die bestehenden Verhältnisse verbunden ist. Davids Rolle in der von Johannes aufgenommenen Hoffnung Hesekiels auf das Leben der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker übernimmt vielmehr der Messias Jesus, der in seinem Tod am Kreuz die Pax Romana als Menschenschlächterherrschaft bloßstellt und durch die Übergabe der in der Solidarität Gottes mit seinem Volk (agapē) gründenden Inspiration an seine Schülerschaft überwindet. Da Israels friedvolle Zukunft unter römischen Bedingungen nicht anders als durch die Befreiung der gesamten Menschenwelt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, zu erreichen ist, hat das Johannesevangelium also eine weltweite Perspektive, konzentriert sich aber dennoch ursprünglich auf Israel. Mit diesen Ausführungen lehne ich mich eng an Ton Veerkamp an, dem zufolge Johannes nur von den jüdischen Schriften her angemessen zu verstehen ist.
Dieser Ton Veerkamp <1465> fragt in seiner Auslegung von Vers 21, wie sich ganz konkret das vollziehen wird, was als Aufstieg Jesu zum VATER bzw. als sein Auferstehen bezeichnet wurde. Anders als Wengst und Thyen beschäftigt sich Veerkamp mit den beiden unterschiedlichen griechischen Worten apostellein und pempein, die in der Regel beide mit „senden“ übersetzt werden:
Noch einmal der messianische Friedenswunsch. Dann sagt Jesus, wie der Prozess des Aufstehens weitergehen wird: „Wie der VATER mich gesandt hat, so schicke ich euch.“ Zwischen den beiden Verben apostellein, senden, und pempein, schicken, gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Beide Verben geben die Sendung des Messias durch den Gott Israels und die Sendung der Schüler durch den Messias wieder. Wenn nun in einem Satz das Verb gewechselt wird, drängt sich ein Unterschied zwischen beiden Sendungsvorgängen auf. Wir können nur sagen, dass der VATER den Messias sendet oder schickt und die Inspiration, die von beiden ausgeht; Menschen werden aber nicht vom VATER geschickt bzw. gesendet, sondern nur vom Messias. Es gibt hier keine Gesandten, die direkt von Gott kommen, und der Gesandte, den es gab, Mose, wird in der Gruppe um Johannes durch den Messias abgelöst. Auch bei Matthäus ist alle Sendung Sendung durch den Messias. Der Messias sendet also die Schüler, und diese Sendung ist der Sendung des Messias durch den VATER absolut gleich: sein Leben einsetzen für die Schafe, d.h. die Kinder Israels, 10,15.
Die Ausstattung der Schüler Jesu mit dem pneuma hagion, traditionell mit „Heiliger Geist“ übersetzt, interpretiert auch Veerkamp vor dem Hintergrund einiger von Wengst und Thyen angeführter Schriftstellen, zieht aber auch noch einige weitere in Betracht. Er übersetzt Vers 22 so:
Als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagt ihnen:
„Nehmt an Inspiration der Heiligung.“
Dann „inspiriert“ Jesus seine Schüler körperlich, er haucht über sie. Das Verb emphysan kommt in den messianischen Schriften nur hier, Johannes 20,22, vor. In der griechischen Fassung der Schrift ist das Verb selten. Es steht für das hebräische Verb nafach. Das Verb bedeutet „blasen [mit dem Mund]“, und zwar mit zwei entgegengesetzten Effekten: beleben und verbrennen. Die ursprüngliche Bedeutung ist „[ein Feuer] anhauchen“, Jesaja 54,16; Hiob 20,26. Die Wut Gottes wird als Feuer gegen sein aufsässiges Volk angehaucht (Ezechiel 22,20f.). In Genesis 2,7 dagegen hören wir:
Der NAME, Gott, bildet die Menschheit als Staub vom Acker.
Er bläst (wa-jipach, enephysen) in ihre Nasenlöcher Hauch des Lebens.
Es wurde die Menschheit zur lebenden Seele.Die eingeschüchterten Menschen in diesem verbarrikadierten Raum sind sozusagen Tote in einem Totenhaus. Sie müssen belebt werden. Die große Vision Ezechiel 37,1ff. wurde bereits bei der Besprechung 6,63 zitiert. Der Prophet wird vor ein Feld voll mit ausgedorrten Knochen geführt, und der NAME fragt ihn:
„Menschenkind, können diese Knochen wieder aufleben?“
Ich sagte: „mein Herr, EWIGER, du weißt es.“
So hat mein Herr, der NAME, gesagt:
„Sage aus als Prophet über diese Knochen, sagen sollst du zu ihnen:
‚Ihr ausgedorrten Knochen, hört das Wort des NAMENS!‘“
So sagt mein Herr, der NAME, zu diesen Knochen:
ICH bin es, ich lasse in euch Inspiration kommen, und ihr lebt auf!
Ich gebe euch Muskeln, ziehe Fleisch, spanne Haut über euch.
Ich gebe über euch Inspiration, ihr lebt auf, ihr erkennt:
ICH BIN ES, der NAME.Nur von solchen zentralen Texten der Schrift können wir verstehen, was Jesus hier tut. Er sagt: „Nehmt an Inspiration der Heiligung.“ Wir haben bei der Besprechung von 19,30 diese Stelle angekündigt: Jesus „gab die Inspiration“. Hier, 20,22, haben wir die dazu entsprechende komplementäre Aufforderung: „Nehmt an …!“ „Die Inspiration ist es, die lebend macht, das Fleisch kann nichts dazu beitragen“, hörten wir in 6,63. Die bedrohte, verwundbare Existenz dieser eingeschüchterten Menschen, Fleisch, wird inspiriert und soll sich in messianische Existenz verwandeln. Das wird hier nicht erzählt, vorerst bleibt die Isolation, der geschlossene Raum. Erst als die Gruppe nach Galiläa geht, wird die Verwandlung zur Wirklichkeit. Die Inspiration, die ausgeht vom wundgeschlagenen und getöteten Messias, belebt diese Menschen und befähigt sie, ihre Mission zu erfüllen.
Noch viel stärker weicht Veerkamp in seiner Übersetzung und Auslegung der beiden Sätze in Vers 23 von dem ab, was Wengst und Thyen aus ihm herauslesen. Sie sind ihm zufolge „schwer zu übersetzen und noch schwerer zu erklären“. An der Art und Weise, wie das Wort hamartia {Sünde} zu interpretieren ist, entscheidet sich letzten Endes die Frage, worauf die Sendung Jesu an seine Schülerschaft hinausläuft:
Vorab sei gesagt: Hier wird nicht, wie die Katholiken lesen, das Sakrament der Beichte eingerichtet.
Es geht um Verirrung (hamartia, chataˀ, „Sünde“), um wegnehmen (aphienai, ssalach) und um verstockt sein lassen (kratein):
„Wenn ihr irgendwelchen die Verirrungen aufhebt,
sind sie ihnen aufgehoben. <1466>
Soweit ihr bei ihnen Verstockung bleiben lasst,
bleiben sie verstockt.“
Das Verb kratein kommt bei Johannes nur hier vor, das Verb aphienai dagegen vierzehnmal. Bis auf 20,23 bedeutet letzteres „verlassen, entlassen“. Man übersetzt dann „Sünden erlassen, vergeben“. Weil wir das Wort „Sünde“ ob seines moralistischen Beigeschmacks vermeiden und von „Verirrung“ reden, müssen wir aphienai mit einem Wort wie „aufheben“ umschreiben. In der Schrift werden „Sünden“ nur von Gott „vergeben“, „Verirrungen“ werden nur durch Gott „bedeckt“ (kipper vgl. jom kippur) oder „aufgehoben“, vgl. Markus 2,7. Das Verb salach („vergeben“) hat in der Schrift kein anderes Subjekt als Gott bzw. der NAME.
Eng an die jüdische Tora angelehnt beschreibt Veerkamp nun, „[w]as geschieht, wenn Verirrungen aufgehoben werden“, und zwar in deutlichem Unterschied zu einem christlichen Verständnis von Sündenvergebung, das die Seele rein macht, um nach dem Tod im Himmel aufgenommen werden zu können:
In den ersten Kapiteln des Buches Leviticus wird über Verirrungen gesprochen. Der, der in die Irre gegangen ist, muss ein Opfer darbringen, er muss etwas vernichten, ein Handvoll Mehl verbrennen oder ein Tier schlachten. Er zeigt drastisch, dass durch seine Verirrungen etwas kaputtgegangen ist. Wenn er dieses Bewusstsein – mit einem drastischen Opfer – zeigt, wird die Verirrung bedeckt, und sie kann nicht länger ihre gesellschaftszerstörende Wirkung entfalten. Die Menschen können also wieder das tun, was ihre eigentliche Bestimmung von ihnen verlangt.
Das hebräische Verb chataˀ bedeutet so etwas wie „ein Ziel verfehlen“. „Vergeben“ bedeutet dann „wieder auf das ursprüngliche Ziel orientieren“. Wie gesagt, diese Neuorientierung kommt in der Schrift nur von Gott. „Wer vermag Verirrungen aufzuheben, es sei denn Gott“, fragen die Peruschim bei der Heilung des Gelähmten in Markus 2,7. In der Tat: Verirrungen kann man nicht dadurch aus der Welt schaffen, indem man sie „vergibt“. Die ursprüngliche Bestimmung der Menschen wird wiederhergestellt, indem Gott, von dem diese Bestimmung kommt, sie wieder zur Bestimmung der Menschen macht. In der Vollmacht „Gottes“ kann das der Messias, und in der Vollmacht des Messias können es die vom Messias inspirierten Schüler. Anders gesagt: Nur wenn ein Mensch Gott und seine gesellschaftliche Ordnung – die Tora – wieder als sein alleiniges Ziel annimmt, „ist ihm vergeben worden“ (nisslach lo, aphethēsetai autō). Diese Vollmacht erteilt der Messias durch seine Inspiration der Heiligung den Schülern.
Das Verb kratein, das der Aufhebung der Verirrung bzw. der Vergebung der Verfehlung entgegensteht, deutet Veerkamp in seiner Anm. 564 zur Übersetzung von Johannes 20,23 vor dem Hintergrund der Verstockung Pharaos durch den Gott Israels:
Das Verb kratein steht sehr oft für das hebräische chasaq. Der Hintergrund ist Exodus 10,20: „Der NAME ließ das Herz Pharaos verstocken (JHWH jechaseq); er schickte die Kinder Israels nicht frei.“ Hier handelt es sich um einen Wechsel zwischen hechesiq (Kausativ) und chasaq (Grundstamm), den Johannes auf Griechisch durch den Wechsel von Konjunktiv Präsens und Perfekt Passiv wiedergibt. Das Geschehen im Kampf um die Befreiung Israels ist wie die Verstockung Ägyptens das Ergebnis einer Tat des NAMENS: es verhärten sich notwendig die Fronten, weil entweder Ägypten aufhören muss, das Haus der Sklaverei zu sein, oder Israel die Bereitschaft aufgeben muss, zu Kindern der Freiheit zu werden. Das indikativische Perfekt kekratēntai deutet, wie immer bei Johannes, einen definitiven Zustand an.
Einschränkend ist dazu allerdings festzustellen, dass die Septuaginta die Verstockung des Herzens Pharaos nicht mit kratein, sondern mit sklērynein wiedergibt, während im Kontext der Exoduserzählung das Wort krataia cheiri oft die „mächtige Hand“, bechoseq jad, des NAMENS bezeichnet, die die Israeliten aus Ägypten herausführt. Nur in Exodus 9,2 wird enkratein für das Aufhalten der Israeliten durch den Pharao verwendet.
In seiner Auslegung von 2007 legt Veerkamp das Wort kratein noch ohne den Bezug auf die Exodusgeschichte aus, sondern vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den Judäern, die Jesus in Johannes 9,41 ihrer Verirrung überführt:
Kratein ist offenbar das Gegenteil. Kratein, „ergreifen, verhaften, dingfest machen“. Wir sollten uns erinnern an Johannes 9,41: Jesus sagte ihnen: „Wenn ihr blind wärt, würdet ihr euch nicht verirren. Jetzt sagt ihr: wir sehen. Eure Verirrung bleibt.“ Wenn also die Schüler feststellen, dass Menschen sich (politisch) irren, diese Verirrung bei ihnen „fest sitzt“, etwa wenn sie behaupten, sie seien auf dem richtigen Weg, dann bleibt nichts anderes übrig, als sie in die falsche Richtung gehen lassen, dann „ist“ die Verirrung in ihnen „fest gemacht worden“, so kann man das passive Perfekt kekratēntai umschreiben.
Im Grunde bezieht Veerkamp das, was wir traditionell unter Sündenvergebung verstehen und was eine solche Vergebung unmöglich macht, auf das resignative Verhalten gegenüber einer angeblichen Allmacht der gesellschaftlichen Verhältnisse:
Die Schüler und ihre messianischen Gemeinden sollten darin bestärkt werden, die Resignation und die Ohnmacht der Weltordnung gegenüber „aufzuheben (aphienai)“. Wer allerdings die Übermacht, ja Allmacht der Weltordnung als eine Tatsache ohne Alternative auffasst, dessen Verirrung sitzt dann so tief, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Das ist Verstockung. Dadurch, dass die Schüler die Alternative zeigen, ja leben, wird aus der politischen Verblendung Verstockung. Sie verursachen sozusagen die Verstockung.
Wir müssen diese Stelle nicht als Begründung für die Beichte auffassen, sondern versuchen, sie im Lichte des Erfüllungszitates Jesaja 6,10 zu verstehen, das uns Johannes 12,37-43 in einem bitteren Resümee hören ließ. Dort ging es um die Verstockung. Die Schüler sollen tun und reden wie die Propheten, wie Ezechiel, „dass der Verirrte, der umkehrt von seiner Verirrung, seine Seele am Leben hält“ (Ezechiel 18; 33,1-20); wie der Prophet Jesaja: ein Volk „mit verfettetem Herzen, schwerhörigen Ohren und verschmierten Augen“ geht zugrunde (6,10). Keine beneidenswerte Aufgabe für die inspirierten Schüler. Propheten finden selten Gehör!
Leider muss man hinzufügen: Selbst wenn sie doch Gehör finden, können sie, wie es dem Autor des Johannesevangelium am Ende geschieht, in extremer Weise missverstanden werden. Denn kaum einem Exegeten ist es noch bewusst, dass Johannes als jüdischer Messianist einen durch Jesus inspirierten Widerstand gegen die Gewaltverhältnisse dieser Weltordnung im Sinn hatte, der zu ihrer Überwindung durch die Praxis der agapē führen sollte. Schon bald wurde Johannes 20,23 eben tatsächlich auf eine Beichtpraxis bezogen, durch die der Sünder als Individuum seine Reinheit des Gewissens als Zugangsvoraussetzung zum Himmel herstellen lassen musste.
↑ Johannes 20,24-25: Thomas will die Wundmale Jesu sehen und ertasten, um vertrauen zu können
20,24 Thomas aber, einer der Zwölf,
der Zwilling genannt wird,
war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
20,25 Da sagten die andern Jünger zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen.
Er aber sprach zu ihnen:
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe
und lege meinen Finger in die Nägelmale
und lege meine Hand in seine Seite,
kann ich‘s nicht glauben.
[16. Februar 2023] Die Absicht (W562), die Johannes damit verbindet, dass er „an das Auftreten des auferweckten Jesus inmitten seiner Schüler, bei dem er sie mit Geisteskraft ausrüstete und sandte, nicht unmittelbar den Epilog anfügt und damit sein Evangelium abschließt, sondern noch eine weitere Erzählung bietet“, besteht nach Klaus Wengst darin, dass er in „der Gestalt des Schülers Thomas, die jetzt im Mittelpunkt steht, … dem Zweifel Raum“ gibt, und er
macht deutlich, wer allein den Zweifel überwinden kann, nämlich Jesus selbst. Dabei unterstreicht er noch einmal in großer Eindringlichkeit und Ausführlichkeit, was er schon vorher angedeutet hat, dass nämlich der Auferweckte kein anderer ist als der Gekreuzigte, dass er sich gerade als der Gekreuzigte ausweist. Auf ihn bleibt der Glaube derjenigen bezogen, die jenseits der Zeit derer leben, die Jesus „gesehen“ haben, wie es die Geschichten in Kap. 20 erzählen. Ihnen, den späteren Glaubenden, gilt die abschließende Beglückwünschung Jesu.
Den „Schüler Thomas“, der „zuerst in 11,16 und dann in 14,5 aufgetreten“ war, führt Johannes nun in Vers 24 erneut als „einen von den Zwölf“ ein, die nach 6,66f. „von den Schülern Jesu … übrig geblieben“ sind:
Dass danach andere dazu gekommen wären, wird nicht erzählt. Im Gegenteil, Judas ist herausgefallen. Die Zwölf ohne Judas hat Johannes also im Blick, wenn er nach 13,30 von den Schülern spricht. Das aber heißt, dass Thomas in der vorangehenden Erzählung eigentlich als anwesend gedacht wäre. Aber nun heißt es lapidar: „Thomas jedoch, einer von den Zwölfen, ,Zwilling‘ genannt, war nicht bei ihnen, als Jesus gekommen war.“ Das geht aus V. 19-23 nicht im Geringsten hervor. Diese Erzählung ist in sich abgeschlossen und auf keine Fortsetzung angelegt. Johannes eröffnet eine mögliche Fortsetzung, indem er nachträglich das Fehlen des Thomas bei der dort erzählten Begegnung feststellt. Diese neue Erzählung setzt damit die Vorhergehende voraus und hinge ohne sie in der Luft. Sie erweist sich damit als eine sekundäre Bildung. Aber indem Johannes sie erzählt, zeigt er, dass er an ihr ein primäres Interesse hat.
Wengst zufolge repräsentiert an dieser Stelle die „Leser- und Hörerschaft des Evangeliums“, die wie „Thomas bei der Begegnung des auferweckten Jesus mit seinen Schülern nicht anwesend war“ und wie er „auf das Zeugnis anderer angewiesen“ ist. In Vers 25 wird nun der Zweifel ausgesprochen, der auf Grund eines solchen Zeugnisses aufbrechen kann:
„Da sagten ihm die anderen Schüler: ,Wir haben den Herrn gesehen.‘“ Dass Jesus lebe, dass der Gekreuzigte „der Herr“ sei, weiß Thomas nur vom Hörensagen. Da erhebt sich Zweifel. In der Gestalt dieses Schülers bringt Johannes den Zweifel zur Sprache, dem er in seiner Gemeinde und ihrem Umfeld begegnet. Solchen Zweifel hat er schon in der Schülerfrage von 14,22 anklingen lassen: „Herr, wie kommt es, dass du dich uns zeigen willst und nicht der Welt?“ Die Kreuzigung Jesu ist eine feststehende historische Tatsache, seine Auferweckung dagegen – in der Perspektive von außen – nur ein Gerücht, weil einige behaupten, Jesus nach seinem Tod „gesehen“ zu haben. Solcher Art Zweifel gibt Johannes Ausdruck in der Gestalt des Schülers Thomas, der nicht dabei war, als Jesus seinen Schülern erschien.
Die Schilderung (W563) der „Überwindung dieses Zweifels“ hält Wengst „in zweifacher Hinsicht“ für „aufschlussreich“, und zwar erstens im Blick auf das, was der Evangelist
nicht schreibt. Er lässt die anderen Schüler den Thomas nicht bestürmen. „Glaube, der sich durch den Zweifel des andern an seine eigne Wundheit, an das Stück Unehrlichkeit und menschlicher Anstrengung in ihm selbst erinnert weiß, solch Glaube wird gegen den Zweifel ausziehen mit Büchse und Saufeder, so als ob es auf die Wildschweinjagd ginge.“ <1467> Nein, die anderen Schüler gehen gegenüber Thomas nicht auf solche Wildschweinjagd. Ihre Sache ist allein das Zeugnis, sonst nichts. Wie es Sache der Mirjam war, ihnen zu bezeugen: „Ich habe den Herrn gesehen“, so ist dasselbe Zeugnis ihre Sache gegenüber Thomas: „Wir haben den Herrn gesehen.“ Und es ist ganz und gar nicht ihre Sache, Thomas mit Bekehrungseifer zu bedrängen oder ihn gar auszuschließen. Sie behalten ihn in ihrer Gemeinschaft und er bleibt bei ihnen. Aber Glauben zu schaffen, der auf den Gekreuzigten als Auferweckten vertraut, und den Zweifel zu überwinden, ist weder ihre Sache noch seine. Das ist nach dieser Erzählung allein die Sache Jesu selbst. So macht sie davon frei, den Glauben als schwer errungene eigene Leistung zu verstehen und den Zweifel durch krampfhafte Anstrengung überwinden zu wollen. Sie macht dazu frei, mit Zweifeln in der Gemeinde zu bleiben, ja mit Zweifeln glauben zu dürfen.
Weitere Aufschlüsse ergeben sich nach Wengst daraus,
wie Thomas seinen Zweifel formuliert: „Wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger nicht an die Stelle der Nägel lege und meine Hand nicht an seine Seite lege, traue ich dem ganz gewiss nicht.“
Da es (Anm. 460) „[b]eim ‚Glauben‘ … selbstverständlich nicht um ein bloßes Fürwahrhalten“ geht, übersetzt Wengst „in diesem Zusammenhang mit ‚trauen‘, ‚vertrauen‘.“ Dabei verstehe ich nicht ganz, warum er das nur in diesem Zusammenhang für angebracht hält. Was Thomas zur Überwindung seines Zweifels für notwendig hält deutet Wengst folgendermaßen (W563):
Thomas fordert nicht auch für sich einfach eine Erscheinung Jesu, sondern er will wissen, ob „der Herr“, von dem die anderen reden, wirklich dieselbe Person ist, die er gekannt hat, Jesus von Nazaret – noch genauer: ob er mit dem identisch ist, der hingerichtet wurde. Zur Identität Jesu gehören unaufgebbar die Wundmale des Gekreuzigten. Sie sind das unveränderliche Kennzeichen seiner Person; durch sie bleibt er mit dem bestimmten Schicksal seines Todes am Kreuz gekennzeichnet. Ein auferweckter Jesus ohne Wundmale wäre nicht mehr derselbe Jesus, der am Kreuz hingerichtet worden ist, und dann auch nicht derselbe Jesus, dem seine Schüler nachgefolgt sind und weiter nachfolgen sollen. Thomas hat in 14,5 Unkenntnis über „den Weg“ geäußert. Inzwischen hat er wahrgenommen, dass der Weg Jesu ans Kreuz führte. Wie soll er sich „trauen“, diesem Weg zu folgen, wenn es ein Weg ins Scheitern war und also ein Weg ohne Perspektive ist? Er könnte sich nur dann „trauen“, er könnte nur dann „glauben“, wenn sich ihm wirklich der Gekreuzigte als „der Herr“ erwiese.
Diese Erklärung klingt plausibel und lässt doch Fragen offen. Immerhin haben manche Exegeten gerade die bleibende Ausstattung des Auferstandenen mit seinen Wundmalen als lächerlich betrachtet. Warum sollten diese als Beweis dafür tauglich sein, dass der Weg Jesu ans Kreuz kein Weg ins Scheitern war? Das Problem scheint mir darin zu bestehen, dass Wengst nicht klar genug macht, woran sich hier überhaupt der Zweifel entzündet. Es scheint ihm zufolge nicht einfach der Zweifel daran zu sein, ob ein Toter von Gott überhaupt neues Leben geschenkt bekommen haben kann, sondern daran, ob Jesus in seinem Weg ans Kreuz gescheitert ist. Warum aber ist dieses Scheitern ausgerechnet dann in Frage gestellt, wenn der auferstandene Jesus sich dem Zweifler mit seinen Wundmalen präsentieren kann?
Hartwig Thyen beschäftigt sich zu den Versen 24 und 25 mit solchen Fragen nicht. Er referiert zunächst einfach ihren Inhalt (T768):
Erst jetzt erfährt der Leser, daß Thomas, der hier als einer der Zwölf und wie schon in 11,16 als der Jünger mit dem Beinamen Didymos (Zwilling) eingeführt wird (s. dazu o. z. St.), nicht unter den Jüngern war, als Jesus ihnen am Osterabend erschien. Doch mit denselben Worten wie zuvor Maria den Jüngern verkündet hatte, daß sie den Herrn gesehen habe, so hatten sie Thomas gesagt: heōrakmen ton kyrion {Wir haben den Herrn gesehen}. Doch der hatte ihnen entgegnet: ,Wenn ich nicht (selbst) die Male der Nägel in seinen Händen sehe und meinen Finger in diese Nägelmale lege und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich das nie und nimmer glauben!‘ (stärkste Verneinung: ou mē pisteusō).
Außerdem geht er lediglich darauf ein, dass ein „Grund für die Abwesenheit des Thomas an jenem ersten Osterabend … nicht genannt“ wird und wir „auch nicht danach suchen“ sollten. Dazu macht Thyen zufolge (T768f.) unter
Berufung auf Alter, der gezeigt hat, daß in der Kunst biblischen Erzählens derartige Details wie in unserem Fall die Abwesenheit des Thomas oder in Joh 5,9, der Umstand, daß der Tag der Heilung ein Sabbat war, oft bis zur letzten Minute verborgen bleiben, … D.A. Lee <1468> darauf aufmerksam, daß auch für Johannes gilt: „Abwesenheit ist ein beliebtes literarisches Mittel dieses Autors“.
Ton Veerkamp <1469> stellt wie Wengst zu den Versen 24-25 fest, dass „Thomas, der solidarische Skeptiker, der Zwilling, … die messianische Gemeinde“ repräsentiert,
die sehen will, aber nicht sehen kann. Diese Gemeinde will belehrt sein. Auf die Botschaft seiner Mitschüler: „Wir haben den Herrn gesehen“, reagiert Thomas mit großer Skepsis. Er will eine tastbare Sicherheit, und zwar bezüglich der Vertrauenswürdigkeit eines geschundenen und getöteten Messias. Er scheint zu sagen: „Das soll euer Herr, Kyrios, sein, dieser vom Tode Gezeichnete?“ Er will also wissen, ob es sich um wirkliche tödliche Wunden handelt. Die messianische Gemeinde, die nach der Katastrophe Israels keine Perspektive mehr sieht, erst recht keine messianische, kann nicht verstehen, dass und wie die Zeichen des Todes die eigentlichen, messianischen Zeichen des Herrn sein sollen.
Damit bringt Veerkamp die Fragen zur Sprache, die in meinen Augen in der Auslegung dieser Stelle von Wengst offen geblieben sind.
↑ Johannes 20,26-29: Thomas inmitten der Schüler hinter verschlossenen Türen darf Jesu Wundmale sehen, und Jesus preist Vertrauende selig, die nicht sehen
20,26 Und nach acht Tagen
waren seine Jünger abermals drinnen,
und Thomas war bei ihnen.
Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren,
und tritt mitten unter sie und spricht:
Friede sei mit euch!
20,27 Danach spricht er zu Thomas:
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände,
und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
20,28 Thomas antwortete und sprach zu ihm:
Mein Herr und mein Gott!
20,29 Spricht Jesus zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du?
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
[16. Februar 2023] Indem (W563) der „bei der Begegnung Jesu mit seinen Schülern nicht anwesend[e]“ Thomas „[g]egenüber deren Zeugnis … für seine Bereitschaft zum Glauben eine Bedingung“ formuliert,
hat Johannes den Problemhorizont für die weitere Erzählung entworfen. Sie wird {Vers 26} mit einer neuen Zeitangabe fortgeführt: „Und nach acht Tagen waren seine Schüler wiederum drinnen und Thomas bei ihnen.“ Genau eine Woche später sind also Jesu Schüler wieder im Haus versammelt.
Zu dieser Zeitangabe bemerkt Wengst (Anm. 461) mit Schlatter, <1470> dass „‚[n]ach acht Tagen‘ … nicht ‚nach Ablauf von acht vollen Tagen‘“ meint, „sondern ‚nach dem Anbruch des achten Tages, am ersten Wochentag‘“, außerdem hält er es (W564) für „wahrscheinlich“, dass sich in dieser „Versammlung jeweils am ersten Wochentag, also am Sonntag“ bereits widerspiegelt, dass „zur Zeit des Johannes das sonntägliche Zusammenkommen der Gemeinde schon ein fester Brauch war“, worauf auch die Schrift Didache 14,1 verweist. Für Wengst ist darin ein „indirekter Hinweis“ darauf zu erkennen, wie Blank <1471> formuliert,
dass „die Gegenwart des auferstandenen Christus im Gottesdienst der Gemeinde erfahren werden kann“. Jedenfalls erzählt Johannes unmittelbar anschließend, dass Jesus wiederum unvermittelt da ist: „Jesus kam bei verschlossenen Türen und trat mitten unter sie und sprach: ,Friede sei mit euch!‘“ Von Furcht der Schüler wird nicht mehr gesprochen; die Türen sind jedoch noch verschlossen. Wieder entbietet Jesus den Schülern insgesamt den Friedensgruß. Darüber hinaus interessieren sie in dieser Erzählung nicht mehr. Jesus wendet sich allein Thomas zu.
Er weiß um seinen Zweifel, wie aus seiner unvermittelten Anrede an Thomas in Vers 27 hervorgeht:
„Strecke deinen Finger hierher und sieh meine Hände, strecke deine Hand aus und lege sie an meine Seite!“ Was Thomas gegenüber den anderen Schülern als Bedingung dafür, dass er ihrer Botschaft traue, verlangt hat, wird ihm von Jesus selbst gewährt. Gegenüber den Angaben in V. 20 wesentlich verstärkt und durch die Aufnahme der Aussagen des Thomas betont hervorgehoben, gibt sich der Auferweckte als der Gekreuzigte zu erkennen. Noch einmal: Die Wundmale machen seine Identität aus.
Eine (Anm. 464) angeblich „beachtliche Parallele“, die Schnelle <1472> dazu bei Philostrat findet, entspricht dem bei Johannes Erzählten nicht so genau, wie dieser meint:
Danach hatte sich Apollonius vor einem Prozess vor Domitian mit seinen Schülern verabredet, sie danach an einem bestimmten Ort zu treffen. Bei diesem Prozess musste mit seiner Verurteilung zum Tod gerechnet werden. Als er dann tatsächlich mit seinen Schülern zusammentrifft und sie unsicher sind, ob er wirklich lebe, fordert er sie auf, seine Hand zu ergreifen und sich so von seiner leibhaftigen Lebendigkeit zu überzeugen. Als sozusagen natürliche Reaktion der Schüler wird daraufhin erzählt: „Sie standen auf, warfen Sich um seinen Hals und umarmten ihn“. Eine solche Reaktion findet sich bei Johannes in 20,17 angedeutet und dann sofort von Jesus untersagt und kommt bei den weiteren Erscheinungserzählungen gar nicht in den Blick. Das gilt auch für Lk 24,39f. Selbst diese massivste neutestamentliche Erscheinungsgeschichte wahrt insofern Distanz, als sie erkennen lässt, dass es bei Jesus nicht um die Rückkehr in das Leben vor dem Tod geht. Mit ihrer Art der Darstellung weisen diese Erzählungen auf eine andere Dimension von Wirklichkeit.
Thomas hatte (W564), „weil er von der Unerfüllbarkeit seiner Bedingung ausging, mit Bestimmtheit gesagt, dem nicht zu trauen bzw. nicht zu glauben, was die anderen ihm bezeugten“. Nun aber hat Jesus seine Bedingung erfüllt und fordert ihn auf:
„Und sei nicht ohne Vertrauen, sondern habe Vertrauen!“ Luther übersetzt: „Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Die positive Formulierung findet sich identisch in der Mahnung in Apk 2,10, die Luther so übersetzt: „Sei getreu (bis an den Tod)!“ Dort wird die Gemeinde in Smyrna ermuntert, in bedrängter Situation ihren Weg im Vertrauen auf Gott, der in Tod und Auferweckung Jesu gehandelt hat, weiterzugehen.
Zu diesem „Verständnis von Glauben bzw. Vertrauen“ zitiert Wengst entsprechende „Aussagen der rabbinischen Tradition“ (W564f.): <1473>
Als die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten in die ausweglose Situation zwischen dem Meer und dem sie verfolgenden ägyptischen Heer zu geraten drohen (S. 83: „[…] das Meer vor ihnen und die Ägypter hinter ihnen“), bringt Mose sie genau da hinein durch die Rückkehr nach Pi-Hachirot (Ex 14,2), die beim Signal des Blasens erfolgen soll. „Als er das Horn blies zurückzukehren, begannen diejenigen, denen es in Israel an Vertrauen fehlte, ihre Haare auszuraufen und ihre Kleider einzureißen, bis Mose zu ihnen sprach: ,Aus dem Munde der Macht ist mir gesagt worden, dass ihr Kinder von Freien seid!“ Es gilt also, auf Gottes Verheißungswort zu trauen und den eingeschlagenen Weg in die Freiheit weiterzugehen.
Wird Wengst nun (W565) auf Grund dieser Parallele auch so konsequent sein, das von Thomas geforderte Vertrauen darauf zu beziehen, dass der Aufstieg des gekreuzigten Messias zum VATER den Weg Israels inmitten der Völker in die Freiheit bereitet? Er beginnt seine Antwort auf die Frage: „Worauf soll Thomas vertrauen? Was soll er ‚glauben‘?“ mit den sehr allgemein gehaltenen Worten:
Angesichts dessen, dass sich ihm der gekreuzigte Jesus als lebendig erwiesen hat, kann und soll er darauf setzen, dass Gott hier sein schöpferisches, Leben aus den Toten schaffendes Wort gesprochen hat, und sich auf die Nachfolge Jesu einlassen.
Für „bezeichnend“ hält es Wengst, „dass Johannes nichts davon erzählt, Thomas sei der Aufforderung Jesu, seine Wundmale zu berühren, nachgekommen“. Das betont er (Anm. 465) gegenüber Hirsch-Luipold, <1474> demzufolge „Jesus in dieser Erzählung ‚die handgreiflichste Form körperlicher Versicherung‘ einsetze, ‚die Versicherung über das Greifen mit den Händen‘.“ Aber tatsächlich spricht Jesus „im folgenden Vers hinsichtlich der sinnlichen Wahrnehmung des Thomas nur vom Sehen.“ Allein dieses Sehen genügt (W565), um ihn „stattdessen sofort auf die letzte Aufforderung Jesu mit einem bekennenden Ausruf reagieren“ zu lassen (Vers 28):
„Thomas antwortete und sagte ihm: ,Mein Herr und mein Gott!‘“ Er macht diesen Ausruf im Augenblick der Erkenntnis, dass der gekreuzigte Jesus lebt.
Im Zusammenhang mit der Deutung dieses Thomasbekenntnisses sieht sich Wengst genötigt, eine ganze Reihe von Klarstellungen zu unternehmen.
Zu dem Bekenntnis ho theos mou {mein Gott} hebt er erstens hervor: „Er lebt nicht deshalb, weil er „ein Wesen göttlicher Art“ sei“ (Anm. 466), wie Schneider <1475> meint, denn der „Artikel vor ‚Gott‘ im griechischen Text ‚(ist) durch den Vokativ bedingt‘ und macht nicht über Jesus eine Wesensaussage als ‚Gott‘.“
Zweitens betont Wengst (W565): „Dass der gekreuzigte Jesus lebt, ist in Gottes schöpferischer Macht begründet.“ In seinen Augen (Anm. 467) ist die Annahme von Hirsch-Luipold [342] „doppelt falsch“, dass „Jesus nach Lazarus auch sich selbst aus den Todesbanden befreit“ habe, denn bei
der Auferweckung des Lazarus ist Gott das entscheidend handelnde Subjekt (Joh 11,41f.). Er ist auch logisches Subjekt in 2,22: „Als er (Jesus) von den Toten aufgerichtet/aufgeweckt worden war“. Wie Jesus sich nach der analogen Aussage in 12,16 nicht selbst verherrlicht hat, ist auch hier egérthe nicht in dem Sinne zu verstehen, dass er „sich aufrichtete“ oder schlicht „aufwachte“.
Drittens (W565) geht er näher auf den Zusammenhang der beiden Bekenntnisformeln ho kyrios mou kai ho theos mou {mein Herr und mein Gott} ein:
Mirjam aus Magdala und die Schüler hatten bezeugt, „den Herrn gesehen“ zu haben (20,18.25). Sie hatten Jesus als Lebendigen wahrgenommen, von Gott zu einem Leben erweckt, das den Tod nicht mehr vor sich hat. Das macht Thomas ausdrücklich, wenn er Jesus anredet: „Mein Herr und mein Gott!“ Er sieht den Gekreuzigten und erkennt in dessen Lebendigkeit den schöpferisch handelnden Gott.
Von daher kann Wengst (Anm. 468) der Aussage Dietzfelbingers <1476> zustimmen:
„In Jesus wird Gott selbst präsent“, [hält] es aber für verfehlt, wenn er – wie viele andere – einen Satz vorher meint: „Mit der Benennung Jesu als Kyrios (Herr) wurde der alttestamentliche Gottesname J[…] (von Dietzfelbinger ausgeschrieben) auf Jesus übertragen – ein entscheidender und für die Zeitgenossen unerhörter theologischer Schritt“ (vgl. aber auch die differenzierteren Ausführungen auf S. 344f.). Mir scheint, dass so aufgrund der Gleichheit des griechischen Wortes kýrios erst in griechischer Tradition gedacht werden konnte, als man das einmütige Zusammenwirken von Vater und Sohn (Joh 10,30) ontologisch als Wesenseinheit begriff. Wenn im Neuen Testament von Jesus als „Herrn“ (kýrios) gesprochen wird, steht hebräisch adón oder aramäisch mar dahinter. Im Ruf marána thá ist das auch ausdrücklich fassbar.
Wengst ist sicher darin zuzustimmen, dass es im Johannesevangelium noch nicht um die wesensmäßige Einheit Jesu mit Gott geht, wie sie die Konzilien in griechisch-philosophischer Terminologie formulierten. Dennoch ist es in meinen Augen kaum von der Hand zu weisen, dass der Messias Jesus den Willen und das Wirken des Gottes Israels nach Johannes in einem solchen Ausmaß repräsentiert, dass man ihn tatsächlich als die Verkörperung seines befreienden NAMENS betrachten kann. Entscheidend für das angemessene Verständnis dieser Verkörperung ist es jedoch, sie von den jüdischen Schriften her zu begreifen, und zwar insofern, als im Wirken Jesu und vor allem durch seinen Tod am Kreuz die für Israel geltenden Verheißungen des Lebens der kommenden Weltzeit in Erfüllung gehen. Problematisch wird eine christlich verstandene Übertragung des Gottesnamens auf Jesus dann, wenn damit der eine Gott Israels von Jesus her völlig neu definiert werden soll.
Nach Wengst geht es im Thomasbekenntnis viertens darum (W565f.), dass „zum Ziel“ kommt,
was Jesus in den Abschiedsreden gegenüber Philippus gesagt hat: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (14,9). Das verstanden die Schüler in der Situation des Abschieds nicht. Es erschließt sich erst angesichts des auferweckten Gekreuzigten. Darauf kommt es Johannes aufgrund der erfahrenen Infragestellung an: herauszustellen, dass Gott auch und gerade im gekreuzigten Jesus präsent ist.
Zustimmend zitiert Wengst dazu Marianne Thompson: <1477> „Sehen erfordert die Gegenwart dessen, der gesehen wird“, wendet sich aber zugleich kritisch (Anm. 469) gegen ihre Schlussfolgerung,
es sei „die Erkenntnis Gottes keine Erkenntnis, die es abgesehen von der Person Jesus gibt“. Danach stellt sie fest: „Die Bezeichnung ,Gott‘ wird unter Bezug auf das Wort (Gottes) gebraucht und unter Bezug auf den Auferweckten“, sie werde aber „nicht gebraucht für Jesus von Nazaret während seines Lebens und Wirkens“ (233f.). In 1,1 wird „das Wort“ in engste Verbindung mit Gott gebracht, aber nicht mit ihm identifiziert. Darf man angesichts der genannten Beobachtungen im Blick auf das Thomasbekenntnis von der „Identität Jesu mit Gott“ reden (235) oder aus der „Verleiblichung des Wortes Gottes“ in Jesus folgern: „Dann verdient er die Anrede ,mein Gott‘“ (224)? Wem genau gilt diese Anrede?
Wengst meint, nicht weiter gehen zu dürfen (W566), als dass
Gottes Gegenwart im Gekreuzigten – das Sehen des Vaters im Sehen Jesu – … von Thomas wahrgenommen [wird] angesichts des Auferweckten. Es ist die Gegenwart des Schöpfers, der hier endzeitlich-neuschöpferisch gehandelt hat, indem er den am Kreuz gestorbenen Jesus ins Leben rief, das den Tod ein für alle Male hinter sich hat. Wenn Thomas Jesus in dieser Weise sieht, sieht er „den Vater“. Ihm gilt daher das Bekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“
Damit bestätigt sich für Wengst, was Johannes bereits im ersten Vers seines Evangeliums von dem Wort Gottes gesagt hatte, das im gesamten Weg Jesu bis zum Kreuz zur Sprache kommen würde:
Mit diesem Bekenntnis fast am Schluss des Evangeliums schlägt Johannes einen Bogen zurück zum Anfang. Dort hat er vom „Wort“ gesprochen, das am Anfang bei Gott und gottgleich war und das Fleisch wurde (1,1.14; vgl. 1,18). Damit hat er deutlich gemacht, dass im Weg Jesu, wie dann im Evangelium dargestellt, derjenige zu Wort kommt, „der sprach und es ward die Welt“. <1478> Er kommt es gerade auch an Jesu so bitterem Ende am Kreuz. … Darauf werden die das Evangelium Lesenden und Hörenden gleich zu Beginn hingewiesen. Aber es erschließt sich ihnen – wie den in ihm auftretenden Schülern – erst von seinem Schluss her. So wird, wer das Evangelium zum ersten Mal durchschritten hat, zu dessen erneuter Lektüre an den Anfang zurückverwiesen, um nun den Weg Jesu bewusst als Weg des Mitgehens Gottes zum Kreuz wahrzunehmen.
Fünftens betont Wengst nochmals, dass Thomas „sein Bekenntnis gegenüber einem“ ausspricht, „der hingerichtet worden ist“, und sieht (Anm. 472) als einen möglichen „antithetische[n] Hintergrund“,
dass Kaiser Domitian sich entsprechend nannte und benennen ließ. Sueton kennzeichnet es als Ausdruck seiner „Arroganz, als er eine Verfügung im Namen seiner Prokuratoren diktierte; er begann nämlich so: ,Unser Herr und Gott befiehlt, daß folgendes zu geschehen habe.‘ Seitdem war es üblich, daß man ihn sogar in Briefen und im Gespräch so nannte“. <1479> Bei Johannes wird die Anrede „mein Herr und mein Gott!“ nicht dem höchsten Repräsentanten der Gewalt zuteil, sondern erfolgt angesichts eines Opfers dieser Gewalt. Es sei allerdings auch darauf hingewiesen, dass Beamte und Priester als „Gott und Herr“ bezeichnet werden konnten. Dafür nennt Deissmann <1480> zwei Fälle aus der Zeit des Augustus, in denen nach ihm Schmeichelei um des Geldes willen vorliegt.
An einem solchen Bekenntnis zu einem Gekreuzigten ist nach Wengst (W566f.)
schon früh auch innerhalb der Kirche Anstoß genommen worden. Jesus habe nur „scheinbar“ (dokéo) gelitten und sei nur „scheinbar“ am Kreuz gestorben. Diese „Doketen“ sind zuerst in den Briefen des Ignatius von Antiochia zu erkennen (IgnTrall 9f.; IgnSm 1-4) und wurden im Laufe der Zeit als Ketzer ausgeschlossen. Ihr Jesus hat keine Wundmale. Das Ärgernis, dass das höchste Bekenntnis gegenüber einem Gekreuzigten gesprochen wird, ist aber auch da verdrängt, wo nicht mehr wahrgenommen wird, dass das Kreuz Jesu ein elender Galgen war, wo das Kreuz „Vergoldung“ erfährt, wo es zum Symbol der Macht erhoben oder zum Schmuckstück bagatellisiert wird.
Indem Wengst (W567) die Kritik des Atheisten Nietzsche <1481> am gekreuzigten Gott zitiert, macht er deutlich, dass dieses „Ärgernis … manchmal von erklärten Nichtchristen schärfer erkannt worden als innerhalb der Kirche“:
„Gott am Kreuze – versteht man immer noch die furchtbare Hintergedanklichkeit dieses Symbols nicht? – Alles was leidet, alles was am Kreuze hängt, ist göttlich […].“ Er hat gewusst: Wenn Gott im gekreuzigten Jesus gegenwärtig ist, dann hat das außerordentliche Konsequenzen; und die lehnt er radikal ab. Wenn Gott im gekreuzigten Jesus gegenwärtig ist – dann kann man zwar nicht mit Nietzsche formulieren, dass alles, was leidet, göttlich sei. Aber dann muss man sagen, dass Gott der Gott für die Leidenden, für die Gefolterten und Entrechteten ist. Dem auferweckten Jesus sind die Wundmale, die ihm am Kreuz zugefügt wurden, nicht verheilt; er behält sie. Er ist kein heiler Siegertyp, sondern ein tief verletzter, ein geschundener Mensch, dessen Verletzungen sichtbar bleiben. Durch sie bleibt er den Leiden und Leidenden der Welt verbunden.
Das „Bekenntnis des Thomas“ bildet nicht das Ende dieser Szene; in Vers 29 folgt noch eine Reaktion Jesu:
„Weil du mich gesehen hast, hast du vertraut? Glücklich, die nicht gesehen haben und doch Vertrauen gewinnen.“ Von Thomas herkommend nimmt die abschließende Beglückwünschung die das Evangelium Lesenden und Hörenden in den Blick, die jenseits der Zeit der Ostererfahrungen der Schüler Jesu leben. Am Beginn der Erzählung stand Thomas mit ihnen auf einer Stufe, insofern auch er die Ostererfahrung der anderen nicht geteilt, sondern nur ihr Zeugnis gehört hatte. An ihm wurde gezeigt, dass Jesus selbst in seiner Lebendigkeit beeindruckt und Glauben hervorruft. Aber er tut es gegenüber Thomas, wie er es gegenüber Mirjam und den Schülern getan hat, in einer Weise, wie sie die Späteren nicht mehr erfahren werden. Insofern Thomas als Hörer des Zeugnisses der anderen mit den Späteren zusammenstand und diese Späteren wegen ihres Glaubens glücklich gepriesen werden, ohne gesehen zu haben, enthält der erste Satz Jesu an Thomas auch eine Kritik: „Weil du mich gesehen hast, hast du vertraut?“ Er hätte aufgrund des Zeugnisses der anderen glauben können und sollen.
In diesem Zusammenhang erinnert Wengst (Anm. 475) an Johannes 1,50 und sieht eine Analogie zur dem, was Jesus dort dem Natanael sagt. „Überhaupt zeigt sich eine strukturelle Nähe zwischen den Erzählungen über Natanael (1,45-51) und hier über Thomas“. Außerdem verweist er auf eine rabbinische Parallele (W567f.): <1482>
In Auslegung von Jes 54,12, dass Gott Jerusalems Tore zu Edelsteinen mache, malt Rabbi Jochanan Jerusalems künftige Herrlichkeit so aus, dass der Heilige, gesegnet er, Edelsteine und Perlen von 30 Ellen im Quadrat zu Toren bilde und an Jerusalems Toren aufstelle. Ein Schüler spottet darüber, weil es Edelsteine und Perlen ja nicht einmal in der Größe eines Eis der Turteltaube gäbe. Auf einer Seereise „sieht“ er dann die Dienstengel entsprechend großen Edelsteinen und Perlen arbeiten und erfährt von ihnen, dass diese tatsächlich als künftige Tore Jerusalems dienen sollen. Daraufhin kehrt er zu Rabbi Jochanan zurück: „,Lege aus, Rabbi! Dir geziemt es, auszulegen. Wie du es gesagt hast, so habe ich es gesehen.“ Er sprach zu ihm: ,Hohlkopf, wenn du nicht gesehen hättest, hättest du nicht geglaubt. Ein Spötter über die Worte der Weisen bist du.‘“ „Die Worte der Weisen“ sind Auslegung des Wortes Gottes. Der Schüler hat nicht einfach nur Rabbi Jochanans Worte verspottet, er hat dem Verheißungswort Gottes nicht getraut, das Jerusalem – und Israel – Zukunft gibt.
Obwohl Wengst (W568) eine „Kritik an Thomas“ wahrnimmt, lehnt er es ab, diese Kritik auch auf sein Bekenntnis zu beziehen und erst recht nicht als „Kritik an den Ostererzählungen überhaupt“ zu begreifen:
Das jedoch meint Bultmann: <1483> „Wie der Schwachheit des Menschen das Wunder konzediert wird, so wird der Schwachheit der Jünger die Erscheinung des Auferstandenen konzediert. Im Grunde sollte es dessen nicht bedürfen! Im Grunde sollte nicht erst die Schau des Auferstandenen die Jünger bewegen, ,dem Worte, das Jesus sprach‘, zu glauben (2,22), sondern dieses Wort müßte allein die Kraft haben, ihn zu überzeugen.“
Demgegenüber hält es Wengst für höchst unwahrscheinlich, dass „Johannes – höchst unkritisch – gleich drei Erscheinungserzählungen hintereinander bietet, um sie dann mit einem einzigen kurzen Satz zu kritisieren“. Im ganzen Evangelium
ist zu beachten, dass die Wörter, die Jesus als „das Wort“, das Glauben weckt, enthalten und bezeugen, zu einem nicht unerheblichen Teil von Wundern erzählen und zu einem wesentlichen von Erscheinungen des auferweckten Gekreuzigten. Nur von deren Osterzeugnis her konnte Johannes schon die Kreuzigung Jesu als Erhöhung, als Verherrlichung darstellen. Deshalb kann er nicht auf sie verzichten. Auf ihr Zeugnis sind die Späteren angewiesen. Sie, „die nicht gesehen haben“, werden glücklich, werden „selig“ gepriesen, „weil sie glauben können aufgrund dessen, was gesehen worden ist. Selig sind sie also gerade durch ihre Angewiesenheit auf die Seherfahrung der anderen. Sie glauben, weil andere gesehen haben. Indem sie auf das Sehen der anderen bezogen sind, öffnen sich auch ihre Augen für die Anschaulichkeit Gottes, die im Weg Jesu ans Kreuz offenbar geworden ist.“ <1484>
Abschließend betont Wengst mit einem Zitat von Calvin, <1485> dass es dabei darauf ankäme, Jesus
„ebenso deutlich im Evangelium ([zu] sehen), als stünde er leibhaftig vor uns“, im Hören auf das Zeugnis ihn selbst als lebendig und wirksam zu erfahren. Indem das Zeugnis der Thomasgeschichte den Glauben auf die Wundmale des Gekreuzigten verweist, wird er daran gehindert, schwärmerisch über die Leiden der Welt hinwegzusehen und sich Illusionen von einer heilen Welt zu machen. Deshalb äußert sich der Glaube an den Auferstandenen in einer Praxis der Nachfolge des Gekreuzigten (vgl. 12,26). Die späteren Glaubenden werden zwar nicht wie Thomas die Wundmale Jesu zu sehen bekommen. Aber es käme wohl darauf an, dass sie die Wunden seiner geringsten Schwestern und Brüder (Mt 25,31-46) nicht übersehen.
Hartwig Thyen (T769) beschränkt sich zu den Versen 26 und 27 auf ihre inhaltliche Wiedergabe samt einigen Bemerkungen, die über die Auslegung von Wengst nicht hinausgehen:
Nach acht Tagen, also wiederum am Sonntag als dem Tag der Auferstehung, an dem sich, sicher bereits als unser Evangelium geschrieben wurde bis in unsere Gegenwart Jesu Jünger immer noch versammeln, sind die Jünger wieder beieinander und nun ist auch Thomas unter ihnen. Trotz ihrer österlichen Sendung verschanzen sie sich immer noch hinter verschlossenen Türen. Doch die hindern Jesus nicht, erneut mit dem Friedensgruß eirēnēn hymin {Friede mit euch} in ihre Mitte zu treten. Und völlig unvermittelt, als habe er die zweifelnde Entgegnung des Thomas an seine Mitjünger Wort für Wort mitgehört, fordert er den nun auf: ,Reiche mir deinen Finger her und sieh dir meine Hände an; und gib mir deine Hand und lege sie (in die Wunde) in meine(r) Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern glaube!‘
In den Worten „Mein Herr und mein Gott!“, mit denen Thomas in Vers 28 darauf antwortet, sieht Thyen
das adäquateste und gefüllteste Bekenntnis des gesamten Evangeliums. In ihm gipfeln alle bisherigen Prädikationen Jesu und zugleich werden hier die Aussagen des Prologs: kai theos ēn ho logos {und Gott war das Wort} (1,1) und monogenēs theos ho ōn eis ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato {der einziggeborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat Kunde gebracht} wieder eingeholt.
Zugleich kann nach Thyen im
Blick auf die Äußerung der Oberpriester und ihres Gefolges, die auf die Pilatusfrage: ‚Soll ich etwa euren König kreuzigen?‘ emphatisch geantwortet hatten: ,Wir haben keinen König außer dem Caesar!‘ (19,15), … das Thomas-Bekenntnis von den Lesern des Evangeliums vielleicht zugleich als eine Absage an jegliche Form des Kaiserkultes verstanden worden sein, die sich wohl auch hinter dem rätselhaften Schlußwort des ersten Johannesbriefes verbirgt: teknia, phylaxate heauta apo tōn eidōlōn {Kindlein, hütet euch vor den Götterbildern} (5,21 <1486>). … Das erscheint uns jedenfalls insofern nicht abwegig, als sich der zur Zeit der Entstehung unseres Evangeliums regierende Imperator Domitian, sei es mündlich oder sei es schriftlich, stets mit der Anrede ho kyrios hēmōn kai ho theos hēmōn {Unser Herr und unser Gott} prädizieren ließ, nachdem er sich selbst in einem amtlichen Erlaß einmal so genannt hatte (Sueton, Domitian 13).
In diesem Zusammenhang betont Thyen, dass die Bezeichnung „der ,ungläubige Thomas‘“ eine Karikatur darstellt, statt dass sie ihn „in seinem berechtigten Anliegen“ versteht. Da er sich weigert, „aufgrund bloßen Hörensagens zu glauben“, und „die Gegenwart seines Herrn durch eigenes Sehen und Fühlen selbst erfahren“ will,
wird Thomas kritisiert, weil er nicht um des reinen Glaubens willen glauben, sondern selbst sehen will. Dazu erklärt L. Steiger <1487> treffend: „Aber um diese falsche Reinheit geht es gar nicht. Und Thomas will ja nicht nur sehen, sondern auch anfassen. Selber will er seine Erfahrung machen, will nicht glauben, weil andere erfahren haben. Diesen Thomas darf keiner sich schenken“. Wie die Leute aus dem samaritanischen Sychar will Thomas am Ende auch sagen können: Ich glaube jetzt nicht mehr aufgrund eurer Botschaft, sondern weil ich selbst gehört und begriffen habe, daß dieser wahrhaftig der Erlöser der Welt ist (4,42).
Was Lothar Steiger damit meint, das lässt Thyen ihn selber erläutern, indem er darauf aufmerksam macht, dass grundsätzlich kein Glaubender in einer anderen Situation ist als Thomas. Auch er konnte den Auferstandenen letzten Endes nicht anders sehen oder erfahren als jeder spätere Glaubende (T769f.):
Steiger [100] fährt fort, oft werde von Theologen gesagt, „daß wir vom Auferstandenen keine ,objektiven‘ Zeugen haben, sondern nur solche Zeugen, die auch zum Glauben gelangten durch ihr Sehen. Das ist richtig – und bleibt doch eine unwahre Behauptung, weil man damit sagt, daß einer heute den Auferstandenen nicht sehen könne. Und so zweifelt man insgeheim auch, ob er denn je gesehen wurde. Daß es den Thomas geben muß, liegt eben daran, daß er den Zweifel festhält. Gäbe es diesen Zweifel nicht in einer Geschichte, die vom auferstandenen Herrn erzählt, so kämen wir alle nicht vor, die wir zweifeln müssen, solange wir nicht erfahren haben. Mag sein, daß die Geschichte von Thomas bereits für diejenigen geschrieben ist, die meinen (sic!), den Auferstandenen nicht mehr sehen zu können. Daß diesen deshalb zugerufen wird: Selig, wer nicht sieht und doch glaubt! Wäre dies so, Thomas bliebe doch wieder die Ausnahme, hätte seinen Platz bei den Jüngern, die den Herrn sahen. Und wer wollte nicht da seinen Platz haben? … Zu tadeln ist Thomas nicht, weil er seinen Herrn so nah haben wollte. Damit machte er ja nur aufmerksam auf den Zusammenhang, der besteht zwischen Geist, Seele und Leib. Daß es um die ganze unteilbare Wirklichkeit im Glauben zu tun ist. Sondern zu tadeln ist, daß Thomas etwas zur Bedingung seines Glaubens macht. Wenn ich nicht…, kann ich nicht glauben (20,25). Verständlich, daß Thomas so redet, denn er will nicht ausgeschlossen sein von der Erfahrung der anderen Jünger. Und dennoch verschließt er sich so die Möglichkeit, den Auferstandenen zu sehen. In keiner Geschichte, in der sich Jesus lebendig zeigte, hieß es, daß ,deswegen‘ geglaubt wurde. Ja vom Glauben war nicht eigens die Rede, weil von der Erfahrung erzählt wurde, durch die Glaube entsteht. Diese logische Struktur Wenn – dann widerspricht der Erzählstruktur und dem Medium der Beschreibung. Der Auferstandene läßt sich gleichwohl in der Erzählung auf die Logik des Zweifels ein. Er ahmt den Sprachbau des Thomas (weil – darum) in der Antwort nach. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Und dann folgt der berühmte Satz, der im Zusammenhang mit dem vorigen erst seinen Sinn gewinnt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“
Dieser „Makarismus {Seligpreisung}“ in Vers 29 wird in den Augen von Thyen (T770) daher
[z]u Unrecht … fast immer so ausgelegt“, als formuliere er die Moral von der Geschichte des Zweiflers, als preise er im Gegensatz zu Thomas allein die Nachgeborenen selig, die sogenannten ,Schüler zweiter Hand‘, deren Glaube sich nicht mehr auf eigene Erfahrungen mit dem Irdischen und dem Auferstandenen, sondern nur noch auf das apostolische Zeugnis seiner originären Augenzeugen gründen könne. Demgegenüber hatten wir schon zu dem Prologsatz: „Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ ausgeführt, daß in ihm nicht die Stimme zufälliger historischer Augenzeugen erklingt. Vielmehr wird darin die Erfahrung der Glaubenden aller Zeiten laut, so daß hier deren „Gleichzeitigkeit in der Autopsie des Glaubens“ (Kierkegaard) zur Sprache kommt.
Zur Unterstützung seiner Auslegung zieht Thyen als Parallele die einführenden Verse 1-4 des 1. Johannesbriefs heran, die ihm zufolge in gleicher Weise zu verstehen sind:
Da will nicht, wie Kügler <1488> argwöhnt, ein autoritärer Anonymus durch die Fiktion seiner Augenzeugenschaft des historischen Jesus seinem Schreiben eine unhinterfragbare Autorität verleihen, sondern da wollen im glaubenden Umgang mit dem gegenwärtigen Auferstandenen Erfahrene eine von Apostasie bedrohte Christengemeinde für die volle koinōnia {Gemeinschaft} „mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus“ zurückgewinnen, damit auch sie die 16,22 verheißene Freude erfülle. Das zeigen die auffallend neutrische Formulierung, der Perfekt-Aspekt der Verben, ho akakoamen, ho heōrakamen tois ophthalmois {was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen} und die Formulierung peri tou logou tēs zōēs {über das Wort vom Leben} deutlich.
Interessant finde ich, dass von der Aussageabsicht der beiden Texte her Thyen zwar gegen Kügler Recht zu geben ist, dass aber dennoch 1. Johannes 1,1-4 gar nicht auf die Erfahrung der Auferstehung Jesu bezogen sein muss. Ton Veerkamp <1489> hat in seiner Auslegung dieser Stelle mit überzeugenden Gründen in Zweifel gezogen, dass sich, wie es „die gängige Auslegung“ will, die
Wörter „hören, mit den Augen sehen, erschauen, mit den Händen ertasten“ …, auf „das Wort des Lebens“ [beziehen], wie man meistens übersetzt. Was man hört, sieht, erschaut und ertastet, also eben das, „was von Anfang war“, beziehe sich auf jenes „Wort des Lebens“ und das könne, nach unseren dogmatischen Vorstellungen, nur die „zweite Person der Dreieinigkeit“, schlicht „Jesus Christus“, sein. Solche Vorstellungen lasten wie ein ungeheurer Verfremdungsdruck auf diesem Text.
Veerkamp dagegen besteht darauf, den 1. Johannesbrief wie überhaupt die messianischen Schriften dessen, was wir Neues Testament nennen, von den jüdischen heiligen Schriften her auszulegen, und fährt fort:
Daß man „Reden“ (debarim) hören kann, ist nicht verwunderlich; in der Sprache der Schrift, die Grundsprache des Judäers „Johannes“, kann man „Reden“ auch sehen. Die „Rede“ die man hören kann, ist die „Rede“ der Befreiung, Dtn 4,32f:
Ob etwas geschah wie diese große Rede,
oder etwas gehört wurde, wie diese: da,
ob wohl ein Volk eine Stimme „Gottes“ hörte,
redend mitten aus dem Feuer,
wie du es hörtest und bliebst am Leben …Im gleichen Text hören wir (4,9):
Jedoch hüte deine Seele, hüte sehr,
daß du vergessen würdest
die Reden, die deine Augen sahen.
Es würde zu weit führen, Veerkamps gesamte Auslegung von 1. Johannes 1,1-4 wiederzugeben; wichtig ist seine Schlussfolgerung:
Unser Text bezieht das nicht auf den auferstandenen Messias, sondern auf die debarim, die Reden und Taten in und für Israel. Sicher ist der Messias ein dabar {Wort, Tatwort, Worttat} in und für Israel, aber eben und nur im Rahmen dieser Reden und Taten, die wir von Anfang gehört, gesehen (mit den Augen!), erschaut und mit den Händen ertastet haben. Die Reden sind wirklich sichtbar und die Vision ist mit den Händen zu greifen: wahrhaftiges, irdisches, „weltliches“ Leben. Freilich steckt in diesem sicher auch eine Ankündigung einer Auseinandersetzung mit der Vergeistigung des Messias und der Rede an Israel überhaupt, die in den Gemeinden aus den gojim (unter dem Label „Heidenchristen“ bekannt) gang und gäbe geworden scheint.
Von hier aus wäre dann auch Thyens und Steigers Auslegung von Johannes 20,29 noch einmal zu überdenken. Worauf bezieht sich eigentlich in ihren Augen der Glaube, zu dem Thomas durch das Sehen des Auferstandenen befähigt wird? Nach Thyen (T770), der nochmals Steiger [101f.] zitiert, ist es
der Auferstandene selbst, der dafür sorgt, daß die falsche Fragestellung des Zweiflers nicht fehlschlägt. „Er spricht mit Thomas und führt seinen Finger. Damit konnte der Zweifler nicht rechnen, der doch ,selber‘ sehen und anfassen wollte. … So darf der Zweifler dennoch in die Erfahrung des Auferstandenen gelangen. Sein Zweifel wird nicht ausgeschlossen, sondern behoben und über sich aufgeklärt. Behoben wird er, weil er sehend und fühlend wird! Über sich aufgeklärt wird er, weil Thomas glaubend seinem früheren Sehenwollen gegenüberstehen darf. In diesem Gegenüber ist er nicht mehr unglücklich, sondern selig“.
Verglichen mit der Einbettung der Glaubenserfahrung jüdischer Messianisten in die Befreiungshoffnungen der Tora und der Propheten, wie Veerkamp sie voraussetzt, konzentriert sich bei Thyen und Steiger der Glaube des Thomas und aller späteren Christen, die es schaffen, ihren Zweifel zu überwinden, auf die Erfahrung des auferstandenen Jesus in seiner ihn selig machenden Kraft.
Betrachten wir von hier aus die Art und Weise, wie Ton Veerkamp <1490> die Verse Johannes 20,25-29 auslegt. Er legt Wert darauf, in welcher Zeit – nämlich nach dem verheerenden Judäischen Krieg – Johannes die Szene mit Thomas erzählt:
Dem Mann soll jetzt geholfen werden. Der Messias ist wieder da in der Mitte der Schüler, mit seinem Friedensgruß mitten in den Zeiten von Krieg und Zerstörung. An der Lage der Gemeinde hat sich nichts geändert, ihr Raum bleibt fest verschlossen. Thomas muss sich die Wirklichkeit ertasten. „Wenn ich in seiner Hand die Schlagstelle der Nägel nicht sehe, nicht meine Finger in die Schlagstelle der Nägel stecke (balō), nicht meine Hand in seine Seite stecke, vertraue ich auf gar keinen Fall“, hatte er gesagt. Thomas kann einem Messias nicht vertrauen, der wirklich tot war, ja, ist.
Bei Paulus setzt die Auferstehung den Tod außer Kraft: „Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg?“ (1 Korinther 15,54f.) Das wäre angesichts der trostlosen Lage Israels nach 70 hohler Triumphalismus. Der Tote wurde bei Paulus „in Vergänglichkeit ausgesät, in Unvergänglichkeit erweckt, in Würdelosigkeit ausgesät, in Ehre erweckt“, 1 Korinther 15,42f.
Nach Veerkamp drückt Thomas mit seiner kategorischen Ablehnung eines Vertrauens auf Jesus als den Messias, wenn er nicht seine Wundmale sehen und ertasten kann, eine Skepsis aus, die den Zweifeln der meisten messianischen Juden seiner Zeit entspricht. Wie soll ein gekreuzigter Messias das Leben der kommenden Weltzeit herbeiführen? Was Jesus selbst dem Thomas handgreiflich vor Augen führt, ist die zugleich schmerzliche wie befreiende Einsicht, dass tatsächlich der „aufstehende Messias … bei Johannes kein glorreicher Toter“ ist:
Thomas sagte seinen Mitschülern: Ein vom Tode nach wie vor gezeichneter Messias kann nicht sein, das widerspreche allen messianischen Hoffnungen Israels. Genau dieser Tote mit diesem Tod ist die Hoffnung Israels. Das will dieser Text sagen.
Zurückhaltend bezieht sich Veerkamp auf die Frage, ob Thomas wirklich den geschundenen Körper Jesu angefasst hat. Er meint sogar, dass Jesus ihn nur zu einer behutsamen Berührung aufgefordert hat, da er an Stelle des Wortes balein {stecken} das Wort pherein {nehmen} verwendet:
„Nimm (phere, nicht „stecke“, bale) deinen Finger, hierhin“, fordert Jesus Thomas auf. Er soll es mit der nötigen Behutsamkeit tun. Die Wunden sind richtige Wunden, keine frommen Insignien, keine verheilten Narben.
Das ist zwar richtig, aber in der zweiten Aufforderung: „nimm deine Hand und stecke sie in meine Seite“, greift Jesus nach dem Wort pherein dann doch auch auf das Wort balein zurück und schließt ein handgreiflicheres Ertasten nicht aus.
Zu Recht betont Veerkamp jedoch, dass „nicht berichtet“ wird, „ob Thomas der Aufforderung nachgekommen ist.“ Sein Bekenntnis zum Messias folgt unmittelbar, nachdem Jesus ihm sagt:
„Werde nicht zum Treulosen, sondern zum Getreuen.“ Ein Treuloser war Thomas nie, wohl aber ein Skeptiker, ein in seiner ganzen Skepsis (14,5) vorbehaltlos Solidarischer: „Gehen wir mit ihm, sterben wir mit ihm“ (11,16). Zumindest wollte er solidarisch sein; als die Stunde kam, folgte er dem Messias nicht in den Tod. Der Typus der skeptischen Messianisten war offenbar so verbreitet, dass Johannes ihm drei Auftritte gönnte. Der Skeptiker wurde in der Gemeinde nicht verdammt. Johannes lässt gerade ihn das eigentliche Gemeindebekenntnis zum Messias Jesus aussprechen: „Mein Herr und mein Gott!“ Herr, Kyrios, ist der Titel, den die Herrscher der Weltordnung für sich in Anspruch nahmen. „Gott“ ist die absolute Loyalität, welche die Träger dieser Bezeichnung „Gott“ verlangen. Dominus ac deus ließ sich der flavische Kaiser Domitian (81-96) nennen. Dieses Bekenntnis ist eine Kampfansage an das Reich, keine Vorwegnahme der orthodoxen Christologie.
Den abschließenden Vers 29 dieser Szene interpretiert Veerkamp nicht im Sinne eines Tadels gegenüber denjenigen, deren Vertrauen auf ihren Erfahrungen mit dem Messias Jesus beruhte. Er ist vielmehr an diejenigen gerichtet, denen solche Erfahrungen nicht mehr möglich sind, da der Messias endgültig Abschied genommen hat:
Das letzte Wort Jesu ist zunächst: „Glücklich die, die nicht sahen und vertrauten.“ Diese Worte richten sich über den Kopf des Thomas hinweg an die Generation, die nach den Augenzeugen kommt. Der Augenzeuge war der Verfasser des Evangeliums, 19,35: „Der gesehen hat – nämlich das Blut und das Wasser aus der Brust Jesu – hat es bezeugt … damit auch ihr vertraut.“ Dieser ist „der andere Schüler, der als erster zum Grab gekommen war und sah und vertraute“ 20,8. Es sind die Schüler und Maria aus Magdala. Alle anderen haben nicht gesehen.
Jesu Worte an die Adresse des Thomas bedeutet keine Abqualifizierung derjenigen, die „sahen und vertrauten“. Auch Thomas gehört jetzt zu den Zeugen, die gesehen haben und vertrauten. Jesu Worte gelten der Generation der Messianisten, die nach dem Judäischen Krieg nichts mehr gesehen haben und dennoch vertrauten. Der Tod ist das letzte Wort, weil ohne diesen Tod, diesen Weggang des Messias, nichts mehr weitergehen kann. Der tote, vom Tode aufsteigende (Präsens!) Messias ist dominus ac deus. Genau das ist nicht zu sehen. Dem muss man vertrauen.
In christlichen Ohren klingt der Satz: „Der Tod ist das letzte Wort“ wie eine Verleugnung des Glaubens an die Auferstehung Jesu. Veerkamp hingegen hält das gängige Verständnis der Auferstehung Jesu als einer längst vollzogenen räumlichen Verlagerung seiner Existenz in den Himmel Gottes für fragwürdig, wie vergeistigt man sich diese Existenzform Jesu auch vorstellen mag. Tragfähig und glaubwürdig ist das von Jesus geforderte Vertrauen allein deswegen, weil mit der Vorstellung vom unaufhaltsam zum VATER aufsteigenden Messias zugleich der Empfang der inspirierenden Treue des Gottes Israels verbunden ist, die wir gewöhnlich als „Heiligen Geist“ bezeichnen, die Johannes den Parakleten nennt und die gegen allen Augenschein durch die Praxis der solidarischen Liebe Jesus diese Welt von der versklavenden Weltordnung befreien wird, die auf ihr lastet. Thomas war ja nicht dabei gewesen, als seine Mitschüler diesen Geist in Empfang nehmen durften; vorauszusetzen ist, dass er in der Überwindung seines Zweifels auf seine Weise genau die Belebung und Sendung erfuhr wie die anderen Schüler – und zuvor bereits die Schülerin Maria.
↑ Ein drittes von vielen anderen Zeichen zur Offenbarung der Ehre des Messias Jesus (Johannes 20,30 – 21-25)
[17. Februar 2023] Ausnahmsweise beginne ich die letzte Einleitung zur Auslegung eines Abschnitts im Johannesevangelium mit Hartwig Thyen, da ich seinem Vorschlag folge, den durch 20,30-31 und 21,24-25 umschlossenen Epilog als integralen Bestandteil des Evangeliums zu betrachten. Zwar geht es zu weit (T772), allen Exegeten, die in den Versen 20,30-31 „immer noch den ursprünglichen Schluß des Evangeliums erkennen wollen“, zu unterstellen, dass sie damit „Joh 21 als den sekundären Nachtrag eines epigonalen Redaktors von bescheidenem literarischen Vermögen beurteilen“, aber ich muss feststellen, dass es viele überzeugende Gründe gibt
für die ursprüngliche und unauflösliche Zusammengehörigkeit von Joh 21 mit den vorausgegangenen Kapiteln 1-20 und dafür, daß gerade dieser vermeintliche ,Nachtrag‘ ein unentbehrlicher Schlüssel für die Interpretation unseres Evangeliums ist…
Sein Plädoyer für diese Zusammengehörigkeit beginnt er mit einem Zitat von Dorothy Lee. <1491> Ihr zufolge fungieren (T772f.)
die Verse 20,8-10 „als Vorwegnahme, die auf die Begegnung mit dem auferstandenen Christus in Johannes 21 und die Rolle, die jeder Jünger spielen wird, hinweist“ (s. o. z. St.). Ja mehr noch, alle Texte, die seit 13,23 einen der Jünger Jesu als denjenigen benennen, den Jesus liebte, oder auch nur auf seine Gegenwart anspielen, wie 1,40ff, 18,15ff und 19,35b, blieben ohne 21,20ff schlechthin rätselhaft und hingen ohne diese Klimax förmlich in der Luft. Schon als einer der Jünger Jesu zum ersten Mal mit dem Quasi-Pseudonym der Jünger, den Jesus liebte benannt wird (13,23ff), erscheint er als derjenige, der en tō kolpō {an der Brust} Jesu liegt. Durch diese nicht nur physische Nähe erfährt er als einziger, welcher unter den Mitjüngern es ist, der Jesus an seine Feinde ausliefern sollte. Er gibt dieses Wissen freilich einstweilen noch nicht an seine Mitjünger weiter, sondern behält es für sich, bis er nach der Verherrlichung Jesu die ganze Geschichte vom Leben, Sterben und der Auferstehung seines Herrn erzählen und aufschreiben wird (21,24). So wird er zu dem von seinem Herrn dazu bestimmten Exegeten Jesu, ebenso wie dieser… der einzige und verläßliche Exeget Gottes ist: theon oudeis heōraken pōpote; monogenēs theos ho ōn en ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato {niemand hat Gott jemals gesehen; der einziggeborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat Kunde gebracht} (1,18).
Als weitere Gewährsleute für seine Auffassung verweist Thyen (T773) auf Bauckham, der im Anschluss an Minear <1492>
zunächst die unauflösbare Zusammengehörigkeit von Joh 21 mit dem Rest des Evangeliums aufgewiesen und überzeugend begründet [hat], daß die Einführung des geliebten Jüngers von vorneherein allein dem Zweck dient, ihn dem Leser am Ende seiner Lektüre als den ,idealen Autor‘ und Evangelisten zu präsentieren.
Weiter argumentiert Thyen, dass „ein Johannesevangelium … nach Ausweis seiner handschriftlichen Überlieferung ohne Joh 21 nie öffentlich existiert“ hat und dass es „[w]eder auf der inhaltlichen noch auf der linguistischen und/oder stilistischen Ebene … irgendein verläßliches Indiz für den sekundären Charakter von Joh 21“ gibt.
Aber vermitteln die letzten beiden Verse von Kapitel 20 nicht den Eindruck eines Buchschlusses? In Thyens Augen haben die Verse 30 und 31 eine
Brückenfunktion …, indem sie sowohl das Corpus des Evangeliums, nämlich das Zeugnis für Jesus, den messianischen Gottessohn (Joh 1-20), beschließen (hoti Iēsous estin ho christos ho hyios tou theou {dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes}), zugleich aber auch der Eröffnung seines Epilogs als des Zeugnisses Jesu für dieses Evangelium dienen…
Darum zieht er die Verse 30-31 „zur Verdeutlichung dieser Funktion zu Joh 21“ und folgt damit Overbeck, <1493> der „Joh 20,30-21,25 (!) unter der Überschrift ‚Der Abschluß‘ behandelt und dazu erklärt“ hatte:
„Kap 21 kommt als scheinbarer Nachtrag besser zur Geltung und zur Anerkennung seiner besonderen Bedeutung, als wenn es sich unmittelbar an 20,29 anschlösse. Je weniger streng man aber 20,30f als Schluß des Evangeliums auffaßt, um so weniger braucht man sich dann auch Umstände zu machen, 21,24f richtig zu fassen, d. h. wiederum als Schluß zum ganzen Evangelium, nicht etwa nur zu Kap. 21“.
Das Verhältnis von 20,30-31 und 21,24-25 zueinander betrachtet Thyen unter letztendlicher Berufung auf de la Potterie <1494> noch eingehender (T773f.):
Nach Joh 19,35b ist 20,31 der einzige Fall, in dem der Erzähler seine Zuhörer/Leser in der zweiten Person Pluralis direkt anredet, und damit als Mittler zwischen sie und sein geschriebenes Werk tritt. Wenn auch ohne diese direkte Anrede, jedoch der Sache nach ähnlich und mit der bezeichnenden Wiederaufnahme des Lexems graphein {schreiben}, findet sich diese Reflexion auf das geschriebene Buch dann auch in den beiden Schlußversen von Joh 21,24-25, so daß 20,30f und 21,24f in chiastischem Spiel mit den Motiven ,geschrieben – nicht geschrieben‘ eine kunstvolle Inklusion um Joh 21 bilden. De la Potterie hat mit diesem Spiel, das dem Schema A B B‘ A‘ folgt, zugleich die Kohärenz des gesamten Epilogs von 20,30-21,25 aufgewiesen. A redet von den Zeichen, „die nicht geschrieben sind“ (20,30); B dagegen von denen, „die geschrieben sind“ (20,31); B‘ erklärt: „dies ist der Jünger, … der dieses geschrieben hat“ (21 ,24); und A‘: „wollte man das alles im Einzelnen niederschreiben“, also wiederum „nicht geschrieben“…
Den von Thyen vorgebrachten Argumenten möchte ich noch weitere hinzufügen, auf die ich selber erst aufmerksam geworden bin, als ich mich eingehend mit dem Zahlwort triton {das dritte Mal} in Johannes 21,14 beschäftigt habe. Da Johannes es liebt, viele Bezugnahmen in seinem Evangelium in der Schwebe zu belassen, mag es zwar sein, dass er sich dort vordergründig auch auf die dritte von drei Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Schülern bezieht, aber es spricht viel dafür, dass hintergründig ein erheblich wesentlicherer Bezug besteht.
Denn erstens gab es bisher im Johannesevangelium nur zwei sēmeia {Zeichen}, die als der Anfang der Zeichen (archēn tōn sēmeiōn, 2,11) und als das zweite oder andere Zeichen (deuteron sēmeion, 4,54) ausdrücklich gezählt wurden.
Zweitens wird der wunderbare Fischfang zwar nicht in den Versen 1 und 14 des Kapitels 21 ausdrücklich ein sēmeion genannt, genau dieses Wort wird aber doch unmittelbar davor in 20,30-31 ausdrücklich in betonter Weise aufgegriffen. Das kann leicht übersehen werden, wenn man die letzteren Verse als vermeintlichen Buchschluss betrachtet, der mit dem vermeintlichen Nachtrag in keiner Verbindung zu stehen scheint. Versteht man jedoch diese Verse als Auftakt des Epilogs, dann öffnen sich die Augen für die Einsicht, dass die vielen Zeichen, die Jesus tat und von denen 20,30 spricht, möglicherweise gar nicht oder nur vordergründig auf die vergangenen Werke Jesu zu beziehen sind, sondern stattdessen auf die größeren Werke, die Jesus in der Zukunft des messianischen Wirkens seiner Schülerschaft vollbringen wird und von denen der Epilog im Abschnitt 21,1-14 beispielhaft erzählt.
Drittens bezeichnet sowohl in 2,11 als auch in 21,1.14 das Wort phaneroō {offenbaren, sich zeigen, manifestieren} die öffentliche Herausstellung der Ehre des Messias, in 2,11 und 21,1 sogar mit der exakt gleichen Verbform ephanerōsen {er zeigte sich bzw. seine Ehre öffentlich}. <1495> Dass dieses Wort hingegen in Kapitel 20 in allen drei Erzählungen von der Begegnung Jesu mit Maria und den Schülern nicht verwendet wird, spricht gegen die Annahme, dass sich 21,14 mit dem Zahlwort triton lediglich vordergründig auf eine dritte Erscheinung des auferstandenen Jesus vor den Jüngern bezieht.
Viertens wird sicher nicht zufällig von der ersten Kana-Episode unmittelbar nach dem Auftreten des Nathanael (1,45-51) erzählt, dessen Herkunft aus Kana wiederum erst in 21,2 erwähnt wird.
Ich halte es daher für möglich, dass Johannes (oder der sich kongenial auf ihn beziehende Verfasser des Nachtragskapitels, falls ein solches doch erst mit 21,1 an einen ursprünglichen Schluss in 20,30-31 angeschlossen worden sein sollte) mit dem Wort triton den öffentlichen Auftritt Jesu vor seinen Schülern am See Tiberias bewusst in eine Reihe mit den Zeichen stellt, die beide in Kana stattfanden und einen erzählerischen Rahmen um den Anfangsteil des Evangeliums bildeten, in dem es um das öffentliche Wirken des Messias ging. Dieses öffentliche Wirken wird nach Verborgenheit und Abschied des Messias nun auf neue Weise fortgeführt.
So gesehen weist Johannes 20,30 vorausblickend darauf hin, dass Jesus nicht nur selbst in seiner bisherigen leibhaftigen Wirksamkeit, sondern auch in Zukunft messianische Zeichen zu vollbringen in der Lage ist, und zwar durch das durch ihn angestoßene Wirken seiner Schülerschaft. In poetischer Darstellung zeigt die folgende Erzählung, wie die von Jesus seiner Schülerschaft übergebene Inspiration des Gottes Israels bzw. der von ihm angekündigte Paraklet die auf ihn Vertrauenden zu größeren Werken (5,20; 14,12), als er sie tun konnte, ermutigen und befähigen wird.
Zuvor wird in 20,31 das Ziel der öffentlichen Wirksamkeit Jesu noch einmal knapp umrissen, die durch die beiden gezählten Zeichen zu Kana umrahmt und repräsentiert wurde und die nun meta tauta, also „nach diesem“ allen, das bisher erzählt wurde, mit einem beispielhaften dritten Zeichen fortgeführt wird.
Dass Jesus nach seiner öffentlichen Wirksamkeit in die Verborgenheit abtauchen musste und er den Römern zur Hinrichtung ausgeliefert wurde, weil die führenden Kreise seines Volkes ihn ablehnten, führt also nur vorübergehend zur Isolation seiner Schüler hinter verschlossenen Türen, sondern der zum VATER aufsteigende Messias selbst durchbricht diese Abschottung, indem er, wie in 14,23 angekündigt, sich gemeinsam mit dem VATER bei ihnen „einen Ort von Dauer macht“.
Mit den letzten Erwägungen lehne ich mich eng an Ton Veerkamp <1496> an, der zwar das Kapitel 21 als Nachtrag zum Johannesevangelium betrachtet, aber davon ausgeht, dass es ohne diese Ergänzung keine öffentliche Wirksamkeit hätte entfalten können. Mit den beiden Szenen hinter verschlossenen Türen und dem Schlusswort in Johannes 20,30-31 konnte das
Evangelium als Text der messianischen Bewegung … hier und so nicht enden. Es war zunächst nur die Selbstverständigung einer Gruppe in einem geschlossenen Raum, sozusagen der Text einer geschlossenen Gesellschaft. Erst das 21. Kapitel nach der traditionellen Zählung, das meistens als später eingefügter Anhang bezeichnet wurde und dem wir uns jetzt zuwenden, erzählt, wie die Gruppe um Johannes ihre Isolierung durchbrechen konnte, wie sie zum Teil einer messianischen Bewegung und wie sein Text zu einem messianischen, später zu einem kirchlichen Text wurde. Es hatte es auch so schwer genug, allgemein akzeptiert zu werden, schwerer als die Briefe des Paulus, schwerer als das Matthäusevangelium, das kirchliche Evangelium des zweiten Jahrhunderts und das Gegenstück zu Paulus.
Obwohl Veerkamp also das ursprüngliche Evangelium mit dem Kapitel 20 beendet sieht, hält er das 21. Kapitel nicht für ein
Korollarium {Zugabe}, das der Vollständigkeit wegen „angehängt“ wurde und nichts Wesentliches zur Argumentation beiträgt. Die Frage, wer es wann hinzugefügt haben soll, ist nebensächlich. Sprachlich spricht einiges dafür, dass es von einer anderen, aber doch von „Johannes“ geschulten Hand stammen könnte, sicher ist das aber nicht. Das Evangelium ist nie ohne dieses Kapitel überliefert worden, es ist ein integraler Bestandteil des Evangeliums und macht es sozusagen „katholisch“ – von kath‘ holon: für das Ganze gedacht.
Sinn und Zweck des Kapitels 21 fasst er in seiner Anm. 567 zur Übersetzung von Johannes 21,1 folgendermaßen zusammen:
Das ganze Kapitel hat nur ein Thema: „Simon Petrus“. Diese Gestalt steht für einen bestimmten Typus von Messianismus, der von den drei synoptischen Evangelien vertreten wird, von jedem in seiner eigenen Weise, und sich vom Paulus-Typ unterscheidet. Lukas hat diesen Unterschied dokumentiert und eine Vermittlung zwischen beiden Typen versucht. Nach dem Tod des Simon Petrus hat die ursprünglich völlig isolierte Johannesgruppe (6,67-71; 13-17; 20,19-29) den Anschluss an diesen Messianismus gesucht und gefunden. Die „Söhne Zebedäi“ tauchen im Johannesevangelium nur hier auf. Sie spielen in den synoptischen Evangelien eine wichtige Rolle. Dass sie ausgerechnet hier auftauchen, zeigt, wie die Gruppe den Anschluss an den synoptischen Messianismus gefunden hat. Das Dokument dieses Anschlusses ist dieses Kapitel; es ist gleichzeitig das Dokument des Ausbruches aus der sektenhaften Isolierung. Für Datierungszwecke ist es ungeeignet; erstens wissen wir nicht, wann Simon Petrus getötet wurde; zweitens wissen wir nicht, wann Kap. 21 dem Evangelium hinzugefügt wurde. Jedenfalls dokumentiert dieses Kapitel den Vorgang, wie die Gruppe von einer Sekte zum Teil einer umfassenden Bewegung wurde, ihr Text aber vom Sektenpapier zum Grunddokument einer Bewegung und alsdann zum „kirchlichen“ Dokument. Dass es in der Gruppe um Johannes heftige Diskussionen um die Zukunft der Gruppe gegeben haben muss, dokumentieren die Johannesbriefe. Johannes 21 wurde daher zum integralen Bestandteil dieses Evangeliums, weil dieses Kapitel das Johannesevangelium aus einem Text einer isolierten Sekte zum Grunddokument einer messianischen Bewegung machte.
Klaus Wengst (W573) beginnt seine Auslegung dessen, was er als „Nachtrag“ des Johannesevangeliums bezeichnet, mit einem Zitat von Tholuck: <1497>
„Das Evangelium hatte mit dem Schluß von Kap. 20 seinen sachgemäßen Abschluß. Daß hier ohne Uebergang die Erzählung von vorn anfängt, läßt dieses Kap(itel) als Nachtrag erscheinen.“
Er bestreitet nicht (Anm. 2), „dass Thyens Lektüre eine mögliche ist“, nämlich „Kap. 21 für einen von vornherein geplanten Teil des Evangeliums“ zu halten, „wohl aber, dass sie die einzig mögliche sei“, und fügt hinzu: „Ich hoffe mit meiner Auslegung zu zeigen, dass ich Kap. 21 dieselbe Aufmerksamkeit widme und denselben Respekt entgegenbringe wie dem übrigen Evangelium.“
Das wesentlichste Argument für „den Nachtragscharakter von Kap. 21“ ist ihm zufolge (W573)
die Eigenaussage des Textes, nämlich die Selbstunterscheidung der bzw. des in 21,24f. Sprechenden von dem dort angegebenen Verfasser des Evangeliums. Dass diese Selbstunterscheidung nicht literarisches Mittel ein und desselben Verfassers ist, sondern tatsächlich zutrifft, lässt sich bei der Besprechung des Textes bestätigen. In jedem Fall jedoch ist Kap. 21 – aus welchen Stoffen es immer gebildet sein mag – als eine Einheit konzipiert worden, die sich ihrerseits auf das ganze Evangelium von Kap. 1-20 bezieht.
Zum Inhalt von Kapitel 21 schreibt Wengst, dass es „aus zwei Erzählabschnitten (V. 1-14.15-23), der Angabe des Autors (V. 24) und einer Schlussformulierung (V. 25)“ besteht (W573f.):
Die Erzählabschnitte spielen innerhalb derselben Szenerie: am See von Tiberias eine unbestimmt bleibende Zeit nach dem im Evangelium zuletzt erzählten Ereignis. Durch die kommentierende Bemerkung in V. 14, die Formulierungen aus V. 1 aufnimmt, stellt der Verfasser eine inclusio her und bildet so zwei Szenen. Die erste erzählt von einer weiteren Begegnung Jesu mit mehreren Schülern. Sie erstellt den Rahmen für die zweite und ist zugleich ein Vorspiel zu ihr, insofern in ihr Simon Petrus besonders hervortritt und an einer Stelle auch der Schüler, den Jesus liebte, sich aus den anderen heraushebt. Allein diese beiden Schüler sind in der zweiten Szene im Blick. Sie treten in ihr nacheinander auf. Zuerst redet Jesus mit Simon Petrus; der fragt am Ende des Gesprächs nach dem Schüler, den Jesus liebte. Daraufhin geht es nur noch um diesen.
Die (W574) daran anknüpfende „kommentierende Bemerkung in V. 24“ bezeichnet „diesen Schüler als wahrhaftigen Zeugen und Verfasser des Evangeliums“, worin „der Zielpunkt des ganzen Kapitels“ besteht:
Demgegenüber formuliert dann V. 25 nur noch einen 20,30f. verkürzt variierenden und doch zugleich einen eigenen Akzent setzenden Abschluss für das nun um dieses Kapitel erweiterte Evangelium. Kap. 21 hat also eine Funktion für das Evangelium im Ganzen. Das gilt auch schon für den Prolog (1,1-18) und den Epilog (20,30f.). Dort geht es einmal um eine inhaltlich bestimmte Leseanweisung und zum anderen um eine inhaltlich bestimmte Zielangabe. In Kap. 21 jedoch soll durch die Zuschreibung an den Schüler, den Jesus liebte, der Rang des Evangeliums formal abgesichert werden. Erwägungen über Anlass und Zweck, Ort und Zeit dieser Absicherung sind erst nach der Einzelbesprechung anzustellen.
↑ Johannes 20,30-31: Einige der vielen Zeichen Jesu sind aufgeschrieben, „damit ihr vertraut“
20,30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern,
die nicht geschrieben sind in diesem Buch.
20,31 Diese aber sind geschrieben,
damit ihr glaubt,
dass Jesus der Christus ist,
der Sohn Gottes,
und damit ihr, weil ihr glaubt,
das Leben habt in seinem Namen.
[18. Februar 2023] Nach Klaus Wengst (W569) geben sich die beiden letzten Verse 30 und 31 im 20. Johannes-Kapitel
deutlich als eine abschließende Formulierung zu erkennen. Indem Johannes „dieses Buch“ erwähnt und in direkter Anrede an die es Lesenden und Hörenden das Ziel seines Schreibens angibt, blickt er auf das ganze Werk zurück. Zugleich betont er – und das unterstreicht den Charakter dieser Aussagen als Rückblick -, eine Auswahl aus einem größeren Stoff getroffen zu haben.
Daher muss, wie unter anderem Schnelle <1498> schreibt, diese Notiz „als der ursprüngliche Schluß des Evangeliums angesehen werden“:
Dass es sich bei diesen beiden Punkten – Auswahl aus einem größeren Stoff und Angabe des Zweckes – um eine Konvention für einen möglichen Buchschluss handelt, belegen die folgenden beiden Texte, die jeweils am Ende eines Werkes stehen. Philo, SpecLeg IV 238: „Auch dem Langlebigsten würde die Zeit ausgehen, wenn er alles Löbliche an der Gleichheit und der von ihr hervorgebrachten Gerechtigkeit vollständig durchgehen wollte. Deshalb scheint es mir besser zu sein, sich mit dem Gesagten zu begnügen, um das Denken der Wissbegierigen anzuregen, das sonst noch in ihren Seelen Aufgeschriebene – göttliche Bildsäulen für den heiligsten Raum – wegzulassen.“ Lukian, Demonax 67: „Dieses ganz Wenige aus Vielem habe ich erzählt; und es reicht für die Lesenden, daraus zu schließen, von welcher Art jener Mann war.“
Der Zusammenhang dieses Schlusswortes mit dem Evangelium im Ganzen ist nach Wengst (W570) differenziert zu betrachten:
Als Rückblick auf das gesamte Werk beziehen sich die hier gemachten Aussagen selbstverständlich auf das Schreiben des Evangelisten im Ganzen – und nicht nur auf einzelne Aspekte oder gar nur einen einzigen Aspekt. Das schließt es andererseits nicht aus, dass er besondere Verknüpfungen mit bestimmten Stellen und Passagen seiner Schrift herstellt. So zeigt sich zunächst eine unmittelbare Anknüpfung an den letzten Satz Jesu in V. 29, die Beglückwünschung derer, die vertrauen bzw, glauben ohne „gesehen“ zu haben. Damit waren schon die das Evangelium Lesenden und Hörenden in den Blick gekommen. Sie spricht Johannes nun direkt an, wenn er als Ziel dessen, dass er dieses Evangelium schreibt, ihren Glauben bzw. ihr Vertrauen angibt. Mirjam, die Schüler im Ganzen und schließlich auch Thomas wurden durch die jeweilige Begegnung mit dem auferweckten Jesus, in der sie ihn „gesehen“ haben, dazu gebracht, ihn zu bekennen (20,18.25.28). Jesus pries abschließend diejenigen glücklich, die in dieser Weise nicht mehr „sehen“ und doch glauben bzw. vertrauen. Aber so, wie von ihm in diesen Geschichten erzählt wird – und wie schon im ganzen Evangelium von ihm erzählt wurde -, steht er diesen Späteren beim und durch das Lesen des Evangeliums doch auch vor Augen. Daraufhin sollen sie glauben bzw. vertrauen.
Mit seiner Bemerkung in Vers 30: „Zwar hat Jesus ja noch viele andere Zeichen vor seinen Schülern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben stehen“, erweckt Johannes, wie Blank <1499> meint, „beim Leser den Eindruck einer ,Fülle an Jesus-Überlieferung‘, die er gar nicht hat ausschöpfen können“.
Zusammenfassend benennt der Evangelist das,
was Jesus getan hat, … hier als „Zeichen“. Diesen Begriff hat er zuletzt am Beginn des Rückblicks auf den ersten Teil des Evangeliums (12,37) und zuerst am Schluss der Erzählung von der Hochzeit in Kana (2,11) gebraucht. Damit bezeichnet er die wunderbaren Taten Jesu. Parallel zu ihnen fasst er jetzt die Erscheinungsgeschichten unter den Begriff des Zeichens.
Eine solche Einbeziehung der Ostererscheinungen Jesu in seine zeichenhaften Taten verteidigt Wengst folgendermaßen gegen Tholuck und Wilckens: <1500>
Schon Tholuck hatte dagegen eingewandt, dass das Tun von Zeichen „nicht von Erscheinungen gebraucht seyn“ könne. Aber bei den Erscheinungen, wie Johannes sie beschreibt, ist Jesus durchweg – nicht anders als bei den Wundern – als selbständig handelndes Subjekt vorgestellt. Wilckens bemerkt zwar die Ausweitung des Zeichenbegriffs, schließt daraus aber das unmittelbar vorher Erzählte strikt aus, wobei er sich allerdings unscharf ausdrückt: „Auf die Osterereignisse speziell darf er keineswegs bezogen werden; denn diese sind selbst nicht ,Zeichen‘, sondern vollendete Wirklichkeit der Herrlichkeit Jesu“. Was sind „die Osterereignisse speziell“ und „selbst“? Eine „vollendete Wirklichkeit der Herrlichkeit Jesu“ beschreibt Johannes nicht. Wie bei den Wundern erzählt er Geschichten, in denen Jesus handelt, als wäre das, was er tut, völlig selbstverständlich und „normal“ – und doch merken die Lesenden und Hörenden, dass Wunderbares geschieht.
Auch (W571) „die ausdrückliche Erwähnung … im Buchschluss“, dass Jesus „noch viele andere Zeichen vor seinen Schülern getan hat“, womit „an die erste Erwähnung des Zeichenbegriffs in 2,11 erinnert“ wird, betrachtet Wengst als „Hinweis darauf, dass die Erscheinungsgeschichten zu den Zeichen zu zählen sind“, denn schon der „Anfang seiner Zeichen im galiläischen Kana“ führte zum Glauben an Jesus, der aber „erst im Bekennen des auferweckten Gekreuzigten zum Ziel kommt“.
Für (W570f.) „nicht überraschend“ hält es Wengst, dass Johannes, indem er „unter dem Begriff“ des Zeichens „auf sein ganzes Werk zurückblickt, … ihn auf das in ihm dargestellte Wirken Jesu überhaupt“ ausweitet (W571):
Die Zeichen sind ja Jesu „Werk“ (vgl. nur 9,3.16) und somit integraler Bestandteil des Werkes Gottes, mit dessen Vollzug und Vollendung er beauftragt ist (4,34; 5,36; 17,4), die am Ende seines Weges mit dem Tod am Kreuz erreicht wird (19,28.30). Von daher sind die Motive „sehen“ und „glauben“ sowohl mit den Zeichen verbunden als auch mit Jesus selbst (vgl. nur 6,26.30.36). Die Zeichen verweisen auf ihren Täter, also zunächst auf Jesus. Schon nach Jesu Aktion im Tempel am Beginn seines Wirkens wurden die nach einem Zeichen als Legitimation Fragenden auf Tod und Auferweckung Jesu verwiesen (2,18f.). Auch dieses „Zeichen aller Zeichen“, „das Zeichen des Propheten Jona“, <1501> ist immer noch „Zeichen“, nämlich Hinweis auf den Tote erweckenden Gott.
Dass der nächste Vers 31 sich mit dem Wort tauta auf den vorangehenden Vers bezieht, bei dem in der Schwebe bleibt, ob es sich auf das Wort sēmeia {Zeichen} bezieht oder auf alles in diesem Buch Geschriebene, führt nach Wengst (Anm. 10) zu einer Übersetzungsschwierigkeit:
Die Übersetzung mit „diese“ macht den griechischen Text eindeutiger, als er ist. Es wäre dann „Zeichen“ zu ergänzen. Das ist möglich, aber nicht zwingend. Das griechische Wort taúta kann auch einfach ein zusammenfassendes „Das“ meinen, wie damit etwa in 6,59; 8,30; 14,25 auf größere Redepartien zurückgeblickt wird. Dann wäre zu übersetzen: „Das aber ist geschrieben.“ Der Evangelist hätte den Text durch Zufügung von ta semeía („Zeichen“) leicht eindeutig machen können. Indem er das nicht tut, wird noch klarer erkennbar, dass er den Zeichenbegriff auf seine ganze Darstellung des Weges Jesu ausweitet.
Was will nun (W571f.) „Johannes mit dem Schreiben seines Evangeliums bei seiner Leser- und Hörerschaft erreichen“? Nach Vers 31 dasselbe, was „von den Schülern gilt, dass sie jetzt die ihnen gegebenen „Zeichen“ recht zu deuten verstehen“:
„Diese aber sind geschrieben, damit ihr darauf vertraut, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr im Vertrauen darauf in seinem Namen Leben habt.“ Mit dem, was er geschrieben hat, will Johannes den Glauben, das Vertrauen, seiner Leser- und Hörerschaft stärken. Er schreibt, wie in der Einleitung dargestellt, nicht an Außenstehende, sondern für eine bedrängte Gemeinde, deren Menschen „bleiben“ sollen.
Indem Wengst annimmt (Anm. 12), dass „der Evangelist bereits an Jesus Glaubende voraussetzt“, stützt er sich auf Handschriften, die im ersten hina-{damit-}Satz „das Präsens pisteúete“ haben. Andere Handschriften enthalten den „Aorist pisteúsete“:
Wäre der Aorist ursprünglich und würde er ingressiv {auf den Anfang einer Handlung bezogen} verstanden, wäre das Zum-Glauben-Kommen ausgedrückt. Barrett <1502> fragt, ob das Evangelium geschrieben wurde, „um die Glaubenden zu stärken, oder als Missionstraktat, um die hellenistische Welt zu bekehren“, und bemerkt dazu: „Die Frage wird durch die Tempora aufgeworfen, sie kann aber nicht aufgrund der Tempora gelöst werden“.
Da es Johannes nach Wengst (W571) also um die Selbstvergewisserung des Glaubens an Jesus geht, steht
[d]ementsprechend … bei dem, was geglaubt werden soll, auch an erster Stelle genau der Punkt, der im Evangelium immer wieder von außen in Frage gestellt wird: „dass Jesus der Gesalbte ist“. Wie schon im Bekenntnis der Marta in 11,27 steht neben dem Titel „der Gesalbte“ („der Messias“) der mit ihm zusammengehörige: „der Sohn Gottes“. Johannes kann also am Ende seines Evangeliums die Frage, wer Jesus ist, damit beantworten, dass er ihn als den von Gott beauftragten messianischen König bezeichnet. Dabei klingt auch an, was im Evangelium über Jesus als „den Sohn“ im Verhältnis zum „Vater“ gesagt wurde. Damit ist noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass Jesus seinen Weg, wie er im Evangelium beschrieben ist, ganz und gar als von Gott Beauftragter gegangen ist und dass deshalb eben auf diesem Weg Gott begegnet. In 12,44 hat Jesus gesagt: „Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich geschickt hat.“ Das lesende Durchschreiten des Evangeliums, das im Nachgehen des Weges Jesu Gott begegnet, will zu solchem Glauben, zu solchem Vertrauen führen. Denen, die sich dahin führen lassen, wird in der abschließenden Zielbestimmung Leben verheißen: „[…] und damit ihr im Vertrauen darauf in seinem Namen Leben habt.“ Auch damit ist aufgenommen, was im Evangelium schon oft gesagt ist: Im Vertrauen auf den Tote erweckenden Gott zu leben, ist wirkliches Leben. Es wird vermittelt durch „seinen Namen“, der für die gerade genannte Person steht: Jesus.
An mehreren Stellen vermerkt Wengst dazu in Anmerkungen (13 bis 15), dass „noch einmal ein Bogen“ zu bisherigen Aussagen bis hin zum „Anfang des Evangeliums zurück geschlagen“ wird, so bezüglich „der gegen Jesu Messianität erhobenen Einwände“, zum Messias (4,42), zum „Sohn Gottes“ (1,34) und zu „den an seinen Namen Glaubenden“ (1,12).
Hartwig Thyen (T774) beschäftigt sich zu Vers 30 mit der Frage, worauf sich die Aussage des Erzählers bezieht, „daß Jesus über die in seinem Buch beschriebenen Zeichen hinaus noch viele weitere vor seinen Jüngern getan habe“. Damit muss er Thyen zufolge voraussetzen,
daß seine potentiellen Leser, vermutlich doch wohl aus ihrem Vertrautsein mit den synoptischen Evangelien, um derartige Zeichen wissen. Unter Rückgriff auf diese Wundererzählungen, gelegentlich wohl auch durch deren Kombination, bietet er seinen Lesern jedoch nur eine repräsentative Auswahl aus den zahlreichen Wundertaten Jesu.
Aber worauf bezieht sich der Erzähler, wenn er diese Wundertaten „an diesem Ende wie schon bei ihrer archē {Anfang} im galiläischen Kana sēmeia {Zeichen} nennt (2,11)? Nach Thyen macht es der „Gebrauch des prominenten Lexems sēmeion und der Verweis auf ,dieses Buch‘“ erforderlich,
hier alle im Evangelium erzählten Zeichen Jesu ins Auge zu fassen. Den sieben prädizierten Ich-Bin-Worten Jesu korrespondierend sind das wohl die folgenden sieben Zeichen: (1) Das Weinwunder von Kana als ihre archē; (2) die Rettung des Sohnes des königlichen Beamten (4,46-54); (3) die Heilung des Lahmen (5,1-16); (4) die wunderbare Speisung der Fünftausend (6,1ff), (5) die Heilung des Blindgeborenen (Joh 9); (6) die Erzählung von Tod und Auferweckung des Lazarus (Joh 11); und endlich (7) das im sechsten Zeichen bereits vorabgebildete letzte und größte Zeichen, nämlich die Geschichte von Verhaftung, Verurteilung, Hinrichtung und Auferstehung Jesu (Joh 18-20). Alle diese Zeichen sind längere, oft von Diskursen unterbrochene Erzählungen und nie solche symbolischen Einzelzüge, wie etwa die sechs steinernen Krüge bei der Hochzeit in Kana, der weggeschaffte Stein vor dem Grabe Jesu oder seine geordneten Grabtücher (so Minear).
Gegen diejenigen, die „die Reihe der ,Zeichen‘ … mit dem Lazarus-Wunder als ihrem siebten beendet“ sehen, „wobei man dann Jesu Seewandel (6,16ff) vom Brotwunder abtrennen und ihn als eigenes sēmeion zählen müßte“, wendet sich Thyen mit dem Argument, dass „kein Erzähler seinem Zuhörer zumuten kann, bei der Rede von den in diesem Buch aufgeschriebenen Zeichen über die langen Kapitel 12-20 hinweg an die schon mit dem Lazarus-Wunder abgeschlossene Reihe der Zeichen zu denken“. Dafür, dass „sich die Verse 20,30f auch auf die ihnen unmittelbar vorausgehende Erzählung von Jesu Passion und Auferstehung als sēmeion beziehen“ müssen, spricht nach Minear [90] schließlich noch
die Zeichenforderung der Ioidaioi in 2,18 … Auf diese Forderung eines seine Tempelreinigung beglaubigenden Zeichens hatte Jesus geantwortet: „Brecht diesen Tempel nur ab, ich werden ihn binnen dreier Tage wieder aufrichten“. Und dazu hatte der Erzähler bemerkt: „Das sagte er aber im Blick auf den Tempel seines Leibes“, und hinzugefügt, daß die Jünger das erst im Lichte des Sterbens und Auferstehens Jesu begreifen sollten (2,18-22).
Nach Vers 31 hat der Erzähler (T775) die
genannten ausgewählten Zeichen … in seinem Evangelium aufgeschrieben, damit seine Leser zum Glauben kommen (pisteusēte) – oder: an dem Glauben festhalten und in ihm bleiben (pisteuēte) -, daß Jesus der Messias und Gottessohn ist, und in solchem Glauben das ewige Leben bewahren.
In Abwägung der Argumente von Carson und Riesenfeld <1503> wendet sich Thyen gegen Carsons Auffassung, dass das Johannesevangelium als „primär evangelistisch“ zu beurteilen ist, sondern spricht sich mit Riesenfeld „für die Ursprünglichkeit der präsentischen Lesart“ und dafür aus, „daß unser Evangelium dazu geschrieben wurde, wankende Glaubende (und wer wäre das nicht?) dazu zu ermutigen, am Glauben festzuhalten und in ihm zu bleiben; nicht aber dazu, Außenseiter zum Glauben zu bewegen“. Gegen Carsons Einwand, „daß Riesenfelds Beispiele für den Gebrauch von hina {damit} mit nachfolgendem Konjunktiv Präsens zumeist dem 1Joh entstammten, der als ein Brief an Christen natürlich deren innergemeindliche Probleme thematisiere und insofern gewiß keine ,evangelistischen‘ Interessen verfolge“, verweist Thyen auf „die prominente Rolle, die das Lexem menein {bleiben} im gesamten Corpus Iohanneum spielt“, auf „die gewichtige, an die Jünger und zugleich alle späteren Leser gerichtete Frage: ,Wollt ihr etwa auch weggehen?‘ (Joh 6,67; vgl. 1Joh 2,18ff), sowie das Spiel mit der jüdischen Bibel und den synoptischen Prätexten“. All das zeigt nach Thyen
unübersehbar, daß das Evangelium – ebenso wie der weithin darauf beruhende und es auslegende erste Johannesbrief – sich primär an eine von Zweifeln und Apostasie bedrohte Christenheit richtet. Auch wenn das Evangelium in der Hand derer, die Jesus als seine Brüder in die Welt sendet, sekundär eine quasievangelistische Rolle spielen mag, ist es jedoch primär keinesfalls ein missionarischer Traktat.
Wieder einmal ist hier jedoch an Thyen die Frage zu richten, ob nicht die hier ausgespannte Alternative zu kurz greift. Wenn die ursprünglichen Adressaten des Johannesevangeliums eben noch keine vom Judentum unterschiedene „Christenheit“ darstellen, sondern jüdische Messianisten sind, dann mag seine Schrift sowohl der Selbstvergewisserung dieser Gruppierung dienen, der die Nachfolger weglaufen und die sich hinter verschlossenen Türen verschanzt, als auch dem Aufruf an bisher Außenstehende, sich auf das Vertrauen zu Jesus als dem Messias Israels einzulassen.
Zurück zu Thyens Auseinandersetzung mit Carson, dessen „Hauptargument für seine These“ darin besteht, dass er in dem hoti-Satz: hoti Iēsous estin ho christos ho hyios tou theou {damit ihr zum Glauben kommt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes} … die Prädikation Jesu als des messianischen Gottessohnes als das Subjekt und den Jesusnamen als Prädikatsnomen“ ansieht:
Dann müßten die hier zum Glauben Gerufenen (hina pisteu[s]ete) solche sein, die in der messianischen Erwartung Israels zu Hause und mit der jüdischen Bibel vertraut sind, und ihnen sagte der Autor: Ihr braucht nicht länger zu warten, denn der Erwartete ist längst gekommen, er ist Jesus, dessen Geschichte ich euch hier erzählt habe.
Thyen dagegen sieht darin
eine unzulässige Vertauschung von Subjekt und Prädikat. Denn im gesamten Evangelium ist der Jude Jesus aus dem unbedeutenden Nazaret, dessen Vater und Mutter man kennt, das einzige Subjekt, und Messias, Gottessohn, Gott, Logos, Licht, Brot des Lebens, Weg, Wahrheit und Leben, Auferstehung, guter Hirte, wahrer Weinstock etc. sind seine Prädikate.
Ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit dieser Argumentation von Thyen gehabt und verspüre diese auch hier, vor allem, wenn er daraus folgert (T776), dass „die Christenheit zur Zeit der Abfassung des Evangeliums samt allen ihr folgenden Generationen als die intendierte Leserschaft des Evangeliums“ anzusehen ist. So Recht Thyen damit hat, dass der unbekannte Jude Jesus „das einzige Subjekt“ des Johannesevangeliums ist, so unbestreitbar ist es doch auch in seinen Augen, dass der hier schreibende Evangelist und seine unmittelbaren Adressaten „in der messianischen Erwartung Israels zu Hause und mit der jüdischen Bibel vertraut sind“. Und mit dem unbekannten Jesus werden doch nicht, wie auch Thyen immer wieder versichert, völlig neue Prädikate verbunden, um Gott als den Vater Jesu neu zu definieren, sondern der Jesus sendende Gott ist der bekannte Gott Israels. Was Thyen hier als die „Prädikate“ Jesu bezeichnet, durfte doch im gesamten Johannesevangelium nicht anders ausgelegt werden, als dass Prädikate, die den befreienden NAMEN des Gottes Israels kennzeichnen, auf Jesus als die Verkörperung dieses NAMENS bezogen werden.
Abschließend wendet sich Thyen nochmals dagegen, „die Frage nach Geschichte und Geschick einer vermeintlichen johanneischen Gemeinde … zum Schlüssel der Johannes-Interpretation“ zu machen, wie es vor allem Meeks, Martyn und Brown <1504> getan haben:
Diese johanneische Gemeinde (bzw. diese Gruppe von Gemeinden) soll … eine nur Insidern verständliche Sondersprache gepflegt haben und, isoliert vom Rest des Urchristentums, als eine Art Sekte existiert haben. Anstelle des Evangelisten erklärt Meeks, der damit aber wohl auch für Martyn, Brown und viele andere spricht, diese Gemeinde gar zum eigentlichen Autor der Evangeliums, das er dementsprechend nicht als literarisches Werk liest, sondern nur als ,Produkt‘ begreifen kann: „Dennoch ist es überdeutlich geworden, dass die johanneische Literatur das Produkt nicht eines einzelnen Genies ist, sondern einer Gemeinschaft oder einer Gruppe von Gemeinschaften, die offensichtlich über eine beträchtliche Zeitspanne hinweg eine einheitliche Identität besaßen“.
Gegen Malina, <1505> der im Anschluss „an die eben genannten Autoren … das JohEv wegen seines signifikant geringen Wortschatzes als das Zeugnis einer ‚überlexikalisierten‘ und durch das dichte Netz seiner Metaphorik ‚re-lexikalisierten‘ Sprache“ beschreibt, „die nur ,Insidern‘ verständlich sei“, ist nach Thyen das Johannesevangelium
im Gegenteil unter allen neutestamentlichen Schriften wohl diejenige, die gerade Außenstehende am besten in die christliche Tradition einzuführen vermag. Denn Johannes benutzt nicht die vermeintlich vorhandene metaphorische Sondersprache eines esoterischen Konventikels, sondern er verwendet im Gegenteil große Mühe darauf, seine gesamte Metaphorik vor den Augen seiner Leser erst eigens aus deren Alltagssprache zu erschaffen…
Dazu hat Dokka <1506> Thyen zufolge unter anderem ausgeführt (T777):
„Während Johannes den Außenseitern seine Sprache beibringt, entzieht er ihnen [d. h. den Insidern] die metaphorische Kompetenz und verwirrt sie, indem er immer wieder die normale ‚äußere‘ Bedeutung seiner Worte herbeischafft“. Die stärkste Instanz solcher „Insider-verwirrenden Entmetaphorisierung“ sieht Dokka in Jesu Dialog mit Martha (Joh 11,20ff). In allen übrigen Zeichenerzählungen wird nämlich die metaphorische Bedeutung dieser physischen Zeichen erst durch einen Diskurs erschlossen, der sich an die Erzählung anschließt. Und: „Diese Reihenfolge wird im Allgemeinen als ein wesentliches Merkmal der johanneischen Theologie angesehen, insbesondere in Bezug auf die semeia. Nach allgemeiner Auffassung hält Johannes einen Glauben, der sich auf Zeichen – oder auf irgendetwas Sichtbares und Irdisches – stützt, für minderwertig oder ganz und gar verfehlt. Zeichen sind bestenfalls eine Art Pädagogik, die erste Stufe, um angehende Gläubige von dieser Welt auf die Höhe der geistigen Wahrheit zu heben“. Hier dagegen legt Martha ihr scheinbar vollgültiges Bekenntnis zu Jesus als die Auferstehung und das Leben (11,27) bereits ab, noch ehe Jesus das Zeichen überhaupt vollbracht hat. Und zudem muß Jesus die vermeintlich spirituell initiierte Martha gegen deren Protest (11,39f) kurz darauf förmlich dazu zwingen, ihre Sinne auf das Grab und seinen Verwesungsgeruch zu richten. Dabei wird die brutale Physikalität betont. Und als Jesus Lazarus dann aus dem Grabe ruft, geschieht das ohne jegliche Metaphorisierung des Vorgangs und die Erzählung endet mit der trivialen Aufforderung: ‚Löst ihm die Fesseln und laßt ihn gehen!‘: „Dies hebt das Metaphorische oder Spirituelle nicht auf. Aber die Reihenfolge der Ereignisse in der Geschichte bleibt ein fast brutales Korrektiv für eine Spiritualität, die von der gewöhnlichen Körperlichkeit der Menschen getrennt ist. In gewissem Sinne ist es Maria mit ihrem körperlichen Ausdruck von Emotionen, die die Szene für sich gewinnt – nicht über die metaphorische Bedeutung der Auferstehung, sondern über die esoterische Abgehobenheit, die sie scheinbar erlangen könnte“.
Das heißt, Thyen interpretiert mit Dokka Marthas Haltung als „weltlose … Spiritualität“, die durch „den johanneischen Jesus“ korrigiert wird. Insofern hat nach Dokka
Joh 11 erschließende Kraft für alle übrigen Zeichenerzählungen unseres Evangeliums, weil „die kognitive Bewegung keine einseitige spirituelle Metaphorisierung ist. Man braucht sich nicht lange mit ihnen abzumühen oder mit ihnen zu spielen, bevor man ihre doppelte Wirkung erkennt, nämlich himmlische Metaphern aus dem normalen menschlichen Leben zu schaffen – und das normale menschliche Leben aus den himmlischen Metaphern neu zu erschaffen“. Zusammenfassend kann darum gesagt werden: Hätte eine dem modernen Konstrukt entsprechende, vom Rest des Urchristentums isolierte esoterische ,johanneische Gemeinde‘ real überhaupt je existiert, und hätte sich diese Gemeinde dann tatsächlich zu einer ,Sekte‘ im soziologischen Sinn des Wortes entwickelt, dann könnte man dazu nur mit Dokkas Worten erklären: „Wenn dem so wäre, stünde dies jedoch nach meiner Auslegung im Widerspruch zum Johannesevangelium … [das] beträchtlichen Widerstand gegen [diese] Art von sektiererischer Diagnose leistet … und darüber hinaus auch gegen ihren schattenhaften Zwilling, das exegetische Sektierertum, das sie impliziert“.
Auch zu dieser von Thyen so ausführlich belegten Auseinandersetzung Dokkas mit denjenigen, die das Johannesevangelium für die esoterische Schrift einer spirituell abgehobenen Sekte halten, muss ich die Frage stellen, ob die von den Kontrahenten vorausgesetzten Grundannahmen überhaupt zutreffen. Geht es in Marthas Bekenntnis tatsächlich um eine „weltlose … Spiritualität“, sondern nicht vielmehr, wie ich unter Berufung auf Veerkamp zur Auslegung von Johannes 11,25-27 hervorgehoben habe, um die Frage, wie „den konkreten Erfahrungen der messianischen Gemeinde im und nach dem Judäischen Krieg“ standgehalten werden kann, ohne „die Befreiung Israels“ aus den Augen zu verlieren? Dass die johanneische Gruppe sektiererische Züge aufweist und bis in die Thomas-Erzählung hinein aus der Isolation hinter verschlossenen Türen nicht herausfindet, kann jedenfalls nach Veerkamp auch mit ihrer radikalen befreiungstheologischen Position zusammenhängen und muss nicht in spiritueller Abgehobenheit begründet sein.
Verglichen mit der Ausführlichkeit der Auslegungen von Wengst und Thyen zu den Versen Johannes 20,30-31 beschränkt sich Ton Veerkamp <1507> auf einen einzigen Absatz, in dem er auf das Ziel eingeht, das Johannes mit der Darstellung sechs beispielhafter Zeichen in seinem Evangelium verfolgt hat. Das Vertrauen auf den Messias Jesus, um das es im vorigen Vers 29 gegangen war,
geschieht auf der Basis des Zeugnisses der Augenzeugen. An diese letzten Worte schließt sich die ursprüngliche Schlussbemerkung des Evangeliums an. Johannes schreibt, welchen Zweck er mit seinem Text verfolgte. Er wollte einen Teil der Zeichen Jesu beschreiben, die dieser vor seinen Schülern getan hat. Viele sind nicht in sein Buch aufgenommen. Er hat also eine Auswahl vorgenommen: das Zeichen der messianischen Hochzeit in Kana, Galiläa, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kana, Galiläa, die Heilung des Gelähmten in Jerusalem, die Ernährung der Fünftausend, die Heilung des Blindgeborenen, ebenfalls in Jerusalem, und die Belebung des Lazarus in Bethanien. Das zeigt, dass Johannes eine Reihe von anderen Überlieferungen kannte, aber diese sechs paradigmatischen Zeichen sind mit dem Ziel des Vertrauens aufgeschrieben worden, dass Jesus der Messias, der wie Gott, ist. Dieses Vertrauen hat ein Ziel: Die, die nicht sehen, aber dennoch vertrauen, erhalten das Leben der kommenden Weltzeit „mit seinem Namen“.
Dass sich dieses „Leben“ auf die Zukunft Israels inmitten der Völker auf dieser Erde unter dem Himmel Gottes bezieht, die im Vertrauen auf den befreienden NAMEN und in der Praxis der agapē als einer solidarischen Liebe tätig erwartet werden kann, setzt Veerkamp hier voraus, ohne es noch einmal zu wiederholen.
↑ Johannes 21,1-2: Jesus lässt sich am See von Tiberias öffentlich vor sieben seiner Schüler sehen
21,1 Danach offenbarte sich Jesus abermals
den Jüngern am See von Tiberias.
Er offenbarte sich aber so:
21,2 Es waren beieinander
Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird,
und Nathanael aus Kana in Galiläa
und die Söhne des Zebedäus
und zwei andere seiner Jünger.
[19. Februar 2023] Die Szene Johannes 21,1-14 wird nach Klaus Wengst (W574) vom „Verfasser des Nachtrags“ durch die „Feststellung“ umschlossen,
dass sich Jesus seinen Schülern „wiederum“ bzw. zum „dritten Mal“ zeigte. Innerhalb dieses Rahmens erzählt er eine Begegnung mit eigenartigen Handlungsgängen.
Darin sieht Wengst aber keinen Anlass (W575),
die einzelnen Teile unterschiedlichen Traditionen, einem „Erscheinungsbericht“ und einem „Fischfangbericht“, sowie der Redaktion zuzuweisen und damit den Text zu „erklären“. Demgegenüber gilt es auch hier, den vorliegenden Text – wie immer er entstanden sein mag – in seinem Zusammenhang zu verstehen. Obwohl die Rahmung sagt, dass sich Jesus „zeigt“ bzw. „offenbart“, steht hier – anders als in den Erscheinungsgeschichten von Kap. 20 – überhaupt nicht im Mittelpunkt, dass sich Jesus, der gekreuzigte Jesus, als Auferweckter erweist. Er ist in einer fast selbstverständlichen Weise einfach da, indem er gebietet und es auf sein Wort hin Gelingen gibt, indem er für die Seinen sorgt und als Gastgeber beim Mahl fungiert. Das geschieht eher nebenbei. Für den Zusammenhang des ganzen Kapitels ist es wichtiger, dass an einer Stelle kurz der Schüler, den Jesus liebte, auftritt, indem er als erster erkennt: „Es ist der Herr“ (V. 7), und dass Simon Petrus symbolisch schon das tut (V. 11), wozu er dann beauftragt werden wird.
Mit dem „zeitlich unbestimmt“ beginnenden Vers 1: „Danach zeigte sich Jesus wiederum seinen Schülern am Meer von Tiberias. Er zeigte sich aber so“, knüpft der Verfasser Wengst zufolge an
die in Kap. 20 erzählten Erscheinungsgeschichten an, verändert aber den Ort. „Das Meer von Tiberias“ war nach 6,1 Schauplatz des Brotwunders. Motive aus dieser Erzählung klingen auch hier an. Der Ortswechsel der Schüler von Jerusalem in den Norden ist vorausgesetzt; er wird nicht erzählt. Kann für die Zeit des Nachtrags bei der Leser- und Hörerschaft Kenntnis der anderen Evangelien angenommen werden, liegt für sie der Bericht von einer Erscheinung des auferweckten Jesus in Galiläa im Erwartungshorizont. Nach Mt 28,7.10 und Mk 16,7 sollen die Schüler nach Galiläa gehen, in Mt 28,16-20 wird eine dort erfolgende Erscheinung erzählt.
Indem der Verfasser in Vers 2 vor „Beginn der Erzählung … die anwesenden Schüler“ nennt: „Es waren zusammen Simon Petrus, Thomas, ,Zwilling‘ genannt, Natanael aus dem galiläischen Kana, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Schülern“, hebt der Verfasser zunächst drei Schüler namentlich hervor, die„aus dem Evangelium“ bekannt sind, mit denen „das ganze Evangelium überspannt“ ist“, in denen „die in ihm erzählte Geschichte präsent“ ist:
Simon Petrus trat im Evangelium relativ oft auf. Aber es war auffällig, dass er dort in die Gemeinschaft der Schüler eingeordnet wurde und dass der Schüler, den Jesus liebte, ihm übergeordnet erschien. Das wird nun nicht mehr der Fall sein. Thomas stand gerade in der letzten Erzählung des Evangeliums im Mittelpunkt (20,24-29) und ergriff davor in 11,16 und 14,5 das Wort. Mit Natanael wird an den Anfang des Evangeliums erinnert; er kam als letzter der in der ersten Woche gewonnenen Schüler zu Jesus (1,45-51). Dass er aus Kana stamme, wird hier mitgeteilt. Es könnte aus der Folge der Abschnitte über Natanael und die Hochzeit in Kana erschlossen sein. Diese drei mit Namen genannten Schüler sind diejenigen, die am Anfang und am Ende des Evangeliums und mittendrin ein ausdrückliches Bekenntnis gegenüber Jesus aussprachen (1,49; 6,69; 20,28).
Dass als weitere Schüler „die des Zebedäus“ angeführt werden, die „vorher an keiner einzigen Stelle“ vorkamen, aber „bei der Leser- und Hörerschaft als bekannt vorausgesetzt“ werden und mit denen „nur das Brüderpaar Jakobus und Johannes gemeint sein“ kann, „das in den synoptischen Evangelien öfter auftritt“, spricht in den Augen von Wengst (Anm. 4)
für den Nachtragscharakter dieses Kapitels. Jakobus und Johannes als Söhne des Zebedäus treten neben Simon Petrus auch in der Erzählung vom wunderbaren Fischfang in Lk 5,1-11 auf, die zu Joh 21,2-13 einige parallele Züge aufweist. Aber der Versuch, das Verhältnis zwischen beiden Stellen zu klären, kann immer nur zu einem solchen Ergebnis führen, dass es sich auch ganz anders verhalten mag.
Indem weiterhin „zwei andere von seinen Schülern“ ohne Namensnennung angeführt werden, können sie nach Wengst „die Rolle von ‚Platzhaltern‘ für den Schüler, den Jesus liebte, wahrnehmen, der schon in dieser Szene kurz auftreten wird.“ Wenn die damit erreichte „Zahl 7“ der genannten Personen „sich nicht zufällig ergibt, sondern bewusst gewollt ist, bringt sie als Zahl der Vollständigkeit und Vollkommenheit zum Ausdruck“, dass „[d]iese Jüngerschar … die künftige Gemeinde“ repräsentiert“, wie Schnackenburg <1508> meint.
Auch Hartwig Thyen (T777) weist darauf hin, dass der „Epilog“ des Johannesevangeliums bereits am Anfang (Vers 7) „in der Erzählung von dem wunderbaren österlichen Fischzug der Jünger“ auf „das Gegenüber von Petrus und dem ‚Jünger, den Jesus liebte‘“ anspielt und am Ende auf die „Gegenüberstellung dieser beiden Jünger“ in den Versen 20-25 hinausläuft. Und auch er meint, ähnlich wie Wengst (777f.):
Durch das auf die Kapitel 1-20 zurückblickende meta tauta {danach}, den Ortswechsel von Jerusalem nach Galiläa, der zugleich einen Wechsel der Zeit impliziert, in V. 1 sowie durch das Resümee der Fischfang-Erzählung in V. 14 bildet diese eine in sich geschlossene Einheit und fungiert zugleich als Exposition für die beiden ihr folgenden Szenen.
Als völlig abwegig schätzt Thyen in diesem Zusammenhang (T778) die Auffassung von Jürgen Becker <1509> ein, dass in dieser Szene „einfach eine weitere und … zudem an ihrer Stelle gänzlich deplazierte ,Ostererzählung‘“ zu sehen sei:
Becker hält die Erzählung nämlich deshalb für an ihrer Stelle unpassend, weil er sie im Bann der älteren Formgeschichte als eine ,Wiedererkennungslegende‘ bestimmt, und in ihr darum den Bericht von einer ersten Erscheinung des Auferstandenen nach seinem Begräbnis sieht. Darum muß er sie nach den Erzählungen von Joh 20 natürlich für deplaziert halten! Aber deplaziert ist hier jene ältere Formgeschichte, die offensichtlich nicht dazu taugt, literarische Werke angemessen zu interpretieren.
Demgegenüber hält Thyen es für „gewiß absichtsvoll“, wenn „diese österliche Erzählung den Leser nun an den See von Tiberias in Galiläa versetzt“ und ihn damit „an die wunderbare Speisung der Fünftausend an jenem See in Joh 6 erinnern“ will:
Das, samt der Einführung des erneuten Gegenübers von Petrus und dem geliebten Jünger, dürfte das primäre Interesse des Erzählers sein, der Petrus nach dessen dreifacher Verleugnung am Kohlenfeuer (anthrakia wie 21,9) in der Aula des Hannas (18,18) damit an den Ort seines einstigen Bekenntnisses zurückführt und damit die folgende Szene der liebevollen Restitution des Verleugners durch seinen Herrn (21,15-19) einleitet.
Ebenfalls „für völlig abwegig“ hält es Thyen,
dem Evangelisten zu unterstellen, durch diese galiläische Ostererzählung wolle er einen Ausgleich bewirken zwischenden vermeintlich rivalisierenden Ostertraditionen Jerusalems und Galiläas. Denn einmal sehen wir in der sogenannten ,Jüngerflucht nach Galiläa‘ mit von Campenhausen eine „Legende der Kritik“. <1510> Und zum anderen dürfte Galiläa, wie schon für Markus, so auch für Johannes der Ort des Glaubens und seiner Bewährung im Alltag sein. Mit der Verheißung des Engels, Jesus werde den Seinen nach Galiläa vorangehen: „Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat“ (Mk 16,7), werden nämlich nicht irgendwelche galiläischen Ostererscheinungen angekündigt, die Markus, ebenso wie nach ihm Lukas, ja auch gar nicht zu kennen scheint, sondern da werden die Leser mit den Jüngern zur Relektüre des Evangeliums in ihrem weltlichen Alltag aufgerufen. Nach Mk 16,8 hat wohl erst Matthäus ein Sehen des Auferstandenen in Galiläa vermißt und darum die Erzählung von der Versammlung der Jünger auf jenem galiläischen Berg geschaffen, auf dem Jesus ihnen einst seine ,Bergpredigt‘ gehalten hatte. An sie erinnert der Evangelist mit den Jüngern seine Leser mit Jesu abschiedlichem Wort: „und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe!“
Keinesfalls kann nach Thyen „unsere Erzählung vom wunderbaren Fischzug … so verstanden werden, als hätten die Jünger nun ihren alten Fischerberuf wieder aufgenommen.“ Das schließt er kategorisch aus (T778f.), nachdem
der Auferstandene seine Jünger durch den Hauch seines Mundes neu geschaffen und sie mit dem Geist der Wahrheit begabt hatte (20,22; vgl. Gen 2,7), und nachdem er sie mit der ,Schlüsselgewalt‘ ausgestattet hatte, Sünden zu vergeben oder sie zu behalten und sie endlich mit den Worten: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ zum Vollbringen ihrer ,größeren Werke‘ (14,12) in die Welt gesandt hatte (20,21f)… Auf der Ebene der unüberhörbaren symbolischen Obertöne unserer Erzählung kann darum der vergebliche nächtliche Fischzug der Jünger nichts anderes als dies bedeuten, daß sie sich jetzt erstmals auf dem Feld ihres neuen Berufs als ,Menschenfischer‘ versuchen (Lk 5,10). Doch auf sich allein gestellt müssen sie bei diesem Versuch ihr Scheitern und die Wahrheit von Jesu Wort erfahren: „Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ (15,5). Erst als sie auf die Weisung des Unerkannten am Ufer hin den reichen Fischzug tun und der geliebte Jünger, der sich – wie 20,8 ja bereits gezeigt hat – auf die Lektüre der Zeichen seines Herrn versteht, zu Petrus sagte: „Es ist der Herr!“, bekleidet der sich rasch mit seinem Obergewand – denn er war nackt (vgl. Gen 3,7) – und wirft sich, seinem Herrn entgegen, in den See (21,7).
Da es sich nach Thyen (T779) „als äußerst fruchtbar erwiesen“ hat, „Johannes in ständiger Korrespondenz mit seinen synoptischen Prätexten zu sehen“, wird man ihm zufolge
auch unsere Erzählung vom wunderbaren Fischzug auf dem galiläischen See von Tiberias als eine Art von Palimpsest {antikes oder mittelalterliches Schriftstück, von dem der ursprüngliche Text abgeschabt oder abgewaschen und das danach neu beschriftet wurde} über Lk 5,1-11 und 24 lesen müssen. <1511> Vielleicht darf man deshalb auch den ungewöhnlichen ,Wasserweg‘, auf dem sich Petrus zu seinem Herrn begibt, als die nun glücklich-gelingende Wiederholung seines einst vergeblichen Versuches dazu ansehen (Mt 14,28-31…). Mit Neirynck sehen wir in Lk 5,1ff die einzig überlieferte und überprüfbare ,Quelle‘ – oder vielleicht besser: das einzig überlieferte Modell -, nach dessen Gestalt Johannes unsere Erzählung geschaffen hat.
Auf Thyens Auseinandersetzung mit anderen Vorschlägen zur vermeintlichen Entstehung unserer Erzählung gehe ich nicht weiter ein, da er selbst „solches Bemühen“ letzten Endes als „ein unnützes Gedankenspiel“ einschätzt,
weil uns auch die vollkommenste Aufklärung des Gewordenseins unseres Evangeliums dem Verstehen der Bedeutung des so Gewordenen um keinen Schritt näher brachte. Denn auch von dem geschriebenen Evangelium muß all seinen möglichen Traditionen gegenüber gelten, daß sie in ihm aufgehoben und zu etwas unvorhersehbar Neuem geworden sind.
Kommen wir nun zu Thyens Einzelauslegung der beiden ersten Verse von Kapitel 21. Zunächst weist er darauf hin, dass sich nach 20,30f. in Vers 1 „das unseren Epilog eröffnende meta tauta {danach} auf das gesamte ihm vorausgehende Evangelium beziehen“ muss.
Wie ist das Wort phaneroō {offenbaren, sich zeigen} zu übersetzen und zu begreifen (T779f.), „das im Neuen Testament 49mal vorkommt“? Es ist nach Thyen (T780)
kein gebräuchlicher Terminus für Erscheinungen des Auferstandenen. Abgesehen von seinen drei Vorkommen in den V. 1 u. 14 unser Erzählung, wo es, durch das palin {wieder, dagegen, zurück, vielmehr} noch verstärkt, zumindest zurückweist auf die Erscheinungen vor den Jüngern (20,19-23) und vor diesen und Thomas (20,24-29), findet es sich im Neuen Testament – wohl unter dem Einfluß von Joh 21 – nur noch zweimal im sekundären Markusschluß (Mk 16,12 u. 14). lm Corpus Iohanneum erscheint das Verb 18mal, und zwar je 9mal im Evangelium und im ersten Brief (Ev.: 1,31; 2,11; 3,21; 7,4; 9,3; 17,6 sowie zweimal in 21,1 u. 21,14; – 1Joh: 1,2 [2x], 2.19. 28. 3,2 [2x]; 3,5. 8; 4,9). Abgesehen von unserer Passage wird es in keinem dieser Fälle speziell zur Bezeichnung einer Ostererscheinung gebraucht. Wir fragen uns indes, ob das nicht auch für die drei Vorkommen in unserer Erzählung gilt, die mit dem Lexem palin und V. 14: touto ēdē triton ephanerōthē Iēsous tois mathētais egertheis ek nekrōn {Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war}, zwar deutlich auf die vorangegangenen österlichen Erscheinungen zurückweisen, aber doch wohl mehr und anderes als diese bedeuten wollen. Lindars <1512> weist zu Recht auf die Nähe zwischen 21,14 und Joh 2,11 hin, wo es heißt: kai ephanerōsen tēn doxan autou, kai episteusan eis auton hoi mathētai autou {und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn}.
Sodann wiederholt Thyen nochmals, dass
Johannes – anders als Lukas – von einem erneuten, vierzig Tage währenden, irdischen Wirken des auferstandenen Jesus (di‘ hēmerōn tesserakonta: Act 1,3) und seiner erst danach erfolgenden Himmelfahrt nichts wissen will… Bei allen, die von und mit Maria Magdalena das Loslassen des irdischen Jesus lernen, will er vielmehr als der zum Vater Erhöhte alle Tage bis an der Welt Ende bleiben und sich ihnen zeigen. Seine österliche Erscheinung vor seinen Jüngern (20,19-23) darf nicht historisiert, zu einem Stück der toten Vergangenheit und zum Privileg damaliger Augenzeugen gemacht werden. Mit ihr hat er vielmehr die Zeit seiner bleibenden Gegenwart eröffnet. <1513 In der sonntäglichen Begegnung mit Thomas hat er sie erneut bestätigt, und mit dem meta tauta {danach} von 21,1 erfüllt sich seine Verheißung, daß die Seinen fortan nicht als Waisen in der Welt zurückbleiben sollen, sondern daß er zu ihnen kommt (14,18) und sich ihnen zeigt (emphanizō: 14,21), ja, daß er zusammen mit seinem Vater zu ihnen kommt und bleibend bei ihnen wohnen will (14,23).
Die Benennung des von Lukas so bezeichneten „Sees Gennezaret“, bei Matthäus und Markus „See von Galiläa {wörtlich: Meer von Galiläa}“, durch Johannes „mit dem zu seiner Zeit wohl offiziellen Namen als den See von Tiberias“ führt Thyen wie bereits in seiner Auslegung von Johannes 6,1 nicht auf eine spätere redaktionelle Einfügung zurück.
Weiter argumentiert er (T781) zum „Gebrauch der Präposition epi mit dem Genitiv, wie hier und in 6,16.19.21 epi tēs thalassēs (auf oder an dem See)“, dass er
bei Johannes relativ selten [ist]. Er ist jedoch gut griechisch, und es besteht kein Grund, des Vers darum einem Redaktor zuzuschreiben. Gerade wegen seiner Ambivalenz dürfte epi mit dem Genitiv hier absichtsvoll gewählt sein, denn mit dem Zeichen des wunderbaren Eischzugs offenbart sich Jesus seinen Jüngern ja zunächst auf dem See (vgl. 21,7!) und danach bei dem geheimnisvollen Frühmahl am Kohlenfeuer dann an dem See. Damit der Leser diese doppelte Offenbarung auch wahrnehme, fügt der Erzähler dem Vers noch den Satz hinzu: „Er offenbarte sich aber in folgender Weise“.
Zu Vers 2 äußert sich Thyen zunächst in gleichem Sinne wie Wengst:
Sieben der Jünger Jesu sind am See versammelt und werden zu Zeugen seiner neuen Offenbarung, nämlich Simon Petrus, Thomas mit dem Beinamen Zwilling, Nathanael aus dem galiläischen Kana, die (beiden Söhne) des Zebedäus, und noch zwei weitere seiner Jünger. Während Thomas der zuletzt Genannte im Corpus des Evangeliums war, erinnert das Auftreten von Nathanael an dessen Anfang (1,45-51). Von seiner Herkunft aus dem galiläischen Kana erfährt der Leser erst hier und wird damit zugleich an die dortige archē tōn sēmeiōn Jesu erinnert (2,1-11 u. 4,46-54). So sind hier Anfang und Ende der Historia Jesu absichtsvoll verknüpft.
Zur Identität des anonymen Jüngers, den Jesus liebte, geht Thyen jedoch wieder seine eigenen uns inzwischen vertrauten Wege:
Wie V. 7 zeigt, muß einer dieser Sieben der namenlose Jünger sein, den Jesus liebte. Da der bis zum Ende des Evangeliums auch namenlos bleibt und das offenbar auch bleiben soll, kann er mit keinem der drei namentlich Genannten identisch sein. Er kann also nur einer der beiden ,Anderen‘ aus dem Jüngerkreis oder er muß einer der beiden im gesamten Evangelium bisher nirgendwo genannten Zebedaiden sein, also entweder Jakobus oder Johannes. Als die Genossen des Petrus (koinōnoi) erscheinen diese beiden auch in dem lukanischen Prätext (Lk 5,10). Dort jedoch werden sie ausdrücklich mit ihren Namen Jakobus und Johannes genannt und dann erst als die Söhne des Zebedäus bezeichnet. Daß Johannes sie gedankenlos aus der lukanischen Erzählung übernommen haben sollte, erscheint uns nahezu ausgeschlossen. Die Kurzform ihrer Bezeichnung als hoi tou Zebekaiou {die des Zebedäus} entspricht der dreifachen Anrede des Petrus als Simon Iōannou {Simon des Johannes} in den folgenden V. 15, 16 und 17. Sie setzt auf jeden Fall voraus, daß die Leser die Brüder und ihre Namen kennen. Gerade die Auslassung ihrer Namen aber muß (und soll wohl auch) sofort den Verdacht erregen, einer dieser beiden könnte doch der Jünger sein, den Jesus liebte. Dann hätte der Erzähler die „beiden anderen seiner Jünger“ nur hinzugefügt, um das Rätsel um den geliebten Jünger zu komplizieren: „Sie machen die Identifizierung des Jüngers, den Jesus liebte unmöglich“. <1514>
Zu diesem Verfahren des Erzählers hatte Thyen zufolge bereits Overbeck <1515> gemeint, er habe
„zwei ganz entgegengesetzte Interessen … unzertrennlich ineinandergeflochten, von denen das eine darauf ausgeht, uns den Evangelisten ebenso sicher zu verbergen, wie das andere, ihn uns erraten zu lassen“.
Außerdem weist Thyen darauf hin, dass Johannes „durch die Hinzufügung dieser beiden ,Anderen‘ die von ihm geliebte Siebenzahl“ erreicht, die „als Symbol der Fülle und Vollkommenheit“ nach Beasley-Murray <1516> „zweifellos eine symbolische Zahl“ darstellt, „die für die gesamte Jüngergruppe steht, und in der Tat für den gesamten Leib der Jünger, die Kirche“.
Zu seiner Identifikation (T782) des geliebten Jüngers „mit dem Zebedäussohn Johannes“ beruft sich Thyen weiter auf die „Väter der Alten Kirche“, die „sein Evangelium deshalb als das euangelion kata Iōannēn {Evangelium nach Johannes} bezeichnet“ haben:
Daß dieser Johannes ein anderer als der Apostel und Jakobusbruder gewesen sein könnte, ist keinem der Väter je in den Sinn gekommen, sondern dessen Identifizierung etwa mit Johannes Markus oder mit dem kleinasiatischen Presbyter Johannes ist erst eine verfehlte neuzeitliche Folgerung aus der historisch-kritischen Einsicht, daß der Zebedaide keinesfalls der tatsächliche Autor unseres Evangeliums sein kann.
Schließlich verweist Thyen auf seine Auslegung von Johannes 13,23ff., in der er „bereits ausführlich begründet“ hat,
daß der geliebte Jünger als der Evangelist und Erzähler der ganzen Geschichte Jesu von ihrem Anfang an ihr Augenzeuge gewesen sein muß, und daß er als derjenige, der beim letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern an der Brust seines Herrn gelegen hatte, einer der Zwölf sein muß. Darum sehen wir in ihm, neben dem namentlich genannten Andreas, den namenlos gelassenen Anderen der beiden Täuferjünger, die Jesus auf das Zeugnis des Johannes hin nachgefolgt und bei ihm geblieben waren (1,35ff). Denn daß zwei Brüderpaare, nämlich Andreas und Petrus, sowie Johannes und Jakobus, die ersten Jünger Jesu waren, weiß der Erzähler, und das wissen mit ihm seine Leser aus den synoptischen Prätexten. Darum dürfte der Zebedaide Johannes, der namenlose Namensvetter seines einstigen Meisters Johannes, der Tradent und Fortsetzer von dessen martyria {Zeugnis} sein.
Darin folgt Thyen F. C. Baur, <1517> der ihm zufolge
ganz richtig gesehen hat, daß der reale Autor unseres Evangeliums zwar nicht der Zebedaide Johannes ist, daß er sein Werk aber gleichwohl dessen apostolischer Autorität unterstellen will. Ähnlich unterscheidet Overbeck [240f.] zwischen dem Evangelisten im vierten Evangelium und dessen „wahrem Verfasser“ und hält nur die Frage nach dem ersteren für sinnvoll, die nach dem letzteren dagegen für „bare Absurdität“. Darin, daß die Kirchenväter den Evangelisten im vierten Evangelium mit dem Zebedaiden Johannes identifiziert haben, folgten sie ganz richtig der Spur, auf die sie der wahre Verfasser gelockt hatte. Daß unser Evangelium aber ein Pseudepigraph und dazu noch anonym sein könnte, haben sie nicht geahnt, als sie den erzählten und erzählenden fiktionalen Evangelisten mit dessen unbekanntem Schöpfer identifizierten. Der tatsächliche Evangelist, von dem wir nichts wissen können und nach dem zu fragen Overbeck für absurd hielt, weil er sich bis zur Selbstaufgabe in den Evangelisten im Evangelium entäußert hat, der hat mit seinem Werk dem Zebedaiden Johannes, der wie Petrus schon lange zuvor als Märtyrer gestorben war, ein unvergeßliches literarisches Denkmal gesetzt (s. u. zu V. 20ff).
Wie Thyen befasst sich auch Ton Veerkamp <1518> in seiner Auslegung von Vers 1 eingehend mit dem Wort phaneroun:
Das Stück fängt mit einem merkwürdigen Satz an. Im Evangelium hat das Verb phaneroun die Bedeutung „öffentlich bekanntmachen“. In den Erzählungen über die Auferstehung in Johannes 20 kommt das Verb phaneroun, öffentlich machen, offenbaren, nicht vor. Im Evangelium dient das Verb zur Kennzeichnung des Messias als öffentliche und politische Gestalt, 1,31 und 7,4, der öffentlichen Ehre des Messias, 2,11, und seiner Werke, 3,21; 9,3, und seines Namens, 17,6. Überall ist das Öffentliche ein Wesenselement des Verbs. Wir müssten also übersetzen: „Danach ließ sich Jesus wieder öffentlich von den Schülern sehen.“ Die traditionellen Übersetzungen behelfen sich mit „erscheinen“. Geister oder Gespenster erscheinen, Jesus ist weder das eine noch das andere. Auch hier hat das Verb die Bedeutung sich öffentlich bekannt machen bzw. sich sehen lassen.
Von dieser Bedeutung und bisherigen Verwendung des Wortes phaneroun her hebt Veerkamp hervor, dass es auf eine wesentliche Veränderung der Situation gegenüber der vorangegangenen Erzählung hindeuten soll:
Im 20. Kapitel ließ sich Jesus gerade nicht öffentlich sehen. Er wurde von Maria aus Magdala nicht erkannt, er hat sich kenntlich gemacht als Lehrer, weil er ihren Namen ausgesprochen hatte. Von den Schülern wurde er nur im geschlossenen Raum gesehen. Jetzt geht es um Öffentlichkeit. Wir müssen also mit „sich öffentlich sehen lassen“ übersetzen. Das aber ist, soweit wir sehen, einmalig. <1519> Die Verwendung des Verbs zeigt an, dass die Gruppe in die messianische Öffentlichkeit entlassen wird; die Verwendung der Partikel palin in der für Johannes spezifischen Bedeutung „vielmehr“ zeigt, dass jetzt etwas Entscheidendes geschehen wird. Wie und mit welchem Zweck, wird in diesem letzten Kapitel erzählt.
Zu Vers 2 stellt Veerkamp zunächst heraus, dass mit der Erwähnung der Zebedäussöhne symbolisch auf eine größere „messianische Öffentlichkeit“ angespielt wird, vor der sich Jesus als der zum VATER aufsteigende Messias nun zeigen wird:
Von den Zwölf sind sieben zusammen. Zu unserer Verwunderung begegnen uns die zwei Söhne des Zebedäus, die bei den Synoptikern eine herausragende Rolle spielen, bei Johannes aber mit keiner Silbe erwähnt wurden. Die zwei werden auf der Ebene der Erzählung als Berufsgenossen des Simon Petrus dargestellt, tatsächlich sind sie auf der Ebene des Erzählers Hauptrepräsentanten der messianischen Bewegung derer, die aus Judäa stammen. Für Paulus „galten sie als Säulen“, Galater 2,9, und diese Bedeutung muss dem Erzähler bekannt gewesen sein. Sie stellen die messianische Öffentlichkeit dar, in die Jesus die bis dahin isolierte Gruppe entlässt.
Zur Siebenzahl der in Vers 2 erwähnten Schüler äußert sich Veerkamp zurückhaltender als Wengst und Thyen. Er bezieht sie nicht auf die künftige Gemeinde oder Kirche, sondern verweist darauf, dass sie hinter der Vollzahl der Zwölf zurückbleibt. Den geliebten Schüler identifiziert Veerkamp eindeutig mit einem der beiden Anonymen:
Simon Petrus ist da, um ihn wird es ja gehen. Dann Thomas, der Zwilling genannt, der solidarische Skeptiker, und Nathanael, der Israelit, in dem keine Tücke war. Dann noch zwei andere. Der eine ist der Lehrling, dem Jesus solidarisch verbunden war. Er bleibt ohne Namen, wie auch der andere. Das ist eine merkwürdige Gesellschaft. Weder Andreas noch Philippus sind zugegen, zumindest erfahren wir ihre Namen nicht. Sieben ist eine volle Zahl, aber sieben ist nicht zwölf. Wir haben sieben Menschen. Die Woche hat sieben Tage. Der Fremde am Strand ist der achte Mensch. Der achte Tag ist joma chad, „Tag eins“.
Die abschließende Bemerkung klingt weit hergeholt, aber die hier angedeuteten Zahlen 7 und 8 können tatsächlich an die zwischen den beiden Begegnungen Jesu mit seinen Schülern am „Tag eins“ der neuen Schöpfung und am achten Tag liegende Woche erinnern sowie daran, dass jeder achte Tag zu einem weiteren „Tag eins“ werden kann, wenn an ihm der zum VATER aufsteigende Messias Jesus seiner Schülerschaft in dessen befreiender und zur Solidarität befähigenden Inspiration begegnet.
↑ Johannes 21,3-6: Einen Fischzug der Schüler mit Petrus führt erst die Begegnung mit dem unerkannten Jesus zum Erfolg
21,3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen.
Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir.
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot,
und in dieser Nacht fingen sie nichts.
21,4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer,
aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.
21,5 Spricht Jesus zu ihnen:
Kinder, habt ihr nichts zu essen?
Sie antworteten ihm: Nein.
21,6 Er aber sprach zu ihnen:
Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes,
so werdet ihr finden.
Da warfen sie es aus
und konnten‘s nicht mehr ziehen
wegen der Menge der Fische.
Nach Klaus Wengst (W576) veranlasst Simon Petrus „als Wortführer der versammelten Schüler“ die anderen mit seiner Aufforderung in Vers 3: „Ich gehe fischen“ zum Fischfang in einem gemeinsamen Boot, worauf sie bereitwillig eingehen:
„Wir gehen mit dir.“ Dass Simon Petrus und die anderen von Beruf Fischer seien, war in Kap. 1-20 nirgends erwähnt worden, wird hier aber als selbstverständlich – und damit als der Leser- und Hörerschaft bekannt – vorausgesetzt. Sie weiß es aus mündlicher Tradition oder aus den anderen Evangelien. Nach Mt 4,19; Mk 1,17 kündigt Jesus den erstberufenen Schülern an, sie zu „Menschenfischern“ zu machen. Von daher mag für die Leser- und Hörerschaft schon hier eine metaphorische Dimension mitschwingen.
Mit sparsamen Worten wird der Fischzug beschrieben:
„Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot.“ Das Hinausgehen bezieht sich auf das Haus, in dem die Schüler versammelt waren, vielleicht auch auf den Ort, der nicht genannt ist. Über ihre Arbeit verlautet nichts. Nur der negative Erfolg wird festgestellt: „Aber in jener Nacht fingen sie nichts.“ Nachträglich ergibt sich also, dass die Schüler über Nacht zum Fischen gegangen waren.
In Vers 4 stellt „die Erwähnung des Morgens einen beabsichtigten Kontrast“ zur „erfolglosen Nacht“ dar:
„Als es schon Morgen wurde, trat Jesus an den Strand.“ Wie er nach 20,19.26 mitten unter seine Schüler trat, ebenso selbstverständlich und unvermittelt tritt er hier an den Strand. Bei der Leser- und Hörerschaft weckt das die Erwartung, dass sich die gerade beschriebene Situation der Schüler ändern wird. Aber zunächst heißt es von ihnen: „Die Schüler jedoch wussten nicht, dass es Jesus war.“ Es geht ihnen damit nicht anders, als es nach Joh 20,14 Mirjam aus Magdala und nach Lk 24,15f. den beiden Schülern auf dem Weg nach Emmaus bei ihren Begegnungen mit Jesus erging. Aber während in diesen Erzählungen alles auf den Moment des Wiedererkennens zuläuft und Jesus sich unmittelbar anschließend entzieht, wird hier das Wiedererkennen sehr verhalten berichtet – und Jesus bleibt in dieser und auch noch in der folgenden Szene.
Da Wengst (W576f.) „die Schüler als Repräsentanten der Gemeinde betrachtet“, ist es in seinen Augen nicht befremdlich, dass „die Schüler Jesus nicht wiedererkennen, obwohl er ihnen doch nach Joh 20,19-29 schon zweimal erschienen ist“, denn natürlich (W577)
hat die Gemeinde gelernt, dass Jesus lebt und in ihr gegenwärtig ist. Aber es käme darauf an, Zeichen dieser Gegenwart in ihrem Alltag immer wieder zu entdecken und wirklich wahrzunehmen.
Wie bereits in Johannes 13,33 redet in Vers 5 der „Unbekannte am Strand … diejenigen, die vergeblich die ganze Nacht gefischt haben, als ‚Kinder‘ an.“ Während dort (Anm. 7) im „griechischen Text … teknía“ steht, erscheint „hier das gleichbedeutende paidía. Beide Anreden finden sich im ersten Johannesbrief, paidía zweimal, teknía siebenmal.“ So spricht Jesus (W577) als „der Lehrer zu seinen Schülern“.
Die nun folgende Frage Jesu interpretiert Wengst aus der Sicht eines Publikums, das mehr weiß als die beteiligten Schüler, und stellt sie in den Zusammenhang mit der Speisungsgeschichte in Kapitel 6:
Hier fährt er mit einer zweifelnd gestellten Frage fort, die eine verneinende Antwort erwartet: „Ihr habt wohl keinen Fisch?“ Die Leser- und Hörerschaft, die ja im Unterschied zu den in der Erzählung agierenden Schülern darüber informiert ist, wer da an den Strand trat, weiß daher auch, dass Jesus die Situation durchschaut und mit seiner Frage nur das Eingeständnis der Erfolglosigkeit sucht, das er auch sofort erhält: „Sie antworteten ihm: ,Nein.‘“ Die Leser- und Hörerschaft wird sich auch an die Speisungsgeschichte erinnern, wo Jesus den Philippus fragte, wovon für die große Menge Brot gekauft werden solle, und der Evangelist anschließend bemerkte: „Das aber sagte er, um ihn zu erproben. Er selbst nämlich wusste schon, was er tun würde“ (6,5f.).
In der Aufforderung Jesu in Vers 6: „Werft das Netz zur rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet welchen finden“, hat nach Wengst (Anm. 9) „‚Rechts‘ … gegenüber ‚links‘ eine positive Konnotation“, wozu er auf Matthäus 25,33 verweist.
Was daraufhin geschieht, vergleicht Wengst mit dem in Lukas 5,5-7 dargestellten Erfolg des in Lukas 5,4 dem Simon gebotenen Fischzuges. Dort (Anm. 10) weist Simon „auf die Vergeblichkeit ihrer nächtlichen Mühe“ hin, und (Anm. 11) „die Größe des Fangs“ wird dadurch ausgedrückt, dass die Netze zu reißen anfangen und die Boote der Fischer fast sanken. Hier bei Johannes (W577) tun die Schüler
[o]hne jeden Einwand, ohne jedes Zögern …, was Jesus ihnen geboten hat: „Sie warfen es also aus.“ Ebenso unmittelbar, wie sie dem Wort Jesu folgen, trifft auch die gegebene Zusage ein: „[…] und konnten es nicht mehr heraufziehen wegen der Menge von Fischen.“ Das Netz ist sofort so voll, dass sie es nicht mehr hochziehen können, um den Fang ins Boot zu schütten.
Hartwig Thyen (T782) vergleicht in Vers 3 die Fischfangszene mit dem lukanischen Prätext:
Petrus erklärt: Ich gehe fischen, und die anderen folgen ihm und besteigen das Boot. Wie in Lk 5,5, wo freilich Petrus im Gespräch mit Jesus sagt: „Herr, die ganze Nacht über haben wir uns gemüht und doch nichts gefangen“ (di‘ holēs nyktos kopiasantes), so muß hier, weil Jesus ja noch gar nicht aufgetreten ist, der Erzähler berichten: „Doch in jener Nacht fingen sie nichts“.
Zur Auslegung von Vers 4 geht Thyen über Wengst hinaus darauf ein (T783), warum er das nur von wenigen Handschriften bezeugte „Part. Präs. ginomenēs {wörtlich: werdend}“ der „breiter und besser bezeugten Lesart genomenēs {wörtlich: geworden seiend} den Vorzug“ gibt. Zum einen erscheint ihm
die sekundäre Angleichung des Partizips an den Modus des ihm folgenden Aorist estē {wörtlich: sich gestellt habend} wahrscheinlicher als der umgekehrte Vorgang, und zum anderen erlaubt es die präsentische Variante des genitivus absolutus prōïas … ginomenēs {wörtlich: wegen der werdenden Morgendämmerung}, in der gerade erst anbrechenden Morgendämmerung den Grund dafür zu sehen, daß die Jünger ihren Herrn nicht erkennen konnten. Die Situation müßte man sich dann so vorstellen wie diejenige bei der Ankunft Marias am Grabe Jesu: erchetai prōï skotias eti ousēs ktl. {sie kam früh am Morgen, als es noch finster war usw.} (20,1).
Zu Vers 5 bemerkt Thyen, dass das Wort paidion {Kind} im Johannesevangelium zwar bereits in 4,49 und 16,21 vorkam, aber „als Anrede der Jünger mit paidia (Kinderchen) singulär im Evangelium“ ist. „Es findet sich aber in 1Joh 2,14 und 2,18.“
Den Vers 6 betrachtet Thyen wieder im Vergleich zum „lukanischen Prätext“, wobei er außer Lukas 5,5-7 zur Bitte um ein prosphagion {Zukost, Fisch} auch Lukas 24,41f. in den Blick nimmt (wenngleich dort statt der Vokabel prosphagion das Wort brōsimos {Essbares} steht). An der erstgenannten Stelle
gebietet Jesus Petrus und seinen Gefährten Jakobus und Johannes: Rudere hinaus ins tiefe Wasser, und werft dort eure Netze zum Fang aus! (Lk 5,4). Darauf erwidert ihm Petrus, der was vom Fischfang versteht und weiß, daß dafür die Nacht der günstigste Termin ist: „Meister, wir haben bereits die ganze Nacht über (di‘ holēs nyktos kopiasantes) gefischt und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin, will ich die Netze (nochmals) auswerfen“. Bei Johannes wird diese Geschichte, ebenso wie alles, was ihr noch folgt, aus der Perspektive der Jünger erzählt, unterbrochen nur durch gelegentliche Kommentare des Erzählers. Mit der ersten seiner kommentierenden Bemerkungen in V. 3bf übersetzt er das Petruswort in seine Erzählperspektive: Und sie gingen hinaus und bestiegen das Boot, doch in jener Nacht (en ekeinē tē nykti), die bis zum Morgengrauen währte (prōïas de ēdē ginomenēs), fingen sie nichts. Bei Lukas, wie bei Johannes, folgt darauf Jesu Aufforderung, das Netz auszuwerfen. Johannes motiviert die Aufforderung durch die Bitte des einstweilen noch für einen Fremden gehaltenen Jesus um ein prosphagion (vgl. Lk 24,41f) und präzisiert sie durch den Auftrag Jesu, das Netz an der rechten Seite des Bootes auszuwerfen: „Und so werdet ihr Erfolg haben“ (kai heurēsete {wörtlich: ihr werdet finden}). Der Größe des Fischfangwunders gibt Lukas dadurch Ausdruck, daß er erzählt, sie hätten so viele Fische gefangen, daß ihre Netze zu zerreißen drohten (dierrēsseto de ta diktya autōn), und daß sie zu deren Bergung noch die Kollegen aus einem anderen Boot zu Hilfe rufen mußten. Johannes sieht das Wunder umgekehrt darin, daß das Netz trotz der Menge der darin gefangenen 153 großen Fische nicht riß (kai tosoutōn ontōn ouk eschisthē to diktyon: V. 11).
Ton Veerkamp <1520> setzt in der Auslegung von Vers 3 nicht wie Thyen oder auch Wengst voraus, dass hier symbolisch von missionarischer Tätigkeit im Sinne der synoptischen Menschenfischer (Markus 1,17; Matthäus 4,19) sein könnte:
Simon geht nun seinem Gewerbe, dem Fischfang, nach. Auch davon war bislang nicht die Rede. Simon ergreift die Initiative, er ist in der Erzählung der Protagonist. „Ich geh‘ fischen“; die übrigen schließen sich an: „Auch wir kommen mit dir.“ Die sieben gehen fischen, sie sind hier ein Berufskollektiv, noch keine messianische Gemeinde. Sie sind eine verschüchterte Gruppe von Leuten, die sich früher auf ein messianisches Abenteuer eingelassen hatten. Jetzt gehen sie wieder fischen. Irgend etwas muss der Mensch tun, um essen zu können; Fischer gehen eben fischen, Messianisten sind sie schon lange nicht mehr, trotz der „Erfahrung“ im geschlossenen Raum nach dem Tode Jesu.
Was Johannes in den Versen 4 bis 6 von der Begegnung der Fischer mit Jesus schildert, gibt Veerkamp in einfühlsamer und die morgendliche Stimmung nach erfolglos durchgearbeiteter Nacht treffend einfangender Weise wieder:
Die nächtliche Unternehmung ist ergebnislos. Nichts geht mehr. Bei der Rückkehr sehen die Fischer Jesus am Strand stehen, ohne zu wissen, dass er es ist. Das erlebte auch Maria aus Magdala. Auch sie nahm eine Gestalt wahr, ohne zu wissen, dass es Jesus war, sie hielt ihn für den Gärtner. Den aufstehenden Messias erkennt man nicht, er gibt sich zu erkennen.
Jesus redet die Schüler mit paidia an, so etwas wie „Jungs“. Er hatte sie einmal teknia genannt, „Kinder“, 13,33. Er bittet um „Zuspeise“ (pros-phagion), „etwas zu essen“ übersetzen wir. Das Wort gab es in der griechischen Sprache bis dahin nicht, der Erzähler hat es erfunden. Die Fischer sind buchstäblich einsilbig: „Ou, Nein.“ Für sie ist der Mann ein Fremder, ein Außenstehender.
Der Fremde gibt ihnen den Rat, das Netz an der rechten Seite des Bootes auszuwerfen. Das tun sie. Warum diese professionellen Fischer einen beruflichen Rat eines Fremden annehmen, ist merkwürdig, zumal es egal ist, ob das Netz rechts oder links vom Boot ausgeworfen wird. Gibt es Fisch, dann fangen sie, gibt es keinen Fisch, fangen sie nicht, gleich ob links oder rechts. Sie tun aber, was der Mann sagt, und zwar weil er es sagt und nicht, weil die rechte Seite die Glücksseite sein soll. Darauf wären sie schon von allein gekommen.
Jetzt fangen sie, und der Erfolg ist unerhört: sie können das Netz wegen der Menge an Fisch nicht schleppen.
Hier unterbreche ich Veerkamps Redefluss mitten in einem noch nicht zu Ende geführten Gedankengang, bevor er auf die Reaktion des geliebten Schülers und des Petrus auf den erfolgreichen Fischfangs eingeht, die im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts steht.
↑ Johannes 21,7: Der geliebte Schüler bekennt Jesus gegenüber Petrus als den Herrn, woraufhin Simon Petrus sich gürtet und in den See wirft
21,7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus:
Es ist der Herr!
Als Simon Petrus hörte: „Es ist der Herr“,
da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt,
und warf sich in den See.
[20. Februar 2023] Zum Auftritt (W577) des Schülers, „den Jesus liebte“ in Vers 7 betont Wengst nochmals, dass „für ihn genug Platz frei“ blieb, da „in der Aufzählung der Schüler zwei ungenannt blieben“ (W577f.):
In dieser Szene greift er nur ganz kurz, aber bedeutungsvoll ein und verschwindet dann wieder in der Mehrzahl der Schüler. „Da sagte jener Schüler, den Jesus liebte, zu Petrus: ,Es ist der Herr.‘“ Der große Fang, der sich auf das Wort des Unbekannten am Strand hin ergab, wird ihm zum Zeichen der Gegenwart Jesu. So spricht er als Erster und Einziger die Erkenntnis aus: „Es ist der Herr.“ Aber er teilt diese Erkenntnis nur Petrus mit. Diese Gegenüberstellung der beiden Schüler bereitet die zweite Szene vor. Sie erinnert aber auch an das letzte Mahl Jesu, als Simon Petrus dem anderen zunickt, damit er erkunde, wer Jesus ausliefere; der erfährt es, sagt es aber nicht weiter (13,24-26). Und sie erinnert an das Laufen der beiden zum Grab, als der eine „sah und glaubte“ (20,8) und wiederum dem anderen nichts sagt.
Dass er aber jetzt „dem Petrus“ sagt, „was bzw. wen er erkannt hat“,
führt bei diesem sofort zu einer Reaktion: „Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, da gürtete er sich das Obergewand um – er war nämlich nackt – und warf sich ins Meer.“ Dass er bei der Arbeit nackt war, ist nicht als ungewöhnlich anzusehen. Die Mitteilung, dass der Unbekannte „der Herr“ sei, lässt eine Begegnung mit Jesus erwarten. Darin dürfte es begründet sein, dass Simon Petrus sich das Obergewand umgürtet.
Zu der für uns ungewöhnlichen Vorstellung, dass sich jemand, der nackt ist, etwas anzieht, um ins Wasser zu springen, führt Wengst zwei rabbinische Stellen <1521> an. Die erste (Anm. 12) nimmt „eine Situation im Blick, in der Menschen nackt auf dem Feld sind oder nackt andere Arbeit verrichten. Sie müssen sich, wenn sie das Sch‘ma {Glaubensbekenntnis} rezitieren, in irgendeiner Weise bedecken“. Die zweite (Anm. 13) beschreibt, was „für den Besuch eines Bades“ gilt: „An dem Ort (innerhalb der Räume des Bades), an dem die meisten Menschen sich nackt aufzuhalten pflegen, dort entbietet man den Gruß nicht.“
Weiter hält Wengst (Anm. 14) die Annahme von Thyen (T779/T784), dass „dem Petrus hier gelinge, was er nach Mt 14,28-31 vergeblich versucht habe und er also auf dem Wasser zu Jesus gehe“, für „allzu phantasievoll. Die Formulierung des Textes, dass ‚Petrus sich ins Meer warf‘, bietet dafür nicht den mindesten Anlass.“ Wengst selbst stellt darüber andere nicht weniger phantasievolle Spekulationen an:
Als Absicht solchen Handelns, über die der Text schweigt, wird so gut wie durchgängig angegeben, „um möglichst schnell bei Jesus zu sein“. <1522> Aber die Annahme einer solchen Absicht wird durch den tatsächlichen Verlauf der Erzählung in keiner Weise nahegelegt. In ihr ist Simon Petrus, von den anderen Schülern getrennt, für eine Weile buchstäblich untergetaucht. Man muss sich um ihn keine Sorgen – und auch keine Gedanken – machen; er wird schon wieder auftauchen.
Hartwig Thyen (T783) hebt zu Vers 7 hervor, dass der „Jünger, den Jesus liebte“ und der erst jetzt als „einer der in V. 2 aufgezählten Sieben“ erwähnt wird, „ein Erfahrener in der Lektüre der Zeichen seines Herrn“ ist, was zuletzt in 20,8 erkennbar war. Das Neue (T784) „an seiner Äußerung zu Petrus: ,Es ist der Kyrios‘“ besteht darin,
daß er erst in diesem Epilog zum ersten Mal sein Glaubenswissen auch weitergibt (vgl. dagegen 13,26). Und kaum hat Petrus vernommen, daß es der Kyrios ist – bei Johannes ist ho kyrios der Name des Auferstandenen; vgl. 20,18.20.25.28; proleptisch und auf 21,12ff vorausweisend schon 6,23 – da gürtete er sich mit seinem Obergewand, denn er war nackt. D. h. er wird wohl, wie unter Fischern üblich, mit entblößtem Oberkörper seine Arbeit verrichtet haben. So aber kann er nicht vor seinen Herrn treten, ihn zu begrüßen (vgl. Gen 3,7.10). Barrett [555] verweist auf T. Ber 2,20 (5), wonach „die Entbietung des Grußes (schaˀal schalom) eine religiöse Handlung (war, die) nicht in unbekleidetem Zustand ausgeführt werden (konnte)“.
In Abgrenzung zu Brown, auch im Gegensatz zu Wengst und Barrett, jedoch im Anschluss an Steiger <1523> begründet Thyen sodann seine Auffassung, Petrus habe sich ins Wasser geworfen, um Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen:
Weil er meint, Petrus wolle eilends zu Jesus schwimmen, läßt Brown ihn sein Obergewand lediglich festbinden und begründet das damit, daß das Verbum diazōnnymi „sich (Kleidung) umbinden“ bedeute. Dazu wäre freilich der Nachsatz: „Denn er war nackt“, mehr als nur überflüssig. Nicht weil er zu ihm schwimmen wollte, sondern weil er so rasch wie möglich und angemessen bekleidet vor seinen Herrn treten und ihn begrüßen wollte, hat Petrus sein Obergewand angelegt. Zudem fragt man sich doch, ob ein galiläischer Fischer im ersten nachchristlichen Jahrhundert überhaupt schwimmen konnte, zumal Mt 14,29f ja auf jeden Fall das Gegenteil voraussetzt. Im Gegensatz zu derartigen historischen Recherchen und zu Barretts Bemerkung [556], es sei nicht nötig (!), „hier den Bericht des Mt (14,28-32) über Petrus‘ Versuch, auf dem See zu wandeln, zum Vergleich heranzuziehen“, scheint uns Steiger der Intertextualität unseres Evangeliums mit seinen synoptischen Prätexten und dem Geist dieser Erzählung doch viel näherzukommen, wenn er erklärt: „Petrus, als er den Herrn erkennt, wirft sich ins Wasser, um ihm entgegenzugehen (Joh 21,7). Das tut er wie vormals (Mt 14,29f), doch ohne zu sinken“.
Am überreichen Erfolg des Fischfangs erkennt nach Ton Veerkamp <1524>
der Schüler, „dem Jesus solidarisch verbunden war“, um wen es sich handelt, und sagt zu Simon: „Es ist der Herr.“ Jesus wird hier „Herr“ genannt. Das ist das Bekenntnis der messianischen Gemeinde.
Die Reaktion des Simon Petrus interpretiert Veerkamp in ähnlicher Weise wie Thyen unter Bezug auf die synoptische Erzählung von seinem gescheitertem Versuch, auf dem Meer zu gehen, die Johannes in 6,16-21 nicht aufgegriffen hatte:
Simon reagierte, als ob er an etwas erinnert wurde, was er vergessen oder, besser, verdrängt hatte: Als er „hörte, dass es der Herr war“, wirft er sich den Mantel um und geht ins Wasser. In diesem Schlusskapitel holt Johannes nach, was er in der Erzählung über Jesus, der auf dem Wasser den Schülern entgegenging, versäumt hatte. Dort lässt er, abweichend von der synoptischen Fassung der Erzählung, Simon im Boot. Jetzt geht Simon ins Wasser.
Zur Nacktheit des Petrus und zu seiner Gürtung mit der Oberbekleidung stellt Veerkamp Überlegungen an, die über diejenigen von Wengst und Thyen hinausgehen:
Er wusste, dass er nackt war, und er wusste auch, dass er seine Nacktheit bedecken muss. Unter nicht-paradiesischen Verhältnissen ist Nacktheit eine Schande (Genesis 3) und Zeichen extremer Bedürftigkeit. Daher ist es Menschenpflicht, Nackten Kleidung zu geben (Ezechiel 18,16; Matthäus 25,36). Simon weiß um seine Nacktheit, um die Isolierung der ehemaligen Messiasschüler. „Er zog das Oberkleid um sich“, heißt es. Das Wort (diezōsato, von zonnynaki, „gürten“) ruft die Szene auf, wo Jesus ihm ankündigen wird, dass ein anderer ihn umgürten wird (21,18). Noch kann Simon handeln und seine Nacktheit, die ihn isoliert, überwinden. Denn Isolierung ist die Isolierung vom Messias.
Mich hat das Stichwort „gürten“ außerdem an die Szene erinnert, als Jesus sich umgürtete, um die Füße seiner Jünger zu waschen, 13,4. Nun scheint Petrus bereit zu sein, dem in der Fußwaschung gezeigten Beispiel seines Herrn vorbehaltlos zu folgen.
↑ Johannes 21,8-11: Petrus zieht das Netz mit 153 Fischen im Auftrag Jesu an Land, nachdem die anderen Schüler es bis ans Ufer gezogen haben
21,8 Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot,
denn sie waren nicht fern vom Land,
nur etwa zweihundert Ellen,
und zogen das Netz mit den Fischen.
21,9 Als sie nun an Land stiegen,
sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden
und Fisch darauf und Brot.
21,10 Spricht Jesus zu ihnen:
Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!
21,11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land,
voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig.
Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.
Was auch immer Petrus getan hat, ob er an Land geschwommen oder auf dem See gelaufen ist, um Jesus zu erreichen, oder ob er einfach untergetaucht ist, in Vers 8 nimmt nach Klaus Wengst der Verfasser
danach „die anderen Schüler“ in den Blick: Sie „kamen mit dem Boot – sie waren nämlich nicht weit vom Land, nur etwa 200 Ellen – und schleppten das Netz mit den Fischen“. Da sie wegen der vielen Fische das Netz nicht heraufbringen konnten, ziehen sie es – die Entfernung zum Ufer beträgt nur knapp 100 Meter – mit dem Boot hinter sich her.
In meinen Augen zeigt die Formulierung, dass die anderen Schüler „mit dem Boot“ kamen, eindeutig, dass Petrus allein, schwimmend oder laufend, also eben nicht im Boot, vor ihnen bei Jesus angekommen sein muss. Mir ist unerfindlich, in welcher Weise sich Wengst das Untertauchen des Petrus nach seinem Sich-ins-Wasser-Werfen vorstellt; nimmt er an, er habe nicht nur schwimmen können, sondern sei zwischendurch buchstäblich auf Tauchstation gegangen, oder er habe sich vor dem Herrn zunächst versteckt? Wie dem auch sei, Wengst fährt zu Vers 9 fort:
Als sie nun aufs Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot.“ Dabei ist vorausgesetzt, dass sie das Boot festgemacht haben und das Netz mit den Fischen noch im Wasser liegt. An Land gekommen, erblicken sie also ein Kohlenfeuer. Ein Kohlenfeuer war im Evangelium in 18,18 erwähnt. Damit wird die Leser- und Hörerschaft daran erinnert, dass Simon Petrus am Kohlenfeuer im Hof des Hohepriesters Jesus dreimal verleugnet hat. An diesem Kohlenfeuer am Strand wird er die dreimalige Frage Jesu, ob er ihn liebe, dreimal bejahen. Aber das geschieht erst in der nächsten Szene; noch ist Simon Petrus nicht wieder aufgetaucht. Die an Land kommenden Schüler erblicken nicht nur das Kohlenfeuer, sondern auf ihm auch Fisch und Brot: Das Mahl ist schon bereitet. „Der Herr“ sorgt wunderbar für die Seinen.
In der Aufforderung Jesu (Vers 10): „Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!“, erblickt Wengst ein „retardierendes Moment“, bevor das Mahl stattfinden kann. Er meint, dass auf diese Weise Simon Petrus, der noch „fehlt“, wieder ins Spiel gebracht werden soll (W579):
Die Aufforderung Jesu, von den gefangenen Fischen zu bringen, hat, wie die Fortsetzung der Erzählung zeigt, ausschließlich die Funktion, Simon Petrus wieder auftauchen zu lassen und in Szene zu setzen. Diese Aufforderung war an die aus dem Boot gestiegene Schülergruppe gerichtet, die Simon Petrus nicht mehr einschloss.
Einen anderen Grund für den Auftrag Jesu schließt Wengst aus, nämlich dass „es noch weiteren Fisches für das Mahl bedürfe… Es ist Fisch da, wie auch Brot da ist – auf wunderbare Weise.“ Der Verfasser (Anm. 16) würde doch das „wunderbare Vorhandensein von Fisch und Brot“ nicht feststellen, „um gleich anschließend einzuräumen, dass es sich leider nur um ein halbes Wunder handle, weil der Fisch doch nicht ausreiche.“ Zudem „wird gerade nicht erzählt“, dass „von den gefangenen Fischen tatsächlich welche gebracht und gebraten würden“.
Stattdessen (W579) „heißt es nun“ in Vers 11:
„Da stieg Simon Petrus herauf“, nämlich aus dem „Meer“, in das er sich gestürzt hatte, „und zog das Netz ans Land“. Er tritt also Jesus damit wieder unter die Augen, dass er zunächst für die Erfüllung des gegebenen Auftrags die Voraussetzung schafft. Aber nachdem er so wieder in Szene gesetzt worden ist, interessiert dieser Auftrag in der weiteren Erzählung nicht mehr; er hat offenbar seine Funktion erfüllt.
Die fixe Idee von Wengst, Petrus sei nach seinem Sprung ins Wasser bis zu diesem Zeitpunkt untergetaucht und noch nicht an Land erschienen, macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Die anderen Schüler mit dem Boot und dem schweren Netz müssten ihn überholt haben, Petrus müsste tatsächlich die ganze Zeit im Wasser verbracht haben. Abgesehen davon kann sich das Wort anebē {er stieg hinauf} ebenso gut darauf beziehen, dass Petrus wieder auf das Boot steigt und nicht vom Wasser auf das Ufer.
Trotzdem wird Wengst insofern Recht haben, dass Jesu Aufforderung nicht dazu dienen soll, die unzureichende Menge an Fisch auf dem Kohlenfeuer zu vervollständigen. Dass es Simon Petrus ist, der den gegenüber allen Schülern ausgesprochenen Auftrag Jesu erfüllt, dient sicher der symbolischen Vorwegnahme seiner Führungsrolle, die ihm in der nächsten Szene von Jesus übertragen wird. Und mir kommt sogar der Gedanke, Jesus könne eine leise Kritik an der Art und Weise geübt haben, wie Petrus mit seinem Sprung ins Wasser ihn vor allen anderen Schülern erreichen wollte, womit er sich aber zugleich der Aufgabe entzog, den reichen Fischfang gemeinsam an Land zu bringen. Dieser Aufgabe stellt er sich jetzt auf die ausdrückliche Aufforderung Jesu an alle Schüler allein.
Außerdem wird nun noch „das Bild des das Netz aus dem See ans Land ziehenden Simon Petrus mit zwei weiteren Einzelzügen versehen“. Erstens wird die „Menge von Fischen“ in dem Netz genau bezeichnet:
„voll von 153 großen Fischen“. Der Verfasser erzählt nicht, dass der Inhalt des Netzes ausgeschüttet und eine Zählung vorgenommen wurde, aus der sich diese Zahl ergebe. Mit ihr muss eine Bedeutung verknüpft sein, die von der Leser- und Hörerschaft erkannt werden sollte und konnte.
Welche Bedeutung das aber sein soll, konnten schon die Kirchenväter nicht wirklich klären. Nach Wengst „gibt es drei diskutable Möglichkeiten“. Erstens könnten nach dem Verfahren der „Gematrie“ wie etwa in Offenbarung 13,18 Worte in Zahlenwerte umgesetzt werden“, aber die „bisher im Blick auf diese Stelle für die Zahl 153 gemachten Vorschläge sind ohne Evidenz.“ Zweitens weist Hieronymus <1525> „in seinem Kommentar zu Ez 47,6-12 unter Bezug auf Joh 21,11“ darauf hin, dass es „153 Arten von Fischen“ gebe; damit würde das „Netz mit den Fischen aller Arten … die universale Gemeinde mit Menschen aus allen Völkern“ symbolisieren. Vielleicht sind aber die Autoren, auf die sich Hieronymus beruft, auf diese Zahl umgekehrt gerade von Johannes 21,11 her gekommen. Drittens schließlich ist 153 „die Dreieckszahl von 17, also die Summe aller Zahlen von 1 bis 17“. Und nach Barrett <1526> ist „17 selbst … die Summe aus sieben und zehn, beides sind Zahlen, von denen schon jede für sich auf Vollständigkeit und Vollkommenheit weist“. Von daher lässt sich nach Wengst das
Netz „voll von 153 großen Fischen“ … am besten verstehen als Bild für die Gemeinde, deren Vollständigkeit und Vollkommenheit herausgestellt wird. Das bestätigt der zweite mit dem Netz verbundene Einzelzug am Schluss des Verses: „Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.“ In Lk 5,6 wird die Größe des Fanges damit hervorgehoben, dass „ihre Netze rissen“. Hier wird betont, dass das Netz trotz der vielen Fische nicht zerriss: Die Einheit der aus so vielen bestehenden Gemeinde bleibt gewahrt. Als Garant solcher Einheit erscheint hier der das Netz ans Land Ziehende Simon Petrus. Damit ist in ein anderes Bild gesetzt, was der dem Schüler Simon gegebene Beiname „Stein/Fels“ (Kephas, Petrus) nach Mt 16,18 besagt: „Du bist ,der Fels‘ und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen.“ Diese Tradition ist in Joh 1,42 aufgenommen, aber bezeichnenderweise nicht ekklesiologisch ausgewertet, wie sich ja überhaupt in Kap. 1-20 immer wieder eine Simon Petrus nivellierende Einordnung in die Gemeinschaft der Schüler Jesu zeigt. Hier nun wird erstmals deutlich, dass der Verfasser des Nachtrags ein anderes Bild von Simon Petrus aufbaut. Das wird er am Beginn der zweiten Szene aufnehmen.
Hartwig Thyen (T784) fasst zunächst den Inhalt der Verse 8 und 9 folgendermaßen zusammen:
Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa zweihundert Ellen, und hatten das Netz mit den Fischen im Schlepp. Als sie ausgestiegen und an Land gegangen waren (apebēsan), sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer (anthrakia wie 18,18) und darauf lagen Fisch und Brot.
Auf das Wort apebēsan in Vers 9 macht Thyen in besonderer Weise aufmerksam:
Im Zusammenhang mit der Seefahrt ist apobainein terminus technicus mit der Bedeutung: sich ausschiffen, an Land gehen. In diesem speziellen Sinn begegnet das Lexem im Neuen Testament nur hier und Lk 5,2 (!).
Versteht man das Wort als Gegensatz zu anabainein, wird man letzteres Wort in Vers 11 definitiv auf den Wiederaufstieg auf das Boot beziehen müssen.
Im Blick auf „die Singulare opsarion kai erton {Fisch und Brot}“ meint Thyen, dass schwer zu entscheiden sei, ob sie
kollektive Bedeutung im Sinne von Fisch(en) und Brot(en) haben, oder wirklich nur von einem Fisch und einem Brot sprechen… Da uns das Ganze aber als eine österliche Wiederholung jenes Mahles am gleichen See mit den fünf Gerstenbroten und den zwei Fischen zur Sättigung der Fünftausend erscheint und da es nachher, ähnlich wie dort, in nahezu sakramentaler Sprache heißt: „Und er nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso auch den Fisch“ (V. 13), sollte zur Sättigung dieser Sieben und ihres Gastgebers wohl erst recht ein Brot und ein Fisch ausreichend gewesen sein.
Nach Vers 10 und 11 handelt auf
Jesu Aufforderung an die Jünger hin, ihm nun auch Fische aus dem eben gelungenen Fang zu bringen, … für sie alle allein Simon Petrus: Er bestieg dazu zunächst das Boot, in dessen Schlepptau sich das prall gefüllte Netz ja noch befand. Anabainein {hinaufsteigen} muß hier der Logik der Erzählung nach den Gegensatz zu dem gerade zuvor gebrauchten Lexem apobainein {herabsteigen} bezeichnen, so daß anebē oun Simōn Petros {es stieg nun Simon Petrus hinauf} nur heißen kann, daß Petrus sich erneut an Bord des Bootes begab.
Damit dürfte die vorhin wiedergegebene Auffassung von Wengst endgültig widerlegt sein. Thyen setzt sich in diesem Zusammenhang (T785) mit Schnackenburg <1527> auseinander, der „hier Peschs literarkritischer Analyse unserer Erzählung“ folgt und zu ähnlich fehlgeleiteten Ergebnissen wie Wengst gelangt:
Sein Interesse gilt darum mehr ihrer vermeintlichen Genese als der Interpretation ihrer überlieferten Gestalt im Kontext unseres Evangeliums. So erklärt er etwa zu V. 9-10: „Die folgende Szene ist vorzeitig in die Fischfanggeschichte eingeblendet; denn in ihr gehen die Männer im Boot sicher nicht vor Petrus an Land. Dem Redaktor lag daran, den reichen Fischfang mit dem Mahl, von dem in dem Erscheinungsbericht erzählt wurde, in Verbindung zu bringen: Einige der soeben gefangenen Fische sollten auch zum Mahl dienen (V. 10). Die entsprechende Aufforderung Jesu stößt sich aber mit der Schilderung des schon auf einem Kohlenfeuer zugerüsteten Mahles“. Schnackenburg bezieht also das anabainein des Petrus nicht darauf, daß der sich wieder an Bord begab, um das dort vertäute Netz an Land zu bringen, sondern auf seinen Gang die Uferböschung hinauf, so daß der unglückselige Kompilator der ihm vermeintlich vorgegebenen Erzählungen den so eilig seinem Herrn zustrebenden Petrus am Ende noch nach den Jüngern im Boot das Ufer erreichen läßt. Wie schon zuvor bei seinem Lauf zum Grabe geriete er also auch hier ins Hintertreffen!
Thyen dagegen besteht darauf, den „überlieferten Text“ auszulegen und unterstellt ihm „bis zum Erweis des Gegenteils … Sinnhaftigkeit und Kohärenz“, zumal „dieser Fischfang ja ein Handeln der Jünger ist, die Jesus zuvor mit dem heiligen Geist begabt und als seine Zeugen in die Welt gesandt hatte.“
Als Petrus nun also „erneut das Boot“ besteigt, „die Vertäuung des Netzes“ löst und „es an Land“ zieht, war es
voller großer Fische, einhundertdreiundfünfzig an der Zahl. Da Johannes hier eine genaue Zahl nennt und nicht wie sonst von ,etwa (hōs) 150‘ spricht, kann man an der symbolischen Bedeutung dieser Zahl schwerlich zweifeln. Augustin sah in ihr eine ,großes Mysterium‘; und seit alters ist die Zahl der Versuche, es zu enträtseln, Legion.
Auch Thyen geht wie Wengst auf die Auslegung von Hesekiel 47 durch Hieronymus ein, demzufolge „griechische Zoologen als die Zahl aller Arten von Fischen 153 angeben“, und verweist darauf, dass
im Hintergrund der Erzählung des Stromes von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu (19,34f) wohl Sacharjas Verheißung der endzeitlich in Jerusalem entspringenden Quelle gegen alle Sünde und Befleckung steht (Sach 12f), … {und} daß diese Sacharja-Kapitel ihrerseits wiederum ein intertextuelles Spiel mit Ez 47 sind. In einer Vision sieht der Prophet da im Eschaton eine Quelle aus dem Tempel Jerusalems entspringen, die zu einem mächtigen Strom anschwillt, das Wasser des Toten Meeres gesund macht und ,zahllosen Fischen‘ Lebensraum bietet: „Und Fischer werden an ihm stehen von En-Gedi (ˁejn gedi) bis En-Eglajim (ˁejn ˁeglajim), es wird eine Stätte sein, wo man die Netze ausbreitet, und Fische werden da sein gleich denen des großen Meeres, zahlreich und über die Maßen“ (Ez 47,91). Nach den Regeln der Gematrie, d. h. der Ersetzung der Ziffern durch die ihnen entsprechenden Buchstaben des Alphabeths (vgl. Apk 13,17f u. d. Komm. z. St.) entspricht nach Emerton <1528> En-Gedi der Zahl 17 und En-Eglajim der Zahl 153. Ähnliche Überlegungen mögen wohl schon Hieronymus bewegt haben.
Schließlich hält Thyen noch Mathias Rissi <1529> für erwähnenswert, der
abgesehen von dem Vorgegebensein der geheimnisvollen Dreieckszahl 153 … alle bisher vorgetragenen Deutungsversuche fur unbefriedigend [hält]. Allein wegen der unübersehbaren Nähe unserer Mahlszene zu Joh 6 sieht auch er in der Grundzahl 17, die den 153 zugrunde liegt, ein Verbindungsglied zwischen den beiden Mahlszenen. Siebzehn sei nämlich die Summe aus den fünf Gerstenbroten und den zwölf Körben voller Brotreste … Schreibt man Punkte in siebzehn Zeilen, beginnend mit einem Punkt in der ersten, zweien in der zweiten usw bis hin zu siebzehn Punkten in der Letzten, so ergibt sich das folgende gleichseitige Dreieck mit insgesamt 153 Punkten: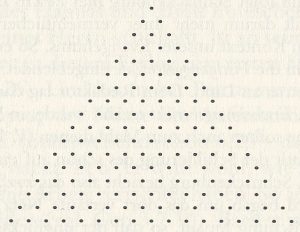
Ton Veerkamp <1430> beschränkt sich in seiner Auslegung der Verse 8 bis 11 auf wenige Sätze, in denen er das von Thyen beschriebene Szenario voraussetzt, dass Petrus bereits vor den anderen Schülern das Ufer erreicht hatte:
Die Schüler folgen und verrichten die schwere Arbeit, den Fang an die Küste zu bringen. Die Schüler kommen mit dem Fisch, Simon ist bereits an Land. Die Schüler gehen vom Boot herunter (apebēsan), Simon geht auf das Boot hinauf (anebē) und er schleppt das Netz, voll mit großen Fischen, 153 an der Zahl. Der Anführer der Fischer vollendet das schwere Werk.
Zur symbolischen Bedeutung der Anzahl der Fische schreibt Veerkamp:
Die Zahl 153 ist bis heute ungeklärt. Johannes hat mit ihr sicher etwas deutlich machen wollen, aber er sagt uns nicht, was. Auch wir kapitulieren vor diesem Rätsel und sind in guter theologischer Gesellschaft.
Allerdings merkt Veerkamp am Rande an (Ann. 572), was Calvin, <1531> „der Augustin verehrte, zu dessen Auslegung dieser Zahl“ schreibt:
„In der Zahl der Fische soll man keinen geheimnisvollen Sinn suchen. Augustin bringt sie zwar sehr scharfsinnig mit Gesetz und Evangelium in Verbindung [ein Gott, der zunächst in den fünf Büchern der Tora spricht, sich dann im Evangelium als dreieiniger Gott offenbart]; bei genauerem Nachdenken jedoch wird man finden, daß das eine kindische Spielerei ist“.
An dieser Stelle verweist nun auch Veerkamp auf eine symbolische Bedeutung dieses Netzes mit den vielen Fischen, das trotzdem nicht zerreißt:
Trotz der Menge hielt das Netz. Es ist wohl kaum einer überbordenden allegorischen Phantasie geschuldet, wenn wir dieses Netz als die große Versammlung (ekklesia) aller Messianisten deuten. Denn diese Erzählung hat zweifellos etwas mit der Vereinheitlichung der messianischen Bewegung unter Simon Petrus nach ihrer Zersplitterung in den Jahren seit der Katastrophe des judäischen Krieges zu tun. Was hier geschieht, die Vereinheitlichung der Messianisten, ist kaum weniger ein Wunder als das, was bei der Ernährung der Fünftausend an der gleichen Stelle geschehen war. Aber vorerst haben wir es hier noch nicht mit Messianisten zu tun, sondern mit galiläischen Fischern.
Nach Veerkamp kann man also nicht von Anfang dieser Erzählung an davon ausgehen, dass sich hier Anhänger Jesu daran machen, der Aussendung ihres Herrn Folge zu leisten. Offenbar will die Erzählung gerade herausstellen, auf welche Weise aus der hinter verschlossenen Türen isolierten und zu ihrem alltäglichen Broterwerb zurückgekehrten Schar der Schüler eine messianische Gemeinde erst entsteht. Dabei mag Johannes durchaus absichtsvoll erzählen, dass am Kohlenfeuer Fisch auf wunderbare Weise bereits vorhanden ist und Jesus dennoch seine Schüler auffordert, Fische aus ihrem Fang herbeizubringen. In der Übernahme alltäglicher Verantwortung füreinander wird sich das Wunder ereignen, dass niemand hungern muss.
↑ Johannes 21,12-13: Jesu Schüler erfahren Jesus als ihren Herrn, indem er sie zum Mahl einlädt und es mit ihnen feiert
21,12 Spricht Jesus zu ihnen:
Kommt und haltet das Mahl!
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen:
Wer bist du?
Denn sie wussten:
Es ist der Herr.
21,13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt‘s ihnen,
desgleichen auch den Fisch.
[21. Februar 2023] In den Augen von Klaus Wengst (W580) ist nun „Simon Petrus wieder in die Szene gekommen“, und der Verfasser knüpft in Vers 12
an die Situation an, in der auf dem Kohlenfeuer Fisch und Brot schon vorgefunden wurden. Nun lädt Jesus zum Mahl ein; er ist der Gastgeber: „Kommt, haltet das Mahl!“ Bevor aber der Vollzug des Mahls erzählt wird, folgt eine Bemerkung über das Verhältnis der Schüler zu demjenigen, der sie hier einlädt. Hatte es vorher geheißen, dass sie „nicht wussten, dass es Jesus war“, so wird jetzt ein solches Wissen festgestellt, aber auf sehr verhaltene Weise: „Keiner aber von den Schülern wagte es, ihn auszufragen: ,Wer bist du?‘ Sie wussten ja, dass es der Herr war.“ Warum sollten sie ihn nach seiner Identität fragen, wenn sie doch wissen, wer er ist?
Zum griechischen Wort exetazein, das gewöhnlich einfach mit „fragen“ übersetzt wird, lässt Wengst (Anm. 17) Bultmann <1532> zu Wort kommen:
„Der Sinn der Frage ist, da sie ihn ja erkannt haben, offenbar der: ,Bist Du es wirklich?‘ Es soll das eigentümliche Gefühl gezeichnet werden, das die Jünger angesichts des Auferstandenen befällt: er ist es, und er ist es doch nicht; es ist nicht der, den sie bis dahin gekannt hatten, und doch ist er es! Eine eigentümliche Scheidewand ist zwischen ihm und ihnen errichtet.“
Wengst selbst gibt daher exetazein mit „ausfragen“ wieder – im Sinne eines Versuches, wissen und beweisen zu wollen, statt sich einzulassen und zu vertrauen:
Es ist wohl von Bedeutung, dass das hier gebrauchte griechische Wort für „fragen“ eine größere Intensität zum Ausdruck bringt, weshalb ich es mit „ausfragen“ übersetzt habe. Wenn trotz Wissens „ausgefragt“, nachgeforscht werden soll, dann geht es darum, des Wissens auch ganz sicher zu sein. So gewinnt die Frage die Bedeutung: Bist du es auch wirklich? Wenn sie es aber nicht wagen, so zu fragen, gibt das dem Ausdruck, dass ein solches Nachforschen unangemessen wäre. Es würde die unverhoffte Gegenwart Jesu dingfest machen wollen. Aber der auferweckte und lebendige Herr lässt nicht über sich verfügen. Er stellt sich ein.
Die Art und Weise, wie sich Jesus nach Vers 13 in der Beziehung zu seinen Schülern einstellt, so dass sie ihn als lebendige Wirklichkeit erfahren können, beschreibt Wengst so:
Er tut es hier als Gastgeber. Er hat zum Mahl geladen und so handelt er nun auch: „Jesus kam, nahm das Brot und gab es ihnen und den Fisch ebenso.“ Mit diesen Formulierungen erinnert der Verfasser an die Speisungsgeschichte und die auf sie bezogene Rede Jesu in Kap. 6. Auch dort gab er Brot und Fisch – und darin doch auch mehr als Brot und Fisch, nämlich sich selbst als „das Brot des Lebens“. Zugleich erinnert der Verfasser die Leser- und Hörerschaft damit an die in ihren Mahlfeiern begangene Eucharistie, in der Jesus als der gegenwärtig anwesende Gastgeber geglaubt wird.
Hartwig Thyen (T786) weist zu Vers 12 zunächst darauf hin, was in ihm nicht gesagt wird:
Davon, daß diese Fische oder ein Teil davon nun noch gebraten worden wären, ist nicht die Rede. Jesus hat den Seinen unabhängig davon das Frühmahl bereits bereitet und lädt nun mit den Worten: deute aristēsate {kommt, haltet das Mahl} dazu ein. Wenn die 153 großen Fische, wie wir überzeugt sind, die Fülle aller potentiellen Glaubenden symbolisieren, zu deren Sammlung Jesus seine Jünger ja gesandt hat, dann sind sie ja auch weniger ein Nahrungsmittel (prosphagion) als vielmehr das Symbol künftiger Mahlteilnehmer. Auf seine Weise sieht Johannes die Jünger also auch zu ,Menschenfischern‘ bestellt. Er bedient sich dazu, wie die folgende Passage zeigen wird, aber lieber der in Kapitel 10 schon eingeführten und durch den Tod des guten Hirten für seine Schafe bereits bewährten Hirtenmetaphorik.
Den zweiten Teil von Vers 12 interpretiert Thyen nicht wie Wengst von der Unverfügbarkeit des hier begegnenden Auferstandenen her, sondern vor dem Hintergrund des Zweifels, der allen innewohnt, die auf Jesus vertrauen wollen:
Wenn der Erzähler der Einladung Jesu zum Mahl jetzt noch den sich scheinbar selbst erübrigenden Satz hinzufügt, daß es keiner der Jünger gewagt habe, Jesus mit der Frage: Wer bist du? zu bedrängen (exetasai), weil sie ja alle wußten, daß es der Herr war, so macht er damit deutlich, daß der Zweifel des Thomas kein spezielles Problem dieses Einen war, sondern daß er in ihnen und in uns allen wohnt und immer erneut der Überwindung bedarf.
Dieser Auslegung von Vers 12b entsprechend ist nach Thyen in Vers 13 nun die Rede von genau
dieser Überwindung durch den gegenwärtigen Herrn …: „Und Jesus trat herzu und nahm das Brot und gab es ihnen und desgleichen auch von dem Fisch“. Ob man daraus freilich wie Rissi <1533> eine spezielle Art der Herrenmahlsfeier in einer johanneischen Gemeinde (!) erschließen darf, bei der nicht Brot und Wein, sondern Brot und Fisch gereicht wurden, und in deren Zentrum nicht der Tod Jesu, sondern seine Auferstehung gestanden habe, darf man sicher bezweifeln. Denn einmal sind wir, wie ja schon öfter gesagt, hinsichtlich der Sonderexistenz jener ,johanneischen Gemeinde‘ äußerst skeptisch, und zum andern spielen ja auch in Rissis Deutung der Zahl 17 gerade die Fische keine Rolle.
Ton Veerkamp <1534> beschäftigt sich in seiner Auslegung von Vers 12 mit der Bedeutung des seltenen Wortes aristan für „essen“. Zwar ist ihm bewusst (Anm. 573), dass, wie Barrett <1535> anmerkt, „das Verb im Spätgriechischen für das erste Mahl am Tag verwendet wird“, und dass auch ein „gängiges Wörterbuch (Gemoll) … bei aristan ‚frühstücken‘“ angibt. Eine derart alltägliche Übersetzung passt aber nicht zu der Szenerie, die hier beschrieben wird:
Jetzt spricht Jesus die Einladung: „Kommt, esst.“ Das merkwürdige Verb aristan kommt bei Johannes zweimal (hier und in V.15) und bei Lukas einmal vor. In der Septuaginta begegnet das Wort viermal. In 1 Könige 13,7 steht es für ssaˁad, „befestigen, bestärken“, in Genesis 43,25 steht es für „Brot essen“. Der befremdende Ausdruck will andeuten, dass es hier um ein ganz besonderes Essen geht.
Noch ein weiteres selten vorkommendes Wort, das bereits in Vers 9 die Situation gekennzeichnet hat, anthrakia {Kohlenfeuer}, gibt dem gemeinsamen Essen mit Jesus sein besonderes Gepräge:
Der Messias steht am Kohlenfeuer. Ein Kohlenfeuer gibt es in den messianischen Schriften nur hier und im Vorhof des Gerichtshofes des Großpriesters, Johannes 18,18. Die beiden Feuer haben etwas miteinander zu tun. …
Alle wissen vom Kohlenfeuer im Hof des Großpriesters. Damals war es unmöglich, sich zum verhafteten Jesus zu bekennen. Simon hat damals auf die Frage, ob er einer von denen war, die zu Jesus gehörten, geantwortet: „Ouk eimi, ich bin es nicht.“ Das war, wie wir sagten, politisch klug. Und dennoch hat dieses Kohlenfeuer Simon an seine Vergangenheit erinnert. Alles war wieder da, die Zeit mit dem Messias Jesus, die Unmöglichkeit, bei ihm zu bleiben und sich zu ihm und den eigenen messianischen Erwartungen zu bekennen.
Insofern spiegelt sich im Verzicht der Schüler auf Fragen an Jesus nach Veerkamp nicht einfach die angemessene Haltung gegenüber dem unverfügbaren Auferstandenen wider, wie Wengst meint. Er beschreibt die Situation stattdessen als „ungemütlich“, was er mit der verzweifelten Lage nach dem Jahr 70 in Verbindung bringt.
Die Schüler sind sich zwar dessen bewusst, dass es sich beim Fremden um den Herrn handelt. Sie wagen es nicht, genau nachzufragen: „Du, wer bist du eigentlich?“ Das Wissen, dass es sich um Jesus handelt, hebt das Fremde an ihm nicht auf. …
Das Schweigen der Schüler beim Essen redet laut: „Wir waren mit dir, wir haben dich verlassen, wir haben dich nicht mehr in Betracht gezogen, (theōrein!), wir sind eben zurück in einer trostlosen Gegenwart ohne eine Spur des Messias.“ Konnten sie jetzt fragen: „Bist du es wirklich? Schön! Nach allem, was in Jerusalem geschehen ist, im Jahr 30, im Jahr 70.“ Wenn einem so etwas durch den Kopf geht, ist man mit Stummheit geschlagen.
Indem Veerkamp diese Hintergründe berücksichtigt, kann er keinen Osterbericht der Evangelien einfach als Urkunde eines fröhlichen Glaubens an die Auferstehung Jesu betrachten, der den Tod überwunden hat, ohne zugleich daran zu denken, dass an Stelle der Überwindung der weltweiten Gewaltordnung diese vielmehr den Tempel Jerusalems für immer zerstört hat und scheinbar für alle Zeiten fest im Sattel sitzt:
Alle Auferstehungserzählungen zeugen von der Hoffnungslosigkeit dieser Menschen nach der Zerstörung Jerusalems. Paulus hatte es leichter, alles war noch möglich, aber jetzt? Jesus gibt als Gastherr das Brot aus, auch die Beilage. Das Essen mit Jesus ist etwas völlig anderes und neues geworden. Nein, es ist kein gewöhnliches Mahl, es ist ein messianisches Mahl, bei dem der Messias selber der Gastherr ist und die Gäste sich zögerlich darauf einlassen.
Wie sollte man sich auch anders als „zögerlich“ auf eine Mahlfeier einlassen, die letzten Endes nichts weniger ist als eine Vorwegnahme des ultimativen Befreiungsfestes Israels inmitten der Völker! Ton Veerkamp beschreibt dieses Passamahl, ohne es so zu nennen, indem er es in Verbindung bringt mit dem, was nach Johannes 6 schon einmal am See Tiberias geschehen ist:
Das Ganze scheint eine Aktualisierung von Johannes 6,5-24 zu sein. Zwischen der Erzählung der Ernährung Israels, 6,5ff., und der Erzählung über das messianische Mahl gibt es die Verbindung der strukturellen Transformation. Das Brot und die Beilage, die mit dem seltenen Wort opsarion angedeutet wird, das nur bei Johannes und nicht in der griechischen Fassung der Schrift vorkommt, verbinden beide Stellen Johannes 6 und Johannes 21. Damals gab es nur zwei Fische, „Was ist das schon für so viele“, fragt Andreas. Hier hätte Andreas, falls er zugegen gewesen wäre, keinen Anlass zu einer solchen Frage gehabt: Sieben Schüler, 153 Fische! Das ist der Kontrast zwischen beiden Erzählungen. Dort, in Johannes 6, trat der Überfluss erst im Nachhinein zutage (zwölf Körbe mit den Brocken der fünf Gerstenbrote), hier herrscht Überfluss von Anfang an. Dort, in 6,11, spricht Jesus das traditionelle Dankgebet der Juden: „Gesegnet seiest Du, unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde hervorsprießen lässt.“ Hier teilt er ohne dieses Gebet aus, weil er selber vom Gott Israels zum „König der Welt“ und zum „Brot des Lebens“ gemacht worden ist.
Damit setzt Jesus aber nicht einen anderen Gott an die Stelle des Gottes Israels, vielmehr verkörpert er dessen befreienden NAMEN, indem im Vertrauen auf ihn in der Praxis seiner agapē die Welt von der Gewaltordnung, die auf ihr lastet, befreit werden und Israel inmitten der Völker in Frieden und Gerechtigkeit leben kann.
↑ Johannes 21,14: Zum dritten Mal lässt sich Jesus von den Schülern öffentlich sehen
21,14 Das ist nun das dritte Mal,
dass sich Jesus den Jüngern offenbarte,
nachdem er von den Toten auferstanden war.
Nach Klaus Wengst (W581) dient Vers 14 dazu, die gerade erzählte „aspektreiche Geschichte“, die „durch die kurze Erwähnung des Schülers, den Jesus liebte, und durch die Herausstellung des Simon Petrus die folgende Szene vorbereitet hat, in den Zusammenhang mit Kap. 20“ einzuordnen: „Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Schülern zeigte, nachdem er von den Toten aufgeweckt worden war.“ Daraus ergeben sich für Wengst mehrere Schlussfolgerungen:
Wenn er diese Erscheinung Jesu vor den Schülern als dritte angibt, zählt er die vor Mirjam aus Magdala nicht mit. Das heißt aber nicht, dass er sie damit abwertet. Vor den Schülern erfolgten nur die beiden in 20,19-29 berichteten Erscheinungen. Das zeigt aber auch, dass bei dem Plural „Schüler“ auf der Erzählebene nicht an eine geschlechtlich gemischte Gruppe gedacht ist.
Auch Hartwig Thyen (786) setzt als selbstverständlich voraus, dass sich das Wort triton in Vers 14 auf die dritte Offenbarung Jesu als Auferstandener vor seinen Jüngern bezieht:
Dieses war bereits das dritte Mal, daß Jesus sich seinen Jüngern offenbarte, nachdem er auferstanden war von den Toten. Daß es zugleich das letzte Mal gewesen wäre ist nicht vorausgesetzt, geschweige denn gesagt. Vielmehr ist damit die lange, bis ans Ende der Weltzeit währende Geschichte seines Kommens zu den Seinen eröffnet. Jetzt ist die Zeit, da die Jünger im Licht seiner Auferstehung erst die ganze Wahrheit seines irdischen Weges begreifen (2,22). Und für alle Leser heißt das, daß sie von diesem Licht erleuchtet mit der erneuten Lektüre des Evangeliums beginnen sollten.
Ton Veerkamp <1536> akzentuiert seine Auslegung von Vers 14 etwas anders, indem er davon ausgeht, dass die Bezeichnung dieser dritten Offenbarung Jesu vor seinen Schülern die ersten beiden Begegnungen mit ihnen erst „zu öffentlichen Ereignissen“ macht:
„Es war das dritte Mal, dass Jesus sich von den Schülern öffentlich sehen ließ.“ Durch die Mahlzeit am Strand wussten die Schüler, dass Jesus der Herr ist. Jetzt wird dieses Bewusstsein eine Angelegenheit für die Öffentlichkeit. Und so werden die beiden Begegnungen zwischen den Schülern und Jesus im geschlossenen Raum ebenfalls zu öffentlichen Ereignissen. Das waren sie zunächst nicht. Sie hatten lediglich dazu geführt, dass die Schüler zu jenem Beruf zurückgehen mussten, aus dem sie der Nachfolgeruf Jesu (1,35-51) zu ihrer messianischen Berufung herausgerufen hatte. Das Geschehen im geschlossenen Raum war folgenlos geblieben. Erst durch die Einmischung des zunächst unerkannten Messias in ihren Beruf konnten sie zu ihrer Berufung zurückfinden. Sie haben ihre Isolierung nicht durchbrochen, sie wurde ihnen durch den Messias aufgebrochen. Wie das geschah, erzählt der nächste Abschnitt.
Ich selbst habe bereits in der Einleitung zur Auslegung dieses Epilogs meine Überzeugung dargelegt, dass Johannes oder der sich kongenial auf ihn beziehende Verfasser des Nachtragskapitels mit dem Wort triton den öffentlichen Auftritt Jesu vor seinen Schülern am See Tiberias bewusst in eine Reihe mit den Zeichen stellt, die beide in Kana stattfanden und einen erzählerischen Rahmen um den Anfangsteil des Evangeliums bildeten, in dem vom Anfang des öffentlichen Wirkens des Messias die Rede war. An dieses öffentliche Wirken kann nach der Zeit der Verborgenheit des Messias und im Zuge seines Aufsteigens zum VATER hier nun wieder angeknüpft werden.
↑ Johannes 21,15-17: Jesus fragt Simon Petrus nach seiner Solidarität bzw. Freundschaft mit ihm und macht ihn zum Hirten der messianischen Gemeinde
21,15 Da sie nun das Mahl gehalten hatten,
spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben?
Er spricht zu ihm:
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Spricht Jesus zu ihm:
Weide meine Lämmer!
21,16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm:
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Er spricht zu ihm:
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Spricht Jesus zu ihm:
Weide meine Schafe!
21,17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm:
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Petrus wurde traurig,
weil er zum dritten Mal zu ihm sagte:
Hast du mich lieb?,
und sprach zu ihm:
Herr, du weißt alle Dinge,
du weißt, dass ich dich lieb habe.
Spricht Jesus zu ihm:
Weide meine Schafe!
[22. Februar 2023] Klaus Wengst (W582) hebt zu Vers 15 hervor, dass der Verfasser über „die abschließende Bemerkung der ersten Szene hinweg“ nicht nur „an die vorher beschriebene Mahlszene“ erinnert, sondern auch an die erste Begegnung Jesu mit Petrus im Evangelium:
„Nachdem sie nun das Mahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus.“ Die Bedeutung der jetzt geschilderten Situation wird schon durch die Anrede hervorgehoben, mit der Jesus diesen Schüler bedenkt: „Simon, Sohn des Johannes.“ So hatte er ihn bei ihrer ersten im Evangelium erzählten Begegnung angeredet, als ihn sein Bruder Andreas heranführte: „Du bist Simon, der Sohn des Johannes“ (1,42). Damit war die Benennung mit „Kephas“ verbunden, aber bezeichnenderweise nicht ekklesiologisch {im Blick auf die Gemeinde} ausgewertet worden. Was dort nicht erfolgte, wird hier – mit Hilfe eines anderen Bildes – geschehen.
Petrus wird also zwar nicht wie bei Matthäus als der Fels beschrieben, auf den Jesus seine Gemeinde aufbaut, sondern mit dem Hirtenamt betraut werden, doch
zuvor muss sich Simon Petrus noch eine Frage gefallen lassen: „Liebst du mich mehr als diese?“ Auffällig ist die vergleichende Fragestellung, ob er Jesus mehr liebe, als die anderen Schüler es tun, die hier zum letzten Mal im Blick sind. Sie könnte dadurch veranlasst sein, dass nach Mt 26,33 (vgl. Mk 14,29) Petrus selbst, bevor ihm Jesus die Verleugnung ankündigte, sich von den anderen abgesetzt hatte: „Wenn alle von dir abfallen sollten, ich jedenfalls werde nie und nimmer abfallen.“
In die gleiche Richtung ging auch die Aussage des Petrus (Anm. 18) in Johannes 13,37: „Mein Leben will ich für dich einsetzen.“
Daraufhin würde er jetzt angesprochen, sodass hier schon der Bezug auf die Verleugnung deutlich wäre. Die Antwort Simons lässt den Vergleich weg; er hat die Anspielung verstanden und betont lediglich seine Liebe zu Jesus als dessen Wissen: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.“ Jesus beantwortet diese Aussage seinerseits mit einem Auftrag: „Weide meine Schafe!“ Was in der Benennung des Simon als „Fels“ enthalten ist und was in Mt 16,18 ausgeführt, aber von Johannes in 1,42 vermieden wird, das findet sich hier nun im Bild vom Hirten. Wenn Simon Petrus Jesu Schafe weiden soll, heißt das, dass dieser eine Schüler damit beauftragt wird, seine gesamte Gemeinde zu leiten.
Neu (Anm. 19) ist dieses „Hirtenbild“ nicht; es findet sich auf
das Volk Israel bezogen… schon in der jüdischen Bibel: „Du führtest wie Schafe Dein Volk durch die Hand Moses und Aarons“ (Ps 77,21). „Da erwählte er David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Schafhürden weg; von den Mutterschafen weg ließ er ihn kommen, Jakob zu weiden, sein Volk, und Israel, sein Erbe. Da weidete er sie mit lauterem Herzen und leitete sie mit geschickten Händen“ (Ps 78,70-72). Beide Stellen sind aufgenommen in der Auslegung von Ex 3,1 in ShemR 2,3: <1537> „Der Heilige, gesegnet er, sprach zu ihm (David): ,Du bist treu erfunden worden über die Schafe (im wörtlichen Sinn): komm und hüte meine Schafe (= Israel)!‘“ Das wird mit Ps 78,71 begründet. Im Blick auf das entsprechende Handeln des Mose heißt es anschließend: „Da nahm ihn der Heilige, gesegnet er, dass er Israel hüte.“ Das wird mit Ps 77,21 begründet.
Nach Wengst (W582f.) ist die Beauftragung des Petrus mit der Gemeindeleitung
eine für das Johannesevangelium erstaunliche Hervorhebung. Von der Darstellung dieses Schülers in Kap. 1-20 her, wo er immer wieder in die Gemeinschaft der Schüler eingeordnet und dem Schüler, den Jesus liebte, nachgeordnet und gerade nicht herausgehoben wurde, ist sie nicht zu erwarten. Sie ist auch nicht zu erwarten von Kap. 10 her, wo Jesus selbst als Hirte seiner Schafe dargestellt ist. In den Abschiedsreden hatte er für die Zeit nach seinem Tod die Geisteskraft als Beistand angekündigt, die ihn wiederholt im Zeugnis seiner Schüler. Dass sich diese Geisteskraft sozusagen in einer Person in solcher Weise konzentriert, dass ihr allein Leitungsfunktion zukomme und sie so Stellvertreter Jesu werde, ist durch nichts vorbereitet.
Darin sieht Wengst (W583) „die in V. 24f. gemachte Selbstaussage des Textes“ bestätigt, „dass der Nachtrag von anderer Hand geschrieben ist als die Kapitel 1 bis 20.“ Er fragt sich jedoch, „warum … hier von Simon Petrus in dieser anderen Weise geredet“ wird. Warum wird eine Tradition, derzufolge „das Hirtenbild die Ausbildung des gemeindeleitenden Amtes widerspiegelt“ wie in „Eph 4,11; Apg 20,28; 1Petr 5,1-4“, die jedoch „der johanneischen fremd ist…, hier aufgenommen und so pointiert herausgestellt?“ Darauf will Wengst erst später eingehen,
wenn nach der Besprechung dieser zweiten Szene abschließend nach der Funktion der hier vorgenommenen Gegenüberstellung von Simon Petrus und dem Schüler, den Jesus liebte, gefragt wird.
In Vers 16 wiederholt sich der „gerade erzählte Ablauf“, nur dass nach „der ersten Antwort … jetzt in der Frage der vergleichende Blick auf die anderen Schüler entfallen“ kann. Am Ende steht Jesu Auftrag an Petrus: „Hüte meine Herde!“ Nur am Rande geht Wengst (Anm. 21) auf die Verwendung unterschiedlicher Vokabeln im griechischen Text ein:
In den Verben variiert der griechische Text zwischen bóskein („weiden“: V. 15.17) und poímaínein („hüten“: V. 16). Philon unterscheidet zwischen beiden Verben so, dass er mit dem ersten die Gabe von Nahrung, mit dem zweiten Herrschafts- und Leitungsmacht verbindet (Det 25). In Joh 21,15-17 liegt wohl nur eine stilistische Variation vor. Denn auch das Objekt ist mit zwei Synonymen ausgedrückt und Verb und Objekt werden in jeder möglichen Kombination miteinander verbunden. arníon kann außer „Schaf“ auch „Lamm“ und „Widder“ bedeuten. Aber dass ein Hirte nur zum Hüten von Lämmern oder Widdern aufgefordert würde, ist nicht gerade wahrscheinlich. próbata bezeichnet allgemein „Kleinvieh“ (Schafe und Ziegen). Aber „Hüte mein Kleinvieh!“ oder „Hüte meine Ziegen!“ sind keine möglichen deutschen Übersetzungen, da es ja hier um das Mitschwingen der metaphorischen Dimension geht. Um variieren zu können, habe ich deshalb hilfsweise mit „Herde“ übersetzt.
In Vers 17 wird dann (W583) „[d]erselbe Ablauf … noch ein drittes Mal geboten. Noch einmal fragt Jesus: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?“ Und wieder verweist Wengst nur in einer Anmerkung (22) darauf, dass auch „bei dem hier durchgängig mit ‚lieben‘ wiedergegebenen Wort … der griechische Text“ variiert:
In den ersten beiden Fragen Jesu bietet er agapán, in den Antworten Simons phileín. Die Synonymität beider zeigt sich daran, dass in der dritten Frage Jesu auch phileín steht. Beide Verben werden auch im übrigen Johannesevangelium synonym gebraucht.
Nach der zum dritten Mal gestellten Frage Jesu (W583f.)
unterbricht eine Bemerkung über das Empfinden des Schülers die Gleichförmigkeit der Struktur: „Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sprach: ,Liebst du mich?‘“ Spätestens hier muss sich die Leser- und Hörerschaft an dessen dreimalige Verleugnung erinnert sein lassen, auf die ja schon das „Kohlenfeuer“ in V. 9 zurückgewiesen hat. Der dreimaligen Verleugnung entspricht die dreimalige Beteuerung der Liebe, die nun beim dritten Mal variiert wird: „Herr, du weißt alles; du weißt doch auch, dass ich dich liebe.“ Und noch einmal gibt Jesus den Auftrag: „Weide meine Herde!“
In diesem Zusammenhang wehrt Wengst die Argumentation ab (Anm. 23), dass „Joh 1-20 nicht als eine abgeschlossene Einheit gelten könne, weil dann die Rehabilitation des Petrus noch ausstünde“, da auch „die synoptischen Evangelien nichts“ von „einer Rehabilitation des Petrus erzählen“. „Dessen dort berichtete Reue (Mk 14,72; Mt 26,75; Lk 22,62) ist keine Entsprechung zu Joh 21,15-17.“
Nach Hartwig Thyen (T787) ist das Gespräch Jesu mit Petrus vor dem Hintergrund eines Prätextes im Lukasevangelium auszulegen:
Es sieht so aus, als wolle Johannes hier erzählen, was bei Lukas als die Zukunft des Petrus nur angekündigt wird. In Lk 22,31-34 heißt es nämlich: „Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch ausgebeten, daß er euch siebe wie den Weizen. Ich aber habe für dich darum gebetet, daß dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst umkehrst, dann sollst du deine Brüder stärken. Der aber entgegnete ihm: Herr, als dein Gefährte bin ich bereit auch in die Gefangenschaft, ja selbst in den Tod zu gehen. Doch Jesus sagte: Ich sage dir, Petrus, kein Hahn wird heute krähen, ehe du nicht drei Mal geleugnet hast, mich zu kennen“. Von diesem ,Dermaleinst‘ der Umkehr, oder vielleicht besser: der ,Umkehrung‘ des Petrus durch seinen auferstandenen Herrn, erzählt uns Johannes hier. Begonnen hatte bei Petrus diese Umkehr, als er im Boot seine Nacktheit wahrnahm und sich schämte, wie einst Adam; als er sein Obergewand anlegte und sich über das Wasser hinweg auf den Weg zu seinem Herrn machte und dann mit ihm das Mahl teilen durfte. Doch Krisis und Klimax {Entscheidung und Höhepunkt} seiner Umkehr stehen ihm in dem intimen Vier-Augen-Gespräch mit Jesus nach der gemeinsamen Frühmahlzeit noch bevor.
In seiner Besprechung der ersten Frage Jesu an Petrus in Vers 15: „Simon, des Johannes (Sohn), hast du mich lieber als diese (anderen)?“ ergänzt Thyen, dass er „in dieser Passage ein intertextuelles Spiel mit Mt 16,13ff“ sieht:
Als Jesus diesen Jünger zum ersten Mal erblickt hatte, das hatte er zu ihm gesagt: „Du bist Simon, der Sohn des Johannes, fortan sollst du Kephas heißen!“ Der Erzähler fügte dem sogleich hinzu, daß Kephas auf griechisch der Felsen, Petrus, heißt (1,42). … Als Antwort auf des Petrus Bekenntnis in Caesarea-Philippi hatte Jesus ihn dort mit den folgenden Worten seliggepriesen: „Selig bist du, Simon, Sohn des Jona …“. Anders als Matthäus, der Jesus den Andreasbruder mit Simon Bariōna anreden läßt, also mit der griechischen Transskription von dessen aramäischem Vaternamen: Sohn des Jona, läßt unser Evangelist ihn Jesus als den Sohn des Johannes (1,42) oder wie hier verkürzt als den des Johannes anreden. Daß er damit den weithin unbekannten Namen Jona durch den (zumal ja ihm!) geläufigeren Namen Johannes ersetzt, läßt sich wohl nur mit seiner dichterischen Freiheit begründen. Denn daß ihm für die Genealogie des Petrus eine andere oder gar bessere Quelle als Matthäus vorgelegen hätte, darf man bei dieser geringen Variation des Vaternamens eines Mannes, von dessen Abstammung wir ohnehin nichts Verbürgtes wissen, schwerlich postulieren.
Die „Frage Jesu, ob Petrus ihn mehr liebe als die anderen“, soll nach Thyen gewiss
die Erinnerung des Gefragten wachrufen und an sein Gewissen rühren. Denn natürlich wollte Petrus das gerne (und wer wollte das nicht?): Sich in seiner Liebe zu seinem Herrn von niemandem übertreffen lassen. In diesem Sinne hatte er Jesus beim letzten Abendmahl gefragt: „Herr, warum sollte ich dir denn jetzt nicht nachfolgen können?“, um ihm im gleichen Atemzug dann zu versichern: „Ich will sogar mein Leben für dich einsetzen!“ (13,37; vgl. Mk 14,29 / Mt 26,33). Aber als dann im Hof des Hannas-Palastes der Hahn krähte, war alles ganz anders verlaufen. Obwohl er inzwischen gehört hatte, daß niemand größere Liebe habe als der, der sein Leben für seine Freunde hingebe (15,13), fürchtete er seinen eigenen Tod mehr als den seines Herrn und verleugnete ihn gleich dreifach (18,15ff).
Diese Tat des Petrus bezeichnet Thyen (T788) als „Verrat“, der „jetzt bereinigt werden“ muss. Hier führt Jesus
mit Petrus auch allen folgenden Lesern des Evangeliums authentisch vor, was es mit dem Amt der Schlüssel (Mt 16,19) auf sich hat, und wie die ja nicht allein dem Petrus, sondern allen Jüngern verliehene Vollmacht, Sünden zu vergeben oder aber den Sünder bei ihnen zu behaften (20,23; vgl. Mt 18,18), wahrgenommen sein will. Damit die Liebe die Menge der Sünden zudecken kann (1Pt 4,8), müssen die aber erst erinnert und aufgedeckt werden.
Im Zusammenhang mit dem hier konkret durchgeführten „Verfahren“, das Steiger <1538> [53ff.] „den ,Rückweg‘“ nennt, stellt Thyen die Frage, ob man wie Steiger [55f.] „bei dem dreifachen Hirtenauftrag zwischen den arnia als den schwachen und hilflosen Lämmern, die Petrus durchaus mehr lieben darf, und den erwachsenen probata unterscheiden soll“.
Fragen kann man auch, ob das Wechselspiel von agapan und philein semantische Nuancen im Auge hat, oder ob unser Erzähler hier, wie auch sonst oft, lediglich mit Synonyma spielt. So oder so zeigt jedenfalls der wechselnde Gebrauch von agapan und philein, daß hier himmlische und irdische Liebe nicht voneinander getrennt werden können. Hier gilt vielmehr: Wer behauptet, er liebe Gott, seinen Bruder aber haßt, der ist ein Lügner (1Joh 4,20…).
Wenn Thyen damit andeuten will, dass agapan mehr eine „himmlische“, philein dagegen eine „irdische Liebe“ bezeichnen soll, dieser Unterschied andererseits aber gar keine Rolle spielt, bleiben in dieser Hinsicht mehr Fragen offen als geklärt.
Zum „dreifachen Hirtenauftrag Jesu an Petrus“ betont Thyen weiter, dass es dabei
weder um einen Primat des Petrus noch um die Installation eines besonderen ‚Petrusamtes‘ [geht], sondern um die Suche des ,guten Hirten‘ nach seinem ,verlorenen Schaf‘, um Jesu liebevolle Kur an seinem Verleugner, um dessen Rehabilitation und Bevollmächtigung zu wahrer ,Nachfolge‘ an den Ort, wohin sein Herr ihm vorausgegangen ist. Die Wiederaufnahme des Namens Simon, (Sohn) des Johannes, aus 1,42 zeigt zudem, daß dieser Simon nach seinem tiefen Fall hier wieder erhöht und wieder geboren werden soll als Petrus, der Felsenmann.
Unter Bezug auf Lévinas <1539> fügt Thyen hinzu, dass es zum Heilwerden des Petrus auch gehört,
daß er hier lernen muß, allein auf seinen eigenen ihm bestimmten Weg zu sehen und darüber das dem Eigenen niemals assimilierbare Anderssein des Anderen zu respektieren (V. 22). Denn Hirte und damit in der ursprünglichen Bestimmung des Menschen als ,Hüter seines Bruders‘ (Gen 4,9) ist allein, „wer als Leibbürge für ihn eintritt. Hierin besteht die Unmittelbarkeit. Die Verantwortlichkeit rührt nicht von der Brüderlichkeit her, sondern die Brüderlichkeit ist der Name für die Verantwortlichkeit für den Anderen, die jenseits meiner Freiheit liegt“.
Energisch wendet sich Thyen „angesichts unserer Szene“ dagegen,
das literarische Gegenüber von Petrus und dem geliebten Jünger … als Spiegel einer extratextualen Auseinandersetzung zwischen einer johanneischen Kirche und dem Petrinismus oder gar der Großkirche aus[zu]schlachten, wie das vielfach geschieht. Die sogenannte johanneische Gemeinde, die vom Rest des übrigen Urchristentums isoliert als Sekte existiert haben soll, erscheint uns ebenso als ein Phantasma der modernen Kritik, wie die Rede von der Großkirche im Blick auf unser Evangelium und seine Zeit ein grober Anachronismus ist.
Auch findet Thyen (T589) „in unserem Evangelium … nicht die geringste Spur irgendeines ,Antipetrinismus‘, wie das neuerdings vielfach behauptet wird.“ <1540> Stattdessen ist ihm zufolge
im Anschluß an das Petrusbekenntnis (Joh 6,68) die synoptische Schelte des Petrus als Satan kaum zufällig ausgelassen und auf Judas übertragen (6,70f). Denn nicht ein vorsätzlich geschwächter, sondern nur ein starker Petrus, der in den Fußstapfen seines Herrn als ein guter Hirte für dessen Schafe sterben wird, kann der Autorisierung des anonymen Jüngers und seines Werkes erfolgreich dienen. Das hatte schon Overbeck <1541> sehr klar gesehen: „Ganz im Gegenteil ist die Höhe des Petrus der Fußsockel für die des Johannes“. Nirgendwo geht es um einen Rangstreit zwischen Petrus und dem geliebten Jünger oder um die ,Ablösung‘ des Einen durch den Anderen, sondern stets um deren jeweils besondere Bestimmung. In hierarchischen Kategorien ist unser Evangelium der Brüderlichkeit nicht zu begreifen.
Zurück zu Thyens Auslegung von Vers 15:
Auf Jesu komparative Frage, ob er ihn lieber habe als die anderen Jünger, geht Petrus gar nicht ein. Er ist wohl schon unterwegs ,älter‘ zu werden und zu begreifen, daß sein kindisches Mehr-Lieben-Wollen im Grunde ein Weniger war, und daß es nicht einfach ist liebzuhaben, weil einer immer lieber haben will [Steiger 55]. So antwortet er denn auch: Ja Herr, du weißt doch genau, daß ich dich liebhabe.
Auf Vers 16 geht Thyen mit einer Wiedergabe seines Inhalts ein, indem er auf einzelne Unterschiede zu Vers 15 hinweist:
Doch wieder, und nun schon zum zweiten Male (palin deuteron), fragt Jesus ihn – nun ohne jenen peinlichen und durch die Antwort des Gefragten ja obsolet gewordenen Komparativ lieber (als die anderen Jünger) -: Simon Johannessohn, hast du mich lieb? (agapas me). Und wieder antwortet der mit den gleichen Worten: Ja, Herr, du weißt doch, daß ich dich liebe (hoti philō se). Beim Abschied hatte Jesus seinen Jüngern versichert, daß sie seine Freunde (philoi) seien, wenn sie täten, was er ihnen geboten habe (15,14). Petrus weiß natürlich, daß er diese Bedingung nicht erfüllt hat, dennoch möchte er Jesu Freund bleiben und erklärt ihm seine Liebe.
Da jedoch „der ,Rückweg‘ (Steiger) … noch nicht zuende gegangen“ ist, muss Petrus sich in Vers 17 noch ein drittes Mal (T789f.)
fragen lassen: Simon, Johannessohn, hast du mich lieb (anstelle von agapas me sagt jetzt auch Jesus: phileis me). Dazu merkt der Erzähler ausdrücklich und unter Wiederholung dieses to triton an: „Da wurde Petrus traurig (elypēthē), weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich?“ Diese Anmerkung signalisiert, daß Petrus traurig wurde, weil ihn dieses ,dritte Mal‘ an seine Tränen beim Hahnenschrei im Palasthof des Hohenpriesters erinnern mußte: „Und er ging hinaus und weinte bitterlich“ (eklausen pikrōs: Mt 26,75). Wieder setzt der Erzähler dabei voraus, daß seine Zuhörer/Leser diesen Prätext kennen.
Die Antwort des Petrus legt Thyen (T790) vor dem Hintergrund des Petrusbekenntnisses von Johannes 6,68-69 aus:
In seiner so wieder heraufbeschworenen Traurigkeit antwortet Petrus auf diese dritte Frage nach seiner Liebe nicht mehr allein: Herr, du weißt doch, daß ich dich liebe, sondern zunächst: Herr, du weißt doch alles! Das emphatische panta sy oidas {du weißt alles} bringt zum Ausdruck, daß Petrus sich trotz seines Versagens in dem Wissen seines Herrn um seine Liebe zu ihm geborgen weiß. Erst danach fährt er sinngemäß fort: Darum mußt du ja auch um meine Liebe zu dir wissen … Es scheint so, als habe Petrus mit dieser Erkenntnis des Allwissens Jesu endlich sein vormaliges Bekenntnis am See wieder eingeholt, als er stellvertretend für seine Mitjünger bekannt hatte: „Wir haben geglaubt und erkannt, daß du der Heilige Gottes bist!“
Ton Veerkamp <1542> hält im Gegensatz zu Wengst und Thyen das Problem für sehr viel wesentlicher, dass im „Fragegespräch zwischen Jesus und Simon Petrus … für zwei Vorgänge jeweils zwei Synonyme“ verwendet werden. Daher stelle ich seiner Auslegung zunächst seine Übersetzung voran:
21,15 Als sie nun gegessen hatten,
sagt Jesus zu Simon Petrus:
„Simon, Sohn des Johannes,
bist du mir solidarisch verbunden, mehr als die anderen?“
Er sagt zu ihm:
„Ja, HERR,
du weißt, dass ich dir in Freundschaft verbunden bin.“
Er sagt zu ihm:
„Hüte meine Lämmer!“
21,16 Sagt er wieder zu ihm, zum zweiten Mal:
„Simon, Sohn des Johannes, bist du mir solidarisch verbunden?“
Er sagt zu ihm:
„Ja, HERR,
du weißt, daß ich dir in Freundschaft verbunden bin.“
Er sagt zu ihm:
„Sei Hirte meiner Schafe!“
21,17 Er sagt zu ihm, zum dritten Mal:
„Simon, Sohn des Johannes, bist du mir wie einem Freund verbunden?“
Es schmerzte Petrus, dass er ihm zum dritten Mal gesagt hatte:
„Bist du mir in Freundschaft verbunden?“
Er sagte zu ihm:
„HERR, alles weißt du.
Du erkennst doch, dass ich dir in Freundschaft verbunden bin!“
Er sagt zu ihm:
„Hüte meine Schafe!
In seiner Johannes-Auslegung von 2007 schreibt Veerkamp zu einem ersten Paar meist als gleichbedeutend angesehener Verben recht knapp:
Für das, was unsere Übersetzungen „lieben“ nennen, hat Johannes agapan und philein. Ersteres haben wir mit „solidarisch (verbunden) sein mit“ und das zweite mit „befreundet sein mit“ übersetzt. Das zweite Verb hat einen stärkeren emotionalen Wert als das erste.
In seiner Anm. 575 zur Übersetzung von Johannes 21,15 äußert sich Veerkamp sehr viel präziser zum Unterschied zweier hier angesprochener Gestalten von „Liebe“:
Jesus fragt nach der agapē des Simon, dieser antwortet mit philō, „ich bin dir in Freundschaft verbunden“. Agapan zielt auf eine Verbundenheit mit einer Person der gemeinsamen Sache wegen, daher „Solidarität“; philein dagegen zielt auf eine Beziehung von Person zu Person. Jesus erteilt Simon einen sachlichen Auftrag, er solle „Hirt werden“, also eine politische Leitungsfunktion übernehmen; was das beinhaltet, wissen wir aus dem Kapitel 10,1ff. Zweimal fragt Jesus nach Solidarität, zweimal wird die Frage missverstanden, wohl aufgrund der dreifachen Verleugnung. Das dritte Mal nimmt Jesus das Persönliche auf, um es in die sachliche Sphäre des Auftrags umzusetzen. Es geht hier nicht um Stilfragen, weil es in diesen Texten nicht um „lebhaften“ Stil, sondern um genaues Zuhören geht. Jede Beziehung zum Messias ist an der Erfüllung des messianischen Auftrages zu messen. Mit irgendeiner „Liebe zu Jesus“ wäre der Sache nicht gedient. Deswegen übersetzen wir, die Unterschiede berücksichtigend, betont spröde.
Außerdem geht Veerkamp ausführlich auf zwei weitere Wortpaare mit jeweils recht ähnlicher Bedeutung ein:
Das zweite Paar Synonyme lautet boskein und poimainein. Beide Verben bedeuten „das menschliche Führen einer Herde von Tieren“. Bei den Synoptikern kommt boskein nur als „Schweine hüten“ vor, Markus 5,11.14 par. und Lukas 15,15. Poimainein kommt in den messianischen Schriften elfmal vor. Nur in zwei Fällen hat das Wort eine viehwirtschaftliche Bedeutung, Lukas 17,7 und 1 Korinther 9,7. Sonst hat es eine politische Bedeutung; es bedeutet das Führen eines Volkes, der Gemeinde Gottes, der Völker (im Buch der Offenbarung immer).
Schließlich gibt es zwei verschiedene Bezeichnungen für die Tiere der Herde, arnia (Lämmer) und probata (Schafe). Den Plural arnia gibt es in den messianischen Schriften nur einmal, in Johannes 21,15. Den Singular arnion gibt es nur im Buch der Offenbarung, dort aber gleich 28mal. Es ist das Hauptwort dieses Buches: das geschlachtete Lamm ist der siegreiche Messias. Die Schafe (probata) sind, wie wir aus dem Gleichnis vom Guten Hirten wissen, die Mitglieder des Volkes Israel. In der Septuaginta kommen arnia und probata sozusagen in einem Atemzug vor: „Als Israel aus Ägypten zog …, hüpften die Berge wie Widder, die Hügel wie die Jungen der Schafe (arnia probatōn)“, Psalm 114,4.6 (LXX Psalm 113).
Zur genaueren Analyse der Verse 21,15-18 sei ihre Struktur noch einmal so zusammengestellt, „dass Frage, Antwort, Auftrag und Herde jeweils in einer Zeile untereinander geschrieben werden“:
1) Bist du mit mir solidarisch mehr als die anderen?
Ich bin dein Freund.
Hüte
die Lämmer.2) Bist du mit mir solidarisch?
Ich bin dein Freund.
Sei Hirte
der Schafe.3) Bist du mein Freund?
Ich bin dein Freund.
Hüte
die Schafe.
Veerkamp schlägt vor, „das Rätsel von hinten“ aufzurollen, also von der Frage her, wer mit den Lämmern und den Schafen gemeint sein könnte. Er bezieht die Lämmer auf die neu zur größeren von Petrus geleiteten und repräsentierten messianischen Bewegung hinzukommende johanneische Gruppierung und setzt den Unterschied von Lämmern und Schafen zusätzlich in Beziehung zu den anderen unterschiedlich verwendeten Worten:
Die Lämmer (arnia) sind die jungen Schafe (probata). Es geht also um das Verhältnis zwischen den jungen Tieren der Herde und den alten. Simon Petrus muss beide Gruppen hüten und führen. „Hüten“ und „Hirte sein“ sind zwei verschiedene Sachen, „Lämmer“ und „Schafe“ zwei verschiedenartige Herdetiere. Da es sich in unserem Fragment um das Zusammenführen der Gruppe um Johannes mit der messianischen Bewegung unter Simon Petrus handelt, muss die jeweils zweifache Andeutung der Führungsaktivität mit dem Zusammenbringen zweier verschiedener Gruppierungen zu tun haben.
Die Eignung zum Führungsamt wird mit einem sehr bestimmten Verhältnis zum Messias Jesus verbunden, solidarisch und freundschaftlich verbunden sein mit dem Messias, und zwar – in der ersten Frage – „mehr als die anderen“. Simon beantwortet die Frage, indem er das „solidarisch sein“ durch das emotional stärkere „befreundet sein“ ersetzt. Damit reagiert er auf das „mehr als die anderen“. Zum Amt der Führung qualifiziert nur das Mehr an Solidarität mit dem Messias. Der Auftrag lautet dann: „Hüte meine Lämmer“, halte die Gruppe mit den neu hinzugekommenen Messianisten zusammen. Es geht um das Verhältnis Simons zu Jesus. Die Haltung der Schüler Jesus gegenüber muss eine solidarische sein, sie müssen sich eins mit der Lebensaufgabe des Messias wissen. Der aber, dem das Führungsamt übertragen wird, muss sich mehr als die anderen eins mit dem Messias wissen.
Jesus wiederholt die Frage, diesmal ohne den Zusatz: „mehr als die anderen?“ Simon wiederholt seine Antwort. Diesmal wird ihm das Hirtenamt aufgetragen. Aus Johannes 10 wissen wir, was „Hirte sein“ bedeutet. Er muss die Herde nicht nur zusammenhalten (hüten), sondern als Hirte vorangehen, die Richtung weisen, sich „mit seiner Seele“ (psychēn) für die Schafe einsetzen, wie der Messias (10,11). Simon Petrus hatte am Abend der Fußwaschung gesagt: „Meine Seele werde ich für dich einsetzen“ (13,37). Damals stand das nicht zur Debatte. Zunächst muss Simon den Messias verleugnen, muss, sagen wir, weil ihm im Vorhof des Großpriesters keine andere Wahl bleibt. Diesmal muss er der Hirte sein, und das heißt: seine Seele einsetzen.
In seiner Anm. 576 zur Übersetzung von Johannes 21,16 ergänzt Veerkamp seine Ausführungen zum Wort poimainein, das in Vers 16 im Unterschied zum Verb boskein in den Versen 15 und 17 verwendet wird:
beide stehen für die Wurzel raˁa. Johannes hat einen Grund, hier zu variieren. Boskein zielt auf den Inhalt des Auftrags, „hüten, weiden“, poimainein dagegen auf die Funktion dessen, der hütet, „Hirt sein“. Der Hirte muss hüten, aber das Hüten kann nur geschehen, wenn ein Hirte da ist. Petrus muss jetzt die ganze Herde, alle messianischen Gruppen, hüten, die kleine Gruppe um Johannes in die ganze Bewegung hineinführen, und die Gruppe muss Petrus als Hirten anerkennen.
Schließlich erwägt Veerkamp eine besondere Idee, warum Jesus in der dritten Frage mit dem Verb philein die von Petrus durchwegs betonte Freundschaft aufnimmt:
Jetzt muss er, mit der besonderen Bindung zum Messias, die ganze Herde zusammenhalten. Auch die, die lange in der Isolierung ein eigenes Leben führten, die Gruppe im Raum mit den geschlossenen Türen.
Er muss jetzt dreimal gefragt werden, so eindringlich, dass es schmerzt. Als Simon einer der Schüler war, musste er dreimal leugnen, dass er zum Messias gehörte. Jetzt muss er sich dreimal bekennen als solidarischer Freund des Messias. Dreimal wird ihm das Führungsamt aufgetragen. Erst danach kann Simon das tun, was er zunächst wollte: nachfolgen, seine Seele für Jesus einsetzen, 13,37.
Ich halte es durchaus erwägenswert, die „Verwendung des dreifachen Synonympaares agapan/philein, boskein/poimainein und arnia/probata“ in dieser Weise äußerst differenziert einerseits auf „das Streben nach Einheit in der messianischen Bewegung“ zu beziehen und andererseits auf „die Wahrung der Identität der Gruppe, die nicht zum messianischen Mainstream gehört, sondern auf eigenen Wegen dem Messias folgt.“ Dabei ist hervorzuheben, dass Veerkamp noch keine einheitliche Großkirche voraussetzt, sondern eine ganze Reihe jüdisch-messianischer Gruppierungen, die auf den Messias Jesus vertrauen; trotzdem setzen sowohl Paulus als auch die synoptischen Evangelien in gewisser Weise eine führende Rolle des Petrus für die Gesamtbewegung voraus.
↑ Johannes 21,18-19a: Der Lebensgang des Petrus, der sich früher selbst gegürtet hat, wird verändert durch den, der ihn gürtet
21,18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Als du jünger warst,
gürtetest du dich selbst
und gingst, wo du hinwolltest;
wenn du aber alt bist,
wirst du deine Hände ausstrecken
und ein anderer wird dich gürten
und führen, wo du nicht hinwillst.
21,19a Das sagte er aber, um anzuzeigen,
mit welchem Tod er Gott preisen würde.
Ein letztes Mal (W584) leitet Jesus in Vers 18 ein Wort feierlich „mit dem doppelten Amen“ ein, nämlich seine
Ankündigung für Simon Petrus …: „Amen, amen ich sage dir: Solange du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst.“
Nach Klaus Wengst hat diese Aussage über das „Gürten“, womit „das Hochbinden des langen Gewandes“ gemeint ist, „um beim Gehen richtig ausschreiten zu können“, zwar „zwei Blickrichtungen, zunächst die vom Standpunkt des Alters in die jüngere Lebenszeit“, in der „Petrus … gemäß seinem eigenen Willen gegangen“ ist, aber ihm zufolge bildet
das in dieser Blickrichtung Gesagte … nur die gegenteilige Folie für die dann in anderer Blickrichtung – aufs Alter hin – gemachte Ankündigung. Aus dem Folgenden ergibt sich, dass Jesus hier Petrus das Martyrium ansagt. Danach soll die jetzige Aussage anzeigen, „durch welchen Tod“ er sterben werde. Das kann nicht nur allgemein irgendeinen gewaltsamen Tod, sondern muss einen bestimmten Tod meinen, der auch klar genug angedeutet wird. Dass Petrus seine Hände ausstrecken wird, weist auf seine Kreuzigung hin.
Zur Begründung dafür verweist Wengst auf eine ganze Reihe von Belegstellen:
Vom Ausstrecken der Hände im Zusammenhang mit der Kreuzigung ist schon bei Plautus, Miles gloriosus II 4,7f. die Rede. Dort bekommt jemand gesagt: „Du mußt demnächst in dieser Positur vor dem Stadttor sterben mit ausgestreckten Armen, da du den Kreuzesbalken halten wirst“. <1543> Aus dieser und einer weiteren Stelle hat Bauer die Reihenfolge von ausstrecken, „gürten“ (= fesseln) und hinbringen so erklärt, „daß der Delinquent das patibulum mit daran ausgebreiteten und angefesselten Armen zum Richtplatz hinaustragen mußte“. Epiktet polemisiert in Dissertationes III 26,22 gegen jemanden, der befürchtet, dass er keine Sklaven habe, die ihm folgen, „damit du im Bad, wenn du dich ausgezogen und dich ausgestreckt hast wie die Gekreuzigten, von beiden Seiten abgerieben wirst“. Artemidor sagt im Traumbuch I 76 über einen Verbrecher, der träumt zu tanzen: Er „wird gekreuzigt werden: wegen der Höhe und wegen des Ausstreckens der Hände“. Nach Barn 12,2 sollte Mose in Ex 17,8-13 „ein Vorbild des Kreuzes“ herstellen: „Mose legte nun mitten im Handgemenge einen Schild auf den anderen, trat darauf, sodass er alle überragte und streckte die Hände aus.“
Außerdem darf man nach Wengst (W585)
mit Schnackenburg <1544> bei der folgenden Aussage „einen übertragenen Sinn von ,gürten‘ = fesseln vermuten“. Wenn schließlich vom Gang zum Richtplatz geredet wird als einem Hinbringen, „wohin du nicht willst“, ist hier noch keinerlei Martyriumssehnsucht vorausgesetzt, wie sie sich bei Ignatius von Antiochia zeigt (IgnRöm 4-6).
Der „andere“, der Petrus „gürten und hinbringen wird, wohin du nicht willst“, ist vordergründig der Scherge, der ihn zur Hinrichtung führt. Aber Petrus erfährt dieses Schicksal gerade als derjenige, der von Jesus beauftragt wurde und also fortan diesem Auftrag leben und schließlich für ihn sterben wird. So ist der „andere“ zugleich noch ein ganz anderer, der Petrus gürtet und ihn seinen Weg bis zum Ende führt.
Die „kommentierende Bemerkung“ in Vers 19 stellt das, was bisher nur angedeutet wurde, noch klarer heraus:
„Das aber sagte er, um anzuzeigen, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde.“ Der Verfasser des Nachtrags nimmt hier im Blick auf Petrus auf, was der Evangelist in 12,33 und 18,32 von Jesus ausgesagt hat. Das stützt die Annahme, dass auch der Tod des Petrus am Kreuz erfolgte. Zugleich erfährt damit seine vorzeitige und also unangemessene Aussage nun eine positive Aufnahme: „Mein Leben will ich für dich einsetzen“ (13,37b). Aber dieser Einsatz des Lebens für Jesus, der Verlust des Lebens im Dienste Jesu und um Jesu willen geschieht zur Verherrlichung Gottes. Wie Jesus nach der Darstellung des Johannesevangeliums nichts anderes tun wollte, als den Willen Gottes auszuführen, so dient auch das Leben und Sterben derer, die ihm folgen, allein der Ehre Gottes.
Am Rande merkt Wengst an, dass nach Barrett <1545> diese „Stelle … als ein vergleichsweise früher und guter Beleg für das Martyrium des Petrus am Kreuz verstanden werden“ muss, und er verweist auf Euseb, der unter „Berufung auf ältere Überlieferung schreibt: ‚Wie berichtet wird, wurde Paulus eben in Rom unter Nero enthauptet und Petrus gekreuzigt‘ (Kirchengeschichte II 25,5)“.
Hartwig Thyen (T790) lässt dem von ihm fast wie von Wengst wiedergegebenen Vers 18 von Vers 19 her eine Deutung folgen, die auch der Interpretation von Wengst im Großen und Ganzen entspricht:
Wenn der Erzähler dieses Wort nicht sogleich {in Vers 19} folgendermaßen kommentiert hätte: „Das sagte er aber, um so anzudeuten (sēmainōn), mit was für einer Todesart er (Petrus) Gott preisen werde“, bliebe es ein mißverständliches Orakel, als habe Jesus hier Sturm und Drang der Jugend des Petrus mit der Hilflosigkeit seines Greisenalters kontrastieren wollen. Erst dieser Erzählerkommentar hebt diese Ambivalenz auf und zeigt, daß Jesus dem gesamten irdischen Leben des Petrus mit all seinen Irrungen und Wirrungen sein Sterben als treuer Märtyrer gegenübergestellt hatte. Dann weisen das Ausstrecken der Hände und das von einem anderen Gefesseltsein auf das Tragen des patibulum zur Stätte seiner Hinrichtung. Das Patibulum ist der Querbalken des Kreuzes, an den die Hände des zu Kreuzigenden gefesselt waren. Weil es um die Kreuzigung des Petrus geht, ist dieser Kommentar des Erzählers gewiß auch nicht zufällig in engem Anklang an die Worte formuliert, mit denen er zuvor schon Jesu Rede von seiner ,Erhöhung‘ kommentiert hatte: „Das hatte Jesus aber gesagt um anzuzeigen, was für eine Art von Tod er erleiden müsse“ (touto de elegen sēmainōn poiō thanatō ēmellen apothnēskein: 12,33).
Ton Veerkamp <1546> verfolgt bei der Auslegung der Verse 18 und 19a eine gänzlich andere Spur:
21,18 Amen, amen, sage ich dir:
Als du jünger warst, hast du dich selbst umgürtet,
du gingst deinen Gang, wo immer du wolltest.
Wenn du älter sein wirst,
wirst du deine Hände ausstrecken.
Ein anderer wird dich umgürten und dich dorthin bringen,
wohin du nicht willst.“
21,19a Das sagte er, bezeichnend,
durch welchen Tod er GOTT ehren werde.
Einig ist Veerkamp mit Wengst und Thyen in zweierlei Hinsicht:
Die nachfolgenden Sätze haben ein großes Gewicht, denn sie werden so eingeleitet: „Amen, amen, sage ich dir“. Die Sätze werden durch die Anmerkung des Erzählers gedeutet. Sie weisen auf den Tod hin, mit dem Simon Petrus Gott ehren wird.
Dann aber sieht Veerkamp
große Probleme mit der traditionellen Erklärung der Aussage, Petrus könne, solange er jung sei, sich gürten, wie er wollte, und gehen, wohin er wollte. Aber wenn er älter sein werde, werde er die Hände ausstrecken, ein anderer würde ihn gürten und dorthin tragen, wohin er nicht wolle.
Also, sagt man, als alter Mann würde er seine Hände ausstrecken, um sich ans Kreuz nageln zu lassen, und man würde ihn dorthin tragen, wohin er nicht wollte, nämlich, indem man das Kreuz aufrichtet, an dem er festgenagelt worden war. Nun ist von Kreuzigung nicht die Rede, und ein wirklich verlässliches Dokument über die Kreuzigung des Petrus ist bislang nicht aufgefunden worden.
Gegen die Deutung des Ausstreckens der Hände auf die Kreuzigung beruft sich Veerkamp auf den Gebrauch dieser Wendung in den jüdischen Schriften und den synoptischen Evangelien:
Das „Ausstrecken der Hände“, ekteinein tas cheiras bedeutet niemals, „die Hände zur Fesselung ausstrecken“. In der Regel ist dies ein Zeichen der Macht, vor allem im Buch Exodus. Und wenn jemand bei den Synoptikern aufgefordert wird, die Hand auszustrecken, geschah das, um sie zu heilen, Markus 3,5 par. Peripatein übersetzen wir immer mit „den Gang gehen“. Gemeint ist mit diesem Verb der Gang mit dem Messias bzw. mit dem „Licht der Welt“, 8,12; 11,9f.; 12,35.
Von diesem Hintergrund her bezieht Veerkamp die hier mit dem „Alt sein“ verbundenen Aussagen nicht nur auf den im nächsten Vers angekündigten Tod des Petrus, sondern auf seinen gesamten zukünftigen Lebensgang einschließlich seines Todes:
Die Gegensätze sind: „jung“ und „alt“ / „sich gürten“ und „sich von einem anderen gürten lassen“ / „den Gang gehen“ und „von einem getragen werden“ / „wollen“ und „nicht wollen“. Nur „die Hände ausstrecken“ hat keinen Gegensatzpartner, der Ausdruck steht für sich. „Alt sein, sich gürten lassen, getragen werden und nicht wollen“, bedeutet: nicht länger frei über sein Tun und Lassen verfügen zu können. …
Der Hirte kann nicht mehr seinen eigenen Gang gehen. Er wird gegürtet werden. Das Verb „sich gürten“ (zōnnynai, hagar) kommt in der Schrift 44mal vor. Das Objekt ist meistens Schwert oder Waffen, 16mal. Auch der Ausdruck „die Hände ausstrecken“ bedeutete häufig „die Hände ausstrecken nach dem Schwert“, vor allem in den Büchern Josua, Richter, Samuel. Nicht selten ist das Objekt von „gürten“ Priestergurt und Priesterschurze, achtmal. Sich umgürten mit dem Bußgewand des Sackleinens kommt sechsmal vor. Sich gürten ohne Objekt oder sich die Lenden gürten bedeutet: sich reisefertig machen (sechsmal). Aber nirgendwo ist „sich von einem anderen gürten lassen“ ein Synonym für „sich fesseln lassen“.
Daraus zieht Veerkamp für seine eigene Auslegung folgende Schlussfolgerungen:
Als Simon jung war, ging er seinen eigenen, zelotischen Gang und „zog sein Schwert“, 18,10. Wenn er alt sein wird, wird er seine Hände ausstrecken, aber nicht nach dem Schwert, sich gürten lassen, aber nicht mit dem Schwert. Dann kann von einem eigenen, frei gewählten Weg nicht mehr die Rede sein. Er wird getragen werden durch jenen „Anderen“. Dieser „Andere“ ist der Messias. Der Messias ist der Hirte, der seine Seele einsetzt für die Schafe, bis zum Ende, bis zum Tod, wie erzählt wird. Jetzt ist Simon Petrus der Hirte. Er wird den Gang des messianischen Hirten gehen, mit der gleichen Konsequenz: bis zum Ende, bis zum Tod, mit dem er Gott ehren wird, wie der Messias durch seinen Tod Gott geehrt hat. Simon Petrus wird Gott durch den Tod ehren wie der Messias.
Am Ende stimmt seine Deutung dann doch wieder mit dem überein, was auch Wengst und Thyen annehmen. In meinen Augen macht es durchaus Sinn, das Wort Jesu gegenüber Petrus auf seinen gesamten zukünftigen Lebensgang zu beziehen.
↑ Johannes 21,19b-23: Die Nachfolge des Petrus und des Schülers, dem Jesus solidarisch verbunden war
21,19b Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm:
Folge mir nach!
21,20 Petrus aber wandte sich um
und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte,
der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte:
Herr, wer ist‘s, der dich verrät?
21,21 Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus:
Herr, was wird aber mit diesem?
21,22 Jesus spricht zu ihm:
Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme,
was geht es dich an?
Folge du mir nach!
21,23 Da kam unter den Brüdern die Rede auf:
Dieser Jünger stirbt nicht.
Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt:
Er stirbt nicht,
sondern:
Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme,
was geht es dich an?
[23. Februar 2023] Klaus Wengst (W585) stellt zu Vers 19b fest, dass hier nach „einer Übergangswendung, die in Anknüpfung an den ersten Abschnitt dieser Szene den zweiten eröffnet, … Petrus ausdrücklich zur Nachfolge aufgefordert“ wird: „Und als er das gesprochen hatte, sagte er ihm: ,Folge mir nach!‘“ Dieser Aufruf schließt nach „der vorangegangenen Ankündigung … den ‚Ruf zur Nachfolge ins Martyrium‘ ein“ (so Bultmann <1547>), womit nach Wengst (Anm.26) „[s]achlich … aufgenommen [ist], was im Evangelium in 12,26 ausgeführt wurde“ (W585):
Noch einmal bezieht sich der Verfasser auf die Situation von 13,36 zurück. Jetzt gilt, was dort unzeitig war, was aber Jesus dem Simon Petrus für später angekündigt hat: „Wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst aber später folgen.“
Wengst zufolge hat diese Aufforderung Jesu an Petrus zur Nachfolge „zugleich die Funktion“, in Vers 20 (W585f.)
den Schüler, den Jesus liebte, in die Szene zu bringen. „Petrus wandte sich um und sah, wie der Schüler, den Jesus liebte, nachfolgte.“ Wozu er aufgefordert wurde, das sieht er den anderen schon tun. Da dieser andere, wie die Fortsetzung des Textes zeigt, nicht den Märtyrertod sterben wird, macht der Verfasser damit auch deutlich, dass es unterschiedliche Weisen der Nachfolge gibt und Nachfolge nicht nur im Martyrium besteht. An dieser Stelle, an der dieser Schüler wieder in den Blick kommt und bis zum Schluss im Zentrum steht, wird zunächst sehr deutlich an sein erstes Auftreten im Evangelium (13,23-25) erinnert: „Er war es, der sich beim Mahl an seine Brust zurückgelehnt und gesagt hatte: ,Herr, wer ist‘s, der dich ausliefert?‘“ Damit stellt der Verfasser dessen besondere Nähe zu Jesus betont heraus.
Welche Funktion hat nun (W586) die in Vers 21 gestellte Frage des Petrus an Jesus?
„Als nun Petrus den erblickte, sagte er zu Jesus: ,Herr, was aber ist mit dem?‘“ Nachdem Jesus sich über das Schicksal des Petrus geäußert hat, ist es die Funktion dieser Frage, jetzt eine Äußerung Jesu über diesen anderen Schüler hervorzurufen und ihn so mit seinem sehr anderen Schicksal doch gleichrangig neben Petrus zu stellen.
Aus Jesu „prompt“ erfolgender und Petrus zurechtweisender Antwort geht Wengst zufolge zunächst „auf alle Fälle“ hervor, „dass der andere Schüler im Unterschied zu Petrus nicht das Martyrium erlitten hat“, was aber „nicht als Mangel gelten“ soll:
„Jesus sagte ihm: ,Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?‘“ … Danach verweist ihn Jesus noch einmal betont auf seinen spezifischen Weg, der das Martyrium einschließt: „Folge mir nach!“ Dabei ist daran zu erinnern, dass er den anderen schon nachfolgen sah, dass also dessen Weg ebenfalls Nachfolge Jesu ist.
Insofern erkennt Schnackenburg <1548> Wengst zufolge (Anm. 27)
als „das Anliegen“ des Verfassers „eher ein positives: diejenigen, die sich an Petrus halten und seine Autorität betonen, sollen auch Verständnis für jenen Jünger und seine Gemeinde aufbringen. Ohne die Autorität des Petrus herabzusetzen, will der joh(anneische) Kreis das Ansehen seines Gründers und Meisters heben, gerade durch Petrus, dem die Antwort Jesu zuteil wird.“
Was aber meint Jesus (W586) in Bezug auf den anderen Schüler mit dem Stichwort „bleiben“?
Er soll „bleiben“, bis Jesus „kommt“. Hier kann nicht das in den Abschiedsreden angekündigte Kommen in Geisteskraft gemeint sein. Vielmehr ist – wie in 1. Joh 2,28 – die Parusie Jesu im Blick, sein endzeitliches Kommen.
In der Erzählung wird diese Aussage zum Anlass für „ein Missverständnis“, das zu Beginn von Vers 23 folgendermaßen umschrieben wird:
„Da verbreitete sich diese Rede unter den Geschwistern: Jener Schüler stirbt nicht.“ Mit „den Geschwistern“ können hier nur die Gemeindeglieder gemeint sein. Diese Bezeichnung findet sich besonders ausgeprägt im ersten Johannesbrief. Daraus – wie auch schon aus der starken sprachlichen Anknüpfung an das Johannesevangelium – ergibt sich, dass der Verfasser des Nachtrags in johanneischer Tradition steht und selbst zum johanneischen Kreis gehört. In diesem Kreis muss es die Überzeugung gegeben haben, dass ein herausragendes Mitglied, das Jesus noch selbst erlebt hatte, nicht sterben, sondern bis zur Parusie Jesu am Leben bleiben würde. So kann das „Bleiben“ durchaus verstanden werden als „am Leben bleiben“ (vgl. 1. Kor 15,6; Phil 1,25); das ist das nächstliegende Verständnis dieser Aussage. Paulus erwartete im Blick auf die Parusie nach 1. Kor 15,51, dass „wir nicht alle entschlafen, aber alle verwandelt werden“. In Mt 16,28 steht als Jesuswort: „Es gibt welche unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie sehen, wie der Menschensohn in seiner königlichen Macht kommt“ (vgl. Mk 9,1; Lk 9,27). Starben mehr und mehr der aus der Zeit Jesu Stammenden, konzentrierte sich diese Erwartung auf die Übriggebliebenen. So konnte es zu der Überzeugung kommen: „Jener Schüler stirbt nicht.“
Hier wird nach Wengst der „Schüler, den Jesus liebte“, der im Evangelium bisher „der ideale Schüler“ war, „der Namenlose, mit dem sich jede und jeder identifizieren soll“, im Nachtrag „mit einer bestimmten historischen Gestalt in seiner Tradition“ verbunden. Allerdings lässt ihn auch der Verfasser des Nachtrags (W587) „weiterhin namenlos sein“ sein. „Warum er diese Historisierung vornimmt, wird sich zeigen.“
Am Ende von Vers 23 wird die anfangs erwähnte „Deutung des Jesuswortes“ korrigiert: „Jesus hatte aber nicht gesagt: ,Er stirbt nicht.‘“ Der Anlass dieser Korrektur kann nach Schnackenburg [443] „wohl nur der Tod jenes Jüngers sein“.
Wie ist aber „Jesu Wort dann zu verstehen“? Wengst entwickelt dazu eine klare Vorstellung, mit der er (Anm. 29) Spekulationen wie die von Haenchen <1549> entschieden zurückweist, „Jesus habe gar nicht verheißen, daß jener Jünger nicht sterben werde, sondern nur unverbindlich (!) von dieser Möglichkeit gesprochen.“ Wie kann also das, „was Jesus gesagt hat“ und was der Verfasser zunächst wörtlich wiederholt: „Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?“, sinnvoll anders gedeutet werden, als „dass jener Schüler nicht sterbe“?
Den Bedingungssatz so zu verstehen, dass Jesus eben nicht gewollt habe, ist unmöglich. Das würde diese Aussage völlig belanglos machen. Kein Gemeindeglied – jedenfalls in früher Zeit – wird Jesu Reden für unverbindlich halten. Daher ist gegenüber der Deutung, dass „jener Schüler nicht stirbt“, bei der Wiederholung der Aussage Jesu das „Bleiben“ als betont anzusehen. Es darf nicht als „am Leben bleiben“ interpretiert, sondern muss anders verstanden werden. Worin dieser Schüler „bleibt“, wird deutlich: in dem von ihm geschriebenen Evangelium, für das er als Zeuge einsteht. „Er sollte nicht als ein lebender Zeuge für Christus bis zur Parusie überleben, sondern er sollte durch das geschriebene Evangelium sich selbst zu dem bleibenden Gewährsmann der Überlieferung der Kirche und des Wortes Jesu, durch welches allein die Kirche existiert, machen.“ <1550>
Auch Hartwig Thyen (T790) sieht mit Jesu „Aufforderung: Folge mir nach!“ in Vers 19b, die seine „an Petrus gerichtete Rede über dessen Geschick“ beschließt,
die Stunde gekommen, die Petrus schon in der Nacht des letzten Mahles angebrochen glaubte, als er sich sagen lassen mußte, jetzt könne er Jesus noch nicht nachfolgen, später aber werde er ihm nachfolgen (akolouthēseis de hysteron: 13,36). Wie schon damals, so hat das Lexem akolouthein erst recht hier martyrologische {auf den Märtyrertod bezogene} Obertöne.
Anders als Wengst setzt Thyen voraus, dass auch der geliebte Jünger, von dem ab Vers 20 die Rede ist, vom Martyrium nicht verschont bleiben werde:
Als Petrus sich umwandte, sah er den Jünger, den Jesus liebte, ebenfalls nachfolgen (akolouthounta). Das soeben martyrologisch imprägnierte Lexem akolouthein dürfte diese Prägung zwischen den beiden Sätzen kaum verloren haben und darum auch das Martyrium des geliebten Jüngers implizieren. In der für unseren Erzähler typischen Manier identifiziert er den geliebten Jünger hier noch einmal ausdrücklich als denjenigen, der beim letzten Mahl an der Brust Jesu gelegen und ihn (im Auftrag des Petrus!) gefragt hatte: „Herr, wer ist es denn, der dich ausliefern wird?“ (13,23ff; vgl. zu diesem Verfahren die erneute Nennung von Nikodemus in 19,39, von Judas in 6,71 u. ö. sowie von Kaiaphas in 18,14. Diese Rückverweise sind freilich nicht rein formal, sondern sie dienen dazu jeweils die vorigen Kontexte mit ins Spiel zu bringen).
In kunstvoller Weise versteht es Thyen zufolge der Erzähler, der in seinen Augen ja mit dem geliebten Jünger identisch ist, nach „der Bestimmung des Geschicks des Petrus“ nun auch (T791) „dessen eigene Bestimmung“ mitzuteilen. Dabei ist Petrus selbst sein Geschick zunächst allerdings noch „ebenso verborgen …, wie ihm damals die Identität dessen, der Jesus seinen Feinden ausliefern sollte, verborgen geblieben und nur dem erzählenden und kommentierenden geliebten Jünger und seinen Zuhörern/Lesern offenbar geworden war“, während die Bestimmung des geliebten Jüngers „dem Leser freilich insofern nur indirekt mitgeteilt“ wird, als dies „nämlich durch das andauernde Gespräch zwischen Jesus und Petrus“ erfolgt.
Im Zusammenhang mit der sich auf den geliebten Jünger beziehenden Frage des Petrus in Vers 21 hebt Thyen das Wort epistrephein {umwenden} aus Vers 20 hervor, das an die ersten Jünger erinnert, die Jesus in 1,35ff. für sich gewonnen hatte und von denen in seinen Augen einer mit dem geliebten Jünger identisch sein muss:
Nachdem er den geliebten Jünger ebenfalls auf dem Weg der Nachfolge Jesu gesehen hat, fragt Petrus Jesus nach dessen Bestimmung: Herr, was ist es um diesen? (kyrie, houtos de tis?). So wie Petrus sich jetzt umwendet und sieht, daß der geliebte Jünger Jesus bereits nachfolgt, ohne daß der ihm das eigens hätte gebieten müssen, so hatte sich Jesus selbst einst umgewandt und jene beiden Jünger des Johannes erblickt, die aufgrund von dessen martyria zu Nachfolgern Jesu geworden und bei ihm geblieben waren (1,35ff). Die Frage, warum der Erzähler nur den Namen des einen dieser beiden Täuferjünger nennt, nämlich den des Petrusbruders Andreas, den des anderen aber verschweigt und damit eine ,Leerstelle‘ schafft, deren Ausfüllung er seinen Zuhörern/Lesern überläßt, haben wir oben z. St. breit erörtert und sind dabei zu dem Schluß gekommen, daß dieser Anonymus neben Andreas der geliebte Jünger sein muß … Denn nur wenn er von Anfang an bei Jesus geblieben und ihm überall hin nachgefolgt ist, kann von ihm ja gesagt werden, daß er der Zeuge der ganzen Geschichte Jesu ist und dieses Zeugnis in unserem Evangelium in festen Buchstaben verfaßt hat. Zugleich ist er damit auch der ideale Zeuge der martyria seines vorigen Meisters Johannes.
Obwohl Thyen im Gegensatz zu Wengst ein Martyrium des geliebten Jüngers nicht ausschließt, sondern sogar für wahrscheinlich hält, läuft seine Auslegung der Verse 22 und 23 letzten Endes wie bei Wengst darauf hinaus, dass das „Bleiben“ dieses Jüngers sich auf sein Zeugnis in Form des von ihm geschriebenen Evangeliums bezieht:
Auf die Petrusfrage, wozu denn dieser Andere bestimmt sei, antwortet Jesus ihm wiederum mit einem höchst ambivalenten Orakel: „Wenn ich will, daß er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du jedenfalls sollst mir nachfolgen!“ Und auch diese Ambivalenz bliebe bestehen, wenn der Erzähler sie nicht sogleich durch seinen erneuten Kommentar aufgehoben hätte: „Daraufhin verbreitete sich unter den Brüdern das Gerücht: Dieser Jünger wird nicht sterben. Doch Jesus hatte ihm (nämlich Petrus) ja nicht gesagt, daß der nicht sterben werde, sondern er hatte gesagt: Wenn ich will, daß er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an?“ Ganz offensichtlich unterscheidet der Erzähler hier zwischen ,Nicht-Sterben‘ und ,Bleiben‘. Daß dieser Jünger aber nicht sterben, sondern bis zur Parusie ,übrigbleiben‘ und leben werde, hatte Jesus nicht gesagt. Dergleichen hatte Paulus fast ein halbes Jahrhundert zuvor den Thessalonichern geschrieben: Bei der Parusie Jesu würden zuerst die Toten auferweckt und danach erst würden „wir, die Lebenden, die wir übriggeblieben sind, zugleich mit ihnen zur Einholung des Herrn in die Wolken entrückt“ werden (1Thess 4,17). Doch im Unterschied zu seinem Wort an Petrus und dessen Wißbegier hatte Jesus im Blick auf den geliebten Jünger gerade nichts über dessen Leben und Sterben und erst recht nichts über sein Nicht-Sterben gesagt, sondern erklärt, der solle als sein treuer Zeuge (ho martyrōn) und als sein von ihm selbst autorisierter ,Exeget‘ (vgl. 1,18 mit 13,23 u. s. o. z. St.) bis ans Ende der Tage (heōs erchomai) bleiben. Einerlei also, ob er lebt oder stirbt, auf alle Fälle soll er nach dem letzten Willen seines Herrn bleiben und schreiben, soll schreiben und damit in seinem geschriebenen Zeugnis bleiben, so daß fortan alle Hirten wie Petrus, vermittelt durch sein Zeugnis, zu ihrem Herrn kommen werden.
Auch Thyen wendet sich wie Wengst gegen diejenigen, die meinen, dass Johannes mit „dem konditionalen ,Wenn ich will …‘ (ean auton thelō menein) … offen“ gelassen hätte, „was und ob Jesus will oder nicht will“, <1551> vielmehr tut Jesus damit (T792)
gerade seinen unverbrüchlichen Willen kund. Denn jede Deutung, die sich derart auf die konditionale Form des Satzes stützt, übersieht, daß mit dem fraglichen Satz ja Petrus angeredet, wegen seiner ungehörigen Einmischung in die Frage nach dem Geschick des geliebten Jüngers schroff zurückgewiesen und an seine eigene Bestimmung erinnert wird. „Das thelō {ich will} in dem Falle des Johannes ist nämlich nichts anderes als der Ersatz für den Imperativ im Falle des Petrus, und die Notwendigkeit dieses Ersatzes ist einfach durch den Umstand herbeigeführt, daß der Gesamtanlage der Erzählung gemäß nur die für Petrus bestimmte Willenserklärung sich an diesen direkt richtet. Zugleich aber erklärt sich nun auch das diesem thelō vorgesetzte ean {wenn}. Auch dieses ist lediglich durch den Umstand herbeigeführt, daß die für Johannes bestimmten Jesusworte nicht als direkte Anrede an Johannes auftreten, sondern in der Form einer Zurechtweisung des Petrus“. <1552> Übersetzt in eine Anrede an den geliebten Jünger müßte der Satz darum lauten: „Du sollst bleiben und schreiben, schreiben und darin bleiben!“
Das Gerücht, der geliebte Jünger werde nicht sterben, will Thyen keineswegs „anachronistisch“ in einer „johanneischen Gemeinde“ verortet wissen:
Zu dem logos, der sich nach dem Kommentar unseres Erzählers unter den Brüdern verbreitete, daß nämlich der geliebte Jünger nicht sterben, sondern als Lebender die Parusie seines Herrn erfahren werde, muß bedacht werden, daß die Bezeichnung der Christen als der Brüder Jesu, abgesehen von Mt 23,8 und der damit spielenden Passage Joh 20,17, in keinem unserer Evangelien vorkommt. Darum können die Brüder, unter denen sich der Logos verbreitete, u.E. nur die vom Auferstandenen selbst in 20,17 so bezeichneten Elf und nicht etwa völlig anachronistisch die Glieder einer johanneischen Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts sein. Treffend macht Kügler <1553> darauf aufmerksam, „daß der implizite Autor den Verbreitungskreis des Gerüchts von seinen Adressaten unterscheidet, die der Erzähler ja sonst direkt anreden kann“. In unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Verklärung auf dem ,hohen Berg‘ (Mk 9,2ff), als deren Zeugen Petrus, Jakobus und Johannes ausdrücklich benannt werden, hatte Jesus feierlich erklärt: „Amen ich sage euch, da sind einige unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, ehe sie nicht den machtvollen Anbruch der Gottesherrschaft gesehen haben“ (Mk 9,1). Es ist zumindest denkbar, daß sich dieses sogenannte ,Naherwartungs-Logion‘ nach den Martyrien von Jakobus (Act 12,11) und Petrus an den einstweilen Überlebenden, nämlich an Johannes, geheftet haben könnte. Der muß nach Mk 10,35ff freilich ebenfalls, und zwar noch vor der Abfassung dieses Evangeliums, den Märtyrertod erlitten haben. Doch … starb er sicher nicht zugleich mit seinem Bruder Jakobus, der etwa im Jahre 42 unter Agrippa I mit dem Schwert hingerichtet wurde (Act 12,2). Er gehörte vielmehr noch im Jahre 49 neben dem Herrenbruder Jakobus und Petrus als eine der drei ,Säulen‘ der Jerusalemer Gemeinde zu den Verhandlungspartnern des Paulus beim sogenannten Apostelkonvent (Gal 2,1ff…). Da er u.E. der fiktionale und anonyme Evangelist im Evangelium (Overbeck) ist, könnte der wirkliche Evangelist noch um die Trauer um dessen gar nicht erwarteten Tod gewußt und dieses Wissen hier eingebracht haben, denn immerhin will er diesem Jünger mit seinem Evangelium ja ein bleibendes Denkmal setzen.
Wenn Zahn [704ff.] dagegen „jene ,Brüder‘ mit „Gemeinden [identifiziert], welche (im Gegensatz zu jenen Spöttern von 2Pt 3,3ff) nicht spotteten oder auch nur zweifelten, sondern auf die Verheißung Jesu, wie sie dieselbe verstanden, den Glauben gründeten, daß Jo nicht sterben, sondern die Parusie des Herrn erleben werde“, so ist dies Thyen zufolge darauf zurückzuführen, dass dieser „den Zebedaiden Johannes für den tatsächlichen Autor unseres Evangeliums“ hält (T792f.):
Daß Joh 21 dessen Tod voraussetze, bestreitet er vehement. Er müsse vielmehr zur Zeit der Niederschrift von Joh 21 noch am Leben gewesen sein, weil der Tag seines Todes die Möglichkeit, Joh 21 zu schreiben, „für immer ausgeschlossen“ hätte (Komm. 704ff). Ganz ähnlich urteilt nach ihm Morris [879]…
Demgegenüber hat sich Thyen von „Küglers Monographie über ,den Jünger, den Jesus liebte‘ und seine gelungene Destruktion von dessen außertextlicher Existenz“ davon überzeugen lassen,
daß – auch wenn Joh 21,22f u.E. fraglos den Tod des geliebten Jüngers voraussetzt – dieser Tote doch keinesfalls der verehrte Gründer, der allseits bekannte Lehrer und das ,Schulhaupt‘ einer spezifisch ,johanneischen Gemeinde‘ sein kann, die in ihrem tiefen Betroffensein über dieses unerwartete Sterben durch eine präzisere Exegese dessen, was Jesus wirklich gesagt hatte, hätte getröstet werden müssen. Abgesehen davon, daß diese Art von Naherwartung schwerlich zu dem Evangelium jener vermeintlich johanneischen Gemeinde passen würde, wird dieser Jünger in 13,23 ja auch nicht als ,der (bekannte) Jünger, den Jesus liebte‘ in das Evangelium eingeführt, sondern als ,einer seiner Jünger, den Jesus liebte‘: „Der Unterschied ist gering, zeigt aber, dass vom Leser nicht erwartet wird, dass er den geliebten Jünger kennt. Am Ende muss dem Leser auch gesagt werden, dass es der geliebte Jünger war, der diese Dinge bezeugt und geschrieben hat“. <1554>
Angesichts dessen hält Thyen es allerdings für „[u]nbegreiflich“,
wie Kügler [482] dann gegen seine bessere Einsicht am Ende dennoch den Rückweg antreten und konzedieren kann: „Die Existenz einer apostolischen Lehrer- oder Gründergestalt, die am Beginn des johanneischen Christentums steht oder zumindest in der Gemeindegeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, kann natürlich nicht bestritten werden. Unbestreitbar ist ferner die Möglichkeit, daß die Redaktion diese Gestalt kannte und bei der Gestaltung der Lieblingsjüngerfigur an diese dachte“. Denn weil die Rede von einer johanneischen Schule und ihrem Schulhaupt ja überhaupt nur aufkommen konnte, solange man glaubte, diese Person im Spiegel der Textpassagen um den geliebten jünger als deren reales Modell entschlüsseln zu können, erscheinen uns alle derartigen Erwägungen als bloße Varianten der alten ephesinischen Johanneslegende, die u.E. allein aus Joh 21,23-25 herausgesponnen ist…
Einen anderen Weg beschreitet Ton Veerkamp <1555> zur Auslegung der Verse 19b-23, da er das Verhältnis von Petrus und dem geliebten Schüler als Widerspiegelung der Verhältnisse in der messianischen Bewegung am Ende des 1. Jahrhunderts begreift:
Jetzt muss noch eine letzte, an sich nebensächliche, aber lästige Frage geklärt werden. Was geschieht mit der eigenständigen und wohl auch recht eigensinnigen Gruppe um Johannes innerhalb der vereinheitlichten messianischen Bewegung? Es geht also um das Verhältnis zwischen einer lokalen messianischen Gruppe um „den Schüler, dem Jesus solidarisch verbunden war“ – einer Gruppe, die deutlich einen abweichenden Weg geht -, und der überregionalen messianischen Bewegung unter der Führung des Simon Petrus.
Der Schüler, um den es geht, wird hier als derjenige bezeichnet, der an der Brust Jesu fragte, „Herr, wer ist es, der dich überliefern wird?“ Es ist der Schüler, der mit Petrus zum Grab rannte und am offenen Grab „sah und vertraute“. Es ist der Schüler, der einen ganz besonderen Zugang zu Jesus hatte und für den Petrus sehr wichtig war.
Nehmen wir diese zwei Akteure der Erzählung als Repräsentanten verschiedener messianischer Gruppen bzw. Richtungen, so ist das Verhältnis klar. Simon Petrus ist der eindeutige Führer der ganzen messianischen Bewegung; zugleich ist er auf die Einheit mit jenem Schüler, also mit der Gruppe um Johannes, angewiesen. „Johannes“ begreift sich hier als ein Element der großen messianischen Erzählung, aber er hat für sie eine herausragende Bedeutung. Der Erzähler von Johannes 21 will also zwei Sachverhalte sicherstellen. Die Gruppe muss sich als Teil einer übergreifenden Bewegung verstehen, sie muss aber zugleich an ihrer eigenen, vom messianischen Mainstream abweichenden Identität festhalten.
Vor diesem Hintergrund bezieht Veerkamp das Wort menein {Bleiben} nicht wie Wengst und Thyen auf das bleibende Zeugnis des geliebten Schülers in seinem schriftlich niedergelegten Evangelium, sondern auf sein Festbleiben bzw. Durchhalten in der eigenständigen Art seiner Nachfolge, die nicht mit derjenigen des Petrus vollkommen gleichzuschalten ist. Das wiederum erinnert an die Position von Wengst im Blick auf die Gleichwertigkeit einer Nachfolge mit oder ohne Martyrium:
Die Frage Simons an Jesus, was denn mit jenem Schüler sei, betrifft nicht in erster Linie den Tod jenes Schülers, sondern dessen Verhältnis zu ihm. Die Frage bedeutet dann: „Soll er weiter seine eigenen Wege gehen?“ Denn eingeleitet wurde der Passus mit der Bemerkung, dass Petrus den Schüler Jesus folgen sieht. Es geht also um die besondere Art, in der die Gruppe dem Messias folgt. Der Erzähler, Sprecher der Gruppe um Johannes, lässt Jesus barsch antworten: „Wenn ich will, dass er durchhält, bis ich komme, was geht dich das an? Du folge mir!“ Die Einheit soll nicht in dogmatischer Uniformität bestehen, sondern darin, dem Messias zu folgen.
Die Einordnung der johanneischen Gemeinde, das Durchbrechen ihrer Isolierung, ist eine Sache, die Eigenständigkeit der Gruppe innerhalb einer Bewegung eine andere Sache. In der weltweiten messianischen Bewegung soll es die verschiedenen Formen der Nachfolge geben. Die messianische Bewegung ist eine politische Bewegung, aber keine politische Partei und folglich gibt es in der messianischen Bewegung keine Parteidisziplin. Den Anhang Johannes 21 hat gerade die alte und später die römisch-katholische Kirche mit großer Sorgfalt gelesen, offenbar aber nur bis zu V.19. Hätte sie weiter gelesen, hätte sie das anathema sit [„verflucht sei er“] spärlicher verwendet.
Ein Problem stellen für Veerkamp in diesem Zusammenhang die Worte Jesu „bis ich komme“ dar:
Mit diesem Gedanken ist das Johannesevangelium eigentlich wenig vertraut. Was kommt, ist die Inspiration der Heiligung. Der Gedanke, dass „Jesus kommt“, taucht eigentlich nur in 14,3 auf: „Ich gehe hin, euch einen Ort zu begründen. Wiederum komme ich, um euch aufzunehmen zu mir selbst.“ Wir haben diese Stelle gedeutet als eine Umschreibung dessen, was in 11,52 „zusammenführen in eins“ der auseinandergetriebenen Kinder Israels ist.
Die veränderte Akzentuierung dieser Erwartung, die Jesus jetzt vornimmt, stellt Veerkamp in den Rahmen eines Lernprozesses, den die johanneische Gruppierung vollzieht, indem sie sich der größeren messianischen Bewegung anschließt, die mit dem Namen Petrus repräsentiert wird:
Bei Matthäus, Markus und Lukas „kommt“ der Messias, um endlich und endgültig Recht zu schaffen. Inzwischen mag die Gruppe begriffen haben, dass zwar der Messias gekommen und kein anderer Messias zu erwarten ist, aber dass das Werk des Messias genausowenig vollendet war wie das Schöpfungswerk des Gottes Israels, 5,17. Die Messianisten haben sich nicht nur aus der räumlichen Isolierung, sondern auch aus dem Gefängnis der reinen messianischen Gegenwart befreit, sie haben eine Zukunft, und die Welt hat auch eine Zukunft, eine Zukunft ohne die Ordnung, die sie jetzt unterdrückt. Das lernt die Gruppe von der messianischen Bewegung unter Simon.
Nach wie vor hält aber der Text des Johannesevangeliums an zwei Grundlinien fest, erstens an der Abwehr zelotisch-messianischer Abenteuer und zweitens am Ziel der Vollendung der „Werke des VATERS und des Messias“, die in der Sammlung ganz Israels und im Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit für Israel inmitten der Völker bestehen. Daher bleibt
der Text … auch hier zurückhaltend. Zu tief steckt die Ablehnung des Zelotentums, das das Kommen des Messias auf den Wolken des Himmels mit dem Schwert in der Hand herbeizwingen wollte. Das Kommen des Messias bedeutet im Kontext des ganzen Evangeliums, dass die Werke des VATERS und des Messias vollendet sind. Das Verb menein bedeutet, wie wiederholt gezeigt, „standhalten, durchhalten, fest bleiben“. Das Leben eines Menschen, der Jesus folgt, ist nichts als „durchhalten, aushalten, fest bleiben“. „Wenn ich will, dass dieser Schüler durchhält, bis ich komme“, heißt also: „Bis der Schüler durchhält, bis das Werk des Messias vollendet sein wird, die Zusammenführung der auseinandergetriebenen Gottgeborenen in eine Synagoge, 11,52. Für Simon ändert sich nichts, er soll Jesus folgen.
Das Gerücht über den geliebten Schüler, er werde nicht sterben, verortet Veerkamp in „der messianischen Gemeinde um Johannes“,
nämlich dass der Vorsteher dieser Gemeinde, den man für den Schüler hielt, dem Jesus solidarisch verbunden war, bleiben wird, bis das Ziel des Messias erreicht ist. Der Sinn der Aussage war aber, dass die Gemeinde ihren eigenen Weg geht, wie Simon seinen Weg. Trotz der Tatsache, dass die Gruppe um Johannes die Führung des Simon akzeptiert, legt sie Wert auf ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Vorstellungen. Offenbar war die Diskussion in der Gruppe um ihren Status in der messianischen Bewegung der Messianisten, die aus Israel stammen, noch nicht abgeschlossen.
Mit seiner Bemerkung, dass zur Zeit der Abfassung dieser Verse der geliebte Schüler mit dem „Vorsteher dieser Gemeinde“ identifiziert wurde, scheint Veerkamp ähnliche Vorstellungen wie Zahn, Kügler und Morris vorauszusetzen. Nach dem folgenden abschließenden Abschnitt stimmt er letzten Endes jedoch insofern mit Wengst und Thyen überein, dass es nicht auf solche Spekulationen über dessen Identität ankommt, sondern darauf, dass er in der Erzählung die Rolle dessen übernimmt, der das Zeugnis vom Messias Jesus in geschriebenen Worten bleibend in die Zukunft trägt.
↑ Johannes 21,24-25: Das vertrauenswürdige Zeugnis des Schülers, der nur einen kleinen Teil dessen aufschreiben konnte, was Jesus getan hat
21,24 Dies ist der Jünger,
der das bezeugt und aufgeschrieben hat,
und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.
21,25 Es sind noch viele andere Dinge,
die Jesus getan hat.
Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte,
so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen,
die zu schreiben wären.
Indem (W587) „der Verfasser des Nachtrags“ in Vers 24 „an die wiederholte Ansage Jesu über das Bleiben jenes Schülers“ die Aussage anschließt: „Das ist der Schüler, der hierüber Zeugnis ablegt und der dies geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis verlässlich ist“, meldet sich, wie Wengst mit Trobisch <1556> versichert,
„eine Stimme zu Wort, die sich vom Verfasser des vierten Evangeliums unterscheidet […]. Es kann daher aus Leserperspektive kaum ein Zweifel bestehen, daß hier jemand über den Verfasser des Evangeliums spricht, das man gerade gelesen hat […]. Suchen die Leser nun nach einem Punkt, an dem das schriftliche Zeugnis“ dieses Verfassers „zu einem Ende gekommen ist, stoßen sie unweigerlich auf die […] abschließenden Formulierungen von Joh 20,30-31.“
Damit wird der „Schüler, den Jesus liebte“,
als Verfasser des Evangeliums identifiziert. Seine Zeugenschaft, die im Präsens ausgesprochen wird, ist Voraussetzung dessen, dass er geschrieben hat, und dauert doch auch zugleich in dem von ihm Geschriebenen fort.
Der „Identifizierung des Schülers, den Jesus liebte, als Autor des Evangeliums“ folgt die Formulierung: „Und wir wissen, dass sein Zeugnis verlässlich ist.“ Dazu fragt Wengst (W587f.):
Mit wem schließt er sich hier zusammen? Dass er auf Mitautoren hinweisen wolle, legt sich nicht nahe. Wieso tut er es dann nicht auch in V. 25, in dem er im Singular von sich spricht? Ebenfalls unwahrscheinlich ist es, dass er sich in einem Kreis von Autoritäten im Gegenüber zur Leser- und Hörerschaft sieht. Denn das hier ausgesprochene Wissen ist ja kein gleichsam objektives, würde über das mit dem Evangelium gegebene Zeugnis von außen – über der Sache stehend – ein wertendes Urteil abgegeben. Dass in V. 25 die erste Person Singular, in V. 24 die erste Person Plural gebraucht ist, muss mit dem jeweiligen Inhalt zusammenhängen. In V. 25 spricht der Verfasser des Nachtrags allein für sich. Er gibt dort dem um seinen Nachtrag erweiterten Evangelium einen neuen Schluss. Hier in V. 24 fasst er sich mit seiner Leser- und Hörerschaft zusammen, weil es um das sozusagen experimentell gewonnene und zu gewinnende Wissen derjenigen geht, die sich auf das im Evangelium gegebene Zeugnis eingelassen haben und einlassen möchten und es als für ihr Leben tragfähig und somit als verlässlich erfahren.
Die Absicht des Nachtrags (W588), der hier „seinen Zielpunkt erreicht“ hat, fasst Wengst mit einem Zitat von Wilckens <1557> zusammen:
„So stellt der Verfasser das von ihm herausgegebene Joh(annesevangelium) unter die ,bleibende‘ Autorität des ,Jüngers, den Jesus liebte‘. Dazu hat er den Nachtrag Joh 21 verfaßt und dem Werk des Joh(annes)evangelisten hinzugefügt.“ Aber es ist noch einmal zu beachten, dass der Verfasser diesen Zielpunkt in der Gegenüberstellung des Schülers, den Jesus liebte, mit Simon Petrus gewinnt. Anders als im Evangelium ist es dabei hier bezeichnend, „daß die beiden als gleichen Ranges dargestellt werden“. <1558> Indem der Verfasser Simon Petrus von Jesus als Hirte seiner Schafe beauftragt sein lässt, wird dessen Leitungsfunktion anerkannt. Die Bedeutung des Schülers, den Jesus liebte, liegt auf einer anderen Ebene: Er wird zum Garanten des Johannesevangeliums als eines legitimen Zeugnisses.
In diesem Zusammenhang erwägt Wengst nochmals Antworten auf die Frage, wo das Johannesevangelium in seiner Endgestalt veröffentlicht worden sein könnte:
Ein solches Verfahren der Darstellung ist am besten denkbar an einem Ort, an dem unterschiedliche Traditionen und ihre Trägerkreise zusammenkommen. Die kirchliche Tradition lässt die johanneischen Schriften in Ephesus entstanden sein. <1559> Für den ersten Johannesbrief macht das seine sehr bald nach seiner Abfassung bezeugte Benutzung in der Provinz Asia wahrscheinlich (Polykarp, Papias). Joh 21 bildet m. E. den Abschluss der johanneischen Traditionslinie, sodass die Abfassung dieses Kapitels und damit die Veröffentlichung des Johannesevangeliums in seiner kanonisch gewordenen Gestalt auch für Ephesus anzunehmen ist.
Trotzdem hält Wengst „nach wie vor“ an seiner Einschätzung fest (Anm. 36), dass „die Heimat des johanneischen Kreises und die Entstehung von Joh 1-20“ aller Wahrscheinlichkeit nach „im nördlichen Ostjordanland“ zu lokalisieren ist: <1560>
Dass bei einer solchen Annahme die weitere Hypothese hinzukommen muss, dass Teile des johanneischen Kreises oder auch nur (ein) Einzelne(r) von Osten nach Westen wanderte(n), ist kein gravierender Einwand. Dass solche Bewegungen nach Westen nicht ganz selten waren, ist unter den Bedingungen der Zeit nach dem jüdisch-römischen Krieg gut vorstellbar. Schließlich muss ja auch Hengel sie für seine These vom Presbyter Johannes annehmen.
Da nach Wengst (W588) in der Gemeinde von Ephesus als der „Hauptstadt der Provinz Asia … sich unterschiedliche Trägerkreise mit ihren Traditionen begegnet“ sind, kann „der Verfasser von Joh 21 das Johannesevangelium … auf sozusagen ökumenische Weise“ einbringen (W588f.):
In seiner Darstellung der Gestalt des Simon Petrus anerkennt er eine andere, von der eigenen markant abweichende Tradition in deren besonderer Eigenart, ohne in der Gesamtpräsentation des Evangeliums die eigene Tradition in ihrer Eigenart aufzugeben oder unkenntlich zu machen. Mit dieser Anerkennung verschafft er dem so besonderen Johannesevangelium in einem größeren Kontext Gehör. Das dürfte auch die Voraussetzung dafür gewesen sein, dass es schließlich kanonisiert wurde und so der Kirche diese unverwechselbare Stimme erhalten geblieben ist.
Damit vertritt Wengst einen Standpunkt, der demjenigen von Veerkamp zumindest ähnlich ist.
In Vers 25 „schließt der Verfasser … das um Kap. 21 erweiterte Buch ab“,
indem er an den Schluss des Evangeliums anknüpft. Er nimmt das in 20,30 Gesagte auf und variiert es. Hatte Johannes zunächst formuliert: „Zwar hat Jesus ja noch viele andere Zeichen vor seinen Schülern getan“, so heißt es jetzt: „Es gibt aber auch noch vieles andere, was Jesus getan hat.“ Dem Umstand, dass der Verfasser des Nachtrags den Zeichenbegriff nicht wiederholt, ist wohl kein Gewicht zuzumessen. Wahrscheinlich wollte er nur eine andere Formulierung bieten. Signifikanter ist die Abweichung in der Fortsetzung. Während Johannes hinsichtlich der „anderen Zeichen“ nur schlicht festgestellt hat, dass sie „nicht in diesem Buch geschrieben stehen“, führt der Verfasser hier aus: „Wenn all das eins nach dem andern geschrieben würde, fasste die Welt nicht, meine ich, die dann geschriebenen Bücher.“
Diese Aussage ist nach Wengst nicht etwa als „arge Übertreibung“ an dieser Stelle „unpassend“, wie viele Exegeten meinen, die sie „einer nochmals anderen und späteren Hand als der des Nachtrags“ zuschreiben, vielmehr (W590, Anm. 40) betont sie, wie auch Bultmann [556] meint, „die unerschöpfliche Fülle des Gegenstandes des Ev(an)g(eliums) und damit der christlichen Verkündigung“. Bereits (W589) die abschließende Bemerkung des Evangelisten (20,30), „Jesus habe noch vieles andere getan, was nicht in seinem Buch geschrieben steht“, hatte „dem Verfasser des Nachtrags die Möglichkeit für seinen Nachtrag“ geboten (W589f.):
Er erzählt wenigstens noch eins mehr von dem, was Jesus getan hat und was nicht im schon abgeschlossenen Evangelium steht. <1561> Das erweiterte Evangelium erhält wiederum einen literarischen Abschluss. Aber mit dem veränderten Schluss macht der Verfasser deutlich, dass das nun doppelt abgeschlossene Evangelium doch nicht verschlossen, sondern offen ist. Dieses doppelt abgeschlossene Evangelium beschließt in sich das Wirken Jesu, aber es schließt Jesus nicht ein, sondern eröffnet zugleich sein weiteres Wirken, das nicht begrenzt werden kann, sondern unerschöpflich ist.
Ganz ähnlich stellt Wengst zufolge (W590) „die rabbinische Tradition <1562> die Unerschöpflichkeit der auf der Tora gründenden Lehre … heraus“:
„Man sagte über Rabban Jochanan ben Sakkaj, dass er keine einzige Parascha von der Tora beiseiteließ, die er nicht studiert hätte. Er studierte auch die übrige Schrift sowie Targum, Midrasch, Halachot und Aggadot; alles studierte er. Und so sagte man über ihn, dass er gesagt habe: ,Wenn alle Himmel Blätter würden und alle Bäume Schreibrohre und alle Meere Tinte, wäre das nicht genug, um meine Weisheit aufzuschreiben, die ich von meinem Lehrer gelernt habe. Und doch habe ich von der Weisheit der Weisen nur so viel herausgenommen wie diese Fliege, die im großen Meer eintaucht und ihm nur ein wenig fehlen lässt.“
Indem der Verfasser des Nachtrags „das schon abgeschlossene Evangelium gleichsam zum Überlaufen“ bringt, demonstriert er die Wahrheit des abschließenden Verses 25:
Er geht nicht unmittelbar auf sein Ziel zu, dem Evangelium einen Autor zu geben (V. 24), sondern er erzählt zunächst eine Geschichte (V. 1-14) – eine Geschichte, die in nicht näher bestimmter Zeit spielt, aber an bestimmtem Ort in alltäglicher Situation. Es ist eine Geschichte, die prinzipiell zwar auch innerhalb des Evangeliums hätte stehen können – wie sie in ähnlicher Form ja auch tatsächlich im Lukasevangelium geboten wird (5,1-11) -, die aber jetzt nach Abschluss des Evangeliums nur noch als Ostergeschichte erzählt werden kann, wie auch alles weitere von Jesus noch zu Erzählende Ostergeschichten sein werden. Denn er ist ja kein ein für alle Mal Toter, sondern ein Lebendiger, der Zukunft hat und deshalb je und je Gegenwart gewinnen wird bei den Seinen – wie bei den Schülern am See. Von dem her, was über ihn geschrieben steht, gibt es immer noch mehr zu erzählen, als schon geschrieben ist.
So beendet Wengst seine Auslegung des Johannesevangeliums, nicht ohne allerdings (W591) noch Überlegungen zur „Über- und Unterschrift“ des Werkes hinzuzufügen, die in der „Masse der Handschriften“ mit „Evangelium nach Johannes“ angegeben wird. Dazu vertritt er die Auffassung (W592), dass die „in allen Überschriften und Unterschriften der Evangelien einheitliche Einführung des Autors mit ‚nach‘“ nur dann auf verständliche Weise erklärt werden kann,
wenn damit eine schon vorhandene Mehrzahl von Evangelien unterschieden und zugleich betont werden soll, dass in jedem von ihnen das Evangelium enthalten ist. Als Ort für die Entstehung der einheitlichen Überschriften und Unterschriften in den Evangelien hat Trobisch [58-68] die um die Mitte des 2. Jh.s anzusetzende Endredaktion des Neuen Testaments im Rahmen der Herausgabe einer christlichen Bibel wahrscheinlich gemacht. Er untersucht die Evangelientitel nicht isoliert, sondern zusammen mit den Titeln der übrigen neutestamentlichen Schriften…
Dass in dieser „christlichen Bibel“ das an die „vierte Stelle gesetzte Evangelium“ als „Evangelium nach Johannes“ bezeichnet wurde, ergibt sich aus der Sicht der Herausgeber Wengst zufolge (W592f.)
auf ihrer Ebene – d. h. im Blick auf das von ihnen redigierte Neue Testament, besonders im Blick auf die anderen Evangelien und die Apostelgeschichte – ganz von selbst. Sie lasen in Joh 21, dass der Schüler, den Jesus liebte, Verfasser dieses Evangeliums sei. Wollte man den auch hier noch namenlos Gelassenen identifizieren, fiel das bei Kenntnis der anderen Evangelien und der Apostelgeschichte nicht schwer. Er musste einer von den drei Schülern sein, die von den anderen Evangelisten in einer besonderen Nähe zu Jesus geschildert werden: Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Simon Petrus scheidet aus, weil er mehrfach im Gegenüber zu dem Schüler, den Jesus liebte, erscheint. Auch Jakobus, der Sohn des Zebedäus, kann es nicht sein, weil er nach Apg 12,1f. von König Herodes Agrippa I. schon früh hingerichtet wurde. So bleibt nur sein Bruder Johannes [vgl. Trobisch 81-86].
Nach Wengst (W593) war „der Verfasser des Nachtrags“ erfolgreich mit seiner Absicht, „diese besondere und von ihm erweiterte Schrift in die Gesamtkirche einzubringen“. Indem sein Evangelium gegenüber den anderen
die Geschichte Jesu neu erzählt, weist es besonders eindringlich auf die Notwendigkeit der weitergehenden Auslegung hin. Identisch bleibt nur, was unter veränderten Bedingungen anders gesagt wird. Die authentische Stimme Jesu wird nicht durch historische Rekonstruktion hinter den sie verwahrenden Zeugnissen gewonnen; in deren je neu gewagter Auslegung kann sie erklingen.
Im allerletzten Absatz seines Kommentars gibt Wengst der
Zuschreibung des vierten Evangeliums an den Zebedaiden Johannes, die gewiss nicht aus historischer Kenntnis erfolgte, … jedenfalls darin Recht …, dass es sich bei dem Autor um einen Juden handelt. Dieser Autor, den ich aus pragmatischen Gründen mit der Überlieferung „Johannes“ nenne, hat in seiner Situation die Stimme Jesu zu Gehör bringen wollen. Er hat es getan in einer heftigen Auseinandersetzung mit der Mehrheit seiner Landsleute, die ihrerseits Gründe hatte, seinen Glauben an Jesus als Messias nicht zu teilen. Sein Evangelium macht die Notwendigkeit situationsbezogenen Verkündigens ebenso deutlich, wie dessen Kontextgebundenheit klar hervortritt.
Abschließend hebt Wengst hervor, dass eine solche „Kontextgebundenheit“ des Johannesevangeliums vor allem „hinsichtlich seiner negativen Aussagen über ‚die Juden‘“ vorliegt, und betont nochmals mit Nachdruck (W593f.):
Die Reflexion unserer geschichtlichen Situation verbietet es, seine damals vielleicht verständliche Polemik nachzusprechen. Deren – leider oft nur zu bereitwillige und oft auch unbedachte – wiederholende Rezeption in der Auslegungsgeschichte verschüttet es, wie sehr auch dieses Evangelium im Kontext des Judentums steht. Das gilt es heute wahrzunehmen. So käme es darauf an, bei der Lektüre und Auslegung des Johannesevangeliums in der Kirche, ohne das Trennende verleugnen zu wollen, das mit dem Judentum Verbindende zu erkennen und herauszustellen. Dann könnte der Satz zum Leuchten kommen, den Jesus nach dem Johannesevangelium doch auch gesagt hat – ich zitiere ihn jetzt nach der Übersetzung Luthers: „Das Heil kommt von den Juden.“
Zu den beiden letzten Versen des Johannesevangeliums widerspricht Hartwig Thyen (T793) von vornherein „allen Autoren, die die V. 24 und 25 als sekundäre Zusätze von ,Redaktoren‘ oder ,Editoren‘ des Evangeliums von Joh 21 abtrennen wollen, aufs entschiedenste“. Sein erstes Argument ist dabei das hinweisende „houtos {dieser}, das diesen Vers einleitet“, das „außerhalb des Evangelientextes keinerlei reales Referenzobjekt“ hat und „dessen Leser vielmehr allein auf jene von dem realen Evangelisten mit literarischen Mitteln geschaffene fiktionale Figur“ verweist,
die bei der Lektüre des Evangeliums erst nach und nach ihre Konturen gewinnt. … Denn, wie die absichtsvolle Rekapitulation der ersten Einführung jenes Jüngers als des von Jesus geliebten (13,23ff) in V. 20 zeigt, läuft nicht nur Joh 21, sondern vielmehr das gesamte Evangelium auf die unlösbar zusammengehörigen V. 23-25 hinaus. Darum ist „jede Herauslösung dieser beiden Schlußverse 24 und 25 auch nur durch Alinea {Absetzung durch eine neue Zeile oder einen neuen Absatz} absolut grundlos“. <1563> Das gilt auch den meisten modernen Texteditionen gegenüber, die mit ihren vielfältigen Alinea anstelle des überlieferten Textes häufig fragwürdige Interpretationen desselben bieten.
Falls (T794) die Vermutung von Hengel [31-33 und 204-209] zutrifft, dass das Johannesevangelium „vom Augenblick seiner ersten Publikation an bereits durch die Inscriptio euangelion kata Iōannēn {Überschrift: Evangelium nach Johannes} und/oder die Subscriptio kata Iōannēn {Unterschrift: Nach Johannes} bezeichnet gewesen“ war wie in der Handschrift P66, müsste nach Thyen
sein Autor zugleich der Editor unseres Vier-Evangelien-Kanons sein. Denn der denkwürdige Gebrauch des Lexems euangelion als Gattungsname und die ebenso ungewöhnliche Zuschreibung eines Exemplars dieser Gattung an einen Autor durch kata mit dessen Namen kann nur der Feder des Herausgebers einer Reihe solcher Evangelien und dessen Absicht entstammen, sie so unterscheidbar und damit auch zitierbar zu machen. Zu solcher Einschreibung unseres Evangeliums in einen Evangelienkanon würde sein souveränes Spiel mit den synoptischen Texten ebenso passen wie sein Schlußvers (21,25), der sich mit seinem Verweis auf Bücher (!) ja wirklich ausnimmt, wie „das höchst charakteristische Schlußwort der urchristlichen Evangelienschriftstellerei“, das alle weiteren Versuche dazu „entmutigt“ oder ihnen doch zumindest „das Gehör der Gläubigen“ verschließt [Overbeck 455]…
Bereits 1897 hat Harnack <1564> über Johannes 21,24-25 geurteilt,
daß, verborgen in „einem dunklen Wir“, nämlich in dem wir wissen (oidamen), Spätere das Werk des Presbyters Johannes eigenmächtig um die V. 24f ergänzt und dessen Verfasser mit dem Zebedaiden identifiziert haben sollen
Darin liegt nach Thyen der „fast unausrottbare Grund für diese Abtrennung der beiden Schlußverse unseres Kapitels“, die noch fast „ein Jahrhundert später“ durch Hengel [224f.] „in fast allen Einzelheiten“ wie von Harnack begründet und von vielen weiteren Autoren vertreten wird:
Alle diese Autoren – und ihre Zahl dürfte die der 153 großen Fische weit übertreffen – urteilen so, weil sie aus V. 23 nicht den Tod des Evangelisten im Evangelium (Overbeck), sondern den Tod von dessen realem Verfasser herauslesen und die dadurch bestürzten Bruder mit dessen vermeintlichen Schülern identifizieren. Die sollen sich in den Wir von V. 24 als die Herausgeber des Evangeliums ihres eben verstorbenen Meisters zu Wort gemeldet und dem Werk mit V. 25 noch „die mächtigste Hyperbel, die je ein Buch schließen kann“, angefügt haben (Herder, Werke 273; zitiert von Overbeck [454]).
Aber wie ist nach Thyen (T795) der merkwürdige „Plural in oidamen {wir wissen}“ zu erklären? Er erinnert dazu an Johannes 1,14 und verweist auf 1. Johannes 1,1ff., um zu begründen, dass wie in diesen „Prologen … der implizite Autor auch in diesem Epílog auf das bewährte Instrument des plural auctoris“ zurückgreift, also auf die „Verwendung des Plurals durch eine Person, die dabei nur von sich selbst spricht und den Plural verwendet, um ihre Hörer oder Leser in ihren Gedankengang einzubeziehen“, wovon Thyen übrigens auch selbst oft Gebrauch macht:
„Mit diesem seinem ,Wir wissen‘ spricht der Verfasser nur den Glauben aus, mit dem er die Leser seiner Schrift zu entlassen wünscht. Es ist das Glaubensbekenntnis, in dem er sich und den Leser, den er durch seine Schrift gewonnen hat, eins weiß. Als Zeugnis eines Fremden an Fremde könnte es nur das Evangelium verdächtigen“ [Overbeck 454]. Als der Zeuge für die Wahrheit des im Evangelium Buch gewordenen Zeugnisses des Evangelisten im Evangelium meldet sich mit diesem plural auctoris am Ende der reale Evangelist und Verfasser dieses anonymen Pseudepigraphen {die Person, die der tatsächliche Verfasser als angeblichen Verfasser ausgibt} zu Wort. Und daß keiner, der zu dem Mittel der Pseudepigraphie greift, es riskieren wird, daß ihm sein fingierter Autor oder dessen Freunde eines Tages als lebendige Kritiker gegenübertreten könnten, versteht sich ja wohl von selbst. Es kommt hinzu, daß die Bezeichnung des impliziten Evangelisten als des Jüngers, den Jesus liebte, als eine literarische Invention des realen Evangelisten betrachtet werden muß. Denn so hat sich gewiß kein realer Christ je selbst genannt, und so werden ihn auch seine Mitjünger und Freunde schwerlich jemals bezeichnet haben.
So gesehen ist das Wort oidamen {wir wissen} das einzig greifbare Zeugnis des „reale[n] Autor[]s“ des Evangeliums, „der sich nach dem Motto des Johannes: Er muß wachsen, ich aber abnehmen! absichtsvoll und unwiderruflich in sein Werk und den geliebten Jünger als dessen Autor entäußert hat“.
Zur Frage, wer „ihm für sein Bild des geliebten Jüngers als Modell gedient hat“, lässt sich Thyen an dieser Stelle seine eigene des öfteren vorgestellte Auffassung durch Trobisch [85] bestätigen, der die Frage stellt,
ob der etwa anonym bleibe, weil der Evangelist seinen Namen nicht gekannt habe, um darauf zu antworten: „Nein, sondern weil es sich um den Zebedaiden Johannes handelt, den Verfasser des Evangeliums, und weil dieser sich auch sonst in seinem Werk nicht nennt, (denn) als ehemaliger Jünger des Täufers konnte Johannes (auch über diesen) aus eigener Anschauung berichten, so die Leserperspektive“.
Auf den „Zebedaiden Johannes als Modell“ bezieht sich Thyen, weil es ihm
zur Klärung der Frage nach der Figur des geliebten Jüngers sinnvoll und methodisch weiterführend [erscheint], zwischen diesem Modell, seinem Maler, nämlich dem tatsächlichen Evangelisten, den wir freilich nur als den Autor im Text kennen, und dem daraus entstandenen Bild des Jüngers, den Jesus liebte, zu unterscheiden. Dabei sind der Maler und sein Modell ganz fraglos reale Personen, der geliebte Jünger ist es jedoch nicht. Ihn gibt es nur als das aus dem Gegenüber von Maler und Modell entstandene abstrakte und idealisierte Porträt.
Overbeck [409] sieht Thyen zufolge „deutlich …, daß der Autor als den Erzähler der Geschichte Jesu nur einen Apostel gebrauchen konnte“, und lenkt (T796) zur Beantwortung der von ihm selbst gestellten
Frage, warum es gerade Johannes sein mußte, … seinen Blick auf Gestalt und Rolle jenes anderen Johannes, die in der gesamten übrigen Tradition nirgendwo „so kühn und willkürlich“ behandelt werde wie in unserem Evangelium, nämlich auf Johannes den Täufer, der in unserem Evangelium so freilich nie bezeichnet wird [Overbeck 417]:
„Nimmt man z. B. an, daß für den Verfasser des Evangeliums der Apostel Johannes für den eben angegebenen Zweck der gegebene Mann war, weil er seinem Evangelisten zu Jesus nach seinem Hinscheiden dieselbe Stellung zu geben gedachte, wie dem Täufer vorher, so verstand sich die mysteriöse Einführung des Evangelisten von selbst. Sein Name konnte dann im Evangelium gar kein anderer als ein Geheimname sein. Denn er trug ihn nicht wegen irgendwelcher Beziehung zum wirklichen Apostel Johannes, sondern wegen seiner Beziehung zur Idealfigur des Täufers im Kopfe des Verfassers des Evangeliums. Dieser hat selbst seinen Evangelisten unnennbar gemacht, weil er überhaupt nur eine Gestalt seiner ldealwelt ist, nur in dieser lebt und einen Namen hat. Natürlich mußte dieser Jünger einen Namen erhalten, aber ihn unter den ihm gegebenen Aposteln unmittelbar zu finden, konnte der Verfasser selbst nicht denken, sondern es handelt sich für ihn (darum), diesen Namen in den Apostelkreis hinein zu praktizieren, d. h. zu seiner Identifikation außerhalb dieses Kreises einzusetzen. Das gelang ihm, indem er zu seinem Idealjünger die Täufergestalt seines Evangeliums dazu erfand. Unter den Aposteln ist Johannes der Evangelist dieses Evangeliums nicht um seiner selbst willen, sondern um des Täufers willen als sein Namensvetter, oder anders gesagt: Er heißt Johannes um des ihm in seinem Evangelium zugefallenen Berufs willen und um der inneren Verwandtschaft dieses Berufs willen mit dem des Täufers in der ganzen Oekonomie der Offenbarung des göttlichen Lichts in der Welt nach der Grundvorstellung dieser Oekonomie, auf der laut Prolog das ganze 4. Evangelium beruht“.
Ich habe diese Worte Overbecks genau so ausführlich wie Thyen zitiert, um „sie der Vergessenheit zu entreißen und erneut zum Nachdenken darüber anzuregen“, denn
diese geniale Zusammenschau der beiden Träger des Namens Johannes in unserem Evangelium, die Matthias Grünewald in dem zentralen Kreuzigungsbild des Isenheimer Altars bereits vorweggenommen hat, erscheint uns für die Interpretation unseres gesamten Evangeliums überaus fruchtbar.
Dem letzten Vers 21,25 des Johannesevangelium widmet Thyen einen knappen letzten Absatz seines Johannes-Kommentars:
Mit seinem Spiel um die geschriebenen Bücher sowie um die ungeschriebenen, die aber geschrieben werden müßten, wenn man die unbeschreibbare Fülle alles dessen erzählen wollte, was Jesus getan hat, bildet dieser letzte Vers zusammen mit Joh 20,30f eine vollendete Inklusion um diesen Epilog. Das haben wir oben bereits begründet. Hatte der Evangelist sich in V. 24 mit dem auktorialen Plural oidamen (wir sind gewiß) zur Wahrheit des Zeugnisses des geliebten Jüngers bekannt, eines Plurals der, wie das etheasametha {wir sahen} von 1,14, zugleich alle Leser einladen will, in dieses Bekenntnis einzustimmen, so tut er in V. 25 mit dem singularischen oimai (ich bin der Meinung) jenseits des verbindenden und verbindlichen Bekenntnisses seine persönliche Meinung kund. Darauf, daß sich dieser Schlußvers tatsächlich ausnimmt wie „das höchst charakteristische Schlußwort der urchristlichen Evangelienschriftstellerei“, mit dem sein Verfasser alle weiteren Versuche dazu „entmutigt“ oder ihnen zumindest „das Gehör der Gläubigen“ verschließt [Overbeck 455], haben wir oben bereits hingewiesen.
Ton Veerkamp <1565> betrachtet die Verse 21,24-25 als die „Unterschrift“ dessen, den das Johannesevangelium selbst als seinen eigenen Autor versteht. Darin ist er mit Wengst und Thyen einig. Ein Werk zeitgenössischer Literatur des 20. Jahrhunderts <1566> zieht er zum Vergleich heran:
Der Autor der Denkwürdigkeiten aus dem Leben des deutschen Tonkünstlers Adrian Leverkühn ist in der Erzählung ein Doktor Serenus Zeitblom. In der Erzählung, die von Thomas Mann stammt, ist Zeitblom der Autor.
In der Erzählung, die wir ausgelegt haben, ist der geliebte Schüler einer der Sieben, die „den Herrn“ am Strand des Galiläischen Meeres sahen. Die Forschung mag versuchen, hinter Serenus Zeitblom den „Thomas Mann“ dieses Evangeliums ausfindig zu machen. Für die Deutung der Erzählung über Jesus ben Joseph aus Nazareth, Galiläa, ist Erfolg oder Misserfolg solcher Versuche belanglos. Der Doktor Serenus Zeitblom unserer Erzählung, der geliebte Schüler, hat ein wahrhaftiges und vertrauenswürdiges Zeugnis über Jesus ben Joseph abgegeben.
Kurz und bündig beschließt Veerkamp seine Johannesauslegung mit einem Blick auf die letzten Sätze dieses getreuen Zeugen:
„Ich lüge euch nichts vor“, sagt er, „ihr könnt euch auf diese geschriebenen Worte verlassen.“ Die Erzählung ist eine Auswahl, das hörten wir schon in 20,30f. Auch jener antike „Zeitblom“ wusste, dass andere ihre Auswahl brachten. Alles kann man nicht aufschreiben, die Welt ist nicht groß genug, um alle Bücher darüber fassen zu können, die darüber verfasst werden können. Diese 21 Kapitel müssen also reichen.
Sie reichen tatsächlich, um die Messiasauffassung jener radikal-messianischen, nicht länger isolierten Gruppe verstehen zu können.
Anders als Wengst und Thyen fügt Veerkamp seiner Auslegung jedoch noch einen eigenen Epilog an, in dem er Hintergründe und Zielsetzungen seiner Arbeit zu verdeutlichen sucht. Es würde zu weit führen, diese gesamten Ausführungen hier auszubreiten, ich möchte aber doch aus jedem der vier Kapitel dieses Epilogs jeweils einige wesentliche Gedanken hervorheben, um zu verdeutlichen, warum es mir am Herzen liegt, seiner befreiungstheologischen Lektüre des Johannesevangeliums Gehör zu verschaffen.
Zum Stichwort „Johannesevangelium und Antisemitismus“ <1567> schreibt Veerkamp:
Das Christentum produzierte mit Johannes eine nicht nur proto-, sondern originalrassistische Doktrin des Antisemitismus, die den Juden tatsächlich keine Chance mehr ließ, als Menschen überleben zu können. Johannes auslegen heißt, sich dieser Wirkungsgeschichte ständig bewusst zu sein. Jedoch sind Text und Wirkungsgeschichte zu unterscheiden. …
Mit „Wiedergutmachung“ hat das nichts zu tun. Für das, was geschehen ist, gibt es keine „Wiedergutmachung“ und keine Vergebung. Den Versuch, Antisemitismus zu überwinden, unternehmen wir für uns, denn er ist eine Verstümmelung unserer Seelen. Gerade weil wir durch Antisemitismus und Rassismus zutiefst entstellt sind, sind wir eine Gefahr für die Juden, für die gesamte Menschheit und nicht zuletzt für uns selbst. Dass Christen und Juden und andere miteinander darüber sprechen müssen, wie die Pest des Antisemitismus und des Rassismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Dieser Dialog ist schiere Pflicht.
Insofern es kein Geheimnis ist, dass Veerkamp die „messianische Inspiration“, <1568> auf die das Johannesevangelium hinausläuft, in engem Zusammenhang mit modernen sozialistischen Zielsetzungen betrachtet, verdeutlichen folgende Worte pointiert sein politisch-theologisches Glaubensbekenntnis:
Messianische lnspiration heißt auf alle Fälle, daß der Satz: „Es gibt keine Alternative zur faktischen und herrschenden Weltordnung“, ein heilloser, gottloser, böser Satz ist, eine richtige „Sünde wider den Heiligen Geist“. Messianische Inspiration heißt, dass in aller Politik etwas vom Messias zum Vorschein kommen sollte. Dieses Etwas ist bei Johannes die agapē, die Solidarität der Mitglieder der messianischen Gemeinde untereinander.
Die Verwandlung des jüdischen Messianismus, <1569> wie er in den Schriften des Neuen Testaments und insbesondere im Johannesevangelium propagiert wird, in das bis heute existierende Christentum betrachtet Veerkamp in differenzierter Weise:
Sicher war das Christentum über große Zeitstrecken eine religiöse Sanktionierung der herrschenden Ordnung. Aber tief in ihm steckt die Große Erzählung Israels, die der Impuls des Messianismus der Evangelien und der apostolischen Schriften war. Denn das Buch der Großen Erzählung, das die Kirche jeder neuen Generation weiterreicht, war immer wieder mächtiger als jeder kirchliche Disziplinierungsversuch, als alle religiösen Fälschungen und alle Versuche, die Große Erzählung Israels zu domestizieren. Die Aufhebung des Messianismus war und ist konkret das Bewahren der Großen Erzählung Israels. So wirkte und wirkt die Inspiration der Treue oder, klassisch, der Heilige Geist. Diese Wirkung ermöglichte der Abschied des Messias. In der Kirche. Nicht selten gegen die Kirche.
Schließlich stellt Veerkamp zur real existierenden „Weltordnung“ <1570> unserer Tage ernüchtert fest, dass uns wohl
die große Zeit des globalen Kapitalismus“ noch bevorsteht. Wir müssen unter den Bedingungen dieser realen Weltordnung, en tō kosmō, leben. Wir müssen unser 21. Kapitel noch schreiben, denn wir müssen nicht nach den Bedingungen der Weltordnung, ek tou kosmou, leben, anders gesagt: Wir müssen uns denen anschließen, die eine andere Weltordnung für möglich halten und deswegen Nein sagen zur herrschenden Weltordnung. Der Untergrund scheint ihnen und uns bestimmt zu sein, der Untergrund einer belächelten Minderheit mit ihren verzweifelten Liturgien der Demonstrationen, ihren trotzigen Publikationen, ihren noch machtlosen Aktionen. Sie ist eine Minderheit,die man vorerst nicht einmal entschlossen zu verfolgen gedenkt, eine Minderheit, bei der „nicht viele weise nach der fleischlichen Existenz, nicht viele mächtig, nicht viele hochgeboren“, vielmehr „töricht in den Augen der Weltordnung sind“, 1 Kor 1,26f. Diese Minderheit hütet den Vorschein des Messias.
Wir leben unter einer Weltordnung, gegen die augenblicklich keine radikale Gegenmacht und keine politische Strategie der radikalen Weltveränderung in Sicht ist. „Für mich ist der Augenblick, der kairos, nicht gekommen“, lässt Johannes seinen Messias sagen, 7,6. Wie schwer das auszuhalten war, zeigen die verzweifelten Diskussionen in Johannes 14-16. Wie schwer das auszuhalten ist, zeigen die verwirrend vielen und widersprüchlichen Aktionen und Diskussionen der Gegnerinnen und Gegner der über uns herrschenden Weltordnung.
Als Vermächtnis hinterlässt Ton Veerkamp uns ziemlich genau 15 Jahre vor seinem Tod am 28. Februar 2022 den Satz: „Der Widerstand ist heute entweder Amoklauf oder Liturgie“, und lässt keinen Zweifel daran, dass er, so wenig der johanneische Jesus für den Terrorismus der Zeloten übrig hatte und seinen das Schwert schwingenden Schüler Petrus in die Schranken wies, keinen Augenblick lang daran denkt, den Amoklauf in Erwägung zu ziehen:
Die Liturgie des Widerstands mag vorerst an den Machtverhältnissen der herrschenden Weltordnung wenig ändern, aber die Liturgien der Messianisten haben damals die Hoffung auf die absolute Alternative lebendig gehalten, und die heutigen Liturgien des Widerstands werden das gleiche bewirken. Im Widerstand dieser Minderheit schlägt das Herz des Messias. Der Feind des Johannes, die Weltordnung, ist immer noch unser Feind, weil in ihr ein Leben nach dem Maßstab des MENSCHEN, bar enosch, nicht möglich ist. Lehrt uns Johannes.
Diese Lehre gilt.
Lemgow- Schmarsau, März 2007
Ton Veerkamp
Diesen Worten möchte ich heute, am 23. Februar 2023, genau ein Jahr, nachdem ich mit dem Vergleich der drei Johanneskommentare von Klaus Wengst, Hartwig Thyen und Ton Veerkamp begann, hinzufügen, wie dankbar ich bin, von den Gedanken aller drei Autoren unermesslich viel gelernt zu haben und gelegentlich auch zu eigenen weiterführenden Gedanken angeregt worden zu sein.
Freuen würde ich mich, wenn meine Besprechung dieser drei Bücher dazu beitragen würde, dass Ton Veerkamps befreiungspolitische Lektüre des Johannesevangeliums sowohl in der kirchlichen Öffentlichkeit als auch in der akademischen Welt zumindest als eine von mehreren möglichen alternativen Verständnissen des Johannesevangeliums ernst genommen würde.
Helmut Schütz
↑ Anmerkungen
<937> Dritter Teil: Pascha – der Abschied des Messias, 13,1-20,31, Abs. 1-4 (Veerkamp 2021, 296; 2007, 24), und Vor dem Pascha, 13,1-30a, Abs. 1-3 (Veerkamp 2021, 296; 2007, 39).
<938> Hier weist Wengst (Anm. 1) darauf hin, dass er im „Folgenden … dankbar eine Anregung“ aufgreift, die ihm „Nikolaus Walter im Anschluss an eine Autorentagung in einem ausführlichen Brief vom 9.4.1997 gegeben hat.“
<939> Thyen zitiert F. F. Segovia, The Farewell of the Word: The Johannine Call to Abide, Minneapolis 1991, VIIIf., mit den oben von mir ins Deutsche übersetzten Zitaten im folgenden Abschnitt, demzufolge
„das gesamte Evangelium – mag es auch „the ultimate product of a process of accretion and expansion“ sein – dennoch, als „an artistic and strategic whole“ gelesen sein will. Und das gilt zumal darum, weil wir erkannt haben, daß jegliche derartige „theory concerning such a process of accretion and expansion sheds little light on the present meaning of the speech“. Darum können wir uns Segovias Worte über diesen Wechsel von einer redaktionsgeschichtlichen zu einer integrativen Perspektive der Johanneslektüre zu eigen machen und zu unserem Umgang mit dem Text mit Segovia erklären: „With this change from a redactional to an integrative perspective has come a further change from the idea of one sole and objective meaning in the text or in the author of that text – a general presupposition of the redactional approach – to the idea of meaning as a negotiation between text and reader. With such a change I would no longer claim to provide the definitive reading of this text against all those who posit a different reading. I seek to provide, instead, a reading that is comprehensive and persuasive, that reflects in some way my own social location and ideological stance as a reader and interpreter, and that is not presented as the only objective and definitive way to read the text. The reading is one of several such readings, and I offer it as such to my own readers.“
<940> Thyen zitiert Ammonius mit der Angabe: „Frgm. 442 bei Reuss 307“, ohne in seinem Literaturverzeichnis diese Quelle näher zu bezeichnen.
<941> Damit beruft sich Thyen auf Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 167.
<942> Herr und Lehrer als Sklave, 13,1-17, Abs. 1-6 (Veerkamp 2021, 297 und 299-300; 2015, 102-103 und 2007, 39-40).
<943> Dazu beruft sich Veerkamp auf Susanne Hausamann, Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten. Band 1: Frühchristliche Schriftsteller. „Apostolische Väter“, Häresien, Apologeten, Neukirchen/Vluyn 2001, 117ff. In seinem eigenen Buch Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung, Berlin 2013, 359f., schreibt Veerkamp, wie ich an anderer Stelle zusammengefasst habe:
Im sogenannten „Quartodezimanerstreit“ entschieden sich die westliche Kirche und Alexandrien um die Mitte des 2. Jahrhunderts dafür, das Osterfest „am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond [zu] feiern“, während es „die östlichen Gemeinden, vor allem die in Anatolien und Syrien, am 14. und 15. Tag des Monats Nisan, das heißt zwei Wochen nach diesem Neumond, also an wechselnden Wochentagen“ feiern, „wie Pesach bis heute bei den Juden gefeiert wird.“ Die Karfreitags- und Osterliturgie konfrontieren die „Befreiungstaten Gottes für Israel“ mehr und mehr „mit der Verwerfung und Tötung des Messias durch Israel“.
<944> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 211f.
<945> Herr und Lehrer als Sklave, 13,1-17, Abs. 1 und 7-11 (Veerkamp 2021, 297-298 und 300-301; 2015, 102-103 und 2007, 40-41).
<946> Wengst zitiert Siphre ad Deuteronomium § 355 in: sifrej al sefer d‘varim, hg. v. L. Finkelstein u. H. S. Horovitz, Nachdruck New York 1969 (Berlin 1939), 421, „MekhJ Mischpatim (Nesikin) 1“ nach: Mechilta d‘Rabbi Ismael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 (Erstausgabe Frankfurt am Main 1931), 248, und aus dem Jerusalemer Talmud den Traktat Peˀa 1,1 [15c]: talmud jeruschalmi, Nachdruck Jerusalem 1969 (Krotoschin 1866).
<947> Wengst zitiert Bemidbar Rabba 16,27 und Shemot Rabba 25,6: Midrasch Rabba über die fünf Bücher der Tora und die fünf Megillot. midrasch rabbah, 2 Bde., Nachdruck Jerusalem o.J. (Romm, Wilna 1887), 71c und 46b.
<948> So zitiert Wengst den Kommentar von H. J. Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg 1894, 235, und ergänzt die Feststellung:
Aber es könnte sein, dass gerade das Haften am Bild, ohne auf die mit ihm gemeinte Sache zu achten, dazu geführt hat, die Wendung „außer die Füße“ sekundär zu ergänzen.
Das unmittelbar folgende Zitat steht bei Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 272, der Wengst zufolge zwar „die Fußwaschung als Symbol des Kreuzestodes versteht“, ihr aber dennoch „nur sekundär ergänzende Funktion“ zuschreibt. Anschließend zitiert Wengst Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 433.
<949> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 357f. Auf ein weiteres Bultmann-Zitat in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<950> So zitiert Thyen Francis J. Moloney, The Gospel of John, Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 375, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Such information only serves to heighten the impact of Jesus‘ gesture. The recipients of this footwashing, a symbolic action that reveals Jesus‘ limitless love for his own, are ignorant disciples, one of whom he knows will betray him“.
<951> Thyen zitiert Heinrich Julius Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg, nach der 3. Auflage 1908, 176. Ähnlich wie Holtzmann urteilt Thyen zufolge Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 171:
„Was Jesus im Lc sagt, stellt er bei Jo handelnd dar“.
<952> Herr und Lehrer als Sklave, 13,1-17, Abs. 11-14 (Veerkamp 2021, 300-301; 2007, 41), und Anm. 409 zu seiner Übersetzung von Johannes 13,8 (Veerkamp 2021, 298; 2005, 75, Anm. 24).
<953> Veerkamp verweist dazu auf Hermann L. Strack / Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II, München 6. Auflage 1974, 557.
<954> Wengst zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 170.
<955> Thyen zitiert Sandra M. Schneiders, The Footwashing (John 13,1-20): An Experiment in Hermeneutics, CBQ 43 (1981), 80, mit folgenden oben von mir übersetzten Worten:
„If the signs are what Jesus did to reveal his glory so that his disciples would believe in him (John 2,11), then surely his paschal mystery in which he is fully glorified … and his disciples come to believe and to know who he really is … must be included among the signs. In what follows, the foot washing is regarded as a sign par excellence, i. e., a work of Jesus which reveals the meaning of salvation as the Fourth Gospel understands and presents it. The symbolic revelation of the act of the foot washing is re-symbolized in the text. In other words, the sign which was done for Jesus‘ first disciples is, by being written into the Gospel, made a sign for all who can read with understanding. This means that the footwashing is not an event which has a single, univocal meaning coterminous with the intention of the fourth evangelist and / or the understanding of his original audience, but that it is a symbol, endlessly giving rise to reflection, generating an ever deeper understanding of the salvation it symbolizes as the horizon of the text fuses with the various horizons of generations of readers“.
<956> Thyen beruft sich auf Emmanuel Lévinas, Die Zeit und der Andere, Hamburg 1989, und zitiert Ludwig Wenzlers Nachwort zu dieser Schrift: Zeit als Nähe des Abwesenden, 71.
<957> Das folgende Zitat von Hartwig Thyen steht in seiner Studie 43 zum Corpus Iohanneum, Joh 14,28: „Der Vater ist größer als ich“. Indiz einer subordinatianischen Christologie?, Tübingen 2007, 642f. Dort zitiert Thyen Ludwig Wenzlers in meiner vorigen Anmerkung genanntes Nachwort etwas ausführlicher, 70f.
<958> Thyen bezieht sich auf R. Alan Culpepper, The Johanine Hypodeigma: A Reading of John 13,1-38, in: R. A. Culpepper & F. F. Segovia (eds.), The Fourth Gospel from a Literary Perspective, Semeia 53, Atlanta 1991, 142f.
<959> Thyen zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums. Übers. M. Trebesius u. H. C. Petersen, 338.
<960> Thyen beruft sich auf Yves Simoens, La gloire d‘aimer: Structures stylistiques et interprétatives dans le Discours de la Cène, AnBib 90, Rom 1981, 115ff. und 151ff.
<961> So sieht es Thyen zufolge Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, 3. Bd, Freiburg, Basel u. Wien 1975, 29.
<962> So zitiert Thyen Herbert Kohler, Kreuz und Menschwerdung im Johannesevangelium, AThANT 72, Zürich 1987, 228, mit einem Verweis auf die Seiten 227ff. Auch das unmittelbar folgende Zitat stammt von Kohler, ebd.
<963> Herr und Lehrer als Sklave, 13,1-17, Abs. 15-16 (Veerkamp 2021, 301-302; 2007, 41).
<964> Vgl. dazu in meiner Zusammenfassung von Ton Veerkamp, Die Welt anders, Berlin 2013, den Abschnitt Die Struktur der Großen Erzählung:
Nach Veerkamp (50) begreift die Bibel Gott nicht als „höchstes Wesen“, sondern als die Beschreibung einer Funktion. Diese Definition erinnert an Martin Luthers Satz: „Worauf du nu . . . Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“ [Martin Luther, Großer Katechismus, Auslegung des ersten Gebots, Bekenntnisschriften der evang.-lutherischen Kirche (BSLK) 560,22-24] Ton Veerkamp meint also: „Es existiert kein Wesen Gott, so wie es kein Wesen, sondern nur die Funktion ‚König‘ gibt.“ Das Wort „Gott“ beschreibt, (51) was in einer Gesellschaftsordnung „als zentrales Organisationsprinzip für Autorität und Loyalität“ funktioniert. Das ist gemeint, wenn man in der Antike fragte: „Was ist sein [Gottes] Name?“
In Israel (53) ist dieser Name unaussprechlich, „der NAME ist ‚nur Stimme‘.“ Er hat keine Gestalt, man darf kein Bild von ihm machen und anbeten. Er ist gefüllt mit dem, was er tut; er führt aus dem Sklavenhaus, er befreit. Das altbekannte Wort „Gott“ bekommt einen neuen Namen, einen neuen Inhalt. (55) „Der NAME ist die Chiffre für eine Grundordnung, welche die Sklaverei ausschließt, Ba‘al ist die Chiffre für eine Gesellschaft der großen Eigentümer, die Sklaverei zwingend voraussetzt.“
<965> Vgl. dazu meine Arbeit Bibelauslegung – politisch UND fromm, inbesondere im Kapitel 6: Die Psalmen und das Gebet zum Gott der Tora.
<966> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 4: Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte, hg. v. Erwin Mühlhaupt, bearb. v. Eduard Ellwein, Göttingen 1954, 361 = WA.TR 3, 672, Nr. 3868.
<967> Thyen zitiert Maarten J. J. Menken, Old Testament Quotations in the Fourth Gospel. Studies in Textual Form, CBET 15, Kampen 1996. Die entsprechenden Seitenzahlen gebe ich in eckigen Klammern an.
<968> Herr, wer ist es? 13,18-30a, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 303-304; 2007, 42).
<969> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 52.
<970> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 214.
<971> Wengst zitiert Johannes Schneider, Das Evangelium nach Johannes, ThHK Sonderband, Berlin 1976, 249.
<972> Thyen zitiert Maurits Sabbe, The Footwashing in Jn 13 and Its Relation to the Synoptic Gospels, in: Studia Neotestamentica. Collected Essays, BETL 98, Leuven 1991, 418.
<973> Thyen bezieht sich auf Francis J. Moloney, A Sacramental Reading of John 13,1-38, CBQ 53 (1991), 250ff. Die wörtlichen Zitate im folgenden Absatz, die ich oben ins Deutsche übersetzt habe, stammen aus Francis J. Moloney, The Gospel of John, Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 384 und 254:
„Scribes could not tolerate the idea that the sharing of the morsel between Jesus and Judas might have eucharistic overtones and thus they eliminated words that made this association explicit“. Sein Fazit lautet darum: „We can now claim that there are sufficient indications in the text itself to argue that a subtheme to the meal, the gift of the morsel and of the new commandment in vv 21-38, is eucharistic, just as a subtheme to the footwashing and the gift of example in vv 1-17 was baptismal. The whole of 13,1-38 indicates that Jesus shows the quality of his love – a love which makes god known – by choosing, forming, sending out, and nourishing his disciples of all times, catching them up in the rhythm of his own self-giving life and death. Within the context of a meal which is indicated as eucharistic, Jesu gives the morsel to the most despised ,character‘ in the Gospel‘s narrative: Judas!“
<974> Helmut Gollwitzer, Krummes Holz – aufrechter Gang, Zur Frage nach dem Sinn des Lebens, München, 4. Auflage 1971.
<975> Herr, wer ist es? 13,18-30a, Abs. 6-8 (Veerkamp 2021, 304; 2007, 42-43).
<976> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 286.
<977> Herr, wer ist es? 13,18-30a, Abs. 9-12 (Veerkamp 2021, 305; 2007, 43).
<978> Das neue Gebot, 13,30b-38, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 306; 2007, 44).
<979> Dazu verweist Wengst auf den so betitelten ausführlichen Exkurs bei Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 523-537.
<980> Wengst zitiert Jörg Frey, Die johanneische Eschatologie II, Tübingen 1998, 135f. (dort teilweise kursiv) und 136.
<981> Dazu beruft sich Wengst auf „MekhJ Beschallach (Schira) 3“ (Mechilta d‘Rabbi Ismael. mechilta d‘Rabbi Jischmael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 [Erstausgabe Frankfurt am Main 1931], 126. Das folgende Gleichnis findet Wengst im Midrash Wayyikra Rabbah 2,5. midrasch wajikra rabbah, 5 Teile in 2 Bänden, hg. v. M. Margulies, Jerusalem 1993, 44. Das Zitat am Ende dieses Abschnitts stammt aus „bJom = Talmud Bavli Yoma Kippurim 86a“ (talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<982> Thyen zitiert George Bradford Caird, The Glory of God in the Fourth Gospel: An Exercise in Biblical Semantics, NTS 15 (1969), 265-277. Die folgenden Seitenzahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf dieses Werk. Das folgende ausführliche Zitat wurde oben von mir übersetzt und lautet im Originaltext:
„It therefore seems reasonable for me to suppose that a Jew, searching for a Greek word to express the display of splendid activity by man or God, which in his native Hebrew could be expressed by the niphal nikhaved, might have felt justified in adapting the Verb doxazesthai to this use, with every expectation that his Greek neighbour would correctly discern his meaning. Thus when John put in the mouth of Jesus the words ho Theos edoxasthē en autō, he could confidently expect his readers, whether Jews or Greeks, to understand that God had made a full display of his glory in the person of the Son of Man“ [277].
<983> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 441.
<984> Thyen zitiert Delbert Burkett, The Son of Man in the Gospel of John, JSNT, Sheffield 1991, 125f., mit den oben von mir übersetzten Worten:
„The reason for the tense in this context is that it allows Jesus to distinguish between two future moments of glorification: the past tenses in 31-32a refer to one, and the future tenses in 32b refer to another. The distiction would have obscured if the future tense had been used for both events. … The first moment of glorification, on the cross, will be followed by a second, in which the Son is glorified by the Father. … This second glorification will take place shortly after the glorification on the cross, for God will glorify him ,short away‘“.
<985> Er zitiert Burkett, ebd. 127, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Nothing in Isa 52,13ff, however, indicates that the Servant returns to glory formerly possessed. The idea of the previous glory of the Son of the Man must therefore have another source. Such a source appears in Isa. 6,1ff, a passage to which the Evangelist refers in Jn 12,37-41. In the vision of Isa 6, the prophet lsaiah sees Yahweh on a throne ,high and lifted up‘, his ,skirts‘ (schulaw) filling the temple. The LXX translates ,skirts‘ as ,glory‘ (doxa), understanding the term as a reference to the splendor in which Yahweh is clothed. Yahweh recieves further ,glory‘, in the sense of ,praise‘, from the seraphim, who cry to one another, ,Fill all the earth with his glory‘. In this vision, therefore, Yahweh is both ,lifted up‘ and ,glorified‘. In referring to this vision, the Evangelist identifies ,Yahweh‘ the glorified figur seen by lsaiah, as the pre-existent Son reigning in glory, remarking that lsaiah ,saw his [Jesus‘] glory‘ (12,41)“.
<986> Das neue Gebot, 13,30b-38, Abs. 4-7 (Veerkamp 2021, 307; 2007, 44).
<987> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 442. Auf ein weiteres Barrett-Zitat in diesem Abschnitt werde ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern verweisen.
<988> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 4: Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte, hg. v. Erwin Mühlhaupt, bearb. v. Eduard Ellwein, Göttingen 1954, 154 und 155.
<989> Wengst zitiert Tertullian, Apologeticum. Verteidigung des Christentums. Lateinisch und Deutsch, herausgegeben, übersetzt und erläutert von Carl Becker, München, 2. Aufl. 1961, 185 (Abschnitt 39,7).
<990> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 403. Auf weitere Bultmann-Zitate in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<991> Thyen beruft sich auf Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 385ff.
<992> Thyen bezieht sich auf Jörg Augenstein, Das Liebesgebot im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen, BWANT 134, Stuttgart, Berlin und Köln 1993, 94ff. und zitiert wörtlich 52. Auf weitere Augenstein-Zitate verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<993> Thyen zitiert Emmanuel Lévinas, Gott und die Philosophie. In: B. Kasper (Hg.), Gott nennen – Phänomenologische Zugänge, München 1981, 112f.
<994> Das neue Gebot, 13,30b-38, Abs. 8-11 (Veerkamp 2021, 307-308; 2007, 44-45).
<995> Das neue Gebot, 13,30b-38, Abs. 12-16 (Veerkamp 2021, 308-309; 2007, 45-46).
<996> Thyen beruft sich auf F. F. Segovia, The Farewell of the Word: The Johannine Call to Abide, Minneapolis 1991. Auf ein Zitat aus diesem Buch in diesem Abschnitt weise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern hin.
<997> Thyen bezieht sich auf Johannes Beutler, ‚Habt keine Angst‘. Die erste johanneische Abschiedsrede (Joh. 14), SBS 116, Stuttgart 1984.
<998> Thyen zitiert Günter Fischer, Die himmlischen Wohnungen. Untersuchungen zu Joh 14,2f. EHST 38, Bern Frankfurt 1975, 26, und Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 463.
<999> Thyen zitiert Hans-Joachim Iwand, Himmelfahrt: Joh 14,1-14. In: Ders., Predigtmeditationen, Göttingen, 4. Aufl. 1984, 642.
<1000> Der erste Einwand: Wir wissen nicht, wo du hingehst, 14,1-7, Abs. 1-2 (Veerkamp 2021, 309-310; 2015, 109 und 2007, 46).
<1001> Wengst zitiert das äthiopische Henochbuch nach S. Uhlig, JSHRZ V 6, Gütersloh 1984.
<1002> Wengst zitiert Siphre ad Deuteronomium § 307 in: sifrej al sefer d‘varim, hg. v. L. Finkelstein u. H. S. Horovitz, Nachdruck New York 1969 (Berlin 1939), 346.
<1003> Wengst zitiert SifBam § 82 (Sifre zu Num sifrej al sefer bamidmar ve-sifrej suta, hg. v. H. S. Horovitz, Nachdruck Jerusalem 1992 [Leipzig 1917]), 78.
<1004> Thyen zitiert E. Fuchs nach dem Vorwort zum Buch seines Schülers Jürgen Heise, Bleiben. Menein in den johanneischen Schriften, HUTh 8, Tübingen 1967, III.
<1005> Thyen zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie, Bd 2, München & Gütersloh, 1992, 302 und 287.
<1006> Thyen zitiert Johannes Neugebauer, Die eschatologischen Aussagen in den johanneischen Abschiedsreden, BWANT 7/20, Stuttgart, Berlin und Köln 1995, 137.
<1007> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 447. Auf ein weiteres Barrett-Zitat weise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern hin.
<1008> Thyen zitiert Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953, 8. Aufl. 1968, 404f., der in Johannes 14,2f. „the closest approach to the traditional language of the Church‘s eschatology“ sieht, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„By now it is surely clear that the ,return‘ of Christ is to be understood in a sense different from that of popular Christian eschatology. It means that after the death of Jesus, and because of it, His followers will enter into union with Him as their living Lord, and through him with the Father, and so enter into eternal life. That is what He meant when He said, ,I will come again and receive you to myself, that where I am you too may be“ (cf. also XVII 24)“.
<1009> Barrett zitiert J. Louis Martyn, History and Theology in the Fourth Gospel, New York 1968, 139.
<1010> Der erste Einwand: Wir wissen nicht, wo du hingehst, 14,1-7, Abs. 3-8 (Veerkamp 2021, 310-311; 2007, 46-47). Die Übersetzung von 14,2-3 mit den darauf bezogenen Anmerkungen 425 bis 427 steht dort in Abs. 1 (Veerkamp 2021, 309-310; 2015, 109 und 108).
<1011> Vgl. das Buch von Marcel Simon, Verus Israel. A study of the relations between Christians and Jews in the Roman Empire (135-425). Translated from the French: H. McKeating, Oxford 1986.
<1012> So der Titel des Buches von Helmut Gollwitzer, Vortrupp des Lebens, München 1975.
<1013> Wengst zitiert Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 462.
<1014> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 300, und Rainer Hirsch-Luipold, Gott wahrnehmen. Die Sinne im Johannesevangelium, Tübingen 2017, z. B. 52, 53, 85, 248.
<1015> Wengst zitiert ihn folgendermaßen: Briefe und Tagebücher I (1900-1918), hg. v. Rachel Rosenzweig u. Edith Rosenzweig-Scheinmann, 1979, 135.
<1016> Thyen zitiert Ignace de la Potterie, La Vérité dans Saint Jean I: AnBib 73, Rom 1977, 252f., mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Les mots hē alētheia kai hē zōē servent à indiquer – explicitement et sans image – le sens de la métaphore employée par Jesus au début du verset: egō eimi hē hodos. Ce premier terme, ,le chemin‘, est plus important. Il est vrai que les trois substantifs sont coordonnés grammaticalement (par un double kai), mais ils ne sont pas pour le sens. … Le premier kai est simplement epexégétique. Le verset ne signifie donc pas que Jesus est la chemin vers le Père, précisement en tant qu‘il est la vérité et la vie; alētheia et zōē expliquent son rôle de médiateur: c‘est parce que Jesus est la vérité et la vie qu‘il peut nous conduire au Père“.
<1017> Thyen zitiert Helmut Gollwitzer, Außer Christus kein Heil? (Joh 14,6), in: W. P. Eckert u. a. (Hgg.), Antijudaismus im Neuen Testament? Exegetische und systematische Beiträge, München 1967, 180.
<1018> Thyen zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Hermeneutik des christlich-jüdischen Verhältnisses, in: A. Baudis u. a. (Hgg.), Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Festschrift H. Gollwitzer, München 1979, 151.
<1019> So zitiert Thyen Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie, Bd 2, München & Gütersloh, 1992, 428.
<1020> So zitiert Thyen Carl Heinz Ratschow, Die Religionen, HST 16, Gütersloh 1979, 126.
<1021> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 180.
<1022> Der erste Einwand: Wir wissen nicht, wo du hingehst, 14,1-7, Abs. 9-18 (Veerkamp 2021, 311-313; 2007, 47-49).
<1023> Wenst zitiert Ruben Zimmermann, Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10, Tübingen 2004, 436.
<1024> So zitiert Wengst den Kirchenvater Augustin: Sancti Aurelii Augustini in Iohannis evangelium tractatus CXXIV, post Maurinos textum edendum curavit D. Radbodus Willems, CCSL 36, Turnholt 54; dt.e Übers.: Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes, übers. v. Thomas Specht, BKV 4-6, Bd. 1 u. 2, Kempten 1913, Bd. 3, 1914, 868 (Vortrag 71,3).
<1025> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 101f.
<1026> Wengst zitiert Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 465.
<1027> Thyen zitiert Hans-Joachim Iwand, Himmelfahrt: Joh 14,1-14. In: Ders., Predigtmeditationen, Göttingen, 4. Aufl. 1984, 644f.
<1028> Thyen zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie, Bd 2, München & Gütersloh, 1992. Die folgenden Seitenzahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf dieses Werk.
<1029> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 471. Auf weitere Bultmann-Zitate in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1030> Thyen bezieht sich auf Christian Dietzfelbinger, Die größeren Werke (Joh 14,12f): NTS 35 (1989), 27-47, und Der Abschied des Kommenden. Eine Auslegung der johanneischen Abschiedsreden, WUNT 95, Tübingen 1997, 44ff.
<1031> Der zweite Einwand: Zeige uns den VATER, und es genügt, 14,8-21, Abs. 2-7 (Veerkamp 2021, 315-316; 2007, 49-50).
<1032> Vgl. den Titel des Nachrufs auf Ton Veerkamp im „Tagesspiegel“ vom 5. Mai 2022: „Warum betest du nicht?“ – „Weil keine Antwort kommt.“
<1033> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 226.
<1034> Wengst verweist dazu auf Bereschit Rabba 24,7 (b‘reschit rabbah, hg. v. J. Theodor u. Ch. Albeck, 3 Bde., korrigierte Neuausgabe Jerusalem 1965, 2. Auflage 1996 (Berlin 1912-1936) 236f.
<1035> Wengst zitiert August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 365.
<1036> Wengst zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 299.
<1037> Thyen zitiert Jörg Augenstein, Das Liebesgebot im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen, BWANT 134, Stuttgart, Berlin und Köln 1993, 54ff.
<1038> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 476.
<1039> Der zweite Einwand: Zeige uns den VATER, und es genügt, 14,8-21, Abs. 8-10 (Veerkamp 2021, 316-317; 2007, 50).
<1040> Wengst zitiert Bernhard Weiss, Das Johannesevangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 486, Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 230, und Theodor Zahn, Das Evangelium des Johannes, KNT 4, Leipzig, 5. und 6. Auflage 1921, 568.
<1041> Der zweite Einwand: Zeige uns den VATER, und es genügt, 14,8-21, Abs. 1 und 11-14 (Veerkamp 2021, 315 und 317-318; 2015, 111 und 2007, 51). Außerdem verweise ich auf seine Anm. 436 zur Übersetzung von Johannes 14,21 (Veerkamp 2021, 315; 2015, 110).
<1042> Wengst zitiert ihn nach dem Werk des Kirchenlehrers Origines, Contra Celsum II 63.67.70.
<1043> Wengst zitiert „bMen = Talmud Bavli Menaḥot 29b“ (talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<1044> Thyen zitiert Christian Dietzfelbinger, Der Abschied des Kommenden. Eine Auslegung der johanneischen Abschiedsreden, WUNT 95, Tübingen 1997, 60f.
<1045> Thyen zitiert Jörg Augenstein, Jesus und das Gesetz im Johannesevangelium, KuI 14 (1999), 172.
<1046> So zitiert Thyen Friedrich-Wilhelm Marquardt, Was dürfen wir hoffen, wenn wir hoffen dürften? Eine Eschatologie, 3. Band, Gütersloh 1996, 424.
<1047> Thyen beruft sich auf Carl Heinz Ratschow, Jesus Christus, HST 5, Gütersloh 1982, 251ff.
<1048> Der dritte Einwand: Warum bist du für uns wirklich und nicht für die Weltordnung? 14,22-31, Abs. 2-9 (Veerkamp 2021, 319-321; 2007, 51-52), und Anm. 438 zur Übersetzung von Johannes 14,23 (Veerkamp 2021, 318; 2015, 112).
<1049> Wengst zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium des Johannes, KNT 4, Leipzig, 5. und 6. Auflage 1921, 573, Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 485f., und Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 365.
<1050> Wengst zitiert Bill Salier, Jesus, the Emperor, and the Gospel According to John, in: Challenging Perspectives on the Gospel of John, ed. by John Lierman, Tübingen 2006, 297.
<1051> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 133. Auf ein weiteres Blank-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1052> Wengst zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 187, der sich wiederum auf eine Aussage des Sokrates aus Plato, Phaidon 63b, bezieht. Auf ein weiteres Zitat von Bauer werde ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern verweisen.
<1053> Wengst zitiert Jörg Frey, Zu Hintergrund und Funktion des johanneischen Dualismus, in: Paulus und Johannes. Exegetische Studien zur paulinischen und johanneischen Theologie und Literatur, hg. v. Dieter Sänger u. Ulrich Mell, Tübingen 2006, 48.
<1054> Wengst zitiert Takashi Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium. Ein Beitrag zur Frage nach der theologischen und pragmatischen Funktion des johanneischen „Dualismus“, Neukirchen-Vluyn 1984, 101.
<1055> Thyen zitiert Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953, 8. Aufl. 1968, 407, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„an example of precisely the kind of wooden criticism which ought never to be applied to the work of a mind like our evangelist‘s.“ Denn „however long these discourses may be, they are burdened from beginning to end with the sense of parting, and the time is short“. Allen Hypothesen über die mögliche Genese der durch 14,31 bezeichneten Aporie gegenüber, sehen wir uns mit Dodd „still faced with the problem of explaining the existing text“.
<1056> Thyen zitiert Dodd, ebenda, 408, im Blick auf „the inner spiritual aspect of the situation immediately before the betrayal“ mit den oben von mir übersetzten Worten:
„it was not only in the Garden that Jesus faced His enemy. There He met the Adversary in the person of Judas and went to meet him, but the power and wickedness of the Archon were not confinecl to his human agent. Christ was already engaged with him; He was already advancing to the conflict, spiritually, while He yet spoke with his disciples in the upper room. That at least is a possible way of understanding the passage, and one well in accord with the evangelist‘s manner“.
<1057> Der dritte Einwand: Warum bist du für uns wirklich und nicht für die Weltordnung? 14,22-31, Abs. 10-20 (Veerkamp 2021, 321-322; 2007, 53-54).
<1058> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 316.
<1059> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 460.
<1060> Thyen beruft sich auf Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 417.
<1061> Thyen zitiert Manfred Frank, Das Sagbare und das Unsagbare, stw 317, Frankfurt, 2. Aufl. 1990, 217.
<1062> Thyen verweist auf Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953, 8. Aufl. 1968, 136, der sich wiederum auf J. H. Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to John, 2. Band, Edinburgh 1928 (Reprint 1953), 447f., beruft.
<1063> Thyen beruft sich auf Rainer Borig, Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Joh 15,1-10, StANT 16, München 1967, 79ff. und 145ff.
<1064> Thyen zitiert Eduard Schweizer, Neotestamentica, Zürich und Stuttgart 1963, 260, und verweist zusätzlich auf Eduard Schweizer, Ego eimi. Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen Bildreden, FRLANT 38, Göttingen, 2. Aufl. 1965, VIII, und Eduard Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordnung nach dem Neuen Testament, AthANT 35, Zürich 1959, 106.
<1065> Das Gleichnis vom Rebstock. Solidarität, 15,1-17, Abs. 1-14 (Veerkamp 2021, 322 und 324-325; 2015, 113 und 2007, 54-55) und Anm. 447 zur Übersetzung von Johannes 15,1 (Veerkamp 2021, 332; 2015, 112).
<1066> So zitiert Wengst Stefan Burkhalter, Die johanneischen Abschiedsreden Jesu. Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur, Stuttgart 2014, 180.
<1067> Thyen beruft sich auf F. F. Segovia, The Farewell of the Word: The Johannine Call to Abide, Minneapolis 1991, 138. Ein weiteres Zitat von Segovia, 139, im nachfolgenden Absatz habe ich oben ins Deutsche übersetzt:
Das Perfekt lelalēka muß man mit Segovia wohl als eines „of completed action pointing to the full ministry, including the ,hour‘, as already accomplished“ verstehen.
<1068> Thyen bezieht sich auf Rainer Borig, Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Joh 15,1-10, StANT 16, München 1967, 200f.
<1069> So zitiert Thyen Jörg Augenstein, Das Liebesgebot im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen, BWANT 134, Stuttgart, Berlin und Köln 1993, 68f. (Thyen verweist hier mit „ebd.“ auf das vorletzte von ihm (T634) erwähnte Werk von Augenstein; wenige Zeilen danach hatte er auf Jörg Augenstein, Jesus und das Gesetz im Johannesevangelium Bezug genommen, dazu passt aber nicht die hier angeführte Seitenzahl.)
<1070> Das Gleichnis vom Rebstock. Solidarität, 15,1-17, Abs. 15-16 (Veerkamp 2021, 326; 2007, 55-56), und Anm. 77 zur Übersetzung von Johannes 1,32 (Veerkamp 2021, 55; 2006, 16).
<1071> Thyen zitiert Rainer Borig, Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Joh 15,1-10, StANT 16, München 1967, und Edwin Clement Hoskyns (ed. by F. N. Davey), The Fourth Gospel, London, 2. Aufl. 1947; ich verweise auf beide Zitate mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1072> Thyen zitiert zur Stelle den Kommentar von Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990. Von Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 489, zitiert er die oben von mir übersetzten Worte:
„which is not intended to be taken literally. Jesus ist not talking about excommunication. The rest of the verse tells what happens to the branches which are thrown away. They wither for lack of sap, and their only usefulness is for firewood. Again, Jesus is not talking about eternal punishment; all he is saying is that a disciple who breaks fellowship with him is useless“.
<1073> Das Gleichnis vom Rebstock. Solidarität, 15,1-17, Abs. 17-18 (Veerkamp 2021, 326; 2007, 56).
<1074> Das Gleichnis vom Rebstock. Solidarität, 15,1-17, Abs. 18-19 (Veerkamp 2021, 326-327; 2007, 56).
<1075> Thyen beruft sich auf F. F. Segovia, The Farewell of the Word: The Johannine Call to Abide, Minneapolis 1991, 150.
<1076> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 449, und unmittelbar danach Eberhard Fuchs, Marburger Hermeneutik, Tübingen 1968, 155.
<1077> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 582.
<1078> So zitiert Thyen Klaus Wengst, Das Johannesevangelium, 2. Teilband: Kapitel 11-21: ThKzNT IV/2, Stuttgart 2001, 145. Wo ich in diesem Abschnitt auf weitere Wengst-Zitate mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern verweise, da ist dieses Buch gemeint.
<1079> Wengst zitiert Bruce J. Malina und Richard L. Rohrbaugh, Social-Science Commentary on the Gospel of John, Minneapolis 1998, 235.
<1080> Zu ihm führt Wengst ein Buch von Thomas Martin Schneider an: Reichsbischof Ludwig Müller. Eine Untersuchung zu Leben, Werk und Persönlichkeit, Göttingen 1993:
Er berichtet über „Feldgottsdienste“, bei denen Müller Joh 15,13 verwertete (61f.76). Auf S. 72 stellt er das gedankliche Gebräu zusammen, innerhalb dessen Joh 15,13 bei Müller steht, der dabei typisch ist für die starke Tradition des nationalen Protestantismus.
<1081> Wengst zitiert Mischna Avot 6,1 nach P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 565.
<1082> Wengst zitiert Bereschit Rabba 49,2 (b‘reschit rabbah, hg. v. J. Theodor u. Ch. Albeck, 3 Bde., korrigierte Neuausgabe Jerusalem 1965, 2. Auflage 1996 (Berlin 1912-1936), 500.
<1083> Thyen zitiert Hermann Timm, Geist der Liebe. Die Ursprungsgeschichte der religiösen Anthropologie (Johannismus), Gütersloh 1978, 95. Auf ein weiteres Timm-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1084> Thyen zitiert Ludwig Wenzlers Nachwort: Zeit als Nähe des Abwesenden, zur Schrift von Emmanuel Lévinas, Die Zeit und der Andere, Hamburg 1989, 70f. Auf ein weiteres Zitat Wenzlers verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1085> Hier bezieht sich Wenzler auf Emmanuel Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg und München, 2. Aufl. 1987, 199.
<1086> Dazu verweist Thyen auf Emmanuel Lévinas, Wenn Gott ins Denken einfällt, Freiburg und München, 2. Aufl. 1988, 224ff.
<1087> Thyen zitiert Martin Heideggers Hauptwerk „Sein und Zeit“ mit der Abkürzung SuZ 264, ohne es in seinem Literaturverzeichnis aufzuführen.
<1088> Thyen beruft sich auf Martin Dibelius, Joh 15,13: Eine Studie zum Traditionsproblem des Johannes-Evangeliums. In: Festgabe für Adolf Deissmann, Tübingen 1927, 168-186. Die im Folgenden zitierte Seitenzahl entspricht allerdings der Veröffentlichung desselben Werkes unter dem Titel: Botschaft und Geschichte Bd. 1, Tübingen 1953, 217.
<1089> Das Gleichnis vom Rebstock. Solidarität, 15,1-17, Abs. 20-23 (Veerkamp 2021, 327-328; 2007, 56-57).
<1090> Das hatte er in seiner Auslegung des ersten Johannesbriefs getan: Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung und Kommentar (= Texte & Kontexte 71/72 (1996)), 35ff. Einen Einblick in die Argumentation dieser Auslegung habe ich im Zusammenhang mit Veerkamps Auslegung von Johannes 3,16 gegeben.
<1091> Wengst zitiert Emanuel Hirsch, Das vierte Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt verdeutscht und erklärt, Tübingen 1936, 370f.
<1092> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 466.
<1093> Thyen zitiert Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953, 8. Aufl. 1968, 412, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„a peculiar Johannine turn“.
<1094> Der Kampf, 15,18-25, Abs. 1-15 (Veerkamp 2021, 328-331; 2015, 117 und 2007, 59).
<1095> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 468.
<1096> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 132, und Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 246 und 245.
<1097> Thyen beruft sich auf Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953, 8. Aufl. 1968, 413.
<1098> Dazu verweist Thyen auf Günter Reim, Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums, SNTS MS 22, Cambridge 1974, 42f. und 160ff. Die Veröffentlichung ist auf der Homepage von Günter Reim einsehbar.
<1099> Der Kampf, 15,18-25, Abs. 1 und 15-20 (Veerkamp 2021, 328 und 331-332; 2007, 60 und 2015, 116f.), und Anm. 457 zur Übersetzung von Johannes 15,22 (Veerkamp 2021, 328; 2015, 116).
<1100> Zu dieser Stelle schreibt Veerkamp (Anm. 461):
Die Stelle ist unerklärlich. Die LXX rettet sich aus der Affäre und schreibt: „Ihr Gebet ist zur Sünde geworden.“ Vielleicht könnte man nach Hiob 24,12, statt thefilla (Gebet, Preisung) thifla (Dreck) lesen, was in der Konsonantenschrift möglich ist. Dann hätten wir: „mich – das Stück Dreck!“
<1101> Der Abschied, 15,26-16,15 und Wenn er kommt, der Anwalt, Inspiration der Treue, 15,26-16,7, Abs. 1-3 Abs. 1-3 (Veerkamp 2021, 332-333; 2015, 119 und 2007, 61).
<1102> Thyen übersetzt in diesem Fall selbst das Zitat von Edwin Clement Hoskyns (ed. by F. N. Davey), The Fourth Gospel, London, 2. Aufl. 1947, 471f.:
„it is ye who must and do bear witness“.
Als „inhaltliche Parallele“ verweist Hoskyns an dieser Stelle auf 3. Johannes 12.
<1103> So zitiert Wengst den Kirchenvater Augustin: Sancti Aurelii Augustini in Iohannis evangelium tractatus CXXIV, post Maurinos textum edendum curavit D. Radbodus Willems, CCSL 36, Turnholt 54; dt.e Übers.: Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes, übers. v. Thomas Specht, BKV 4-6, Bd. 1 u. 2, Kempten 1913, Bd. 3, 1914, 959 (Vortrag 93,2).
<1104> Wengst zitiert Bemidbar Rabba 21,3: Midrasch Rabba über die fünf Bücher der Tora und die fünf Megillot. midrasch rabbah, 2 Bde., Nachdruck Jerusalem o.J. (Romm, Wilna 1887), 89a, mit Parallelen an anderen Stellen.
<1105> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 173 und 174.
<1106> Thyen zitiert Margaret Davies (identisch mit M. Pamment), Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel, JSNT S 69, Sheffield 1992, 299f.
<1107> Thyen bezieht sich auf Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, 3 Bd, Freiburg, Basel u. Wien 1975, 139.
<1108> Thyen beruft sich auf Martin Hengel, Die Zeloten, Leiden und Köln, 1961, 151ff.
<1109> Wenn er kommt, der Anwalt, Inspiration der Treue, 15,26-16,7, Abs. 4-12 (Veerkamp 2021, 334-336; 2007, 61-63).
<1110> Dazu verweist Veerkamp (Anm. 465) auf Einzelheiten bei Shimon Applebaum, The Legal Status of the Jewish Communities in the Diaspora, in: S. Safrai/M. Stern (Hgg.), The Jewish People in the First Century (CRINT I/1), Assen 1974, 420-463, hier 420ff.
<1111> Dazu zitiert Veerkamp (Anm. 467) den jüdischen Philosophen Jakob Taubes, der 1987 in seinem Buch Die politische Theologie des Paulus, München 1993, 38, über Paulus sagte:
„Nicht der Nomos {Gesetz, Tora}, sondern der ans Kreuz Geschlagene durch den Nomos ist der Imperator. Das ist ungeheuerlich, und dagegen sind alle kleinen Revoluzzer doch nichtig! Diese Umwertung stellt jüdisch-römisch-hellenistische Oberschicht-Theologie auf den Kopf, den ganzen Mischmasch des Hellenismus“.
<1112> Wengst zitiert Andreas Dettwiler, Die Gegenwart des Erhöhten. Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13,31-16,33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters, Göttingen 1995, 28. Auf ein späteres Zitat Thyens aus diesem Buch verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1113> Thyen bezieht sich auf Yves Simoens, La gloire d‘aimer: Structures stylistiques et interprétative dans le Discours de la Cène, AnBib 90, Rom 1981, 132ff., und Francis J. Moloney, The Structure and Message of John 13,1-38, ABR 34 (1986), 35ff. (im Literaturverzeichnis sind zu diesem Werk allerdings nur die Seiten 1-16 angegeben), und Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 416f. Auf ein weiteres Zitat aus diesem Kommentar verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1114> Dazu beruft sich Thyen gegen Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 430 (auf ein weiteres Bultmann-Zitat werde ich in eckigen Klammern verweisen), und Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 472, auf Ignace de la Potterie, La Vérité dans Saint Jean I: AnBib 73, Rom 1977, 58f., den er mit folgenden oben von mir übersetzten Worten zitiert:
„En déclarant à ses disciples qu‘il s‘en aille, Jésus, certainement, dit une chose paradoxale, énigmatique, que les apôtres étaient incapables de comprendre sur l‘heure: ils ne pourraient en saisir le vrai sens que lorsque le Paraclet serait venu. Ainsi, la parole dit par Jesus à la dernière Cène était déjà une vraie révélation, quoique encore implicite et voilée“.
<1115> Wenn er kommt, der Anwalt, Inspiration der Treue, 15,26-16,7, Abs. 1 und 13-16 (Veerkamp 2021, 333 und 336-337; 2007, 63-64), und Anm. 464 zur Übersetzung von Johannes 16,7 (Veerkamp 2021, 333; 2015, 118).
<1116> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 148. Auf weitere Zitate Schnackenburgs verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1117> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 251.
<1118> Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Gütersloh 2007, 835, zum Buch „Preisungen“ 103,6, und 629, zum Buch „Jirmejahu“ 51,10. Das nachfolgende Zitat steht im Anhang dieser Ausgabe der Schrift in dem Text von Martin Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift, 1108.
<1119> Wengst zitiert Andreas Dettwiler, Die Gegenwart des Erhöhten. Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13,31-16,33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters, Göttingen 1995, 227.
<1120> Wengst zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 197.
<1121> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 4: Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte, hg. v. Erwin Mühlhaupt, bearb. v. Eduard Ellwein, Göttingen 1954, 506.
<1122> So zitiert Wengst Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 314. Auf ein weiteres Zitat von Schenke verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1123> Thyen bezieht sich auf Ignace de la Potterie, La Vérité dans Saint Jean I: AnBib 73, Rom 1977, 399ff. u. 422ff. Das oben mit der Seitenzahl [410] bezeichnete und von mir ins Deutsche übersetzte Zitat lautet im Original:
„la démonstration de la culpabilité du monde par le Paraclet, qui se passe uniquement dans le coeur des disciples“.
<1124> Hier verweist Thyen auf M. F. Berrouard, Le Paraclet, défenseur du Christ devant la conscience du croyant (Jean 16,8-11), RSPT 33 (1949), 361-389.
<1125> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 435, Anm. 2. Auf weitere Bultmann-Zitate dieses Abschnitts verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1126> Thyen beruft sich auf Donald A. Carson, The Function of the Paraclete in John 16,7-11, JBL 98 (1979), 558ff. Das oben von mir übersetzte Zitat steht auf S. 565:
„he will convict the world of its sin, its righteousness, and its judgment“.
<1127> Thyen zitiert Wilhelm Thüsing, Die Erhöhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium, NTA 26, 1/2, Münster, 2. Aufl. 1970, 143f.
<1128> Thyen zitiert Christian Dietzfelbinger, Der Abschied des Kommenden. Eine Auslegung der johanneischen Abschiedsreden, WUNT 95, Tübingen 1997, 189. Auf ein weiteres Zitat von Dietzfelbinger in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1129> So zitiert Thyen Takashi Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium, WMANT 56, Neukirchen-Vluyn 1984, 135.
<1130> Thyen zitiert Werner Stenger, DIKAIOSYNĒ IN JO. XVI 8,10, NT 21 (1979), 6.
<1131> Thyen zitiert Edwin Hatch, The Meaning of John 16,8-11, HthR 14 (1921), 105, mit den oben von mir übersetzen Worten:
„according to which the believer is justified, or acquitted of his sins, through the pleading of Christ as his advocate in presence of the Father in heaven“.
<1132> So zitiert Thyen Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 502. An gleicher Stelle bzw. auf S. 503 sind diese beiden im folgenden Absatz oben von mir übersetzten Zitate zu finden:
„lt is the fact that God has taken action for the salvation of men (3,16), and that belief is not merely intellectual assent but a matter of entrusting oneself to God on the grounds that he has done so“.
„i. e. you will remain in the world to make known this fact, and so to bring it to bear upon the lives of men. For it is in the mission of the disciples that the Paraclete convicts the world, exposing men‘s hearts for the verdict one way or the other, according to their response“.
<1133> Wenn er kommt, der Anwalt, Inspiration der Treue, 15,26-16,7, Abs. 16 (Veerkamp 2021, 337; 2007, 64), Er kommt und klagt an, 16,8-12, Abs. 1-12 (Veerkamp 2021, 337-340; 2015, 118f. Und 2007, 65-67), und Anm. 470 zur Übersetzung von Johannes 16,9-11 (Veerkamp 2021, 337; 2015, 118).
<1134> Veerkamp zitiert Siegfried Schulz, Das Evangelium nach Johannes (NTD 4), Göttingen 1987, zur Stelle.
<1135> Veerkamp verweist auf Aurelius Augustinus: De Civitate Dei Libri XXII. Recensuit et commentario critico instruxit Emanuel Hoffmann, CSEL Vol. XXXX, Wien 1899.
<1136> Thyen zitiert Wilhelm Michaelis, Art. hodos ktl. ThWNT V (1954), 104ff.
<1137> So beruft sich Thyen Donald A. Carson, The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus, Grand Rapids 1980, 149, auf seine oben von mir übersetzten Worte:
„final apocalyptic climax of world history“.
<1138> Thyen zitiert Wilhelm Thüsing, Die Erhöhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium, NTA 26, 1/2, Münster, 2. Aufl. 1970, 149ff.
<1139> Thyen zitiert Hermann Strathmann, Das Evangelium nach Johannes, NTD IV, Göttingen, 6. Aufl. 1951, 216.
<1140> Thyen beruft sich auf Alv Kragerud, Der Lieblingsjünger im Johannesevangelium, Oslo 1959. Auf Zitate aus diesem Buch verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1141> Thyen bezieht sich auf Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, Freiburg, Basel u. Wien, Band III 1975, 170ff., und Band IV, 56ff. Das folgende Zitat steht in Band III, 170f.
<1142> So zitiert Thyen Takashi Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium, WMANT 56, Neukirchen-Vluyn 1984, 151.
<1143> Wenn sie kommt, die Inspiration der Treue, 16,13-15, Abs. 1-8 (Veerkamp 2021, 340-343; 2015, 119.121 und 2007, 67-69), und Anm. 474 zur Übersetzung von Johannes 16,13 sowie Anm. 475 zur Übersetzung von Johannes 16,15 (Veerkamp 2021, 340-341; 2015, 118.120).
<1144> Dazu verweist Veerkamp auf seinen Aufsatz: Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung und Kommentar (= Texte & Kontexte 71/72 (1996)), 109ff. In seiner Interpretation von 1. Johannes 5,6 schreibt er dort unter anderem (S. 111):
„Johannes“ will nicht, daß seine Leute meinen, der Messias komme mit dem Wasser allein, dem Wasser der Reinigung, denn Wasser steht für Reinigung und für den Inititialimpuls der messianischen Bewegung. Es ist nicht abwegig, hier an die Taufe zu denken. Er komme mit dem Blut. Blut ist auf alle Fälle nicht das Abendmahl. Blut steht für das Ende des Messias, wie für das Ende des Opfertieres.
Johannes schaltet jetzt zwei seiner berühmten Definitionen mit dem Wort estin, geschieht, ein: „Die Inspiration ist das Bezeugen, weil die Inspiration die Treue ist“. Die erste Definition ergibt sich aus der zweiten. Dabei ist an die eigentümliche Konnotation {Begriffsinhalt, Begleitvorstellung} der Copula {Bindewort} „ist“ zu erinnern. Die Inspiration ist das Bezeugen, ist also etwas, was geschieht: Hier wird die semitische Sprachlogik des „Johannes“ besonders auffällig. Die Inspiration geschieht als der Akt des Zeugnisses, weil in diesem Zeugnis die Treue sich vollzieht. Beide Definitionen werden durch die Partikel hoti verknüpft. Die Inspiration – also das Bekenntnis zu Jesus als dem „im Fleische einhergangenen Messias“ – ist das Zeugnis. Diese Inspiration der messianischen Gruppe, die an Israel und seiner Tora festhält, legt also Zeugnis darüber ab, daß Rom sich nicht vollständig durchgesetzt hat. Die Inspiration ist so die Treue selber. … Alētheia ist die Vertrauenswürdigkeit an sich und im Vollzug eben die Treue. Die Inspiration ist der Vollzug der Vertrauenswürdigkeit des „Gottes“ Israels; durch die Sendung des Messias in der Doppelgestalt Mosche und Jizchak {Mose und Isaak} ist die Tatsache, daß „Gott“ an diesem, Seinem Volk festhält, verbrieft. Das wird bezeugt; deswegen, und nur deswegen, kann man die Inspiration mit Bezeugen gleichsetzen. Das Subjekt des Zeugnisses ist, wie wir hören werden, „Gott“ selber, der die Treue ist. Die Inspiration kann als Zeugnis betrachtet werden, weil die Inspiration aus jener Treue stammt, durch die „Gott“ an Israel festhält, weil sie von Dem ausgeht, der den Messias gesandt hat, dem „Gott“ Israels. Es heißt nämlich, Er habe von seiner Inspiration uns gegeben (3,24b…).
Alles nun läuft auf das Eine hinaus. Das dreifache Bezeugen ist in Übereinstimmung mit sich selber: das hoffnungsvolle Beginnen (Wasser), das entsetzliche Ende (Blut) und die Inspiration, die daran gebunden ist, an beides: Anfang und Ende. Das Ende setzt den Anfang nicht außer Kraft – das ist den Leuten bekannt, gerade dieser Tod des Messias ist nicht das hoffnunglose Scheitern eines Messias, der gar keiner war. Der Anfang konnte aber nicht ohne gerade dieses Ende sein. Nicht weil es die Schrift sagt (vgl. Luk 24,25); das mag richtig sein, das ist aber nicht der Punkt. Sondern dieser Tod dieses Messias bedeutet für „den Fürsten dieser Weltordnung“, daß er abgeurteilt worden ist“, wie in den unserem Text sehr verwandten Abschiedsreden des Messias Jesus (Joh 16,11) gesagt wird. Nicht drei an sich selbständige Träger des Zeugnisses, sondern die strukturierte Einheit dieser drei mit einem Neutrum des bestimmten Artikels angegebenen „Reden“ ist hier gemeint: das Inspirieren, das Wasser, das Blut, das Bestimmte (dreimal die Partikel to), weil das von „Gott“ Bestimmte.
<1145> Veerkamp zitiert Jakob Taubes, Die politische Theologie des Paulus, München 1993, 37.
<1146> Nach Veerkamp (Anm. 478) haben sie sowohl die schriftliche (Matthäus 5,18) als auch die mündliche Tora (23,2-3) zu lernen.
<1147> So zitiert Veerkamp Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie II, München 1991, 49.
<1148> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 199.
<1149> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 539.
<1150> Hier zitiert Thyen Rudolf Bultmann, Geschichte und Eschatologie, Tübingen, 3. Aufl. 1979, 144.
<1151> Thyen zitiert Raymond E. Brown, The Paraclete in the Fourth Gospel, NTS (1966/67), 131, mit folgenden oben von mir zitierten Worten:
„We find no evidence that Johannine theology ever abandoned the hope of the final return of Jesus in visible glory, although the Gospel clearly put more emphasis on all the eschatological features that have already been realized in Jesus‘ first coming. The question is not one of the presence in and through the Paraclete as opposed to the coming of Jesus in glory, but one of the relative importance of each“.
<1152> Thyen zitiert Paolo Ricca, Die Eschatologie des Vierten Evangeliums, Zürich und Frankfurt 1966, 153ff.
<1153> Die Stunde der Frau, 16,16-24, Abs. 1-8 (Veerkamp 2021, 343-354; 2015, 121 und 2007, 69-70), und Anm. 480 sowie Anm. 481 zur Übersetzung von Johannes 16,16 (Veerkamp 2021, 343; 2015, 120).
<1154> Veerkamp zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes (NTD Band 4), Göttingen 2000, 254.
<1155> Wengst zitiert Turid Karlsen Seim, Frauen und Genderperspektiven im Johannesevangelium, in: Evangelien. Erzählungen und Geschichte, hg. v. Mercedes Navarro Puerto/Marinella Perroni (Deutsche Ausgabe hg. v. Irmtraut Fischer/Andrea Taschl-Erber), Die Bibel und die Frauen. Neues Testament 2.1, Stuttgart 2012, 223.
<1156> Wengst zitiert Ruben Zimmermann, The Woman in Labor (John 16,21) and the Parables in the Fourth Gospel, in: The Gospel of John as Genre Mosaic, ed. by Kasper Bro Larsen, Göttingen 2015, 338f.
<1157> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 445. Indem er sich dort (Anm. 7) auf „II Reg 1,17“ bezieht, meint er aber nicht 2. Könige 1,17 nach üblichem Verständnis, sondern bezieht sich auf die Bezeichnung des 2. Buchs Samuel in der Septuaginta als des zweiten von vier Büchern der Könige. Auch die Bultmann-Zitate im folgenden Absatz beziehen sich auf S. 445.
<1158> Thyen zitiert Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 509, mit folgenden Worten, deren Umschreibung in seinen eigenen Worten ich oben wiedergegeben habe:
„There is probably a literary allusion to Isa. 66,14: ,You shall see, and your heart shall rejoice‘“, und „The point of the parable is simply the sudden transition from grief to joy“.
<1159> Thyen zitiert Takashi Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium, WMANT 56, Neukirchen-Vluyn 1984, 154ff. und 154.
<1160> Die Stunde der Frau, 16,16-24, Abs. 9-19 (Veerkamp 2021, 346-347; 2007, 70-71).
<1161> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 223f.
<1162> Wengst zitiert Seder Eliyyahu Rabba 18 nach Pseudo-Seder Eliahu zuta (Derech Erec und Pirke R. Eliezer). seder Elijahu rabbah ve-seder Elijahu suta (tanna d‘bej Elijahu), hg. v. M. Friedmann, Jerusalem 1969 (Wien 1904), 92, und Pesikta Rabbati Hosafa 1,4 nach Pesikta Rabbati, hg. v. M. Friedmann, Nachdruck Tel Aviv 1963 (Wien 1880), 200b.
<1163> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 481.
<1164> Thyen zitiert Paolo Ricca, Die Eschatologie des Vierten Evangeliums, Zürich und Frankfurt 1966, 160f.
<1165> Die Stunde der Frau, 16,16-24, Abs. 1 und 20-22 (Veerkamp 2021, 344 und 347-348; 2015, 123 und 2007, 71-72), und Anm. 482 zur Übersetzung von Johannes 16,27 (Veerkamp 2021, 344; 2015, 122).
<1166> So lautet der Titel seines Hauptwerkes Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung © Institut für Kritische Theologie Berlin e. V. 2013, zu dem ich hier eine inhaltliche Einführung veröffentlicht habe: Ton Veerkamp: „Die Welt anders“.
<1167> Wengst zitiert Herbert Kohler, Kreuz und Menschwerdung im Johannesevangelium. Ein exegetisch-hermeneutischer Versuch zur johanneischen Kreuzestheologie, Zürich 1987, 146.
<1168> So zitiert Wengst Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 187. Außerdem verweist er darauf, dass nach Thyen (T676) „diese Wendung“ heißt, „daß sie (die Jünger) ihre Gemeinschaft mit Jesus und sein Liebesgebot preisgeben, daß jetzt jeder von ihnen sich selbst der Nächste ist“.
<1169> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 455.
<1170> Abschluss des Abschiedsgespräches, 16,25-17,1a, Abs. 1-5 (Veerkamp 2021, 348-349; 2015, 123 und 2007, 72), und Anm. 484 zur Übersetzung von Johannes 16,32 (Veerkamp 2021, 348; 2015, 122).
<1171> Zu Augustin verweist Wengst auf Augustins Vorrede zu seinen Predigten über den ersten Johannesbrief, ohne im Literaturverzeichnis dazu weitere Angaben zu machen; er zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 458, und Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 188 (wobei die Hervorhebung von ihm stammt).
<1172> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 4: Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte, hg. v. Erwin Mühlhaupt, bearb. v. Eduard Ellwein, Göttingen 1954, 543.
<1173> Thyen zitiert Gail R. O‘Day, ‚I Have Overcome the World‘ (John 16:33), Semeia 53 (1991), 162f., die ihrerseits auf R. Alan Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel, Philadelphia 1983, 37, Bezug nimmt, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„John 16,33 is more than (or other than) proleptic because it does not anticipate or look ahead to the moment of victory. It does not bring the narrative present into the future, but brings the future in the narrative present. This is different from speaking of the overlap between the future envisioned by Jesus and the present experience of the Johannine community (Culpepper, Anatomy 37). A temporal link is established between the narrative and the reader‘s experience, but it is established by changing the shape of the narrative present, not simply by using the future tense to point to the reader‘s present. … John 16,33 makes categories of prolepsis, anticipation, and retrospection essentielly non-functional because it establishes its own temporal order. The temporal figures of the farewell discourse convey its central theological conviction: the future is assured because the victory has already been won“.
<1174> Abschluss des Abschiedsgespräches, 16,25-17,1a, Abs. 1 und 5-13 (Veerkamp 2021, 348-350; 2015, 123 und 2007, 72-73).
<1175> Zur Gliederung des johanneischen Kapitels „Es war aber Nacht“ bei Veerkamp und zu den davon abweichenden Gliederungsvorstellungen der Autoren Wengst und Thyen verweise ich auf die Einleitung des Abschnitts Vor dem Pascha: Jesu Fußwaschung und der Verrat des Judas (Johannes 13,1-30a). Zum Inhalt von Kapitel 17 zitiere ich Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 2-3 und 10 (Veerkamp 2021, 355-356; 2007, 73-75).
<1176> Wengst zitiert Stefan Burkhalter, Die johanneischen Abschiedsreden Jesu. Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur, Stuttgart 2014, 268, Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 506, August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 391, Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 190, und Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 611.
<1177> Thyen bezieht sich auf Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 748-751, und Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 458ff. Auf ein weiteres Moloney-Zitat in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1178> Thyen bezieht sich auf Alfred Loisy, Le quatrième évangile. Les épitres dites de Jean, Paris, 2. Aufl. 1921, Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, W. O. Walker, The Lord‘s Prayer in Matthew and John, NTS 28 (1982), 237-256, Wolfgang Schenk, Die Um-Codierungen der matthäischen Unser-Vater-Redaktion in Joh 17. In: A. Denaux (ed.), John and the Synoptics, BETL 101, Leuven 1992, 587-607, Oscar Cullmann, Urchristentum und Gottesdienst, AthANT, Zürich (1944), 4. Aufl. 1962, Wilhelm Wilkens, Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums, Zürich 1958, Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes, ÖTK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, Wilhelm Thüsing, Herrlichkeit und Einheit. Eine Auslegung des Hohepriesterlichen Gebets Joh 17. Die Welt der Bibel 14, Düsseldorf 1962, und Wilhelm Thüsing, Die Bitten des johanneischen Jesus in dem Gebet Joh 17 und die Intentionen Jesu von Nazareth. In: R. Schnackenburg u. a. (Hgg.), Die Kirche des Anfangs. Festschrift H. Schürmann, Leipzig 1977 (= Freiburg 1978), 307-337. Auf Zitate der entsprechenden Autoren weise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern hin.
<1179> Thyen bezieht sich auf Percival Gardner-Smith, Saint John and the Synoptic Gospels, Cambridge 1938.
<1180> Thyen nennt Adelbert Denaux (ed.), John and the Synoptics, BETL 101, Leuven 1992, und hat außerdem Maurits Sabbe, Studia Neotestamentica. Collected Essays, BETL 98, Leuven 1991, im Blick, vor allem den darin enthaltenen Aufsatz John and the Synoptics: Neirynck vs. Boismard, 389-397, und Maurits Sabbe, The Four Gospels. Festschrift F. Neirynck, BETL 100, Vol. III, 2051-2082.
<1181> So hatte das unter anderem Hans Windisch, Johannes und die Synoptiker, UNT 12, Leipzig 1926, gesehen.
<1182> Wengst zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 615f.
<1183> Wengst zitiert Augustin: Sancti Aurelii Augustini in Iohannis evangelium tractatus CXXIV, post Maurinos textum edendum curavit D. Radbodus Willems, CCSL 36, Turnholt 54; dt.e Übers.: Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes, übers. v. Thomas Specht, BKV 4-6, Bd. 1 u. 2, Kempten 1913, Bd. 3, 1914, 1038 (Vortrag 105,1).
<1184> Alle mir zugänglichen Bibelübersetzungen teilen eine entsprechende Wiedergabe dieser Worte außer der oben zitierten Lutherbibel 2017 und der Zürcher Bibel 2007, die folgendermaßen übersetzen: „alles, was du ihm gegeben hast“.
<1185> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 261. Auf ein weiteres Wilckens-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1186> Wengst zitiert zwei Midraschim Tehillim 119,5 und 144,1 nach midrasch tehilim, hg. v. S. Buber, Nachdruck Jerusalem 1977 (Wilna 1891), 246b und 266b-267a, und den Traktat Berakhot 63a aus dem Babylonischen Talmud nach talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<1187> Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 410. Auf ein weiteres Calvin-Zitat in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1188> Wengst bezieht sich auf D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 4: Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte, hg. v. Erwin Mühlhaupt, bearb. v. Eduard Ellwein, Göttingen 1954, 567ff. und verweist mit den im folgenden Zitat in runden Klammern angegebenen Seitenzahlen auf dieses Buch.
<1189> So zitiert Wengst Johannes Beutler, Das Johannesevangelium, Freiburg u. a., 2. Auflage 2016, 452.
<1190> Zum Volk Israel zitiert Wengst „TanB Noach 19 (23a)“ und bezieht sich damit wohl auf Midrasch Tanchuma B, übersetzt v. Hans Bietenhard, Bern u. a. 1980 (Band 1), 1982 (Band 2). Zum Tempel verweist er auf „ShemR 25,8 (Wilna 46c)“, was in Midrash Shemot Rabbah (I-XIV), hg. v. A. Shinan, Jerusalem u. Tel Aviv 1984, zu finden sein könnte.
<1191> Thyen zitiert D. François Tolmie, Jesus‘ Farewell to the Disciples. John 13,1-17,26 in Narratological Perspective, Biblical Interpretation Series 12, Leiden 1995, 221, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„The use of this technique has a very powerful effect. It puts across forcefully the notion of Jesus absolute certainty that things will happen exactly the way he predicts“.
<1192> Thyen bezieht sich hier auf den von Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 519, behaupteten „Son of Man context“.
<1193> Thyen zitiert Johannes Fischer, Glaube als Erkenntnis, BevTH 105, München 1989, 51. Auf ein weiteres Zitat aus diesem Buch verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1194> Thyen zitiert Christian Dietzfelbinger, Der Abschied des Kommenden. Eine Auslegung der johanneischen Abschiedsreden, WUNT 95, Tübingen 1997, 270f.
<1195> Thyen zitiert Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen, nach der 4. Auflage 1980, 14. Auf ein weiteres Zitat aus diesem Buch verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1196> Thyen zitiert Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 519, mit den oben von mir übersetzten Worten:
Daß zōē aiōnios „John‘s regular substitute for the ,kindom of God‘ in the earlier tradition (ist), cf. 3,3.15ff“, wurde schon oft beobachtet. Lindars schließt daraus: „It is therefore true to say, that the first two verses of the prayer correspond with the opening of the Lord‘s Prayer: ,Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come‘…“.
<1197> Thyen bezieht sich auf Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933. Auf die jeweiligen Einzelzitate verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1198> So die von mir übersetzten Worte „splendidly voices Jewish Monotheism“, mit denen Thyen Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 519, zitiert; das folgende Zitat steht an gleicher Stelle und lautet im Original: „the whole weight of the OT“.
<1199> Thyen zitiert Johannes Fischer, Wahrer Gott und wahrer Mensch, NZSystTh 37 (1995), 174f.
<1200> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 4-9 (Veerkamp 2021, 350-351 und 355-356; 2015, 125 und 2007, 74), und Anm. 486 zur Übersetzung von Johannes 17,2 (Veerkamp 2021, 350; 2015, 124).
<1201> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 199, und Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 380 Anm. 2 und 385 Anm. 1.
<1202> Wengst zitiert den Midrasch Tehillim 91,8 nach midrasch tehilim, hg. v. S. Buber, Nachdruck Jerusalem 1977 (Wilna 1891), 200b.
<1203> Thyen bezieht sich hier auf den Wörterbuch-Artikel von Rudolf Bultmann und Dieter Lührmann, Art. phainō ktl., ThWBNT IX (1973), 5, und auf Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 380f.
<1204> Dazu verweist Thyen auf Friedrich Büchsel, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen, 5. Aufl. 1948, 160, der zu Johannes 17,6 geschrieben hatte:
„An den Vaternamen ist hier nicht gedacht, aber an all das, wodurch Jesus Gottes Wesen dem Menschen zum Bewußtsein gebracht hat“.
<1205> Thyen verweist auf Hans Bietenhard, Art. onoma ktl. im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament V (1954), 271. Auf ein weiteres Zitat aus diesem Artikel beziehe ich mich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1206> Thyen verweist auf Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 755. Auf weitere Stellen in diesem Buch verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1207> Thyen bezieht sich auf Joseph Bonsirven, Pour une intelligence plus profonde des Saint Jean, RSR 39 (1951), 176-196.
<1208> Thyen zitiert Brown [756] mit den oben von mir übersetzten Worten:
„So also the Johannine Jesus has come among men, not only knowing the name of God as ,I Am‘, but even hearing it, because he is the revelation of God to His people“.
<1209> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 16-18.11 (Veerkamp 2021, 256-258; 2007, 75-76).
<1210> So zitiert Wengst Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 382.
<1211> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 610.
<1212> Wengst zitiert Thomas von Aquins Kommentar zum Johannesevangelium, Teil 1, Göttingen 2011, Nr. 2214. Wengst verweist dazu weiter auf 2246-2248.
<1213> Thyen zitiert Ernst Haenchen, Johannesevangelium. Ein Kommentar (hg. von U. Busse), Tübingen 1980, 512.
<1214> So zitiert Thyen Karl Georg Kuhn, Art. hagios ktl. im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament I (1933), 93.
<1215> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 12-15 (Veerkamp 2021, 351 und 356-357; 2015, 125 und 2007, 75), und Anm. 489 sowie Anm. 490 zur Übersetzung von Johannes 17,11 (Veerkamp 2021, 351-352; 2015, 124).
<1216> Vgl. dagegen die Interpretation von Römer 13 durch Gerhard Jankowski, Die große Hoffnung. Paulus an die Römer. Eine Auslegung, Berlin 1998, 275ff., der das Kapitel von seiner Überschrift in Vers 12,21 her als Strategie eines konfrontationsfreien Umgangs mit der gleichwohl als grundsätzlich „böse“ eingeschätzten römischen Herrschaft deutet.
<1217> Veerkamp zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie II, 1991, 39.
<1218> Veerkamp bezieht sich auf Melanchthons Loci Communes I, Opera XXI, 85.
<1219> Thyen zitiert Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 526, Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 467f., und Armin Kretzer, Art. apollymi ktl.: EWNT I (1980), 326.
<1220> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 368.
<1221> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1.15.19 (Veerkamp 2021, 352 und 357-358; 2015, 127 und 2007, 75-76), und Anm. 491 zur Übersetzung von Johannes 17,12 (Veerkamp 2021, 352; 2015, 126).
<1222> Wengst verweist auf Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 323, der dort den Traktat Berakhot aus dem Jerusalemer Talmud 2,8 (5c) zitiert. Auch Thyen wird sich auf diese Stelle beziehen, auf die ich dort mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern verweise.
<1223> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 389 Anm 3. Auf ein weiteres Bultmann-Zitat in diesem Abschnitt, das Thyen anführen wird, verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1224> So zitiert Wengst Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 506.
<1225> Thyen beruft sich auf Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 526.
<1226> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 19-21 (Veerkamp 2021, 352 und 358; 2015, 127 und 2007, 76-77), und Anm. 487 zur Übersetzung von Johannes 17,6 sowie Anm. 492 zur Übersetzung von Johannes 17,14 (Veerkamp 351-352; 2015, 124.126).
<1227> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 612.
<1228> So zitiert Wengst Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 419.
<1229> Wengst zitiert „TanB Qedoschim 2 (36b-37a)“ nach: Midrasch Tanchuma B, übersetzt v. Hans Bietenhard, Bern u. a. 1980 (Band 1), 1982 (Band 2). Die am Schluss genannte Abkürzung „Sof“ bezieht sich auf den Traktat der Schriftgelehrten „Masechet Soferim“.
<1230> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 212, und verweist auf seine Auslegung von Johannes 10,17f.
<1231> Thyen zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes, Stuttgart 4. Auflage 1975, 323.
<1232> Thyen setzt sich auseinander mit Wilhelm Thüsing, Herrlichkeit und Einheit. Eine Auslegung des Hohepriesterlichen Gebets Joh 17. Die Welt der Bibel 14, Düsseldorf 1962, Martin Dibelius, Joh 15,13: Eine Studie zum Traditionsproblem des Johannes-Evangeliums, in: Festschrift für Adolf Deissmann, Tübingen 1927, 168-186 (= Ders., Botschaft und Geschichte Bd. I, Tübingen 1953, 204-220), Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, und Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986. Auf die jeweiligen Einzelzitate verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1233> Thyen zitiert Johannes Fischer, Glaube als Erkenntnis, BevTH 105, München 1989, 84, und verweist weiter auf 76ff.
<1234> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 21-26 (Veerkamp 2021, 353 und 358-359; 2015, 127 und 2007, 77-78), und Anm. 493 zur Übersetzung von Johannes 17,17 (Veerkamp 2021, 353; 2015, 126).
<1235> Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar, in: Texte & Kontexte 71/72 (1996), 38. Auf weitere Zitate aus dieser Auslegung verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1236> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 422.
<1237> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 281.
<1238> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 206.
<1239> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 393. Auf ein zweites Bultmann-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1240> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 27-30 (Veerkamp 2021, 353 und 359-360; 2015, 127 und 2007, 78), und Anm. 494 zur Übersetzung von Johannes 17,21 (Veerkamp 353; 2015, 126).
<1241> Wengst zitiert Nicole Chibici-Revneanu, Die Herrlichkeit des Verherrlichten. Das Verständnis der dóxa im Johannesevangelium, Tübingen 2007, 292. Auf einer weiteres Zitat von ihr verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1242> So zitiert Wengst Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 2, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 282, und verweist auf ein weiteres Zitat auf derselben Seite: „Einheit ist nach Johannes beides: gegenwärtige Gabe und bleibendes Ziel aller Glaubenden.“
<1243> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 397. Auf weitere Bultmann-Zitate in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1244> Wengst zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 628 sowie 617 und 628.
<1245> Vgl. dazu Thyens Bezugnahmen auf J. Fischer in seinen Auslegungen von Johannes 8,45-47, von Johannes 10,25-30 und von Johannes 17,1-5.
<1246> Thyen beruft sich auf Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 474).
<1247> Thyen bezieht sich auf Alois Stimpfle, Blinde sehen. Die Eschatologie im traditionsgeschichtlichen Prozeß des Johannesevangeliums, BZNW 57, Berlin 1990, 217ff.
<1248> Thyen zitiert Charles Francis Digby Moule, The Individualismu of the Fourth Gospel, NT 5 (1962), 180, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„neither of these pregnant uses precludes the holding of a ,normal‘ expectation of a future consummation in addition. lt is not a realized eschatology in exchange for a futurist, but merely an expression of that element of the realized which inheres in any Christian eschatology“.
<1249> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 31.33-38.32 (Veerkamp 2021, 353 und 360-361; 2015, 127 und 2007, 78-80), und Anm. 497 zur Übersetzung von Johannes 17,24 (Veerkamp 2021, 354; 2015, 128). Außerdem werfe ich einen Blick auf Veerkamps Übersetzung von 17,24 aus dem Jahr 2005 (Veerkamp 2005, 91, Anm. 84).
<1250> Vgl. dazu meine adventliche Betrachtung „Ein Augenblick, und ihr werdet mich sehen“ sowie Veerkamps Auslegungen von Johannes 16,16-19 und von Johannes 16,20-22.
<1251> Wengst zitiert August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 404.
<1252> Wengst zitiert Marie-Therese Sprecher, Einheitsdenken aus der Perspektive von Joh 17. Eine exegetische und bibeltheologische Untersuchung von Joh 17,20-26, Bern u. a. 1993, 215.
<1253> Wengst zitiert den Tosefta-Traktat Berakhot 3,7, hg. v. S. Lieberman, seder serajim, Jerusalem, 2. Auflage 1992; seder moˀed, New York 1962; seder naschim (sota, gittin, kidduschin), New York 1973, auf den Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 326, verweist.
<1254> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 616.
<1255> Das Gebet des Messias, 17,1b-26, Abs. 1 und 39 (Veerkamp 2021, 354 und 361-362; 2015, 129 und 2007, 80), und Anm. 498 zur Übersetzung von Johannes 17,25 (Veerkamp 2021, 354; 2015, 128).
<1256> Verhaftung und Verhör, 18,1-28a, Abs. 3-4 und 1-2 (Veerkamp 2021, 362; 2007, 80-81).
<1257> Wengst verweist hierzu auf Flavius Josephus, De Bello Judaico. Der jüdische Krieg, Griechisch und Deutsch, Band 5, hg. v. O. Michel und O. Bauernfeind, München 1959-1969, 70. Die Stelle ist unter Bell. 5,2,3 in der Übersetzung von H. Clementz einsehbar.
<1258> Wengst bezieht sich auf Friedrich-Wilhelm Marquardt, Eia, wärn wir da – eine theologische Utopie, Gütersloh 1997, 129-131, und Magdalene L. Frettlöh, Christus als Gärtner. Biblisch- und systematisch-theologische, ikonographische und literarische Notizen zu einer königlichen Aufgabe, in: Jabboq VI, hg. v. Jürgen Ebach u. a., Gütersloh 2007, 161-203.
<1259> Thyen bezieht sich auf Walter Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament, Berlin, 5. Aufl. 1958, völlig neu bearbeitet von B. u. K. Aland, 6. Aufl. 1988.
<1260> Verhaftung, 18,1-14, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 364; 2007, 81), und Anm. 502 zur Übersetzung von Johannes 18,1 (Veerkamp 2021, 363; 2015, 128).
<1261> So zitiert Wengst Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 647. Zu Josephus beruft er sich im folgenden Satz auf „Bell 3, 67“, unter Bell. 3,4,2 in der Übersetzung von H. Clementz einsehbar.
<1262> Verhaftung, 18,1-14, Abs. 3 (Veerkamp 2021, 364; 2007, 81).
<1263> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 253. Auf ein weiteres Zitat von Schnackenburg verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1264> Wengst beruft sich auf H. H. Schaeder, Artikel nazarenós, nazoraíos, in: Theologisches Wörterbuch IV, 879-884 (das Zitat steht auf S. 884).
<1265> Wengst zitiert Johannes Schneider, Das Evangelium nach Johannes, ThHK Sonderband, Berlin 1976, 293.
<1266> Wengst zitiert Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 525.
<1267> Wengst zitiert Hans-Ulrich Weidemann, Der Tod Jesu im Johannesevangelium. Die erste Abschiedsrede als Schlüsseltext für den Passions- und Osterbericht, BZNW 122, Berlin u. a. 2004, 255.
<1268> Wengst beruft sich auf „Tan Wajigasch 4“, zitiert nach Midrasch Tanchuma, Nachdruck in Israel o. O. u. o. J. (Wilna 1833), 68a-b, auf den außerdem P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 568, verweist.
<1269> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 423.
<1270> Thyen zitiert die Selbstbiographie des Josephus mit der Angabe „Vit 235“ nach der Edition des griechischen Textes von Benedikt Niese (1890); in der deutschen Übersetzung von H. Clementz ist dieser Text am Ende des Abschnitts 45 zu finden.
<1271> Thyen zitiert Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina Series Vol. 4, Collegeville, Minnesota 1998, 467f. und 465, mit folgenden oben von mir übersetzten Worten:
„The only figure in the story Jesus could not ,care for‘ is Satan who planned the betrayal (cf. 13,2). Jesus washed the feet and shared the morsel with Judas despite Satan‘s designs (cf. 13,2). Nevertheless, Satan entered Judas (cf. 13,27) ,that the Scripture might be fullfilled‘ (17,12d; cf. 13,18). There is a divine order in the events of the life and death of Jesus beyond his control. The son of perdition is beyond the controll of Jesus, but he has cared for his disciples. During their time with him they have been made clean by his word (cf. 13,10; 15,3) that they have kept (17,6), and they have believed that he is the Sent One of the Father (cf. 16,30; 17,8). He has manifested the name of God to them (cf. 17,6). Jesus has kept and cared for all the disciples entrusted to him by the Father, including Judas. The intervention of the son of perdition is part of the larger plan of God manifested in the Scriptures, but so is the limitless love of God revealed in the unfailing love of Jesus for fragile disciples (cf. 13,18-20). He is asking the Father to be ,father‘ to all the disciples, including Judas“. Zu unserem Vers 18,9 sagt er dementsprechend: „The position taken in the interpretation, that the absolute nature of Jesus‘ claim both here and in 17,12 includes Judas, is further indication that ,the son of perdition‘ in 17,12 is not Judas, but Satan (cf. 2Thess 2,3.8f)“.
<1272> Verhaftung, 18,1-14, Abs. 4-6 (Veerkamp 2021, 3645-365; 2007, 81-82).
<1273> So zitiert Wengst Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 39f.
<1274> Verhaftung, 18,1-14, Abs. 7-8 (Veerkamp 2021, 365; 2007, 82).
<1275> So merkt Ton Veerkamp, Alle Worte und Taten des Messias. Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen, in: Texte & Kontexte 157-159, 32, zu Johannes 5,39 an, dass Matthäus „zum Verzicht auf Widerstand gegen die römische Macht … nicht aus pazifistisch-moralischen, sondern aus taktisch-klugen Erwägungen“ aufruft.
<1276> Vgl. dazu nur das, was ich aus Veerkamp 2013, 246, unter der Überschrift Große Erzählung – messianistisch interpretiert, zusammenfasse.
<1277> Wengst zitiert „bPes 57a“, also den Traktat Pesaḥim 57a im Babylonischen Talmud: talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<1278> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 275.
<1279> Verhaftung, 18,1-14, Abs. 9 (Veerkamp 2021, 365-366; 2015, 131 und 2007, 82), und Anm. 503 zur Übersetzung von Johannes 18,12 (Veerkamp 2021, 364; 2015, 130).
<1280> Wengst zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 650, und Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 333.
<1281> Thyen bezieht sich auf Frans Neyrinck, The ‚Other Disciple‘ in Jn 18,15-16, in: Evangelica Leuven, University Press, 1982, 335-364. Sein Literaturverzeichnis enthält allerdings keine Quellenangabe zu diesem Autor.
<1282> Vgl. dazu A. J. Simonis, Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium. Versuch einer Analyse von Johannes 10,1-18 nach Entstehung, Hintergrund und Inhalt, Rom 1967, der erwogen hat, in Johannes 10,3 („Dem [Hirten der Schafe] macht der Türhüter auf“) „eine ironische Aussage“ zu sehen, die sich auf die „jüdische Obrigkeit“ beziehen kann (S. 156):
In der Tat, die jüdische Obrigkeit hat Jesus aufgetan, um die Seinen hinauszuführen, nämlich indem sie ihm den Weg zum Kreuz bahnt. Dadurch, dass die jüdische Obrigkeit im Unglauben verharrt und ihm keinen Zugang gewährt, wird für ihn tatsächlich der Weg freigemacht, den Auftrag des Vaters zu erfüllen (vgl. 10, 17-18).
Auf welche der jüdischen Obern der Vers aber konkret gedeutet werden muss, ist schwer auszumachen. Jedenfalls muss man in der Richtung des Tempelambiente suchen.
Im Besonderen kann nach Simonis in dem Vers sogar (S. 157):
eine versteckte Anspielung auf Kaiphas gesehen werden. Zwar ist der Torwächter des Tempels im Ganzen des Tempelkults der Untergeordnete des Hohepriesters. Auch wird der Name des Kaiphas erst in 11, 49 genannt. Aber in der Idee drückt das thyrōros gerade das Wesen seines Amtes aus.
… Seine Amtspflichten sind religiös-gesellschaftlicher, aber in erster Linie kultischer Art. Ihm allein ist, einmal im Jahre, beim Opfer des grossen Versöhnungstages der Eintritt in das Allerheiligste zugestanden.
Vor allem aber erscheint Kaiphas in Johannes 11,47-53 (S. 157f.)
wider Wissen und Willen als Prophet. … So erscheint Kaiphas hier „im Lichte tragischer Ironie“ und erschliesst, ohne es selbst zu wissen, den Weg zu dem tiefen Erlösungsgeheimnis des Todes Jesu. Der längst geplante Todesbeschluss wird nun endlich gefasst. Denn gleich folgt in 11,53: „Am selben Tage fassten sie den Beschluss, ihn zu töten“. Das Wort des Kaiphas findet also Zustimmung und öffnet nach Gottes Plan für Jesus den Weg, für die Rettung des Volkes, ja, der Menschen überhaupt, zu sterben. Auf diese Weise öffnet der alte Hohepriester die Tür für den neuen Hohenpriester.
<1283> Simons Nachfolge. Jesus vor dem Großpriester, 18,15-28a, Abs. 1-3 (Veerkamp 2021, 366-368; 2015, 131 und 2007, 82-83).
<1284> Wengst bezieht sich auf Wolfgang Stegemann, Gab es eine jüdische Beteiligung an der Kreuzigung Jesu? KuI 13, 1998, 19 und 20.
<1285> So zitiert Wengst Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 434.
<1286> Wengst zitiert Rainer Hirsch-Luipold, Klartext in Bildern. Alethinós, paroimía, parrhesía, semeión als Signalwörter für eine bildhafte Darstellungsform im Johannesevangelium, in: Imagery in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, ed. by Jörg Frey, Jan G. Van der Watt a. Ruben Zimmermann, Tübingen 2006, 85.
<1287> Simons Nachfolge. Jesus vor dem Großpriester, 18,15-28a, Abs. 1 und 4-5 (Veerkamp 2021, 366 und 368; 2015, 131 und 2007, 83), und Anm. 505 zur Übersetzung von Johannes 18,20 (Veerkamp 2021, 366; 2015, 130).
<1288> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 56.
<1289> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 46.
<1290> Simons Nachfolge. Jesus vor dem Großpriester, 18,15-28a, Abs. 6-12 (Veerkamp 2021, 368-369; 2007, 83-84).
<1291> Simons Nachfolge. Jesus vor dem Großpriester, 18,15-28a, Abs. 13-15 (Veerkamp 2021, 369-370; 2007, 84-85).
<1292> Simons Nachfolge. Jesus vor dem Großpriester, 18,15-28a, Abs. 16-17 (Veerkamp 2021, 370; 2007, 85).
<1293> Der erste Teil der Passionserzählung: Frühmorgens, 18,28b-19,13, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 370; 2007, 85).
<1294> Veerkamp zitiert Louis Althusser, Für Marx, Frankfurt/M. 1968. Wer dieses Werk nicht kennt, dem sei seine kurze Zusammenfassung auf der Internet-Seite https://www.getabstract.com/de/ empfohlen. Dort wird zunächst die Absicht Althussers folgendermaßen umrissen:
Mit seiner strukturalistischen Lektüre von Marx’ Schriften wandte sich Althusser gegen linke Intellektuelle in ganz Europa [wandte], die sich vom marxistisch-leninistischen Dogmatismus lösen und in Marx einen humanistischen Philosophen erkennen wollten. …
Zugleich wandte er sich gegen den dogmatischen Stalinismus, den er als Fehlentwicklung des Marxismus abtat.
Weiter stellt Althusser dar, dass die entscheidende Neuerung im Denken von Marx (und auch Engels) nicht ein abstrakt-philosophisches Nachdenken war, durch das Hegel „vom Kopf auf die Füße gestellt“ wurde, wie man gewöhnlich sagt, sondern die Anknüpfung an konkrete Erfahrungen der Arbeiterschaft in Frankreich und England und ihren Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung:
In Frankreich, in den Augen deutscher Intellektueller die Heimat von Aufklärung und Vernunft, entdeckte Marx die organisierte Arbeiterklasse, so wie Engels in England den Klassenkampf entdeckte. Diese radikale Realität, die ohne Philosophie und Philosophen auskam, prägte sein Denken mehr als alle Reflexionen. Erst durch die konkreten Erfahrungen im Ausland erkannte Marx hinter all den Illusionen die wahren Zustände im idealisierten Frankreich sowie die Misere in seiner deutschen Heimat, die Klassenverhältnisse und die Ausbeutung.
Auf diesem Hintergrund stellt Althusser die so genannte marxistische Dialektik als ein Modell dar, das komplexe gesellschaftliche Gegensätze, die er „Widersprüche“ nennt, in ihrer Wechselwirkung betrachtet und daraufhin untersucht, welche Einflüsse jeweils vorherrschen:
Das Spezifische an der marxistischen Dialektik ist also, dass sie – anders als Hegels Modell – nicht von einer ursprünglichen Einheit ausgeht, die auf dem Weg über Entfremdung und Negation von Gegensätzen wiederhergestellt wird. Vielmehr setzt sie eine komplexe Struktur und eine Vielzahl von Widersprüchen schon im Ursprung voraus, allerdings mit einem dominanten Hauptwiderspruch, der die Einheit des Ganzen ausmacht – das Prinzip der Überdetermination. Das bedeutet: Je nach konkreter historischer Situation dominiert jeweils ein Widerspruch neben vielen Widersprüchen, die in ihrem Zusammenwirken ein komplexes Ganzes bilden. In Russland etwa spitzten sich im Jahr 1917 alle möglichen historischen Widersprüche zu; sie verschmolzen und führten zum Ausbruch der Revolution. Die Nebenwidersprüche reflektieren jeweils den Hauptwiderspruch. Dieser ist von vornherein durch eine komplexe, ungleichmäßige Struktur determiniert. Das Ganze ist nicht starr, sondern flexibel: Nebenwidersprüche können zu Hauptwidersprüchen werden und umgekehrt. Zwar herrscht in letzter Instanz das Primat des Ökonomischen, doch gerade im Klassenkampf, der aus marxistischer Sicht der „Motor der Geschichte“ ist und die Entwicklung vorantreibt, verdichten sich das Ökonomische, Politische und Ideologische zu einem komplexen Ganzen.
<1295> Vgl. dazu Marcel Simon, Verus Israel. A study of the relations between Christians and Jews in the Roman Empire (135-425). Translated from the French: H. McKeating, Oxford 1986.
<1296> Wengst zitiert Flavius Josephus, De Bello Judaico. Der jüdische Krieg, Griechisch und Deutsch, Band 2, hg. v. O. Michel und O. Bauernfeind, München 1959-1969, 301. Die Stelle ist unter Bell. 2,14,8 in der Übersetzung von H. Clementz einsehbar.
<1297> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 437, D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 49, Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 351, und Christian Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes. Teilband 2: Johannes 13-21, ZBK.NT 4.2, Zürich 2001, 268.
<1298> Was ist schon Treue? 18,28b-38a, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 371-372; 2007, 85-86), und Anm. 512 zur Übersetzung von Johannes 18,28 (Veerkamp 2021, 370; 2015, 132).
<1299> Wengst zitiert Philon von Alexandria nach seinem Werk „LegGai“ = Legatio ad Gajum (Gesandtschaft an Gajus), 301-303.
<1300> Was ist schon Treue? 18,28b-38a, Abs. 4-7 (Veerkamp 2021, 372-373; 2007, 85-86).
<1301> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 352. Auf weitere Zitate einmal zitierter Autoren in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1302> So zitiert Wengst Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 506.
<1303> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 440, und Siegfried Schulz, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1972, 229.
<1304> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 83.
<1305> Wengst zitiert den Traktat Sanhedrin aus dem Jerusalemer Talmud 1,1 [18a]: talmud jeruschalmi, Nachdruck Jerusalem 1969 (Krotoschin 1866).
<1306> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 56.
<1307> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 216.
<1308> Thyen zitiert Leon L. Morris, The Gospel According to John, NLC, London, 2. Aufl. 1974, 771.
<1309> Thyen zitiert Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 854.
<1310> Thyen zitiert Heinrich Schlier, Meditationen über den johanneischen Begriff der Wahrheit, in: Ders., Besinnung auf das NT, Freiburg, 2. Aufl. 1967, 276.
<1311> Was ist schon Treue? 18,28b-38a, Abs. 1 und 8-35 (Veerkamp 2021, 371 und 393-377; 2015, 135 und 2007, 86-90).
<1312> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 513.
<1313> Da, der Mensch, 18,38b-19,11, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 379-380; 2007, 91), und Anm. 516 zur Übersetzung von Johannes 18,40 (Veerkamp 2021, 377; 2015, 134).
<1314> Wengst zitiert Carl Schneider, Art. mastigóo usw., Theologisches Wörterbuch IV, 523 u. 524.
<1315> Thyen beruft sich auf H. St. J. Hart, The Crown of Thorns in John 19,2-5, JTS 3 (1952), 71ff.
<1316> Da, der Mensch, 18,38b-19,11, Abs. 6-8 (Veerkamp 2005, 18, Anm. 7, Veerkamp 2015, 134, und Veerkamp 2007, 91-92), und Anm. 518 zur Übersetzung von Johannes 19,3 (Veerkamp 2021, 378, 2015, 134) sowie Anm. 73 zur Übersetzung von 1,29 (Veerkamp 2021, 53-54; 2015, 16 und 2005, 18, Anm. 7).
<1317> So zitiert Wengst Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 510. Auf ein weiteres Bultmann-Zitat in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1318> Thyen beruft sich auf Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes, 3. Band, Düsseldorf 1977, 91.
<1319> Thyen zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes, ÖTK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 679f.
<1320> Thyen bezieht sich auf Alan Richardson, The Gospel according to St. John, TBC, London 1959, 197 („königlicher Urmensch“ und „neuer Adam“), Wayne A. Meeks, The Prophet-King. Moses Traditions and the Johannine Christology, NT.S 15, Leiden 1967, 68ff. (der Messias als „königlicher Mensch“), und Rudolf Schnackenburg, Die Ecce-homo-Szene und der Menschensohn, in: R. Pesch und R. Schnackenburg (Hrsg.), Jesus und der Menschensohn, FS A. Vögtle, Freiburg 1975, 371ff. („Menschensohn“).
<1321> Da, der Mensch, 18,38b-19,11, Abs. 15-18.9-14 (Veerkamp 2021, 380-382; 2007, 92-93).
<1322> Wengst zitiert Bernhard Weiss, Das Johannes-Evangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 584f. Thyen wird sich auf dieselbe Stelle beziehen.
<1323> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 286.
<1324> Wengst zitiert Dirk F. Gniesmer, In den Prozeß verwickelt. Erzähltechnische und textpragmatische Erwägungen zur Erzählung vom Prozeß Jesu vor Pilatus (Joh. 18,28-19,16.a.b), Frankfurt am Main 2000, 308f., teilweise wiederholt auf S. 354.
<1325> Thyen zitiert Ernst Haenchen, Johannesevangelium. Ein Kommentar (hg. von U. Busse), Tübingen 1980, 539.
<1326> Thyen bezieht sich auf (H. Strack /) P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 1, München, 3. Auflage 1961, 1006ff.
<1327> Da, der Mensch, 18,38b-19,11, Abs. 1 und 19-21 (Veerkamp 2021, 378 und 382; 2015, 137 und 2007, 92-93).
<1328> Wengst zitiert Philostrat IV 44 nach der Übersetzung von Vroni-Mumprecht, die allerdings in seinem Literaturverzeichnis nicht auftaucht.
<1329> So zitiert Wengst Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 445f.
<1330> Wengst zitiert August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 421, Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 95, und Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 537. Auf weitere Zitate dieser Autoren in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1331> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 512. Auf weitere Bultmann-Zitate in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1332> Wengst zitiert Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 540.
<1333> Wengst bezieht sich auf Emanuel Hirsch, Das vierte Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt verdeutscht und erklärt, Tübingen 1936, 421f.
<1334> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 218f.
<1335> Thyen zitiert Raymond E. Brown, The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, AncB Reference Library, 2 vols., New Ýork 1994 u. 1995, 830, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Pilate is afraid because it becomes clearer and clearer that he will not be able to escape making a judgement about truth“.
<1336> Da, der Mensch, 18,38b-19,11, Abs. 22-29 (Veerkamp 2021, 382-384; 2007, 93-94), und Anm. 521 zur Übersetzung von Johannes 19,11 (Veerkamp 2021, 379; 2015, 136).
<1337> Scholion 8: Obrigkeit von Gott?, Abs. 1-9 (Veerkamp 2021, 384-386; 2007, 95-96).
<1338> Dazu verweist Veerkamp (Anm. 523) auf Gerhard Jankowski, Die große Hoffnung. Paulus an die Römer. Eine Auslegung, Berlin 1998, 275ff., der Römer 13 von seiner Überschrift in Vers 12,21 her als Strategie eines konfrontationsfreien Umgangs mit der gleichwohl als grundsätzlich „böse“ eingeschätzten römischen Herrschaft deutet.
<1339> Dazu verweist Veerkamp auf das große Lutherkapitel in Ulrich Duchrow, Christentum und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre, Stuttgart, 2. Aufl. 1983, 437-573.
<1340> Veerkamp bezieht sich auf Aurelius Augustinus: De Civitate Dei Libri XXII. Recensuit et commentario critico instruxit Emanuel Hoffmann, CSEL Vol. XXXX, Wien 1899, I, 4:4.
<1341> So zitiert Wengst nach der Ausgabe von Flavius Josephus, De Bello Judaico. Der jüdische Krieg, Griechisch und Deutsch, Band 2, hg. v. O. Michel und O. Bauernfeind, München 1959-1969, die Anm. 98 zu Buch 2 auf S. 441, vgl. Josephus, Bell 2, 172, wonach „sich Pilatus in der großen Rennbahn (von Cäsarea) auf seinen Richtstuhl (setzte)“, und Bell 2, 301, wo es vom Prokurator Florus heißt, dass er „vor dem Palast den Richtstuhl aufstellen (ließ) und […] darauf Platz (nahm)“ (vgl. die Version bei H. Clementz: Bell. 2,9,2 und Bell. 2,14,8).
<1342> Wengst zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium des Johannes, KNT 4, Leipzig, 5. und 6. Auflage 1921, 645, An. 65.
<1343> Thyen zitiert G. R. Beasley-Murray, John, Waco/Texas 1987, 340, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„The threat to denounce Pilate before Ceasar if he sets Jesus free is evident. And that really was something for Pilate to fear! For Tiberius was notoriously suspicious of any who threatened his position, and he dealt with them ruthlessly and savagely. Pilate knew that an accusation of aiding and abetting a revolutionary king in turbulent Palestine would be highly dangerous. He was caught in a trap of his own making, unable to escape“.
<1344> Thyen bezieht sich auf J. Blinzler, Der Prozess Jesu, Regensburg, 4. Aufl. 1969, zur Stelle.
<1345> Thyen beruft sich auf Adolf von Harnack, Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus, TU 9, Berlin 1893, 63f.
<1346> Thyen bezieht sich auf Ignace de la Potterie, Jesus roi et juge d‘après Jn 19,13: ekathisen epi bēmatos, Bib 41 (1960), 217-247.
<1347> Freund des Cäsars, 19,12-13, Abs. 2-4 (Veerkamp 2021, 386-387; 2007, 97).
<1348> Der zweite Teil der Passionserzählung: ˁErev Pascha, 19,14-42, Abs. 1-3 (Veerkamp 2021, 387; 2007, 97-98.
<1349> So zitiert Wengst P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 836f.
<1350> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 515, Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 361f., und Jean Zumstein, Kreative Erinnerung. Relecture und Auslegung im Johannesevangelium, Zürich 1999, 151. Auf weitere Zitate von Bultmann und Schnelle in diesem Abschnitt verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1351> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 308. Auf ein weiteres Zitat Thyens von Schnackenburg verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1352> So sieht es Wengst zufolge schon August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 413.
<1353> Thyen zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 290.
<1354> König der Judäer,19,14-22, Abs. 2-9 (Veerkamp 2021, 388-390; 2007, 98-99).
<1355> So übersetzt Veerkamp wörtlich den Imperativ „aron, aron“ vom Wort airein, (auf-)heben.
<1356> Veerkamp zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes. II. Kapitel 11-21, Gütersloh 31991, 664.
<1357> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 113. Auf ein weiteres Zitat von Blank verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1358> Wengst zitiert Bernhard Weiss, Das Johannes-Evangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 592.
<1359> Dazu verweist Wengst auf Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 348: „Der mittlere Platz, der Ehrenplatz, gebührt ,dem König‘.“
<1360> Thyen zitiert Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 917, mit den oben von mir übersetzten Worten: „sole Master of his destiny“. Auf ein weiteres Zitat von Brown verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1361> König der Judäer,19,14-22, Abs. 10 (Veerkamp 2021, 390; 2007, 99).
<1362> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 518.
<1363> König der Judäer,19,14-22, Abs. 1 und 11-13 (Veerkamp 2021, 388 und 391; 2015, 139 und 2007, 100), und Anm. 530 zur Übersetzung von Johannes 19,19 sowie Anm. 531 zur Übersetzung von Johannes 19,21 (Veerkamp 2021, 2015, 138).
<1364> Wengst zitiert P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 1, 565f. und 343.
<1365> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 118.
<1366> Wengst bezieht sich auf „bTaam 11b“ und „bAS 34a“, also die Traktate Taˁanit 11b und ˁavoda Zara 34a im Babylonischen Talmud: talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<1367> Erste Szene: Psalm 22,19 und 23-24, Abs. 2-9 (Veerkamp 2021, 392-393; 2007, 100-102).
<1368> Wengst bezieht sich auf Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 224, und Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 521. Auf weitere von Thyen und Veerkamp angeführte Bultmann-Zitate werde ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern verweisen.
<1369> Thyen bezieht sich auf Eva Krafft, Die Personen des Johannesevangeliums, EvTh 16 (1956), 19 u. ö.
<1370> Thyen zitiert Paul S. Minear, John. The Martyr‘s Gospel, New York 1984, 150, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„They must continue to seek reconciliation with their enemies in synagogues and temple. They must refuse to despair of the ultimate success of that mission. ,From that hour‘ they must obey this word as the command of their king: ,Look! This is your mother!‘ The exclamation points are entirely justified. The obedience of the beloved disciple makes obligatory the same obedience on the part of the community… . In their action of hospitality the past history of God‘s people becomes reconciled to its future history. This is not an idle dream. This is what happened in the hour of Jesus‘ death. This is an index to the power released by that death. The beloved disciple welcomed the Messiah‘s beloved mother into the community of those reborn as God‘s children. The word of the crucified cancels out anti-Semitism among his disciples by means of a pro-Semitic command, an inescapable ,Love your enemies!‘“
<1371> Zweite Szene: Mutter und Sohn, 19,25-27, Abs. 2-8 (Veerkamp 2021, 394-395; 2007, 102-103).
<1372> Auch Veerkamp bemerkt wie Wengst und Thyen (Anm. 536):
Oder vier Frauen, wenn man „die Schwester seiner Mutter“ von „Maria von Klōpas“ unterscheidet.
<1373> Scholion 9: Der Friede unter den messianischen Gemeinden, Abs. 1-11 (Veerkamp 2021, 395-397; 2007, 103-105).
<1374> Dazu verweist Veerkamp (Anm. 537) auf Gerhard Jankowski, Und dann auch den Nichtjuden. Die Apostelgeschichte des Lukas. 2. Teil (9,32-21,14), in: Texte & Kontexte 98/99 (2003), 66ff.
<1375> Auch Veerkamp geht in diesem Zusammenhang (Anm. 538) auf Rudolf Bultmann [369 und 521] ein, demzufolge „die Szene symbolisch“ zu verstehen ist:
„die Mutter repräsentiert das Judenchristentum, der geliebte Schüler das hellenistische Christentum. Diese Auffassung ist im Ordner ‚blühende Phantasie‘ abzuheften.“
<1376> Wengst bezieht sich auf Hans-Ulrich Weidemann, Der Tod Jesu im Johannesevangelium. Die erste Abschiedsrede als Schlüsseltext für den Passions- und Osterbericht, BZNW 122, Berlin u. a. 2004, 385; vgl. weiter 387.446f.
<1377> Wengst zitiert Alan R. Culpepper, The Gospels and Letters of John, Interpreting Biblical Texts, Nashville 1998, 235.
<1378> Wengst zitiert Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6., von Victor von Reichmann bearbeitete Aufl., 1988, Sp. 1164:
Von den hier genannten Belegen sei Plutarch, Marcus Cato 1,7, zitiert: „Auf Feldzügen trank er Wasser; nur wenn er einmal sehr brennenden Durst hatte, verlangte er Säuerling oder nahm, wenn die Kraft nachließ, ganz wenig Wein dazu.“
<1379> Wengst zitiert Shemot Rabba 17,2: Midrasch Rabba über die fünf Bücher der Tora und die fünf Megillot. midrasch rabbah, 2 Bde., Nachdruck Jerusalem o.J. (Romm, Wilna 1887), 33b.
<1380> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 659f.
<1381> Thyen zitiert Roland Bergmeier, TETELESTAI. Joh 19,30, ZNW 79 (1988), 282-290, auf den Thyen später noch ein weiteres Mal verweisen wird.
<1382> Thyen zitiert Robert L. Brawley, An Absent Complement and Intertextuality in John 19,28-29, JBL 112 (1993), 435.
<1383> Thyen zitiert Heinrich Julius Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg, nach der 3. Auflage 1908, 217.
<1384> Thyen zitiert Ernst Haenchen, Johannesevangelium. Ein Kommentar (hg. von U. Busse), Tübingen 1980, 553.
<1385> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 522, und Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, Freiburg, Basel u. Wien, Band III 1975, 331.
<1386> Thyen zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes, ÖTK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 701.
<1387> Thyen zitiert David J. Amante, Theory of Ironic Speech Acts, Poetics Today 2 (1981), 81, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Irony is a matter of perception and it must, to become manifest, be seen by an observer or it does not exist“.
<1388> Thyen zitiert Stephen D. Moore, Literary Criticism and the Gospels. The Theoretical Challenge, New Haven & London 1989, 163 und 168, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Irony – which depended on the clean separation of flesh and glory, earthly and heavenly, material and spiritual, literal and figural, water and ,water‘ – is now collapsed in paradox“,
und:
„But who perceives the reader‘s ironic dilemma at the death scene?“
<1389> Thyen zitiert Edwin Clement Hoskyns (ed. by F. N. Davey), The Fourth Gospel, London, 2. Aufl. 1947, 532, Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 931, und James Swetnam, Bestowal of the Spirit in the Fourth Gospel, Bib 74 (1993), 564ff. Zwei der Autoren werden in den folgenden zwei Anmerkungen wörtlich zitiert.
<1390> Thyen zitiert Hoskyns (ebd. 532) mit folgenden von mir oben übersetzten Worten:
„This is no fantastic exegesis, since vv. 28-30 record the solemn fulfilment of 7,37-39. The thirst of the believers is assuaged by the rivers of living water which flow from the belly of the Lord, the author having already noted that this referred to the giving of the Spirit. The outporing of the Spirit here recorded must be understood in close connection with the outporing of the water and the blood (v. 34). The similar association of Spirit and Water and Blood in 1John 5,8, There are three who bear witness, the Spirit and the water and the blood: and the three agree in one, seems to make this interpretation not only possible, but necessary“.
<1391> Thyen zitiert Swetnam (ebd. 569 und 567) in den folgenden Absätzen mit den von mir oben übersetzten Worten:
„which is the climax of the crucifixion. This bestowal constitutes the Spirit as Jesus ,successor‘, so to speak, whereas the bestowal in 20,22 seems to constitute the Spirit as Jesus‘ ,presence‘“,
und:
„However, to deny that the basis for such thinking is present in the Passion account which he has carefully crafted would seem to go against the linguistic evidence. The linguistic evidence is indirect and evocative. This explains, in part at least, the instinctive repugnance the normal person immersed in biblical language has to seeing the climax of the Fourth Gospel in terminology which involves explicit ontology“.
<1392> Dritte Szene: Das Ziel ist erreicht, 19,28-30, Abs. 1 und 4-10.2-3.11-18 (Veerkamp 2021, 397-401; 2015, 141 und 2007, 105-108), und Anm. 540 zur Übersetzung von Johannes 19,28 (Veerkamp 2021, 398; 2015, 140).
<1393> Veerkamp zitiert Charles K. Barrett, Das Evangelium nach Johannes [KEK], Göttingen 1990, 531.
<1394> Die Übersetzung von ekpnein in Markus 15,37 mit „entgeisten“ geht zurück auf Ton Veerkamp, Vom ersten Tag nach jenem Sabbat. Der Epilog des Markusevangeliums: 15,33-16,8. In: Texte & Kontexte 13 (1982), 5-34, hier 16:
Durch dieses ungewöhnliche Wort will Markus das Sterben Jesu als Negation seiner „Begeistung“ nach der Taufe darstellen. Der Geist – der heilige Geist! – wird von ihm weggenommen. Die Übersetzung: „er gab den Geist auf“ ist daher nicht gut. Es handelt sich nicht um einen etwas gehobenen Ausdruck für „sterben“, sondern um die theologische Tragweite dieses Sterbens. Deshalb der Vorschlag, hier „entgeisten“ zu sagen, um so auf das völlig ungewöhnliche Wort aufmerksam zu machen.
<1395> Veerkamp weist aber darauf hin (Anm. 544), dass dort „‚meinen Geist deiner Hand zuordnen (paqad)‘ gerade nicht sterben“ bedeutet.
<1396> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 534.
<1397> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 525. Auf ein weiteres Bultmann-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1398> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 105.
<1399> Thyen zitiert Maurits Sabbe, The Johannine Account of the Death of Jesus and Its Synoptic Parallels (Jn 19,16b-42), ETL 70, Leuven 1994, 43ff. Auf ein weiteres Zitat von Sabbe verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1400> Vierte Szene: Der Erstochene, 19,31-36, Abs. 2-16 (Veerkamp 2021, 402-406; 2007, 108-111).
<1401> „Hadadrimon im Tag Meggidon“ spielt wohl (Anm. 550) auf den Ort an, „an dem der König Josia tödlich verwundet wurde, 2 Chronik 35,22ff.“
<1402> Wengst zitiert Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 564, Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 558, Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 135, und Bernhard Weiss, Das Johannes-Evangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 604. Auf ein weiteres von Thyen angeführtes Zitat von Haenchen werde ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern verweisen.
<1403> Wengst zitiert Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 364. Auf ein weiteres Schenke-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1404> Wengst zitiert Wayne A. Meeks, Die Funktion des vom Himmel herabgestiegenen Offenbarers für das Selbstverständnis der johanneischen Gemeinde. In: Ders. (Hg.), Zur Soziologie des Urchristentums, München 1979, 260 (in seinem Literaturverzeichnis führt er das Buch nicht auf; ich übernehme die Quellenangabe aus Thyens Literaturangaben).
<1405> Wengst zitiert den Traktat Mischna Schabbat 23.5: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<1406> Die Grablegung, 19,38-42, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 406-407; 2007, 111-112).
<1407> Vorbemerkung: Die Zeitangabe „Tag eins“, Abs. 1-11 (Veerkamp 2021, 407-409; 2007, 112-114).
<1408> Veerkamp schreibt ergänzend (Anm. 552):
Ähnlich verfahren andere semitische Sprachen auch. Aramäisch chad/qadmaj, Arabisch wahid/awwal. In der Ordnung derer, die mit einer Ordinalzahl angedeutet werden, spielt „Erste(r)“ eine Spezialrolle. Verglichen mit allen weiteren hat der Erste eine herausgehobene Bedeutung. Im Hebräischen ist der Erste der „Kopf“, im Aramäischen der, der vorangeht, im Arabischen der, der zurückgeht, der Ursprüngliche.
<1409> Nach Veerkamp (Anm. 553) heißt „Tohu wa-bohu … ‚Irrsal und Wirrsal‘ in der genialen Übersetzung von Martin Buber.“
<1410> Veerkamp verweist dazu (Anm. 554) auf Salomo ben Isaak (Raschi), Pentateuch-Commentar benevens eene nederlandsche verklarende vertaling door A. S. Onderwijzer I-V, Amsterdam 1895 (Reprint 1985), 5.
<1411> Das gilt nach Veerkamp (Anm. 555) auch für den „Targum Onkelos, eine verbreitet akzeptierte und sehr frühe Übersetzung ins Aramäische. Er hat joma chad (Kardinalzahl) statt joma qadmaja (Ordinalzahl).“
<1412> Dazu verweist Wengst auf die bei P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 1, 1052f. angegebenen Stellen.
<1413> Thyen zitiert Frans Neirynck, John and the Synoptics: The Empty Tomb Stories, NTS 30 (1984), 161-187 (= Evangelica II, 572-600).
<1414> Wengst verweist auf Thomas L. Brodie, The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 561, der daraus folgert: „Der Text sagt nicht, dass sie von vornherein zusammen waren.“
<1415> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 162.
<1416> Wengst zitiert Bernhard Weiss, Das Johannesevangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 606.
<1417> Dazu verweist Wengst auf Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 358, und Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 717.
<1418> Das Grab, 20,1-10, Abs. 1-9 (Veerkamp 2021, 409-411; 2015, 145 und 2007, 114-115), und Anm. 557 zur Übersetzung von Johannes 20,1 (Veerkamp 2021, 409-410; 2015, 144).
<1419> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 465 und 466.
<1420> So zitiert Wengst Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 367. Auf ein weiteres Schnackenburg-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1421> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 165, und Jörg Frey, Leiblichkeit und Auferstehung im Johannesevangelium, in: Jörg Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Studien zu den Johanneischen Schriften, Tübingen 2013, 727.
<1422> Wengst bezieht sich in Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6., von Victor von Reichmann bearbeitete Aufl., 1988, auf die Bedeutung Nr. 4 des Wortes gár.
<1423> Wengst zitiert Jörg Frey, Heil und Geschichte im Johannesevangelium, in: Jörg Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Studien zu den Johanneischen Schriften, Tübingen 2013, 630, Anm. 184.
<1424> Wengst bezieht sich auf Michael Wolter, Schriftkenntnis. Anmerkungen zu Joh 20,9, in: Fragmentarisches Wörterbuch. Festschrift Horst Balz, hg. v. Kerstin Schiffner u. a., Stuttgart 2007, 343-352; die eben genannte These steht auf S. 351.
<1425> Thyen beruft sich auf Frans Neirynck, John and the Synoptics: The Empty Tomb Stories, NTS 30 (1984), 173f., und wird ihn im folgenden Absatz mit den oben von mir übersetzten Worten zitieren:
„The comparative study of Jn 20,3-10 and Lk 24,12 leads to the conclusion that this is what happened also in John‘s empty tomb story“.
<1426> Thyen bezieht sich auf Brendan Byrne, The Faith of the Beloved Disciple and the Community in John 20, JSNT 23 (1985), 85ff.
<1427> Thyen zitiert Paul S. Minear, ‚We Don‘t Know Where…‘ John 20,2: Interpr. 30 (1976), 127f., mit den oben von mir übersetzten Worten:
„a radical revision in the usual exegesis of verse 8“,
und:
„They now ,believed‘ in Mary‘s report and thus joined in her confession of ignorance, ,We don‘t know where‘“.
<1428> Thyen bezieht sich auf Dorothy A. Lee, Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20: JSNT 58 (1995), 40f.
<1429> Thyen zitiert Brendan Byrne (siehe Anm. 1426), 87ff. und wird im folgenden Absatz seine oben von mir übersetzen Worte zitieren (88):
„What the neatly folded and separately lying soudarion indicates is that whereas Lazarus was completely passive in his coming back to life, entirely reliant upon the command of Jesus and needing others to remove the facial cloth and so restore him to full human and social life, Jesus has actively raised himself. The neatly folded, separately placed facial cloth would appear to be the culminating indication of this totally self-possessed, majestic act of Jesus“.
<1430> Das Grab, 20,1-10, Abs. 10-21 (Veerkamp 2021, 411-414; 2007, 115-117).
<1431> Veerkamp meint allerdings (Anm. 559), dass das hier verwendete Wort „ˁaschir = Reicher, LXX plousious“ möglicherweise einmal falsch abgeschrieben wurde und dass ursprünglich „statt ˁaschir – ˁosse raˁ = Übeltäter“ zu lesen sein könnte.
<1432> Es mag angebracht sein, hier noch einmal zu wiederholen, worauf ich in meiner Anm. 70 hingewiesen hatte, dass nämlich die „Große Erzählung“ Israels, auf der noch die messianischen Schriften aufbauen (die wir das Neue Testament nennen), nicht auf eine Erlösung im Jenseits ausgerichtet ist, sondern eine konkrete Veränderung dieser Welt auf der Erde unter dem Himmel Gottes für möglich hält.
<1433> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 528.
<1434> Wengst zitiert Bernhard Weiss, Das Johannesevangelium, KEK, Göttingen, 8. Aufl. 1893, 609, Anm. 1.
<1435> So zitiert Wengst Johannes Beutler, Das Johannesevangelium, Freiburg u. a., 2. Auflage 2016, 522.
<1436> So zitiert Wengst Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 168.
<1437> Noch nicht, 20,11-18, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 415; 2007, 117-118).
<1438> Wengst verweist dazu auf den Buchtitel von Jürgen Ebach, Ursprung und Ziel. Erinnerte Zukunft und erhoffte Vergangenheit, Neukirchen-Vluyn 1986. Auf die „sehr viel weitergehenden Ausführungen“ von Friedrich-Wilhelm Marquardt und Magdalene Frettlöh, mit denen er sich bereits in seiner Auslegung von Johannes 18,1 auseinandergesetzt hat, verweist Wengst in Anm. 439.
<1439> So zitiert Wengst Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 531, Anm. 10, und im Folgenden Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 469.
<1440> Wengst zitiert Susanne Ruschmann, Maria von Magdala im Johannesevangelium. Jüngerin – Zeugin – Liebesbotin, Münster 2002, 195.
<1441> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 384.
<1442> Noch nicht, 20,11-18, Abs. 4-5 (Veerkamp 2021, 415; 2007, 118).
<1443> So zitiert Wengst Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 542.
<1444> Wengst zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Was dürfen wir hoffen, wenn wir hoffen dürften? Eine Eschatologie 1, Gütersloh 1993, 404, und Susanne Ruschmann, Maria von Magdala im Johannesevangelium. Jüngerin – Zeugin – Liebesbotin, Münster 2002, 163 und 164.
<1445> Dazu verweist Wengst auf Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 384. Thyen wird auf dieselbe Stelle anspielen.
<1446> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 533 (auf den auch Thyen Bezug nehmen wird) und verweist zugleich auf D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 369 und 371:
„Für seine Person war Christus bereits zum Vater gegangen, für uns aber noch nicht.“
„Summa summarum, er will sagen: Magdalena, ich gelte bei dir noch nicht, was ich gelten soll“.
<1447> Wengst zitiert Ebach mit der Quellenangabe „EBACH, Loslassen 165)“; im Literaturverzeichnis findet sich aber kein dementsprechender Titel.
<1448> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 471f.
<1449> Wengst zitiert Jörg Frey, Die johanneische Theologie als Klimax der neutestamentlichen Theologie, in: Jörg Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Studien zu den johanneischen Schriften, Tübingen 2013, 823, Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 310, und Jean Zumstein, Das Johannesevangelium, KEK 2, Göttingen 2016, 755. Auf weitere Bezugnahmen von Thyen auf Wilckens werde ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern verweisen.
<1450> Thyen zitiert Dorothy A. Lee, Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20: JSNT 58 (1995), 45, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„This language expresses the strong sense of identification between Jesus and his disciples in relation to God. But it is also carefully nuanced to reflect the difference in status between Jeus and his disciples. The covenant relationship in which believers become God‘s ,family‘ is dependent on Jesus as Son (14,5; also 10,7.9)“.
<1451> Noch nicht, 20,11-18, Abs. 6-14 (Veerkamp 2021, 415-417; 2007, 118-119).
<1452> Scholion 10: Tod und Auferstehung des Messias; ein für allemal?, Abs. 1-14 (Veerkamp 2021, 417-419; 2007, 120-122).
<1453> Dazu merkt Veerkamp an (Anm. 561):
Die F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung hatte gemeint, die deutsche Übersetzung unter dem unsachgemäßen Titel Griechische Passion veröffentlichen zu müssen.
<1454> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 175 und 176. Auch Thyen wird sich auf den Kommentar von Blank beziehen.
<1455> Wengst zitiert D. Martin Luthers Evangelien-Auslegung 5: Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien, hg. von Erwin Mühlhaupt, Göttingen 1950, 386f.
<1456> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 474, und meint (Anm. 453), dass an „dieser Nüchternheit Calvins … gegenüber christlichem Überbietungswahn“ festzuhalten ist, wie er sich bei Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 312, „zeigt und völlig nichtssagend bleibt: ‚Es ist der der alltägliche jüdische Gruß […] jedoch in unendlicher Vertiefung‘“.
<1457> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 535, Theodor Zahn, Das Evangelium des Johannes, KNT 4, Leipzig, 5. und 6. Auflage 1921, 678, sowie Calvin nach dem in der vorigen Anmerkung zitierten Kommentar, 475. Später wird auch Thyen sich auf die beiden letzteren Werke beziehen.
<1458> So zitiert Thyen Sandra M. Schneiders, John 20,11-18: The Encounter of the Easter Jesus with Mary Magdalene – A Transforming Feminist Reading, in: F. F. Segovia (ed.), What Is John? Vol. I. SBL. SS3, Atlanta 1996, 165ff. Ihre Formulierung „Easter Apostle“ habe ich oben ins Deutsche übersetzt.
<1459> Dieser Halbsatz fehlt in der gekürzten Fassung des Johannes-Kommentars von Wengst aus dem Jahr 2019, die ich meiner Besprechung zu Grunde lege. Thyen zitiert Klaus Wengst, Das Johannesevangelium. 2. Teilband: Kapitel 11-21: ThKzNT IV/2, Stuttgart 2001, 291.
<1460> Die geschlossenen Türen, 20,19-23, Abs. 2-4 (Veerkamp 2021, 420-421; 2007, 122).
<1461> Wengst zitiert Pesikta Rabbati 40, hg. v. M. Friedmann, Nachdruck Tel Aviv 1963 (Wien 1880), 169a.
<1462> So zitiert Wengst Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 180.
<1463> So zitiert Wengst den Traktat Mischna Joma Kippurim 8,9: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<1464> Thyen bezieht sich auf James Swetnam, Bestowal of the Spirit in the Fourth Gospel, Bib 74 (1993), 571ff.
<1465> Die geschlossenen Türen, 20,19-23, Abs. 1 und 5-17 (Veerkamp 2021, 419-424; 2015, 149, 2005, 102 und 2007, 122-125), und Anm. 564 zur Übersetzung von Johannes 20,23 (Veerkamp 2021, 420; 2015, 148).
<1466> In der Regel folge ich Veerkamps Übersetzung aus dem Jahr 2015 (Veerkamp 2015); in seiner Auslegung aus dem Jahr 2007 bezieht er sich jedoch auf seine Übersetzung aus dem Jahr 2005 (Veerkamp 2005, 102), die ich hier wiedergebe.
<1467> So zitiert Wengst Emanuel Hirsch, Das vierte Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt verdeutscht und erklärt, Tübingen 1936, 458f.
<1468> Thyen verweist auf Robert Alter, The Art of Biblical Narrative, New York 1981, 66), und zitiert Dorothy A. Lee, Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20, JSNT 58 (1995), 43, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„absence is a favourite literary device of this author“.
<1469> Sehen und vertrauen, 20,24-29, Abs. 2 (Veerkamp 2021, 424; 2007, 125).
<1470> Thyen zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit, Stuttgart, 2. Aufl. 1933, 525f.
<1471> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 188.
<1472> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 388f., Anm. 52). Das folgende Zitat aus der entsprechenden Stelle in der Vita Apollonii VIII 12 führt Wengst in der Übersetzung von Vroni Mumprecht an.
<1473> Wengst zitiert „MekhJ Beschallach (Wajehi) 1“ (Mechilta d‘Rabbi Ismael. mechilta d‘Rabbi Jischmael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 [Erstausgabe Frankfurt am Main 1931], 84.
<1474> Wengst zitiert Rainer Hirsch-Luipold, Gott wahrnehmen. Die Sinne im Johannesevangelium, Tübingen 2017, 324. Auf ein weiteres Zitat dieses Autors verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1475> Wengst bezieht sich auf Johannes Schneider, Das Evangelium nach Johannes, ThHK Sonderband, Berlin 1976, 324, und Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 233, der dort „auf die Differenzierung in 1,1“ verweist.
<1476> Wengst zitiert Christian Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes. Teilband 2: Johannes 13-21, ZBK.NT 4.2, Zürich 2001, 343.
<1477> Wengst zitiert Marianne Meye Thompson, The God of the Gospel of John, Grand Rapids u. a. 2001, 233, und verweist auf weitere Zitate im folgenden Absatz mit Seitenzahlen in runden Klammern.
<1478> Wengst merkt dazu an (Anm. 470):
„Das ist eine in der rabbinischen Literatur sehr häufig gebrauchte Bezeichnung Gottes.“
<1479> So zitiert Wengst die Biographie Domitians von Sueton (Domitian 13,2) in der Übersetzung von Marunet; vgl. Die deutsche Suetonübersetzung Jakob Vielfeldts (1536), 193.
<1480> Wengst bezieht sich auf Adolf Deissmann, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen, 4. Aufl. 1923, 309, Anm. 7.
<1481> Wengst zitiert Friedrich Nietzsche, Der Antichrist 51, in: Derselbe, Werke in drei Bänden, hg. v. Karl Schlechta, II, München o. J., 1217.
<1482> Wengst bezieht sich auf den bei P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 586, angeführten Traktat Baba Batra 75a aus dem Babylonischen Talmud.
<1483> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 539.
<1484> So zitiert Wengst Herbert Kohler, Kreuz und Menschwerdung im Johannesevangelium. Ein exegetisch-hermeneutischer Versuch zur johanneischen Kreuzestheologie, Zürich 1987, 187.
<1485> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 483.
<1486> Dazu verweist Thyen auf Ekkehard W. Stegemann, Kindlein, hütet euch vor den Götterbildern, ThZ 41 (1985), 284-294.
<1487> Thyen zitiert Lothar Steiger, Die Erinnerung nach vorne. Erzählter Glaube. Die Evangelien, Stuttgart 1993, 100. Auf weitere Steiger-Zitate verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1488> Thyen bezieht sich auf Joachim Kügler, Die Belehrung der Unbelehrbaren, BZ 32 (1988), 249-254.
<1489> Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar, in: Texte & Kontexte 71/72 (1996), 11-15. Die folgenden Zitate stehen auf den Seiten 12 und 13.
<1490> Sehen und vertrauen, 20,24-29, Abs. 1 und 3-9 (Veerkamp 224-426; 2015, 149 und 2007, 125-126).
<1491> Thyen zitiert Dorothy A. Lee, Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20, JSNT 58 (1995), 40, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„as a prolepsis, pointing forward to the meeting with the risen Christ in John 21 and the kee roles each disciple will play“.
<1492> Thyen beruft sich auf Richard Bauckham, The Beloved Disciple as Ideal Author, JSNT 49 (1996), 1-37, und Paul S. Minear, The Original Functions of John 21, JBL 102 (1983), 85-98. Auf weitere Zitate von Minear verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1493> Thyen beruft sich auf Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 434-455, und zitiert 435.
<1494> Thyen bezieht sich auf Ignace de la Potterie, Le témoin qui demeure: Le disciple que Jésus aimait, Bib 67 (1986), 354-381.
<1495> Ohne das Zahlwort triton auch mit dem Zahlwort deuteron und dem entsprechenden Zeichen in 14,54 in Verbindung zu bringen, sieht auch Esther Kobel, Dining with John. Communal Meals and Identity Formation in the Fourth Gospel and its Historical and Cultural Context, Leiden: Brill 2011, 119, einen engen Zusammenhang zwischen der Selbstoffenbarung Jesu in 2,11 und 21,1.14 (das Zitat wurde von mir ins Deutsche übersetzt):
„Das vierte Evangelium präsentiert … die erste und die letzte Offenbarung Jesu an die Menschheit im Rahmen des ersten und des letzten Mahles der Erzählung.“
Vgl. dazu auch den Abschnitt 3.5 Der Fischfang im See Tiberias als dritte zeichenhafte Offenbarung Jesu in meiner Besprechung des genannten Buches: Jesu Fleisch kauen – wie beim Gott Dionysos?
<1496> Schlusswort: Damit ihr vertraut, 20,30-31, Abs. 3 (Veerkamp 2021, 426-427; 2007, 127), Am See von Tiberias, 21,1-25, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 427; 2007, 128), und Anm. 567 zur Übersetzung von Johannes 21,1 (Veerkamp 2021, 427; 2015, 150).
<1497> Wengst zitiert August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 445.
<1498> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 392, der auch auf die beiden folgenden Belegstellen verweist.
<1499> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 3, GSL.NT 4, Düsseldorf 1977, 190.
<1500> Wengst zitiert August Tholuck, Commentar zum Evangelium Johannis, Gotha, 7. Aufl. 1857, 443, und Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 319.
<1501> So zitiert Wengst Karl Barth, Erklärung des Johannes-Evangeliums (Kapitel 1-8), hg. v. W. Fürst, Zürich 1976, 206.
<1502> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 551.
<1503> Thyen zitiert Donald A. Carson, The Purpose of the Fourth Gospel: John 20:31 Reconsidered, JBL (106) 1987, 640f. (im englischen Original: „primarily evangelistic“), und Harald Riesenfeld, Zu den johanneischen hina-Sätzen, ST 19 (1965), 213-220.
<1504> Thyen bezieht sich auf Wayne A. Meeks, The Man from Heaven in Johannin Sectarianism, JBL 91 (1972), 44-72; jetzt auch in: J. Ashton (ed.), The Interpretation of John, Edinburgh, 2. Aufl. 1997, 169-205, J. Louis Martyn, History and Theology in the Fourth Gospel, New York (1968), 2. Aufl. 1979, und Raymond E. Brown, The Community of the Beloved Disciple: The Life, Loves and Hates of an Individual Church in New Testament Times, New York 1979 (= deutsch: Ringen um die Gemeinde. Der Weg der Kirche nach den johanneischen Schriften, Salzburg 1982). Meeks (173) zitiert er mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Nevertheless, it has become abundantly clear that the Johannine literature is the product not of alone genius but of a community or group of communities that evidently persisted with some consistent identity over a considerable span of time“.
<1505> Thyen bezieht sich auf Bruce J. Malina, The Gospel of John in Sociolinguistic Perspective – Colloquy 48, Berkeley 1985.
<1506> Thyen bezieht sich auf Trond Skard Dokka, Irony and Sectarianism in the Gospel of John. In: J. Nissen & S. Pedersen (eds.), New Readings in John, JSNT SS 182, Sheffield 1999, 99ff., und zitiert zur „insider-confusing de-metaphorization“ folgende oben von mir übersetzten Worte (104):
„while John teaches his language to the outsiders, he de-teaches and confuses their [i. e. the insiders] metaphorical competence by time and again fetching in the normal ,outside‘ meaning of his words“.
Etwas später im selben Absatz bringt er zwei weitere Zitate von Dokka (105):
„This order is generally taken to reflect an essential feature in Johns theology, particularly as regards the semeia. The generell view is that John thinks of a belief based on signs – or on anything visible and earthly – as being inferior or altogether mistaken. Signs are at best a kind of pedagogy, the first stage in lifting prospective believers from this world to the height of spiritual truth“.
„This does not annul the metaphorical or spiritual. But the order of events in the story remains an almost brutal corrective to a spirituality which is severed from the common physicality of humans. It is, in a sense, Mary with her bodily expression of emotion, that wins the scene – not over the metaphorical meaning of resurrection, but over the esoteric aloofness it apparently might aquire“.
Schließlich zitiert Thyen Dokka im darauf folgenden Absatz noch zwei weitere Male (106 und 102):
„the cognitive movement is not a one-way spiritual metaphorization. One cannot toil or toy long with any of them before seeing their double effect of creating heavenly metaphors of normal human life – and of recreating normal human life out of the heavenly metaphors“.
„If so, however, in my reading this would be at odds with the Gospel of John … [which] offers considerable resistance to [that] kind of sectarian diagnosis … and, for that matter, to its shadowy twin, the exegetical sectarianism which it implies“.
<1507> Schlusswort: Damit ihr vertraut, 20,30-31, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 426; 2007, 126-127).
<1508> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 420.
<1509> Thyen bezieht sich auf Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes, ÖTK 4/2, Gütersloh, 3. Auflage 1991, zur Stelle.
<1510> Thyen bezieht sich auf Hans von Campenhausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab, SHAW, Heidelberg, 2. Aufl. 1958 (= Derselbe, Tradition und Leben. Kräfte der Kirchengeschichte, Tübingen 1960, 48-113).
<1511> Dazu verweist Thyen auf Frans Neirynck, John 21, NTS 36 (1990), 321-336 (= Evangelica II, 601-616).
<1512> Thyen bezieht sich auf Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 624.
<1513> Damit bezieht sich Thyen auf Andreas Dettwiler, Die Gegenwart des Erhöhten. Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13,31-16,33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters, FRLANT 169, Göttingen 1995.
<1514> So zitiert Thyen Ernst Haenchen, Johannesevangelium. Ein Kommentar (hg. von U. Busse), Tübingen 1980, 595.
<1515> Thyen zitiert Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 240f. Auf dieselbe Stelle wird sich Thyen später noch einmal beziehen.
<1516> Thyen zitiert G. R. Beasley-Murray, John, Waco/Texas 1987, 399, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„Doubtless a symbolical number, representing the whole disciple group, and indeed the whole Body of disciples, the Church“.
<1517> Thyen beruft sich auf Ferdinand Christian Baur, Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Verhältniß zueinander, ihren Charakter und Ursprung, Tübingen 1847, 377ff.
<1518> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 429-430; 2007, 128-129).
<1519> Dazu merkt Veerkamp an (Anm. 570):
Wenn Paulus 1 Kor 15 von solchen Vorgängen berichtet, verwendet er das Passiv ōphthē. Nur im sogenannten unechten Markusschluss ist ein solcher Gebrauch von phaneroun dokumentiert, 16,12.14.
<1520> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 6-10 (Veerkamp 2021, 430; 2007, 129-130).
<1521> Wengst zitiert den Tosefta-Traktat Berakhot 2,14, hg. v. S. Lieberman, seder serajim, Jerusalem, 2. Auflage 1992; seder moˀed, New York 1962; seder naschim (sota, gittin, kidduschin), New York 1973, auf den Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 367, verweist, sowie die ebenfalls von Schlatter angeführte Stelle aus dem Traktat Berakhot 2,3 (4c) im Jerusalemer Talmud: talmud jeruschalmi, Nachdruck Jerusalem 1969 (Krotoschin 1866). Als eine Parallele zur letzteren Stelle zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 555, den Tosefta-Traktat Berakhot 2,20 (zu dem Wengst auf die eben erstgenannte Quelle verweist) und auf den sich auch Thyen beziehen wird.
<1522> So spricht das Wengst zufolge Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 423f., „gleich dreimal aus“.
<1523> Thyen bezieht sich auf Lothar Steiger, Die Erinnerung nach vorne. Erzählter Glaube. Die Evangelien, Stuttgart 1993, 91, und zitiert Raymond E. Brown, The Gospel According to John, AncB. 29/B, New York 1970, 1072, mit seiner oben von mir übersetzten Wiedergabe des griechischen Wortes diazōnnymi durch „to tie (clothes) around oneself“.
<1524> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 10-12 (Veerkamp 2021, 430-431; 2007, 130).
<1525> Wengst verweist dazu auf die Quelle: In Hiezechielem XIV, CChr.SL 75, 717.
<1526> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 556.
<1527> Thyen bezieht sich auf Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, Freiburg, Basel u. Wien, Band III 1975, 424f.
<1528> Thyen beruft sich auf John Adney Emerton, The 153 Fishes in John 21,11: JTS 9 (1958), 86-89.
<1529> Thyen bezieht sich auf Mathias Rissi, Voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig: Joh 21,1-14, ThZ 35 (1979), 8fff.
<1530> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 13-14 (Veerkamp 2021, 431-432; 2007, 130-131).
<1531> Veerkamp zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannesevangeliums [1553], übersetzt v. Martin Trebesius und Hand Christian Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 488.
<1532> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 549.
<1533> Thyen bezieht sich auf Mathias Rissi, Voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig: Joh 21,1-14, ThZ 35 (1979), 73-89.
<1534> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 15-19 (Veerkamp 2021, 432-433; 2007, 131-132).
<1535> Veerkamp zitiert Charles K. Barrett, Das Evangelium nach Johannes [KEK], Göttingen 1990, 556.
<1536> Auch wir kommen mit dir, 21,1-14, Abs. 20 (Veerkamp 2021, 433; 2007, 132).
<1537> Wengst zitiert Shemot Rabba 2,3: Midrash Shemot Rabbah (I-XIV). midrasch schemot rabbah (paraschot 1-14), hg. v. A. Shinan, Jerusalem u. Tel Aviv 1984, 107, und fügt hinzu: Auf diese Stelle verweist P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 587.
<1538> Thyen bezieht sich auf Lothar Steiger, Er geht mit uns, Freiburg 1990. Auf Zitate aus diesem Buch verweise ich in diesem Abschnitt mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1539> Thyen zitiert Emmanuel Lévinas, Gott und die Philosophie. In: B. Kasper (Hg.), Gott nennen – Phänomenologische Zugänge, München 1981, 112f.
<1540> Dazu verweist Thyen beispielhaft auf Graydon F. Snyder, John 13,16 and the Anti-Petrinism of the Johannine Tradition, BR 16 (1971), 5-15.
<1541> Thyen zitiert Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 458, und verweist außerdem auf 456ff.
<1542> Der Hirte, 21,15-19a, Abs. 1-15 (Veerkamp 2021, 433-436; 2015, 153.155 und 2007, 132-134), Anm. 575 zur Übersetzung von Johannes 21,15 und Anm. 576 zur Übersetzung von Johannes 21,16 (Veerkamp 2021, 433-434; 2015, 152.154).
<1543> Wengst zitiert Plautus nach der Übersetzung von Binder und Ludwig, ohne diese Quelle im Literaturverzeichnis anzugeben. Das folgende Zitat steht bei Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Aufl. 1933, 239.
<1544> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 438.
<1545> Wengst zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 560. Zum folgenden Euseb-Zitat stützt er sich auf die übersetzung von Haeuser und Gärtner.
<1546> Der Hirte, 21,15-19a, Abs. 1 und 16-22 (Veerkamp 2021, 437-438; 2015, 155 und 2007, 134-135).
<1547> Wengst zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 553.
<1548> Wengst zitiert Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 3, HthK 4, Freiburg u. a., 2. Aufl. 1976, 441. Auf ein weiteres Zitat dieses Autors in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1549> Wengst zitiert Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 592.
<1550> So zitiert Wengst Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK Sonderband, Göttingen 1990, 558.
<1551> Dazu verweist Thyen auf Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 702ff., G. R. Beasley-Murray, John, Waco/Texas 1987, 412, und Leon L. Morris, The Gospel According to John, NLC, London, 2. Aufl. 1974, 878. Auf weitere Zitate dieser Autoren verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1552> So zitiert Thyen Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 450.
<1553> Thyen zitiert Joachim Kügler, Der Jünger, den Jesus liebte, SBB 16, Stuttgart 1988, 484. Auf ein weiteres Kügler-Zitat in diesem Abschnitt verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1554> So zitiert Thyen R. Alan Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel, Philadelphia 1983, 215, mit den oben von mir übersetzten Worten:
„The difference is slight but shows that the reader is not expected to recognize the Beloved Disciple. At the end, the reader must also be told, that it was the Beloved Disciple who bore witness to, and wrote, these things“.
<1555> Folge mir, 21,19b-23, Abs. 2-10 (Veerkamp 2021, 438-440; 2007, 135-137).
<1556> Wengst zitiert David Trobisch, Die Endredaktion des Neuen Testaments. Eine Untersuchung zur Entstehung der christlichen Bibel, Freiburg Schweiz und Göttingen 1996, 148. Auf weitere Zitate von Trobisch verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1557> Wengst zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 330.
<1558> So zitiert Wengst Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 555. Auf ein weiteres Bultmann-Zitat verweise ich mit einer Seitenzahl in eckigen Klammern.
<1559> Dazu bezieht sich Wengst auf Martin Hengel, Die johanneische Frage. Ein Lösungsversuch. Mit einem Beitrag zur Apokalypse von Jörg Frey, Tübingen 1993, 9-95. Auch Thyen wird sich auf Hengel beziehen, worauf ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern verweise.
<1560> Dazu verweist er auf Klaus Wengst, Bedrängte Gemeinde und verherrlichter Christus. Ein Versuch über das Johannesevangelium, München, 4. Aufl. 1992, 157-179, sowie „die Bemerkungen auf S. 156.“
<1561> Damit nimmt Wengst „dankbar Gedanken aus einer Andacht auf, die Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch (Stuttgart) gehalten und [ihm] vermittelt hat.“
<1562> Mit „Sof 16,8 (41c)“ bezieht sich Wengst auf eine Stelle im Traktat der Schriftgelehrten „Masechet Soferim“, die von P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, 587 geboten wird.
<1563> So zitiert Thyen Franz Overbeck, Das Johannesevangelium (hg. von C. A. Bernoulli), Tübingen 1911, 453. Auf weitere Overbeck-Zitate verweise ich mit Seitenzahlen in eckigen Klammern.
<1564> Thyen bezieht sich auf Adolf von Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur II/1, Leipzig 1897, 675.
<1565> Unterschrift: Dies ist der Schüler, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 440-441; 2007, 137).
<1566> Thomas Mann, Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde.
<1567> Johannesevangelium und Antisemitismus, Abs. 8 und 18 (Veerkamp 2021, 442-445; 2007, 139 und 141).
<1568> Sozialismus und messianische Inspiration, Abs. 9 (Veerkamp 2021, 446; 2007, 142).
<1569> Messianismus: Ursprung, Scheitern, Bewahrung, Abs. 16 (Veerkamp 2021, 450; 2007, 146).
<1570> Liturgien des Widerstands gegen unsere Weltordnung, Abs. 1-2 und 5-6 (Veerkamp 2021, 450-451; 2007, 146-147).
