Der katholische Bibelwissenschaftler Marius Reiser liest die Anfänge der Evangelien mit den Augen des römischen Schriftstellers Plutarch als vier miteinander zusammenstimmende Lebensbilder des Gottessohnes Jesus. Unter Berufung auf Andreas Bedenbender, Frans Breukelman und Ton Veerkamp plädiere ich dafür, endlich den jüdischen Hintergrund des Neuen Testaments ernst zu nehmen, da die Evangelien lange genug einseitig heidenchristlich ausgelegt worden sind.
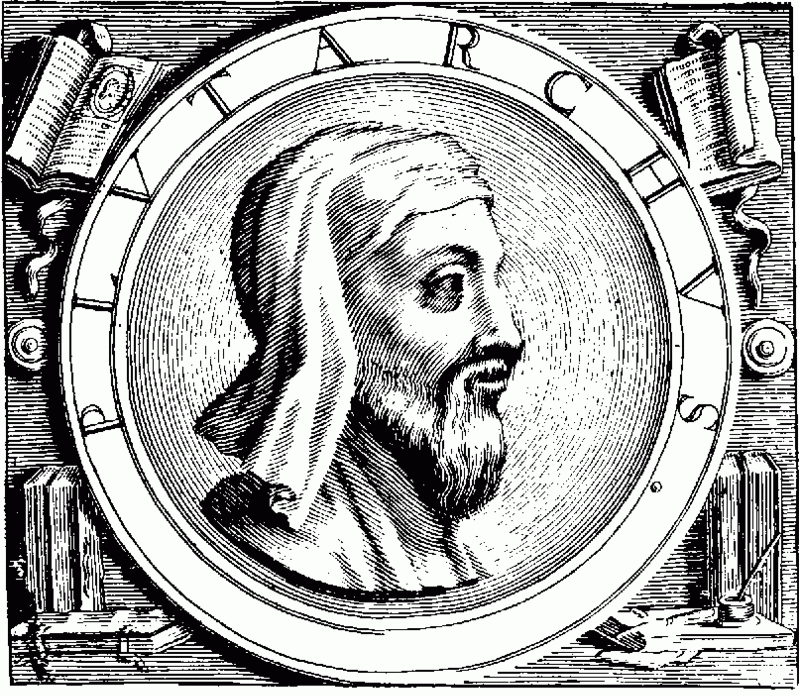
Inhaltsverzeichnis
Wie wichtig ist die historische Glaubwürdigkeit Jesu?
Haben die Evangelisten als Historiker gearbeitet?
Warum wurden überhaupt Evangelien verfasst?
Zur Eigenart der vier kanonischen Evangelien
Zum Gedankenexperiment, die Evangelien mit den Augen Plutarchs zu lesen
Gesichtspunkte biographischer Arbeit bei Plutarch
Denkwürdigkeit einer Begebenheit
Chronologische Abfolge eines Lebenslaufs
Charakterdarstellung durch direkte Rede
Prüfung der Glaubwürdigkeit historischer Angaben
Antike Biographien als „Lebensbilder“
Die Evangelien als Lebensbilder Jesu
In welcher Weise war Jesus Mensch und Gott zugleich?
Öffentliches Wirken, anekdotische Erzählweise, Passion
Unterschiede der sozialen Welt bei Plutarch und in den Evangelien
Die Evangelien zitieren nur aus der Heiligen Schrift
Wie einmalig waren die Evangelien im Gegenüber zu den Schriften des Alten Testaments?
Direkte Rede und Dialog in den Evangelien
Subversive Nutzung der literarischen Gattung bios durch Markus
Warum besprechen Sie nur die Anfänge der Evangelien?
Schrieb der Dolmetscher des Petrus das Markusevangelium?
Die Nähe des Markusevangeliums zu paulinischen Gedanken
Wann wurde das Markusevangelium geschrieben?
Ein Buch für „Liebhaber der heiligen Schriften Israels“
Auf wen oder was sind die Worte „in der Wüste“ zu beziehen?
Wer oder was ist der „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“?
Worauf geht das Wort vom Ausziehen der Sandalen zurück?
Wollte Markus eine Biographie des Sohnes Gottes schreiben?
Warum wird um 70 n. Chr. an der Auferstehung gezweifelt?
Mit welchen Tieren ist Jesus in der Wüste zusammen?
Was meint Markus mit dem Wort „Evangelium“?
Lehrt Jesus bei Markus die Umkehr zu einer neuen Religion?
Lehrt Jesus anders als die Juden oder Johannes der Täufer statt des Gerichts das nahe Heil?
Stellt Jesus der jüdischen Tora seine eigene Lehre entgegen?
Was ist das revolutionär Neue an der Lehre Jesu?
Das Wort vom Riss im Mantel – wie heilt man Zerrissenheit?
Neuer Wein in neue Schläuche – was ist wirklich damit gemeint?
Wer ist verantwortlich für den Tod des Messias?
Lüftete ein römischer Centurio als erster das Geheimnis der Gottessohnschaft Jesu?
Der Evangelist Matthäus – Zöllner oder beispielhafter Schüler?
Zur Überschrift und zum Stammbaum Jesu nach Matthäus
Kurze Zwischenbemerkungen zur Jungfrauengeburt…
… und zur Anbetung des Jesuskindes
Zur Bearbeitung des Markusevangeliums durch Matthäus
Warum lehrt Jesus auf einem Berg – und was lehrt er dort?
Sollen Jesu Taten seine Göttlichkeit beweisen?
Verstößt Jesus gegen die Pflicht, geliebte Tote zu begraben?
Die Aussendungsrede als Schluss des Matthäusevangeliums
Lukas als weltgewandter, gebildeter und schriftkundiger Schriftsteller
Das Problem von Mythos und Historie im Lukasevangelium
Der Vorläufer des Messias Jesus: Wer ist Johannes der Täufer?
Was ist an den Geburtsgeschichten Jesu historisch wahr?
Gottes Wort der Befreiung geschieht quer zur römischen Einschreibung!
Was ist ein Sōtēr? „Retter“? „Heiland“? „Befreier“?
Ein Stammbaum Jesu bis zu ˀADaM (= Menschheit)
Ist Jesus nach Lukas 4,22 ein „begnadeter“ Redner oder redet er auch inhaltlich von „Gnade“?
Warum spricht Lukas nicht von Menschenfischern wie Markus?
Lukas als „Historiker“ und/oder als Evangelist der Befreiung
Lukas als Evangelist der Armen, der Frauen und des Geistes
Zwischenfazit: Was vermitteln die ersten drei Evangelien?
Die härteste Nuss am Anfang: Wie ist der Prolog zu begreifen?
Den Prolog auf naive Weise lesen – als „griechisches Kind“
Von den Schwierigkeiten eines Heiden oder Juden, den Prolog des Johannes zu verstehen
Ist die christliche Lektüre des Prologs die einzig mögliche?
Geht Johannes, der Theologe, von einer griechischen Interpretation des Logos aus?
Auch der Evangelist Johannes schreibt zwar griechisch, ist aber jüdisch-hebräisch zu lesen
2. Was meint Johannes mit dem Satz, dass der Logos nicht in Gott, sondern bei Gott gewesen ist?
3. Kann Johannes als Jude den Logos als göttlich beschrieben bzw. mit Gott identifiziert haben?
Johannes der Täufer als der Zeuge für den Messias Jesus
Warum lehnt es der johanneische Täufer ab, Elia zu sein?
Die „zehnte Stunde“ – bloß eine historische Anmerkung?
Ist Jesus ein Parapsychologe? Nein, ein Friedensstifter!
Ist Johannes Zebedäus der Autor des Johannesevangeliums?
Zwei Namenlose im Johannesevangelium: der geliebte Jünger und die Mutter des Messias
Welchen Sinn hat das erste Zeichen Jesu bei der Hochzeit zu Kana?
Wer ist der Architriklinikos – Speisemeister oder Festvorsteher?
In der messianischen Hochzeit Gott zu eigen, nicht sein Besitz werden
Was bedeuten die letzten Worte des Festvorstehers „bis jetzt“?
Machte Jesus nur ein paar Tage Urlaub in Kapernaum?
Warum steigt Jesus nach Kapernaum hinab?
Welche Bedeutung hat die Geographie in den Evangelien?
Mildert Johannes das Jesuswort zur Tempelreinigung ab?
Ist die Tempelreinigung Jesu als eine Wundertat zu betrachten?
Jesus als Verkörperung des befreienden NAMENs des Gottes Israels
Hat Johannes den „Text“ des historischen Jesus „vollständig dekodiert“?
Wie hätte wohl der Heide Plutarch die Evangelien gelesen?
Wie viel Historie steckt in den Evangelien?
Ist mit dem lebendigen Jesus die große Idee des Christentums in die Welt gekommen?
↑ Sehr geehrter Herr Reiser,
ich habe Ihr Buch „Vier Porträts Jesu. Die Anfänge der Evangelien gelesen mit den Augen Plutarchs“ (Stuttgart 2019) mit großem Interesse gelesen (1). Die Biographien des römischen Schriftstellers mit den Evangelien zu vergleichen, hilft tatsächlich dabei, die Werke des Markus, Matthäus, Lukas und Johannes nicht vorschnell an modernen Maßstäben biographischer oder historischer Literatur zu messen, sondern sie in den Rahmen der Antike einzuordnen.
Allerdings ist mir beim Studium Ihrer Ausführungen um so klarer geworden, in welcher Weise wir Christen ja bereits seit dem Siegeszug des Heidenchristentums über die anfänglich jüdisch-messianische Bewegung der frühen Nachfolger Jesu das Neue Testament sowieso schon durch eine heidnisch (von der griechisch-hellenistischen Theologie und Philosophie her) geprägte Brille lesen.
Daher erlaube ich mir, Ihr Buch als willkommenen Anlass zu nehmen, um Ihrer heidnisch/heidenchristlichen Lektüre der Evangelien mehrere Ansätze einer ihnen angemesseneren jüdisch/judenchristlichen Lektüre gegenüberzustellen. Dabei nehme ich vor allem Bezug auf zwei Bücher von Andreas Bedenbender (2), der intensiv über das Markusevangelium in seinem Zeitbezug zum Jüdischen Krieg geforscht hat, und auf drei Bände einer exegetischen Zeitschrift, in der Ton Veerkamp (3) eine spannende Auslegung des Johannesevangeliums als jüdisch-messianischer Schrift vorgelegt hat. In geringerem Umfang ziehe ich auch Schriften von Frans Breukelman (4) zum Lukasevangelium und von Wolfgang Stegemann (5) zur historischen Jesusforschung heran.
↑ Wie wichtig ist die historische Glaubwürdigkeit Jesu?
Gleich Ihre beiden Grundvoraussetzungen, die Sie im Vorwort dankenswerterweise klar benennen, leuchten mir nicht vollständig ein. Es geht Ihnen in Ihrem Buch (S. 5)
darum, die Einheitlichkeit des Bildes Jesu in seiner vierfachen Brechung aufzuzeigen und seine historische Glaubwürdigkeit.
Zur Begründung berufen Sie sich auf Reinhold Schneider (6) mit seinem Satz: „Darauf allein kommt es an, daß wir von Christus ergriffen werden“. Aber sind diese beiden Voraussetzungen wirklich notwendig? Kann ich nicht auch ergriffen sein von Jesus Christus, wenn nicht alles historisch glaubwürdig ist, was die Evangelisten von ihm aufzeichnen? Und fällt der Glaube an Jesus wirklich hin, wenn die Evangelien ihn als Messias, Gottes- und Menschensohn aus je anderer, vielleicht sogar widersprüchlicher Perspektive betrachten?
Auch ich halte sowohl manche Denkvoraussetzungen als auch viele Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung nicht unbedingt für der Weisheit letzten Schluss. Im stimme aber dem Grundgedanken der historischen Kritik zu, dass die biblischen Autoren nicht in erster Linie Geschichtsschreiber waren, sondern ihr Vertrauen auf den Gott Israels bzw. auf den Messias dieses Gottes, Jesus Christus, ausdrücken wollten. Entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Messias Jesus ist den Evangelisten zufolge aber offenbar nicht, dass alle biographischen Einzelheiten des Lebenslaufes Jesu historisch korrekt und miteinander übereinstimmend dargestellt werden, sondern dass sein Leben und Sterben, seine Worte und Taten mit dem Zeugnis der heiligen Schriften Israels übereinstimmen bzw. durch ihn zur Erfüllung gelangen.
Also wenn etwa Kindheitsgeschichten Jesu oder Wunderberichte erfunden worden sind, dann kommt es darauf an, welche Wahrheit sie über den Messias Jesus von der alttestamentlichen Überlieferung her verkünden wollen. Und wenn das Zeugnis der Evangelien über Jesus in manchen Punkten widersprüchlich ausfällt, würde ich darin kein Problem sehen, so lange sich darin die Vielfalt menschlicher Zugangsweisen zum Vertrauen auf Gott zu unterschiedlichen Zeiten und Orten und unter ganz verschiedenen Lebensbedingungen widerspiegelt.
Recht haben Sie sicher darin, dass man die antike Gattung des bios (= „Leben“, „Lebensbild“) nicht von den Kriterien moderner Biographien oder Entwicklungsromane her beurteilen kann. Dennoch bin ich nicht überzeugt von der Stichhaltigkeit Ihrer Behauptung bezüglich der Evangelien (S. 17):
Gerade weil es in ihnen um Verkündigung ging, durften sie nicht mit Fiktionen und Verzerrungen der wirklichen Geschehnisse aufwarten.
Interessanterweise wird sich herausstellen, dass dieser Punkt im Folgenden gar keine so hervorgehobene Rolle spielt. Einerseits werden auch Sie bestimmte Einzelheiten etwa der Geburtsgeschichten als fiktiv bezeichnen oder geographischen Unrichtigkeiten in den Darstellungen der Evangelien einräumen. Wirklich wichtig werden andererseits ganz andere Themen sein.
↑ Haben die Evangelisten als Historiker gearbeitet?
Folgendermaßen schätzen Sie die schriftstellerische Arbeit der synoptischen Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas ein (S. 22f.):
So will ich hier einmal den Versuch machen, die Anfangscharakteristik, die Markus in seinen ersten drei Kapiteln von Jesus gibt, als Modell und Vorlage der beiden anderen Synoptiker zu verstehen und von hier aus zu erklären, wie sie den markinischen Text bearbeitet haben. Man sieht dann schnell, welche Lücken die beiden bei ihrem Vorgänger entdeckt haben und wie sie diese Lücken mit dem reichen Überlieferungsmaterial ausfüllten, das ihnen aus schriftlichen oder mündlichen Quellen zur Verfügung stand. Dabei wird sich … zeigen…: daß es diesen beiden Evangelisten nicht einfach darum ging, Lücken auszufüllen, sondern daß sie als souveräne Schriftsteller mit einem bestimmten Darstellungsziel arbeiteten. Dieses Ziel bestand darin, die Gestalt Jesu und seiner Verkündigung wahrheitsgemäß und möglichst umfassend darzustellen.
Das klingt plausibel und mag auch zutreffen, setzt allerdings voraus, dass die Evangelisten tatsächlich vor allem als Historiker gearbeitet haben oder jedenfalls, dass ihnen als Verkündigern der Botschaft von Jesus die möglichst umfassende Darstellung der historisch korrekten Biographie Jesu ein Hauptanliegen war. Ich denke aber, dass Matthäus und Lukas das von ihnen als unzureichend bzw. lückenhaft empfundene Markusevangelium auch unter Rückgriff auf alttestamentliche Texte ausgestaltet haben.
↑ Warum wurden überhaupt Evangelien verfasst?
Wichtiger noch ist die Frage, warum überhaupt Evangelien verfasst wurden. Noch Paulus wollte nach 2. Korinther 5,16 Christus gar nicht mehr „nach dem Fleisch“ kennen – warum konzentrieren sich in der Zeit ab 70 n. Chr. gleich vier Evangelisten dann doch sehr intensiv auf die Worte und Taten Jesu? Liegt das nur daran, dass die Wiederkunft Christi sich verzögerte und man für weitere Generationen die Erinnerungen an Jesus aufzeichnen wollte?
Nach biblischen Theologen wie Ton Veerkamp und Andreas Bedenbender entstanden die Evangelien als Reaktion auf die Katastrophe des Jüdischen Krieges, in dem ein zelotischer Kampf für das Friedensreich Gottes mit der Zerstörung des jüdischen Tempels und der Stadt Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. endete. Markus als erster, dann aber auch Matthäus und Lukas und schließlich Johannes, formulieren ihr Evangelium sozusagen, um dieses Trauma zu bewältigen, und schreiben die Erfahrungen des Jüdischen Krieges mit hinein in die Geschichte des am Kreuz gescheiterten Messias – der aber gerade durch dieses scheinbare Scheitern den Sieg über die römische Weltordnung erringt – was man aber nur begreifen kann, wenn man die Worte und Taten und das Leiden Jesu von den biblischen Schriften her auslegt. Eine solche Auslegung wird von den Evangelisten ausdrücklich in Markus 14,49 oder Matthäus 26,56 sowie in Lukas 24,27.32.44-48 oder Johannes 5,39 vorausgesetzt.
↑ Zur Eigenart der vier kanonischen Evangelien
Dankbar bin ich Ihnen für zwei Hinweise. Erstens machen Sie deutlich, worin ein entscheidender Unterschied zwischen den kanonischen und den nicht in den biblischen Kanon aufgenommenen Evangelien bestand (7) (S. 23),
daß die ältesten Handschriften der kanonischen Evangelien zum großen Teil aus professioneller Herstellung und kirchlich kontrollierten Schreibzentren – man denke an Großstädte wie Antiochia, Cäsarea, Alexandria, Rom – stammen und als liturgische Lesetexte dienen sollten. Demgegenüber haben die frühen Handschriften der nichtkanonischen Evangelien durchweg privaten Charakter und waren nicht zum öffentlichen Vortrag gedacht. Sie stammen offenkundig aus marginalen [= randständigen] Kreisen.
Zweitens betonen Sie (S. 24):
Man hielt offenbar alle vier [Evangelien] für wahre Darstellungen mit je eigener Perspektive und je eigenen Akzentsetzungen und wollte sie gerade in ihrer literarischen Eigenart bewahrt wissen, weil diese Eigenart jeweils zu ihrer Wahrheit dazugehört. Ihre Zusammengehörigkeit deutete man durch den Titel an, den man diesen vier Jesusgeschichten gab: Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Solche merkwürdigen Titel gab es in der Buchgeschichte vorher nirgends. Mit ihnen sind die vier Jesusgeschichten als vier Versionen des einen Evangeliums gekennzeichnet. Wer wissen will, wer Jesus von Nazaret war, was er wollte, was er lehrte und wie es ihm erging, der muß alle vier Geschichten zusammennehmen. Nur zusammengenommen bilden sie das Evangelium, nur zusammengenommen erfassen sie die singuläre Gestalt dessen, von dem sie erzählen. Dieses Zusammennehmen muß aber gleichsam unvermischt und ungeschieden erfolgen; das wahre Bild Jesu ergibt sich nur, wenn die jeweilige Eigenart der einzelnen Porträts hineingenommen wird.
Mit der Formulierung „unvermischt und ungeschieden“ lassen Sie die dogmatische Formulierung des nicänischen Glaubensbekenntnisses anklingen, mit der das Geheimnis der menschlichen und göttlichen Natur Jesu umschrieben wurde. Zugleich macht eine solche Wortwahl deutlich, wie sehr sich die Evangelien eben doch von anderen antiken Lebensbildern (bioi) unterscheiden.
↑ Zum Gedankenexperiment, die Evangelien mit den Augen Plutarchs zu lesen
Dass Sie (S. 26) das „Gedankenexperiment“ unternehmen, die Evangelien mit den Augen des antiken Philosophen und Historikers Plutarch zu lesen, finde ich, wie bereits gesagt, spannend. Und von vornherein möchte ich nochmals kritisch anmerken, dass eine solche Lektüre für uns Christen nicht grundsätzlich neu ist – schließlich gehören wir seit dem Untergang des Judenchristentums und „judaisierender“ Strömungen der frühen Kirche alle zu den nichtjüdischen „Gojim“ (8), die an die Evangelien in der Regel ohne das ganze Wissen herangehen, durch das ein damaliger mit der jüdischen Heiligen Schrift vertrauter Leser die an vielen Stellen mitschwingenden Anklänge an Schriftworte nachvollziehen konnte, die oft nur durch wenige Andeutungen aufgerufen wurden.
Was also ist damit gewonnen, wenn wir die Evangelien mit den Augen eines möglicherweise wohlwollenden Heiden der Antike wie Plutarch lesen, dabei aber vergessen, dass ja bereits die griechisch gebildeten Heidenchristen die Evangelien eben auch als Heiden gelesen haben? Ein solcher Leser, der (S. 25) „historisch interessiert“ ist, mag die Evangelien in der Tat als interessante Lebensbilder lesen und sogar wie wir zum christlichen Glauben kommen. Er wird vielleicht sogar wie Sie um die jüdischen Wurzeln aller Evangelien wissen, ohne allerdings ihre jüdisch-hebräische Sprach- und Denkstruktur wirklich wahr- und ernstnehmen zu können. Liest er etwa das Johannesevangelium allerdings mit einer griechisch geprägten Brille, wie wir Christen es weithin bis heute tun, wird ihm dessen ursprüngliche Aussageabsicht vermutlich verschlossen bleiben. Langer Rede kurzer Sinn: Eine Evangelienlektüre mit jüdischen Augen halte ich für noch wichtiger als eine solche mit heidnischen Augen.
↑ Gesichtspunkte biographischer Arbeit bei Plutarch
In Ihrer Darstellung der biographischen Arbeit Plutarchs (S. 29) lassen sich zunächst einmal vier von fünf Gesichtspunkten sehr gut auch auf die Arbeit der Evangelisten beziehen:
↑ Denkwürdigkeit einer Begebenheit
Erstens legt Plutarch (und offenbar nicht nur er) bei der inhaltlichen Auswahl des Erzählmaterials besonderen Wert auf die „Denkwürdigkeit“ einer Begebenheit:
Den Großteil der erzählenden Darstellung macht in jedem Fall das öffentliche Wirken der Protagonisten aus. Dabei gibt es Schwerpunkte. … Die Auswahl der erzählten Begebenheiten erfolgt nach dem Gesichtspunkt ihrer Denkwürdigkeit. … Dieses Prinzip gilt nicht nur für Plutarch, sondern für die antike Geschichtsschreibung ganz allgemein. Und wir sollten nicht übersehen, daß dies auch heute noch gilt. … (S. 30:) Gibt es nun allgemeine Kriterien der Denkwürdigkeit? Über zweierlei war man sich in der Antike einig: Denkwürdig sind, wie Herodot schreibt, „die großen und erstaunlichen Leistungen“, (9) insbesondere aber die Leiden der Helden wie der Völker. (10) … Ein Leben ohne politische und kriegerische Taten, beschlossen durch einen gewöhnlichen Tod, ist kein lohnender Stoff für einen Geschichtsschreiber oder Biographen. (11) … Der Gesichtspunkt der Denkwürdigkeit kann sogar den Gesichtspunkt der Authentizität zurücktreten lassen. … (S. 31:) Die Denkwürdigkeit einer Anekdote und ihre Übereinstimmung mit dem übrigen Charakter der Betreffenden ist im Zweifelsfall wichtiger für die Authentizität als die Güte der Bezeugung. Für dieses Urteil konnte Plutarch auf so gut wie allgemeine Zustimmung unter den antiken Geschichtsschreibern rechnen.
Übertragen auf die Evangelien würde das bedeuten, dass auch dort die historische Authentizität hinter inhaltlichen Gesichtspunkten zurücktreten kann – wobei genauer betrachtet werden muss, ob das Kriterium der Denkwürdigkeit auf die Evangelien anders anzuwenden ist als auf andere antike Biographien.
↑ Chronologische Abfolge eines Lebenslaufs
Unmittelbar relevant für die Auslegung der Evangelien scheint mir zweitens Ihre Beobachtung (S. 32), wie Plutarch „die chronologische Abfolge eines Lebenslaufs“ schildert – nämlich sehr ähnlich, wie das auch die Evangelisten tun:
Er ordnet seine Erzählung zwar grob chronologisch, im übrigen aber begnügt er sich fast durchweg mit relativen Angaben wie „ungefähr zur Zeit des Peloponnesischen Krieges“, (12) als dieses und jenes geschah, in seinem ersten Konsulat, ein Zeitgenosse von dem und dem, „um diese Zeit“, „damals“ „nun geschah es, daß …“, „dann“, „danach“, „kurz darauf“, „inzwischen“, „am folgenden Tag“. Das kann der Erzählung einen episodischen Charakter geben. Ungewöhnlich sind präzise Angaben wie „um die zweite Nachtwache“, (13) „als es tagte“, „um die Mitte der Nacht“, „schon krähte da und dort ein Hahn“, (14) „es war die sechste Stunde, als ein Wind aufkam …“. (15)
Einmal heißt es: „Wenige Tage später rückte Caesar ein und bemächtigte sich Roms.“ (16) Eine Anmerkung des Übersetzers berichtigt: Es sei mehr als zwei Monate später gewesen. (17) Aber das wußte Plutarch durchaus, wie er an anderer Stelle zeigt. Er hat hier wie an vielen Stellen im Interesse des Zusammenhangs seiner Erzählung die Chronologie gerafft, um keine Leerstelle in der Erzählung zu lassen. (18) Mit solchen Erzähltechniken muß man bei einem antiken Autor, auch bei den Evangelisten, rechnen. Im übrigen gehört das zeitraffende Erzählen zu den elementaren Notwendigkeiten des Erzählens überhaupt und hat verschiedene Formen. (19)
↑ Multiperspektivität
Drittens erwähnen Sie im Zusammenhang der beiden Biographien von Julius Cäsar und seinem Mörder Brutus (S. 34), dass Plutarch „zumindest ansatzweise so etwas wie Multiperspektivität“ kennt, indem er nämlich
die Geschichte des Mordes [an Cäsar] noch ein zweites Mal [erzählt], nicht weniger ausführlich, mit neuen Einzelheiten, jetzt aber aus der Perspektive der Mörder…
↑ Charakterdarstellung durch direkte Rede
Im Blick auf die Reden, die der Autor des Johannesevangeliums Jesus in den Mund legt, ist schließlich viertens (S. 34) die „Charakterdarstellung durch direkte Rede“ von Bedeutung,
einer sogenannten Ethopoiie (ēthopoiia) oder Prosopopoiie (prosōpopoiia), wie sie in der Rhetorikschule eingeübt wurde. Dort konnten Aufsatzthemen lauten: Wie hat wohl der oder die bei der und der Gelegenheit gesprochen? (20)
↑ Prüfung der Glaubwürdigkeit historischer Angaben
Ein großer Unterschied zur Arbeitsweise der Evangelisten besteht allerdings darin (S. 37), dass Plutarch als Geschichtsschreiber
immer wieder unterschiedliche Versionen einer Begebenheit [erwähnt und referiert] und … seine Ansicht [begründet], welche er für glaubwürdiger hält. Das ist das Geschäft des Historikers.
↑ Antike Biographien als „Lebensbilder“
Für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei den Evangelien um Biographien handelt, finde ich Ihre folgende Begriffsklärung interessant (S. 39):
Bei alldem darf man einen einfachen philologischen Sachverhalt nicht übersehen. Das griechische Wort, das man gewöhnlich mit „Biographie“ wiedergibt, ist bios. Dieses Wort bedeutet aber nicht eigentlich „Lebenslauf“ oder „Biographie“, sondern zunächst einmal „Lebensform“, „Lebensart“, „Lebensstil“, way of life. …
(S. 40:) Wenn mit bios ein literarisches Werk gemeint ist, dann ist es also die Darstellung einer Lebensform, ein „Lebensbild“, wie Konrat Ziegler gern übersetzt, oder ein „Porträt“ einer bestimmten Person. … „Der Bios eines Menschen ist durchaus nicht sein Lebenslauf, nicht was er erlebt, sondern wie er lebt,“ schreibt Wilamowitz. (21) Der Begriff „Biographie“ für diese Lebensbilder oder Porträts war in der Forschungsgeschichte geradezu irreführend, da man mit einer Biographie moderne Erwartungen verband (vollständiger Lebenslauf, innere Entwicklung der Persönlichkeit, korrekte Chronologie, Verzicht auf Fiktives usw.), Erwartungen, die kein antiker „Biograph“ erfüllen wollte oder konnte. …
(S. 40f.:) Nach antiker Auffassung kommt der bios eines Menschen vor allem durch die Art und Weise zustande, wie er sein Leben gestaltet und mit Schicksalsschlägen umgeht. Daraus ergibt sich auch die Darstellungsabsicht Plutarchs: Er will keinen vollständigen Lebenslauf bieten; er will nicht die großen und kleinen geschichtlichen Ereignisse im Leben seiner Helden möglichst vollständig erzählen; er will vielmehr die Lebensführung bedeutender Persönlichkeiten darstellen, wie sie in ihren Worten und Taten zum Ausdruck kommt. Dazu dient seine auswählende und stark anekdotische Darstellung des Lebens dieser Persönlichkeiten. …
(S. 41:) Die politischen Ereignisse und ihre Hintergründe kommen nur soweit zur Sprache, als es zum Verständnis des bios notwendig ist. … Die Lebensform wiederum ist seiner Ansicht nach Ausdruck des Charakters eines Menschen, seiner Ziele und Eigenschaften.
Dieses Verständnis einer Biographie als „Lebensform“ oder „Lebensbild“ erinnert mich an die Bedeutung der hebräischen Worte DaBaR = „Wort“ und HaLaKh = „gehen, wandeln“, die von den Evangelisten auf die Beschreibung der Worte und Taten des Messias Jesus und auf seinen Wandel in der Tora (22) (= „Wegweisung, Gesetz“) JHWHs übertragen werden. Sicher unterscheidet sich die griechisch-römische Beurteilung eines hervorragenden Charakters von der jüdisch-hebräischen Beurteilung des tora-gemäßen Lebens eines „Gerechten“ oder gar des von besonderen Zeichen begleiteten Wandels des Messias; gemeinsam ist beiden Lebensbetrachtungen allerdings das Desinteresse an der bloßen Zusammentragung biographischer Fakten.
↑ Die Evangelien als Lebensbilder Jesu
Unter der Überschrift (S. 43) „Die Evangelien als Lebensbilder“ tragen Sie weitere Gesichtspunkte zusammen, die den Evangelien und den Plutarchschen Biographien gemeinsam sind oder sich voneinander unterscheiden.
↑ In welcher Weise war Jesus Mensch und Gott zugleich?
Ein erster Punkt ist die Problematik, dass Jesus nach der Überzeugung der Evangelisten
Mensch und Gott zugleich war. Als Gott kann Jesus zwar Wunder wirken, doch keine Untugenden haben. Aber gibt es einen menschlich überzeugenden Charakter, der ohne alle Untugenden ist? Plutarch hätte zweifellos mit Nein geantwortet. … Wie soll man also einer Gestalt wie Jesus gerecht werden, von der all dies Unmögliche gilt? Die Evangelien sind vier Versuche, diese Aufgabe zu lösen.
Mir stellt sich hier allerdings die Frage, ob diese Frage nicht allein schon deswegen unbeantwortbar ist, weil sowohl die Gottesvorstellungen von Juden und Heiden als auch ihre Begriffe von Tugend und Untugend einfach nicht kompatibel sind.
So ist Jesus für die Autoren der Evangelien kein Gott nach Art der Heiden, der sich auf Grund der Zeugung durch einen Gott, durch Unsterblichkeit oder durch bestimmte Tugenden als solcher zu qualifizieren hätte. Und Jesus ist auch noch nicht in dem Sinne „Gott“, wie es die spätere christliche Dogmatik definiert hat. Vielmehr ist Jesus zunächst einmal Gottes Sohn im Sinn der jüdischen Vorstellung, dass „einer wie Gott“ dem nach Gottes Ebenbild geschaffenen Menschen entspricht (23), und dann im Besonderen als Messias Israels die Verkörperung sowohl des erstgeborenen Sohnes Gottes (der nach 2. Mose 4,22 Israel ist) als auch des befreienden NAMENs (24) Gottes.
Was Tugend oder Untugend betrifft, könnte man einerseits sagen, dass gerade die griechisch-römischen Götter sich nicht gerade durch besondere Tugendhaftigkeit hervortun. In der jüdischen Bibel gibt es andererseits durchaus Menschen (wenn auch nur wenige), von denen es heißt, dass sie mit Gott oder in den Wegen Gottes wandeln, zum Beispiel Henoch (1. Mose 5,22.24) oder König Josia (2. Könige 23,25). Wie wenig in den Evangelien das Selbstverständnis Jesu als Menschensohn, Messias oder Gottessohn auf seine vollkommene menschliche „Tugendhaftigkeit“, etwa im Sinne von Güte oder Gerechtigkeit, zurückgeführt wird, zeigt sich etwa in Markus 10,18 (bzw. Lukas 18,19), wo Jesus es ablehnt, „gut“ genannt zu werden, oder in Matthäus 3,15, wo Jesus darauf besteht, die Umkehrtaufe des Johannes zu empfangen.
↑ Öffentliches Wirken, anekdotische Erzählweise, Passion
Ähnlich sind (S. 44) die Evangelien den Lebensbildern Plutarchs vor allem darin, dass ihr „Schwerpunkt auf dem öffentlichen Wirken“ Jesu und „der Darstellung der Passion“ liegt. Außerhalb der Passionsgeschichte
finden wir wie bei Plutarch vielfach eine episodische und anekdotische Erzählweise mit spärlichen und fast durchweg relativen Zeitangaben sowie die Unterordnung der Chronologie unter sachliche Gesichtspunkte. Bereits Augustinus beobachtet bei den Evangelisten die Erzähltechnik der chronologischen Raffung, um die Kohärenz der ausgewählten Ereignisse zu wahren, die zu den elementaren Notwendigkeiten des Erzählens gehört. (25) Und selbstverständlich treffen wir auch hier auf die bei Plutarch üblichen Mittel einer authentischen Stilisierung in Verhaltensweisen, Worten, Reden und Gebeten.
↑ Unterschiede der sozialen Welt bei Plutarch und in den Evangelien
Mit Recht weisen Sie aber auf einen „auffallenden Unterschied“ hin, den es zwischen „der sozialen Welt, die Plutarch zur Darstellung bringt, und der in den Evangelien geschilderten gibt“:
Die Helden Plutarchs entstammen alle der Oberschicht, die meisten sind Aristokraten und Adlige. Die Welt dieser Helden sind große Städte, die Belange der hohen Politik, Feldzüge und Schlachten. Fast alle verbindet ein hervorstechender Charakterzug, der sie zu ihren großen Taten treibt: Ehrgeiz und das unbedingte Streben nach Ruhm. …
(S. 45:) Die Hauptperson der Evangelien dagegen ist ein Handwerkersohn und armer Volksprediger. Seine Geschichte spielt in der Welt der kleinen Leute, hauptsächlich in einem Landstädtchen am See Genesaret, wo es um Fischerei und bäuerliche Arbeiten geht. Ehrgeiz und Ruhmsucht kann man ihm nicht nachsagen, aber er tritt als Autorität mit ungewöhnlichen, ja übermenschlichen Fähigkeiten auf. Eine große Stadt und Aristokraten wie die Sadduzäer kommen erst ins Spiel, als es diesen darum geht, den hochbegabten, aber unbequemen Volksprediger loszuwerden.
Nur mit zwei Namen überschneiden sich die historischen Welten der Evangelisten und Plutarchs: der eine ist Augustus, der in Lk 2,1 freilich nur als Urheber eines Edikts genannt wird, nicht als agierender Charakter, der andere ist Herodes der Große. Er tritt im zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums sogar als handelnder und redender Charakter auf.
↑ Die Evangelien zitieren nur aus der Heiligen Schrift
Ebenfalls mit Recht erwähnen Sie (S. 46), dass unter den Evangelisten nur Lukas eine „gewisse Vertrautheit mit heidnischer Literatur … durchblicken“ lässt und dass in den Evangelien Zitate „durchweg aus der Heiligen Schrift“ stammen,
gewöhnlich in der Fassung der Septuaginta, die jedem frommen Juden oder Gottesfürchtigen vertraut war. Diese Schriftzitate treten sozusagen an die Stelle der Dichterzitate bei Plutarch. Ihre Funktion ist freilich nicht ganz dieselbe. Plutarchs Dichterzitate haben meistens ornamentalen Charakter, die Schriftzitate der Evangelien dagegen bringen einen sachlichen oder geschichtlichen Zusammenhang zum Ausdruck.
Das ist richtig. Allerdings frage ich Sie: Was genau meinen Sie mit sachlich? In welcher Weise beziehen sich Ihrer Ansicht nach die Evangelisten auf das Alte Testament? Verstehen sie Jesus vom Alten Testament her – ist also Jesus nur als Messias Israels wirklich zu begreifen? Oder wollen schon sie wie die spätere christliche Kirche das Alte Testament ausschließlich auf Jesus hin interpretieren – ist in ihren Augen das Judentum also lediglich als Vorläuferreligion für das Christentum relevant und mit Jesus Christus letzten Endes überholt?
↑ Wie einmalig waren die Evangelien im Gegenüber zu den Schriften des Alten Testaments?
Über Ihren folgenden Abschnitt stolpere ich an zwei Stellen:
Aus der Schichtgebundenheit der antiken Literatur ergibt sich für den heutigen Historiker eine große Schwierigkeit. Denn da es in dieser Hinsicht alle antiken Geschichtsschreiber wie Plutarch gehalten haben, auch die alttestamentlichen Geschichtsbücher und Flavius Josephus, ist uns die Welt der Reichen samt ihren großartigen Baulichkeiten recht gut bekannt, über die Welt der Armen und der kleinen Leute dagegen sind wir schlecht informiert. Ihre Hütten und ihr armseliges Leben hat der Staub der Geschichte und die Geringschätzung der Gebildeten fast vollständig verweht. Erst durch die Papyrusfunde in Ägypten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist uns diese Welt näher gekommen. Zu literarischer Beachtung und wirklicher Wertschätzung gelangte sie erst mit den Evangelien. Mit ihnen tritt, vielleicht abgesehen von Hesiod, erstmals Literatur ans Licht, die nicht in erster Linie für die Oberschicht gedacht ist, sondern schichtenübergreifend für alle. Das ist ein bemerkenswertes soziologisches und sozialgeschichtliches Faktum.
Wollen Sie diese Analyse wirklich auch insgesamt auf das Alte Testament beziehen? Etwa weil die Bücher Samuel und Könige die Geschichte der Könige Israels und Judas darstellen? Allerdings wird diese Geschichte ja gerade aus der Sicht des Gottes Israels geschildert, dessen NAME für Befreiung und Gerechtigkeit steht und der radikal Partei ergreift für die Armen und Elenden des Volkes, während fast alle Könige von den Propheten JHWHs scharf kritisiert werden. In meinem Augen sind auch die Bücher des TeNaK (26) bereits schichtenübergreifende Literatur für die Gesamtheit der jüdischen QaHaL, also der Versammlung einer religiösen Gemeinde, wie sie nach dem babylonischen Exil in der Perserzeit entsteht – und dieser Versammlung aus „Männer[n] und Frauen und alle[n], die es verstehen konnten“, wird nach Nehemia 8,2-6 sogar die befreiende Tora JHWHs als Verfassung einer israelitischen Bürgergemeinde zur Abstimmung vorgelegt.
Wenn Sie im nächsten Abschnitt betonen, dass die Sprache der Evangelien „der gewöhnlichen Alltagssprache sehr nahe stand und damals überhaupt nicht literaturfähig war“, bestätigen Sie dann ja doch auch zugleich, dass das „Vorbild für diese Art Literatur … zweifellos die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta“ war. Wieso wollen Sie dennoch den Eindruck erwecken, als seien die Sprache und der soziale Hintergrund der Evangelien in der antiken Literatur ein einmaliges Phänomen gewesen?
↑ Direkte Rede und Dialog in den Evangelien
Schließlich führen Sie (S. 47) zwei weitere „Unterschiede in der Erzähl- und Darstellungsweise zwischen Plutarch und den Evangelien“ an. Da ist erstens „die besprechende Funktion des Autors“ (27), die in den Evangelien nur eine untergeordnete Rolle spielt, und zweitens (S. 48) „der reichliche und vielfältige Gebrauch von direkten Reden und Dialogen, die Alltagsgespräche nachahmen“, der in den Evangelien viel häufiger vorkommt als bei Plutarch. Hier machen Sie deutlich (S. 49), dass die Evangelisten
diese lebhafte, dramatische Erzählweise … ebenso wie das objektive Erzählen ohne Kommentare und Reflexionen aus der biblischen Erzählweise im Alten Testament gelernt und übernommen [haben]. Dort finden wir sie in allen erzählenden Teilen, in der Urgeschichte der Genesis ebenso wie in den Samuel- und Königsbüchern oder in den biographischen Partien des Jeremiabuchs. (28)
↑ Subversive Nutzung der literarischen Gattung bios durch Markus
Da (S. 53f.) „nach allem, was wir wissen, die große biographische Erzählung aufgrund einer kritischen Sichtung der Quellen und Überlieferungen eine originale Schöpfung Plutarchs“ (29) ist, finden Sie es um so bewundernswerter, dass „der Evangelist Markus … eine beachtliche biographische Erzählung schon Jahrzehnte vor Plutarch geschaffen hat“ und sich dabei (S. 68) etwa im „Gebrauch des Asyndetons … durchweg an die literarischen Regeln der klassischen griechischen Literatur [hält]. Das ist bezeichnend für seine schriftstellerische Kompetenz.“
Interessant finde ich den Hinweis von Andreas Bedenbender (30), dass im Hinblick auf „die Möglichkeit…, daß Markus sich bei der Abfassung seines Werkes an der griechisch-römischen Gattung ‚Biographie‘ orientierte, … die folgende Darlegung von A. Yarbro Collins (31) bedacht werden“ sollte:
„Wie Homi Bhabha und andere nach-koloniale Theoretiker argumentiert haben, ahmen unterworfene Menschen in einer Situation kultureller Unterlegenheit die Werte und Praktiken ihrer Herrscher nach, aber mit einem Unterschied. Der Autor des Markusevangeliums imitiert griechische und römische Geschichtsschreibung und Biographie, indem er gewisse Anklänge an ihre Techniken und Werte mit seiner Erzählung verknüpft, aber zugleich verlagert er sie heraus aus dem System der griechischen Kultur und des römischen Imperiums. Stattdessen versetzt er sie in eine stillschweigend vorausgesetzte biblische Große Erzählung, die auf der Septuaginta [der griechischen Übersetzung der jüdischen Heiligen Schrift] beruht und auf ein apokalyptisches Szenario [nämlich der schlagartigen endzeitlichen Überwindung der gegenwärtigen Unterdrückungssituation durch Gottes befreiendes Eingreifen] hinausläuft.“ (32)
↑ Warum besprechen Sie nur die Anfänge der Evangelien?
Ihre Einführung abschließend kommen Sie noch auf die Frage zu sprechen (S. 54), warum Sie in Ihrem Buch nur die Anfänge der vier Evangelien mit den Augen Plutarchs zu lesen unternommen haben. Dazu berufen Sie sich auf die Einsicht, dass der „Anfang … für antikes Denken etwas Grundlegendes und Verpflichtendes“ ist, oder, wie Plutarch sagt:
Archē men dē megiston en panti „Der Anfang ist bei allem das Größte“ (33).
In dieser Hinsicht unterschied sich Ihres Erachtens die hellenistische Philosophie nicht von der Bibel, wie Sie unter Hinweis auf eine Reihe von Beispielen deutlich machen (S. 55f.):
Wenn den Anfang erotischer Leidenschaft der Blick machen kann, (34) dann muß man die entsprechende Warnung Jesu (Mt 5,28) ernst nehmen. Wenn der Anfang der Weisheit die Gottesfurcht ist, (35) dann muß man eben, um Weisheit zu erlangen, mit Gottesfurcht beginnen und nichts anderem. Wenn „die Verehrung der wesenlosen Götzen der Anfang, die Ursache und Vollendung jeglichen Übels“ ist, (36) muß man sie unter allen Umständen meiden. Wenn die Welt ihren Anfang mit einem Schöpfungsakt Gottes nimmt (Gen 1,1), dann ist eine gottlose Welt ein Unding.
Wie bereits diese Beispiele zeigen, liegt hier eine weit verbreitete Denkfigur der Antike vor. Deshalb liegt Plutarch daran, daß nicht Antonius der Auslöser (archē) des Bürgerkriegs war, wie Cicero behauptete, sondern Cäsar. (37) Und es ist ein starkes Argument, wenn er behauptet, die übertrieben ängstliche Form der Religion (deisidaimonia) habe „den Anlaß (archēn) für die Entstehung des Atheismus geliefert“, (38) oder wenn Jesus in der Frage der „Entlassung“ der Ehefrau sich gegen Mose auf „den Anfang der Schöpfung“ beruft. (39) Nicht von ungefähr wiederholt der Evangelist Johannes das Stichwort „im Anfang“ zu Beginn des Prologs zweimal und mahnt in seinem ersten Brief die Christen, bei dem zu bleiben, was sie „anfangs“ (ap‘ archēs) gehört haben. (40) Und es macht einen Unterschied, ob man die Woche mit dem Sonntag beginnt oder beendet. (41)
Wenn es ganz konkret um den Anfang einer Biographie geht, dann lässt, wie Sie schreiben (S. 61), der
dreiteilige Aufbau von Plutarchs Lebensbildern: Herkunft – allgemeine Charakteristik – öffentliches Wirken … freilich viele Varianten und Ergänzungen zu.
Dass Sie sich in Ihrem Buch darauf beschränken, die Anfänge der Evangelien zu besprechen, hatten Sie bereits in Ihrem Vorwort folgendermaßen begründet (S. 8):
Ich möchte den Begriff des Anfangs … nicht nur literarisch auf die Anfänge der Evangelien beziehen, sondern auch historisch auf die Anfänge Jesu und der Bewegung, die mit ihm beginnt. Denn für antikes, aber auch für heutiges Denken ist der Anfang einer Sache von großer Bedeutung. Man muß eine Sache richtig beginnen, damit sie gelingen kann. Die gelungenen Anfänge wiederum bestimmen das Ganze und können, wo es sich um die Identität einer sozialen Bewegung handelt, verpflichtenden Charakter haben. Nicht von ungefähr beginnt Markus sein Evangelium mit diesem Stichwort und will Lukas nach Auskunft seines Vorworts den Anfängen nachgehen.
Auch Matthäus beginnt sein Werk mit einem historischen Anfang, wenn er bei Abraham einsetzt. Daß Johannes noch weiter zurückgreift bis zum Anfang schlechthin, hängt mit seiner besonderen Sicht der Dinge zusammen.
Vor allem im Blick auf diesen zuletzt zitierten Satz gebe ich bereits hier zu bedenken, ob hebräisches und griechisches Denken nicht doch etwa in der Auslegung der ersten Worte des Johannesevangeliums in unterschiedliche Richtungen gehen. Sie scheinen nämlich den Anfang des Logos vom griechischen Denken her als kosmologisch-jenseitige Präexistenz vor aller Zeit zu begreifen, während das hebräisch-biblische Denken den „Anfang“ der Schöpfung als das grundlegende Wirken (= BaRaˀ) des befreienden und Recht schaffenden Gottes Israels betrachtet, das im Diesseits – auf der Erde unter dem Himmel – geschieht und erst dann abgeschlossen sein wird, wenn niemand auf Erden mehr in Armut und Elend leben wird (42). Und in dieses Schöpfungsverständnis hinein schreibt der jüdische Autor Johannes seine Botschaft des Messias Jesus, den er als den göttlichen Logos verkündet und der von sich sagt (Johannes 5,17):
„Mein VATER wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.“
So viel zur Einführung in ihr Buch und zu meinen grundlegenden kritischen Anmerkungen. Nun zu Ihrer Betrachtung der Anfänge der Evangelien im Einzelnen und Konkreten.
↑ Markus
↑ Schrieb der Dolmetscher des Petrus das Markusevangelium?
Zum Markusevangelium hatten Sie schon weiter oben angenommen (S. 18f.), dass seine Hauptquelle durchaus, wie von Papias bezeugt, „die Erzählungen des Petrus“ gewesen sein könnten. Er sei nämlich (S. 64) „der Dolmetscher des Petrus“ gewesen. Jedenfalls meinen Sie (S. 19):
Auch vierzig Jahre nach den Ereignissen lebten jedenfalls noch genug Leute, die aus eigener Erfahrung oder aus den Erzählungen von Zeugen wußten, was geschehen war, und gegen grobe Verfälschungen der Tatsachen Einspruch erhoben hätten. Es war um das Jahr 70 n. Chr. sicher keine Schwierigkeit, noch Augenzeugen und verläßliche Tradenten zu finden.
Dass der Evangelist Markus „Erkundigungen einzog, deutet er“ Ihnen zufolge (S. 19f.)
an einer Stelle seines Evangeliums sogar an, nämlich dort, wo er von Simon von Cyrene sagt, er sei der Vater von Alexander und Rufus gewesen (Mk 15,21). Die beiden Namen der Söhne, die in seiner Erzählung gar keine Rolle spielen, kann er bei den Adressaten offenbar als bekannt voraussetzen. Aber warum hat er sie überhaupt erwähnt? Offensichtlich doch nur als Zeugen oder Tradenten der Szene, die er gerade erzählt, und vielleicht nicht nur dieser Szene. … Und es ist bemerkenswert, daß Paulus im Römerbrief einen Rufus und seine Mutter grüßen läßt (Röm 16,13). Die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Rufus mit dem von Mk 15,21 identisch ist, kann man nicht einfach abstreiten. (43)
Ob diese beiden Namen in der markinischen Komposition seines Evangeliums aber tatsächlich eine inhaltliche Rolle spielen, das hat Andreas Bedenbender (44) in Frage gestellt, indem er sie in eine Strategie des Markus einordnet, durch die Erwähnung symbolträchtiger Namen die Erinnerung an für seine Botschaft wichtige Überlieferungen der biblischen bzw. jüdischen Tradition aufzurufen – und zwar in diesem Fall, um indirekt Kritik zu üben an der Instrumentalisierung makkabäischer Traditionen durch die für den Jüdischen Krieg mitverantwortlichen zelotischen Bewegungen. Nach Bedenbender erinnern nämlich die Namen Simon und Alexander an wichtige Repräsentanten des makkabäisch-hasmonäischen Königshauses, nämlich Simon Makkabäus und Alexander Jannai (zugleich klingt der Name des Juden Tiberius Alexander an, der im Auftrag der Römer Zelotenführer kreuzigte); und der typisch römische Name Rufus = der Rote mag als Symbol für Rom auftreten. Anzuzweifeln ist nach Bedenbender auf jeden Fall, dass Markus nur an dieser einen Stelle „Gestalten, die zu den Lokalgrößen irgendeiner der vielen Gemeinden zählten, auf biographisch-anekdotischem Wege seine Reverenz erweisen“ würde.
↑ Die Nähe des Markusevangeliums zu paulinischen Gedanken
Gegen eine Nähe des Markusevangelium zu Petrus spricht nach Andreas Bedenbender (45) vor allem die Tatsache, dass sich „das Mk-Ev mit paulinischen Gedanken“ berührt:
Markus wie Paulus betonen das Kreuz Christi und verwenden „Evangelium“ als ein Schlüsselwort. Beide sehen sie die Heiden in einer Weise vom Evangelium angesprochen, die nicht den Vorstellungen des Herrenbruders Jakobus und seiner Anhängerschaft entsprach, und beide geraten durch diesen Gegensatz zur Familie Jesu in Bedrängnis. Die Relation, zwischen der Rettung Israels und der Rettung der Heiden, die sich aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Hellēnes in Mk 7,27-29 ergibt, entspricht dem paulinischen „dem Juden zuerst und dann auch dem Hellēn“ in Rom 1,16.
Das Markusevangelium scheint also insbesondere darin dem Herzensanliegen des Paulus nähergestanden zu haben als der Judenmission des Petrus, dass es (46) „auf die Einheit von Juden und Heiden in der Gemeinde“ zielt und diese „als eine Einheit von Verschiedenen“ versteht. Dass Jesus nach Markus in 7,19 alle Speisen für rein erklärt, entspricht nach Bedenbender (47) ebenfalls „Darlegungen des Paulus“ in Römer 14,14 und Galater 2,11-14:
„Hier scheint mir das entscheidende Argument gegen eine Entstehung des Mk-Ev im geistigen Umfeld des Apostels Petrus zu liegen. Die eher klägliche Rolle, die Petrus bei Markus spielt, ließe sich noch zur Not damit erklären, daß Markus sich auf eine selbstkritische Darstellung des Apostelfürsten stützte. Aber ein Petrus, der in der Speisefrage auf die Linie der Jakobusleute eingeschwenkt war und die Tischgemeinschaft mit den Heiden in Antiochia wieder abgebrochen hatte, hätte am Mk-Ev (7,19!) nie und nimmer Freude haben können. Und es gibt keinen Grund zu der Annahme, Petrus habe sich später erneut umbesonnen. Das Donnerwetter des Paulus hat bei ihm offenbar nicht gefruchtet, denn sonst hätte der Völkerapostel den Galatern sicher von seinem Erfolg berichtet.“
↑ Wann wurde das Markusevangelium geschrieben?
Zur Datierung des Markusevangeliums wollen Sie nicht ausschließen (S. 64), dass es
auch im Jahr 40 entstanden sein [kann]. Darauf deutet jedenfalls der merkwürdig chiffrierte Satz mit der Leseranrede in Mk 13,14.
Das würde Ihrer Annahme entgegenkommen, das Markusevangelium auf Augenzeugenberichte des Simon Petrus zurückzuführen, die er dann schon wenige Jahre nach Jesu Tod seinem Dolmetscher Markus mitgeteilt hätte. Man kann Markus 13,14 aber auch auf andere Weisen deuten, die mir weitaus plausibler erscheinen, worauf im einzelnen einzugehen hier zu weit führen würde (48).
Fast alle Bibelwissenschaftler sind sich inzwischen allerdings darüber einig, dass Markus sein Evangelium um das Jahr 70 n. Chr. herum, am Ende des Jüdischen Krieges mit der Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und seines Tempels, geschrieben hat. Auf einige Argumente Andreas Bedenbenders, die dafür sprechen, werde ich später noch eingehen.
↑ Ein Buch für „Liebhaber der heiligen Schriften Israels“
Auch auf das, was Sie (S. 65) zum Begriff „Evangelium“ (wörtlich = „gute Nachricht“) schreiben, möchte ich erst später zurückkommen, weil es besser in den Zusammenhang dessen passt, was Sie die „neue Lehre“ Jesu nennen.
Mit Recht stellen Sie heraus (S. 66), dass man zum „Verständnis dieser „guten Nachricht“ … einiges an Vorwissen“ benötigte. Sowohl das Wort „Christus“, das Heiden möglicherweise als „Cognomen“ (= Rufname) mit dem „beliebte[n] Sklavenname[n] Chrēstos ‚der Brauchbare‘“ verwechseln konnten, als auch „die Herkunftsaussage“, er sei „der Sohn Gottes“ gewesen, lassen sich nur von der jüdischen Heiligen Schrift her begreifen. Und so erkennen Sie auch „im Buch des Propheten Hosea in seiner griechischen Übersetzung“ die „nächste Parallele“ für die „zwei Überschriften“ des Markusevangeliums (49) (S. 67):
Damit ist schon vom ersten Satz an klar: Das kleine Büchlein des Markus will nicht Literatur für Literaturliebhaber und historisch Interessierte sein, sondern heilige Schrift für Liebhaber der heiligen Schriften Israels. Speziell angesprochen sind solche Liebhaber der heiligen Schriften, die über diesen Jesus Christus mehr erfahren wollen. Wie die herkömmlichen heiligen Schriften im Gottesdienst vorgelesen wurden, so soll auch dieses Büchlein im Gottesdienst vorgelesen werden.
Gerade in griechischer Sprache paßte es gut in die Tradition der heiligen Schriften Israels. Denn die griechische Übersetzung dieser Schriften wies dieselbe Sprachform auf wie das Markusevangelium: eine Koine, die der wirklich gesprochenen sehr nahe stand.
↑ Auf wen oder was sind die Worte „in der Wüste“ zu beziehen?
Mit dem (S. 68) „Doppelzitat aus zwei verschiedenen Prophetenbüchern (Mal[eachi] 3,1 und Jes[aja] 40,3)“ in Markus 1,2-3 wird vollends deutlich, dass der Autor bei seinen Lesern Schriftkenntnisse voraussetzt. Nicht einverstanden bin ich mit Ihrer stillschweigend vorausgesetzten Annahme, dieses Zitat kündige (die folgende Hervorhebung stammt von mir)
einen Boten an, der näher charakterisiert wird als eine Stimme in der Wüste, die dazu aufruft, dem HERRN die Wege zu bereiten.
So eindeutig bezieht sich nämlich die Ortsbestimmung „in der Wüste“ nicht auf den Ort, an dem die Stimme des Boten zu vernehmen ist; sie kann sich auch auf die Verwüstung Jerusalems und des Tempels im Jüdischen Krieg beziehen, innerhalb derer dem HERRN, also dem befreienden NAMEN des Gottes Israels der Weg, ein neuer Anfang, bereitet werden soll (50).
↑ Wer oder was ist der „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“?
Auch über eine weitere Bezugnahme, die Sie vornehmen, kann man geteilter Meinung sein. Sie setzen Johannes den Täufer mit dem „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“ gleich; nun hat aber Markus sein ganzes Werk unter die Überschrift „Anfang des Evangeliums“ gestellt, woraus Andreas Bedenbender (51) weitreichende Schlüsse zieht:
Das Mk-Ev spricht vom Scheitern Jesu mit einer schonungslosen Klarheit, wie sie wohl nur poetischen Texten eignet. Der Text artikuliert sich nicht klagend, vielmehr dominiert ihn das Bemühen um rationale Analyse. Er ist darauf angelegt, verständlich zu machen, kraft welcher Notwendigkeit die Botschaft Jesu nicht durchdringen konnte. Darum stellt die Erkenntnis des Scheiterns nicht sein Fazit dar, sie ist im Gegenteil der Ausgangspunkt, von dem aus sich das markinische Evangelium erzählerisch entfaltet.
Weiterhin ist es nach Bedenbender (52)
kennzeichnend für die Radikalität des markinischen Ansatzes, daß der Text keine neue Perspektive jenseits des Scheiterns entwickelt. In der Bildsprache des Mk-Ev: Der Auferstandene tritt im Text nicht mehr in Erscheinung, und die Nachricht von seiner Auferstehung löst Panik aus, sie läßt sich nicht weitersagen. Gemessen an der mehrere Jahrzehnte älteren Ostertradition, die ihren Niederschlag in 1 Kor[inther] 15,3-7 gefunden hat, stehen wir vor einer beispiellosen Rücknahme christlicher Glaubensgewißheiten. …
Die Hoffnung des Mk-Ev ist schwer beschädigt, preisgegeben hat der Text sie nicht. Wenngleich sonderbar reduziert – und unter den gegebenen Umständen nicht vermittelbar -, hat die Osterbotschaft hier eben doch noch ihren Platz: in der für die Jünger bestimmten Verheißung, den Auferstandenen zukünftig zu sehen (16,7, vgl. auch 14,28), und im Anblick des leeren Grabes, in dem „Er ist nicht hier“. Diese Verse, mit denen die Darstellung abbricht, bestreiten, daß die Geschichtsschreibung der Sieger das letzte Wort hat und daß das Evangelium am Ende vom Tod verschlungen wurde. Im Mk-Ev verbindet sich, anders gesagt, die Weigerung, eine Perspektive jenseits der Katastrophe auch nur umrißhaft zu entwickeln, mit dem Insistieren darauf, daß es eine solche Perspektive geben könne – und vielleicht sogar: geben müsse.
Ich habe Bedenbenders „Frohe Botschaft am Abgrund“ so ausführlich zitiert, um deutlich zu machen, inwiefern das gesamte Markusevangelium sich in einer so wenig triumphalistischen, sondern gebrochenen Form sehr bescheiden und doch klar lediglich als einen (neuen) „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“ nach der Katastrophe des Jüdischen Krieges begriffen haben mag.
↑ Worauf geht das Wort vom Ausziehen der Sandalen zurück?
Fraglich ist es (S. 70), ob die Aussage Johannes des Täufers, „daß nach ihm ein anderer, Stärkerer, kommen werde, dem er nicht einmal die Sandalen auszuziehen würdig sei (1,7)“, tatsächlich in erster Linie auf die heidnische Gepflogenheit zurückzuführen ist, dass für „das Ausziehen der Sandalen … reiche Haushalte einen eigenen Sklaven“ besaßen. Nach Ton Veerkamp (53) spricht bei Markus als einem der jüdischen Tradition verpflichteten Autor viel mehr dafür, dass er das in Ruth 4,7f. bezeugte jüdische Ritual für die rechtskräftige Besiegelung einer Vereinbarung im Sinn hat:
Wir wissen aus der Rolle Ruth, daß das Lösen eines Schuhs ein Zeichen ist. Ein Geschäft wird in Israel rechtskräftig, indem der eine der daran Beteiligten seinen Schuh löst und ihn dem anderen gibt (Ru 4,7f.). Hier ist mehr im Spiel als nur ein Ausdruck für totale Unterwerfung. Niemand in Israel kann den Messias dazu zwingen, rechtskräftig in und für Israel zu handeln, man kann ihm nicht die Schuhe lösen, nicht einmal die Bänder der Schuhe.
↑ Wollte Markus eine Biographie des Sohnes Gottes schreiben?
Sehr problematisch finde ich Ihre Annahme (S. 71), dass Markus quasi als erster das tollkühne Unternehmen in Angriff genommen habe, eine Biographie des Sohnes Gottes zu schreiben. Auf diese Weise habe er versucht, nicht nur Heiden anzusprechen, für die „Götter, die eine Zeit lang auf Erden in Menschengestalt umherwandern, eine vertraute Vorstellung“ waren, sondern auch „jüdischen Frommen glaubhaft [zu] machen, daß der eine Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, als Mensch daherkommen kann“.
Dagegen spricht meines Erachtens nicht nur, was ich von Andreas Bedenbender über das Markusevangelium als „Frohe Botschaft am Abgrund“ gelernt habe, dass nämlich der wirklich dringliche Anlass für diese Schrift in der massiven Infragestellung des Evangeliums von Jesus Christus durch die traumatischen Erfahrungen des Jüdischen Krieges bestand und die Absicht des Markus nicht, wie Sie meinen, ein rein religiös begründeter Versuch war, „zunächst nur die Geschichten ein wenig in Form bringen, die Petrus zu erzählen pflegte.“ Das klingt doch zu banal und spiegelt nicht ansatzweise etwas davon wider (54), „wie sehr der Jüdische Krieg die Verkündigung der frohen Botschaft verstört hatte.“
Hinzu kommt, dass Jesus für Markus zwar in einem einzigartigen, aber eben doch noch jüdisch geprägten Sinn „Sohn Gottes“ ist (vgl. Weisheit 2,17-20). Das beweist schon Markus 10,18, wo es Jesus ausdrücklich ablehnt, mit dem Einen Gott gleichgesetzt zu werden.
Zwar stimme ich Larry W. Hurtado (55) zu, dass Jesus nicht erst von Heidenchristen, sondern bereits sehr früh auch von Judenchristen mit dem Gott Israels zusammen angebetet wurde, allerdings eindeutig auf eine Weise, die mit heidnischer Menschenvergottung nicht verwechselt werden darf.
Indem Jesus nach Markus 1,10-11 den Geist und Zuspruch Gottes als sein „geliebter Sohn“ empfängt, wird ein Kenner der Tora zugleich an den „geliebten Sohn“ Isaak aus Genesis 22,2.12.16 erinnert. Dann ist Jesus in den Augen des Markus nicht nur insofern Gottes Sohn, als er mit seinem NAMEN (JɘSchUˁAH = Hilfe, Rettung, Befreiung) den befreienden heiligen NAMEN des Einen Gottes Israels verkörpert, sondern er ist Sohn Gottes = einer wie Gott, indem er zugleich auf einzigartige Weise als Messias Israels das Volk Israel (= Isaak) selbst repräsentiert, das in Exodus 4,22 von Gott als „mein erstgeborener Sohn“ angesprochen wird.
Sie selbst gehen (S. 72) im Zusammenhang mit der in Markus 1,10f erwähnten Himmelsstimme auf diese biblischen Parallelen mit keinem Wort ein und lassen dadurch völlig außer Acht, dass vor Jesus bereits das Volk Israel der „geliebte Sohn“ Gottes gewesen war. Ihre folgende Formulierung bekommt dadurch (bewusst oder ungewollt?) einen israel-vergessenen Zungenschlag:
Jetzt weiß er [Jesus], daß er der geliebte einzige Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde ist. Der hyios agapētos ist im Griechischen der einzige Sohn, der schon deshalb besonders geliebt ist. (56)
↑ Warum wird um 70 n. Chr. an der Auferstehung gezweifelt?
Auf unzureichende religiöse Offenheit der in jüdischen Vorstellungen verfangenen Jünger Jesu führen Sie die Frage zurück, die sich die Jünger Jesu in Markus 9,10 untereinander stellen: „Was ist das, auferstehen von den Toten?“ Sie schreiben (S. 72):
Die Totenauferstehung war nach frühjüdischen Vorstellungen ein kollektives Ereignis am Jüngsten Tag. Mit der Auferstehung eines einzelnen vor diesem Tag rechnete zur Zeit Jesu niemand. Erst als es so weit ist, wird das Wissen der Jünger zu einem begreifenden Wissen.
Aber diese Erklärung scheitert schon daran, dass die Jünger ja gar nicht nach der konkreten Auferstehung Jesu im einzelnen fragen, sondern – wörtlich übersetzt – ganz allgemein nach dem „Auferstehen aus Toten“. Daher ist Andreas Bedenbender (57) in seinen folgenden Ausführungen vollkommen Recht zu geben:
Religionsgeschichtlich ist der Unverstand der Jünger absurd. lm Palästina der Zeit Jesu gehörte es zu den Kennzeichen der Pharisäer, auf die „Auferstehung von den Toten“ zu hoffen, und selbst die Sadduzäer – die diese Hoffnung dezidiert nicht teilten -, ja vermutlich sogar Heiden, sofern sie religiös auch nur halbwegs gebildet waren, hätten sich deshalb unter „Auferstehung“ immerhin etwas vorstellen können. Dementsprechend hantieren die Sadduzäer des Mk-Ev ganz geläufig mit dem Begriff (vgl. 12,18,23), und ein Schriftgelehrter kann Wohlgefallen an einem auferstehungsbejahenden Wort Jesu finden (vgl. 12,28). Wenn aber dieser Schriftgelehrte (der „verständig“ und „nicht fern vom Reiche Gottes“ ist; 12,34) mit der Darlegung Jesu ohne weiteres etwas anzufangen vermag – und zwar vor Ostern -, warum muß dann gerade der engste Kreis der Jünger in der gleichen Frage scheitern?
Außerdem ist für Markus nicht einmal am Ende seines Evangeliums die Zeit gekommen, dass irgendein Jünger von der Auferstehung Jesu wirklich etwas weiß, geschweige sie begriffen hat – denn es endet in 16,8 mit dem entsetzten Schweigen der Zeuginnen des leeren Grabes.
Stellt man sich aber vor Augen, dass das Markusevangelium, wie nun schon mehrfach bemerkt, nach Andreas Bedenbender ein „Evangelium am Abgrund“ ist, wird unmittelbar verständlich (58), dass den Jüngern
die Bedeutung des Wortes „Auferstehung“ abhanden gekommen [ist], und wenn sie das Unverstandene „festhalten“, so heißt dies umgekehrt: Sie … sind von dem „Festgehaltenen“, der überlieferten Verkündigung der Auferstehung, selbst überfordert.
Die Generation der Christen zur Zeit des Markus musste also offenbar noch einmal ganz neu zu buchstabieren lernen, was „Auferstehung der Toten“ bedeutet (59):
Man mache sich klar: Ein Menschenalter vor der Abfassung unseres Textes hatte erst Jesus von Nazareth den bevorstehenden Anbruch des Gottesreiches proklamiert, dann war die Botschaft von seiner Auferweckung als der des „Erstlings der Entschlafenen“ in die Welt hinausgedrungen. Nun aber kam, anstelle der allgemeinen Auferstehung der Toten, das Massensterben von Jerusalem. Die Verhungerten, Erschlagenen, Gekreuzigten zählten in jedem Fall nach Zehntausenden; Schätzungen gehen bis zu einem Drittel der jüdischen Bevölkerung Palästinas. Wer überlebt hatte, sah sich in die Sklaverei verkauft, hatte das Bergwerk, die Galeere oder „die Spiele“ vor sich.
Angesichts dieser Schrecken hielt es Markus anscheinend für unmöglich, in seiner Evangeliumsverkündigung
das ganze Gewicht auf das ewige Leben zu legen und den irdischen Tod, wie grausam er auch immer sei, für bedeutungslos zu erklären. Wie aber läßt sich der Gedanke der rettenden Lebenshingabe Jesu bewahren, ohne zynisch zu werden oder das tatsächliche Leid zu bagatellisieren?
Und genau die in der zuletzt gestellten Frage enthaltene Spannung hält das Markusevangelium aus – getreu der überkommenen Gebetspraxis der Psalmen oder Hiobs, am Gott Israels sogar in tiefster Verzweiflung, in Klage und Anklage und sogar Gottverlassenheit festzuhalten, wie es sich am deutlichsten zeigt, wenn Jesus am Kreuz den Psalm 22 betet (Markus 15,34).
↑ Mit welchen Tieren ist Jesus in der Wüste zusammen?
Die Geschichte von der Versuchung Jesu schildert Markus (1,12-13) im Gegensatz zu den späteren Evangelisten Matthäus und Lukas äußerst knapp:
Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.
Sie können mit diesen Versen offenbar wenig anfangen und stellen einige widersprüchliche Vermutungen an, warum sich Markus wohl nicht ausführlicher äußert und was er mit seinen Andeutungen meinen mag (S. 73f.):
Das ist doch allzu dürftig: vom Satan versucht, zusammen mit den wilden Tieren, von den Engeln bedient – wie soll man sich das zusammenreimen? Satanische Versuchungen: So etwas kennen wir, aber darüber würde man doch gern Näheres erfahren. Wie sehen solche Versuchungen beim Sohn Gottes aus? Daß der Erzähler darüber nichts weiter sagt, ist meines Erachtens so zu erklären, daß er Kenntnisse darüber bei seinen Lesern voraussetzen kann. Das Zusammensein mit den wilden Tieren und das Bedientwerden durch die Engel soll wohl einen irgendwie paradiesischen Zustand andeuten. Das verlorene Paradies kann offenbar in der Einsamkeit wiedergefunden werden, jedenfalls für Jesus. So gibt diese Szene in ihrer ganzen Dürftigkeit viel zu denken. Von der Sache her handelt es sich um so etwas wie die Exerzitien des Sohnes Gottes vor seinem Amtsantritt. Die müssen schon etwas ungewöhnlich ausfallen.
Wenn Markus sein Evangelium tatsächlich als eine erste Biographie des christlichen Gottessohnes im Sinne einer Art Gründungsurkunde der neuen Religion des Christentums verstanden hätte, dann wäre es sogar vorstellbar, seinen Aufenthalt in der Einsamkeit analog zur späteren Exerzitienpraxis katholischer Mönchsorden zu begreifen. Dann hätte Markus zwar noch das eine oder andere spannende Detail von seiner Begegnung mit Satan erzählen können, aber weil seine Leser es schon kannten, konnte er es auch weglassen. Und sein Zusammensein mit den wilden Tieren mochte an Adam und seine Namensgebung der Tiere im Garten Eden erinnern. Dass Engel Jesus dienen, würde zur Paradiesgeschichte allerdings nicht passen.
Wieder ist es Andreas Bedenbender (60), der Markus 1,12f. weitaus stimmiger in seine Sicht einer „Frohen Botschaft am Abgrund“ einzuordnen vermag. Von Anfang an erklingt diese Botschaft (S. 188) „in der Wüste“ der verheerenden Auswirkungen des Jüdischen Krieges. Aber anders als für die Propheten Jeremia und Hesekiel, die die erste Tempelzerstörung „auf einen Plan Gottes“ zurückgeführt hatten, ist für Markus die Wüste, „die er vor Augen hat, … mindestens ebensosehr die Wirkungsstätte des Satans.“
Die in Markus 1,12f. verbundenen Vorstellungen vom Satan, von den wilden Tieren und von Gottes Engeln bringt Bedenbender weiterhin mit einer Tradition zusammen, die später in der Offenbarung des Johannes (Kapitel 12 und 13) ausführlich ausgestaltet wird (S. 189):
Der von Michael und seinen Engeln besiegte und dann vom Himmel gestürzte Drache setzt der in die Wüste geflohenen Mutter des Messiaskindes nach und will sie ersäufen, was durch das Eingreifen der Erde verhindert wird. Deshalb macht sich der Drache daran, gegen die übrigen vom Geschlecht der Frau zu kämpfen, „die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu“ (12,17). Zu diesem Zweck schickt er zwei Agenten vor, die im 13. Kapitel vorgestellt werden und offensichtlich als Sinnbilder des römischen Staates und seines Kultpersonals zu nehmen sind: eine „Bestie (therion) aus dem Meer“ und „eine Bestie aus der Erde“ (vgl. Offb 13,1.11).
Mk 1,12f. und Offb 12 kennen somit beide eine Konfrontation mit dem Satan, die in der Wüste stattfindet. … Wir haben zwei unterschiedliche Ausgestaltungen eines im Kern identischen Traditionsmaterials vor uns. Da überdies in Mk 1 wie in Offb 12 eine Opposition Satan – Engel zu erkennen ist, liegt es nahe, die in Mk 1,13 unmittelbar im Anschluß an den Satan erwähnten „Tiere“ entsprechend den beiden „Tieren“ von Offb 13 aufzufassen: als Kreaturen des Teufels, Repräsentanten seiner Macht auf Erden (61).
Schließlich halte ich auch Bedenbenders folgende Annahme für durchaus vertretbar (S. 190):
Es wird nicht verkehrt sein, in das „er war bei (meta) den Bestien“ von 1,13 die „pugnare cum bestias [mit wilden Tieren kämpfen]“ hineinspielen zu sehen: In Reaktion auf den Brand Roms waren als Brandstifter aufgegriffene Christianer nach römischem Recht und Gesetz von wilden Tieren zerfleischt worden, und das gleiche war vielen jüdischen Gefangenen nach dem Ende des Krieges widerfahren. Zum markinischen Jesus, dessen Weg ans Kreuz ein Weg der Solidarität ist, würde es passen, auch die „ad bestias“ Verurteilten nicht allein zu lassen. Der Gedanke ist wohl nicht, daß bereits Jesus mit den Tieren gekämpft (und am Ende dann über sie triumphiert) hätte, sondern daß die Konfrontation der Verurteilten mit den Tieren ihnen paradoxerweise Gemeinschaft mit Christus gewährt. Was der markinische Jesus in 8,38 in einem Zweischritt entfaltet – wer jetzt Jesus die Treue hält, der wird zukünftig zum Menschensohn gehören, wenn dieser „mit den heiligen Engeln“ kommt -, das fällt in Mk 1,12f. in eins.
Bestätigt wird Bedenbenders Sicht auch durch die Art (62), wie in späteren ägyptischen Kindheitsevangelien der Umgang des „Jesusbuben“ mit den wilden Tieren dargestellt wird:
Dem Jesusbuben gehorchen die wildesten Tiere der Wüste. Sie sind durch seine Präsenz sofort handzahm, unterwerfen sich der Autorität des kleinen Jesus. Nicht nur, dass sie keine Gefahr mehr für die Menschen darstellen, die Jesus lieb und teuer sind. Sie alle verschonen jeglichen Vertreter der menschlichen Gattung: Löwen, Panther und Drachen. Der kleine Jesus kennt keine Furcht.
Zwar werden hier die wilden Tiere von Jesus in einen paradiesischen Zustand versetzt, aber zunächst handelt es sich ebenfalls um gefährliche Raubtiere oder sogar Drachen.
↑ Was meint Markus mit dem Wort „Evangelium“?
Nun aber endlich zur Frage, was Markus eigentlich mit dem Wort „Evangelium“ meint. Sie empfinden (S. 65) die Übersetzung des griechischen Wortes euangelion im überschriftartigen Eingangssatz des Markusevangeliums mit „gute Nachricht“ als unzureichend, weil zu alltagssprachlich. Unzureichend finde ich allerdings auch Ihre weiteren Erläuterungen zu diesem Begriff:
Dieses Wort kam im Singular mit der Bedeutung „gute Nachricht, gute Kunde“ erst in hellenistischer Zeit auf. Plutarch hat nur zwei Belege. (63) Die frühen Christen griffen es auf und machten es zu einem zentralen Begriff, um das zu bezeichnen, worum es ihnen ging: die Heilsbotschaft, deren Gegenstand die Person und die Verkündigung Jesu Christi ist. So wurde das alltägliche Wort zu einem gewichtigen Begriff, der in ein spezifisches Milieu führt, von dem Plutarch, der sonst so belesen und umfassend informiert war, nichts wußte und offensichtlich nicht das geringste ahnte. Deshalb sollten wir doch bei dem Fremdwort „Evangelium“ bleiben…
Mich wundert doch sehr, dass Sie auf diese Weise den Begriff „Evangelium“ ausschließlich von seiner späteren christlichen Füllung her interpretieren und mit keinem Wort auf seine sprachlichen Hintergründe im Heidentum und im Alten Testament eingehen, die nahelegen, dass Markus es zunächst in einer ganz anderen Zuspitzung verstanden und verwendet hat.
Andreas Bedenbender (64) hat sehr gründlich erforscht und dargelegt, welche Kontexte und Bedeutungsnuancen beim Wort „Evangelium“ mitschwingen, und stellt fest, dass „wir nebeneinander einen jüdisch-biblischen und einen paganen [= heidnischen] Gebrauch“ haben. Dazu schreibt er im einzelnen:
lm [römischen] Kaiserkult … meint das Wort das „mit dem Erscheinen des Kaisers heraufziehende… Heil…“ … oder allgemein in diesem Zusammenhang „Heilsereignisse (…), welche die Bewohner des Imperiums in ihrer Existenz betreffen“ … (65) Die Rede vom „Evangelium“ eines von den Römern hingerichteten Messias ist darum schon terminologisch eine Provokation. Sie bringt politischen Protest auf den Begriff, und zwar auf einen Begriff aus der Sprache der Herrschenden…
Völlig geleugnet werden muß ein biblischer Bezug des „Evangeliums nach Markus“ damit freilich nicht. In Nah[um] 2,1 (66) wird die Nachricht vom Fall der unter dem Namen „Ninive“ firmierenden Weltmacht als eine Form der Evangeliumsverkündigung dargestellt, das trifft sich in der Stoßrichtung mit dem Mk-Ev. Dementsprechend sucht Markus bei seiner eigenen Evangeliumsverkündigung gezielt den Anschluß an das „Evangelium nach Nahum“ (67).
Seltsamerweise verbinden Sie dann später (S. 75) das „was Jesus in Galiläa tut: verkünden, bekannt machen, ausrufen, proklamieren: kēryssein“ mit der aus „der griechischen Tradition“ bekannten „Tätigkeit des Herolds (kēryx), des lautstarken Ausrufers, der Botschaften ausrichtet und Proklamationen verbreitet.“ Sie gehen sogar beispielhaft auf das von Plutarch geschilderte „Auftreten eines Herolds am Ende des Zweiten Makedonischen Kriegs“ ein, der „mit lauter Stimme“ die Freudenbotschaft von dem als sōtēr (= Heiland, Retter, Befreier) dargestellten siegreichen römischen Feldherrn verkündet:
„Der römische Senat und der Feldherr und Konsul Titus Quinctius, die Sieger im Kampf gegen König Philipp und die Makedonen, gewähren Freiheit und Unabhängigkeit den Korinthern, Phokern, Lokrern [usw.]. Frei von Besatzung und Abgaben sollen sie nach den Gesetzen ihrer Väter leben!“ … „Da brauste aus der Menge ein unglaubliches Freudengeschrei empor, das bis zum Meere hin erschallte. Alles Volk sprang von den Sitzen auf, niemand kümmerte sich mehr um die Wettkämpfer, alle drängten durcheinander, um dem Heiland (sōtēr) und Vorkämpfer Griechenlands die Hand zu schütteln, ihm Dankesworte zu sagen.“ (68)
Den Gegensatz zu einem solchen römischen „Evangelium“ sehen Sie nun allerdings nicht darin, dass Jesus, die frühen Christen oder Markus zumindest auch ihr „Evangelium“ als eine Kampfansage gegen das unterdrückerische römische Weltsystem verstanden haben könnten, sondern (S. 76):
Was Jesus proklamiert, ist nicht politische Freiheit, sondern „das Evangelium Gottes“: „Die Zeit ist erfüllt und nahegekommen ist die Herrschaft Gottes. Also denkt um und glaubt an das Evangelium“ (1,15). Der notwendige Gesinnungswandel wird mit der Nähe der Herrschaft Gottes begründet.
↑ Lehrt Jesus bei Markus die Umkehr zu einer neuen Religion?
Aber was genau verstehen Sie nun unter diesem angeblich völlig unpolitischen neuen Evangelium, das Jesus proklamiert? Sollte Jesus wirklich ein anderes Königtum Gottes nahekommen sehen als den Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden umfassenden SchaLOM des Einen Gottes Israels, den bereits die Propheten Israels proklamiert hatten? Meint also Jesus mit seiner Aufforderung zum Umdenken, zur Umkehr, griechisch metanoein, wirklich eine Abkehr von jüdisch-politischen Freiheitshoffnungen und eine Bekehrung zu einer neuen christlichen Religion mit einem rein geistig, innerlich und individualistisch zu verstehenden Freiheitsbegriff?
Bezeichnend ist, dass Sie in Ihrer Analyse „des Stichworts metanoein“ auf die Bedeutung von „Reue nach einem Mißerfolg, ein schlechtes Gewissen oder eine beliebige Meinungsänderung“ nur im heidnischen Griechisch eingehen. „Erst in den Spätschriften der Septuaginta … wie im ganzen Neuen Testament“ habe der Begriff dann „die Bedeutung ‚Gesinnungswandel, Umdenken, Umkehr‘ an[genommen]“. Sie wollen darauf hinaus, dass es zwar „das Phänomen der Bekehrung in der heidnischen Antike eigentlich nur im Bereich der Philosophie“ gab und eine
religiöse Bekehrung … so gut wie nie vor[kam]… Erst mit dem Christentum wurde die Bekehrung zu einem gesellschaftlichen Phänomen und Störfaktor, mit dem man rechnen mußte.
Die Frage ist aber, ob bereits Markus mit dem Begriff metanoein die Bekehrung zu einer neuen Religion meint. Dagegen spricht, dass dieses Wort durchaus auch schon in den prophetischen Schriften Israels eine Rolle spielt. Dort ist es meistens auf eine barmherzige Umkehr Gottes bezogen, der „sich das Unheil gereuen“ lässt (etwa in Joel 2,13 oder Jona 4,2), das Menschen mit ihrem bösen Handeln verdient haben; aber in Jeremia 8,6 und 39,19 ist im Zusammenhang mit der Umkehr zu Gott auch von einer metanoia der Menschen im Sinne ihrer Reue über böse Taten die Rede. Ganz in diesem Sinne ziehen dann ja auch Sie von dem „eschatologisch [also von der bevorstehenden Endzeit her] begründete[n] Ruf zur Umkehr … in der essenischen Tradition“ eine Linie zu „der prophetischen Verkündigung des Täufers und Jesu“.
↑ Lehrt Jesus anders als die Juden oder Johannes der Täufer statt des Gerichts das nahe Heil?
Fragwürdig ist aber Ihre vollständige Entgegensetzung der Verkündigung Jesu zur jüdischen Prophetie und Eschatologie (S. 76):
Dabei ist charakteristisch, daß er [der Ruf zur Umkehr] bei Jesus nicht wie in den frühjüdischen Traditionen und beim Täufer durch das nahe Gericht begründet wird, sondern durch das nahe Heil.
Vergleicht man Markus 1,4 und 1,15 miteinander, so ist in der Verkündigung des Johannes und Jesu kein derartiger Unterschied zu entdecken (noch deutlicher wird die Übereinstimmung im auf Markus aufbauenden Evangelium nach Matthäus 3,2 und 4,17). Und schaut man sich die eben erwähnten prophetischen Belege für die Barmherzigkeit des Gottes Israels an und vergleicht sie mit der Vorausschau auf die Wehen der Endzeit in Markus 13, dann kann ich das „nahe Gericht“ und das „nahe Heil“ als Anlass zur Umkehr keineswegs als jüdisch-christlichen Gegensatz einander gegenüberstellen. Vielmehr schließt schon in den Heiligen Schriften Israels bis hin zu den Ankündigungen des Weltgerichtes durch Jesus die Nähe Gottes immer beides ein: Heil, SchaLOM, Befreiung für diejenigen, die auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen und barmherzig und gerecht handeln – und zugleich den Zorn Gottes für diejenigen, die sich seiner Barmherzigkeit und Vergebung und der Umkehr zu ihm verschließen.
↑ Stellt Jesus der jüdischen Tora seine eigene Lehre entgegen?
Genau so wenig ist Ihre folgende Behauptung aufrechtzuerhalten (S. 76f.):
Auch inhaltlich ist ein Unterschied festzustellen: Die Umkehr soll nicht in einer Umkehr zur Tora und ihren Geboten bestehen, sondern im Beherzigen seiner eigenen Weisungen.
Zwar bekräftigt Jesus bei Markus nicht ausdrücklich die fortwährende Geltung der Tora, wie es später Matthäus in 5,17-18 tut. Aber in dem Lehrgespräch, das Jesus in Markus 12,28-34 mit dem Schriftgelehrten führt, dem er bescheinigt „nicht fern vom Reich Gottes“ zu sein, zeigt sich doch deutlich, wie klar Jesus am Glaubensbekenntnis Israels (5. Mose 6,4-5) festhält und auf dem Boden der Tora und der Propheten argumentiert.
Wie wenig Jesus daran liegt, eine der jüdischen Tora entgegengesetzte Lehre zu verkünden, bestätigen Sie indirekt, indem Sie sich mehrfach darüber wundern, dass Markus über den konkreten Inhalt seiner Lehrtätigkeit häufig rein gar nichts verlauten lässt. So wäre (S. 79) bei seinem ersten Auftreten in der Synagoge von Kapernaum „Gelegenheit gewesen, ein konkretes Beispiel einer solchen Lehre zu geben. Aber über den Inhalt der Lehre Jesu bei dieser Gelegenheit erfahren wir nichts. Das ist sehr auffällig.“ Weiter (S. 85f.) heißt es, nachdem er in seiner Vaterstadt nur wenige Heilungen vollziehen konnte, im „6. Kapitel …: ‚Und er zog rings in den Dörfern umher und lehrte‘ (6,6). Von dem, was er dabei verkündigt, hören wir wieder nichts.“ Schließlich (S. 86) muß „Jesus einmal fünftausend Männer verköstigen …, weil er sie so lange mit einer Predigt hingehalten hat (6,34-44). Vom Inhalt der Predigt erfahren wir wieder nichts.“
Dies ist allerdings gar nicht so verwunderlich, wenn Jesus seine Lehre gar nicht im Sinne einer Abkehr von der „Tora und ihren Geboten“ begreift, sondern im Sinne ihrer messianischen Auslegung, die genau die Tora zur Erfüllung bringen soll.
Auch (S. 86) die tatsächlich „schöne Paronomasie (69) des Markus elalei autois ton logon“ = Jesus „redete ihnen das Wort“, die in 2,2 und 4,33 vorkommt, ist Ihnen zufolge „spezifisch christlicher Sprachgebrauch“. Doch an vielen Stellen ist die Redewendung logon lalein schon im Alten Testament gang und gäbe, vor allem wo es darum geht, dass Gott zum Volk Israel „das Wort redet“, und worum sollte es sich dort handeln, wenn nicht buchstäblich um das, was Gott lehrt, also die Tora, die Wegweisung Gottes?
Auch die Beispiele, die Sie selbst (S. 94ff.) für die revolutionäre Lehre Jesu anführen, heben die Geltung der Tora und der Propheten nicht grundsätzlich; stattdessen geht es um die wahre Auslegung und Erfüllung der Tora, zum Teil um ihre Radikalisierung, im Ganzen aber um ihre Ausrichtung auf die zentralen Tora-Gebote der Liebe zu Gott und zum Nächsten. So stellen Sie klar (S. 96), dass Jesus auch in den „Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern“ über „vier heikle Bereiche des jüdischen Gesetzes“, nämlich „die Sündenvergebung, die Speisegebote als Teil der Reinheitsgebote, das Fasten und die Sabbatgebote“, keineswegs „die Gültigkeit der entsprechenden Vorschriften … leugnete“, sondern dass er sie nur „im Einzelfall … relativierte“.
Wieder berufe ich mich auf Andreas Bedenbender (70), um entscheidenden Punkte noch deutlicher hervortreten zu lassen:
Wenn Jesus zumindest in einigen Fällen nicht unter, sondern über den Geboten steht, dann liegt das in seiner einzigartigen Autorität als „Menschensohn“ begründet, das Halten der Toragebote wird so nicht grundsätzlich zu einer Sache des freien Beliebens. Nach der Schöpfungsordnung war die Ehe, wie der markinische Jesus es versteht, solange unauflöslich, bis eben Mose (gemeint ist wohl: die Tora, die Gott Mose am Sinai anvertraute) die Erlaubnis zur Ehescheidung einführte. Von da an, und bis zum Kommen Jesu, war die Ehescheidung wirklich gestattet; nun aber sieht Jesus sich in der Lage, die ursprüngliche Bestimmung wieder in Kraft zu setzen. Ebenso hatten Bestimmungen über reine und unreine Speisen von den Tagen des Sinai an Gültigkeit, bis Jesus „alle Speisen für rein erklärte“ (Mk 7,19c) (71). Wir stoßen hier auf die Vorstellung einer messianisch oder eschatologisch modifizierten Tora, wie sie uns auch anderswo in der jüdischen Tradition begegnet. Die grundsätzliche Geltung, die Jesus im Mk-Ev ungeachtet dieser Änderungen der mosaischen Tora zubilligt, zeigt sich an zwei Stellen: Die Speisung der Fünftausend, die in Mk 6,35-44 mit fünf Broten und zwei Fischen erfolgt, dürfte den Gedanken versinnbildlichen, das eschatologisch gesammelte Zwölfstämmevolk werde mit den fünf Büchern der Tora und mit den zwei Bundestafeln „gespeist“ – also nicht etwa mit den Bundestafeln (und dem in diese eingehauenen Dekalog) allein! Dementsprechend gilt in Mk 7,8-10 das, was „Mose gesagt hat“, ganz selbstverständlich als „Gottes Gebot“.
↑ Was ist das revolutionär Neue an der Lehre Jesu?
So bleibt immer noch die Frage, was denn das Neue an der Lehre Jesu ist, der wie andere jüdische Lehrer in der Synagoge lehrt und als solcher angesprochen wird, der aber seine Lehre auch draußen unter freiem Himmel verkündet. Den Vers Markus 1,22, in dem „die Wirkung der Worte Jesu auf die ersten Hörer“ geschildert wird, übersetzen Sie so (S. 79):
„Sie waren fassungslos über seine Lehre, denn er lehrte sie wie ein Souverän und nicht wie die Schriftgelehrten“.
Diese Souveränität erläutern Sie folgendermaßen näher (S. 80):
Die Schriftgelehrten sind in ihrer Lehre gebunden, nicht nur durch den Text der heiligen Schrift, sondern auch durch die Auslegungstradition, in der sie stehen. Deshalb berufen sie sich ständig auf anerkannte Lehrer. Jesus aber redet, als sei er völlig souverän, als brauche er sich um die Tradition der Väter und irgendwelche gelehrten Autoritäten gar nicht zu kümmern, als kenne er das Wort Gottes sozusagen von innen.
Hier ist es aber geboten, sehr gut achtzugeben, dass man aus dem Messias des Gottes Israels, der tatsächlich aus der Souveränität oder Wucht (so wörtlich das hebräische Wort KaBOD, das gewöhnlich mit Ehre oder Herrlichkeit übersetzt wird) Gottes heraus die Wegweisung Gottes auslegt und sogar verändern darf, nicht einen ganz neuen Gott einer neuen Religion macht, der mit dem alten Gott der Juden und seiner überholten Tora angeblich rein gar nichts mehr zu tun hat.
Ich frage mich (S. 93), ob Ihre Interpretation der beiden Jesusworte in Markus 2,21-22 „als Parolen eines Revolutionärs“ nicht schon in diese Richtung weist:
Sie bilden ein Paar, das streng symmetrisch gebaut ist, in der Form eines strophischen Parallelismus, einer poetischen Schöpfung Jesu. Man soll einen alten Mantel nicht flicken mit einem Fetzen Stoff, der noch gar nicht gewalkt ist, sonst wird der Riß nur noch größer. Und jungen Wein soll man nicht in alte Schläuche gießen, denn der gärende Wein wird die Schläuche zerreißen und dann ist beides hin, der Wein und die Schläuche. Also: „Jungen Wein in neue Schläuche!“ (2,22) So reden Revolutionäre. Aber wie lautet das Programm des Revolutionärs? Welchen alten Mantel will er wegwerfen? Was will er denn umstürzen?
Sie sprechen es nicht deutlich aus, aber unausgesprochen deuten Sie an, dass es Jesus wohl doch darum geht, den alten Mantel und die alten Schläuche des Judentums wegzuwerfen, wie man es im Christentum zwei Jahrtausende hindurch behauptet hat.
Da es wirklich wichtig ist, eine solche Sichtweise endlich zu überwinden, erlaube ich mir, ausführlich aus einer Predigt zu zitieren, die ich am 14. Januar 2007 zum Thema Neuer Wein in neue Schläuche gehalten habe:
Was meint Jesus mit diesen Bildern aus dem Alltagsleben? Früher hat die Kirche gedacht, dass mit den alten Schläuchen und dem alten Kleid das Judentum gemeint sei. Die Juden, vor allem die Pharisäer, hätten sich mit frommen Leistungen das Wohlwollen Gottes verdienen wollen. Dagegen hätte Jesus erstmalig verkündet, dass Gott uns seine Gnade und Liebe ohne Bedingungen schenkt. Mit dem Glauben an Jesus wäre also die Religion der Juden überholt. Diese Auffassung spiegelt sich auch in der geläufigen Unterscheidung vom „Alten“ und „Neuen Testament“ wider.
Aber das sogenannte Alte Testament war die Bibel, die Jesus verwendet hat, seine Heilige Schrift. Er hat sie nicht zum alten Eisen geworfen, sondern neu ausgelegt und den alten Sinn neu zum Leuchten gebracht. Er hat in seinem eigenen Leben und Sterben die Verheißungen dieser Schrift so erfüllt, dass sie die Heilige Schrift für alle Völker werden konnte, also auch für uns der Weg zur Freiheit und zur Erfüllung unseres Lebens. Nicht ohne Grund besteht unsere Bibel aus beiden Testamenten. Das Alte Testament ist nicht die Urkunde eines außer Kraft gesetzten veralteten Glaubens. Alt ist es eher im Sinne von altehrwürdig und altbewährt – denn das Wort Testament steht für den Bund, den Gott mit Noah und Abraham, mit Mose und seinem Volk schließt. Diesen Bund gibt Gott nicht auf, denn Gott ist treu. Das Neue am neuen Bund, der im Neuen Testament beurkundet wird, besteht darin, dass Gott durch Christus alle Völker mit hineinnimmt in den Bund mit seinem Volk Israel.
Vielleicht hilft uns ja ein Blick ins Alte Testament auch, die Worte Jesu vom Riss im alten Kleid und von den alten und neuen Schläuchen zu verstehen.
↑ Das Wort vom Riss im Mantel – wie heilt man Zerrissenheit?
Welche Stellen der Bibel werfen denn ein Licht auf das Wort vom Riss im Mantel, der schlimmer wird, wenn man ihn mit einem Flicken von neuem, ungewalkten Tuch flickt?
Im Alten Testament erzählt zum Beispiel das Buch der Richter 21, 15 von einem
Riss … zwischen den Stämmen Israels
und meint damit einen furchtbaren Konflikt, durch den der Stamm Benjamin fast ausgerottet worden wäre. Und als sich im Königreich Israel unter dem Sohn des Königs Salomo die 10 Nordstämme vom König in Jerusalem abspalten, da hatte der Prophet Ahija das angekündigt mit einer krassen Zeichenhandlung (1. Könige 11, 30-31):
30 Und Ahija fasste den neuen Mantel, den er anhatte, und riss ihn in zwölf Stücke
31 und sprach zu Jerobeam: Nimm zehn Stücke zu dir! Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir zehn Stämme geben -,
33 weil er mich verlassen hat und angebetet [fremde Göttinnen und Götter], und nicht in meinen Wegen gewandelt ist und nicht getan hat, was mir wohlgefällt, meine Gebote und Rechte, wie sein Vater David.
Diese Spaltung des Volkes Israel wurde nie geheilt. Das Nordreich gab es schon seit der Eroberung durch die Assyrer nicht mehr, das Südreich Juda konnte nach der Verbannung in Babylon zwar neu aufgebaut werden, es litt aber nacheinander unter der Fremdherrschaft von Persern, Griechen und Römern und blieb auch im Innern von politisch-religiösen Auseinandersetzungen zerrissen. Das Wort vom Riss im Kleid sagt Jesus nach den drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, unmittelbar nachdem er gefragt wird, warum er und seine Jünger eigentlich nicht fasten, wie es die Pharisäer und auch die Jünger von Johannes dem Täufer tun. Pharisäer, Johannesjünger, die Gruppe um Jesus, das waren nur einige von den vielen Richtungen, in die damals das jüdische Volk zersplittert und zerrissen war, und das Fasten war für Pharisäer und Johannesjünger eine von vielen Methoden, um eine Veränderung herbeizuführen. Würde Gott nicht besondere religiöse Anstrengungen belohnen? Würde eine Umkehr zu Gott nicht die Zerrissenheit des Volkes überwinden und dazu führen, dass der Messias das Volk auch von der Fremdherrschaft der Römer befreit?
Jesus ist anderer Meinung. Er sieht, dass die Risse im Volk nur noch größer werden, wenn sich die einzelnen Gruppierungen im Volk über den richtigen Weg zur Einheit nicht einig sind. Aufrufe zum Fasten und zur Gesetzestreue sind zwar gut gemeint, aber sie heilen nicht den Riss im Volk, sondern reißen einen neuen Riss zwischen denen auf, die sich als die fromme Elite fühlen, und denen, die als unverbesserliche Sünder abgestempelt werden.
Nein, sagt Jesus:
21 Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; sonst reißt der neue Lappen vom alten ab, und der Riss wird schlimmer.
Aber wie kann der Riss im Volk geheilt werden?
Zur Begründung, warum seine Jünger nicht fasten, hatte Jesus gesagt (Markus 2):
19 Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten.
Der Bräutigam, das ist er selbst, der Messias Gottes. Wenn Gott selbst den Menschen nahe ist, wenn sie sich durch seine Liebe verwandeln lassen, dann müssen sie nicht mehr, bildlich gesprochen, in geflickten Kleidern herumlaufen, sondern Gott selbst zieht sie ganz neu an. Die Flickschusterei im Volk Gottes hört auf; die Zerrissenheit im Volk und im einzelnen Menschen ist überwunden; es gibt keinen Widerspruch mehr zwischen der Vielfalt von Meinungen und der Einigkeit im Wesentlichen.
Davon hat auch der Apostel Paulus gesprochen. Er hat es im Brief an die Kolosser 3, 12-14, so ausgedrückt:
12 So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;
13 und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!
14 Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Wer die Liebe Gottes „anzieht“, bekommt ein neues Outfit für seine Persönlichkeit. Ein jähzorniger Mensch wird nicht dadurch sanft, geduldig, demütig, dass er die eigene Zerrissenheit mit ein paar Flicken zudeckt. Seine Charakterschwäche kann er nur überwinden, indem er Liebe an sich heranlässt und die Ursachen für seinen übersteigerten Zorn überwindet. Wenn ich ängstlich, verzagt und depressiv bin, nützen mir auch keine Sprüche wie „Kopf hoch!“ oder „Wird schon wieder!“ Wenn ich mich der Welt mit Zuversicht stellen will, brauche ich die Gewissheit, dass ich nicht allein dastehe auf dieser Welt, dass mich jemand in den Mantel seiner Liebe einhüllt. Jesus sagt uns: „Gebt euch nicht damit zufrieden, an euren Macken herumzuflicken. Habt Vertrauen auf Gott, er zieht euch neu an, er hüllt euch in seine Liebe ein, wagt es nur, im Gottvertrauen zu leben!“
So viel zum Riss im Kleid. Er hat weniger damit zu tun, dass alte Anschauungen durch neue überholt werden und dass im Zuge dessen vielleicht die einen Menschen besser dastehen als die anderen, sondern damit, dass diese ganze Zerrissenheit zwischen den Menschen geheilt wird. Und die Voraussetzung dafür ist die Heilung unserer inneren Zerrissenheit.
Bei dieser Auslegung ließ ich mich von Andreas Bedenbender (72) leiten, der den Riss im alten Mantel gemäß 1. Könige 11,29-31 mit dem zerrissenen Großreich Israel in Verbindung bringt:
„Nach dem desaströsen Ende des Jüdischen Krieges werden auf jüdischer Seite nicht wenige auch beklagt haben, daß ihre Hoffnung auf ein mächtiges Großreich getrogen hatte. Diesbezüglich bringt Jesus nun in einem Bildwort zum Ausdruck: Er, der messianische „Bräutigam“, denkt nicht daran, das Davidsreich zurückzubringen. Was immer er wiederherstellen, was immer er reparieren wird, es wird nicht das nach dem Tode Salomos auseinandergebrochene Davidsreich sein. Ist Jesus der Flicken, dann ist der Mantel, der auf jeden Fall ungeflickt bleiben sollte, das Davidsreich.“
↑ Neuer Wein in neue Schläuche – was ist wirklich damit gemeint?
Beim Thema der alten und neuen Weinschläuche weiß ich nicht mehr, woher ich meine Anregungen zur Auslegung damals genommen habe oder ob ich auf die biblischen Parallelstellen auf eigene Faust gekommen bin. Nochmals zitiere ich aus meiner Predigt vom 14. Januar 2007:
Die Schläuche sind ja aus einer ganzen Ziegenhaut gemacht, keine Stelle darf undicht sein, der Schlauch darf nicht zerreißen. Die Frage ist nun: Wie bleibt der Schlauch ganz, wie verhindert man, dass er zerrissen wird?
Ich fand dazu eine Stelle im Buch Hiob 32. Da vergleicht ein Mann mit Namen Elihu seine eigenen Überzeugungen mit neuem Wein in neuen Schläuchen:
19 Siehe, mein Inneres ist wie der Most, den man nicht herauslässt und der die neuen Schläuche zerreißt.
Elihu ist ein junger Schriftgelehrter, der dem leidenden Hiob entgegentritt. Hiob hält am altvertrauten Glauben an den treuen Gott Israels fest; darum klagt er im Leid Gott an und fordert von ihm Gerechtigkeit. Drei alte Theologen haben dem Hiob gesagt: „Das kannst du nicht machen, natürlich ist Gott gerecht, du selber wirst für irgendetwas deine Strafe verdient haben.“ Als Hiob darauf besteht: „Ich habe nichts Unrechtes getan, es ist Gott, der mich zu Unrecht leiden lässt“, da gärt es in Elihu, ihn packt der Zorn auf Hiob und auf die alten Männer (Hiob 32, 3),
weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten.
Elihu meint, weiser zu sein als die Älteren, er verteidigt mit überschäumender Begeisterung einen Gott, der alles kann und alles darf, einfach weil er der Allmächtige ist. In diesem Zusammenhang vergleicht er sich selber mit Most, der nicht nur alte, sondern sogar neue Schläuche zerreißt!
Ob Jesus diesen Satz im Blick hat, als er vom neuen Wein und den neuen Schläuchen spricht? Wir wissen ja von Jesus, dass ihn das Leid der Menschen jammert, die wie Hiob sind, oder wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein unbarmherzig fordernder Umgang mit dem Gesetz Gottes, ein fanatischer Glaube an Gott macht ihr Leid nur größer.
Nebenbei erwähne ich, dass der Evangelist Lukas 5 an das Gleichnis vom neuen Wein in alten Schläuchen noch den Satz anfügt:
39 Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen; denn er spricht: Der alte ist milder.
Es gibt Ausleger der Bibel, die denken, dass Jesus das kritisch meint: gegen diejenigen, die zu bequem sind, um Neues zu wagen, und das altvertraute Schlechte dem besseren Neuen vorziehen. Aber vielleicht will Jesus ja auch davor warnen, Alt und Neu gegeneinander auszuspielen. Was alt oder neu ist, ist nicht immer automatisch auch „besser“ oder „schlechter“, muss nicht als Fortschritt oder als Rückschritt eingeschätzt werden. Jesus ist daran interessiert, das gute Alte zu bewahren. Das alte Gesetz Gottes soll auch später in seiner Eigenart und Absicht verstanden und befolgt werden. Wer das in einer neuen Zeit tut, der muss manches neu sagen. Aber ein fanatischer Übereifer der Erneuerung schadet genauso wie ein engstirniges Festhalten am alten Buchstaben des Gesetzes und zerstört letzten Endes das Alte, das man bewahren will.
↑ Wer ist verantwortlich für den Tod des Messias?
Ausführlich möchte ich weiterhin auf Ihre Ausführungen zu der Frage eingehen (S. 99), wer nach dem Markusevangelium letzten Endes für Jesu Tod verantwortlich ist:
Damit ist die Grundkonstellation für die folgenden Geschehnisse gegeben: Jesus, die Zwölf, die Volksmengen oder einzelne, die sein Wort und seine Wunder suchen, auf der einen Seite und seine Gegner, vor allem die Schriftgelehrten, auf der anderen Seite. Erst in Jerusalem treten mit den Sadduzäern die Adelskreise auf den Plan, die dann das schmutzige Geschäft übernehmen, das die Pharisäer zusammen mit den Herodianern schon längst ins Auge gefaßt hatten. Sie mußten noch den römischen Statthalter hineinziehen, da nur er ein Todesurteil vollstrecken durfte. Eine solche Koalition von Gegnern, die untereinander alles andere als ein Herz und eine Seele waren, nur um einen Handwerkersohn aus dem Weg zu räumen, was dann nicht einmal gelingt: diesen Plot hätte sich kein antiker Autor ausdenken können. Jedenfalls zeigt sich hier etwas von der Außerordentlichkeit dieses Handwerkersohns, vom Geheimnis seiner Person.
In Ihren Augen schließt sich also im Markusevangelium eine Koalition von Juden zusammen, „um einen Handwerkersohn aus dem Weg zu räumen“, der darin außerordentlich ist, dass er der Sohn Gottes ist. Den römischen Statthalter erwähnen Sie dabei nur am Rande und sogar ohne Namensnennung, ist er doch lediglich ausführendes Werkzeug der Jesus gegenüber feindselig eingestellten Juden. Hier wird deutlich, wie auch Jahrzehnte nach Auschwitz immer noch eine antijudaistische Lektüre des Markusevangeliums gepflegt werden kann, wenn man den zeitgeschichtlichen Kontext dieses Evangelium völlig außer Acht lässt.
Liest man dagegen wie Andreas Bedenbender das Markusevangelium als „Frohe Botschaft am Abgrund“ des Jüdischen Krieges, dann kann man nicht übersehen, dass Jesus seine prophetische Kritik am eigenen Volk und ihren verschiedenen Gruppen und Führern eben als Messias Israels übt, also als Jude und nicht als Judenfeind (73). Zwar greift er in scharfer Form einerseits Tempelaristokratie und Schriftgelehrte als Ausbeuter und Kollaborateure Roms an, zwar verurteilt er ebenso scharf den Weg der Zeloten in den aussichtslosen gewaltsamen Aufstand gegen Rom. Aber seine Hauptkritik gilt der Römischen Weltordnung mit ihrer Geldwirtschaft, ihrem Militär und ihrem Anspruch, die Völker niederzuhalten, was besonders in Jesu Worten über Macht und Herrschaft, Armut und Reichtum deutlich wird. Als Messias Israels geht Jesus den Leidensweg seines Volkes im Jüdischen Krieg von Galiläa nach Jerusalem sozusagen Schritt für Schritt mit, und am Ende wird er Seite an Seite mit zwei als „Räuber“ bezeichneten zelotischen Terroristen gekreuzigt, solidarisch sogar mit denen, deren Haltung er zutiefst ablehnt, weil sie in ihrem Eifer für die Tora nicht auf Gott und seinen Messias, sondern auf ihre eigene Macht bauen wollen.
↑ Lüftete ein römischer Centurio als erster das Geheimnis der Gottessohnschaft Jesu?
Was ist nun von der Äußerung des römischen Hauptmanns nach dem Tod Jesu in Markus 15,39 zu halten, die Sie aus seiner heidnischen Sicht folgendermaßen zitieren (S. 99):
„Wahrhaftig, dieser Mann war ein Sohn eines Gottes!“
Kommt damit (S. 100) „ausgerechnet ein römischer Centurio“ unter dem Kreuz Jesu „von sich aus auf des Rätsels Lösung“, worin das Geheimnis der Person Jesu besteht? In Ihren Augen ist es „der laute Schrei, mit dem Jesus stirbt“, der „den harten Realisten darauf brachte“:
Da ein Gekreuzigter an völliger Entkräftung stirbt, muß ein lauter Schrei, der Kraft verlangt, als Wunder gedeutet werden. Und Wunder können aus der Sicht des Heiden nur Götter tun.
Diese Deutung überzeugt mich aber nicht. Selbst wenn es ungewöhnlich war, dass ein Gekreuzigter noch laut schreien konnte, hätte ein realistischer Römer doch kaum im Todesschrei eines soeben jämmerlich Verreckten ernsthaft die Wunderkraft eines mächtigen Gottes erkennen können. Viel eher ist anzunehmen, dass seine Bemerkung zynisch gemeint ist: „Der soll also wirklich ein Gottessohn gewesen sein?!“
Hätte Markus tatsächlich Jesu göttliche Wunderkraft sogar noch in seinem Tod herausstellen wollen, so fragt Andreas Bedenbender (74), warum hat sich dann nicht (S. 210) nun zum dritten Mal „die ‚Himmelsstimme‘ Gottes zu Jesus“ bekannt, wie sie es in 1,11 und 9,7 getan hatte? „Nun, als Jesus am Kreuz hängt, wäre es Zeit für die Himmelsstimme, sich vor aller Welt auf seine Seite zu schlagen; und genau jetzt schweigt sie sich aus.“ Hier ruft nur Jesus zwei Mal (15,34.37). „Doch sein Rufen verhallt in der Leere.“
Es würde zu weit führen, alle Argumente aufzuführen, die nach Bedenbender dagegen sprechen, diesen – wie er es formuliert (S. 191) – „Nekrolog des Zenturio“ (75) als ein erstes „christliches Bekenntnis“ zu Jesus als dem Sohn Gottes zu deuten. Erwähnt seien nur noch die Details, dass der Römer dem Text zufolge gar nicht unter dem Kreuz steht, sondern ihm gegenüber, und dass Markus in seinem Evangelium auch sonst (S. 194) „die christologisch präzisesten Bekenntnisse“ zu Jesus ausgerechnet „den Dämonen in den Mund legt“. Bedenbender sieht darin eine „scharfe Abrechnung mit einem christlichen Glauben…, der im Jüdischen Krieg mit den Römern sympathisierte und in der Zerstörung Jerusalems, in dem zehntausendfachen Mord ein göttliches Strafgericht erkannte“, und kommt schließlich zu dem Fazit (S. 202):
Zusammengefaßt: Die „Bekenntnisse“ der Dämonen und ebenso das „Bekenntnis“ des Zenturio sollen die Leserschaft des Mk-Ev nicht in ihrer Glaubensgewißheit bestärken, indem sie vorführen, daß selbst die größten Feinde des Evangeliums am Ende die Überlegenheit Jesu – und sei es auch nur zähneknirschend – anerkennen. Vielmehr werden die Leser des Mk-Ev hier mit der prinzipiell verstörenden Tatsache konfrontiert, daß – anders, als Paulus dies in 1 Kor 12,3 voraussetzte – christologische Bekenntnisse, wie richtig sie auch der Sache nach sein mögen, nichts darüber besagen, ob die jeweiligen Sprecher nun auf der Seite Jesu stehen oder nicht.
↑ Ist der Schluss des Markusevangeliums nur ein literarischer Paukenschlag oder das Anzeichen einer traumatischen Verstörung?
Den Schluss des Markusevangeliums interpretieren Sie (S. 104) rein literarisch als einen höchst außergewöhnlichen „Paukenschlag“:
Markus läßt seine Geschichte nicht mit dem Tod Jesu enden. Es folgt noch eine merkwürdige, fast absurde Szene: Beim Sonnenaufgang am übernächsten Tag verlassen drei entsetzte Frauen fluchtartig ein leeres Grab und erzählen niemand, was sie darin erlebt haben, „voll Furcht, wie sie waren“ (16,8). Von wem hat Markus dann das eben Erzählte mit seiner tiefen Symbolik? Und welcher antike Autor wollte eine Biographie mit einer reinen Frauengeschichte schließen? Ich weiß eigentlich keine Geschichte der Weltliteratur, die mit einem vergleichbaren Paukenschlag endet.
Sie übergehen damit völlig die inhaltliche Verstörung, mit der das Evangelium endet, und kommen zu dem Urteil:
Selbst bei großen Romanen und Erzählungen ist der Schluß nicht selten schwach und enttäuschend. Ein guter Schluß ist noch schwerer zu machen als ein guter Anfang. Das Markusevangelium jedoch endet so großartig und überraschend wie es begonnen hat. Die Revolution, die in den Anfängen erstickt werden sollte, kommt am Ende durch ein unvorhersehbares Ereignis zum Ziel: die Auferstehung des Revolutionärs.
Damit lässt Ihre Einschätzung dieses Werkes jede Wahrnehmung des spannungsreichen Kontextes vermissen, den Andreas Bedenbender so überzeugend herausgearbeitetet hat, denn angesichts der Leichenberge in und um Jerusalem im Jahr 70 ist dem Autor und den Lesern des Markusevangeliums ja die fraglose Gewissheit abhanden gekommen, was in solchen Tagen noch die Auferstehung eines einzelnen von den Toten bedeuten kann. Und Ihre Beschreibung der Leistung des Markus wirkt geradezu deplaziert:
Der Evangelist bietet aufs Ganze gesehen eine sorgfältig strukturierte, zielstrebige Erzählung, in die sich die kurzen Reden gut einfügen. Als bios Iesou tou legoumenou Christou „Lebensbild Jesu des sogenannten Christus“ (vgl. Mt 1,10) ist sie ein Meisterwerk.
Ja, sie ist ein Meisterwerk! Aber Sie haben in meinen Augen ihre wahre Aussageabsicht nicht im Mindesten erfasst.
Ihr letzter Satz zum Evangelisten Markus macht noch einmal deutlich, dass Sie in ihm in erster Linie den authentischen Erzähler einer historisch wahren Geschichte erblicken (S. 105):
So schreibt nicht jemand, der in erster Linie eine theologische Konzeption entwerfen oder nur ein Glaubenszeugnis geben will. So erzählt man wirklich erlebte Geschichten.
Aber keine der drei Alternativen, die Sie hier nebeneinanderstellen, trifft das Anliegen des Markusevangeliums:
- Hier erzählt nicht einfach nur einer nach, was er von Petrus gehört hat.
- Hier legt nicht einfach nur einer ein Zeugnis für seine persönlichen Glaubenserfahrungen ab.
- Hier entwirft auch nicht ein Theologe eine christliche Dogmatik.
Nein – hier versucht ein Jude, dessen Vertrauen auf den Messias Jesus angesichts des Jüdischen Krieges in eine tiefe Krise geraten ist, gegen allen Augenschein an diesem Vertrauen festzuhalten, ohne das Bekenntnis zu Jesus Christus gegen das von Rom massakrierte Israel auszuspielen.
↑ Matthäus
↑ Der Evangelist Matthäus – Zöllner oder beispielhafter Schüler?
Auch bei der Frage nach dem Autor des Matthäusevangeliums folgen Sie (S. 107) seiner traditionellen Identifizierung mit dem Apostel Matthäus. Merkwürdig wäre dann aber, dass er sich inhaltlich so stark auf das Evangelium nach Markus stützt, wenn er doch selber als Augenzeuge ganz von Markus unabhängig hätte berichten können. Vollkommen einig bin ich mit Ihnen jedenfalls in Ihrer folgenden Einschätzung des Matthäus, dessen Evangelium den Anfang des Neuen Testaments bildet:
Er muß jedenfalls ein pharisäisch gebildeter Mann, vielleicht selbst ein Schriftgelehrter gewesen sein. Das zeigt schon der Eingang seines Evangeliums, der eindeutig eine Frucht großer Gelehrsamkeit ist. Mit diesem Evangelium hat die Kirche sozusagen das jüdischste der vier Evangelien zum bevorzugten gemacht.
Nur am Rande erwähnen Sie, dass der Evangelist Matthäus den Namen des bei Markus von Jesus berufenen Zöllners Levi (Markus 2,14) durch den Namen „Matthäus“ ersetzt (Matthäus 9,9) und dass dieser Zöllner Matthäus dann auch zum Apostel Jesu berufen wird (Matthäus 10,3). Sie schreiben dazu sehr knapp: „Eine Identität beider ist ausgeschlossen.“ Levi und Matthäus hätten somit nichts miteinander zu tun; warum Markus den einen Namen und Matthäus den anderen nennt, bliebe unerklärt. An späterer Stelle (S. 133) beschäftigt Sie diese Frage nochmals, da Ihnen historische Genauigkeit ja besonders am Herzen liegt:
Hier stehen wir vor einem historischen Problem, für das noch keine befriedigende Lösung gefunden ist und nach Lage der Dinge auch nicht gefunden werden kann.
Hochinteressant sind dazu erneut Erwägungen von Andreas Bedenbender (76), demzufolge „Levi, der (Sohn) des Alphaios“ in Markus 2,14 „zu den ‚sprechenden‘ Personennamen des Mk-Ev gehört“:
Von seinem Namen her läßt Alphaios an das hebräische ˀALaPh (und das aramäische ˀÄLaPh) denken, welches im Grundstand „lernen“, im Piel (respektive im Pael) „lehren“ bedeutet. Zuständig für die Lehre in Israel waren aber vor allem die Leviten. Somit trägt die Angabe „Sohn des Alphaios“ zur subtilen Ironie der Darstellung bei: Jesus hat eben noch die Menge gelehrt und muß nun einen an sich zum Lehren prädestinierten Levi, der nur leider völlig von seinem Weg abgekommen ist, zur Sache rufen.
Auf überraschende Weise wird diese Deutung durch die Parallelstelle bei Matthäus bestätigt. In Mt 9,9 wird der von Jesus berufene Zöllner nicht als „Levi, Sohn des Alphaios“ vorgestellt, sondern als „Mensch, der Matthaios genannt wurde“ [im Akkusativ: anthrōpon…, Matthaion legomenon). Der Name Matthaios läßt an mathētēs, den „Schüler“ („Jünger“) denken, mathētēs aber kann in der LXX zur Übersetzung von ˀALLUPh, verstanden als „belehrt“, genommen werden (Jer 13,21, Codex Alexandrinus). Dementsprechend gibt die LXX in Spr 22,25 das hebräische ˀALaPh mit dem zu mathētēs gehörigen Verbum manthanein wieder. Wie es aussieht, hat Matthäus (nicht der Zöllner, sondern der Evangelist) den im Mk-Ev mit dem Namen Alphaios verknüpften Nebengedanken ansprechend gefunden, fürchtete aber, der hebräisch oder aramäisch codierte Einfall möchte an ein griechischsprachiges Publikum verschwendet sein. Darum übertrug er die Anspielung in die griechische Sprache und wertete sie zugleich auf. Bei ihm geht es nicht um das Lehramt der Leviten, sondern um die Möglichkeit eines jeden Menschen, zum „Lehrling“, zum Jünger Jesu zu werden. So schließt sein Text ja auch mit der Aufforderung Jesu, alle Völker zu solchen „Lehrlingen“ zu machen (mathēteusate panta ta ethnē; 28,19). Was Matthäus von Zöllnern dachte, ist in 18,17 zu erkennen: Wer nicht auf die Gemeinde hört, soll „wie ein Heide und Zöllner“ angesehen, also gemieden werden. Zugleich aber gilt für ihn, daß noch im letzten römischen Zöllner ein potentieller Jünger zu sehen ist – im Matthaios ein mathētēs (77).
Das könnte bedeuten, dass der anonyme Autor des Matthäusevangeliums seinem Werk vielleicht bewusst einen Autorennamen vorangestellt hat, der ihn als einen exemplarisch durch Jesus belehrten Schüler ausweist, wie er ja auch sein Evangelium gemäß 28,19 als Grundlage der Belehrung der Völker versteht und weit mehr als Markus die Lehre des Messias Jesus in den Vordergrund seiner Ausführungen rückt.
↑ Zur Überschrift und zum Stammbaum Jesu nach Matthäus
Mit Recht merken Sie an (S. 108), dass Matthäus mit der Überschrift seines Evangeliums in 1,1: „Buch der Herkunft Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“ von vornherein klarstellen will:
In dem, was ich jetzt erzählen will, setzt sich die Geschichte fort, die in den heiligen Schriften erzählt wird.
Sie irren allerdings gewaltig, wenn Sie schreiben:
Eine genaue Vorlage oder Parallele im Alten Testament gibt es zu dieser Überschrift freilich nicht; in der Septuaginta finden wir lediglich den Ausdruck biblos geneseōs „Buch der Herkunft“ (Gen 2,4; 5,1).
Aber damit nennen Sie doch die genaue Stelle der Tora, an die Matthäus mit seinem Evangelium anknüpft! Ton Veerkamp (78) hat das in Anlehnung an Einsichten des niederländischen Theologen Frans Breukelman (79) so auf den Punkt gebracht:
Matthäus entnimmt seinen Titel dem Buch Genesis, das in 5,1 so beginnt: „Dies ist das Buch der Zeugungen der Menschheit“. Matthäus will einen völlig neuen Abschnitt der Großen Erzählung schreiben: „Das Buch der Zeugung des Jesus Christus (Jeschua Mschiach), des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“. Jeschua ist also der Sohn Abrahams und Davids, also der, der das Lebensprogramm Abrahams und Davids fortsetzt. … Die letzte Zeugung unterscheidet sich von allen vorausgegangenen; einundvierzig Mal zeugte der Mann seinen Sohn, aktiv, egenésen, die letzte Zeugung steht im Passiv: „Joseph, der Mann Marias, aus der gezeugt wurde (egenéthé) Jeschua, der Messias genannt wird“ (1,16). Die letzte Zeugung war ein passiver Vorgang und muss erklärt werden. Also heißt es: „Die Zeugung des Jeschua Mschiach war wie folgt“.
Damit knüpft Matthäus auch an diejenige biblische Tradition an, die schon in der Zeugung Isaaks als des dem Abraham verheißenen Sohnes einen passiven Vorgang erblickt hatte: In Genesis 21,1-2 wird nämlich nichts von einer Zeugung durch Abraham erwähnt, sondern, dass Sara nach einer Heimsuchung durch JHWH dem Abraham den verheißenen Sohn gebärt. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Genesis zehn Zeugungen (hebräisch ThOLɘDOTh) erwähnt:
- 2,4 von Himmel und Erde;
- 5,1 von Adam;
- 6,9 von Noah;
- 10,1 von den Söhnen Noahs,
- 11,10 insbesondere Sems;
- 11,27 von Terach;
- 25,12f. von Ismael;
- 25,19 von Isaak;
- 36,1.9 von Esau;
- 37,2 von Jakob
– aber ausgerechnet die Zeugung Abrahams gibt es nicht; er wird als Vater Isaaks zu den Zeugungen seines Sohnes Isaak in 25,19 gerechnet! Dem entspricht von der männlichen Seite her, dass die Zeugung Jesu ebenso auf dem Gottvertrauen Josefs, des Mannes Marias, beruht (Matthäus 1,24f.) wie damals die Zeugung Isaaks auf dem Gottvertrauen Abrahams (Genesis 15,6).
So ist auch Ihre Frage zu beantworten (108): „was kann der Stammbaum des Ziehvaters über die Herkunft Jesu sagen?“ Eine ganze Menge, wenn Matthäus dadurch die ebenso passive Rolle des Abraham bei der Zeugung des erstgeborenen Sohnes Isaak-Israel aufrufen will und Jesus auf diese Weise mit dem Volk Israel außerordentlich eng verbindet. Sowohl (S. 110) „der Knick am Ende des Stammbaums“, der „in eine rein weibliche Linie“ führt und „den Zeuger offen läßt“, als auch die folgende „Kindheitsgeschichte, deren Held Josef ist“, zeichnen die Herkunft des Messias also zusätzlich in die Herkunftsgeschichte des Volkes Israel ein und machen deutlich, wie sehr für Matthäus der Messias Jesus sein Volk Israel repräsentiert.
Mit Recht stellen Sie ja auch fest (S. 108):
Diese Genealogie macht gleichsam die ganze Geschichte Israels zur Vorgeschichte Jesu.
Dabei kommt es (S. 109) wie überhaupt
bei den Genealogien in der Antike nicht so sehr darauf an, daß sie stimmen, sondern daß man eine hat. Da ist jede Pedanterie fehl am Platz. Mit einer langen Genealogie eines adligen Geschlechts wird ein gesellschaftlicher Anspruch erhoben. Die Genealogie ist dann richtig, wenn dieser Anspruch von der Gesellschaft akzeptiert wird.
Allerdings gibt es konkret beim Stammbaum Jesu folgende erheblichen Unterschiede zu heidnischen Stammbäumen:
Ein Handwerkersohn hat normalerweise gar keinen Stammbaum. Dieser Handwerkersohn aber wird mit einer lückenlos scheinenden Genealogie mit über vierzig Gliedern vorgestellt, die bis auf Abraham zurückgeht.
Und wie in griechischen und römischen Stammbäumen „Frauen … nur erwähnt [werden], wenn ein Mann Kinder von verschiedenen Ehefrauen hat oder die Frau aus einem berühmten Geschlecht stammt“, so ist es auch für einen jüdischen Stammbaum ungewöhnlich (S. 108), dass
Matthäus 42 Männernamen als Vorfahren Jesu und … dazu fünf ungewöhnliche Mütter [erwähnt]. Die vier ersten verbindet eine Eigenart: Sie sind heidnischer Herkunft. Die letzte ist die Mutter Jesu.
Dankbar bin ich Ihnen für den Hinweis, dass Matthäus mit der heidnischen Herkunft der vier Ahnfrauen Jesu wohl bereits am Anfang darauf hindeuten mag, dass durch die Schüler des Messias Jesus die Lehre vom Gott Israels am Ende in die Völkerwelt hinausgetragen werden soll.
Allerdings stellt Matthäus die uneheliche Mutter Maria sicher auch ganz bewusst in eine Reihe mit Rahab, Tamar, Ruth und Bathseba, die einerseits aus der Sicht der Patriarchen Israels in einem moralisch eher zweifelhaften Licht erscheinen und andererseits die Doppelmoral gerade eines ehrenwerten Stammvaters wie Juda zu Tage treten lassen, der seine von ihm geschwängerte Schwiegertochter Tamar wegen ihrer Unzucht nur deswegen nicht steinigen lässt, weil sie gewitzt genug ist, ihn auszutricksen.
Insofern ist es nur die eine Seite der Medaille (S. 112), wenn Josef als „eigentlicher Held“ der „Kindheitsgeschichte des Matthäus“ als „gerecht (1,19)“ dargestellt wird, weil er, als „seine Frau ohne sein Zutun schwanger wird, … sie nicht bloßstellen, sondern heimlich entlassen“ will. Richtig sind zwar Ihre Ausführungen über die Unterschiede des heidnischen und jüdischen Gerechtigkeitsempfindens (S. 112f.):
Ein Grieche oder Römer würde vielleicht fragen: Was hat der Verzicht auf die rechtlichen Mittel mit Gerechtigkeit zu tun? Und ein Jude würde ihm dann vielleicht erklären, daß sie unter Gerechtigkeit mehr verstehen als nur so handeln, wie es dem Gesetz und der gesellschaftlichen Konvention entspricht. Zur Gerechtigkeit gehört aus jüdischer Sicht nicht nur Rechtschaffenheit, sondern ein Handeln, das Gottes Beifall findet. Da darf Barmherzigkeit nicht fehlen.
Ob diese (S. 113) „Gerechtigkeit im biblischen Sinn“ allerdings mit dem gleichzusetzen ist, was Sie als katholischer Theologe „heute Heiligkeit nennen“? Wie dem auch sei: Nach Matthäus muss jedenfalls zur Gerechtigkeit des Josef noch ein Vertrauen auf die ihm durch einen geschickten Engel Gottes vermittelte Botschaft hinzukommen, damit er seine Verlobte Maria eben nicht im Stich lässt, sondern Verantwortung für sie und ihr Kind übernimmt.
Das heißt aber auch: Der Stammbaum, den Matthäus von Jesus entwirft, zeigt ein zwiespältiges Bild – nicht einfach die fleckenlose großartige Ahnenreihe eines Großkönigs David! Er mag deutlich machen wollen: Indem Gott Jesus als seinen Messias erwählt, kann er sehr deutlich auf krummen Linien gerade schreiben! Mir kommt dazu das Wort aus Hiob 14,4 in den Sinn:
„Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen?“
Eigentlich hätte aus einer solchen Abstammung sowieso nicht der eine reine Gottessohn (= „einer wie Gott“) hervorgehen können, der dem Ebenbild Gottes wahrhaft entspricht, und dennoch ist Jesus auf wunderbare Weise der, den Gott verheißen hat (80).
↑ Kurze Zwischenbemerkungen zur Jungfrauengeburt…
Auf eines (S. 117) der „Erfüllungszitate“, mit denen Matthäus darauf einzugehen pflegt, „daß es sich bei einem bestimmten Sachverhalt um die Erfüllung eines Prophetenworts handelt“, gehen Sie mit folgenden Worten ein:
Das erste ist das Prophetenwort Jes[aja] 7,14: „Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Emmanuel nennen, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns“ ([Matthäus] 1,23). Man hat in der Moderne zwar unermüdlich behauptet, im hebräischen Text sei nicht von einer Jungfrau die Rede, sondern lediglich von einer jungen Frau. Aber das wußten die Kirchenväter besser… Der angebliche Bedeutungsunterschied zwischen dem hebräischen almah und dem griechischen parthenos (junge Frau / Jungfrau) ist eine Fiktion. Mit dem hebräischen wie mit dem griechischen Wort ist ein unverheiratetes Mädchen gemeint, von dem im gesamten Altertum Jungfräulichkeit verlangt und vorausgesetzt wurde. Man braucht sich nur einmal die Bezeichnungen für Rebekka in Gen 24 im hebräischen Text einerseits und im griechischen der Septuaginta andererseits anzuschauen, und die Sache ist evident. Wenn man das Wort des Propheten als Hoffnung auf eine große Erlösergestalt versteht, hat es sich in Betlehem tatsächlich erfüllt. Dann stimmt auch das Prophenwort von der Jungfrau, die empfängt und gebiert.
So überzeugend das auf den ersten Blick klingt – es liegt doch ein entscheidender Denkfehler vor. Natürlich wird von der almah Jungfräulichkeit erwartet, aber keine almah wird in der Regel als Jungfrau ohne Zutun eines Mannes schwanger. Und so ist auch bei Jesaja nicht davon die Rede, dass die von ihm vorausgeschaute Mutter Immanuels diesen jungfräulich – als unberührte bethulah – gebären wird. Genau das ist aber nach Matthäus das Außergewöhnliche bei der Empfängnis Jesu durch Maria. Wie schon gesagt, mag allerdings Matthäus das, was er über Isaak wusste, der dem Abraham durch Sara auf dem Wege einer passiven Zeugung geboren wurde, mit der Vision des Jesaja verbunden und durch sie bestätigt gesehen haben (81).
↑ … und zur Anbetung des Jesuskindes
Im Zusammenhang mit {118} dem Besuch der „Magier aus dem Osten“ im „Haus des ‚Königs der Juden‘ [in] Betlehem“ legen Sie Wert darauf, dass sie Jesus tatsächlich als Gott anbeten (S. 118f.):
Sie fallen anbetend vor ihm auf die Knie (prosekynēsan autō) und bringen ihm symbolträchtige Geschenke. Das anbetende Knien beweist, daß sie wissen, wen sie vor sich haben. Es ist wichtig, daß man hier mit der Vulgata und Luther vom anbetenden Knien oder Niederfallen spricht und nicht mit der Einheitsübersetzung vom bloßen Huldigen. Proskynese wird nur vor Göttern oder Götterbildern geübt, und das vor allem östlich des Mittelmeers. Nur in Persien gehörte sie zum Hofzeremoniell.
Das stimmt auf jeden Fall für die Bibel eindeutig nicht – auch vor höhergestellten Menschen und Königen fällt man nieder. Insbesondere ist das in Psalm 72,10-11 der Fall – Könige bringen dem König bzw. Königssohn Israels ihren Tribut (dōra) und fallen vor ihm nieder. Zunächst einmal dürfte Matthäus also genau die Erfüllung dieses Psalmworts im Hinterkopf haben, wenn Magier aus dem Osten Jesus dōra bringen und ihn durch ihren Kniefall als Messiaskönig Israels anerkennen. Man sollte also nicht allzu schnell eine Anbetung als Gott im Sinne der späteren christlichen Dogmatik damit verbinden.
Allerdings habe ich mich von Larry W. Hurtado (82) überzeugen lassen, dass die Entwicklung einer hohen Christologie im Sinne einer Anbetung Jesu gemeinsam mit dem Gott Israels bereits sehr früh begann und bei Matthäus schon weit vorangeschritten war, was sich unter anderem auch darin zeigt, wie Sie später schreiben (S. 125), dass „bei Matthäus immer wieder Menschen vor Jesus in Proskynese auf die Knie“ fallen und „ihm damit göttliche Ehre erweisen“.
↑ Zur Bearbeitung des Markusevangeliums durch Matthäus
In welcher Weise (S. 123f.) bearbeitet Matthäus nun Ihnen zufolge das von ihm weitgehend übernommene Material des Markusevangeliums?
Er übernimmt so gut wie alles, kürzt aber, wo es irgendwie geht. Er will offenbar Platz gewinnen für sein ergänzendes Überlieferungsmaterial, ohne sein Buch übermäßig aufzublähen. Das Sprachniveau seines Modells hebt er ganz behutsam an und macht den Stil durch einfache Mittel wie ein eingeschobenes „und siehe“ ein wenig biblischer. Dabei verliert die Sprache allerdings auch etwas von der Frische, die sie bei Markus hat. Die Art, wie er sein neues Material in den von Markus vorgegebenen Rahmen einbaut, muß man insgesamt genial nennen.
Gewiss ist Matthäus als Autor nicht weniger genial als Markus. Allerdings hege ich Zweifel, ob Matthäus seine markinische Vorlage einfach nur kürzt, um Platz zu gewinnen oder um dessen stilistisches Niveau zu heben. Mir erscheint die Einschätzung Andreas Bedenbenders (83) einleuchtender, dass Matthäus ein bis zwei Jahrzehnte nach dem Jüdischen Krieg die verstörte Redeweise des Markus, die aus seiner traumatisierenden Nähe zu den damaligen Ereignissen herrührt, nicht mehr nachvollziehen kann. So entfernt Matthäus etwa (S. 314) alle „Hinweise auf die Schwäche Jesu“, die ihm anstößig erscheinen, und entwickelt anders als Markus Strategien für die Zukunft (S. 317):
Matthäus durchschlägt den von Markus geschnürten gordischen Knoten. Das Evangelium kann nun wieder verkündet und verstanden werden, das Sprachtabu rings um die Katastrophe von 70 ist verschwunden, die Zerstörung Jerusalems wird als Strafgericht Gottes eingeordnet. Nicht länger auf eine Aporie [Ausweglosigkeit] fixiert, weitet das Mt-Ev den Blick und wendet sich Gebieten zu, die für Markus jenseits des selbstgewählten Horizontes gelegen hatten: Wie steht es um die Gültigkeit der Tora in allen ihren Verzweigungen? Wie soll das Zusammenleben in der Gemeinde Jesu gestaltet werden, und an welchen Maßstäben können sich die einzelnen Menschen in ihrer Existenz coram Deo [= vor Gott] orientieren?
Dennoch ist der Text des Matthäus literarisch weniger komplex als der des Markus. Matthäus hat nicht nur an mehreren Stellen christologisch Anstößiges beseitigt, er hat auch perikopenübergreifende Zusammenhänge getilgt; mitunter durch Streichung ganzer Abschnitte.
↑ Warum lehrt Jesus auf einem Berg – und was lehrt er dort?
Anders als Markus verwendet der Evangelist ausführliches Material an Worten Jesu, das ihm zur Verfügung steht, um ausführliche Reden Jesu zu gestalten, in denen Jesus seine Lehre darlegt, zuerst in Kapitel 5 bis 7 die so genannte Bergpredigt. Aber warum findet die überhaupt auf einem Berg statt? Sie gehen davon aus (S. 126f.), dass Matthäus seinen Jesus „nicht in der kleinen Synagoge von Kafarnaum“ seine Antrittsrede halten lassen wollte,
sondern im Freien. Denn daß Jesus mit Vorliebe im Freien sprach, konnte er seiner Vorlage deutlich genug entnehmen. Hatte doch Markus für die erste große Rede Jesu eine herrliche Szenerie geschaffen: Jesus sitzt ein wenig entfernt vom Ufer im Boot, während die Leute am Ufer stehen (4,1f). Diese idyllische Szenerie, die wohl kaum erfunden ist, behielt Matthäus für seine erweiterte Gleichnisrede in Kapitel 13 auch bei. Er mußte also nach einer vergleichbaren Szenerie im Freien suchen.
Hierzu sei angemerkt, dass Markus wenige Jahre nach dem Massaker auf dem See Genezareth, bei dem im Jahr 67 nach Josephus 6700 Menschen den Tod fanden, (84) kaum der Sinn danach gestanden haben kann, sich in 3,9f. und 4,1f. eine Idylle aus der Zeit Jesu in Erinnerung zu rufen. Andreas Bedenbender (85) verweist diese Szene eher in „den Bereich des Surrealen“, indem er Markus 3,9f. folgendermaßen übersetzt und interpretiert:
9 [Jesus] sagte zu seinen Schülern,
daß ihm ein kleines Boot bereitgestellt werde –
wegen des Volkshaufens, damit man ihn nicht bedränge.
10 Denn er heilte viele,
so daß alle, die geplagt waren, sich auf ihn warfen, um ihn zu berühren.Man stelle sich das einmal bildlich vor: Jesus muß sich hier in Sicherheit bringen, damit er nicht vom allgemeinen Elend erdrückt wird.
Dass Matthäus einen Berg auswählt, wie Sie schreiben (S. 127), „um der Programmatik dieser ersten großen Predigt Jesu besseren Ausdruck zu verleihen“, begründen Sie folgendermaßen:
Der Lehrer muß beim Unterricht sitzen, aber welcher Lehrstuhl ist für diesen Lehrer, der als neuer Mose spricht, geeigneter als ein Berg? Die souveräne Lehre des neuen Mose sollte also vom Berg herab erfolgen. Die Assoziation zu den religiösen Ursprüngen Israels am Sinai war gewollt. Wie einst das alte Gesetz von einem Berg herab verkündet wurde, so wird jetzt auch das neue, endgültige Gesetz von einem Berg herab verkündet. Dabei sollte das neue Gesetz das alte nicht etwa ersetzen, sondern erfüllen, das heißt: zu seinem Ziel und damit erst richtig zur Geltung bringen, und das nicht nur für das auserwählte Volk. Mose selbst hatte doch einen zweiten Mose angekündigt: „Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören“ (Dtn [5. Mose] 18,15). Dieser Prophet wie Mose ist Jesus.
Hier entfalten Sie die Beziehung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament durchaus folgerichtig. Ich frage mich allerdings, wie nachhaltig sich in Ihrer Gesamtauslegung der Evangelien Ihre Einsicht auswirkt, dass „das neue Gesetz das alte nicht etwa ersetzen, sondern erfüllen … und … erst richtig zur Geltung bringen“ soll. In Ihrer Auslegung des Markusevangeliums hatten Sie ja noch von einer völlig neuen Lehre Jesu gesprochen und Jesus als Revolutionär geschildert. Es bleibt offen, was genau Jesus in Ihren Augen an der Tora der Juden aufheben, ändern oder erst wirklich zur Geltung bringen will.
Bereits in Ihren folgenden Sätzen (S. 128f.) klingt die altbekannte antijudaistische Hermeneutik an, die dem Alten Testament das Gesetz und nur dem Neuen Testament das Evangelium zuordnet:
Die Bergpredigt setzt nicht mit Geboten ein, sondern mit einer Reihe von Seligpreisungen, die eine Umwertung der üblichen Werte bedeuten. Schon das ist bezeichnend genug für das Neue, das dieser Lehrer bringt.
Nein, vollkommen neu ist das nicht gegenüber der Tora, denn auch sie setzt nicht mit Geboten ein, sondern mit dem Werden Israels inmitten der Völker und der Befreiung Israels als des erstgeborenen Sohnes Gottes aus Ägypten. Erst auf diese Befreiung folgt die Verkündung der Tora auf dem Berg Sinai als eine Disziplin der Freiheit, in der sich das Volk nunmehr im Bund mit dem befreienden Gott bewähren soll.
Insofern sind Jesu Seligpreisungen eher eine Zuspitzung des befreienden Zuspruchs der Tora für leidende und erniedrigte Menschen, die sich nach Trost und Aufrichtung, nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen.
In den (S. 129) „sogenannten Antithesen“ Jesu sehen Sie immerhin „ein Kontrastprogramm“ nicht zur jüdischen Tora, sondern zu dem,
was in der griechischen und weithin auch der römischen Gesellschaft seiner Zeit das Übliche war: Gott statt Mammon, Vergebung statt Rache, Gewaltverzicht statt Vergeltung, Feindesliebe statt Haß, Wahrhaftigkeit statt Lüge, Sorglosigkeit statt Angst. Man lese nur ein wenig Plutarch, und man wird schnell sehen, wie revolutionär das Programm Jesu seinerzeit war. Aber man sieht auch auf den ersten Blick, daß diese Umwertung der Werte immer noch aktuell ist, da auch nach zweitausend Jahren Christentum die Politik immer noch auf Geld, Mißtrauen, Lüge, Prestigesucht, Vergeltung und Gewaltandrohung beruht. Die Lösung kann eigentlich nur heißen: Wenigstens in der Kirche sollte das Programm Jesu gelten. Aber im Augenblick ist wenig Bereitschaft dazu sichtbar.
An dieser Stelle gehen Sie nun mit keinem Wort darauf ein, ob und inwiefern Jesu Programm auch gegenüber der alttestamentlichen Ethik „revolutionär“ war. Daher bleibt weiterhin offen, ob Jesu Lehre in Ihren Augen die Geltung von Tora und Propheten nicht letztlich doch aufheben sollte.
Mit Recht stellen Sie zu Matthäus fest (S.135):
Er fand schon im Markusevangelium Erfüllungszitate vor; daraus hat er ein geradezu gelehrtes Programm gemacht. Er fand schon im Markusevangelium Jesus als Lehrer mit einer neuen, revolutionären Lehre. Diesem Lehrer hat er Profil gegeben.
Aber falls das für Markus so stimmt, rückt gerade Matthäus zurecht, dass es Jesus nicht um den Abschied von der Tora geht, sondern um ihre Erfüllung und um ihre Ausbreitung hin zu allen Völkern.
↑ Sollen Jesu Taten seine Göttlichkeit beweisen?
Neben ausführlich dargestellten Reden legt Matthäus auch auf die Taten Jesu weitaus mehr Wert als Markus. Sie schreiben dazu (S. 132):
Wenn nun jemand so gewaltig spricht wie Jesus, erwartet man auch entsprechende Taten. Das können in diesem Fall aber nur Wundertaten sein. Auch Heiden erwarten von einem Gott Wunder. In dem berühmten Prüfungsgespräch Alexanders mit den indischen Gymnosophisten (Brahmanen) lautet eine Frage: „Wie kann man aus einem Menschen ein Gott werden?“ Im Hintergrund steht der Wunsch Alexanders nach göttlichen Ehren. Die Antwort des Weisen: „Wenn einer etwas vollbringt, was einem Menschen unmöglich ist.“ (86) Das heißt: Wenn er Wunder tut. Ob Alexander freilich bei all seiner Außerordentlichkeit etwas Menschenunmögliches vollbracht hat, das ihn zum Gott macht, war für seine Zeitgenossen bei aller Bewunderung eher zweifelhaft. Erst nach seinem Tod gestand man ihm kultische Verehrung zu. Die Behauptung der Göttlichkeit Jesu bedurfte also eines klaren Ausweises. Das waren seine Wunder. Deshalb stellt Matthäus im 8. und 9. Kapitel einen Zyklus von zehn Wundertaten zusammen. Die Beispiele entnimmt er teils dem Markusevangelium, teils anderen Überlieferungen.
Aber führt es nicht in die Irre, die Wunder Jesu mit heidnischen Versuchen der Vergottung von Menschen in Verbindung zu bringen? Stehen seine Taten nicht vielmehr auf einer Linie mit den Zeichen, Wundern und Machttaten, durch die nach Baruch 2,11 der Gott Israels sein Volk „aus Ägyptenland geführt [hat] mit starker Hand, durch Zeichen und Wunder, mit großer Macht und ausgerecktem Arm“? Jesus macht also nicht nur leere Worte, instrumentalisiert auch nicht Wundertaten zur Selbstvergottung, sondern seine Worte und Taten entsprechen den befreienden Wort-Taten des Gottes Israels, den DɘBhaRIM, die im Hebräischen eine große Bedeutungsbreite von Worten und Taten bis hin zu den Tat-Sachen des Befreiungsgeschehens in Israel umfassen können.
↑ Verstößt Jesus gegen die Pflicht, geliebte Tote zu begraben?
Näher eingehen möchte ich im einzelnen noch auf Ihre Einschätzung des Jesuswortes Matthäus 8,22 (S. 132):
Einem … Nachfolgewilligen, der nur noch seinen Vater begraben will, gibt er zur Antwort: „Folge mir, und laß die Toten ihre Toten begraben!“ (8,18-22). Eine ungeheuerliche Antwort. Wer darf so reden und derartiges verlangen? Das Begraben der Toten war selbst für Heiden eine unbedingte Pietätspflicht. Man denke nur an die „Antigone“ des Sophokles. Nach jeder Schlacht werden die Gefallenen an die eigene Seite zur ehrenvollen Bestattung zurückgegeben. Martin Hengel meint: „Es gibt kaum ein Jesus-Logion, das in schärferer Weise gegen Gesetz, Frömmigkeit und Sitte in einem verstößt“. (87) An der Authentizität eines solchen Wortes kann niemand zweifeln.
Dass Letzteres offenbar doch möglich ist, auch wenn es in Ihren Augen nicht sein darf, lasse ich dahingestellt sein. Wichtiger ist mir, dass Sie wieder einmal dieses Wort Jesu nur in einen heidnischen Kontext von „Gesetz, Frömmigkeit und Sitte“ stellen. Aber könnte es nicht auch in einem Zusammenhang mit der Berufung Elisas durch Elia in 1. Könige 19,19-21 gesehen werden? Auch dort ist es in Vers 20 möglich, dass Elia seinem Schüler nicht erlaubt, noch einmal zurück zu seiner Familie zu gehen, was so interpretiert werden kann, dass er nicht Familieninteressen über seinen prophetischen Dienst am gesamten Volk Israel stellen soll (88).
Allerdings kann auch dann das Jesuswort kaum im wörtlichen Sinn verstanden werden, insofern es angesichts von Matthäus 5,17-19 kaum vorstellbar ist, dass Jesus auf eine solche Weise die Tora übertritt, die doch nach 5. Mose 21,23 sogar die Bestattung eines Gehenkten noch am selben Tag verlangt. In diesem Sinne meint auch Andreas Bedenbender (89):
Bisweilen werden die fraglichen Verse in der Weise gedeutet, daß „die geistlich Toten (…) die physisch Toten begraben sollen“ (Konradt 2015, 141) – mit der Konsequenz, daß sich in V. 20 wie in V. 22 „die hohe Anforderung, ja die totale Beanspruchung in der Nachfolge“ zeige (ebd.). Aber das ist grotesk – die „hohe Anforderung“ bestünde offensichtlich darin, das Gebot der Elternehrung mit Füßen zu treten. Auch ist es im Judentum eine heilige Verpflichtung, jedem Toten ein Grab zu geben. Wer es also übernimmt, einen Verstorbenen beizusetzen, dessen Sohn gerade Wichtigeres zu tun hat, hat es nicht verdient, dafür als „Toter“ beschimpft zu werden. Einem Messias aber, der so redet und der solches fordert, sollte überhaupt niemand nachfolgen!
Aber wie ist dann dieses Wort überhaupt sinnvoll auszulegen? Auch dazu hat Bedenbender (90) einen überzeugenden Vorschlag unterbreitet. Er nimmt nämlich ernst (S. 279f.), dass nach Matthäus „das Wort ‚Laß die Toten ihre Toten begraben!‘ an einem See gesprochen wurde, in dem entsetzlich viele Tote und Ertrinkende versunken waren“, und merkt dazu an (Anm. 31):
Wie verstörend dies für jüdisches Denken sein kann, erkennen wir in Offb 20,13. Dort heißt es bei der Beschreibung des großen Weltgerichts: „Und das Meer gab seine Toten her, und der Tod und die Unterwelt (ho hadēs) gaben ihre Toten her, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten.“ Neben denen, die ihr Grab in der Erde erhalten hatten, bilden die „auf See Gebliebenen“ eine eigene Gruppe, und zwar bis zum jüngsten Tag.
Wenn wir daran denken, dass Markus noch unmittelbar unter dem verstörenden Bann dieses oben erwähnten Massakers auf dem See Genezareth gestanden hatte, macht es Sinn, wenn Matthäus mit Hilfe des hart klingenden Jesuswortes nach Ablauf einer Trauerzeit von zehn bis zwanzig Jahren sich und die von ihm angesprochene Gemeinde aus diesem rückwärtsgewandten Blick lösen möchte. Nach Bedenbender (S. 280):
gestattet es die folgende meditative Entfaltung:
Löse dich von der Vergangenheit! Es führt zu nichts, wenn du den Toten der vorigen Generation (exemplarisch: dem Vater), die kein Grab gefunden haben, die Treue hältst. Sofern du deine Jesusnachfolge an die Bedingung knüpfst, daß du ihnen zuvor den Frieden gibst, den sie verdienen, wirst du Jesus nie nachfolgen. Auch im Lichte des Evangeliums wirst du mit der Vergangenheit nicht ins Reine kommen, du verlangst Unmögliches. Wenn du aber all ihre ungelösten Fragen mit dir herumschleppen willst, wenn du jeden Ort wegen der Schreckenstaten, die irgendwann einmal an ihm geschehen sein werden, zu einem Gedenkort machst, und jeden Tag des Jahres zu einem Gedenktag, lähmt dich das nur, und du kommst gar nicht mehr von der Stelle – oder du wirst gegen deinen Willen von den Geschehnissen immer weitergetrieben. Du mußt nicht die Welt erlösen, nicht die Gegenwart und auch nicht die Vergangenheit. „Es ist genug, daß ein jeder Tag seine Plage hat“ (Mt 6,34) – das soll dich nicht nur im Blick auf die Zukunft entlasten, sondern auch im Blick auf das, was hinter dir liegt. Folge mir nach, und laß die Toten ihre Toten begraben! (91)
↑ Die Aussendungsrede als Schluss des Matthäusevangeliums
Zur zweiten Hälfte des Matthäusevangeliums schreiben Sie (S. 133):
Nach der Gleichnisrede in Kapitel 13 folgt Matthäus dann Markus wieder ganze 14 Perikopen lang. Auch die Passionsgeschichte des Markus übernimmt er großenteils wörtlich (26/27). Aber er brauchte natürlich einen anderen Schluß. Einen Clou, wie ihn Markus bietet, kann man nicht wiederholen. Vielleicht war dieser Schluß Matthäus auch zu grell.
Nochmals weise ich darauf hin, dass der Markusschluss nicht einfach als literarischer Kunstgriff, als Paukenschlag oder „Clou“ einzuordnen ist, sondern mit der Verstörung durch die zeitliche Nähe zum Jüdischen Krieg zusammenhängt. Von daher konnte Matthäus Jahre später natürlich mit einem so abrupten und Verzweiflung andeutenden Schluss nicht mehr zufrieden sein. So gestaltet er Markus 16,8 um, erwähnt in Matthäus 28,8 außer der Furcht der Frauen auch ihre Freude und ihre Bereitschaft, die Botschaft von der Auferstehung weiterzusagen, und lässt schließlich den auferstandenen Jesus selbst zunächst vor ihnen und dann auf dem Offenbarungsberg in Galiläa vor den elf Jüngern auftreten.
In dieser abschließenden Rede erweist sich Jesus (S. 134) noch einmal als der Messias, dem der Gott Israels „absolute Souveränität“ übergeben hat. Er hat sie, wie Sie betonen,
nicht von Satans Gnaden, sondern von dem, der ihn auferweckt hat. Jesus spricht hier jedoch nicht als Gewaltherscher und König der Könige, sondern immer noch als Lehrer. Kein Evangelist hat Jesus so prononciert als Lehrer mit einer unverwechselbaren Lehre charakterisiert wie gerade Matthäus mit den fünf großen Reden. Deshalb sollen die Völker in seinem Auftrag nicht an die Kandare genommen werden, sondern eine Schulung und Erziehung erhalten, durch die sie lernen, was er selbst den Jüngern beigebracht hat.
Leider betonen Sie an dieser Stelle nicht noch einmal, dass die Lehre Jesu nach Matthäus 5,17-19 grundlegend nichts von der Tora Israels wegnehmen will. Seine Ermahnung an die Jünger geht dahin, auch die Völker in diese einzigartige Disziplin der Freiheit einzuführen, die er in messianischer Souveränität auszulegen versteht.
↑ Lukas
↑ Lukas als weltgewandter, gebildeter und schriftkundiger Schriftsteller
Mit dem (S. 136) „Beginn des Lukasevangeliums fühlen wir uns fast in die Welt Plutarchs versetzt“, so interpretieren Sie das in Lukas 1,1-4 vorliegende Vorwort (S. 137), in dem der „Autor Lukas … mit ausdrücklichem ‚ich‘ zum Leser“ spricht“ und einem „Gönner“ namens „Theophilos“ sein Werk widmet, der
offenbar der Gesellschaftsschicht an[gehört], in der sich auch Plutarch bewegt. Das sieht man an der Anrede mit κρατιστη, die nur hochgestellten Persönlichkeiten, zum Beispiel römischen Statthaltern, zukommt. Aufgrund der gesellschaftlichen Nähe, die hier sichtbar wird, aber auch aufgrund der Weltkenntnis, die die Apostelgeschichte verrät, können wir Lukas weit eher ins Gespräch mit Plutarch bringen als seine drei Kollegen.
Zugleich merken Sie zu Recht an (S. 138), dass sich in dem „ansonsten doch so gut gebauten Satz, einer richtigen Periode, wie sich keine zweite in den Evangelien findet“, auch seltsame Begrifflichkeiten finden, die einen Plutarch hätten stutzen lassen:
„Die Dinge, die unter uns zur Erfüllung gekommen sind“, ist eine nur für Insider genügende Themaangabe. Die Insider-Orientierung erkennt man auch an der Begrifflichkeit. Was „Diener des Wortes“ sein sollen, hätte Plutarch nicht gewußt. Wir stoßen hier wieder auf den Gebrauch von logos für „Evangelium“, den wir schon bei Markus gefunden haben, offenkundig ein Begriff des frühchristlichen Soziolekts.
Da das Wort, das Sie mit „Dinge“ übersetzen, pragmatōn im Urtext, wörtlich „Taten“ bedeutet, ist zu vermuten, dass auch Lukas wie die anderen Evangelisten (und auch schon die griechischen Übersetzer der hebräischen Heiligen Schrift in der Septuaginta) letztlich ein hebraisierendes Griechisch schreibt, indem er Grundworte der jüdischen Bibel wie das bereits erwähnte DɘBhaRIM (= Worte, Taten, Tatsachen, Befreiungsgeschehen an Israel) mit Begriffen wie pragma (= Tat, Sache, Ding) oder logos (Wort) zu umschreiben versucht.
Zehn Seiten weiter (S. 147f.) bestätigen Sie das auch selbst:
Lukas … erzählt in einem merkwürdigen Stil. Es ist nicht der Stil eines Plutarch, wie man vom Vorwort her vielleicht erwartet hätte, sondern ein eigenartig biblischer Stil, wie ihn weder Markus noch Matthäus bieten. Lukas hat aus Elementen des griechischen Sprachstils der Septuaginta und Elementen des gehobenen Koinegriechischen einen semitisierenden Stil geschaffen, der ein eigenes Sprachkunstwerk ist. Dieser von der Septuaginta imprägnierte Stil setzt gleich nach dem Vorwort ein und versetzt einem unvorbereiteten Leser einen kleinen Stilschock. Mit diesem Stil will Lukas dasselbe sagen wie Markus mit seinem Prophetenzitat am Anfang und Matthäus mit seinem monumentalen Stammbaum: In diesen Ereignissen geht die heilige Geschichte des auserwählten Volkes weiter.
↑ Das Problem von Mythos und Historie im Lukasevangelium
Sodann (S. 138) stellen Sie das Vorwort des Lukas neben „das Vorwort …, mit dem Plutarch seine Biographie des Theseus eröffnet“, und beschäftigen sich (S. 139) eingehend mit dem
Problem, das Plutarch hier anspricht…: Gehören mythische Überlieferungen überhaupt in die Historiographie? Sind sie einer ernsthaften historischen Darstellung fähig? Kann man denn eine Biographie des Theseus schreiben? Die Antwort Plutarchs lautet, wie wir sehen werden, natürlich Nein. Aber wie und warum kann er dann doch eine schreiben? Das ist die interessante Frage, und ich möchte am Ende von der Einstellung Plutarchs her einen Blick auf eine wichtige Frage der modernen Evangelienkritik werfen, die Frage nämlich, wie es mit den Mythen und der mythischen Interpretation des Wunderhaften in den Evangelien steht, nicht zuletzt in den Kindheitsgeschichten des Lukas. Sie steht seit David Friedrich Strauß im Raum. Die Diskussion darüber ist verworren. Schon der Begriff „Mythos“ oder „mythische Wahrnehmung“ wird ganz unterschiedlich gefaßt. Da kann ein Blick auf Plutarch vielleicht klärend wirken.
Warum also (S. 142) beschäftigt sich Plutarch mit historisch unglaubwürdigen Geschichten?
Am Ende entscheidet der Symbolwert, bei historischen wie unhistorischen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum Plutarch selbst ebenso wie schon Platon mythische Erzählungen gestaltet, um philosophische Wahrheit zu vermitteln, die anders nicht oder wenigstens nicht mit genügender Anschaulichkeit zu vermitteln war.
Und Sie fügen hinzu (S. 143):
Die gedichteten Mythen Platons und Plutarchs, die in vieler Hinsicht auf alter Überlieferung beruhen, sind keine Gedankenspiele, sondern eine Fortsetzung der Argumentation mit poetischen Mitteln. …
Die Mythen dienen im allgemeinen zur Deutung des Daseins und der Bedeutung von historischen Sachverhalten, die nur symbolisch zur Sprache kommen können. Deshalb liegt die Wahrheit fiktiver Erzählungen und Erzählzüge ganz in ihrem symbolischen Sinngehalt und der Kraft zur Wirklichkeitsdeutung oder zum Aufweis eines großen Lebenszusammenhangs.
Besonders interessant ist folgende Einsicht Plutarchs (S. 143f.):
Auch in der ägyptischen Mythologie könne man verstreute Spuren der Wahrheit finden. Doch das gelinge nur „einem geübten Spurenleser, der in kleinen Andeutungen Großes entdecken kann“ (92).
Das scheint auch für viele Rückbezüge der neutestamentlichen Texte auf die Überlieferungen des Alten Testaments zuzutreffen, wobei es Judenchristen, die in ihrer Bibel zu Hause waren, noch relativ leicht gefallen sein muss, zu verstehen, was Paulus oder die Evangelisten von diesen Schriften her über den Messias Jesus verkündeten.
Sie beziehen das (S. 148), was Plutarch über uralte Mythen und Wunder sagt, allerdings nun ausführlich auf die „Kindheitsgeschichten, die Lukas seinem Vorwort folgen läßt“. Und es scheint mir, dass Sie eigenartig hin- und herschwanken zwischen Ihrer oben skizzierten Einsicht, bei erzählten Geschichten sei der Symbolwert entscheidender als ihre historische Glaubwürdigkeit, und dem Wunsch, den Erzählungen des Lukas doch möglichst viel an historisch greifbare Tatsachen zu entnehmen. Darauf deutet zum Beispiel ihr Hinweis darauf, dass diese ja
nicht in grauer Vorzeit [spielen] und nicht im Land der Mirakel, sondern im hellen Licht der Geschichte, die nur wenige Jahrzehnte zurückliegt, „in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa“ (1,5). So datiert auch Matthäus diese Ereignisse (2,1).
Nochmals verwenden Sie den Hinweis auf das geringe Alter der von Lukas erzählten Mythen für Ihre Kritik an einer entmythologisierenden historischen Kritik der Evangelien (S. 150):
Der kunstvolle Aufbau dieser Kindheitsgeschichten mit den eingebauten Liedern macht für jeden antiken Leser klar, daß ihnen zwar historische Begebenheiten zugrunde liegen, ihre eigentliche Aussage aber auf der symbolischen Ebene zu suchen ist. Dazu kommt noch, daß diese Erzählungen mithilfe von alttestamentlichen Erzählschemata gebaut sind, die jedem Kenner der Heiligen Schrift auffallen müssen. (93) Hat Lukas es hier geschafft, einen Mythos oder mehrere Mythen so zu bearbeiten, daß sie das Aussehen von Historie annehmen? Diese Sicht ist in der modernen Exegese sehr beliebt, aber meines Erachtens paßt sie nicht, jedenfalls nicht nach antiken Kriterien. Diese Mythen sind einfach nicht alt genug. Deswegen scheint es mir angemessener, ganz schlicht von symbolischen Erzählungen zu reden. Damit ist ein historisches Substrat impliziert, denn symbolisch können nur reale, sichtbare Gegenstände oder Vorgänge sein. (94) Wie weit das historische Substrat geht, können wir meistens nur ungenau bestimmen.
Dabei ist mir nicht klar, welcher Unterschied nun zwischen mythischen und symbolischen Erzählungen bestehen soll; und ich verstehe auch nicht, wieso nur reale Gegenstände oder Vorgänge in der Lage sein sollen, eine symbolische Bedeutung zu haben.
Gerne stimme ich Ihnen aber in folgender Einschätzung der „Kindheitsgeschichten“ bei Lukas zu (S. 156):
Sie wollen nicht die historische Neugier befriedigen, sondern über die Bedeutung dessen reden, dem die Darstellung gilt. Die märchenhaften Züge, von denen in antiken Kindheitsgeschichten besonders die Geburt außerordentlicher Menschen umgeben sind, muß man als symbolische Züge verstehen, die das Geschehen deuten sollen.
Noch ein drittes Mal kommen Sie dann aber (S. 157) darauf zurück,
daß die Ereignisse, die Lukas beschreibt, nur wenige Jahrzehnte zurückliegen. Lukas sagt im Vorwort selbst, daß er Nachforschungen betrieben hat, und wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln. An vertrauenswürdigen Zeugen hat es ihm sicher nicht gefehlt. Diesen Geschichten, auch den Kindheitsgeschichten, liegen also zweifellos historische Tatsachen zugrunde. Diese Tatsachen finden wir aber nicht durch ein Aussieben des Mythischen heraus, sondern dadurch, daß wir schauen, wo historische Angaben im Text vorliegen und wie man sie historisch beurteilen muß. Betrachten wir daraufhin die beiden Darstellungen bei Matthäus und Lukas.
Und wieder frage ich mich, wie Sie so sicher sein können, dass den Kindheitsgeschichten ohne jeden Zweifel „historische Tatsachen zugrunde“ liegen. Achtzig oder neunzig Jahre sind nicht gerade wenig; welcher Art die Nachforschungen des Lukas gewesen sind, beschreibt er nicht; die Widersprüche zwischen den Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas lassen es zumindest als möglich erscheinen, dass beide hier auch aus vorgegebenen alttestamentlichen Traditionen heraus ihre jeweilige Kindheitsgeschichte Jesu mit poetischer Kraft selber gestaltet haben. Und damit sind sie dennoch wahr in dem, was sie über Jesus aussagen.
↑ Der Vorläufer des Messias Jesus: Wer ist Johannes der Täufer?
Konkret habe ich einige Schwierigkeiten mit Ihrer Interpretation der Darstellung Johannes des Täufers bei Lukas. Zunächst verstehe ich nicht (S. 149), wie Sie so sicher über „das Selbstverständnis des historischen Täufers“ Bescheid wissen können:
Er war überzeugt, daß ihm von Gott die endzeitliche Rolle des Propheten Elija zugedacht war, wie sie vom Propheten Maleachi skizziert wird. Das beweist schon seine Tracht, die ganz klar auf Elija verweist.
Dagegen spricht nach Andreas Bedenbender (95) eine ganze Menge:
Nichts deutet darauf hin, daß Johannes der Täufer schon in vormarkinischer Zeit als wiedergekommener Elia gegolten hätte. Die Zeloten bezogen sich, soweit wir wissen, nicht auf Johannes; Josephus erwähnt ihn zwar, bringt ihn aber in keiner Weise mit Elia in Verbindung, und die Beziehung, die in den übrigen drei kanonischen Evangelien zwischen Johannes und Elia hergestellt wird, läßt sich aus dem direkten oder – im Falle des Joh-Ev – mindestens indirekten Einfluß des Mk-Ev erklären. Außerdem ist es einzig Matthäus, der Johannes ohne Wenn und Aber als Elia versteht (vgl. Mt 17,12f.). Lukas schwächt ab, insofern laut Lk 1,17 in Johannes lediglich der Geist und die Kraft Elias wirksam sind – das galt beispielsweise auch von Elisa (vgl. 1 Kön 2,9.14f.) -, und in Joh 1,21 leugnet der Täufer sogar ausdrücklich, Elia zu sein. – Wie es aussieht, vertrat Markus im Blick auf Johannes also eine Position, die entweder völlig neu war oder sich innerhalb der frühchristlichen Traditionsbildung noch nicht als Konsens hatte etablieren können.
Dass Markus das Äußere des Johannes also so skizziert, dass es an das Erscheinungsbild des Elia erinnert, kann also historisch gar nichts beweisen.
Weiterhin denken Sie (S. 149) zur Anrede an Johannes in Lukas 1,76 „du wirst dem HERRN vorangehen, um seine Wege zu bereiten“, dass
mit dem ‚HERRN‘, dessen Advent der Täufer vorbereiten soll, eindeutig Gott selbst gemeint [ist]. Mir scheint es sicher, daß dies auch das Selbstverständnis des historischen Täufers war. …
Nun haben wir bereits gesehen, daß auch Markus den Täufer als Vorläufer Gottes auftreten läßt. Umso merkwürdiger ist es, wie zäh sich die moderne Exegese dagegen wehrt, daß der historische Täufer sich so verstanden hat. Gegen alle Zeugnisse in unseren Quellen meint man, der Täufer habe in dem „Stärkeren“, vor dem er sich so unwürdig fühlt, daß er ihm nicht einmal den Dienst des Sandalenausziehens tun kann, in Wirklichkeit den Menschensohn gesehen oder den Messias, und das hätte man nach Ostern dann leicht auf Christus deuten können. Diese komplexe Frage können wir hier nicht aufrollen, doch auf ein seltsames Argument, das immer wieder vorgebracht wird und selbst Martin Hengel noch anführt, sei kurz besprochen: „Gott ist inkommensurabel und trägt keine Sandalen.“ (96) Die Rede von den Sandalen Gottes hält man für einen unerträglichen Anthropomorphismus. Schauen wir aber in die Heilige Schrift, dann trägt Gott durchaus Sandalen, sogar nach eigener Aussage. In Psalm 108 lesen wir: „Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meine Sandale“ (Ps 108,10). Das ist ohne Zweifel eine kühne Metapher, aber es ist beileibe nicht die einzige, auch nicht die einzige kühne für Gott in der Heiligen Schrift. Da wollen wir dem Täufer doch die seine lassen.
Ganz verstehe ich diese Argumentation nicht. Soll das bedeuten, dass bereits Johannes der Täufer in Jesus Gott selbst gesehen haben soll? Dass Hengels Argument mit den Sandalen in dieser Hinsicht keine Beweiskraft hat, akzeptiere ich. Aber wie wollen Sie beweisen, dass schon der historische Täufer Jesus als Gott angebetet hat? Was uns in den Evangelien vorliegt, ist ein Verständnis Johannes des Täufers, der auf unterschiedliche Weise eine dienende Funktion für den Messias Jesus ausübt. Aber lediglich für die Zeit nach Jesu Tod können wir als gewiss annehmen, dass dieser Messias Jesus schon bald mit dem Gott Israels zusammen angebetet wird, und zwar als Verkörperung seines heiligen NAMENs.
↑ Was ist an den Geburtsgeschichten Jesu historisch wahr?
Trotz Ihrer Einsicht (S. 158), dass die Wahrheit der unterschiedlichen Kindheitsgeschichten Jesu (97) bei Matthäus und Lukas „vor allem auf der symbolischen Ebene liegt“ und „wir nicht jede Einzelheit als historisch erweisen und alles harmonisieren“ müssen, legen Sie dann doch wieder Wert darauf, dass zwei „übereinstimmende Angaben umso auffälliger“ sind:
Beide lassen unabhängig voneinander Jesus in Betlehem geboren sein. Und beide betonen ausdrücklich, dass an der Schwangerschaft Marias kein Mann beteiligt war. Wenn der Historiker in guten, voneinander unabhängigen Quellen übereinstimmende Angaben findet, geht er normalerweise davon aus, dass sie stimmen. Ich sehe keinen Grund, warum wir in diesem Fall anders urteilen sollten.
Ein solcher Grund könnte sein, dass beide Autoren etwa im Fall der jungfräulichen Empfängnis Jesu auf eine ihnen vorliegende gemeinsame Tradition zurückgreifen, die, wie Larry W. Hurtado (98) annimmt (S. 322), „wahrscheinlich schon mindestens ein Jahrzehnt vor Markus bestanden hat“. Er stützt sich bei seiner Argumentation (S. 319) auf Markus 6,3 „mit dem Bezug auf Jesus, ‚den Zimmermann, den Sohn der Maria‘. Diese Bezeichnung soll wohl als Verleumdung hinsichtlich seiner Illegitimität verstanden werden.“ Aber (S. 321), so Hurtado, damit reagiert Markus wahrscheinlich bereits ironisch auf „jüdische Polemik gegen eine wunderbare Empfängnis Jesu“, um darauf hinzudeuten, dass
nämlich ungewollt damit die Wahrheit gesagt wird, dass Jesus eben wirklich der ‚Sohn der Maria‘ ist und nicht das leibliche Kind seines Vaters Josef, weil er durch ein göttliches Wunder empfangen wurde.
Da außerdem (S. 328) beide Geburtserzählungen von Matthäus und Lukas „gründlich durchflutet sind mit biblischer und judaisierender Tradition und im Sprachgebrauch dieser Tradition komponiert sind“ und dasselbe auch „für die anzunehmende vorherige Tradition von Jesu wunderbarer Empfängnis gilt, auf der beide Erzählungen beruhen“, nimmt Hurtado an, dass
diese Idee am wahrscheinlichsten aus Kreisen jüdischer Christen oder gemischt heidnisch-jüdischer Christen stammt, die es vorzogen, ihren Glauben an Jesus im Sprachgebrauch und den konzeptionellen Kategorien der jüdischen Tradition auszudrücken. (99)
↑ Gottes Wort der Befreiung geschieht quer zur römischen Einschreibung!
Was die Frage (S. 159f.) nach der „Wahrheit der symbolischen Ebene [betrifft], die doch die Hauptsache sein soll“, gehen Sie davon aus, dass im „ersten Teil der Geschichte“, bevor der Engel erscheint, „davon … nichts zu finden“ ist.
Ich kann diese Einschätzung nur als Ignoranz gegenüber der politischen Dimension des Evangeliums interpretieren, denn Lukas versteht Jesus eben nicht nur als einen Provokateur im religiösen Sinn, sondern stellt ihn bewusst gerade auch politisch der pax Romana gegenüber, indem er gegen Cäsar Augustus einen ganz anderen Friedenskönig proklamiert.
Und ich kann nur empfehlen, die Ausführungen von Frans Breukelman (100) über die „Ouvertüre des Evangeliums nach Lukas“ gründlich zu studieren, um etwa eine Ahnung davon zu bekommen, auf welche wahrhaft inspirierte Weise Lukas hier deutlich macht (S. 7f.), wie Gottes befreiende DɘBhaRIM (= Worte, die zugleich wirkmächtige Taten sind) in das totalitäre System der „Einschreibungen“ der Römischen Weltordnung eingreifen. Breukelman empfiehlt (S. 15), die vier Stellen in Lukas 2,1-5, an denen das griechische Wort apographein/apographē vorkommt und die Luther mit „schätzen/Schätzung“ übersetzt, immer mit einem Wort aus derselben Wortfamilie zu übersetzen, damit deutlich wird, wie alle Welt der Römischen Weltordnung unterworfen ist.
Frans Breukelman macht aber auf etwas noch Wichtigeres aufmerksam, was in fast allen Bibelübersetzungen verlorengeht (S. 13): die klare Strukturierung von Lukas 2,1-20 durch die dreimalige hebraisierende Formulierung „Und es geschah…“:
„Und es geschah … Und es geschah … Und es geschah …“ (V.1, V.6, V.15). Am Anfang des ersten Stücks hören wir dann: diese erste Einschreibung „geschah“ (V.2); am Beginn des dritten Stücks hören wir aber: „dies Wort“ ist „geschehen“ (V.15). Mitten in dieser ersten Einschreibung und quer dazu ist „dieses Wort“ geschehen! Durch die Wiederholung des Wortes „geschehen“ sehen wir Lukas die drei Stücke dieser Erzählung miteinander verbinden. Wir können das Thema der Erzählung nun vorläufig wie folgt formulieren: Gott hat sich selbst Ehre bereitet, und ihm wird nun im Himmel und auf der Erde alle ‚gloria‘ zuerkannt, weil mitten in der Weltgeschichte (auch wenn es nur ein Fragment derselben ist [V.1-5] – so wird doch souverän das ganze Weltgeschehen diesem dienstbar gemacht) aus dem Himmel auf der Erde überraschenderweise „dieses Wort“ geschehen und zugleich bekannt gemacht worden ist (V.6-14). Davon werden Menschen auf der Erde Zeugen und Verkündiger (V.15-20).
Aus dieser kurzen Zusammenfassung ist natürlich kaum zu ersehen, in welcher kunstvollen Weise Lukas mit seinem hebraisierenden Griechisch auszudrücken vermag, wie ein „Wort“ Gottes geschehen kann. Zwei der Einschreibung unterworfene Juden, Josef und Maria, und dann die Hirten werden zu den Hauptpersonen des Evangeliums der Befreiung, der sōtēria, die auf wahrhaft revolutionäre Weise der real existierenden römischen Weltordnung ihren Friedenscharakter abspricht und Jesus als einen sōtēr von völlig anderer Art entgegensetzt (101).
↑ Was ist ein Sōtēr? „Retter“? „Heiland“? „Befreier“?
Sie meinen nun, dass man dabei bleiben sollte, dieses Wort sōtēr nach dem Vorbild Luthers mit „Heiland“ statt mit „Retter“ zu übersetzen (S. 160f.):
Denn mit „Retter“ ist das griechische sōtēr nur ganz unvollkommen und flach wiedergegeben. Die antiken Menschen wußten, was ein sōtēr ist. Mit diesem Ehrentitel wurden in Gedichten, Reden und Inschriften Götter und Menschen geehrt, die sich durch besondere Wohltaten ausgezeichnet hatten. So etwa Zeus, weil er regnen läßt und alles Gute wirkt; Asklepios, weil er Gesundheit schenkt; Epikur, weil seine Philosophie von Ängsten und Aberglauben befreit; Politiker und Heerführer, die Ordnung schaffen und für wirtschaftlichen Wohlstand sorgen. … Doch kein Herrscher wurde zur Zeit Jesu so sehr als Heiland geehrt und gefeiert wie jener, den Lukas zu Beginn seiner Geburtsgeschichte nennt: Cäsar Augustus.
Zu diesem Kaiser zitieren Sie einen „der besten Kenner der antiken Kulturgeschichte, Michael Rostovtzeff (102)“ folgendermaßen (S. 161):
Ohne jeden Zweifel war Augustus bei der Masse des Volkes im ganzen Reiche außerordentlich populär, wenn wir mit diesem modernen Wort die halbreligiöse Verehrung bezeichnen wollen, die die Römer ihrem neuen Herrscher entgegenbrachten. Für sie war er tatsächlich ein Übermensch, ein höheres Wesen, der Heiland, der die Wunden heilte und Frieden und Wohlstand spendete.
Wenn Sie nun schreiben, dass Augustus tatsächlich „die Wunden der langen, blutigen Bürgerkriege“ geheilt hat, und man es nicht „als bloße Propaganda abtun“ sollte, wenn „überall im Reich verkündet wurde, „das neue Zeitalter dieses Friedens sei aufgegangen mit seiner Geburt“, dann frage ich mich, in welcher Weise nun das in der Krippe zu Bethlehem geborene Kind in Ihren Augen ein sōtēr sein soll – überbietet es den Kaiser noch in seinen Wohltaten oder setzt es ihm eine andere Art von Heil entgegen?
Sie deuten eine Antwort nur an (S. 161f.):
Wo Gott auf Erden ebenso verherrlicht wird wie in der Höhe, herrscht Friede unter den gottgefälligen Menschen. … Nicht der Heiland Augustus ist der Bringer des wahren Friedens, sondern der in Betlehem geborene Heiland Jesus. Er wird vielleicht schon deshalb als sōtēr bezeichnet, weil das hebräische Grundwort, das in der Septuaginta immer wieder damit übersetzt wird, ja schon in seinem Namen steckt; es ist die Wurzel JaSchAˁ. … Als Heiland hat er die umfassende Berufung zum Retten, Gutmachen und Erlösen, insbesondere wo es um Sünden geht. (103) Wo er aufgenommen wird, herrscht unabhängig von der politischen Lage ein großer Friede.
Aber wenn der Friede des Heilandes Jesus Ihnen zufolge „unabhängig von der politischen Lage“ herrscht – besteht er dann letztlich doch nur in einem Seelenfrieden? Schon die Übersetzung von sōtēr mit „Heiland“ ist ja problematisch, weil dieses Wort heutzutage eher auf eine innerliche Erlösung gerichtet ist als auf ein Geschehen, das den ganzen Menschen und die ganze menschliche Gesellschaft umfasst. Im hebräischen Begriff JaSchAˁ ist aber ein Geschehen von sozialer und politischer Befreiung entscheidend mitenthalten.
Das heißt: Wenn man hier von „Sünden“ spricht, geht es zumindest auch darum, dass es unter der römischen Herrschaft nicht möglich ist, so in Freiheit und Recht miteinander zu leben, wie es die Tora Gottes vorgeschrieben hat. Es ist also kaum vorstellbar, dass die Evangelisten den römischen Kaiser Augustus auch nur ansatzweise als Friedensherrscher und Wohltäter der Menschheit verstanden hätten; vielmehr sehen sie in Jesus den sōtēr im Sinne eines „Befreiers“ auch insofern, dass er der römischen Gewalt- und Ausbeutungsherrschaft einen mit Recht und Freiheit für alle Menschen verbundenen Frieden im Sinne des hebräischen SchaLOM entgegensetzt.
Die Durchsetzung dieses Friedens geschieht nun allerdings nicht auf dem Wege zelotisch-gewaltsamer Revolution, sondern der gewaltfreien Verkündung des Evangeliums der Befreiung, verbunden mit der Bereitschaft zum Leiden.
Zu Recht stellen Sie fest (S. 162), dass Jesus durch Lukas mit den vier Liedern der Maria, des Zacharias, der Engel und des Simeon in ihrem
Stil alttestamentlicher Psalmen … in die Geschichte Israels eingeordnet [wird], die mit Abraham und den Vätern beginnt. Diese Lieder gehören also zu jener Ebene, auf der die erzählten Geschehnisse gedeutet werden. Mit ihnen erreicht Lukas etwas Ähnliches wie Matthäus mit seinem monumentalen Stammbaum. Die Rede vom Heiland und dem Heil, das er bringt, begegnet darin mehrfach [vgl. Lk 1,48.69.71.77; 2,30]. Es ist immer das Heil Gottes gemeint, das sich vollendet in Christus.
Aber nochmals weise ich nachdrücklich darauf hin, dass man nun auch dieses „Heil“ vom Alten Testament her nicht nur individualistisch und rein innerseelisch verstehen darf, sondern in seiner umfassenden gesellschaftlichen Bedeutung als „Schalom“.
↑ Ein Stammbaum Jesu bis zu ˀADaM (= Menschheit)
Dass (S. 167) Lukas für seinen Stammbaum des Josef „ein Schema in aufsteigender Linie“ benutzt, das (S. 168) „in der griechischen Literatur seit Herodot bekannt“ ist und „im Alten Testament … erst in den Spätschriften“ auftaucht, deuten Sie als eine Verfahrensweise, die insofern „typisch für Lukas“ ist, als „er nach Möglichkeit literarische Elemente bevorzugt, die Biblisches und Hellenistisches verbinden.“
Ob die in der sowohl von Matthäus als auch von Lukas bezeugten Abstammung Josefs „aus dem Haus David“ unbedingt als eine „unwidersprochene Familientradition“ und „somit als historische Information“ genommen werden muss, lasse ich dahingestellt sein. Recht gebe ich Ihnen uneingeschränkt darin, dass der Versuch, „die beiden Stammbäume durch geistreiche Annahmen irgendwie zu harmonisieren“ (S. 169),
verlorene Liebesmühe sind. Denn Stammbäume wollen, wie schon gezeigt, nicht so sehr historische Informationen vermitteln, sondern Ansprüche auf gesellschaftliche Bedeutung erheben.
In der Einzelheit, dass Lukas in 3,31 die Davidssohnschaft Jesu nicht über Salomo, sondern über Natham laufen lässt, mag er auch die in 1. Könige 11 geübte Kritik an der Art und Weise der Regierung des leiblichen Davidssohnes Salomo anklingen lassen und zugleich andeuten, dass ein wahrer Davidssohn im Hören auf die Tora Gottes eher einem Propheten wie Nathan entsprechen muss.
In Ihrem folgenden Satz sehe ich nur einen Begriff kritisch:
Indem Lukas den Stammbaum weiter hinauf bis zu Adam steigen läßt, sprengt er den ethnischen Horizont und macht deutlich: in Jesus gipfelt nicht nur die Geschichte Israels, sondern die Geschichte der Menschheit.
Es ist grundfalsch, die Konzentration des Alten Testaments auf die Erwählung Israels als einen ethnischen Horizont zu begreifen. Der ethnische Horizont ist bereits im Alten Testament insofern gesprengt, als Israel als erstgeborener Sohn des NAMENs inmitten der Völker von Gott erwählt wird, um aus der Sklaverei Ägyptens zu einer Disziplin der Freiheit befreit zu werden, die letztlich Segen und Frieden für alle Völker bedeutet.
Richtig an Ihrem Satz ist allerdings das Interesse des Lukas, in seinem Doppelwerk an die Ziele des Paulus anzuknüpfen und das Evangelium der Befreiung ganz bewusst zu allen Völkern bis in die Hauptstadt des Römischen Reiches zu tragen und damit die eben von mir angesprochenen Verheißungen des Alten Testaments zu erfüllen.
↑ Ist Jesus nach Lukas 4,22 ein „begnadeter“ Redner oder redet er auch inhaltlich von „Gnade“?
Die Antrittspredigt Jesu in der Synagoge von Nazareth beschreiben Sie mit folgenden Worten (S. 170f.):
Die Leute hängen an seinen Lippen, denn seine Worte haben etwas, was der Grieche mit dem Wort charis bezeichnet: Anmut, Schönheit, Liebenswürdigkeit, Charme (4,22). … Man sollte an dieser Stelle nicht mit dem gewichtigen theologischen Begriff „Gnade“ kommen, wie die Einheitsübersetzung. Hier geht es nicht um Gnade. Luther hat es besser getroffen mit „den holdseligen Worten, die aus seinem Munde gingen“. In den neueren Revisionen ist freilich auch er „korrigiert“ worden.
Wenn man allerdings das Wort aus Jesaja 61,2, das Jesus in Lukas 4,19 nach der Septuaginta zitiert, im Sinne des hebräischen Textes mit (104) „auszurufen ein Jahr der Begnadung durch Adonai [= den HERRN]“ versteht, macht es doch wieder Sinn, auch in Lukas 4,22 „Worte der Gnade“ zu sehen, die „aus seinem Mund kamen“. Ob Jesus im Sinne der hellenistischen Rhetorik ein begnadeter Redner war (interessant, dass man auch, um einen solchen zu bezeichnen, auf das Wort „Gnade“ zurückgreifen kann!), war dem Lukas angesichts seines Interesses, das Evangelium der Befreiung auszurufen, vermutlich weniger wichtig.
Nicht sicher weiß ich, ob Ihre folgende Einschätzung zutrifft (S. 172):
Analog und symmetrisch gebaute Worte oder Gleichnisse dieser Art sind wie die Amen-Einleitung eine Eigentümlichkeit der Rhetorik Jesu. Die Form des strophischen Parallelismus muß sogar als seine poetische Erfindung gelten, denn sie hat kaum richtige Vorbilder.
Aber ist ein strophischer Parallelismus nicht geradezu das Markenzeichen der Psalmendichtung? Hier wäre ich für eine eingehendere Betrachtung und ein differenzierteres Urteil dankbar gewesen.
Im Zusammenhang (S. 173) mit „dem Doppelwort von der Witwe von Sarepta und dem Syrer Naaman“ sowie deren „genaue Parallele in einem anderen … Doppelwort von der Südkönigin und den Niniviten, das im 11. Kapitel des Lukasevangeliums steht“, stellen Sie die Haltung Jesu und der „Israeliten“ scharf gegeneinander:
Auch dieses Wort bringt – geschlechtergerecht – zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift, eine Frau und die Männer von Ninive. Auch in diesem Wort sind es beide Male Heiden. Und auch in diesem Fall formuliert Jesus die Dinge gezielt provokativ, so daß bei der Gegenüberstellung die Israeliten schlecht wegkommen, in diesem Fall sogar sehr schlecht. Und der Grund dafür ist eigentlich nur, daß sie auf ihn nicht hören wollen, obwohl mit ihm doch mehr gekommen ist als Salomos Weisheit und Jonas Prophetie. Es ist deshalb gar nicht ausgeschlossen, daß auch das provozierende Beispielpaar aus der Nazaret-Perikope auf Jesus selbst zurückgeht. Jedenfalls hätte er ohne weiteres so sprechen können. Wenn Lukas es erfunden hat, hat er es gut, nämlich ganz im Stil und Geist Jesu erfunden.
Wieder einmal ist mir nicht klar, ob Sie einfach davon ausgehen, dass schon der historische Jesus sich von einer grundlegenden Kritik an „den“ Juden her sich „den“ Heiden positiver zugewandt hätte. Dabei geht verloren, dass Jesus genau wie Paulus und die Evangelisten zunächst einmal „als“ Juden innerjüdische Kritik am eigenen Volk übten, ähnlich wie die Propheten Israels, und zwar vor allem an der Führung des Volkes, die mit den Verantwortlichen des römischen Imperiums kollaborierte. Lukas liegt in seiner Kritik an den Juden auf einer Linie mit Paulus, der die Nichtannahme des Evangeliums durch das rabbinische Judentum als Ausgangspunkt für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern versteht (vgl. Römer 11,25ff. mit Apostelgeschichte 28,17ff.).
↑ Warum spricht Lukas nicht von Menschenfischern wie Markus?
Im Zusammenhang mit der Berufung der ersten Jünger (S. 177) sagt Jesus bei Lukas zu Simon Petrus:
„Keine Angst! Von jetzt an wirst du Menschen gefangen nehmen“ (5,10). Warum hat Lukas das Wort von den „Menschenfischern“ bei Markus (1,16) nicht gelassen? Ich vermute, daß ihm diese auf den ersten Blick so passende Metaphorik zu grell und heftig war. Das hätte zweifellos auch Plutarch so empfunden. Für solche Dinge war man in der antiken Rhetorik sehr empfindlich und fügte bei kühnen Metaphern ein „gleichsam“ oder „sozusagen“ hinzu. Das ging in diesem Fall nicht. Zur Erklärung dieses Eingriffs muß man bedenken, daß gefangene Fische sterben. Das ist, zumindest auf den ersten Blick, kein schöner Gedanke für die christliche Mission. Das Verb jedoch, das Lukas anstelle des Fischens wählt, ist zōrgein. Es bedeutet „lebendig fangen, lebend gefangen nehmen“, wie schon die Etymologie zeigt. Man sollte deshalb nicht, wie Luther und die üblichen Übersetzungen, einfach von „fangen“ reden.
Nochmals erinnere ich daran, dass das Markusevangelium nach Andreas Bedenbender (105) unter anderem auch die traumatischen Ereignisse zu verarbeiten suchte, die sich während des Jüdischen Krieges im Jahr 67 am und auf dem See Genezareth zutrugen. Bedenbender (S. 239f.) versucht, „die recht gewaltsam gebildete und ihrem Gehalt nach erschreckende Metapher ‚Menschenfischer‘ in Mk 1,17“ unter Rückgriff auf Jeremia 16,16 zu verstehen (S. 239):
Dort nämlich finden sich die einzigen Menschenfischer der jüdischen Bibel – in einem Gerichtswort, das Gott für sein Volk bestimmt hat:
Wohlan,
ich sende um viele Fischer,
ist SEIN Erlauten,
die sollen sie fischen,
und danach will um Jäger [TsaJJaDIM], viele, ich senden,
die sollen sie jagen,
herunter von allem Berg,
herunter von allem Hügel
und noch aus den Spalten des Geklüfts.
Dieses Wort konnte Markus wenige Jahre nach 67 auf die ihn unmittelbar verstörenden Ereignisse der Menschenjagd auf dem See Genezareth beziehen (S. 240):
Die Römer hatten im Jüdischen Krieg (wie auch in manchem anderen) ihre Opfer wie Tiere gejagt, wie Tiere abgeschlachtet. Und mit besonderer Grausamkeit hatten sie gerade auf dem See Genezareth gewütet. Markus kann seine Hoffnung nicht an dieser Realität vorbeiformulieren, er muß sich ihr stellen. Darum wählt er ein Rettungsbild, das in antithetischer Entsprechung zu der Metapher steht, die in Jer 16,16 das Leidensgeschick Israels so eindrücklich zusammenfaßt. Gewiß ist die von ihm vorgenommene Umdeutung der Rede von den „Menschenfischern“ schief. Fische erfahren es nicht als Rettung, aus dem Wasser gezogen zu werden, es ist ihr Verderben. Doch indem Markus für die Perspektive des Entrinnens ein unstimmiges Bild gebraucht, indem er den verstörenden Gedanken von im Netz zappelnden Menschen andeutet, vermag er sich der realen Absurdität des Jüdischen Krieges stärker anzunähern, als es ihm mit allen wohlgesetzten Vergleichen möglich gewesen wäre.
Es ist klar, dass Lukas in größerem zeitlichen Abstand zum Jüdischen Krieg (vielleicht auch in Unkenntnis des Massakers auf dem See Genezareth (106)) diese Metapher nicht mehr verwenden wollte.
↑ Lukas als „Historiker“ und/oder als Evangelist der Befreiung
Sehr betont stellen Sie die Kompetenz des Evangelisten Lukas als Historiker heraus (S. 180):
Lukas erhebt in seinem Vorwort den Anspruch eines Historikers und löst ihn in seinem Doppelwerk auch ein. Wie Herodot und Thukydides gibt er durch einen Synchronismus ein Epochenjahr an. Sein Epochenjahr ist jedoch nicht politisch, sondern heilsgeschichtlich bestimmt; es ist das öffentliche Auftreten des Täufers.
Diese ungewöhnlich genaue Datierung hatten Sie bereits zuvor damit begründet (S. 166), dass er
wie schon in der Geburtsgeschichte das lokale Ereignis in Palästina in die Geschichte des Römischen Reichs einordnen [will], und so beginnt er seinen großen Synchronismus mit dem Regierungsjahr des Kaisers Tiberius, nach unserer Zeitrechnung das Jahr 28/29 n. Chr. (107) Nach dieser exakten Angabe bietet Lukas noch den Namen des römischen Statthalters in Judäa, Pontius Pilatus, dazu drei Namen gleichzeitig regierender Fürsten aus dem Umland und zweier Hoherpriester, Hannas und Kaiphas. Das ist ein sechsfacher Synchronismus… Damit erweist sich Lukas zur Genüge als Historiker und erhebt zugleich den Anspruch, daß das, was er erzählt, nicht nur lokale, sondern reichsweite Bedeutung hat.
Das heißt: Sie stellen zwar eine „reichsweite Bedeutung“ der Botschaft des Lukas fest, aber (S. 180) Ihre Einstufung des Lukas als Historiker geht damit einher, dass sein Geschichtsverständnis „nicht politisch, sondern heilsgeschichtlich“ bestimmt sein soll. Aber versteht Lukas Geschichte nicht vielmehr auf hebräisch-jüdische Weise als ein Geschehen von Gottes Wort, das sich quer durch die menschliche Weltgeschichte hindurch durchzusetzen vermag? Und muss man dieses Wort nicht zumindest auch als ein politisch befreiendes Wirken Gottes begreifen, indem es durch Leben und Lehre, Leiden und Sterben des Messias Jesus letzten Endes die zutiefst ungerechte Weltordnung überwindet?
Ganz in diesem Sinne hatten Sie auf S. 166 auch deutlich gemacht, dass Lukas mit seiner Fähigkeit, historisch genau zu datieren, zwar seine Kompetenz als Historiker erweist, sein Evangelium aber dennoch kein historisches Werk für ein römisch-hellenistisches Publikum wie etwa das des Josephus über den Jüdischen Krieg darstellt, denn:
Zur angegebenen Zeit „erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste“ (3,2). Mit einer typischen Wendung aus der Heiligen Schrift Israels wird das einschneidende Ereignis des Epochenjahrs angegeben.
Dieses Ereignis ist für Sie „das Auftreten des Täufers“, das wie bei Markus durch ein „Zitat aus dem Propheten Jesaja“ eingeführt wird, „aber fortgeführt bis zu der Verheißung: „Und alles Fleisch wird schauen das Heil (to sōtērion) Gottes“ (3,6). Hier treffen Sie sich mit der Auslegung von Frans Breukelman (108):
Auch Markus und Matthäus lassen uns am Anfang ihrer Erzählung dieses Zitat aus Jes. 40 hören (Mat. 3:3; Mk. 1:3; vgl. Joh. 1:23). Aber sie beschränken sich dabei auf die ersten drei Zeilen. Lukas fügt jedoch die darauf folgenden fünf Zeilen noch an, weil er aus der Ouvertüre als Andeutung des Themas seiner Erzählung unmittelbar auch am Beginn dieser Worte erklingen lassen will: „Und alles Fleisch soll to sootèrion tou theou sehen“.
Insofern sollte man Lukas nicht auf eine Rolle als Historiker festlegen. Zu allererst tritt er uns als der Evangelist der Befreiung entgegen.
↑ Lukas als Evangelist der Armen, der Frauen und des Geistes
Als besondere (S. 181) „Vorlieben und lnteressenschwerpunkte“ des Lukas „schon beim Sammeln des Materials“ nennen Sie an erster Stelle „das Thema Armut und Reichtum“:
Überhaupt zeichnet Lukas Jesus als Heiland der Armen und Verachteten. Zwar fehlt dieser Zug auch in den anderen Evangelien nicht, aber kein Evangelist bietet in dieser Hinsicht so viel Material wie Lukas. Deswegen nennt man ihn mit Recht den Evangelisten der Armen. Wieviel würde uns fehlen ohne die Geschichten von der großen Sünderin (7,36-50), von Zachäus (19,1-10), vom reuigen Banditen am Kreuz (23,40-43)? Und wie arm wären wir ohne die Gleichnisse vom barmherzigen Samaritaner (10,30-35), vom verlorenen Sohn (15,11-32) und vom Pharisäer und Zöllner (18,9-14)! Sie sind uns nur durch Lukas erhalten geblieben.
Ein zweiter (S. 182f.) „Interessen- und Sammelschwerpunkt des Historikers Lukas waren die Frauen um Jesus“. Hierzu kann ich Sie nur zustimmend zitieren:
Bei ihm werden die Frauen erst richtig prominent. Nur bei ihm begegnen Elisabeth, die Mutter des Täufers, und die Prophetin Hanna. Lukas hat uns sogar eine, wenn auch dürre und dürftige Notiz über die Rolle von vermögenden Frauen im Leben Jesu hinterlassen… [Lk 8,1-3].
Was hat wohl Johanna, eine Frau aus der höchsten Gesellschaftsschicht Galiläas, bewogen, einen armen Wanderlehrer finanziell zu unterstützen und sogar mit ihm herumzuziehen? Woher kannte sie ihn überhaupt? Und was sagte ihr Mann dazu? Es muß ja in jedem Fall ein ungeheurer Skandal gewesen sein. Und wer waren „die vielen anderen Frauen“, die dasselbe taten? Haben sie ihn auf den Wanderungen in Galiläa nur zeitweise oder immer begleitet? Diese Frauen bildeten ja offensichtlich das Versorgungsteam Jesu und seiner engsten Jünger.
Nur bei Lukas finden wir die Geschichte von Maria und Martha (10,38-42); von der Sünderin, wohl einer Hetäre, die Jesu Füße salbt und mit ihren Haaren trocknet (7,36-50) (sie löst ihr Haar in fremder Gesellschaft – das war für eine ehrbare Frau unerhört); von der Frau, die Jesu Mutter selig preist (11,27f); von der Witwe von Nain, die um ihren toten Sohn trauert, weil sie damit ohne Versorgung dasteht (7,11-17); von der verkrümmten Frau, die Jesus heilt (13,10-13); von den weinenden Frauen auf dem Kreuzweg (23,27-31). Auch im Sondergut der Bildworte und Gleichnisse, die Lukas überliefert, finden wir Frauen als Hauptpersonen: die Witwe von Sarepta aus dem Alten Testament (4,25f), die couragierte Witwe, die auch mit einem gewissenlosen Richter fertig wird (18,1-8), und die Frau, die das Haus wegen einer verlorenen Drachme auskehrt (15,8-10). Das ist eine bemerkenswerte Reihe von Frauencharakteren. Für die menschliche Charakteristik Jesu in den Evangelien ist das einer der wichtigsten Punkte. Die exegetische Forschung hat ihn noch kaum entdeckt. Und natürlich dürfen wir in der Reihe der Frauen um Jesus auch seine Mutter nicht vergessen. Was wüßten wir von ihr ohne die lukanischen Mariengeschichten? In der östlichen Überlieferung gilt Lukas als Maler von Marienikonen: nicht von ungefähr. Denn nur er zeichnet ein wirkliches Bild von ihr.
Schließlich nennen Sie (S. 183f.) als
dritten Interessenschwerpunkt des Lukas … sein Interesse für das Wirken des heiligen Geistes. Bei diesem Interesse geht es nicht nur um Theologie, sondern um ein grundlegendes Problem der Geschichte, das die Geschichtsphilosophie zu behandeln hat: Was rechtfertigt eigentlich den Singular „Geschichte“? Haben denn die vielen kontingenten Ereignisse einen Zusammenhang, der sie zu einer sinnvollen Einheit macht?
Dabei gehen Sie davon aus (S. 184), dass „nur metaphysische Annahmen eine bejahende Antwort möglich machen“ und „daß Plutarch solche metaphysischen Annahmen hatte“. Sie sehen darin sogar einen
seiner Interessenschwerpunkte. Es ist von der Sache und der Funktion her derselbe wie bei Lukas. Immer wieder weist er vor wichtigen Ereignissen in regelrechten Listen auf Vorzeichen des Kommenden, sogenannte omina und portenta, hin. …
Solche Vorzeichen, bedeutsame Träume und Orakel beweisen für Plutarch und die meisten antiken Historiker, daß die Götter sich um das Geschehen in der Welt kümmern und es zumindest teilweise auch lenken.
Nach Plutarch setzen also (S. 185) „Ordnung, Struktur und Sinn einen Geist voraus…, der sie gewollt und bewirkt hat.“
Kann man aber das Wirken der heidnischen Götter in dieser Weise neben den heiligen Geist der Bibel stellen? Für Sie ist das anscheinend kein Problem (S. 185f.):
Dieser Geist, der die Aufgabe der Fügung hat, ist für Lukas der heilige Geist. Er stellt ihn als die treibende Kraft der Heilsgeschichte dar, dessen Walten zugleich den Sinn und die Einheit dieser Geschichte herstellt. Ich erwähne nur einige markante Stellen. Der Täufer ist schon von Mutterleib an vom heiligen Geist erfüllt (1,15.17); Jesus wird aus heiligem Geist gezeugt (1,35), er beginnt sein öffentliches Wirken in Galiläa in seiner Kraft (4,14) und stellt sich in Nazareth mit dem Zitat aus Jes 61,1 als Geistträger vor (4,18). Den Jüngern verheißt der Auferstandene den heiligen Geist als „Kraft aus der Höhe“ (24,49; Apg 1,4f.8), die mit Pfingsten ganz offensichtlich auch kommt (Apg 2,1-4). Diese Herabkunft wird mit {186} einem langen Zitat aus dem Propheten Joël als die für die Endzeit verheißene Ausgießung des heiligen Geistes gedeutet (Apg 2,17-21). Durch die Taufe können alle Anteil erhalten an diesem Geist, Juden wie Nichtjuden (Apg 2,38f). Die Schuld der „Juden“ besteht nach Lukas darin, daß sie sich diesem Geist widersetzen (Apg 7,51; 28,25-28).
Diese pneumatologische Geschichtsbetrachtung des Historikers unter den Evangelisten wäre heute wieder neu zu gewinnen. Aus philosophischer Sicht spricht nichts dagegen, da jede Weltanschauung auf apriorischen Annahmen beruht. Die Annahme, daß Gott nicht in der Geschichte wirkt, ist philosophisch betrachtet sowenig beweisbar wie ihr Gegenteil.
Da Sie hiermit die Betrachtung des Evangelisten Lukas beschließen, bleibt letzten Endes offen, ob Sie tatsächlich ernstnehmen, dass Lukas in hebräisch-jüdischem Sinn ein Evangelium der Befreiung verkündet, das durch Paulus am Ende bis ins Zentrum der Weltmacht Rom hineingetragen wird, oder ob heidnisch-hellenistische Götterlehre letztlich die biblische Botschaft verdunkelt.
↑ Zwischenfazit: Was vermitteln die ersten drei Evangelien?
Bevor Sie (S. 187) an den Versuch herangehen, das Johannesevangelium zu verstehen, das für Sie, „wenn man von den Synoptikern herkommt, eine harte Nuß“ ist, blicken Sie „noch einmal zurück… auf die Synoptiker und ihre Charakteristik Jesu“ (S. 188):
Ein Wundertäter und Gottessohn, der elendiglich am Kreuz starb: Dieses Paradox liegt dem Christentum zu Grunde, darüber kann es nicht hinauskommen. Jeder Versuch, es nach einer Seite hin aufzulösen, führt zum Verrat am Ganzen. Sobald man an der Gottheit Jesu oder an seinem Kreuzestod etwas wegnimmt, verliert seine Biographie ihre erregende Dramatik und wird entweder zum Mythos eines über die Erde abenteuernden Gottes oder zur Geschichte eines jüdischen Sokrates…
Deshalb haben sich auch Matthäus und Lukas vor der Auflösung des Paradoxes gehütet, auch wenn ihnen manche Details, die ihr Vorbild erwähnte, doch allzumenschlich vorkamen oder sagen wir vielleicht lieber: von der Art schienen, die man im Fall Jesu besser mit Stillschweigen übergeht. Deshalb drängten sie die allzumenschlichen Züge, die Markus ungeniert wiedergab, etwas zurück und strichen die hoheitlichen besser heraus.
Hier wird noch einmal deutlich, dass Ihre Interpretation der Evangelien als Lebensbilder Jesu, griechisch bioi, tatsächlich zwei große Schwachstellen aufweist. Zum einen lesen Sie in die Evangelien von der späteren christlichen Dogmatik her bereits das voll ausgebildete Paradox des Wesens Jesu hinein: wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, wie es auf dem Konzil von Nicäa beschlossen wurde. Zum anderen aber bleibt bei dieser Konzentration auf das Individuum Jesus die Einbindung dieses Messias in sein Volk Israel und in die Verheißungen dieses Volkes weitgehend auf der Strecke. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie zwar durchaus die Betonung der Tora bei Matthäus und den hebraisierenden Stil des Lukas wahrnehmen, aber keine inhaltlichen Konsequenzen daraus ziehen.
Ein von der jüdischen Heiligen Schrift her interpretierter Messias Jesus ist natürlich auf keinen Fall mit einem „über die Erde abenteuernden Gott“ zu verwechseln. Allerdings ist er auch jemand ganz anderes als ein jüdischer Sokrates, nämlich nicht ein wegen seiner Weisheit oder Tugend hervorragender Mensch, sondern sowohl Repräsentant seines Volkes Israel als auch Verkörperung der Herrlichkeit des befreienden NAMENs des Gottes Israels.
Ausgerechnet die Kreuzigung dieses Messias, für die die Führung des jüdischen Volkes und die römische Weltordnung gemeinsam verantwortlich sind, und seine Auferweckung durch den Gott Israels führen nun dazu (und das mag man ein Paradox nennen), dass das, was dem Volk Israel verheißen war, nun auch in die Völkerwelt hinaus verkündet wird. Das war jedenfalls das Programm des Paulus gewesen, der damit begann, den Leib des Messias Jesus ganz konkret als die Gemeinschaft von Juden und Gojim (= Menschen aus den Völkern) in der ekklēsia (Versammlung der entstehenden Kirche) zu begreifen.
Markus schreibt angesichts der traumatischen Katastrophe von 70 n. Chr. seine „Frohe Botschaft am Abgrund“ und hält damit an der Spannung zwischen Kreuzesbotschaft und messianischer Hoffnung fest.
Auf der Basis von Markus, aber in deutlicher Abgrenzung von den verstörenden Elementen seines Evangeliums, formulieren Matthäus und Lukas auf unterschiedliche Weise ein Zukunftsprogramm für eine Gemeinschaft, die auf den Messias und Gottessohn Jesus vertraut. Dabei hält Matthäus an der Tora Israels fest, die allen Völkern gelehrt werden soll, während Lukas darauf bedacht ist, das Programm des Paulus fortzuführen, das in der Gemeinschaft von Juden und Gojim im Leib Christi besteht, ohne dass die Gojim auf die Einhaltung der gesamten Tora verpflichtet werden.
↑ Johannes
↑ Die härteste Nuss am Anfang: Wie ist der Prolog zu begreifen?
Nicht nur für Sie ist das Johannesevangelium eine harte Nuss, auch ich tue mich mit Ihrer Interpretation des vierten Evangeliums schwerer als mit den anderen. Dabei stellt der Prolog in Johannes 1,1-18 eine nochmals härtere Herausforderung dar.
Ihnen zufolge ist (S. 189) der Prolog als „eine hymnische Lobrede … auf den Logos, der erst im Laufe des Textes eine menschliche Identität erhält“, eine (S. 190) weitere „literarische Neuerung“ innerhalb der Evangelien:
Wir haben in den Evangelien jetzt schon eine ganze Reihe davon gefunden. Das Neue, das Jesus gebracht hat, sprengt sogar die Kategorien der literarischen Formen. Auch der literarische Wein muß in neue Schläuche gegossen werden. Und das Christentum fand in den vier Evangelisten gleich vier innovative literarische Genies, die das zustande brachten.
Ob das Bild vom neuen Wein in neuen Schläuchen tatsächlich bereits zur Zeit der Evangelien auf das Neue („Christliche“) bezogen werden darf, das Jesus gegenüber dem Alten („Jüdischen“) gebracht hat, hatte ich ja schon oben angezweifelt. So mag auch hier Ihre ausschließliche Aufmerksamkeit für das „Neue, das Jesus gebracht hat“, in den Hintergrund treten lassen, mit welchem Alten Jesus dennoch unverbrüchlich verbunden bleibt: mit dem Gott Israels nämlich, dessen befreienden NAMEN der Messias Jesus verkörpert, und mit der jüdischen Heiligen Schrift, von der her die gesamte Wirksamkeit Jesu verstanden werden muss.
Bezeichnend ist dann auch, dass Sie zwar verschiedene Möglichkeiten der Lektüre des Johannes-Prologs vorstellen, aber es fehlt ausgerechnet die eine entscheidende Art und Weise, den griechischen Text von der Heiligen Schrift Israels her zu lesen!
↑ Den Prolog auf naive Weise lesen – als „griechisches Kind“
Zunächst einmal (S. 191) probieren Sie „eine ganz naive Lektüre“ aus, die davon ausgeht, dass
jedes griechische Kind [weiß], was logos heißt. Aber wieso war der Logos (ho logos, mit bestimmtem Artikel!) zu Anfang? Und wenn logos hier irgendwie „Wort“ heißen soll, warum taucht es dann vor dem Sprecher auf? Und falls Gott der Sprecher ist, warum heißt es dann nicht: ,Das Wort kam von Gott‘, sondern gleich zweimal: Es war „bei Gott“? Und warum wird es dann gleich in der dritten Zeile so betont als „göttlich“ oder „Gott“ bezeichnet? Wer soll denn dieser Logos sein? Durch ihn soll alles entstanden sein? Dann muß er wirklich Gott sein. In ihm, gemeint ist wohl: nur in ihm soll Leben sein? Dann muß er es zweimal sein, denn allein Gott kann Leben schaffen.
Dass Sie Ihre „naive Lektüre“ mit einem Hinweis auf „jedes griechische Kind“ einleiten, macht bereits deutlich, dass diese Leseweise von Grund auf griechisch geprägt ist, vielleicht ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. Sie fragen sich, ob das Ganze ein „Mythos von einem göttlichen Lichtwesen namens Logos“ sein kann, „dessen Licht in der Finsternis leuchtet“, zumal
es hier irgendwie um die Weltentstehung zu gehen scheint, um den Anfang aller Dinge: das ist klassischer Stoff des Mythos. Aber für einen Mythos ist das Ganze wieder zu abstrakt, zu philosophisch.
Aber da es dann um Johannes geht, „als Zeuge für das Licht, also auch für diesen Logos, damit alle – alle Menschen? – durch ihn zum Glauben, vermutlich zum Glauben an diesen Logos, dieses Licht, kommen sollten“, kann der Schluss gezogen werden, „daß dieser Logos ebenfalls ein Mensch war wie dieser Johannes.“
Weiterhin (S. 192) scheint der Logos „ein intellektuelles Licht“ zu sein, „das jeden Menschen erleuchtet“, er hat
irgendwie Eigentum, wohl auch Eigentum an Menschen, und Verwandtschaft in der Welt, die aber nichts von ihm wissen will und ihn glatt abweist.
Nur wer diesen Logos aufnimmt, „an ihn glaubt“, erhält als Lohn „Gott zum Vater“:
Wer auf diesen Lohn aus ist, muß allerdings ziemlich unirdisch gestrickt sein (nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes) und irgendwie neu gezeugt werden, nämlich aus Gott.
Als „unerträgliche Zumutung für den normalen Verstand“ interpretieren Sie dann den Satz: „Und der Logos wurde Fleisch“, da der „Geist“ niemals „zu Materie werden kann“. Hier ist ein Denkverbot der griechischen Philosophie mit Händen zu greifen.
Indem Sie schließlich auf seltsame Wendungen aufmerksam machen, dass „der fleischgewordene Logos“ unter uns „zeltet“ und dass „seine Herrlichkeit geschaut“ werden kann, „die dieser Logos als einziger Sohn Gottes von seinem Vater her hatte“, wird (S. 193) durch diese Ihre „naive Lektüre des Textes“ vollends deutlich, „daß er ziemlich viel an Insiderwissen voraussetzt.“
Dass auch noch „vom Gesetz die Rede [ist], das durch Mose gegeben wurde, während Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus gekommen seien“, zeigt dann letztendlich die Richtung an, in der dieses Insiderwissen zu suchen ist: ein einerseits durch die Tora des Mose bestimmtes Milieu, in der ein Mensch namens Jesus Christus andererseits inzwischen die alles entscheidende Rolle spielt.
Aus dem Ende des Johannes-Prologs in Johannes 1,18 ziehen Sie eine interessante Schlussfolgerung über diesen Jesus Christus:
Da niemand Gott je gesehen hat, hat dieser einzige Sohn die Auslegung für diesen Gott gebracht, sozusagen in eigener Person. Der Logos als Exeget Gottes: keine schlechte Idee.
↑ Von den Schwierigkeiten eines Heiden oder Juden, den Prolog des Johannes zu verstehen
Durch Ihre bisherige naive Lektüre machen Sie nach eigenem Bekunden deutlich, dass ein Heide wie Plutarch „die größten Schwierigkeiten gehabt“ hätte, den Aussagen des Johannes
auch nur der Spur nach zu folgen und sich einen Reim darauf zu machen. Aber auch ein gebildeter Jude wie Josephus hätte sich nur wenig leichter getan. Er hätte natürlich gemerkt, daß die ersten Worte eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht enthalten. Aber ein Logos, der selbständig agiert und von Gott einerseits unterschieden, andererseits aber doch mit ihm irgendwie eins sein soll, wäre ihm fremd und häretisch vorgekommen.
Das heißt, Sie halten nicht nur eine heidnische, sondern auch eine jüdische Lektüre für ungeeignet, den Johannes-Prolog zu verstehen, da ein Jude
- davon ausgehen würde, dass „Licht und Leben … doch allein Gott und nicht irgendein fleischgewordener Logos“ schenkt,
- die Entgegensetzung von „dem Gesetz des Mose auf der einen und Gnade und Wahrheit auf der anderen Seite“ nicht akzeptieren könnte und
- den „fleischgewordenen Logos … ebenso absurd gefunden [hätte] wie Plutarch.
Diese Einschätzung lasse ich erst einmal so stehen, werde aber später darauf zurückkommen.
↑ Ist die christliche Lektüre des Prologs die einzig mögliche?
Letztendlich halten Sie nur eine christliche Lektüre des Johannes-Prologs für sinnvoll:
Nur Christen, die Bescheid wissen und sich zu den „Wir“ zählen, die im Prolog als Sprecher auftreten, können sich an diesem Text begeistern. Hinter diesen Sprechern, die sich ganz unvermittelt und ohne alle Erklärung zu Wort melden, steht offenkundig auch der Autor dieses Textes.
Also Johannes, dessen Identität Sie erst später klären wollen, war in Ihren Augen ein Christ, der die „Herkunft Jesu“ wie die anderen Evangelisten auf Gott zurückführen wollte, aber nicht ohne „die Besonderheit dieser Gottessohnschaft näher zu bestimmen“. Indem er dazu (S. 194f.) „nicht ein ausgefallenes, schwieriges Wort oder einen philosophischen Begriff zu Hilfe“ nahm, „sondern eines der gewöhnlichsten Wörter der griechischen Sprache“, nämlich das Wort logos = „Wort“,
wurde er zu Johannes „dem Theologen“. Iōannēs ho theologos: Diesen Ehrentitel trägt der vierte Evangelist gewöhnlich auf Ikonen der Ostkirche.
Mit drei Aussagen über den Logos beginnt nun Johannes seinen Prolog, die in Ihren Augen alle drei für einen Juden ungeheuerlich sein müssen (S. 195f.):
„Im Anfang war der Logos.“ Wie kommt ein Jude darauf zu sagen, im Anfang sei nicht Gott, sondern der Logos gewesen? Das widerspricht doch dem ersten Satz der heiligen Schrift! Die zweite Aussage ist nicht weniger überraschend: Dieser Logos sei nicht in Gott gewesen, wie man zunächst denken würde, sondern bei Gott. Und dann heißt es drittens, dieser Logos sei göttlich oder Gott gewesen, griechisch: kai theos ēn ho logos. …
Es ist deutlich, daß wir hier einen der frühen Versuche vor uns haben, den christologischen Sachverhalt zu formulieren, der sich aus dem Grundparadox des Evangeliums ergibt: Gott kommt in einem konkreten Menschen zur Welt, der stirbt, wie nur ein Mensch sterben kann. Wie steht dieser Mensch zu Gott? Irgendwie muß er mit ihm eins sein und irgendwie muß er doch ein individueller Mensch sein. Um die Einheit mit Gott und die Eigenständigkeit als Mensch verständlicher zu machen, kam der Evangelist auf die Idee, ihn als den Logos zu bezeichnen und zu verstehen. Es war eine der fruchtbarsten Ideen der Theologiegeschichte. So kann der Evangelist seinen Prolog schließen mit einem Wort, das eine typische und wichtige Funktion des Logos bezeichnet: exēgeisthai „auslegen, die Auslegung geben“. Allein der Logos, der in innigster Beziehung zum Vater steht, kann als sein Exeget fungieren. Die Exegese, die er gibt, ist seine Geschichte auf Erden, die im Evangelium anschließend erzählt wird.
Diese Idee, Jesus mit dem göttlichen Logos zu identifizieren, führen Sie (S. 196) auf „die bereits vor ihm liegende christliche Tradition“ zurück. Wenn für Paulus, Markus und Lukas der Logos „das verkündigte Evangelium“ darstellte,
war es nur ein kleiner Gedankenschritt zu der Idee: Dieses Evangelium verkörpert im Letzten der Verkündiger selbst. Das aber ist der Grundgedanke des vierten Evangelisten, der sein ganzes Werk durchzieht.
↑ Geht Johannes, der Theologe, von einer griechischen Interpretation des Logos aus?
Um diesen Gedanken auszuführen, musste er Ihnen zufolge aber
nicht an irgendeinen philosophischen Sprachgebrauch an[knüpfen], er konnte vom alltäglichen Gebrauch des Wortes logos im Griechischen ausgehen. Es ist wirklich ein besonderes Wort, das nur die griechische Sprache kennt.
Das würde bedeuten: Johannes ist durch und durch geprägt von griechischem Denken und versteht auch das Wort „Logos“ von all dem her, was im Hellenismus mit diesem Begriff verknüpft ist. Zunächst zählen Sie seine ganze Bedeutungsbreite auf (S. 196f.):
Es bezeichnet das gesprochene oder geschriebene Wort, aber auch den Geist und Verstand des Menschen, der es bildet und hervorbringt. Wo aber ein Wort ist, da ist auch Ordnung, Struktur und verständlicher Sinn, und so sieht der Grieche im Umkehrschluß in allem, was Ordnung, Struktur und Sinn aufweist, logos walten. Das Wort kann also dreierlei bezeichnen: das sinnvoll Strukturierte der Dinge oder menschlicher Gedanken, das adäquate Verstehen dieser sinnvollen Strukturen sowie das Organ dafür und zum dritten das Wort, das solche Sachverhalte ausspricht oder aufschreibt. Wissenschaft ist von daher nichts anderes als den Logos einer Sache erforschen. So entstehen die vielen Logien: Biologie, Philologie, Soziologie, Theologie usw. Es kommt nicht von ungefähr, daß wir zur Bezeichnung so vieler Wissenschaften immer wieder auf dieses griechische Wort zurückgreifen müssen.
Somit ist (S. 197) der Logos „nach griechischer Auffassung“ das, was den Menschen vom Tier unterscheidet und womit er „alle Kulturleistungen hervorgebracht“ hat. Und zugleich ist der Logos „etwas Göttliches“,
denn die vorfindlichen Ordnungen und Strukturen in der Welt und am Himmel hat nicht erst der Mensch hineingelegt; die Ordnung des gestirnten Himmels zum Beispiel, die die Menschen des Altertums tief beeindruckt hat, finden wir vor und erforschen sie mit unserem Logos. So ist der Mensch durch seinen Logos mit dem göttlichen Logos in der Welt verbunden, der alles bestimmt und durchwaltet.
Aus all dem ziehen Sie den Schluss:
Es war eine kühne und geniale Idee, in Christus den inkarnierten Logos zu sehen. Das gab dem griechischen Wort eine ganz neue Dimension. Das griechische Wort hat aber nicht nur die Christologie befruchtet, sondern auch die Anthropologie zu neuen Zielen geführt. Wenn nämlich der Mensch per definitionem das zōon logon echon [= das Geist habende Lebewesen] ist, unter dem logos aber nun Christus verstanden wird, dann ergibt sich ganz logisch der Satz: Der vollkommene Mensch ist allein Christus als der Logos schlechthin, ein bestimmter Mensch aber ist nur insoweit vollkommener Mensch, als er Christus gleicht.
Ihre Argumentation, was den Prolog des Johannesevangeliums betrifft, ist so beeindruckend, dass es mir sehr schwerfällt, mein dennoch vorhandenes Unbehagen in klare Worte zu fassen. Was Sie da über den griechisch verstandenen Logos geschrieben haben, stimmt ja alles. Dass Johannes Jesus als die Verkörperung des von ihm (im doppelten Sinne: durch ihn und über ihn) verkündigten Evangeliums zu begreifen sucht und zugleich als den Exegeten Gottes selbst, der ihn sozusagen von innen her versteht, dem ist tatsächlich nicht zu widersprechen – und es ist eine geniale Leistung des Theologen Johannes.
↑ Auch der Evangelist Johannes schreibt zwar griechisch, ist aber jüdisch-hebräisch zu lesen
Aber nun war Johannes kein Grieche. Und auch wenn Sie die Möglichkeit, den Johannes-Prolog auf jüdische Weise zu lesen, im Vorübergehen sehr schnell als unmöglich abgetan haben, möchte ich nun doch auf eine Interpretation dieses Evangeliums eingehen, die genau das ernstnimmt: Dass dieser Johannes genau wie Lukas zwar griechisch schreibt, aber jüdisch-hebräisch denkt. Seine Begrifflichkeiten müssen zumindest daraufhin überprüft werden, inwiefern sie vom Bibelgriechischen der Septuaginta her zu verstehen sind. Eine solche Lektüre, die das Johannesevangelium nicht vom späteren, griechisch-philosophisch beeinflussten Christusdogma her liest, sondern vom befreienden NAMEN des Gottes Israels her, hat unter dem Titel „Der Abschied des Messias“ Ton Veerkamp (109) vorgelegt.
Insbesondere ist zu fragen, ob Ihre oben angeführten sechs Punkte, im Blick auf die der Prolog des Johannesevangeliums keine jüdische Lektüre zulasse, tatsächlich so zu interpretieren sind.
↑ 1. Kann Johannes als Jude im Widerspruch zum ersten Satz der heiligen Schrift gemeint haben, „im Anfang sei nicht Gott, sondern der Logos gewesen?“
Nein, das kann er nicht, und das tut er auch nicht. Und genau genommen ist natürlich auch einer christlichen Lektüre zufolge eindeutig Gott der Schöpfer und nicht der Logos im Gegensatz zu Gott, dem Vater. Allerdings kann ein Jude durchaus an Sprüche 8,22ff. denken, wo nach 8,1 zwar nicht der logos, sondern die sōphia = „Weisheit“ redet (110), und diese Worte auf den von Gott gesandten Messias beziehen:
22 Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her.
23 Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war.
24 Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen.
25 Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren,
26 als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens.
27 Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe,
28 als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe,
29 als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte,
30 da war ich beständig bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit;
31 ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern.
Natürlich hat nicht jeder Jude in Jesus den Messias erkannt. Und erst recht war es ein gewaltiger Schritt für einen Juden, in diesem Jesus, der ein Gottessohn nach jüdischem Verständnis war, „einer wie Gott“, den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert zu sehen, den man sogar mit Gott zusammen als Kyrios anbeten darf. Aber dennoch kann man Johannes noch nicht allein deswegen, weil er Jesus als den Logos mit Gott zusammen „im Anfang“ denkt, eine nicht mehr jüdische, sondern bereits christliche Denkweise im Sinne des späteren nicänischen Glaubensbekenntnisses unterstellen.
↑ 2. Was meint Johannes mit dem Satz, dass der Logos nicht in Gott, sondern bei Gott gewesen ist?
Zunächst ist die Frage, ob man die Wendung pros ton theon tatsächlich mit „bei Gott“ zu übersetzen hat. In der eben angeführten Bibelstelle Sprüche 8,30 steht par‘ autou = „bei ihm“, wie überhaupt im Alten Testament „bei Gott“ meist mit der Präposition para, nie mit pros ausgedrückt wird. Aber warum verwendet Johannes, wenn er diese Stelle in Erinnerung rufen will, stattdessen die Präposition pros mit dem bestimmten Artikel ton theon? Sie kommt im AT meist im Zusammenhang mit „zu Gott“ beten vor, mit Vertrauen „auf Gott“ oder Furcht „vor Gott“ haben oder „nach Gott“ dürsten. Manchmal geht es auch um eine Auflehnung oder Widerspruch „gegen Gott“.
Die Grundbedeutung von pros ist „auf … hin“; Veerkamp 3, S. 9, übersetzt in Johannes 1,1 mit „Das Wort ist auf GOTT gerichtet“, in Johannes 1,2 mit „Dieses ist im Anfang auf GOTT hin“, wobei er das Wort GOTT in Großbuchstaben schreibt, weil für Johannes das Wort theos mit bestimmtem Artikel immer den Gott Israels mit dem unaussprechlichen NAMEN JHWH meint. Nach Veerkamp 1, S. 9f. gilt also:
pros ton theon bedeutet also nicht auf Gott oder das Göttliche überhaupt hin, sondern auf einen bestimmten Gott, den Gott Israels, gerichtet. Die zwei Vokabeln ton theon, „den Gott“, bedeuten in unendlicher Verdichtung die spezifische, detailliert bestimmte Gesellschaftsordnung, die sich Israel in seiner Tora gegeben hat, eine Ordnung von befreiten Sklaven, von Autonomie und Egalität. Das Wort ist also auf den = diesen Gott gerichtet, also nur von dieser Schrift her verständlich. Das gilt für das Johannesevangelium und überhaupt für alle messianischen Schriften.
↑ 3. Kann Johannes als Jude den Logos als göttlich beschrieben bzw. mit Gott identifiziert haben?
Mit Gott identifiziert er ihn gerade in Johannes 1,1 jedenfalls nicht. Ich lasse noch einmal sehr ausführlich Veerkamp 1, S. 10f., zu Wort kommen:
Der dritte Satz lautet: „… gottbestimmt ist das Wort.“ Es handelt sich nicht um einen griechischen Urteilssatz nach dem Muster S = P. Das Wort ist nicht mit irgendeinem, Prädikat identisch, sondern es geschieht gottbestimmt. Der Artikel fehlt hier, deswegen nicht Gott, sondern gottbestimmt oder, wenn man will, göttlich. Natürlich ist das keine allgemeine Feststellung, das Wort hat keine allgemeine, göttliche Struktur, sondern eine spezifische: Das Wort vollzieht sich im Rahmen dessen, was in Israel der Gott heißt, und es wirkt wie (der) Gott. Dieses „wie Gott“ wird im Evangelium sachlich durch den Ausdruck „Sohn des Gottes“ (hyios tou theou) wiedergegeben. Ein im Denken der spätantiken Kultur geschulter Grieche des 3. oder 4. Jh. kann solche Sätze nicht anders als im Rahmen seiner Logik lesen, im Rahmen der abendländischen Logik überhaupt. Natürlich wird er seine Probleme haben. Der logische Satz das Wort = Gott scheint gegen den monotheistischen Hauptsatz der Schrift zu verstoßen. Er muß den Satz dann interpretieren. Er kennt die alexandrinische philosophische Tradition und ihren großen Höhepunkt, die Philosophie Plotins, er benutzt ihre wissenschaftlichen Kategorien, er hat ja gar keine anderen. Er muß fragen: „Welcher Art ist die Identität Wort = Gott?“ Manche interpretieren: Das Wort ist nicht Gott, sondern göttlich. Das sahen aber andere anders, und der Streit begann. Ist die Identität zwischen Gott und Wort als Wesensgleichheit oder als Wesensähnlichkeit, auf griechisch homoousios oder homoiousios, zu denken? Der Unterschied scheint subtil, das Problem ist wichtig. Ordnet man das Wort dem Gott Israels unter, reduziert man den Christus der christlichen Religion letztlich zu einem der großen Propheten Israels. Dem Judentum und später dem Islam gegenüber hätte das Christentum dann keine wesentlichen ideologischen Vorteile. Macht man aus dem Wort auf neoplatonische Weise eine der Emanationen des Einen (to hen), verliert das Christentum der Spätantike gegenüber seinen einmaligen Charakter. Das Christentum sollte aber nach 323 – in dem Jahr übernahm Konstantin die Alleinherrschaft über das Reich – die Rolle einer einzig legitimen und universalen – oder besser gesagt: hegemonialen – Reichsideologie spielen. Nachdem die spätantike Kultur unter Kaiser Julianus (361-363) noch einmal und vergeblich versucht hatte, das verlorene Terrain zurück zu erobern, wurde sie als Heidentum unter Theodosius (379-395) verboten. Das Christentum hatte das Rennen gemacht, das christliche Mittelalter, basierend auf der neu organisierten Ausbeutung bäuerlicher Arbeit (Kolonat), begann. Mit der plotinischen Übersetzung und Deutung des Satzes „und das Wort ist Gott“ war das Christentum in seinem Bereich, Byzanz, dem Abendland, ideologisch hegemoniefähig geworden. Seitdem können wir kaum noch anders, als Johannes 1,1-18 griechisch zu lesen. Unsere Lektüre hier ist aber orientalisch, wenn man will.
Ich zitiere so lang und breit, um verständlich zu machen, dass die von Ihnen vorgestellte Interpretation des Johannes-Prologs eben wirklich einer griechischen Lektüre entspricht. Zwar lesen Sie Johannes nicht heidnisch-ablehnend (wie Kelsos) oder heidnisch-wohlwollend (wie Plutarch es möglicherweise tun würde), sondern heidenchristlich, denn auch die griechisch gebildeten Heidenchristen haben ja die Evangelien eben als Heiden und als Griechen gelesen. Zwar wissen Sie um die jüdischen Wurzeln des Johannesevangeliums, aber Sie nehmen seine jüdisch-hebräische Sprach- und Denkstruktur zu wenig ernst und unterstellen im Grunde schon dem Johannesevangelium eine griechische Denkweise. (111)
↑ 4. Wie kann im Logos Leben sein, wie der Logos Licht sein, wenn jüdisch gesehen nur Gott Licht und Leben schenkt?
Auch zum Stichwort Licht möchte ich auf Gedanken aus Veerkamp 1, S. 12, zurückgreifen. Er stellt fest, dass die „menschliche Wirklichkeit“ als „konkrete Geschichte“ durch den Widerspruch „Leben/Licht gegen Nichts/Finsternis“ gekennzeichnet ist, von dem bereits grundlegend in der Schöpfungserzählung die Rede war, auf die Johannes 1,1 in seinen ersten beiden Worten „Im Anfang“ anspielt:
Bevor wir dort das Wort Licht überhaupt hören, bevor überhaupt ein Wort gesprochen wird, hören wir in der Schöpfungserzählung das Wort Finsternis. Bevor aus dem Himmel und der Erde Schöpfung wird, muß die Finsternis in ihre Schranken gewiesen werden, genauso wie das Chaosmeer. …
Es gibt freilich auch eine von Menschen verursachte Finsternis. Wir hören Jer 4,23-26:Ich sah das Land, da, irr und wirr,
den Himmel: Keins seiner Leuchten!
Ich sah die Berge, da, erschüttert,
alle Hügel, sie walzen sich um.
Ich sah, da, keine Menschheit mehr,
alle Vögel des Himmels verflogen.
Ich sah, da, Weinberg ist Wüste,
Städte zerstört,
vor dem Antlitz des NAMENS,
vor dem Antlitz der schnaubenden glühenden Wut seiner Nase.Hier wird der Zustand eines von Krieg verheerten Landes beschrieben mit dem Zustand einer Erde vor jedem schöpferischen Wort: Irr und wirr, kein Licht, keine Menschheit, keine Vögel, alles verwüstet, und zwar wegen der törichten Politik der Eliten Jeruschalajims, ihrer Verweigerung, das Reformwerk des guten Königs Joschijahu (Josia) zu bewahren und die Machtverhältnisse in der Region zu beachten. Das Ergebnis dieser Politik ist das Nichts und die Finsternis. Der Prophet kann das nur als Resultat der zornigen Reaktion des Gottes Israels verstehen. Wenn die Ordnung der Tora, die ja für Israel „Gott“ ist, durch die Politik seiner Eliten zerstört wird, reagiert diese Ordnung mit dem Zorn ihres Zerstörtseins. Es geht nicht um einen mythischen Urzustand, es geht um das, was die Menschen um Johannes damals und was wir heute täglich sehen: Finsternis, Chaos, Zerstörung des Lebens.
Was Jirmejahu (Jeremia) beschreibt, ist genau der Zustand des Volkes Jehudas nach dem Jahr 70. Die Stadt ist verwüstet, die Bevölkerung massakriert, das Land unbewohnbar. Was not tut, ist ein vollkommener Neuanfang. Von der Katastrophe des Jahres 70 führt kein Weg mehr zurück, nichts wird mehr sein, was je war. Wegen des aktuellen Zustandes muß jemand, der wie Johannes das Jahr 70 als das Ende deutet, mit den Worten im Anfang beginnen. Das Werk des Messias ist eine neue Erde unter einem neuen Himmel, Leben und Licht. Die Finsternis hat nicht gewonnen: Das Verb, das hier auftaucht, katalambanein, „überwältigen“, hat in der griechischen Version der Schrift immer eine gewalttätige Konnotation. Gegen das Nichts und die Finsternis, die seit dem katastrophalen Ausgang des judäischen Krieges 66-70 herrschten, holt Johannes „Licht“ und „Leben“ hervor: die Finsternis hat Licht und Leben nicht überwältigt.
So konkret, so politisch, so befreiend kann eine jüdisch-hebräische Lektüre zweier Worte aus dem Johannes-Prolog aussehen.
↑ 5. Wieso empfindet der Jude Johannes einen „fleischgewordenen Logos“ nicht als absurd? Weil er kein Jude mehr ist?
Auch zu diesem Thema würde sich ein ausführlicher Ausflug in die Ausführungen Ton Veerkamps lohnen. Ich beschränke mich darauf, nur einige wenige Sätze aus Veerkamp 1, S.20, zu zitieren:
Das Unglück der Johannesexegese besteht bis heute darin, daß man Johannes von den Konzilen in Nicäa und Chalcedon her zu lesen gewohnt ist, statt umgekehrt die Dogmatik der Überprüfung durch Johannes, durch die Schrift überhaupt, zu unterziehen. Zur Ehrenrettung der klassischen Dogmatik muß freilich gesagt werden, daß die Theologen des 4. und 5. Jh. ihre Arbeit gut gemacht haben. Ihr Kompromiß hatte bis in die Neuzeit gehalten, und wir können von ihrer Genauigkeit und ihrer Leidenschaft unendlich viel lernen. Wir dürfen ihre Sätze aber nicht zu ewiger Wahrheit machen.
Wird zur Auslegung von Johannes 1,14 (nach Veerkamp 1, S. 20: „Das Wort geschieht als Fleisch“) aber nun ernstgenommen, dass Johannes „kein Grieche, sondern ein Kind Israels [ist], das im Gebäude der Großen Erzählung zu denken gelernt hat“, dann kann man wie Veerkamp 1, S. 20f., schreiben:
Johannes 1,14 sagt: Der Messias ist ein konkreter Mensch, und dieser Mensch macht die Wahrheit des Satzes Jes 40,6 aus: „Das Wort unseres Gottes steht in Weltzeit.“ Wie damals das Wort in den Worten des Mosche Gestalt annahm, so nimmt jetzt das Wort in der konkret-historischen Existenz eines ganz bestimmten Jehuden, der in den politischen und ideologischen Kämpfen seiner Tage eine ganz bestimmte Position vertrat, Gestalt an. … Das Wort wurde nicht Fleisch, nicht Mensch überhaupt, sondern jüdischer Mensch, und nicht … zum jüdischen Menschen überhaupt, sondern zu einem ganz bestimmten Juden, der in den konkreten politischen Auseinandersetzungen seines Volkes eine ganz bestimmte Stellung eingenommen hatte, eine Stellung, die ihn in einen tödlichen Gegensatz zu den Eliten seines Volkes und zu Rom als Besatzungsmacht brachte. Gerade bei Johannes ist der Messias als dieser konkrete Mensch leidenschaftlich Partei in diesen Auseinandersetzungen. Schüler eines solchen Messias zu sein, heißt bei Johannes: Kampfgefährte, Fleisch und Blut des Messias zu werden, „sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken“, an seiner konkreten menschlichen Wirklichkeit und seinen politischen Kämpfen teilzuhaben und demzufolge von der herrschenden Weltordnung gehaßt zu werden.
Eine solche kämpferische, politische Auslegung des Johannesevangeliums mag uns Christen vollkommen gegen den Strich gehen (vielleicht ist sie in Einzelheiten auch überspitzt). Aber ich halte sie dennoch für sehr erwägenswert, da es doch sehr seltsam wäre, wenn ein Jude des 1. Jahrhunderts bereits von den christlichen Dogmen des 4. Jahrhunderts her denken würde. Zwar ist es sehr schwer, sich entgegen der Tradition einer seit Jahrtausenden durch griechisch-philosophische Begriffe geprägte heidenchristliche Kirche auf eine jüdisch-hebräische Lektüre des Neuen Testaments und insbesondere des Johannesevangeliums einzulassen. Aber ich denke, ein solcher Versuch lohnt schon deswegen, um den Antijudaismus des Christentums nachhaltig zu überwinden.
In diesem Zusammenhang halte ich es für aufschlussreich, auf den Abschluss Ihrer Auslegung des Johannes-Prologs einzugehen (S. 200):
Daß Johannes die Gottheit Christi noch einmal anders und stärker akzentuiert als die Synoptiker, ist sicher richtig, aber auch er löst das christliche Grundparadox in keiner Weise auf. Nirgends ist dieses Grundparadox so konzis und hart formuliert wie in dem berühmten Satz vom Logos, der Fleisch geworden ist (Joh 1,14). Kein Philosoph, der nur Philosoph bleiben will, kann diesen Satz akzeptieren. Er ist bis heute der große Stolperstein der Intellektuellen, die sich mit dem Evangelium schwer tun. Aber er ist nun einmal das Zentrum des christlichen Glaubens. Johannes selbst bezeichnet ihn in seinen Briefen als das entscheidende Kriterium der Rechtgläubigkeit (1 Joh 4,2; 2 Joh 7).
Grundsätzlich haben Sie zwar Recht mit Ihrer Einschätzung, dass das „christliche Grundparadox“ auch bei Johannes nicht in Richtung einer einseitigen Vergottung Jesu aufgelöst wird. Indem Sie aber die Fleischwerdung des Logos als ein intellektuelles Problem „der“ Philosophen interpretieren, das letztlich nur durch einen christlichen Glauben, der die eigene Verstandeshürde überspringt, überwunden werden kann, gerät Ihnen – wie überhaupt der überwiegenden Mehrheit christlicher Theologen! – völlig aus dem Blick, dass für Johannes der göttliche Logos des Gottes Israels in der Weise „Fleisch wird“ oder (wie Veerkamp sagt), „als Fleisch geschieht“, indem er dieser bestimmte jüdische Mensch wird, der auf dieser Erde unter dem Himmel den befreienden NAMEN dieses Gottes verkörpert.
↑ 6. Wie versteht Johannes die durch Jesus Christus gewordene Gnade und Wahrheit im Gegenüber zur Tora des Mose?
Aber muss man nicht doch bereits dem Johannesevangelium eine antijüdische Haltung unterstellen, wenn nach Johannes 1,17 die „Gnade und Wahrheit … durch Jesus Christus“ so scharf der Tora des Mose gegenübergestellt wird? Nochmals lehrt uns Ton Veerkamp, sehr genau hinzuschauen, um zu erkennen, dass hier nicht ein Christ sozusagen von außen vom Judentum Abschied nimmt, sondern ein scharfer innerjüdischer Streit ausgetragen wird. Er geht dabei von der Auslegung des Verses Johannes 1,16 aus, der nach Luther folgendermaßen übersetzt wird:
Von seiner [des „Wortes“] Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Veerkamp 1, S. 24, nimmt nun ernst, dass erstens das Wort charis = „Gnade“ von der Bedeutung des hebräischen Wortes chessed her als „Solidarität“ zu verstehen ist, und zweitens, dass Johannes in der Wendung charin anti charin die Präposition anti = „gegen“ benutzt:
Das Pronomen wir zeigt, daß „Johannes“ für die Gruppe insgesamt spricht. Aus der Fülle des Messias „nehmen wir alle, ja, Solidarität für (statt, anti) Solidarität“. charis steht hier wieder für chessed. Die Solidarität mit Israel wird ersetzt (anti), und zwar durch eine neue Gestalt der Solidarität. Die Solidarität Gottes mit Israel zeigte sich in der Tora (nomos) durch Mosche. Die Peruschim [= „die Abgesonderten“ = Pharisäer] sagten zum geheilten Blindgeborenen: „Wir sind die Schüler des Mosche“ (9,28). Das bedeutet, daß Mosche ihr Lehrer ist, Mosche rabbenu. Letzteres ist geradezu die Definition des rabbinischen Judentums. Die Solidarität Gottes mit Israel ist in diesem Judentum ausschließlich die Tora des Mosche. Diese Tora beschreibt die Ordnungen, in denen das Volk Israel leben will. Diese Ordnungen sind heilsam, sie ermöglichen ein menschliches Leben in Israel. Diese Gesellschaftsordnung von Autonomie und Egalität ist/war die Solidarität Gottes. Ist sagt das rabbinische Judentum. War, sagt Johannes. Denn die Umstände – und wahrlich die weltweiten, globalen Umstände – haben sich so geändert, daß die Gesellschaftsordnung der Tora politisch nirgendwo mehr durchführbar ist. Die Tora ist jetzt das mandatum novum, die Solidarität, die agapē der Schüler des Messias untereinander. Also nicht die allgemeine Menschenliebe, sondern der Zusammenhalt der Gruppe unter allen, auch unter den widrigsten Umständen. So geschieht heute die bleibende chessed we-emet, charis kai alētheia [= „Gnade und Wahrheit“ = „Solidarität und Bewährung“] des Gottes Israel durch den Messias Jeschua. Ist das eine neue Tora? Es scheint so: „Was nun als Tora durch Mosche gegeben wurde, das geschieht als solidarische Treue (chessed we-emet) durch Jeschua Messias“ (1,17). Man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen, denn dieser Satz heißt: Solidarische Treue Gottes Israel gegenüber bleibt auch dann, wenn die Tora unter den tatsächlichen Umständen keine konkrete Lebensmöglichkeit mehr ist. … Johannes redet nicht von einer neuen Tora (nomos kainos), sondern von einem neuen Gebot (entolē kainē). Johannes redet freilich sehr distanziert von der Tora („eure Tora“ 8,17; 10,34; „ihre Tora“ 15,25). Gleichzeitig aber bleibt die Tora (oder die Schrift) für Johannes davar, logos, Rede, die erfüllt werden muß. Erfüllen bedeutet für Johannes nicht erledigen (vgl. 19,24.28).
Das heißt also, wie bereits der Apostel Paulus als Jude nicht das Ende der guten Tora des Mose als solche im Sinn hatte, sondern in Tod und Auferstehung des Messias Jesus die trennende Wirkung der Tora zwischen Juden und Gojim (= Menschen aus den Völkern) als aufgehoben betrachtete (112), geht auch der Jude Johannes mit der Tora des Mose differenziert um. Der Messias Jesus ist durch den Gott Israels auf eine ganz neue Art und Weise dazu bestimmt, die Ziele der Tora in Erfüllung gehen zu lassen.
↑ Johannes der Täufer als der Zeuge für den Messias Jesus
Nach dieser langen Klärung der verschiedenen Arten, den Prolog des Johannesevangeliums zu lesen, möchte ich nur noch auf zwei Punkte Ihrer Interpretation des Prologs eingehen.
Uneingeschränkt Recht gebe ich Ihnen darin (S. 198), dass Sie es ablehnen, literarkritisch „aus dem Prolog einen älteren Logoshymnus herausoperieren [zu] wollen“, und dabei
als erstes die Täuferpassagen weg[zustreichen]. Aber die ganze Jagd nach dem vermeintlichen Hymnus ist die Jagd nach einem Phantom und zerstört den sorgfältig strukturierten Text des Evangelisten.
Denn zu Recht ist für Sie Johannes „der Täufer“ wie „bei den Synoptikern der große Zeuge für Christus“. Während diese ihn „aber nirgends mit diesem Begriff“ bezeichnen, „legt ihn“ der Evangelist Johannes
sozusagen ganz auf diese Rolle fest. So erscheint der Täufer in seinem Evangelium als der Zeuge Christi schlechthin und wird damit zu einer Identifikationsgestalt für jeden Christen.
Kritisch sehe ich allerdings Ihren Blick auf die „doppelte Perspektive“ des Johannes-Prologs, die angeblich durch das Zeugnis des Johannes entsteht:
Die eine, die des Logos, schaut vom Himmel her auf die Welt; die des Täufers schaut umgekehrt aus dem Irdischen hinaus zum Himmel. Der Logos kommt von oben, aber unten im irdischen Bereich hält man Ausschau nach ihm.
Hier muss man sorgfältig darauf achten, was mit diesem „oben“ gemeint sein soll. Es wäre grundverkehrt, den Logos bei Johannes neuplatonisch als Emanation eines unveränderlichen ewigen Gottes zu verstehen oder gar gnostisch als ein Lichtwesen, das auf die Erde kommt, um in der bösen Materie gefangene Lichtfunken in den Himmel zu holen. Indem Johannes hebräisch-jüdisch denkt, ist es nicht sein Ziel, die Menschen in den Himmel aufsteigen zu lassen, sondern vom Himmel her setzt der Gott Israels durch seinen Messias Jesus ein befreiendes Geschehen in Gang, durch das sein Volk Israel auf der Erde unter dem Himmel in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden leben kann.
↑ Warum lehnt es der johanneische Täufer ab, Elia zu sein?
Mit der Aussage Johannes des Täufers in Johannes 1,21, er sei nicht der Prophet Elia, kommen Sie nicht zurecht, da doch die anderen Evangelien ihn (mehr oder weniger) mit Elia in Verbindung bringen (S. 200): „Will der vierte Evangelist dieser Überlieferung widersprechen?“ Sie meinen, dass der Täufer einfach alle Fragen der „Kommission, die von der Jerusalemer Tempelaristokratie geschickt ist“ (S. 201),
mit Nein [beantwortet], weil er das hinterhältige Spiel durchschaut. Nachdem die Schublädchen alle gezogen sind, stellt die Kommission endlich eine vernünftige Frage: „Was sagst du denn über dich selbst?“ Da antwortet der Täufer, wie wir es erwarten: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des HERRN!“ (Joh 1,23) Das ist natürlich nicht die Antwort, die die Frager hören wollten.
Nach Veerkamp 1, S. 30, sollte man die Haltung des Täufers bei Johannes aber nicht mit derjenigen bei den Synoptikern zu harmonisieren versuchen. Er nimmt seine Aussage, er sei nicht Elia, ernst und versteht seinen Rückverweis auf Jesaja 40,3: „Ich bin Stimme eines Rufenden: in der Wüste bahnt den Weg für den NAMEN“ als Verdeutlichung seiner wahren Identität:
Das Jesajazitat sagt, Jochanan [= Johannes] sei wie der Prophet Jeschajahu [= Jesaja]; so wie dieser damals in Babel etwas ungehört Neues ankündigte, so ist Jochanan der, der heute, in der Zeit der Römer, Neues ankündigt. Die Parallele ist die zwischen der Befreiung aus Babel und der Befreiung von Rom.
↑ Die „zehnte Stunde“ – bloß eine historische Anmerkung?
Im Zusammenhang mit der Berufung der ersten Jünger wollen Sie darauf hinaus, dass gewisse Angaben des Evangelisten Johannes auf genaue historische Kenntnisse zurückgehen (S. 203):
Auffällig ist die Angabe in 1,39: „Es war ungefähr die zehnte Stunde.“ Sie ist offensichtlich historisch gemeint, nicht in einem symbolischen Sinn (vgl. 4,6; 19,14). Dann müßte sie aber auf die Erinnerung eines Beteiligten zurückgehen.
Mir ist allerdings nicht klar, woher Sie die Sicherheit nehmen, dass Johannes an diesen Stellen „offensichtlich“ ein historisches Interesse hat, eine bestimmte Einzelheit aus den Tagen Jesu zu überliefern. Zu welchem Zweck sollte er das tun? Es mag zwar schwierig sein, einen symbolischen Sinn dieser Zeitangaben zu bestimmen, aber was Veerkamp 1, S. 38f., dazu zu sagen weiß, halte ich für sinnvoller, als nur eine beiläufige historische Notiz anzunehmen:
Johannes verwendet das Wort „Stunde“, hōra, 26mal. Achtmal sind bestimmte Stunden des Tages gemeint, dreimal davon mit einem Zahlwort. Die übrigen Stellen bezeichnen den festgelegten Zeitpunkt, an dem etwas Bestimmtes passieren soll. Hier ist das griechische Wort hōra bedeutungsgleich mit kairos [= Zeitpunkt]. Wenn man von dem umstrittenen Vers 5,4 absieht, kommt letzteres nur an einer Stelle vor, dort aber gleich dreimal, in 7,6.8. Siebenmal ist ausdrücklich von der „Stunde Jeschuas“ die Rede, also jenem festgelegten Zeitpunkt, an dem Jeschua „geehrt“ werden soll. Vier ganz bestimmte Stunden werden mit einem Zahlwort hervorgehoben. Die sechste Stunde war die Stunde, wo Jeschua sich beim Jakobsbrunnen in Schomron (Samaria) hinsetzte (4,6); hier ruft der Messias die Leute von Schomron zur Einheit Israels zurück. Die siebte Stunde war die Stunde, in der der Sohn des königlichen Beamten geheilt wurde (4,52). Die sechste Stunde wird ein zweites Mal erwähnt; sie ist bei Johannes nicht der Augenblick, wo das ganze Land in Finsternis gehüllt wird, sondern der Augenblick, in dem Pilatus den gefolterten Jeschua herausführte mit den Worten: „Da, euer König!“ (19,14) Die zehnte Stunde war die Stunde des „kommt und seht“. Kommen ist eine Einladung, sehen eine Aufforderung. Hier geht die Einladung an die, die nicht durch ihre Vorurteile geblendet sind.
Genaue Stundenangaben dienen dem Johannes also dazu, bestimmte Schlüsselszenen seiner Erzählung besonders zu betonen.
↑ Ist Jesus ein Parapsychologe? Nein, ein Friedensstifter!
Im Zusammenhang mit einer weiteren Jüngerberufung lassen Sie die Bemerkung fallen (S. 204):
Den skeptischen Natanaël überzeugt Jesus dann durch sein übernatürliches, seherisches Wissen. Dieser Jünger ist den Synoptikern ganz unbekannt, er begegnet nur in Joh 21,2 noch einmal. Historisch gesehen stehen wir mit ihm vor einem Rätsel.
Schade, dass Sie diesen Jünger mit zwei simplen Hinweisen auf eine übernatürliche Kraft Jesu und ein historisches Rätsel so kurz abfertigen. Dabei ruft Johannes in den Versen 1,45-51 eine Unmenge an Schriftworten auf, die von dieser Begegnung mit Nathanael her ein helles Licht auf Jesus als den Messias, Gottessohn und König von Israel sowie den Menschensohn werfen.
Nathanael als „rechter Israelit“ steht nach Veerkamp 1, S. 41, für diejenigen Juden, die ernsthaft nach dem Messias Israel fragen, aber daran zweifeln, ob sich „die Messianität Jeschuas aus der Schrift … nachweisen läßt“, denn (Johannes 1,46): „Was kann aus Nazareth Gutes kommen!“ Weiter schreibt Veerkamp:
Philippos antwortet, wie Jeschua auf die Frage der ersten beiden Schüler geantwortet hat: „Komm und sieh!“ Und Natanel wird sehen, weil Jeschua sieht, eben wie Natanel auf ihn zukommt; er sagt über ihn: „Sieh, einer der getreu (Adverb!) Israelit (Adjektiv) ist, in ihm ist keine Tücke.“ …
Natanel fragt, wo Jeschua ihn als Kind Israel ohne Tücke erkannt hat. Der Tückische ist der absolute Gegensatz zu dem, der in Israel „Bewährter“ (zaddiq) genannt wird. „Als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen“, sagt Jeschua. Die Phantasie geht dann mit vielen Auslegenden durch, Jeschua habe gesehen, was ein normaler Mensch nicht sehen konnte, irgend etwas, was Natanel heimlich unter jenem Feigenbaum trieb… Nein, die angebliche Verblüffung Natanels über parapsychologische Fähigkeiten Jeschuas enthüllt die Ahnungslosigkeit der Exegeten. Jeschua antwortet nicht direkt auf die Frage, er verkündigt vielmehr seine Vision: „Friede für Israel“. Im Goldenen Zeitalter Israels, als König Schlomo noch ein tadelloser Mann war, hieß es, 1 Kön 5,4f.:
Friede war mit ihm [Schlomo] von allen Seiten ringsum.
Und Jehuda und Israel siedelten in Sicherheit,
jedermann unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum,
von Dan bis nach Beer-Schevaˁ,
alle Tage Schlomos.Diese Vision hatte auch der Verfasser des ersten Buches der Makkabäer; während der Regierung des Fürsten Schimon Makkabi saß „jedermann unter dem Weinstock und unter seinem Feigenbaum“ (14,12)…
Das heißt nach Veerkamp 1, S. 42:
Ein Israelit ohne Tücke ist ein Israelit, der nur eins will: Friede für Israel. Dasein unter dem Feigenbaum ist die Friedensvision des Messias und die Herzensangelegenheit Natanels. (113) Natanel begreift sofort, was Jeschua ihm sagt. Jeschua, der Lehrer, sei „wie Gott“ und „König über Israel“, wie Schlomo ben Dawid und Schimon, der Bruder Jehuda Makkabis. Das ist kein formelhaftes Bekenntnis, sondern eine inhaltliche Aussage über Jeschua.
Allerdings macht Jesus in Johannes 1,50-51, das Gespräch mit Nathanael abschließend, deutlich, dass seine Ziele dennoch ein anderes ist, als einfach an „die großen alten Tage Israels“ anzuknüpfen.
Natanel vertraut darauf, daß er „unter dem Feigenbaum“ sein wird, daß er Frieden erleben wird, und Frieden ist mehr als die Abwesenheit offenen Krieges, Frieden ist Sicherheit, und die ist unter Königen wie Schlomo oder Schimon nicht wirklich zu haben. Das plastische Bild für das Leben in Sicherheit ist Sitzen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Aber diese Sehnsucht ist nicht genug. Es gibt ein Problem der Weltordnung, das durch diesen Frieden nicht gelöst wird. Zwischen der Vision der Belebung und Vereinigung Israels Ez 37 und den Blueprint für den Wiederaufbau Israels Ez 40-48 steht der Text über Gog aus Magog. Dieser kommt „gegen ein Land von Bauern, auszuplündern Leute, die in Sicherheit siedeln. Alle siedeln sie ohne Mauern, weder Riegel noch Türen haben sie“ (Ez 38,11). Solange es Gog aus Magog gibt, solange gibt es keine wahre Sicherheit. Was ist größer als Frieden für Israel? Eine Weltordnung des Friedens.
Es hat mich zunächst gewundert, welche weiten Bögen Ton Veerkamp innerhalb der Heiligen Schrift spannt, um das Gespräch Jesu mit Nathanael auszulegen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto einleuchtender erscheint es mir aber, dass dem Juden Johannes eine solche weltweite Vision des Friedens durchaus zuzutrauen ist – und dass er genau mit dieser Überschreitung der Vision eines Friedens für ein wiederhergestelltes Großreichs Israel in Konfikt sowohl mit zelotisch gesinnten Juden als auch mit dem rabbinischen Judentum kommen muss.
Mit einem komplexen „Zitat aus der Schrift, das sich auf drei Stellen bezieht, Ez [Hesekiel] 1,1, Gen [1. Mose] 28,12 und Dan[iel] 7,12“, deutet Jesus sodann in äußerster Verdichtung an, in welcher Weise eine „Weltordnung des Friedens“ möglich ist (Veerkamp 1, S. 43):
Mit den Wolken des Himmels kommt etwas, was noch nie war: die Macht des Humanen, verkörpert durch das Volk der Heiligen des Höchsten, durch Israel (Dan 7,27). Und dieses Humane ist zugleich Maß des Rechts und Vollstrecker des Rechts. Die Verkörperung dieses Israels, dieses bar enosch, dieses MENSCHEN, ist für Johannes der Messias Jeschua ben Joseph aus Nazareth. Immer wenn wir bei Johannes den Ausdruck bar enosch, „Menschensohn“, hören – wir schreiben „MENSCH“ -, müssen wir diese Vision mithören.
↑ Ist Johannes Zebedäus der Autor des Johannesevangeliums?
Im Zusammenhang mit den Berufungen der Jünger durch Jesus meinen Sie (S. 204) die Autorschaft des Johannesevangeliums auf den Jünger Johannes zurückführen zu können. Warum?
- Sie gehen davon aus, dass Johannes den Namen des Täuferjüngers, „der zusammen mit Andreas zu Jesus wechselt“, bewusst verschwiegen hat.
- Dasselbe gilt dann für den ebenfalls anonymen Jünger, „der mit dem Hohenprieser bekannt ist und deshalb mit Petrus zusammen in dessen Hof gelangen kann; er wird dort lediglich als ein ‚anderer Jünger‘ bezeichnet (18,15f). Die Annahme, daß er derselbe ist, der mit Andreas zusammen zu Jesus kam, liegt nahe.“
- Schließlich „tritt im 4. Evangelium … ein weiterer nicht namentlich genannter Jünger auf…, der als ‚der Jünger, den Jesus liebte‘ charakterisiert wird. Er ist offenbar eng verbunden mit Petrus (114). Dieser Jünger wird von den Herausgebern des Evangeliums in 21,24 als Autor des Evangeliums bezeichnet. Wenn er im Abendmahlssaal an Jesu Brust lag (13,23f), muß er einer der Zwölf sein.“
- Da nun „die Zebedäussöhne Jakobus und Johannes zusammen mit Petrus nach den Synoptikern den engsten Vertrautenkreis Jesu“ bildeten, was „historisch sicher richtig“ ist, „kommt eigentlich nur ein Name für unseren Anonymus in Frage: der Zebedäussohn Johannes, der später in der Urgemeinde eine führende Position inne hatte. (115)“
- Aber warum (S. 204f.) werden „ausgerechnet die Namen dieses Brüderpaars im Johannesevangelium nie genannt“ (außer „im Nachtragskapitel (21,2)“, wo sie „buchstäblich aus dem Nichts auftauchen“)? „Der Grund für dieses merkwürdige Schweigen, eine regelrechte Verschleierung, ist meines Erachtens die Bescheidenheit und Zurückhaltung des Autors. Er kann unmöglich ‚ich, der geliebte Jünger‘ sagen, will aber auch nicht wie Cäsar im Bellum Gallicum von sich selbst in der dritten Person sprechen. Da blieb nur dieser Ausweg.“
An späterer Stelle ergänzen Sie Ihre Einschätzung mit der Frage (S. 227), wo ein Autor wie derjenige des Johannesevangeliums „die Selbstsicherheit und Autorität“ hergenommen haben kann, „mit der er eine so von der Tradition abweichende Darstellung vorträgt“ und den Anspruch erhebt, „eine Wesensschau dieser Person [nämlich Jesu] zu geben“. Dass das „Johannesevangelium … unmittelbar nach seiner Veröffentlichung kirchlich anerkannt und rezipiert“ wurde, wäre kaum denkbar gewesen, „wenn der Autor des vierten Evangeliums ein unbedeutender Jünger Jesu war, der nicht zu seinen engsten Vertrauten gehört hat“.
Auf den ersten Blick klingt das plausibel. Aber passt der gesamte Aufbau des Johannesevangeliums mit seinen ausgeführten Jesusreden zu der Annahme, hier würde ein Augenzeuge aus dem Nähkästchen seiner persönlichen Erfahrungen mit Jesus plaudern? Vor allem steht die Tatsache, dass Sie den Evangelisten Johannes recht konsequent als griechisch geprägten christlichen Theologen skizzieren, in einem gewaltigen Widerspruch zum politisch-religiösen Hintergrund, den man für den palästinensichen Fischer Johannes Zebedäus voraussetzen muss und der doch gewiss kein Vertreter des hellenistischen Bildungsbürgertums war.
Von daher dürfte es klüger sein, auf eine Identifizierung des Autors des Johannesevangeliums ganz zu verzichten.
↑ Zwei Namenlose im Johannesevangelium: der geliebte Jünger und die Mutter des Messias
Einen inhaltlich weiterführenden Hinweis zur Frage der Identifikation des geliebten Jüngers im Johannesevangelium findet Ton Veerkamp in der Szene unter dem Kreuz Jesu (Veerkamp 2, S. 102f.). Dort begegnet nach Johannes 19,26f. der anonyme geliebte Jünger Jesu der im Johannesevangelium ebenso namenlosen Mutter des Messias (anwesend sind außerdem die Maria des Klōpas und Maria Magdalena):
Der Schüler, dem Jeschua freundschaftlich verbunden war, ist der Schüler, der sich an die Brust Jeschuas lehnte, 13,25, der am offenen Grab sah und vertraute, 20,8, der den Herrn erkannte, 21,7, der bleibt, bis der Messias kommt, 21,22, und er könnte auch identisch mit dem „anderen Schüler“ gewesen sein, der im Gerichtshof Channans [= des Hannas] war, 18,16. … Die Mutter Jeschuas hat bei Johannes keinen eigenen Namen; wir hören bei ihm nie, daß sie Maria(m) heißt. Das muß eine Bedeutung haben, denn der Name des Vaters Jeschuas wird von Johannes angegeben (1,45; 6,42). Die Mutter des Messias … ist … die Mahnende, die immer die messianische Gemeinde dazu anhalten soll, das zu tun – und nur das -, was Jeschua sagt. Die Mutter des Messias soll den „geliebten“ Schüler Jeschuas als Sohn annehmen, dieser jene als Mutter. Auch der Name des geliebten Schülers wird nicht erwähnt. Beide Namenlosen, die Mutter des Messias und der geliebte Schüler, sind buchstäblich Prototypen. Die Mutter repräsentiert die messianische Gemeinde als solche, der geliebte Schüler den Schüler (und die Schülerin) als solche(n). Die Mutter des Messias, die messianische Gemeinde, ist die Mahnende: „Was er euch sagen wird, das sollt ihr tun!“ Als Mahnende ist sie die autoritative Instanz dem Schüler gegenüber. Der Schüler muß sie, die Gemeinde, als Mutter, eben als jene autoritative Instanz, annehmen. Die beiden anderen Frauen dienen hier als Testamentzeugen: Es handelt sich also um die letzte Verfügung des Messias. „Ab dieser Stunde nahm der Schüler sie zu eigen, eis ta idia.“ Das bedeutet wohl kaum so etwas wie „mit nach Hause“, und es bedeutet erst recht nicht die leibliche Versorgung der alten und schutzlosen Mutter. Das wäre frommer Kitsch. Der Verfasser des Prologs sagt: „In das ihm Eigene (ta idia) kommt es [das Wort], aber die Eigenen (hai idioi) nehmen es nicht an.“ Die Eigenen sind die Kinder Israels, die Jehudim, aber sie haben das Wort nicht angenommen, 1,11. Diese Menschen sind das, was das eigentliche Milieu des Wortes ausmacht, eben das Eigene. Dieses Eigene ist ab jetzt der Ort, wo sich Israel um den Messias sammeln wird, die messianische Gemeinde. Sie, das neue messianische Israel: Mutter des Messias!
Nach dieser Deutung muss der geliebte Jünger im Johannesevangelium also nicht mit einem historischen Jünger namens Johannes Zebedäus identifiziert werden, der dann auch noch das Evangelium geschrieben hätte, sondern er repräsentiert beispielhaft die Denkweise einer (Veerkamp 2, 135) „eigenständigen und wohl auch recht eigensinnigen Gruppe um Johannes innerhalb der vereinheitlichten messianischen Bewegung“ (wobei die Worte „um Johannes“ eben den Autor des Johannesevangeliums bezeichnen). Wenn das so ist, dann bleibt unerheblich, welches Mitglied einer solchen Gruppierung der Autor dieses Werkes gewesen ist; für die rasche Akzeptanz des Evangeliums in der entstehenden Kirche wäre eher entscheidend, welches Gewicht und welchen Einfluss diese Gruppe geltend machen konnte.
In diesem Zusammenhang ist bedenkenswert, welche Funktion nach Ton Veerkamp dem letzten Kapitel 21 zukommt, das dem Johannesevangelium wohl schon früh angehängt wurde:
Es geht also um das Verhältnis zwischen einer lokalen messianischen Gruppe um „den Schüler, dem Jeschua solidarisch verbunden war“ – einer Gruppe, die deutlich einen abweichenden Weg geht -, und der überregionalen messianischen Bewegung unter der Führung des Schimon-Petros. Der Schüler, um den es geht, wird hier als derjenige bezeichnet, der an der Brust Jeschuas fragte, „Herr, wer ist es, der dich überliefern wird?“ Es ist der Schüler, der mit Petros zum Grab rannte und am offenen Grab „sah und vertraute“. Es ist der Schüler, der einen ganz besonderen Zugang zu Jeschua hatte und für den Petros sehr wichtig war. Nehmen wir diese zwei Akteure der Erzählung als Repräsentanten verschiedener messianischer Gruppen bzw. Richtungen, so ist das Verhältnis klar. Schimon-Petros ist der eindeutige Führer der ganzen messianischen Bewegung; zugleich ist er auf die Einheit mit jenem Schüler, also mit der Gruppe um Johannes, angewiesen. „Johannes“ begreift sich hier als ein Element der großen messianischen Erzählung, aber er hat für sie eine herausragende Bedeutung. Der Erzähler von Joh 21 will also zwei Sachverhalte sicherstellen. Die Gruppe muß sich als Teil einer übergreifenden Bewegung verstehen, sie muß aber zugleich an ihrer eigenen, vom messianischen Mainstream abweichenden Identität festhalten.
Die Frage des Petrus nach dem geliebten Jünger in Johannes 21,21: „Herr, was wird aber mit diesem?“ interpretiert Veerkamp 2, S. 136, nun folgendermaßen: Diese
Frage bedeutet dann: „Soll er weiter seine eigenen Wege gehen?“ Denn eingeleitet wurde der Passus mit der Bemerkung, daß Petros den Schüler Jeschua folgen sieht. Es geht also um die besondere Art, in der die Gruppe dem Messias folgt. Der Erzähler, Sprecher der Gruppe um Johannes, läßt Jeschua barsch antworten: „Wenn ich will, daß er durchhält, bis ich komme, was geht dich das an? Du folge mir!“ Die Einheit soll nicht in dogmatischer Uniformität bestehen, sondern darin, dem Messias zu folgen. Die Einordnung der johannäischen Gemeinde, das Durchbrechen ihrer Isolierung, ist eine Sache, die Eigenständigkeit der Gruppe innerhalb einer Bewegung eine andere Sache. In der weltweiten messianischen Bewegung soll es die verschiedenen Formen der Nachfolge geben. Die messianische Bewegung ist eine politische Bewegung, aber keine politische Partei und folglich gibt es in der messianischen Bewegung keine Parteidisziplin. Den Anhang Joh 21 hat gerade die alte und später die römisch-katholische Kirche mit großer Sorgfalt gelesen, offenbar aber nur bis zu V. 19. Hätte sie weiter gelesen, hätte sie das anathema sit [= „verflucht sei“] spärlicher verwendet.
So begreift Ton Veerkamp den Schluss des Johannesevangeliums also als ein Plädoyer für die Bezeugung des Evangeliums vom Messias Jesus in einer großen Offenheit und Vielfalt.
↑ Welchen Sinn hat das erste Zeichen Jesu bei der Hochzeit zu Kana?
Zurück zum Anfang des Johannesevangeliums, nämlich zum Auftakt der wunderbaren Zeichen Jesu. In Ihren Augen (S. 206) ist das Wunder, das Jesus bei der Hochzeit zu Kana vollbringt,
kein programmatischer Auftritt wie der erste öffentliche Auftritt Jesu in der Synagoge von Kafarnaum bei Markus oder der in Nazaret bei Lukas oder die Bergpredigt bei Matthäus.
Dem widersprechen Sie allerdings sogleich, indem Sie schreiben:
Das Wunder geschieht jedoch, und der Evangelist gibt ihm mit seinem abschließenden Autorenkommentar programmatischen Charakter, wenn er sagt: „Damit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen im galiläischen Kana und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn“ (2,11).
Wie „in der synoptischen Verklärungsgeschichte“ geht es hier also „um die Offenbarung von Jesu göttlicher Herrlichkeit vor nur wenigen Jüngern.“ Aber worin besteht diese Offenbarung? Darin, dass (S. 207) in einem „frommen und reichen Haus … bei einer Hochzeit der Wein aus[geht]“ und „diese Peinlichkeit“ durch Jesus (S. 208) „ganz unspektakulär“ behoben wird, wobei „nur die Diener und die Jünger das Wunder überhaupt registrieren“? Wäre das nicht ein allzu banaler Vorgang, um darin die göttliche Herrlichkeit des Logos erwiesen zu sehen? In der Spannung zwischen „der höchst vernünftigen Bemerkung des Speisemeisters über die Reihenfolge der Weine bei einem ausgedehnten Gelage“ und „den wunderbaren Umständen, die dem Speisemeister verborgen bleiben“ sehen Sie sogar noch „ein Stück Komik in die Geschichte“ kommen – soll das wirklich das ganze Geheimnis dieses Wunders sein, dass „nur die Jünger sehen, was zu sehen ist, und … zum Glauben an ihn“ kommen?
Offenbar kam Ihnen das auch ein wenig dünn vor, und so haben Sie bei dem Kirchenlehrer Origenes nachgelesen, wie er die Frage beantwortet (S. 209),
warum im Johannesevangelium ausgerechnet … dieses Weinwunder der Inbegriff, das programmatische Prinzip, ja das Symbol des Evangeliums schlechthin sein [soll]? Und Origenes antwortet: Weil „der Wein des Menschen Herz erfreut (LXX: oinos euphrainei kardian anthrōpou)“, wie es im Psalm heißt (Ps 104,15). Deshalb ist die euphrosynē, die Freude und Fröhlichkeit, „das hervorstechende Zeichen des Sohnes Gottes.“ (116)
Und indem nach Origenes der Logos die Festteilnehmer „mit nüchternem Trank beglückt“ (117), geraten wir Ihnen zufolge
unversehens in die Theologie und die Spiritualität hinein… Aber das entspricht dem Charakter des vierten Evangeliums.
Allerdings kommt gerade das Thema der Freude und der Fröhlichkeit im Zusammenhang mit der Hochzeit zu Kana gar nicht vor (zum Lukasevangelium würde das viel eher passen (118)).
Und ob das Johannesevangelium in dem Sinn, der Origenes und Ihnen vorzuschweben scheint, einen spirituellen Charakter aufweist, entspricht wieder eher einer griechisch-philosophischen Lektüre als dem ursprünglichen Sinn des Evangeliums selber.
Erneut ist es Ton Veerkamp, der die Hochzeit zu Kana in den ihr angemessenen Rahmen einbettet. Zunächst erscheint es ihm wichtig (Veerkamp 1, S. 44f.), dass der Schauplatz dieses ersten Zeichens (genau wie auch des zweiten in Johannes 4,46) ein kleiner Ort ist, der wie Nazareth „mit den großen Ereignissen im Lebens Israels … nicht zu tun“ hatte und nach Josua 19,28 „ein nördlicher Grenzort des Stammgebietes Ascher“ ist. „Ascher liegt an der nördlichen Peripherie, Kana ist in dieser Peripherie wiederum Peripherie. … Es ist also ein Ort am Rande, wo ‚nichts los‘ war.“ Was hier ganz am Rande Israels geschieht, wird aber das Zentrum Israels, die führenden Kreise in Jerusalem, herausfordern und von dort zurückgewiesen werden (Veerkamp, S. 45):
In diesem Ort am Rande fand eine Hochzeit statt. Hochzeit ist im Sprachraum des Johannes nicht irgendeine orientalische Hochzeit, wo die Familie des Jeschua eingeladen war. Seine Sprache wird normiert durch die Sprache der Schrift. Es kann nicht die Rede davon sein, daß Jeschua irgendeiner Hochzeitsgesellschaft aus irgendeiner Verlegenheit hilft und sich als Wundermann erweist. Das Urbild der Hochzeit ist die Hochzeit zwischen Israel und seinem Gott. Hier ist an Jes 62,4f. zu denken:
„Man wird über dich nicht länger sagen: Verlassen!
Über dein Land wird man nicht länger sagen: Verödetes!
Dich [Israel] ruft man: Mein-Gefallen-an-ihr,
und dein Land: Verheiratet.
Denn Gefallen an dir hat der NAME gefunden,
und verheiratet wird dein Land.
Wie ein Junge ein Mädchen heiratet,
so heiratet dich der, der dich erbaut.
Und wie der Bräutigam sich ergötzt an seiner Braut,
so ergötzt sich dein Gott an dir.“Der Zweck des „Zeichens“ besteht darin, daß die Schüler Vertrauen in Jeschua finden, Jeschua, der „Größeres“ ankündigte: die Dinge in der Sicht Gottes zu sehen und zu begreifen, daß es in dieser Hochzeit um Israel geht.
Ihnen zufolge spielt die Mutter Jesu bei der Hochzeit zu Kana eher eine Nebenrolle. So erklären Sie (S. 207) die in Ihren Augen schroffen Worte Jesu in Johannes 2,4 „Was willst du von mir, Frau?“ mit den „strengen Konventionen der Antike für das Verhalten von Männern Frauen gegenüber“. Nach Veerkamp 1, S. 46, ist aber die „Anrede ‚Frau!‘ (gynai) … weder respektlos noch abweisend“, und auch der Ausdruck
„Was ist zwischen mir und dir, Frau?“ … ist aus der Schrift bekannt; er bedeutet, daß ein gemeinsames Anliegen zwischen zwei Personen in Frage gestellt wird. (119)
Das heißt, bei Johannes spielt
die Mutter gerade beim „Anfang der Zeichen“ eine entscheidende Rolle. Die Mutter Jeschuas gehört an erster Stelle zur Hochzeitsgesellschaft, Jeschua und seine Schüler wurden danach herbeigerufen. Gerade sie stellt einen gravierenden Mangel fest, der das Hochzeitsfest unmöglich macht: „Wein haben sie nicht.“
Diesen Mangel an Wein zu einem Zeitpunkt, in dem die Stunde des Messias Jesus noch nicht da ist, deutet Veerkamp so:
Seine Stunde, „die Stunde, um aus dieser Weltordnung heraus zum VATER überzugehen“ (13,1), sei noch nicht gekommen. Noch ist der Augenblick nicht da, wo dem Mangel an Wein abgeholfen wird, wo Israel wieder zu Israel wird, indem die Kluft zwischen Israel (die Mutter) und der messianischen Gemeinde (Jeschua und seine Schüler) zugeschüttet werden wird.
Aber zeichenhaft zeigt die Mutter des Messias, auf welche Weise es, wenn die Stunde dann gekommen sein wird, zu diesem Neuanfang Israels kommen kann (Veerkamp 1, S. 46f.):
Die Mutter des Messias hat auf das Entscheidende aufmerksam gemacht. Wein haben sie nicht, was sie haben, ist Wasser. Wasser ist lebensnotwendig, Wasser ist die Tora, es dient dazu, die zentralen Reinigungsvorschriften der Tora auszuführen. Die Mutter Jeschuas, die sich das zentrale Problem des Hochzeitsfestes zu eigen gemacht hat, wendet sich an die Diensthabenden. Ihre Handlung interpretiert die Frage: „Was ist zwischen mir und dir?“ nicht als eine rhetorische, sondern als eine wirkliche Frage. Was habe ich, der Messias, mit diesem Israel zu tun? Sie beantwortet diese implizite Frage mit einer Aktion; sie sagt zu den Diensthabenden, sie sollen tun, was Jeschua ihnen sagen wird. Mit einem solchen Israel hat er allerdings etwas zu tun.
Das heißt: Ein Israel, das auf den Messias Jesus hört, hat nach dem Evangelisten Johannes Zukunft – es wird (was, wie oben bereits ausgeführt, unter dem Kreuz Jesu besiegelt wird) zur messianischen Gemeinde mit der Verheißung, nicht nur zeichenhaft, sondern wirklich die messianische Hochzeit Israels mit dem befreienden Gott feiern zu dürfen.
↑ Wer ist der Architriklinikos – Speisemeister oder Festvorsteher?
Damit ist die Bedeutung der Erzählung von der Hochzeit zu Kana noch längst nicht ausgeschöpft. Eingehen möchte ich noch auf den architriklinikos, den Sie zunächst (S. 206) als Beleg dafür anführen, dass die Hochzeit in einem reichen Hause stattfindet:
Es hat einen Speise- oder Tafelmeister (architriklinikos), das heißt: einen Sklaven, der die Aufsicht über die Organisation des Festes hat.
Später (S. 208) lassen Sie, wie oben gesagt, die Geschichte enden
mit der höchst vernünftigen Bemerkung des Speisemeisters über die Reihenfolge der Weine bei einem ausgedehnten Gelage. Die Vernünftigkeit dieser Bemerkung kontrastiert mit den wunderbaren Umständen, die dem Speisemeister verborgen bleiben. So kommt ein Stück Komik in die Geschichte, und zugleich bleibt das offenbare Geheimnis Jesu gewahrt.
Aber kann der architriklinikos eine so banale Rolle spielen? Veerkamp 1, S. 47, sieht das anders:
Das Wort ist einmalig, es kommt weder in den griechischen Fassungen der Schrift, noch im nicht-biblischen griechischen Schrifttum vor. Ein Erzähler, erst recht ein Erzähler vom Rang des Johannes, hat seine Gründe, wenn er eine Figur einführt und sie mit einem völlig ungewöhnlichen Wort bezeichnet.
Nach Klaus Wengst (120) kann sich das Wort triklinos auf folgende Stelle der Mischna beziehen:
„Rabbi Jakob sagt: Diese Welt gleicht einer Vorhalle zur zukünftigen Welt: rüste dich in der Vorhalle, damit du in den Palast (triklinos, traqlin auf Mischnahebräisch) eintreten kannst« (mAvot 4,16).
Daraus schließt Veerkamp (S. 47f.):
Die Figur muß also mehr bedeuten als eine Nebenfigur. Der architriklinos ist auf alle Fälle der Vertraute des Bräutigams, wie sich zeigen wird.
Wie soll man das Wort dann übersetzen? Veerkamp lässt es unübersetzt; „Palastvorsteher“ würde zum randständigen Ort Kana nicht passen; „Speisemeister“ ist zu sehr auf die bloße Verantwortung eines Sklaven für die Bewirtung der Festgäste bezogen. Ich schlage die Übersetzung „Festvorsteher“ vor, um nicht mit „wedding planner“ völlig anachronistisch zu werden und sowohl seine hervorgehobene Position zu betonen als auch offen zu bleiben für seine Identität als Freund und Trauzeuge des Bräutigams.
Aber wie nähert sich Veerkamp überhaupt einer Auflösung des Rätsels um die Identität des Festvorstehers? Er nimmt ernst, dass dieser „nicht wusste“, wo der Wein herkam:
Der Bräutigam kann, wenn wir die Hochzeit nach Jes 62,4f. deuten, keinen anderen repräsentieren als den Gott Israels. Der architriklinos weiß nichts, die Wissenden sind die Diensthabenden, die diakonoi. Die Diensthabenden haben keinen direkten Zutritt zum Bräutigam. Die diakonoi wissen, der architriklinos ist der, der nicht weiß, was die diakonoi wissen; von dort muß das Rätsel, vor das uns diese Gestalt stellt, gelöst werden. Bislang hatten wir nur die zweimalige Versicherung des Täufers: „Auch ich hatte kein Wissen von ihm“ (1,31.33, kai egō ouk ēdein auton). Vom architriklinos wird gesagt: „Er wußte nicht.“ So wie der Täufer nicht wußte, daß Jeschua ben Joseph aus Nazareth der Messias war, so wußte der architriklinos nicht, woher der Wein, das effektive Zeichen der messianischen Zeit, stammt. Wer ist der Vertraute oder „Freund des Bräutigams“? Warten wir bis 3,29!
Um die Spannung aufzulösen, blättern wir vor zu dieser Stelle und lesen in der Übersetzung von Veerkamp 3, S. 29:
Wer die Braut hat, der ist Bräutigam.
Der Freund des Bräutigams, der beisteht und ihn hört,
freut sich mit Freude über die Stimme des Bräutigams.
Eben diese Freude, die meine, ist erfüllt.
Dort spricht eben Johannes der Täufer, und somit wird die Vermutung bestätigt, die durch die rätselhaften Andeutungen des Evangelisten vorbereitet wurde (Veerkamp 1, S. 68): „Der Freund des Bräutigams ist der hestēkōs, der Beisteher.“ Seine Funktion ist die eines Trauzeugen. Von dort aus (Veerkamp 1, S. 69)
erhält das Hauptzeichen in Kana seine eigentliche Dimension. Der Bräutigam ist der messianische König, die Braut ist Israel. Matthäus verwendet das Bild der messianischen Hochzeit in der Erzählung von den zehn Mädchen, Mt 25,1-13. Jochanan [= Johannes der Täufer] ist der wichtigste aller Hochzeitsgäste, er ist der architriklinos aus Joh 2,1ff.: „Auch ich wußte nichts von ihm“, sagte Jochanan, 1,34, genauso, wie der architriklinos nicht wußte, wo der Wein herkam (2,9). Jetzt weiß der Freund. Denn er hört die Stimme des Bräutigams.
Um näher zu bestimmen, worin diese Stimme des Bräutigams besteht, verweist Veerkamp auf Jeremia 7,34; 16,9; 25,10, wo eine Ankündigung des Gerichts über Israel darin besteht, dass die „Stimme des Bräutigams“ verstummen wird, während nach Jeremia 33,10f. eben diese Stimme wieder gehört werden wird, wenn der befreiende Gott Israels den (Jeremia 33,6) „Frieden“ im Land wiederherstellt hat:
Um die „erfüllte Freude“ geht es, die endgültige messianische Wende für eine Stadt, wo nur die Stimme des Krieges gehört wird und die in den Tagen dieses Johannes verwüstet ist. In den Tagen der messianischen Hochzeit tritt der Prophet – Jirmejahu, Jochanan [Jeremia, Johannes] – zurück. Der Messias, der Bräutigam, soll zunehmen, wogegen dieser geringer werden soll. Gegen diesen Hintergrund will Johannes den Prozeß der wachsenden messianischen Gemeinde und die schrumpfenden Gruppen der Täuferschüler gedeutet sehen.
So hat sich das Rätsel, das uns Johannes mit der Figur des architriklinos aufgibt, gelöst. Der „Nichtwissende“, Vertrauter oder Freund des Bräutigams, ist jener Jochanan, den wir „den Täufer“ nennen. Bei Johannes ist er Jochanan der Zeuge.
↑ In der messianischen Hochzeit Gott zu eigen, nicht sein Besitz werden
Am Eingangssatz des Verses Johannes 3,29: „Wer die Braut hat, der ist Bräutigam“ verdeutlicht Veerkamp 1, S. 68, außerdem noch den besonderen Charakter der messianischen Hochzeit:
Bräutigam ist der, der die Braut hat. Das Verb haben kennen die semitischen Sprachen nicht. Es will in unseren Sprachen irgendeine Zuordnung eines Objekts zu einem Subjekt andeuten. Besitzanspruch ist eine Form der Zuordnung. Der Besitzanspruch, den der Gott Israels bei den Menschen in Israel geltend macht, ist eine einmalige und spezifische Form der Zuordnung, die sich von anderen unter den Menschen verbreiteten Formen unterscheidet. Niemand darf einem Menschen gegenüber Besitzansprüche geltend machen. Wenn hier von Besitz oder besitzen eines Menschen die Rede ist, dann kann es sich in der Schrift nur um den Gott Israels handeln. In den meisten altorientalischen Gesellschaften „hat“ der Mann als Haupt der Hauswirtschaft, als „Eigentümer“, seine Frau als „Eigentum“; seine Frau gehört ihm wie alles weitere, das „sein ist“, Ex 20,17. Das „Besitzen einer Frau“ ist eigentümlich für eine patriarchalische Gesellschaft. Das Verhältnis zwischen dem NAMEN und Israel ist eben nicht das Verhältnis zwischen Besitzer (Baal) und Besitz. Das heißt, es steht Israel nicht frei, nach einem Baal – Herrn, Besitzer, Gatten, eben „Gott“ – Ausschau zu halten. Die messianische Hochzeit ist eine Hochzeit nach Hos 2,18. Der Bräutigam hat die Braut, aber das heißt eben nicht: er ist ihr baˁal, ihr Herr Besitzer. Hier zeigt sich, wie schwierig es ist, den semitischen Sprachgestus adäquat ins Indoeuropäische, hier das Griechische, zu übersetzen. Vielleicht müßte man übersetzen: „Wer die Braut zu eigen hat, der ist der Bräutigam.“ Wir müssen den Unterschied zwischen nachala, „Eigentum“, und achusa, „Besitz“, sehen, zwischen dem, was einer Familie untrennbar als Basis für ihren Lebensunterhalt gehört, ihr zu eigen ist, und dem veräußerbaren Besitz, wie Ochs und Esel oder Sklaven aus fremden Völkern (Lev 25,44f.). (121) Israel ist das Eigentum und nicht der Besitz des NAMENS, Ps 33,12:
Glücklich die Nation, für die der NAME Gott ist,
das Volk, das er sich zu eigen erwählte.
↑ Was bedeuten die letzten Worte des Festvorstehers „bis jetzt“?
Auf zwei weitere Worte in der Erzählung von der Hochzeit zu Kana gehen Sie überhaupt nicht ein, nämlich die Worte heōs arti = „bis jetzt“, ganz am Ende des verwunderten Ausspruchs des Festvorstehers über den guten Wein. Nach Veerkamp 1, S. 48, kommen diese Worte auch in Johannes 5,17 und 16,24 vor:
Dieser Vertraute sagt zum Bräutigam: „Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und, wenn sie gezecht haben, den minderen. Du hast den guten Wein bewahrt – bis jetzt.“ … Das Wort „bewahren“ bedeutet im Johannesevangelium sonst immer „das Bewahren der Gebote“. Noch zweimal hören wir den Ausdruck „bis jetzt“. In 5,17: „Mein VATER wirkt bis jetzt und auch ich wirke.“ Die andere ist 16,24: „Bis jetzt habt ihr um nichts mit meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet nehmen, damit eure Freude erfüllt sei“, ganz am Ende der sogenannten „Abschiedsreden“. Diese Stellen erklären unsere Stelle hier. Jeschua hat gewirkt „bis jetzt“; bis jetzt spielte bei der Sehnsucht (beten) der Schüler der Name Jeschuas keine Rolle. In dem Moment, wo sie ihre Sehnsucht nach der kommenden Weltzeit mit dem Namen Jeschua verbinden, werden sie das, worum sie beten, annehmen, und ihre Freude wird sich erfüllen. Jetzt wird Israel zu jenem „guten Wein“; bis jetzt war es alles andere als guter Wein, Jes 5,1ff.:
Ich will singen für meine Geliebte,
ein Liebeslied:
Einen Weinstock hatte mein Geliebter, Weinstock für ihn,
an einem Hang fetten Bodens.
Er grub ihn um, entfernte Steine aus ihm,
er pflanzte in ihm einen edlen Wein,
baute einen Wachtturm in der Mitte
und hob ein Keltertrog aus.
Er hoffte, daß er Trauben bringt,
er brachte nur Saures.Das gleiche Bild verwendet Jeremia (2,21). Das Zeichen Jeschuas verwandelt „zuletzt“ die bitteren Worte der Propheten in das, was der Geliebte von seinem Weinstock Israel immer erhoffte: guten Wein. Die Hoffnung Gottes geht „zuletzt“ in Erfüllung. Der architriklinos hilft dem Bräutigam aus einer großen Verlegenheit, ohne auch nur zu ahnen, wo der Wein herkommt, was hier überhaupt geschieht. … Hier geht es um das prinzipielle Zeichen. Nicht das erste Zeichen aus einer Reihe vieler weiterer, sondern der Anfang der Zeichen. Das Evangelium fängt mit den Worten an: „Im Anfang“, so wie die Schrift überhaupt angefangen hat. Hier hören wir das gleiche Wort. Das Zeichen der Zeichen, das, worum es eigentlich geht und gehen muß, zeigt: Israel wird endlich zu Israel. Darum geht es bei allem, was Jeschua sagen und tun wird. Denn das wird seine Ehre sein. Die Ehre Jeschuas ist die Heimführung Israels.
So wird verständlich, warum nach Johannes 2,11 die Jünger Jesu auf Grund des Zeichens in Kana anfangen, die Herrlichkeit des Messias wahrzunehmen und ihm zu vertrauen, und warum hier auch die Gemeinde des Messias entsteht, deren Mitglieder im nächsten Vers genannt werden: seine Mutter, seine Brüder und seine Schüler:
Die Schüler vertrauen Jeschua. … Um dieses Vertrauen wird es gehen. Daß Jeschua der Messias wird, wird ihnen klar (ephanerōsen, offenbar!), als dem Mangel Israels abgeholfen wurde. Sie vertrauen, nicht weil ein Zauberer mit einem Zaubertrick 480 Liter Wasser zu ebensovielen Litern Wein umzauberte, sondern weil ihnen klar wird, was Jeschua tun muß und tun wird. Die Unmenge Weins steht für die Fülle der messianischen Zeit. Folgerichtig, und das bestätigt unsere Deutung, wird die nächste Aktion Jeschuas im traqlin, im triklinos des Gottes Israels stattfinden, dem Heiligtum in Jeruschalajim. „Vor dem Angesicht“ der messianischen Gemeinde, die sich in Kana konstituierte: Die Mutter, die Brüder, die Schüler.
↑ Machte Jesus nur ein paar Tage Urlaub in Kapernaum?
Auch (S. 209) die kurze Bemerkung in Johannes 2,12 über den Aufenthalt Jesu „mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern … in Kafarnaum“ bereitet Ihnen Schwierigkeiten. Denn davon (S. 210), dass dieser Ort (der nach der Lutherübersetzung Kapernaum heißt) wie bei den anderen Evangelisten
Wohnsitz und Hauptwirkungsort Jesu war, finden wir im Johannesevangelium keine Spur. …
Hier in Joh 2,12 hat man den Eindruck, daß Jesus mit seiner Familie und den ersten Jüngern nur einige Urlaubstage in Kafarnaum verbringt. Warum erwähnt er etwas so Banales überhaupt? Offenbar wollte der Evangelist die Reminiszenz an Kafarnaum nicht ganz unterdrücken. Kafarnaum gehört nun einmal an den Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu.
Aber sollte ein inspirierter Autor wie Johannes etwas so Banales wirklich nur aus Gründen der Nostalgie oder einer gewissen historischen Korrektheit mitteilen wollen? Für Ton Veerkamp ist die Aussage dieses Verses alles andere als banal, weil er einmal mehr sein Ohr dicht an der Heiligen Schrift Israels hat (Veerkamp 1, S. 49) und daher eine Menge mit den betont am Schluss dieses Verses stehenden drei Worten ou pollas hēmeras anfangen kann:
Die messianische Hochzeit in Kana, Galil, ist das Gründungsfest der messianischen Gemeinde. Mit ihr geht er nach Kefar Nachum. Hier, am Anfang der Zeichen, sind alle, die die ursprüngliche messianische Gemeinde repräsentieren, noch zusammen: die Gemeinde, zu der die Mutter Jeschuas gehört, die Gemeinde der Brüder Jeschuas in Jeruschalajim und die Gemeinden der Schüler im Land und in der Region. „Sie blieben dort nicht viele Tage“, heißt es abschließend. Von Israel hieß es: „Ihr saßt fest in Qadesch Barnea, viele Tage, die Tage, die ihr fest saßt“ (Dtn 1,46), und: „Wir umkreisten das Gebirge Seir viele Tage“ (Dtn [5. Mose] 2,1). Schließlich heißt es: „Und die Tage, die wir gingen von Qadesch Barnea bis zum Bach Zered [die Grenze zu den Feldern Moabs], waren achtunddreißig Jahre“ (Dtn 2,14). „Nicht viele Tage“ bedeutet: der Aufenthalt in Kefar Nachum soll nicht wie der Aufenthalt in Qadesch Barnea werden: die achtunddreißig Jahre Israels sind vorbei. Um das zu verstehen, müssen wir bis 5,1ff. warten. Die Schwierigkeit bei Johannes ist, daß er immer Rätsel aufgibt, die man erst nach der Lektüre des ganzen Textes lösen kann.
In Johannes 5,5 wird Jesus einem Mann begegnen, der seit 38 Jahren gelähmt war. Nach Veerkamp 1, S. 97,
ruft uns Johannes mit dieser Zahl achtunddreißig jene Erzählung von der Überwindung der Lähmung Israels in Erinnerung. „Jeschua erkannte, daß die Zeit lang genug gewesen war.“ Er handelt hier mit der gleichen Macht, mit der der NAME zu Israel sagte [5. Mose 2,3]: „Genug (rav) ist es für euch, euch im Kreise zu drehen“ – eben [5. Mose 2,1] „nach den vielen Tagen (jamim rabbim, hēmeras pollas)«. Der Mann will, kann aber nicht: „Andere steigen vor mir ins Wasser ab“, er könne nicht als erster – Voraussetzung für die Heilung – in das vom heilenden Engel aufgewühlte Wasser absteigen. Israel kann sich selbst nicht aus dieser Lähmung befreien. Im Deuteronomium geht die Initiative vom mobilisierenden Wort aus [5. Mose 2,3]: „…Genug ist es für euch, euch um dieses Gebirge im Kreise zu drehen; wendet euch nordwärts. Jetzt richtet euch auf!“ Das Wort schuf dort ein handlungsfähiges Israel, jetzt, so Johannes, schaffe der Mensch, der das Wort verkörpert (1,14), ein neues, messianisches, handlungsfähiges Israel. Jeschua erkannte, daß „die Zeit lang genug war“, und sagt: „Richte dich auf, trage deine Liege weg und gehe deinen Gang.“
Wer wissen will, wie genau Veerkamp den „Zustand eines politisch gelähmten Israel in der Zeit nach 70 u.Z. [deutet], ohne antijüdisch zu argumentieren“ (so in Veerkamp 1, S. 98, Anm. 3), sollte sich gründlicher in seine Auslegung des Johannesevangelium vertiefen.
↑ Warum steigt Jesus nach Kapernaum hinab?
Eine andere Einzelheit, nämlich dass Jesus nach Kafarnaum (Kapernaum) hinabsteigt, katebē, erklärt Veerkamp nicht. Sie interpretieren diese Angabe rein historisch geographisch als korrekt (S. 210):
Übrigens spricht Johannes ganz richtig davon, daß man von Kana aus zum See „hinab“ geht. Es sind etwa 300 Meter Höhenunterschied. (122)
Auf dieses Hinab- und Hinaufgehen Jesu im Johannesevangelium geht aber Andreas Bedenbender (123) im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu den Fluchworten über Kapernaum in Matthäus 11,23 und Lukas 10,15 ein. Er weist nach, dass „Kapernaum“ dort einen von mehreren Decknamen für die römische Hauptstadt Rom darstellt, und geht davon aus (S. 433), dass in gewisser Weise
auch das johanneische Kapernaum Rom [vertritt]. Schließlich ist das römische Kaisertum bei Johannes nicht anders als bei den Synoptikern eine Instanz, die in Opposition zum Gott Israels steht, insofern sie in die Sphäre des Satans gehört (124).
Wenn das so ist, ist es nicht verwunderlich, dass sich (S. 432f.) mit
Kapernaum … im Joh-Ev regelmäßig die Vorstellung des Abstiegs (katabainein, „hinabsteigen“, in 2,12; 4,47.49.51; 6,16f.) [verbindet]. Es gibt keinen zweiten Ort, von dem so etwas gilt. Kapernaum fungiert damit als Gegenpol zu Jerusalem und dem Tempel, wohin der Weg typischerweise hinaufführt (anabainein) (125). Das innerweltliche Visavis von Kapernaum und Jerusalem ist allerdings eingebettet in das große Gegenüber von kosmos und „Vater“. Wiederum bilden katabainein und anabainein das zentrale Begriffspaar – beschreiben sie doch gemeinsam die Bewegung Jesu erst vom „Vater“ hinunter in den kosmos und dann aus dem kosmos wieder hinauf zum „Vater“.
Kapernaum, der Tiefpunkt in der Welt des Joh-Ev, erscheint bei solcher Betrachtung als das wahre Ziel der katabasis Jesu. Folgerichtig ist es eben in Kapernaum, wo Jesus seiner Zuhörerschaft regelrecht einhämmert: Er ist das Brot, das vom Himmel hinabstieg (6,33-58: siebenmal katabainein). Und genauso folgerichtig situiert der Evangelist hier auch die denkbar anstößigste Konkretisierung des Gedankens, das Wort sei Fleisch geworden, die er als Schibbolet (126) auf dem Weg der Nachfolge wird: Es gilt, die Fleischwerdung des Logos ohne jeden Vorbehalt zu schlucken – das Fleisch Jesu muß „gekaut“, sein Blut muß „getrunken“ werden. Wem das zuviel des Guten sein sollte, der hat, so Johannes, bei Jesus nichts verloren.
Von einer solchen Sichtweise aus erhält auch der Vers Johannes 3,12 noch eine weitere Bedeutungsnuance (S. 432):
Anfangs, in 2,12, manifestiert sich in Kapernaum die Einheit der messianischen Gemeinde. Die Mutter Jesu, seine Brüder und seine Schüler handeln alle genauso wie er selber, sie „bleiben“ (menein) mit ihm an einem Ort, d.h., sie halten bei ihm aus. Das ist freilich nur ein Zwischenspiel („nicht viele Tage“), welches innerhalb des Joh-Ev ohne Parallele dasteht (127). Und in 6,66 verortet Johannes die gegenläufige Vorstellung vom Zerfall der Gemeinde ebenfalls in Kapernaum. Nimmt man beides, die Bewährung und das Versagen, zusammen, dann ist Kapernaum offenbar der Ort, an dem die Gemeinde in die krisis gerät: In Kapernaum entscheidet sich, was aus ihr wird, ob sie besteht oder vergeht.
↑ Welche Bedeutung hat die Geographie in den Evangelien?
Aber kann man den Evangelisten unterstellen, wie es Bedenbender tut, einen Ortsnamen wie „Kapernaum“ allegorisch auf „Rom“ zu beziehen? Bedenbender (128) begründet diese Annahme grundsätzlich wie folgt:
Die neutestamentlichen Evangelien sind wohl sämtlich ohne näheren Kontakt mit der realen Landschaft Galiläa und ihren Ortschaften entstanden. „Kapernaum“, „Bethsaida“ usw. waren für die Evangelisten bloße Namen, die sie frei verwenden oder eben fortlassen konnten, wie es eben den Erfordernissen des gerade Darzustellenden entsprach (129).
Immerhin finden auch Sie (S. 210f.) durch den Johanneskommentar des Origenes Zugang
zur Erkenntnis, daß man in historischen Fragen nicht willkürlich entweder dem einen oder dem anderen der Evangelisten recht geben könne, sondern davon ausgehen müsse, daß die Wahrheit im Zweifelsfall nicht auf der historischen Ebene zu suchen sei, sondern auf der Bedeutungsebene. Für Origenes gibt es Fälle, wo die Evangelisten die historische Chronologie oder Geographie im Interesse einer symbolischen Aussage ändern. Entscheidend ist für ihn in jedem Fall die geistige Sinndimension, in historischen wie in fiktiven Texten. (130)
In ähnlicher Weise kommt Ihnen zufolge auch die moderne
historische Hermeneutik wieder mehr und mehr zur Einsicht, daß die Darstellung der Geschichte nicht im Anhäufen belangloser, trivialer Fakten liegen kann.
Wie viel mehr muss das gelten für die Auslegung der vier Evangelien, die weit mehr sein wollen als historische Geschichtsschreibung – nämlich Frohe Botschaft des befreienden Gottes Israels für alle Völker!
↑ Mildert Johannes das Jesuswort zur Tempelreinigung ab?
Nachdem Sie (S. 211) den Weg Jesu von „Kafarnaum aus“ als „geographisch wieder ganz richtig, ‚hinauf nach Jerusalem‘ zum Paschafest“, einordnen (131), bezeichnen Sie Jesu „Tempelreinigung“ als „eine klassische prophetische Zeichenhandlung“ (S. 213):
Die provozierende Aktion selbst wird bei Johannes noch rabiater dargestellt als bei den Synoptikern. Jesus macht eine Geißel aus Stricken und treibt nicht nur die Händler hinaus, sondern auch die Schafe und Rinder. Die Erklärung dafür richtet Jesus an die Taubenverkäufer: „Schafft das weg von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus“ (2,16). Dieses Wort ist milder als das bei den Synoptikern zitierte. Bei Markus lautet es: „Steht nicht geschrieben: ,Mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden für alle Völker‘? Ihr aber habt es zu einer ,Räuberhöhle‘ gemacht!“ (Mk 11,17) …
Das Stichwort vom Tempel als Räuberhöhle, die Johannes zu einem Kaufhaus abgemildert hat, ist ebenfalls keine eigene Prägung Jesu, sondern entstammt dem Propheten Jeremia: „Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden?“ (Jer 7,11). Es enthält die eigentliche Provokation, den Protest gegen den profitorientierten Handel im Tempel selbst, den vor ihm noch niemand als anstößig empfunden hatte.
Ihre zweifach vorgetragene Einschätzung, Johannes habe das Jesuswort von der „Räuberhöhle“ zu „Kaufhaus“ abgemildert, klingt zwar auf den ersten Blick plausibel, passt aber nicht zu dem von Ihnen als „rabiater“ dargestellten Verhalten Jesu. Außerdem entspricht die Version des Johannes eigentlich doch einer radikalisierten Kritik am Tempelbetrieb – nicht erst wie in Jeremia 7,9 ein in krasser Weise verfehltes Handeln der für den Tempel Verantwortlichen steht im Fokus der Kritik, sondern schon die Tatsache, dass der Tempel überhaupt ein Kaufhaus darstellt.
Es stimmt übrigens auch nicht, dass dieser Handel zuvor noch von niemandem „als anstößig empfunden“ worden war. Veerkamp 1, S. 51, geht davon aus, dass der johanneische Jesus sich mit der von ihm formulierten Kritik statt auf den Propheten Jeremia vielmehr auf Sacharja 14,21 bezieht:
Für Johannes scheint der letzte Satz des Buches Sacharja den Ausschlag zu geben. „Es wird kein Krämer sein im Haus des NAMENS der Heerscharen an diesem Tag.“ Ein Zustand, nach dem sich das fromme Israel sehnt. Der Kaufmannsstand galt in Israel und überhaupt in der Vormoderne als etwas Abartiges, berufsmäßige Händler werden „Kanaaniter“ genannt. (132) Zumindest am Schabbat duldete Nechemja [= Nehemia] keine Krämer in der Stadt (Neh 13,15-22). Jeruschalajim war in den Augen der Evangelisten eine hellenistische Stadt, eine „Krämerstadt“ (emporion), wie die Propheten die phönizische Handelsmetropole Tyrus nannten, ihre Handelspartner wurden folgerichtig emporioi, „Krämer“, genannt (Jes 23,17; Ez [Hesekiel] 27,15). Das muß ein Ende haben. Jeschua macht damit ein Ende.
Aufschlussreich ist auch Ton Veerkamps Kommentierung der rabiaten Art, in der Jesus die Reinigung des Tempels vollzieht (Veerkamp 1, S. 52):
Auffällig ist die Gewalt, die Jeschua hier anwendet; einer wie Gandhi war er bei Johannes nicht. Auf Unvoreingenommene macht das keinen guten Eindruck; sie können sich dem Eindruck nicht entziehen, daß hier ein fundamentalistischer Eiferer am Werke ist. Dieser Eindruck ist falsch. Vielmehr stellen alle Evangelisten Jeschua ganz in die Tradition der makkabäischen Revolution. Daß sie diesen Jeschua den militärischen Zelotismus ablehnen lassen (Joh 10,8ff.; 18,11; Mt 26,52), hat mit einem dogmatischen Pazifismus nichts, mit einer realistischen Einschätzung des militärischen Kräfteverhältnisses alles zu tun. Aber die Schüler erinnern sich daran, daß Jeschua ein Zelot war: „Der Eifer (zēlos) um dein Haus frißt mich“, sagt der Psalm, und wir denken an Elijahu, der bekannte: „Geeifert, habe ich, geeifert (zēlōn ezēlōka) für den NAMEN, den Gott der Ordnungen“, 1 Kön 19,10. Jeschua war nach Johannes ein Zelot, aber ein richtiger, kein Rambo vom Schlage der Leute, die während des zelotischen Regimes in Jeruschalajim (68-70) jenes blutige Chaos anrichteten, das in die unvorstellbare Katastrophe des Jahres 70 führte. Was hier geschieht, ist eine Art von chanukka, die Reinigung des Hauses Gottes. Hier wird das negative Moment der chanukka, die Säuberung, erwähnt, in 10,22ff. das positive.
↑ Ist die Tempelreinigung Jesu als eine Wundertat zu betrachten?
Sehr ausführlich gehen Sie (S. 215) auf die Einschätzung bereits des Origenes ein, „wie unwahrscheinlich eine solche Aktion Jesu im Tempel, historisch betrachtet, eigentlich war.“ Deswegen (S. 216f.) muss Ihnen zufolge aber die Geschichte nicht schon „für unhistorisch“ erklärt werden, wie das „viele moderne Kommentatoren“ tun:
Das Gelingen dieser Aktion ohne Widerstand, meint Origenes, ist ein Wunder, größer als das von Kana.(133)
An diesem Beispiel sieht man besonders deutlich, wie dogmatische Vorurteile oder philosophische Axiome das historische Urteil bestimmen. Die modernen Exegeten, die die Tempelaktion Jesu für unhistorisch oder von den Evangelisten aufgebauscht erklären, weil sie historisch kaum vorstellbar erscheint, gehen bewußt oder unbewußt davon aus, daß Jesus eben nicht der inkarnierte Logos war, daß er keine wirklichen Wunder tun konnte und folglich auch dieses Wunder einer Gewaltaktion als einer gegen viele nicht zustande bringen konnte. Unter dieser Voraussetzung stimmen ihnen auch die Väter zu. Da die Väter aber davon ausgehen, daß Jesus der war, für den ihn das christliche Credo erklärt, und daß er tatsächlich Wunder tun konnte, können sie auch diese Aktion für wirklich geschehen halten. Wer davon ausgeht, daß Jesus erst nach Ostern „vergöttlicht“ wurde, muß den Großteil der wunderbaren Vorgänge, die in den Evangelien erzählt werden, für Fiktion erklären, eine Annahme, die historisch kaum plausibel gemacht werden kann. So entscheidet die Dogmatik, in diesem Fall die Christologie, auch über die Historie. Doch über das, was möglich oder unmöglich ist, kann kein Historiker als Historiker entscheiden. Wo er solche Urteile fällt, spricht er als Dogmatiker oder als Philosoph.
Natürlich können weder dogmatische noch philosophische Vorurteile über die Historizität eines Wunders entscheiden – allerdings in keiner Richtung. Erst recht ist über die Frage, ob und in welcher Weise Jesus „der inkarnierte Logos“ war, ein historisches Urteil genau so wenig zu fällen wie über die Existenz Gottes oder des Übernatürlichen. Mir erscheint es auch schlicht unerheblich zu sein, in dieser Hinsicht etwas beweisen oder widerlegen zu wollen. Viel wichtiger ist es, wie Sie oben (S. 211), ebenfalls unter Berufung auf Origenes betont haben, „die Wahrheit … auf der Bedeutungsebene“ zu suchen. Auf welche wunderbare Wirklichkeit weisen die in den Evangelien erzählten Wunder hin, auf welches Heilwerden, welche Befreiung, welche Hoffnung in der Wirklichkeit unserer Welt laufen sie hinaus?
↑ Jesus als Verkörperung des befreienden NAMENs des Gottes Israels
Was unterscheidet nun (S. 220) das Johannesevangelium von „seinen Vorgängern“ und was waren „die Gründe…, die den Evangelisten zu seiner so andersartigen Darstellung bewogen haben“? Den Stil insbesondere „der Reden Jesu“ bezeichnen Sie als „geradezu esoterisch“; er ist von „Wiederholungsfiguren aller Art“ und von einander wechselseitig entsprechenden Formulierungen geprägt. „Dieser Stil wirkt eindringlich und meditativ.“ Es ist (S. 221)
deutlich, daß Johannes nicht den Stil des historischen Jesus nachahmen möchte, sondern diesen historischen Jesus in seinem eigenen Stil reden läßt. Dasselbe gilt hinsichtlich des Täufers. Vorbilder für diesen Wiederholungsstil finden wir wieder eher im Alten Testament als in der griechischen Literatur.
Zu kurz greift meines Erachtens Ihre Beurteilung der „Ich bin“-Worte Jesu:
In seinen Reden tut Jesus etwas, das wir an unseren Mitmenschen unerträglich finden: Er redet ständig von sich selber. Besonders typisch für ihn sind die „Ich bin“-Worte: „Ich bin das Brot des Lebens“ (6,35); „Ich bin das Licht der Welt“ (8,12); „Ich bin die Tür“ (10,9); „Ich bin der gute Hirte“ (10,11); „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (11,25); „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (14,6). „lch bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ (15,5). Nirgends gibt es bei den Synoptikern etwas Ähnliches. Man kann sich fragen, warum wir derartiges bei unseren Mitmenschen unerträglich finden, während es uns beim johanneischen Jesus gar nicht auffällt. Ich glaube, die Antwort ist einfach: Bei Jesus ist das Reden über sich selber keine falsche oder überhebliche Ichbezogenheit; er ist der einzige, der es mit Recht tut.
An dieser Stelle machen Sie aber nicht näher deutlich, inwiefern Jesus mit Recht in dieser Weise von sich selbst spricht. Mit keinem Wort gehen Sie darauf ein, dass in der Formulierung „ICH BIN“ der NAME des Gottes Israels aufgerufen wird, wie er dem Mose in 2. Mose 3,14 offenbart wird.
Ton Veerkamp geht auf diese Formulierung dort ein, wo sie zum ersten Mal auftaucht, nämlich im Gespräch Jesu mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, nach Johannes 4,5 „nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte“. Zu dieser Frau schreibt er (Veerkamp 1, S. 76):
Jeschua setzt sich, wie die Väter Israels, wie Jitzchaq [= Isaak] und wie Jakob, an den Ortsbrunnen, den schon Jakob ausgehoben hatte. Drei Namen haben wir gehört: Jeschua, Jakob, Joseph. Jetzt kommt eine Frau, die uns an Rivka (Rebekka) und an Rachel, an die Mutter Israels und an die Mutter Josephs (= Schomrons [= Samariens]) denken läßt. Die Frau am Brunnen ist nicht irgendeine dumme Person mit einer schmuddeligen Vergangenheit, sie ist eine der großen Frauen Israels. Wer sich das nicht gleich am Anfang vergegenwärtigt, wird hier nichts verstehen.
Am Ende seines langen Gesprächs (Veerkamp 1, S. 77) mit dieser Repräsentantin der zehn verlorenen Stämme des Nordreiches Israel, dieser „Frau aus dem Bastardvolk von Schomron“, das seit Jahrhunderten mit den Juden verfeindet ist und das Jesus nach Johannes 10,16 wieder zu einem Gesamtisrael zusammenführen will, offenbart sich Jesus ihr in Johannes 4,26 als Messias mit den Worten „Ich bin es, der mit dir redet.“ Dazu Veerkamp 1, S. 85f.:
Wir hören zum ersten Mal in unserem Text die Worte: „Ich werde dasein, ICH bin es.“ 24mal werden wir im Johannesevangelium dieses egō eimi, „ICH werde dasein, ICH bin es“, hören, 24mal wird uns so die Offenbarung des NAMENS in Ex 3,14, der Grund des prophetischen Selbstbewußtseins, in Erinnerung gerufen werden. Dieses Friedens- und Befreiungsgespräch des Messias mit der Frau am Jakobsbrunnen ist die „Seinsweise Gottes“ in Israel, und zwar jetzt. Für den Menschen, für den diese Worte fundamentale Bedeutung haben, fängt ein neues Leben an. … In dem Augenblick, in dem Jeschua die Blockade: Jehudim [= Juden] verkehren nicht mit Schomronim [Samaritanern], sondern sie schlagen sich gegenseitig tot, aufhebt, geschieht der NAME, geschieht Ich werde dasein, so wie ich dasein werde (Ex 3,14). Der NAME geschieht im Reden, in diesem politischen Gespräch, wo ein Ausweg sichtbar wird, der noch nie war. Den Ausdruck gibt es in zwei Formen, einmal absolut, ohne weitere Bestimmung: egō eimi („Ich werde dasein“), einmal mit einer prädikativen Bestimmung, egō eimi ho lalōn („ICH bin es, der Redende“), egō eimi ho artos („Ich bin es, das Brot“) usw. Die erste Form kommt eigentlich nur viermal vor, 6,20; 8,24.28.58 (die Stellen 9,9, 18,5.6.8 setzen das Prädikat voraus). In diesen vier Fällen kommt, will uns scheinen, nur der direkte Bezug zu Ex 3,14 in Frage. Deswegen übersetzen wir mit „Ich werde dasein.“ In den anderen Fällen, wo Jeschua das Subjekt des Satzes egō eimi ist, müssen wir an die emphatische prophetische Schlußformel denken: ani hu oder ani JHWH. Die Emphase muß man in der Übersetzung immer wiedergeben, etwa: „ICH bin es, ich Erster, ich Letzter“, Jes 48,12. Mit dem Satz: „Ich bin es, der mit dir Redende“, ruft Jeschua für die Frau die gemeinsame Befreiungserzählung auf. Das geschieht hier und jetzt, das ist Messias.
So lässt Johannes den Logos Jesus sehr direkt als Verkörperung des befreienden NAMENs des Gottes Israels auftreten und reden.
↑ Hat Johannes den „Text“ des historischen Jesus „vollständig dekodiert“?
Abschließend beurteilen Sie (S. 225) Johannes als denjenigen Evangelisten, der „das Bild des Auferstandenen“ am konsequentesten „auf das Bild des vorösterlichen Jesus“ abfärben lässt:
Er malt das Bild Jesu von Anfang an mit den wahren Farben, die ihm Ostern geliefert hat. Er zeichnet Jesus als den, der er in Wirklichkeit war: Gottes endgültiges Wort an die Welt. Sein Evangelium sollte den dekodierten Text dieser Botschaft bieten. So ist er gleichsam zum Phänomenologen unter den Evangelisten geworden: Er bietet eine Wesensschau.
Das bedeutet im Hinblick auf den historischen Jesus und den Vergleich mit den anderen Evangelien (S. 226):
Wenn wir das Leben und Wirken Jesu in der angedeuteten Weise als einen Text betrachten, müssen wir somit drei Formen oder Versionen dieses Textes unterscheiden:
- Da ist erstens der ursprüngliche Text, die ursprünglichen Worte und Taten Jesu. Diesen Text haben wir nicht mehr im „Original“, sondern nur noch als Rekonstrukt aus den Quellen, das je nach Rekonstrukteur anders ausfällt. Das sind die vielen und sehr unterschiedlichen Bilder des historischen Jesus, wie sie von Berufenen wie Unberufenen entworfen werden.
- Da ist zweitens der teilweise dekodierte Text in drei Varianten, den synoptischen Evangelien.
- Da ist drittens der vollständig dekodierte Text in der Fassung des Johannesevangeliums.
Aus christlicher Sicht ist klar, daß man diese drei Versionen zwar unterscheiden, aber nicht trennen und gegeneinander ausspielen kann. Sie bilden eine Einheit, vorausgesetzt natürlich, daß die Dekodierung des vierten Evangelisten richtig ist. Wenn es um Jesus geht, sollten wir immer wissen, über welche dieser drei Versionen wir reden. Das muß nicht immer explizit geschehen, aber wir für uns müssen es wissen. Man sollte also nicht synoptische und johanneische Jesusworte auf eine Ebene stellen und unterschiedslos durcheinander zitieren.
Dem kann ich grundlegend durchaus zustimmen – allerdings mit zwei Einschränkungen.
Die erste muss ich nicht noch einmal lang und breit ausführen – sie bezieht sich darauf, dass zumindest nach der jüdisch-hebräisch geprägten Lektüre durch Ton Veerkamp das Johannesevangelium nicht einfach eine vollkommene Wesensschau des christlich verstandenen Gottessohnes Jesus Christus enthält. Vielleicht geht es Johannes sogar viel grundlegender um den Messias Israels „nach dem Fleisch“, um die Menschlichkeit Jesu, insofern er ihn so radikal mit dem befreienden NAMEN des Gottes Israels identifiziert und seine Herrlichkeit so zentral als die Erhöhung zum Kreuzestod begreift. Um diese Konzeption aber vollständig begreifen und beurteilen zu können, muss man Ton Veerkamp selber gründlich lesen und durcharbeiten.
Die zweite Einschränkung bezieht sich auf den historischen Jesus. Wir werden darauf verzichten müssen, auch nur annäherungsweise ein zutreffendes historisches Bild Jesu entwerfen zu können. Zu diesem Punkt berufe ich mich auf Aussagen des Neutestamentlers Wolfgang Stegemann (134). Er hat davor gewarnt, sich auf einen historischen Jesus zu berufen, um einem schwach gewordenen Glauben wieder Stärke zu verleihen:
Sofern historische Forschung uns aus dieser „Schwachheit“ des Glaubens aufhelfen soll, sofern sie sein konstitutives Moment „Vertrauen“ in wissenschaftliche Certitudo verwandeln soll, ist ihre Aufgabe missverstanden, missverstanden ist aber auch der Glaube. Sowenig Balletttanzen eine Bewegungsform ist, die man dazu einsetzt, um einen Bus zu erreichen, so wenig sollte man die historische Jesusforschung zu einer Form des Glaubens machen oder zu dessen Begründung benutzen. (135) Doch welche theologische Funktion kann dann die historische Jesusforschung haben, wenn sie nicht zum Glauben führen kann?
Stegemann, S. 431, verweist dazu erstens auf
die theologie- und kirchenkritische Funktion der Rückfrage nach dem historischen Jesus… Sie zeigt, dass der historische Jesus bzw. die historische Jesusforschung eine unentbehrliche kritische Funktion zum Beispiel für alle „mythischen“ Christologien besitzt, die den himmlischen Christus vom irdischen Jesus trennen. Der „Christus nach dem Fleisch“ (Christos kata sarka) geht uns eben doch etwas an.
Außerdem hält Stegemann, S. 433, Folgendes für außerordentlich bemerkenswert:
Historisch geurteilt haben die Christen die Meistererzählung der antiken lsraeliten akzeptiert und nicht die der Griechen. Sie haben die Geschichte dieses partikularen Volkes, seines Gottes, seine Mythen über Schöpfung und die Ordnung des Kosmos, die moralischen Vorstellungen, die seinen heiligen Schriften inskribiert sind, übernommen.
Und darum beschreibt er die zweite wesentliche Aufgabe der Jesusforschung wie folgt (Stegemann, S. 431f.)
Dass Jesus von Nazareth ein Judäer aus Galiläa war, dass er die kollektive Identität seines jüdischen Volkes und die damit verbundenen kulturellen und religiösen Überzeugungen und Praktiken teilte, das ist nicht zufällig ein fundamentales Thema der historischen Jesusforschung. Es handelt sich dabei vielmehr um ein konstitutives Moment aller Aussagen über den historischen Jesus. Und es ist unbestreitbar auch ein moralischer Fortschritt, den die historische Jesusforschung erzielt hat, wenn es inzwischen immer schwieriger wird, Jesus gegen das Judentum auszuspielen.
Von diesen Überlegungen Stegemanns her kann ich Ihren an späterer Stelle formulierten Vorbehalten (S. 231) gegenüber der „modernen Exegese, die sich mit Vorliebe ‚historisch-kritisch‘ nennt“, durchaus nachvollziehen:
Wie oft findet man dort … Mängellisten für die Evangelien, akribische Sammlungen von Fehlern in Details, von Spannungen, Ungereimtheiten und Widersprüchen, wirklichen und scheinbaren, von prorömischen Tendenzdarstellungen und antijüdischen Affekten, die beweisen sollen, daß man es allenthalben mit ziemlich unglaubwürdigen, entstellten Berichten der Ereignisse zu tun habe. Solche Untersuchungen, die mit Reimarus und Strauß beginnen, werden noch gefördert durch die formgeschichtliche Zersplitterung des gesamten Überlieferungsgutes in kleine Einheiten, die man jeweils für sich auf echt oder unecht „abklopft“, um dann die echten Stücke nach Gutdünken zu einem neuen Bild zusammenzusetzen. Mit erstaunlicher Zuversicht glaubt man immer noch, man könne durch ein solches Selektieren, Gegen-den-Strich-Lesen und neu Zusammensetzen der Bruchstücke die wirklichen Vorgänge um den historischen Jesus „rekonstruieren“.
Es geht also gerade in der Auslegung der Evangelien wirklich nicht (S. 232) um „das Aufspüren von möglichst vielen Fakten“, sondern es muss ernstgenommen werden, dass die Evangelisten die Worte und Taten und das Schicksal Jesu als Juden unter dem Eindruck der Katastrophe von 70 n. Chr. verfassen und von den heiligen Schriften Israels her begreifen.
↑ Wie hätte wohl der Heide Plutarch die Evangelien gelesen?
Zum Schluss Ihres Buches gelangen Sie zu dem Fazit (S. 235), dass der römische Autor Plutarch uns mit
seinen bioi, seinen Lebens- und Charakterbildern, … zu einer gerechteren Beurteilung der Evangelien verhelfen [kann], als sie in einer bestimmten Form der historisch-kritischen Exegese üblich ist. Erwartungen, die man an seine Biographien nicht stellen kann, kann man auch an die Evangelien nicht stellen. Das gilt etwa von der Erwartung einer gewissen Vollständigkeit, genauer chronologischer und lokaler Angaben, der Darstellung einer inneren Entwicklung und einem Verzicht auf alles irgendwie Fiktive. …
So weit haben Sie gewiss Recht. Weiter schreiben Sie (S. 236):
Entscheidend ist, daß ein Bild vom Leben und den Leistungen der Persönlichkeit entsteht, vor allem ein Charakterbild des Betreffenden. Das alles gilt auch von den Evangelien.
Hier wiederhole ich meine Einschätzung, dass es den Evangelien um mehr als nur um ein Charakterbild Jesu geht – zentral geht es um die Frage, ob die Frohe Botschaft der Befreiung durch den Messias Jesus auch nach der Katastrophe von 70 n. Chr. noch tragfähig ist.
Dennoch kann es durchaus sein, dass (S. 237) „Plutarch von seinem religiös geprägten Weltbild her“ etwa die Evangelien des Markus oder Lukas „als Lebensbilder eines außergewöhnlichen Menschen, als bios, anerkannt“, ja, dass er (S. 237f.) auch das „Wunderbare darin … keinesfalls in Bausch und Bogen verworfen“ hätte. Im Gegensatz zu Kelsos (S. 242), der im 2. Jahrhundert als wohl „erste[r] gebildete[r] Heide … die Evangelien gelesen hat“, und zwar „mit größter Antipathie“, hätte Ihres Erachtens Plutarch (S. 242f.)
zweifellos mehr Verständnis für den Jesus der Evangelien aufgebracht und wäre nicht so gehässig gewesen wie Kelsos. Und vielleicht darf man sogar behaupten: Er, der fromme Heide, hätte mehr Verständnis für ihn aufgebracht als die gesamte liberal-skeptizistische Schule der Moderne, deren Weltbild von der sogenannten Aufklärung und ihren Vorurteilen geprägt ist. Denn diese Schule hat sich, was die Frage der Gottheit Jesu und seine Wunder angeht, in ihren ersten Vertretern Hermann Samuel Reimarus und David Friedrich Strauß bewußt Kelsos angeschlossen.
Allerdings merken Sie zu Recht an (S. 238): „Für ein echtes Verständnis des Ganzen hätten ihm schon die jüdischen Vorkenntnisse gefehlt.“ Alles in allem wäre also seine Lektüre der Evangelien vielleicht der Art gar nicht so unähnlich, wie viele Heidenchristen sie später gelesen haben – und zum Teil bis heute lesen.
↑ Wie viel Historie steckt in den Evangelien?
Ob sich (S. 244) die Erzählweise der Evangelien, die sich „an die erzählenden Bücher und Partien des Alten Testaments in griechischer Übersetzung“ anschließt, tatsächlich so eng mit der Gattung des modernen historischen Romans verknüpfen lässt, wie Sie das tun, lasse ich dahingestellt sein.
Auf jeden Fall erzählen die Evangelien (S. 246f.) „von den Anfängen einer großen Geschichte“:
Die Anfänge dieser Geschichte liegen jedoch nicht in prähistorischen Zeiten, sondern nur wenige Jahrzehnte zurück und sind deshalb Stoff für verläßliche Historie, die auch wissenschaftlich erforscht werden kann. Wenn man von den Evangelien nur verlangt, was sie tatsächlich bieten wollen und können, muß man sagen: sie haben sich als verläßliche Historie bewährt. …
Und trotzdem haben die Evangelien etwas von Mythen an sich. Sie erzählen von einer göttlichen Gründergestalt und wunderbaren, geradezu märchenhaften Ereignissen, vor allem aber: Sie erzählen. Wie Gott sich im Alten Testament dadurch als Gott Israels erwiesen hat, daß er sein Volk aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt hat (Ex 20,1; Dtn 5,6), so hat er sich dadurch als der Gott und Vater Jesu Christi erwiesen, daß er ihn von den Toten erweckt hat [Gal 1,1. Vgl. Apg 3,15;-1,10; 13,37 u. ö].
Gerade diese Parallele macht aber deutlich: Auch wenn etwa der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten historisch gar nicht nachweisbar ist, bleibt der Glaube Israels an die befreiende Macht des NAMENs wahr, da er sich immer wieder in der Geschichte Israels und der Juden bewährt hat. Ebenso hängt die Wahrheit des Vertrauens auf den Messias Jesus nicht an der historischen Faktizität jedes einzelnen Ereignisses, das in den Evangelien dargestellt wird.
Ihre nochmalige Bezugnahme auf das Johannesevangelium (S. 247) finde ich aufschlussreich:
um dieselbe Zeit, als Plutarch sich mit dem Problem herumschlug, wie man Mythen mit Hilfe des logos in eine historische Gestalt bringen soll, wurde in Ephesus ein Büchlein veröffentlicht, das mit den Worten begann: En archē ēn ho logos und kurz darauf den ungeheuren Satz wagte: ho logos sarx egeneto. Damit war die Vereinigung von Mythos und Historie gelungen. Und da das Wort mythos zunächst nichts anderes bedeutet als „Wort, Rede, Geschichte“ und somit ein Synonym zu logos darstellt, können wir auch sagen: Im Fleisch gewordenen Wort waren Mythos, Logos und Historie eins.
Das klingt gut und richtig. Aber ohne eine genauere Definition der Begriffe bleiben Missverständnissen Tor und Tür geöffnet. Alles hängt daran, ob Mythos, Logos und Historie griechisch verstanden werden, also von einem Gottesbegriff her, der das Göttliche als übernatürliche, jenseitige und mit dem inneren Menschen verbundene Sphäre des unsichtbaren Geistes versteht und diesem Geist die materielle Welt gegenüber stellt, oder ob sie auf das jüdisch-hebräische Verständnis des wirkmächtigen Tat-Wortes (= DaBaR) zurückgeführt werden, mit dem der NAME des Gottes Israels seinem Volk und durch den Messias Jesus auch den Völkern Befreiung, Gerechtigkeit und Frieden (= SchaLOM) verheißt.
↑ Ist mit dem lebendigen Jesus die große Idee des Christentums in die Welt gekommen?
Abschließend fragen Sie (S. 248):
Was macht denn, bei aller Verschiedenheit, die Einheit der Evangelien aus, die mit den Überschriften „Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes“ behauptet wird?
Die entscheidende Antwort, die Sie darauf geben (S. 249), ist der „Gegenstand“ selbst, „der den vier Evangelien zugrundeliegt“, denn dieser
hat sich als lebendig, ja sehr lebendig erwiesen. Das eine Evangelium mit seinem Protagonisten ist im Laufe der Sammlungs- und Überlieferungsgeschichte und bei den verschiedenen Versuchen, zu deuten und danach zu leben, immer reichhaltiger, immer umfassender und immer umstrittener geworden. Die Deutungen mußten immer mehr Sachverhalte einbeziehen und einer ständig anwachsenden Fülle von Einsichten in die Zusammenhänge gerecht werden. Man fing schon bald nach Ostern an zu streiten, welche Deutungen und praktischen Folgerungen der Sache gerecht werden und welche nicht.
Sie begreifen nun unter Berufung auf John Henry Kardinal Newman136 (S. 250)
das ganze Christentum als die Entfaltung einer einzigen großen Idee, die mit Jesus von Nazaret in die Welt gekommen ist. Dabei darf man das Wort „Idee“ nicht im Sinne einer grauen, blutleeren Theorie verstehen, sondern im Sinne eines beschreibbaren Gehalts und Sachverhalts, der mit einem realen Gegenstand gegeben ist. Eine derartige Idee ist lebendig, wenn sie in einem Menschen oder einer menschlichen Gemeinschaft wirksam wird und lebt.
So ist es auch im Fall der Idee des Christentums. Sie umfaßt Gedanken, Worte und Werke. Sie kam mit Christus als Ganze zur Welt, aber ihre Implikationen und Potentiale wurden erst im Laufe der Zeit erkennbar.
Sie begreifen die Evangelien als frühe Zeugnisse und Entfaltungen „dieser großen Idee des Christentums“ (S. 251) und beenden Ihr Buch mit folgenden Worten:
Schon Markus versuchte zu zeigen, wie es kam, daß Gottes Sohn am Kreuz endete. Dieses Faktum ist das Grundparadox des Christentums. Johannes hat ihm mit der Formulierung vom fleischgewordenen Wort den repräsentativen Ausdruck verliehen. Newman und viele andere waren der Meinung, daß er damit die konstitutive Idee des Christentums formuliert hat, obwohl selbstverständlich auch diese Idee nicht das Ganze repräsentiert. Dieses Ganze repräsentiert nur der lebendige Christus. Und allein dieser lebendige Christus erklärt die Geschichte des Christentums. Daß diese Geschichte nicht nur eine Geschichte zunehmender Entwicklung und Entfaltung war, sondern auch eine Geschichte von Verrat und Verkennung steht auf einem anderen Blatt.
Meine Anfrage an Sie besteht letztlich in der Frage, ob nicht schon die Beschreibung dieses lebendigen Christus als „Idee“ insofern in die von Ihnen angedeutete „Geschichte von Verrat und Verkennung“ hineingehört, als man damit den Tod des jüdischen Messias Jesus am römischen Kreuz in ein abstraktes „Grundparadox des Christentums“ verwandelt und fast vollständig aus seinem jüdisch-hebräischen Wurzelboden herauslöst.
Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, die mir Gelegenheit boten, meine eigenen Gedanken zu den Evangelien klarer herauszuarbeiten, und grüße Sie herzlich!
Ihr Pfarrer i. R. Helmut Schütz
↑ Anmerkungen
(1) Alle Zitate in dieser Buchbesprechung, die nach einer bloßen Seitenzahl ohne weitere Quellenangabe aufgeführt werden, stammen aus Ihrem Buch, dabei sind längere Zitate blau hinterlegt. Bibelzitate hinterlege ich meiner Gewohnheit entsprechend gelb. Längere Zitate aus den in den folgenden 4 Anmerkungen angegebenen Büchern haben einen roten, aus anderen Büchern einen weißen Hintergrund.
Für die Wiedergabe altgriechischer Wörter verwende ich eine einfache deutsche Umschrift, bei der ich zur Unterscheidung der beiden e- und o-Laute den Oberstrich verwende: Eta = ē, Omega = ō. Ich erlaube mir, diese Umschrift auch für Wörter innerhalb von Fremdzitaten zu verwenden, um ihre Lesbarkeit für Nicht-Griechisch-Kenner zu erleichtern.
Übersetzte biblische Namen können in Zitaten verschiedener Autoren voneinander abweichen (zum Beispiel bei dem in der Lutherbibel verwendeten Städtenamen „Kapernaum“, der mit „Kafarnaum“ bedeutungsgleich ist).
Hinzufügungen zu Zitaten in eckigen Klammern [] enthalten Übertragungen weniger geläufiger Namensformen oder Fremdwörter, manchmal auch Bibelstellen, die von Ihnenn in einer Anmerkung angegeben waren.
Für hebräische Wörter benutze ich meist allgemein übliche Eindeutschungen. Wenn ich hebräische Wörter genauer wiedergeben will, greife ich zur deutschen Umschrift auf Großbuchstaben für Konsonanten und kleine Buchstaben für Vokale zurück. Da solche Wörter in diesem Beitrag aber nur selten vorkommen, verzichte ich hier auf noch eingehendere Erläuterungen.
Die häufig in diesem Beitrag vorkommende Abkürzung LXX bezieht sich auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die so genannte Septuaginta (Übersetzung „der Siebzig“).
(2) Ich zitiere im Folgenden mit Bedenbender 1: Andreas Bedenbender, Frohe Botschaft am Abgrund. Das Markusevangelium und der Jüdische Krieg, Leipzig 2013, und mit Bedenbender 2: Andreas Bedenbender, Der gescheiterte Messias, Leipzig 2019.
(3) Ich zitiere im Folgenden mit Veerkamp 1: Ton Veerkamp, Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21. In: Texte & Kontexte Nr. 109-111, 2006, mit Veerkamp 2: Ton Veerkamp, Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25. In: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, mit Veerkamp 3: Ton Veerkamp, Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen, 2., grundlegend überarbeitete Auflage. In: Texte & Kontexte, Sonderheft Nr. 3, 2015, und mit Veerkamp 4: Ton Veerkamp, Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung, Berlin 2013.
(4) Einfach mit Breukelman werde ich folgenden Beitrag des Autors zitieren: Frans Breukelman, Und es geschah… Eine kurze Besprechung der Ouvertüre des Evangeliums nach Lukas, in: Texte & Kontexte Nr. 64, 1994, S. 47.
(5) Mit Stegemann zitiere ich sein Werk: Wolfgang Stegemann, Jesus und seine Zeit, Biblische Enzyklopädie, Band 10, Stuttgart 2010.
(6) Ihre Anm. 1: R. Schneider, Der Starez, in: Ders., Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Wiesbaden 1946, 159-165, hier 165.
(7) Ihre Anm. 29: Scott D. Charlesworth, Early Christian Gospels: Their Production and Transmission (Papyrologica Florentina 47), Florenz 2016.
(8) Das hebräische Wort GOJ (griechisch ethnos) bezeichnet im hebräischen Alten Testament in der Regel alle anderen Völker außer dem Volk Israel. Die Mehrzahl GOJiM wird ins Deutsche häufig mit dem Wort „Heiden“ übersetzt; korrekter wäre die Übersetzung „Völker“ oder „Menschen aus den Völkern“. Wenn das Wort „Volk“ sich auf Israel bezieht, wird meist das hebräische Wort ˁAM verwendet (griechisch: laos).
(9) Ihre Anm. 15: Hdt. [Herodot], Vorwort.
(10) Ihre Anm. 16: Vgl. H. Strasburger, Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung (SbWGF Bd. 5 1966 Nr. 3), Wiesbaden 1966, 63.67.
(11) Ihre Anm. 17: Vgl. ebd. 65f. Er verweist auf Tac. Ann. [Tacitus, Annalen] 4,32: Die friedlichen Zeiten machen es einem Geschichtsschreiber schwer.
(12) Ihre Anm. 21: Plut. Ant. [Plutarch, Antonius] 70,1.
(13) Ihre Anm. 22: Plut. Kleom. [Plutarch, Kleomenes] 21,1.
(14) Ihre Anm. 23: Plut. Cato. min. [Plutarch, Cato minor] 59,2; 70,2. 4. Die Zeit der krähenden Hähne auch Arat. [Plutarch, Aratos] 8,3.
(15) Ihre Anm. 24: Plut. Ant. [Plutarch, Antonius] 65,4. Hier mit temporaler Parataxe [= zeitliche Aneinanderreihung von Hauptsätzen] wie in Mk 15,25.
(16) Ihre Anm. 25: Plut. Pomp. [Plutarch, Pompeius] 62,1.
(17) Ihre Anm. 26: K. Ziegler, Große Griechen und Römer III 369 Anm. 1 zu S. 227.
(18) Ihre Anm. 27: Vgl. dazu Ch. Pelling, Plutarch‘s Adaptation of his Source-Material, in: Ders., Plutarch and History 91-115, hier 92f.
(19) Ihre Anm. 28: Vgl. E. Lämmert, Bauformen des Erzählens 82-85; J. Vogt, Aspekte erzählender Prosa 99-117.145f.
(20) Ihre Anm. 37: Vgl. Theon, Prog. [Theon von Alexandria, Progymnasmata] 8 (115,11-118,6).
(21) Ihre Anm. 69: U. von Wilamowitz-Moellendorff, Plutarch als Biograph 264.
(22) Nach meinen Vorgaben von Anm. 1 müsste ich mit ThORaH umschreiben; hier bleibe ich aber bei dem Wort „Tora“, das ich auch sonst immer für die Wegweisung des Gottes Israels verwende.
(23) Vgl. 2. Mose 4,22; Psalm 2,7; Sirach 4,10; Weisheit 2,18 und 18,13.
(24) Mit dem in Großbuchstaben geschriebenen NAMEN deute ich den Namen JHWH des Gottes Israels an, der wegen einer Einzigkeit und Unverfügbarkeit nicht ausgesprochen werden sollte. Dieser NAME erscheint im Neuen Testament dort, wo von Gott als dem „Vater“ die Rede ist. Mit dem Wort kyrios = „Herr“ kann im Neuen Testament sowohl der NAME als auch der Messias des NAMENs, nämlich Jesus, gemeint sein.
(25) Ihre Anm. 82: Aug., cons. ev. II 17 (PL 34,1079): sic unumquemque Evangelistam contexere narrationem suam, ut tamquam nihil praetermittentis series digesta videatur: tacitis enim quae non vult dicere, sic ea quae vult dicere, illis quae dicebat adiungit, ut ipsa continuo sequi videantur.
(26) Das Kunstwort TeNaK setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Heiligen Schrift der Juden: ThORaH = 5. Bücher Mose, NɘBIˀIM = (vordere und hintere) Propheten, KɘThUBIM = (sonstige) Schriften.
(27) Ihre Anm. 90: Vgl. E. Lämmert, Bauformen des Erzählens 67-70; J. Vogt, Aspekte erzählender Prosa 148.
(28) Ihre Anm. 93: Vgl. R. Alter, Between Narration and Dialogue, in: Ders., The Art of Biblical Narrative, New York 1981, 63-87; A. D. Baum, Einleitung 142-145.
(29) Ihre Anm. 107: So das Urteil von Christopher Pelling, Truth and Fiction in Plutarch‘s Lives, in: Ders., Plutarch and History 143-170, hier 147.
(30) Bedenbender 1, S. 70.
(31) Adela Yarbro Collins, Reflections on the Conference at the University of Aarhus, July 25–27, 2008, in: E. M. Becker / A. Runesson (edd.), Mark and Matthew I. Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in their First-Century Settings, Tübingen 2011, 411-414, hier S. 414.
(32) Das war meine Übersetzung der folgenden Textpassage von Yarbro Collins:
As Homi Bhabha und other post-colonial theorists have argued, in a situation of cultural hegemony, subaltern people mimic the values and practices of their rulers, but with a difference. The author of Marks imitates Greek and Roman historiography and biography by combining certain techniques and values associated with them in his narrative, but also displaces these from the framework of Greek culture and Roman imperium. Instead, he re-places them in an implied, biblical, master-narrative, constructed from the Septuagint, which culminates in an apocalyptic scenario.
(33) Ihre Anm. 110: Plut., De fortuna Romanorum 8 (mor. 321 A). Der Satz geht weiter: „…, und besonders bei einer Stadtgründung.“ Im Zusammenhang geht es um den Anfang der Stadt Rom. Vgl. auch Plut., De Iside et Osiride 36 (mor. 365 B): archē gar ho theos.
(34) Ihre Anm. 116: Plut., Quaestionum Convivalium libri V 7,2 (mor. 681 C). Das führt Plutarch näher aus.
(35) Ihre Anm. 117: Psalm 110 (111),10; Sprüche 1,7; 9,10; Sirach 1,14.
(36) Ihre Anm. 118: Weisheit 14,27. Weitere Anfangsbestimmungen dieser Form: Sprüche 16,7; Weisheit 6,17; 14,12; Sirach 10,12. 13; 11,3; 25,24; 29,21 37,16; 39,26.
(37) Ihre Anm. 119: Plut. Ant. [Plutarch, Antonius] 6,1f. Vgl. Cic. Phil. 11 22 (55).
(38) Ihre Anm. 120: Plut., De superstitione 12 (mor. [Moralia] 171 A). Übersetzung: H. Görgemanns, Religionsphilosophische Schriften 39.
(39) Ihre Anm. 121: Markus 10,6. Vgl. Matthäus 19,8.
(40) Ihre Anm. 122: 1. Johannes 2,24. Der Grieche betont gern den Start, den Ausgangspunkt: Vgl. J. A. Kleist, St. Mark 151f („Stressing the Starting-Point“).
(41) Ihre Anm. 123: Vgl. A. Adam, Ostern alle Jahre anders? Zur Geschichte und Verbesserung des Kalenders, Paderborn 1994, 73-78.
(42) Vgl. dazu Veerkamp 1, S. 99f. zu Johannes 5,17 im Zusammenhang mit der Heilung des Gelähmten:
Schabbat [also der siebte Tag als Vollendung der Schöpfung, an dem der NAME von seinen Werken ruht] ist erst, wenn alle Werke getan sind, wenn alle Menschen heil sind und sie endlich das sind, was sie sind: Ebenbild Gottes. Bis jetzt sind die Menschen alles andere als Ebenbild Gottes, sie sind nicht, was sie sind – Ebenbild Gottes -, und sie sind, was sie nicht sind: verstümmelte, kaputte Menschen; es gibt nichts zu feiern. Das jedenfalls meinen diese Messianisten.
(43) Ihre Anm. 20: Zu dieser historischen Wahrscheinlichkeit vgl. C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans (CECNT) Bd. 2, Edinburgh 1986, 793f.
(44) Bedenbender 1, S. 329ff.
(45) Ebenda, S. 160.
(46) Ebenda, S. 161, Anm. 9: Vgl. Mk 8,14-21: Es gibt zwei Speisungen, aber in Christus (dem „einen Brot“) sind sie eins.
(47) Ebenda, S. 101 mit Anm. 88.
(48) Vgl. ebd., S. 368-371, und Adela Yarbro Collins, Mark (Hermeneia), Minneapolis 2007, S. 608ff.
(49) S. 66f.:
Die erste Überschrift ist die für das gesamte Buch: „Das Wort des Herrn, das erging an Hosea, den Sohn Beeris in den Tagen des Usija …“. Dann folgt als zweite Überschrift: „Der Anfang des Wortes des Herrn an Hosea: …“. Der ersten Überschrift entspricht das „Nach Markus“ über unserem Evangelium, der zweiten der eigentliche Beginn des Buches.
(50) Siehe dazu Bedenbender 1, S. 210, Anm. 70:
Es geht also nicht um Johannes den Täufer, der als „Rufer in der Wüste“ verkündet: „Bereitet den Weg des Herrn“. Der Vers ist vielmehr so abzuteilen, wie es der Akzentsetzung des MT [= des hebräischen Textes im Buch Jesaja] entspricht: „Stimme eines Rufenden: ‚In der Wüste bereitet den Weg des Herrn!‘“ Vgl. auch ebd. Bedenbenders Ausführungen S. 165-190 über die Begriffe „Topos und emēros topos im Markusevangelium“; dabei geht es (S. 166) regelmäßig um einen Ort, der „öde, wüst, verwüstet“ und „einsam“ ist und der (S. 190) als „Schlüsselbegriff“ Erinnerungen an die erste Tempelzerstörung aufruft und es dem Autor gestattet, „vom traumatischen Geschehen der Tempelzerstörung zu reden, ohne auf sie zu sprechen zu kommen“.
(51) Bedenbender 1, S. 14.
(52) Ebenda, S. 15f.
(53) Veerkamp 1, S. 31.
(54) Bedenbender 1, S. 483.
(55) Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity, Grand Rapids 2003.
(56) In Ihrer Anmerkung 22 an dieser Stelle beziehen Sie sich nur auf heidnische Belege: Das sagt Plutarch explizit in De amicorum multitudine (mor. 94 A). Vgl. Bauer, WbNT s. v. agapētos.
(57) Bedenbender 1, S. 9, Anm. 17.
(58) Ebenda, S. 9f.
(59) Die beiden folgenden Zitate ebenda, S. 6f.
(60) Ebenda, S. 188-190; darauf beziehen sich die folgenden Seitenzahlenangaben in diesem Abschnitt.
(61) In seiner Anmerkung 64 auf derselben Seite erläutert Bedenbender zusätzlich:
Daß die in Mk 1,13 erwähnten thēria auf die Seite Satans gehören und also Opponenten Jesu darstellen (anders gesagt, daß es hier nicht um eine friedliche, an das Paradies gemahnende Gemeinschaft des Erlösers mit der Tierwelt geht), begründet Yarbro Collins 2007 [siehe meine Anm. 48], 151-153, umsichtig aus der biblischen und der frühjüdischen Literatur.
(62) Ich verdanke diese Information dem Buch von Walter-Jörg Langbein, Lexikon der Irrtümer des Neuen Testaments. Von A wie Apokalypse bis Z wie Zölibat, München 2007, S. 194.
(63) Ihre Anm. 6: Plut., Bellone an pace clariores fuerint Athenienses 3 (mor. [Moralia] 347 D): zwei Belege. Das Verb euangelizein „eine gute Nachricht bringen“ begegnet in Mar. [Marius] 22,3. Euangelos begegnet sogar als Eigenname (Plut. Philop. [Plutarch, Philopoimen] 4,4).
(64) Bedenbender 1, S. 92-93.
(65) Diese beiden Erläuterungen zitiert Bedenbender ebd. nach G. Strecker, Art. euangelion, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, hg. v. H. Balz und G. Schneider, 2., verb. Aufl. mit Literaturnachträgen, Band 2, Stuttgart/Berlin/Köln 1992, 176–186, hier S. 179.
(66) Irrtümlich unterläuft Bedenbender bei der Zitierung dieser Stelle aus dem Propheten Nahum der Zahlendreher Nah 1,2.
(67) Vgl. dazu Bedenbenders Ausführungen, ebd., auf S. 430f.:
„Kapernaum“ aber, oder „Kefar Nachum“, heißt seinem aramäischen Wortsinn nach „Dorf Nahums“. Es ist nicht abwegig, darin einen Bezug auf die biblische Schrift des Propheten Nahum zu sehen. Das Nahumbuch wird ganz von der Erwartung des Gerichts beherrscht, das über das assyrische Großreich (= Ninive) hereinbrechen wird, und Nahum glaubt damit auf seine Weise ein Evangelium zu verkünden [seine Anm. 38: Vgl. die (offenkundig parallel zu Jes 52,7 gestaltete) Einleitung zur Nachricht von Ninives Fall in Nah 2,1: „Siehe auf den Bergen die Füße eines Freudenboten“ (LXX: euangelizoumenoi).]; das kann einem schriftgelehrten Autor wie Markus, der den Wortstamm euangel- mit großer Macht und großer Originalität zu Ehren brachte, nicht entgangen sein. Die Annahme, „Kapernaum“ stehe als metonymischer [= in einem übertragenen Sinn verwendeter] Verweis auf die Botschaft Nahums für die Erwartung, Rom gehe seinem Untergang entgegen, paßt zu allen drei synoptischen Evangelien gleichermaßen.
(68) Ihre Anm. 29: Plut. Tit. Flam. [Plutarch Tit. Flaminius] 10,3-5. Dasselbe bei Polyb. [Polybios] 18,46. Plutarch zitiert ebd. 16,4 ein Preislied, in dem Titus als „Heiland“ angeredet wird. Ein weiteres schönes Beispiel für den Auftritt eines stimmgewaltigen Herolds und seines Rufes bietet das Ende von Plutarchs „Timoleon“ (39,4f).
(69) Ich merke dazu an: Eine Paronomasie ist ein Wortspiel durch Zusammenstellen lautlich gleicher oder ähnlicher Wörter gleicher Herkunft.
(70) Bedenbender 1, S. 153f.
(71) Vgl. dazu auch Bedenbender 1, S. 132-142.
(72) Bedenbender 2, S. 28. Ja, ich weiß, dieses Buch ist erst 12 Jahre nach meiner Predigt erschienen. Bedenbender hatte seine entsprechenden Gedanken schon früher in einem Aufsatz formuliert.
(73) Vgl. dazu nur einen Satz aus Bedenbender 1, S. 485:
Wenn das Leiden Israels als Passion Jesu verstanden wird, ist all das, was christliche Theologie von nun an über Israel zu sagen hat, nicht unter das Vorzeichen einer von Gott bewirkten Strafe zu stellen, sondern – gerade auch gegen den Augenschein – unter das Vorzeichen von Heilung und Heil.
(74) Alle folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Andreas Bedenbender, ebd., S. 191-202.
(75) Demzufolge (S. 194) Jesus ein Sohn Gottes „gewesen“ ist; dieses Wort „steht ganz am Ende der Wortfolge und erhält damit ein besonderes Gewicht.“
(76) Bedenbender 1, S. 80f. Die weiteren Seitenzahlen bis zum Ende dieses Abschnitts beziehen sich auf dieses Buch.
(77) Dazu Bedenbenders Anm. 23: Dazu paßt, daß in Mt 9,10 (wie übrigens bereits in Mk 2,15) die „Zöllner und Sünder“ außer mit Jesus auch mit den mathētai zu Tisch sitzen.
(78) Veerkamp 4, S. 322.
(79) Vgl. dazu nur folgenden Abschnitt aus Frans Breukelman, Umschreibung des Begriffs einer „Biblischen Theologie“ in: Texte & Kontexte Nr. 31/32, 1986, S. 13-39, hier S. 23:
Wir beabsichtigen, die biblische Theologie, wie wir sie entfalten, aus drei Teilen bestehen zu lassen. Unter dem Titel toledot (Zeugungen) werden wir im ersten Teil die Theologie des Buches Genesis besprechen, weil wir es im sēpher tolɘdôth ādham [Buch der Zeugung aˀdams, des Menschen], in dem es um die Entstehung Israels inmitten der goyîm geht, mit der Ouvertüre zum Ganzen des Tenakh zu tun haben. Im zweiten Teil werden wir dann unter dem Titel dɘbharim so vollständig wie möglich das ganze … Grundmuster der biblischen Theologie beschreiben. Alle Theologie, die wir in der Bibel antreffen, nicht nur die des Alten, sondern auch die des Neuen Testaments, werden sich als Varianten dieses Grundmusters erweisen. Im dritten Teil werden wir zeigen, wie alle neutestamentlichen Zeugen dies miteinander gemein haben, daß sie uns das apostolische Kerygma streng innerhalb des Rahmens des anti-heidnischen Zeugnisses des Tenakh hören lassen. Als Paradigma dafür werden wir … eine sehr ausführliche Beschreibung der Theologie des Evangelisten Matthäus vorausschicken.
(80) Vgl. dazu meinen Gottesdienst Männer und Frauen im Stammbaum Jesu und auch meinen umstrittenen Aufsatz … Marie, die reine Magd.
(81) Vgl. dazu meinen Gottesdienst: Von Adam zu Immanuel – Gott mit uns!
(82) Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity, Grand Rapids, Michigan 2003, 337f. (meine Übersetzung aus dem Englischen):
Diese hohe Sicht von Jesus spiegelt sich auch in Matthäus‘ Vorliebe für Szenen wider, in denen Menschen Jesus Verehrung entgegenbringen. Viel öfter als in den anderen Evangelien benutzt Matthäus das griechische Wort proskynein, um die Ehrerbietung gegenüber Jesus zu beschreiben. Das Verb wird verwendet für eine Haltung der Ehrerbietung gegenüber einem sozial Höherstehenden, wenn man um Gnade oder Gunst bittet (z. B. Mt 18,26), aber es kann auch die Anbetung eines Gottes bedeuten (z. B. 4,9-10). Die Magier kommen, um Jesus anzubeten, Herodes tut so, als ob er das auch machen will (2,2.8.11). Wer ein Wunder sieht (8,2; 9,18; 15,25) und die Mutter der Zebedaiden … (20,20) fällt vor Jesus nieder … Das passt in den kulturellen Kontext der erzählten Ereignisse, wird von den Lesern aber auch als unwissentliche Vorwegnahme aus nach-jesuanischen Kreisen verstanden worden sein.
In mindestens drei matthäischen Szenen ist noch offensichtlicher eine Parallele zur eigenen Gottesdienstpraxis der Leser im Blick, in der Jesus gemeinsam mit Gott Anbetung erfährt. Am Ende der Seewandelgeschichte (Matthäus 14,22-33 / vgl. Markus 6,45-52) ändert Matthäus den Schluss der Markusversion mit den verwunderten Jüngern mit dem Satz: „Wahrlich, du bist der Sohn Gottes!“ … Und in der nach-Auferstehungs-Erzählung fallen sowohl die Frauen als auch die Jünger vor einem Jesus nieder, dem Status und Macht in transzendentem Sinn zugeschrieben wird (28,9.17)…
Im Original ist Folgendes zu lesen 337f:
This high view of Jesus is also reflected in Matthew’s fondness for scenes where people give reverence to Jesus. Much more frequently than the other Gospel authors, Matthew uses the Greek word proskynein to describe the reverence that people offer Jesus. The verb designates a reverential posture that one adopts toward a social superior when pleading for mercy or seeking a favor (e.g.,Matt. 18:26), but also it can mean the worship one gives to a god (e.g., 4:9-10). The Magi come to reverence Jesus, and Herod falsely professes a readiness to do so (2:2, 8, 11). Those who seek a miracle (8:2; 9:18; 15:25) and the mother of the Zebedee brothers, who requests a special place for them in Jesus’ future kingdom (20:20), make this reverential gesture (all of which uses of proskynein have no parallel in the other Synoptic Gospels). In these cases the gesture is perfectly plausible in the cultural context of the events narrated, but it is also likely that the intended readers would have seen the reverence as an unwitting anticipation of post-Jesus Christian circles.
In at least three Matthean scenes, the gesture still more obviously connotes reverence that readers are to see as reflecting their own worship practice, in which Jesus is recipient along with God. In the concluding sentence of the Matthean version of the story of Jesus walking on the waves (14:22-33; cf. Mark 6:45-52), the disciples reverence and acclaim Jesus, saying, “Truly you are the Son of God” (v. 33). This is a striking modification of the Markan version, which ends with the disciples amazed but not perceptive of what has been revealed (6:52). Finally, twice in the postresurrection narratives Jesus’ followers give this reverence to the risen Jesus: the women hurrying fromthe tomb (Matt. 28:9), and in the climactic scene, where Jesus meets his followers and commissions them in august tones (28:17). In all three scenes Jesus’ transcendent status and power are indicated, and it seems undeniable that the intended readers were to take the scenes as paradigmatic anticipations of the reverence for Jesus that they offered in their worship gatherings.
(83) Die folgenden Seitenzahlen bis zum Ende dieses Abschnitts beziehen sich auf Bedenbender 2.
(84) Bedenbender 1, S. 219f.:
lm Mk-Ev ist das biblische „Meer“ … nicht einfach ein „Meer“. Dort, wo Markus es in seinen Text einführt, in 1,16, und ebenso bei der letzten Erwähnung, in 7,31, wird es durch das nachgestellte Genitivattribut näher bestimmt als thalassa tēs Galilaias. Wir haben es mit dem „galiläischen Meer“ zu tun, dem See Genezareth. …
Im Spätsommer des Jahres 67, das schildert Josephus zum Ende des 3. Buches seines Bellum Judaicum, waren bei der Eroberung der am See Genezareth gelegenen Stadt Tarichea durch die Römer viele Aufständische mit Booten hinaus auf den See geflohen; ihre weit überlegenen Gegner hatten den Flüchtlingen nachgesetzt und sie systematisch massakriert…
„Die heranfahrenden Römer durchbohrten viele, die sich durchzuschlagen versuchten, mit ihren Speeren; andere schlugen sie rnit dem Schwert nieder, nachdem sie in ihre Fahrzeuge gesprungen waren. (…) Kam einer der Untergesunkenen mit dem Kopf wieder hoch, so traf ihn gleich ein Geschoß oder erwischte ihn ein Floß; versuchte aber jemand, weil ihm gar nichts anderes übrig blieb, in ein feindliches Boot zu klettern, so schlugen ihm die Römer den Kopf oder die Hände ab. Überall kamen die Juden in großer Zahl und auf mannigfache Weise um, bis die Überlebenden, auf ihren Booten umzingelt, auf der Flucht gegen das Ufer gedrängt wurden. Beim Versuch der Landung wurden viele von Speeren durchbohrt, noch bevor sie den Strand erreicht hatten. Zahlreiche andere sprangen ans Land und wurden von den Römern niedergemacht. Der ganze See sah aus, wie von Blut gerötet und wie von Leichen angefüllt, denn niemand konnte sich retten. Die ganze Gegend litt in den folgenden Tagen unter einem fürchterlichen Gestank und bot ein gräßliches Bild. Denn die Ufer waren von Schiffstrümmern und außerdem von aufgedunsenen Leichen bedeckt; in der sommerlichen Hitze verpesteten die verwesenden Toten die ganze Luft, was nicht nur für die leidbetroffenen Juden Jammer brachte, sondern auch den Urhebern des Unglücks äußerst widerwärtig war. Das war das Ende dieser Seeschlacht; 6700 Menschen fanden den Tod, die schon vorher in der Stadt Gefallenen mit eingerechnet“ (Bell 3,526-531).
(85) Ebenda, S. 88f.
(86) Ihre Anm. 81: Plut. Alex. [Plutarch, Alexandros] 64, 9. Vgl. H. Van Thiel, Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der griechische Alexanderroman nach der Handschrift L, Darmstadt 1974, 242-247.
(87) Ihre Anm. 82: M. Hengel, Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21f. und Jesu Ruf in die Nachfolge (BZNW 34), Berlin 1968, 16.
(88) Vgl. meinen Gottesdienst Nicht zurückblicken!
(89) Bedenbender 2, S. 280, Anm. 32.
(90) Ebenda; auf dieses Buch beziehen sich auch die folgenden Seitenzahlen bis zum Ende des Abschnitts.
(91) Der Evangelist Lukas bettet nach Bedenbender 2, S. 284, dasselbe Wort in einen anderen Kontext ein, nämlich in
den Konflikt mit den Samaritanern (die zugleich stellvertretend für weitere Gruppen von Kontrahenten der Gemeinden Jesu stehen mögen) und um einen Jesus, der dazu anleitet, auf Vergeltung zu verzichten (vgl. Lk 6,27-29).
Das Wort von den Toten, die die Toten begraben sollen, heißt nun: Wünscht euch nicht, die Untaten der Vergangenheit an euren Feinden zu rächen – schaut überhaupt nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorn (vgl. V. [9,]62).
(92) Ihre Anm. 23: Plut. Amatorius 17 (mor. [Moralia] 762 A).
(93) Ihre Anm. 41: Gute Darstellung bei G. Lohfink, Jetzt verstehe ich die Bibel. Ein Sachbuch zur Formkritik, Stuttgart 1973, 110-120.
(94) Ihre Anm. 42: Näheres bei M. Reiser, Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift. Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese und Hermeneutik (WUNT 217), Tübingen 2007, 88-98.
(95) Bedenbender 1, S. 305f.
(96) M. Hengel / A. M. Schwemer, Jesus und das Judentum 306.
(97) Bei denen es sich „in erster Linie um Geburtsgeschichten“ handelt, wie Sie auf S. 164 anmerken werden.
(98) Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity, Grand Rapids 2003, S. 318ff. Die folgenden Seitenzahlen bis zum Ende dieses Abschnitts beziehen sich auf dieses Buch; die angeführten Zitate habe ich selbst aus dem Englischen übersetzt. Hier die Originalstellen:
S. 322:
… we might posit that a claim about Jesus’ miraculous conception was circulating as much as a decade or more earlier than Mark.
S. 319:
We may begin with the curious reference in Mark 6:3 to Jesus as “the carpenter, the son of Mary.” … With Marcus, I judge it likely that this matronymic reference to Jesus by those pictured in the scene as offended by him, is to be taken as their “slur against his legitimacy.”
S. 321:
So it is worth considering whether the crowd’s hostile reference to Jesus as “son of Mary” is another example of what we see elsewhere in Mark: a derogatory comment that unwittingly says what readers can recognize as truth. Indeed, perhaps the intended readers were expected to know the claim that he really is “son of Mary” and not the offspring of his father, Joseph, because he was conceived by divine miracle.
S. 328:
In sum, both nativity narratives are thoroughly suffused with biblical and Judaic tradition and are composed in the idioms of that tradition. The same is true of what appears to be the common prior tradition of Jesus’ miraculous conception upon which both narratives depend. All this means that the most likely provenance for the idea that Jesus was conceived miraculously by God’s Spirit is in circles of Jewish Christians and/or mixed Gentile and Jewish Christian circles that preferred to articulate their faith in Jesus in the idioms and conceptual categories of Jewish tradition.
(99) Siehe dazu oben meine Ausführungen zum Stammbaum Jesu bei Matthäus und der passiven Rolle der Väter Abraham und Josef bei der Geburt ihres verheißenen Sohnes.
(100) Die folgenden Seitenverweise beziehen sich alle auf Breukelman (siehe Anm. 4).
(101) Vgl. dazu meinen Gottesdienst: Weltgeschichte und Gottesgeschichte, in dem ich Einsichten von Frans Breukelman auf die Auslegung der Weihnachtsgeschichte angewendet habe.
(102) Ihre Anm. 65: M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, übersetzt von L. Wickert, 2 Bde., Leipzig 1929, I 39.
(103) In Ihrer Anmerkung, in der sie dazu auf Mt 2,21 verweisen, ist Ihnen ein Zahlendreher unterlaufen: richtig muss es heißen: Mt 1,21.
(104) So übersetzt Gerhard Jankowski, Das Evangelium nach Lukas, in: Texte & Kontexte Nr. 145-147, 2015, S. 38f., die Stelle.
(105) Die Seitenzahlen bis zum Ende dieses Abschnitts stammen aus Bedenbender 1. Zu den Ereignissen, die mit dem See Genezareth zusammenhängen, siehe oben.
(106) Er ist der einzige Evangelist, der den See Genezareth geographisch „korrekt“ mit limnē = „See“ und nicht mit thalassa = „Meer“ bezeichnet, möglicherweise weil er nicht dieselben Schreckensbilder mit dem Binnensee verbindet wie die anderen Evangelisten.
(107) Ihre Anm. 77: Vgl. E. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums Bd. I/1, Stuttgart / Berlin 1921, 46-50.
(108) Breukelman, S. 47.
(109) Veerkamp 1, 2 und 3 (siehe Anm. 3). Um einen Eindruck zu vermitteln, was Ton Veerkamp mit dem „Abschied des Messias“ meint, zitiere ich Veerkamp 2, S. 142, wo er ausführt, dass im
Johannesevangelium… ohne Umschweife das Scheitern des messianischen Projektes festgestellt wurde, 12,37ff. Seine Schlußfolgerung ist nicht der Abschied vom Messias, sondern vielmehr der Abschied des Messias. „Es ist euch nützlich, daß ich weggehe“, sagt Jeschua zu seinen Schülern, 16,7. Der Abschied vom Messias wäre nichts anderes als das Eingeständnis, daß die Schüler sich geirrt hatten. Wäre Johannes dieser Ansicht gewesen, hätte er so etwas wie den Jüdischen Krieg des Flavius Josephus geschrieben. Der Weggang des Messias besagt aber zweierlei. Er entlarvt die messianischen Illusionen der Messianisten, gleich ob sie Schüler des Jeschua waren oder zelotische Kämpfer, die ihre eigene Auffassung über den Messias hatten. Keine menschliche Politik kann je messianisch sein, keine menschliche Politik kann die Probleme der Menschheit definitiv lösen. Hätten die russischen Bolschewiki ihren eigenen Messianismus durchschaut, wäre aus ihrem revolutionären Projekt nicht so schnell und gründlich Stalinismus geworden. Jede messianische Politik wird unvermeidlich zu irgendeiner Form des Stalinismus. Der Abschied des Messias befreit die Politik von jedem messianischen Leistungsdruck, das Messianische entzieht sich allen politischen Bemühungen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite aber ist die messianische Inspiration, von Johannes Paraklet (Anwalt) genannt, die Inspiration der Treue, klassisch mit Geist der Wahrheit übersetzt. Diese messianische Inspiration macht alle Politik vorläufig, sie besteht allenfalls in einstweiligen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen. Dabei wird sie durch das Leben der kommenden Weltzeit (zōē aiōnios) orientiert. Bessere Lebensumstände sind allenfalls Schritte auf dem Weg zu einem Ziel, das die Politik nie erreicht und nie erreichen soll, das aber unsere tiefste Sehnsucht ausmacht. Ohne dieses Ziel wird alles Leben weglos. Messianische Inspiration ist, wie Johannes sagt, das, was uns „den Weg entlang führt“ (hodēgēsei). Der Weg führt nicht in irgendein Jenseits, irgendeinen Himmel, irgendein Leben nach dem Tod, das wäre religiöse Entstellung. Es geht nicht um ewiges Leben nach dem Tod im Jenseits der Erde, sondern um ein messianisches Leben (zōē) in einer kommenden Epoche (aiōn) auf dieser Erde. Messianische lnspiration heißt auf alle Fälle, daß der Satz: „Es gibt keine Alternative zur faktischen und herrschenden Weltordnung“, ein heilloser, gottloser, böser Satz ist, eine richtige „Sünde wider den Heiligen Geist“. Messianische Inspiration heißt, daß in aller Politik etwas vom Messias zum Vorschein kommen sollte. Dieses etwas ist bei Johannes die agapē, die Solidarität der Mitglieder der messianischen Gemeinde untereinander.
(110) Die Begriffe logos und sōphia können, wie Sprüche 1,2 oder 5,1 sowie Prediger 9,16 oder Weisheit 6,9 oder auch 2. Chronik 9,5 zeigen, parallel im gleichen Sinne verwendet werden. Jeremia 8,9 ist in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich, insofern deutlich wird, dass derjenige, der Gottes „Wort“ = DaBaR = logos zurückweist, auch keine „Weisheit“ = ChaKMaH = sōphia zur Verfügung hat: „was können sie Weises lehren, wenn sie des HERRN Wort verwerfen?“
(111) Dabei nehmen Sie ja sogar an – siehe weiter unten -, der jüdische Fischer Johanan ben Zebedaios hätte das Evangelium geschrieben – und der war doch gewiss kein philosophisch gebildeter Grieche.
(112) Vgl. Gerhard Jankowski, Die große Hoffnung: Paulus an die Römer. Eine Auslegung, Berlin 1998. Diese Auslegung (so der Klappentext)
versteht Paulus als einen jüdischen Lehrer,der in der Welt des römischen Imperiums zum messianischen Prediger wurde, geradezu besessen von der Hoffnung, die unter den Bedingungen römischer Herrschaft verfeindeten Menschen zu einen und so die erwartete messianische Revolution vorzubereiten. Seine Kritik der Thora ist begründet in der Erkenntnis, daß es unmöglich ist, die Thora unter den herrschenden Verhältnissen zu erfüllen.
(113) In seiner Anmerkung 5 auf dieser Seite fragt sich Veerkamp, ob darin wohl eine „Zurechtweisung an die Adresse des Markus bzw. Matthäus“ zu sehen ist, „die Jeschua den Feigenbaum verfluchen lassen (Mk 11,12f. par.)“
(114) Ihre Anm. 18: Vgl. Joh 13,23f; 20,2-10, 21,7.20.
(115) Ihre Anm. 19: Vgl. Gal 2,9. Petrus und Johannes erscheinen zusammen in Apg 3,1-4.11; 4,13.19; 8,14.
(116) Ihre Anm. 26: Orig. in Jo I 30 (205-208) (SC 120, 160-163). Diese Gedanken betreffen Joh 15,1, müssen aber auch zu unserer Perikope herangezogen werden.
(117) Ihre Anm. 27: Orig., in Jo X,12 (66) (SC 157, 422-425).
(119) Veerkamps Anm. 7: Beispiele: Ri 11,12; 2 Sam 16,10; ähnlich auch Jos 22,24; Jer 2,18 usw.
(120) Klaus Wengst, Das Johannesevangelium. 1. Teilband: Kapitel 1-10 (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament = ThKNT), Stuttgart 2000, zitiert von Veerkamp, S. 47.
(121) Veerkamps Anm. 16:
Zwar machen Texte wie Leviticus, Numeri und Ez 40-48 keinen konsequenten Unterschied zwischen nachala und achusa. Nirgends wird gesagt, daß Israel „Besitz“ (achusa) des NAMENS ist, 29mal sein „Eigentum“ (nachala) und sechsmal, daß umgekehrt der NAME „Eigentum“ (nachala) Levis bzw. der Priester ist. Das Eigene des NAMENS ist Israel, das Eigene der Priester der NAME. Von dort her ist das metaphorische Verhältnis Bräutigam – Braut zu deuten.
(122) Vgl. B. Schwank, Evangelium nach Johannes 88 Anm. 43.
(123) Bedenbender 1. Die folgenden Seitenzahlen bis zum Ende des Abschnitts beziehen sich auf sein Kapitel 14: „Am Ort und im Schatten des Todes“. Die neutestamentlichen Ortsangaben Kapernaum, Bethsaida und Chorazin als poetische Verweise auf das Römische Reich, S. 413ff.
(124) Bedenbenders Anm. 45:
Vgl. nur den von Jesus gegenüber seinen jüdischen Kontrahenten in Joh 8,44 erhobenen Vorwurf: „Ihr habt den diabolos zum Vater“ mit dem Satz der Hohenpriester, der unmittelbar zur Kreuzigung Jesu führt: „Wir haben keinen König als den Kaiser“ (19,15).
(125) Bedenbenders Anm. 43:
Neun von sechzehn anabainein-Belegen des Joh-Ev beziehen sich auf Jerusalem oder den Tempel, weitere fünf – vgl. das Folgende – auf den Aufstieg in den Himmel.
(126) Nach Richter 12,5-6 ist ein Schibbolet ein Kenn- oder Codewort:
5 Gilead besetzte die Furten des Jordans vor Ephraim. Wenn nun einer von den Flüchtlingen Ephraims sprach: Lass mich hinübergehen!, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm: Bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete: Nein!,
6 ließen sie ihn sprechen: Schibbolet. Sprach er aber: Sibbolet, weil er‘s nicht richtig aussprechen konnte, dann ergriffen sie ihn und erschlugen ihn an den Furten des Jordans, sodass zu der Zeit von Ephraim fielen zweiundvierzigtausend.
(127) Bedenbenders Anm. 42:
Eine Parallele außerhalb der Evangelien wäre Apg 1,14 (nur Jesus fehlt hier; er ist ja bereits zum Himmel aufgefahren).
(128) Bedenbender 1, S. 421.
(129) Bedenbenders Anm. 13:
Während Markus und Matthäus von der Heilung eines Gelähmten in Kapernaum (oder in „seiner Stadt“) erzählen, bringt Lukas die gleiche Geschichte ohne Ortsangabe. (Vgl. Lk 5,17 mit Mk 2,1 und Mt 9,1.) In den synoptischen Evangelien wohnen Petrus und Andreas in Kapernaum, bei Johannes ist Bethsaida ihre polis; (s. u.). Matthäus – und einzig Matthäus – läßt seinen Jesus von Nazareth nach Kapernaum umziehen (s. u.). Die Liste ließe sich leicht verlängern.
(130) Ihre Anm. 31: Vgl. Orig., in Jo X 2,5-10. Zum Verständnis der teilweise nicht ganz einfachen Ausführungen des Origenes vgl. Ch. Metzdorf, Die Tempelaktion Jesu 13-17.
(131) Vgl. dazu den vorletzten Absatz über das Hinab- und Hinaufsteigen.
(132) Veerkamps Anm. 11: Von Kramhandel (kapelikon) um des Gelderwerbs (chrēmatistikē) willen hält z.B. Aristoteles gar nichts (Pol. 1257b).
(133) Ihre Anm. 42: Orig., in Jo X 25, 147-149 (SC 157, 476).
(134) Stegemann (siehe Anm. 5), S. 427f.
(135) Stegemanns Anm. 111: Das Beispiel habe ich aus einem Buch von Terry Eagleton (2009) übernommen.