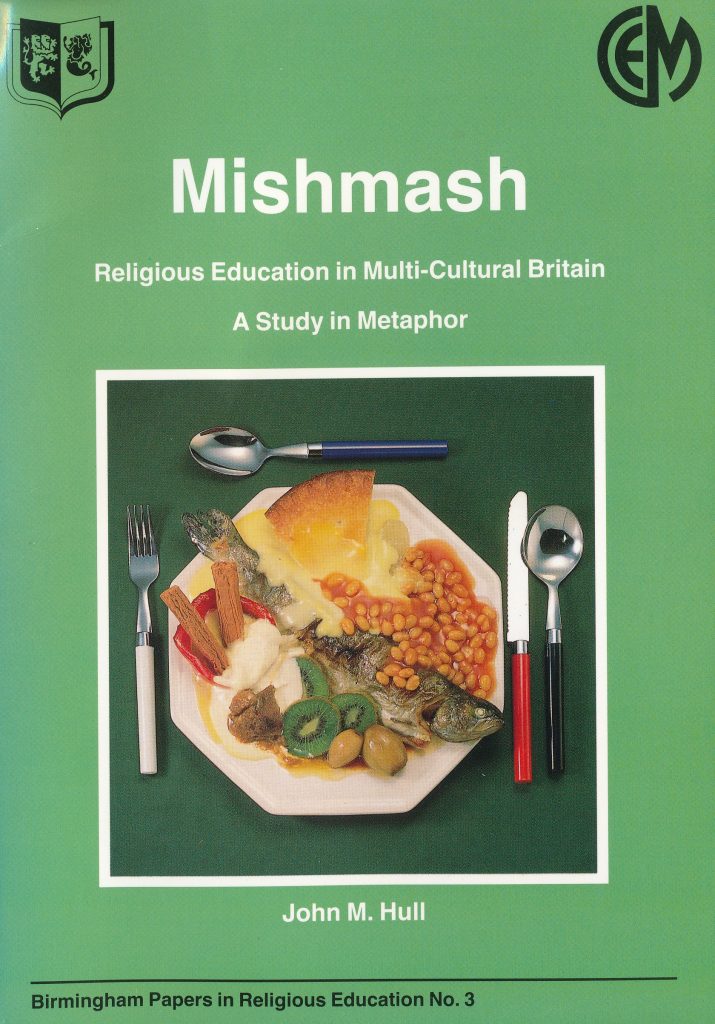Deutsche Übersetzung von Helmut Schütz, hier zuerst veröffentlicht am 8. März 2014.
Originaltitel: Mishmash. Religious Education in Multi-Cultural Britain. A Study in Metaphor, Birmingham 1991
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe (Helmut Schütz)
Vorworte zur englischen Ausgabe (David Konstant und Christopher Hughes Smith)
Kapitel 1: Religionsunterricht und Nahrungsmetaphern
Kapitel 2: Die Bedeutung der Nahrungsmetaphern
Kapitel 3: Bildersprache entschlüsselt: Küche, Klasse und Ideologie
Kapitel 4: Reinheit von Nahrung und Glauben
Kapitel 5: „Er erklärte alle Speisen für rein.“ Ein christlicher Ansatz für den Religionsunterricht
↑ Vorwort zur deutschen Ausgabe (Helmut Schütz)
Ist es ein Segen, dass es in fast allen Bundesländern Deutschlands einen konfessionell getrennten Religionsunterricht gibt, der in „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ wird – basierend auf Artikel 7 des Grundgesetzes? Die großen christlichen Kirchen sehen das zweifellos so, da ihnen diese staatliche Garantie eine willkommene Gelegenheit gibt, Zugang zu einer Zielgruppe zu erhalten, die auf dem Weg der religiösen Erziehung im Elternhaus oder durch die innerkirchliche Kinder- und Jugendarbeit kaum noch nachhaltig mit christlichen Inhalten in Kontakt kommt. Ausnahmen bilden unter anderem der nach wie vor stark in Anspruch genommene evangelische Konfirmandenunterricht und die Angebote religiöser Bildung in von Kirchen getragenen Kindertageseinrichtungen. Eine große Chance für die religiöse Bildung auch der muslimischen Schülerinnen und Schüler bietet gewiss auch der auf der gleichen Rechtsgrundlage basierende islamische Religionsunterricht, für den inzwischen in einigen Bundesländern die Voraussetzungen geschaffen werden.
Drei Probleme lassen sich allerdings auf dieser Grundlage nur schwer lösen.
Zum einen gibt es ein Recht auf religiöse Bildung auch für Kinder ohne Religionszugehörigkeit oder für diejenigen, deren Eltern die Teilnahme am Religionsunterricht in der Verantwortung einer der großen christlichen Konfessionen oder eines der vom Staat anerkannten islamischen Verbände ablehnen.
Zum andern sind vor allem in manchen städtischen Grundschulen christliche Kinder in einer solchen Minderheit, dass ihre Zahl nicht mehr ausreicht, um konfessionellen Religionsunterricht jahrgangsweise zu erteilen.
Einen dritten Gesichtspunkt halte ich für noch wichtiger: Der getrennte Religionsunterricht mag zwar zur Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler beitragen, verfestigt möglicherweise aber auch Vorurteile gegenüber den Angehörigen anderer Religionen, vor allem dann, wenn interreligiöses Lernen der Initiative daran interessierten Lehrpersonals überlassen bleibt und nicht fest in der Konzeption der Schule verankert wird.
Multireligiöser Unterricht wird in Deutschland in der Regel misstrauisch beäugt. Man befürchtet kirchlicherseits eine reine „Religionskunde“, also eine völlig distanzierte und emotionslose Vermittlung von Faktenwissen über die Vielzahl der Religionen, bei der das Eigentliche jeder Religion verloren geht (1), und warnt davor, „die ungeordnete religiöse Vielfalt“ zu fördern, bei der „der Erwerb religiöser Identität“ zu kurz kommt (2). Zwar werden in der deutschen religionspädagogischen Diskussion und Literatur kaum die in England bis zum Überdruss verwendeten Metaphern des religiösen „Mischmaschs“ oder „Eintopfs“ bemüht, vermutlich weil allzu selbstverständlich erscheint, dass die Religionen durch die Bestimmungen des Grundgesetzes in der Schule ohnehin fein säuberlich getrennt zu sein haben. Wo über interreligiöse Gebete nachgedacht wird, findet sich aber durchaus auch in Deutschland die Warnung vor „Religionsvermischung“ (3).
Als ich mich im Jahr 2011 als Pfarrer in einem Studienurlaub mit der Frage auseinandersetzte, ob es sinnvoll sei, in einem von der evangelischen Kirche getragenen Kindergarten, der zu einem Drittel von muslimischen Kindern besucht wird, nicht nur Geschichten aus der Bibel, sondern auch aus dem Koran zu erzählen (4), half mir besonders das vorliegende Büchlein von John M. Hull zur Angst vor religiösem Mischmasch, meine eigenen Gedanken zu klären. Ich fand es bedauerlich, dass es nie ins Deutsche übersetzt wurde, und entschloss mich, diesem Mangel abzuhelfen. Auch wenn die Gedanken von John M. Hull mittlerweile (März 2014) schon 23 Jahre alt sind, halte ich sie in ihrer visionären Kraft für noch lange nicht überholt. Gerade indem sie sich ursprünglich auf die ganz andere Situation in England beziehen, in der das Miteinander der Religionen in den Schulen bereits Jahrzehnte früher als in Deutschland ganz selbstverständlich gelebt wurde, können sie der religionspädagogischen Diskussion in unserem Land wertvolle Impulse verleihen.
↑ Mischmasch – die feine englische Art. Multireligiöser Religionsunterricht in England (5) (Christa Dommel)
Mischmasch – so nennen Kritiker abwertend den englischen pädagogischen Ansatz, allen Kindern, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, gemeinsam Religionsunterricht zu erteilen. „Mishmash“ (6) ist daher auch der Titel eines Buches zum Thema, geschrieben von einem der wichtigsten Befürworter genau dieses Konzepts, Prof. John Hull. Was passiert eigentlich genau in diesem Unterricht, in dem – so die geharnischte Kritik von Baroness Cox im House of Lords 1988 – „wir Gefahr laufen, unser spirituelles Erstgeburtsrecht zu verkaufen für einen fürchterlichen säkularen Eintopf“ (7)? Während eines mehrmonatigen Englandaufenthalts hatte ich Gelegenheit, meiner Neugier nachzugehen.
Eine Gruppe von Kindern, etwa 10 Jahre alt, sitzt im Kreis, gespannte Erwartung liegt auf den Gesichtern. Ihre Lehrerin hat gerade samtweiche rote Geheimnissäckchen verteilt, deren Inhalt von außen vorsichtig betastet wird. Klar ist, dass etwas Besonderes, nichts Alltägliches darin ist. Ein Kind nach dem anderen packt seinen Schatz aus – es sind religiöse Gegenstände aus dem hinduistischen Kulturkreis, die für „Puja“, das tägliche Gebet zu Hause oder im Tempel gebraucht werden. Keine Enttäuschung auf den Gesichtern der Kinder (darauf hatte ich gewartet), sondern anhaltendes neugieriges Interesse. Die Figur des elefantenköpfigen Gottes Ganesha oder die kleinen Kerzenhalter und Behälter werden mit Respekt und Feingefühl in den Händen gehalten und von allen Seiten begutachtet. Ein Junge, dessen Eltern aus Indien stammen und dem diese Gegenstände vertraut sind, erzählt stolz, was er damit verbindet. Andere Kinder – christlich, muslimisch oder konfessionslos – beteiligen sich am Gespräch, vergleichen die Inhalte ihrer Samtsäckchen und hören, was es heißt, ein Hindu in England zu sein. Die Lehrerin moderiert und stellt zwischendurch Fragen oder erklärt etwas. Diese Szene, Ausschnitt eines Films, den ich am „Tag der Offenen Tür“ im Westhill Religious Education Centre, einem College für Lehreraus- und -fortbildung in Birmingham, gesehen habe, spiegelt schulischen Alltag wider: Im multireligiösen Religionsunterricht der öffentlichen Schulen werden die SchülerInnen nicht nach ihrer Religions- oder gar Konfessionszugehörigkeit in getrennte Klassen geschickt, sondern lernen miteinander und voneinander über die eigene und die anderen Religionen in ihrer Stadt, die buchstäblich greifbar werden. Dabei spielen methodisch nicht nur die genannten religiösen Artefakte eine wichtige Rolle, sondern auch Besuche in umliegende Tempel, Synagogen, Moscheen und Kirchen. Neben diesem religionskundlich-informativen Ansatz spielt der themenorientierte Ansatz eine wichtige Rolle. Hier werden existentielle Lebensthemen der SchülerInnen wie z. B. Natur, Familie, Freundschaft, Feste, Tod oder gesellschaftliche Normen in Beziehung gesetzt zu den religiösen Traditionen und zur eigenen spirituellen Entwicklung (letztere wird besonders im Lehrplan hervorgehoben). Denn Ausgangspunkt von „Religious Education“ (RE) ist das einzelne Kind, das befähigt werden soll, im religiös pluralistischen Umfeld seine persönliche Orientierung zu finden, moralische Maßstäbe zu entwickeln und harmonisch mit Andersgläubigen zusammenzuleben. Generell hatte ich in England den Eindruck, dass ein persönlicher religiöser Glaube – unabhängig davon, welcher – weniger als in Deutschland als peinlich oder uncool gilt, bei Erwachsenen wie bei Kindern, sondern hohe Wertschätzung genießt – auch wenn wie in Deutschland die Zahl der Kirchenbesucher abnimmt. Das Wissen etwa: „they pray for us“ („sie beten für uns“) wird als Freundschaftsbeweis verstanden, und zwar durchaus nicht nur von älteren Menschen oder kleinen frommen Randgruppen. Die spirituelle Entwicklung jedes Menschen gilt als wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft, nicht als Privatsache – dies spiegelt sich in vielfältigen politischen Verlautbarungen wider, etwa wenn Tony Blair die 300-Jahr-Feier der Ordensgründung der Sikhs eröffnet, oder an den öffentlichen Schulen, wo jeden Morgen noch immer gemeinsame Schulandachten stattfinden. Deren Charakter ist de facto ebenfalls multireligiös – vom Gesetzestext wird er allerdings seit 1988 als „überwiegend christlich“ definiert, was für muslimische Eltern auch schon vereinzelt Anlass war, ihre Kinder nicht daran teilnehmen zu lassen (wozu sie ebenso das Recht haben wie selbst eine – kostenneutrale – Alternative zu organisieren). Im Streit um das Konzept des Religionsunterrichts hat sich jedoch in den letzten 30 Jahren die Zusammenarbeit der verschiedenen Religionsgemeinschaften mit den lokalen Bildungsbehörden bewährt und zu einer breiten Akzeptanz des multireligösen Konzepts geführt. Bis Ende der 60er Jahre war die englische Religionspädagogik noch ganz anders orientiert, das Ziel war christliche Unterweisung. Der Religionspädagoge Michael Grimmitt (1982) beschrieb das Problem der zunehmenden Irrelevanz dieses Konzepts: „Die überwiegende Mehrheit der SchülerInnen verbindet mit Religionsunterricht die Wiederholung von altbekannten Bibelgeschichten, unglaubwürdigen Wundern und befremdlichen Gleichnissen, (…) Landkarten von Palästina (…) und dem Warten auf die Pause oder (…) ein Entkommen in die ‚richtige‛ Welt draußen.“ (8) 1970 kam der Wendepunkt mit dem „Durham-Report“: eine Kommission der Church of England, der englischen Staatskirche, die sich mit der veränderten gesellschaftlichen Realität der Einwanderung befasst hatte, kam zu dem Ergebnis: „Auf Akzeptanz für einen bestimmten Glauben oder ein Glaubenssystem zu drängen, ist die Pflicht und das Privileg der Kirchen und ähnlicher religiöser Körperschaften. Es ist jedoch nicht die Aufgabe eines Lehrers in der öffentlichen Schule.“ (9)
Abgesehen von den verfassungsrechtlichen Unterschieden im Vergleich zu Deutschland (Großbritannien hat keine Verfassung und kann daher Bildungsgesetze unabhängig von Verfassungsvorgaben verabschieden) ist es wohl auch die große institutionelle Stabilität der englischen Staatskirche, die sie befähigt zu diesem vergleichsweise souveränen und angstfreien Umgang mit den anderen Religionsgemeinschaften und einem Verzicht auf das Privileg eines „christlichen Religionsunterrichts“ zugunsten des weitaus schwierigeren Einigungsprozesses eines „Religionsunterrichts für alle“. Theologische und religionswissenschaftliche Reflexion begleiten diesen dialogischen Prozess und beleuchten dabei die gesellschaftliche Relevanz des religiösen Glaubens auch und gerade in einer pluralistischen Situation, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Die Universitäten Birmingham und Warwick (Prof. Robert Jackson) fanden in zwei voneinander unabhängigen Studien heraus, dass das Bewusstsein der eigenen religiösen Identität bei Kindern sich durch die Begegnung mit anderen Religionen eher vertieft als auflöst oder verwirrt. Jackson (1993) betont, dass für Kinder nicht die verschiedenen Welten, in denen sie leben, verwirrend sind, sondern – wenn überhaupt – die Fragen der Lehrer, die darauf bestehen, dass sie zu einer der großen Weltreligionen gehören müssen, während sie vielleicht zu einer religiösen Gruppe gehören, die keine Unterschiede macht zwischen Hindus und Sikhs. (10)
Für mich als Deutsche war es frappierend zu sehen, dass „Dialog“ in England nicht nur als theologisches Schlagwort existiert, sondern als schulische und gesellschaftliche Realität bereits Gestalt angenommen hat, die von Kindern schon vom Grundschulalter an erlebt wird, und die eine starke öffentliche Lobby hat. So hat etwa das „Inter Faith Network for the UK“, ein 1987 gegründeter nationaler Zusammenschluss aus 9 überregionalen und 36 lokalen Inter Faith Organisationen sowie den Religionsgemeinschaften selbst und verschiedenen akademischen Bildungseinrichtungen, im Februar 1999 einen Forschungsbericht veröffentlicht zum Thema „Interreligiöser Dialog und Religionsunterricht“, der alle lokalen RE-Lehrpläne Englands (über 100) auswertet. Ein wichtiges Ergebnis: Das von allen Beteiligten angestrebte Ziel, Toleranz, Respekt und Wertschätzung für religiöse Vielfalt zu wecken, kann im Religionsunterricht gefördert werden nicht nur durch das Unterrichten über Religionen als separate Systeme, sondern mehr noch durch eine besondere Aufmerksamkeit für die Momente des Zusammentreffens – bei Kooperation, Dialog und gemeinsam entwickelten Visionen, aber auch bei Spannungen und Konflikten. Ein weiteres Anliegen des Reports: Nicht nur Angehörige einer Religionsgemeinschaft sollen durch RE angesprochen werden, sondern in Zukunft stärker auch die wachsende Zahl von „Ungläubigen“, da Religion keineswegs das Privateigentum der Kirchen oder anderer Glaubensgemeinschaften sei. Auch Hull (1998) betont: „Religiöse und säkulare Kinder brauchen einander.“ (11)
Von den Lehrerinnen und Lehrern wird dabei viel Kenntnisreichtum über die großen religiösen Traditionen erwartet sowie soziale Kompetenz bei genau diesen entscheidenden Momenten des Zusammentreffens verschiedener Glaubensrichtungen und Weltanschauungen – im Klassenzimmer und außerhalb. Wer kann dies wirklich leisten? Zunächst fällt auf, dass eine weitaus größere Vielfalt an Medien zum Thema Religion und Religionen als in Deutschland auf dem Markt zugänglich ist und auch nachgefragt wird: Bücher für alle Altersgruppen, Videos, Spiele, Artefakte etc. Religionswissenschaft an Colleges und Universitäten ist weniger exotisch als hierzulande und kooperiert mit verschiedenen Theologien. Es gibt eine Vielzahl von Netzwerken und Projekten hochmotivierter Interfaith-Interessierter, die einen Verbesserungsbedarf erkannt und in Eigeninitiative für Abhilfe gesorgt haben. Ein solches Beispiel ist das Interfaith Education Centre in Bradford/Yorkshire. Hier wurde, finanziert von der Stadt Bradford und der Bildungsbehörde in London, konzipiert von engagierten Pädagogen verschieder religiöser Herkunft, 1986 ein Zentrum aufgebaut für die Beratung und Fortbildung von RE-Lehrern. Das IEC arbeitet in engem Kontakt zu den örtlichen Religionsgemeinschaften, aber finanziell unabhängig von ihnen. In internationaler Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern entstand ein Praxisbuch über Interreligiöse Erziehung und gemeinsame Bürgerwerte mit dem Titel „Regarding Religion – Ideas for school, classroom and community“. (12)
Bei allen Gesprächen mit Religionspädagogen in Birmingham und Bradford fiel mir eines besonders auf: Man hat Spaß an der Sache, und dies ist auch den religionspädagogischen Texten und Gebeten anzumerken.
O God lead me in the path of the one who is seeking truth
And protect me from the one who has found it.
↑ Vorworte
Dieses Büchlein leistet einen wichtigen und faszinierenden Beitrag zur anhaltenden Debatte über den multireligiösen Ansatz für den Religionsunterricht (13). Ausgehend davon, dass Puristen einen solchen Ansatz abwertend als „Mischmasch“ beschreiben, untersucht und beurteilt John Hull die Sprache derer, die offenbar eine große Angst vor multireligiösem Unterricht haben. Er trägt sowohl erheblich dazu bei, einige der Vorurteile zu klären, auf denen solche Ängste beruhen, als auch zu verdeutlichen, was mit einem dialogischen Ansatz in der religiösen Erziehung und Bildung gemeint ist. Die Basis des Ganzen ist sehr einfach auszudrücken: „Heiligkeit wird entdeckt durch Begegnung.“
Ich begrüße die Ermutigung, die hier religiös Erziehenden zuteil wird, die ihren Schülern helfen wollen, Gott und alles, was mit Gott zu tun hat, aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Wenn die Wahrheit uns frei macht, ist sie ein Gut, vor der wir niemals Angst haben müssen.
David Konstant, Bischof von Leeds
Das Wort „Mischmasch“ wird häufig gebraucht im Gespräch über religiöse Erziehung in einer multikulturellen Gesellschaft. John Hull nimmt den Ausdruck ernst, untersucht seine Implikationen sowohl mit Heiterkeit als auch intellektueller Ernsthaftigkeit und betont die Inklusivität des Geistes Christi, der Erziehern eine Vision und informierte Ermutigung anbietet. Die Broschüre ist ein scharfsinniges Plädoyer für Freiheit und für Freude. Verschiedene Wissenschafts-Disziplinen werden zum Thema auf köstliche Weise zusammengebracht, um Hackfleisch aus dem Vorwurf des Mischmasch zu machen.
Christopher Hughes Smith, Generalsekretär der Abteilung Erziehung und Jugend der Methodistischen Kirche und ehemaliger Präsident der Methodistischen Konferenz
↑ Einführung
In den letzten zwei oder drei Jahren war die religiöse Erziehung Gegenstand einer lebhaften öffentlichen Debatte mit weitgefächerten Themen. Diese Themen haben zu tun mit dem Wesen religiöser Erziehung, der Beziehung zwischen Weltreligionen, unausgesprochenen Werten im erzieherischen Prozess und dem Charakter der britischen Gesellschaft. Darüber hinaus stehen Wesen und Auftrag des christlichen Glaubens auf dem Spiel. Es gibt heute eine weltweite Diskussion über den Charakter der christlichen Mission. Die einen sehen sie unter dem Aspekt der Ausbreitung des Christentums als solches. Das mag man die „reproduktive Sicht“ christlicher Mission nennen. Andere sehen die Mission der Christenheit im Dienst einer Sache, die größer ist als die christliche Religion selbst. Diese Sache kann man in dem Ausdruck „Königreich Gottes“ zusammenfassen. Ich identifiziere mich mit der letzteren Sichtweise.
Dieses Büchlein befasst sich nicht mit auswertenden oder inhaltlichen Beiträgen zur Erziehungsdebatte als solcher. Das habe ich anderswo versucht (14). Es beschäftigt sich mit dem christlichen Auftrag in der Erziehung, und zwar begrenzt auf die Diskussion eines Symptoms des Ansatzes, den ich oben als „reproduktive Konzeption“ beschrieben habe: nämlich den Gebrauch von Nahrungsmetaphern.
Bei der Analyse dieser Sprache beschäftige ich mich mehr mit der Bilderwelt als mit den Argumenten derer, die diese Metaphorik benutzen. Zum Teil deswegen, weil die Quellen, auf die ich zurückgreife, eher populär als akademisch sind und eher in gefühlsbetonter Rhetorik abgefasst sind. Rhetorische Metaphorik ist nicht nur ein mächtiges Mittel, um Haltungen zu formen, sondern der Schlüssel zum Verständnis der tieferen Struktur des Miteinander-Redens. Indem ich Parallelen ziehe zwischen den Nahrungsmetaphern in der Debatte um religiöse Erziehung und der Rolle des Essens, besonders ekelerregender Speisen, in der menschlichen Entwicklung, Geschichte und Kultur, versuche ich die Wurzeln der emotionalen Macht der Sprache zu verstehen.
Nur wo der Kontext es notwendig macht, habe ich es für angebracht gehalten, die Namen der auf den folgenden Seiten zitierten Personen zu erwähnen. Zum Teil weil ich mich hauptsächlich auf die Sprache selbst konzentriere und nicht auf persönliche Polemik. Ich möchte nicht andeuten, dass jene, die Nahrungsmetaphern verwenden, um multikulturellen Religionsunterricht anzugreifen, eine einheitliche Gruppe bilden oder eine bewusste Strategie entwickelt haben. In der Diskursanalyse ist nicht so bedeutend, was Leute sagen, sondern was durch sie gesagt wird. Die folgende Erörterung versucht, ein Moment in der Evolution westlicher religiöser Kultur zu präzisieren.
Was ich versuche, ist also nicht nur die Analyse metaphorischer Sprache und die Behandlung der tieferen Struktur des Diskurses, sondern ein kleiner Beitrag zu einer Theologie der Kultur und einem Verständnis christlicher Mission. Ihn entwickle ich hauptsächlich im letzten Kapitel, zugegebenermaßen ziemlich skizzenhaft. Ich habe versucht, die Grundlagen dafür in anderen Schriften zu legen, und hoffe bei späterer Gelegenheit auf diesen besonderen Aspekt zurückzukommen.
„Mischmasch“ ist das Hauptbeispiel dieser Rhetorik. Der Ausdruck „Mischmasch“ ist ziemlich erfolgreich verwendet worden, um anzudeuten, dass etwas Ekelhaftes und sogar Gefährliches in britischen Klassenzimmern stattfindet. Aber wovon wird es uns allen angeblich so schlecht? Wer diese Metaphern ekelerregenden Essens benutzt, erklärt selten ruhig und detailliert, wovor genau er die Öffentlichkeit warnen will. Diese Studie bietet eine Klärung des „Mischmasch“-Vokabulars.
Die vorliegende Studie erwuchs aus meinem Editorial im British Journal of Religious Education, Band 12, No. 3 (Sommer 1990), Seite 121-125, unter dem Titel „Mischmasch: Religiöse Erziehung und Pluralismus“ („Mish-mash: religious education and pluralism“). Ich bin den vielen Freunden und Kollegen dankbar, deren Reaktion mich dazu ermutigte, eine detailliertere Studie anzubieten. Einen besonderen Dank bin ich Lynne Price schuldig für ihre Hilfe bei der Recherche und Julie Brean für die sorgfältige Vorbereitung des Manuskripts. Auch der Universität Birmingham bin ich dankbar, deren Forschungsstipendium es mir möglich machte, diese Arbeit durchzuführen.
The University of Birmingham, School of Education
September 1990
↑ Kapitel Eins – Religionsunterricht und Nahrungsmetaphern
Am 2. August 1990 enthielt die Daily Mail einen Artikel, in dem John MacGregor, der Minister für Bildung und Wissenschaft, kritisiert wurde, mit der Überschrift: „Verrat an Thatchers Kindern: der Täter“ (15). Mitten in der Beschreibung der unterschiedlichen Arten, wie Schulkinder verraten werden, lesen wir: „Der Ort des Christentums im Religionsunterricht ist keineswegs klar, ungeachtet dessen, was das Gesetz zu verordnen scheint. Multireligionismus, eine Art von unzusammenhängendem Mischmasch, bei dem eigentlich alles erlaubt ist vom Rastafari-Kult bis zum Marxismus, ist nach wie vor deutlich erkennbar.“
The Church Times enthielt am 20. Mai 1988 einen Leserbrief unter der Überschrift „Debatte über die Zukunft des Religionsunterrichts“. Der Schreiber beklagte sich: „… uns wird auch gesagt, dass wir im Unterricht andere Glaubensrichtungen berücksichtigen müssen. Ich bestreite das nicht. Es sollte im Lehrplan ein Platz dafür eingeräumt werden. Aber das heißt nicht, den christlichen Religionsunterricht in eine Art von religiösem Cocktail zu verwandeln.“
The Times Educational Supplement veröffentlichte am 14. Oktober 1988 einen Artikel „Klärung eines Glaubensaktes“, der sich auf eine der Reden im britischen Oberhaus bezog. Der Redner „argumentierte gegen multi-religiösen Unterricht als ‚einen Cocktail der Weltreligionen‛.“
The Times am 1. April 1988 brachte einen Artikel „Religionskunde ist ein absolut berechtigtes Thema … hat aber nichts mit religiöser Unterweisung zu tun“ (16). Der Artikel berichtet: „Eine Bewegung wurde ins Leben gerufen, die fordert, den christlichen Glauben im Gesetz zur Bildungsreform klar festzuschreiben. Im Oberhaus eröffnete Baronin Cox letzten Monat die Debatte mit der emotionalen Abgabe einer Erklärung: „Als Nation“, sagte die Baronin, „sind wir in der Gefahr, unser spirituelles Erstgeburtsrecht für einen verweltlichten Linseneintopf zu verkaufen.“
The Independent für den 30. April 1990 berichtete: „Eltern drängen auf Entscheidung über multireligiösen Unterricht“ (17) und zitierte ein Elternteil: „Wenn meine Tochter mit zehn Jahren heim käme und sagte, sie wolle Pandschabisch lernen oder irgendetwas anderes, hätte ich nichts dagegen, das wäre ihre eigene Entscheidung. Aber mit fünf, denke ist, sollte man ihnen nicht zu viel eintrichtern (18).“
The Church Times am 22. Juli 1988 berichtete, dass der damalige Minister für Bildung und Wissenschaft, Mr. Kenneth Baker, die Zusicherung abgegeben hatte: „Es war keine Absicht, bestimmte Arten von Religionsunterricht denen einzutrichtern, die es nicht wollten“ (19).
In der Parlamentsdebatte wird die „Lehrplanvereinbarungs-Ethik“ als „das dilettantische, undefinierbare Milch-und-Wasser-Abkommen, das wir seit 1944 hatten“, beschrieben (Unterhaus, 23. März 1988, Spalte 404). „Natürlich gibt es starke Argumente dafür…, im Unterricht auch ein wenig auf die anderen großen Weltreligionen einzugehen, besonders in einer Gesellschaft, in der diese Religionen praktiziert werden. Solch ein Unterricht kann das Verständnis und den Respekt erhöhen, bei denen es sich um wesentliche Werte in einer pluralistischen Gesellschaft handelt. Aber das ist etwas ganz anderes, als junge Menschen der Position eines extremen Relativismus auszusetzen, indem alle Glaubenssysteme wertfrei miteinander in einen Topf geworfen werden …“ (20) (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalten 1455-1456).
Wie diese Beispiele zeigen, wurde die öffentliche Debatte über den Religionsunterricht durch zahlreiche Missverständnisse durcheinandergebracht. Erstens scheint man anzunehmen, dass Religionsunterricht nichts anderes beabsichtigt, als Kinder religiös zu unterweisen, obwohl diese Voraussetzung in der Literatur zum Religionsunterricht der letzten zwanzig Jahre durchgehend zurückgewiesen wurde. Zweitens neigt man dazu, Unterschiede zwischen dem Charakter und Zweck gemeinsamer Gottesdienstfeiern und dem Religionsunterricht im Klassenraum zu ignorieren. Die öffentliche Debatte der letzten zwei oder drei Jahre war weder gut informiert noch von klaren Argumenten bestimmt, aber diese Studie beabsichtigt nicht, die Argumente selbst zu diskutieren, sondern die Aufmerksamkeit auf ein seltsames Merkmal ihrer Rhetorik zu lenken.
Denkt man über die in dieser Debatte verwendete Sprache nach, ist man wie erschlagen durch das Vorherrschen der Metaphern aus dem Bereich der Nahrung und des Essens. Natürlich findet man auch andere Arten von Metaphern. „Der Lehrplan für den Religionsunterricht steht in der Gefahr, in ein Kaleidoskop seichter Ideen über unzählige Glaubenssysteme verwandelt zu werden.“ (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalte 1456). „Der Religionsunterricht darf nicht zu einer Parade rund um ein Religionsmuseum werden. Es muss um den Glauben gehen.“ (Unterhaus, 23. März 1988, Spalte 413). Diejenigen, die Zweifel an der neuen Betonung des Christentums im Gesetzentwurf äußern, benutzen Argumente, die „fast zur Verfinsterung des Religionsunterrichts in den Schulen geführt“ haben (Unterhaus, 18. Juli 1988, Spalte 819). Ab und an haben wir eine sportliche Metapher. „Wie ich den ehrwürdigen Prälaten verstanden habe, als er sich über die Gesetzesänderung Nr. 3 ausließ, wäre es ganz legal und angebracht, wenn zum Beispiel in einem Fußballspiel die verantwortliche Person es plötzlich für angebracht hielte, nach den Regeln von Rugby zu spielen. Das macht nicht schrecklich viel Sinn.“ (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 721). Religionsunterricht sollte nicht die Religionen vermischen.
Zu anderen Zeiten wird die Unterstellung einer prächtigen, aber oberflächlichen Parade, in der die Religionen rasch in den Blick kommen und wieder aus ihm verschwinden, mit Metaphern aus dem Bereich von Kleidung und Kosmetik hervorgehoben. „Nach meiner Erfahrung schaffen Schulen entweder den Gottesdienst in Schulversammlungen ab oder sie putzen ihn heraus in multireligiösen Gewändern, das heißt, es gibt absolut keinen Gottesdienst mehr.“ (Unterhaus, Ständiger Ausschuss J, 9. Februar 1988, Spalte 1270). Manchmal wird der Religionsunterricht mit Bildern vom Marktplatz angegriffen. Die Führer der Kirche von England sind „ein wenig zu bescheiden beim Verkauf ihrer Waren. Wenn ich ein Produkt vermarkten wollte, würde ich keinen von ihnen als Verkäufer einstellen.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 515). Durch ihr Bestehen auf ihrer Politik des verbindlichen christlichen Religionsunterrichts für ältere Schüler hat sich „die Regierung den Produzenten gebeugt … Wenn sie mit den Konsumenten – den Schülern – gesprochen hätten, wäre ihnen eine andere Antwort gegeben worden. Die Regierung steht in dieser Angelegenheit in der Schuld der Produzenten.“ (Unterhaus, 9. Februar 1988, Ständiger Ausschuss J, Spalte 1264).
Selbst wenn die Metaphern kommerziell sind, geht die Tendenz jedoch dahin, zur Frage der Nahrung zurückzukehren. Religionsunterricht ist Nahrung; sie wird von den Kirchen produziert, und die Schüler als Konsumenten werden mit ihr gefüttert oder zwangsernährt. In der Diskussion darüber, in welchem Sinn der gemeinsame Gottesdienst „im Wesentlichen“ auf dem Christentum beruhen sollte, wurde vor dem Oberhaus erklärt, dass dies nicht „hauptsächlich“ im Sinne von zwei Drittel Reis und ein Drittel Tapioca oder so ähnlich bedeuten würde. (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 717). Die Organisation des gemeinsamen Gottesdienstes auf diese Weise, mit Elementen verschiedener religiöser Traditionen, hätte als Ergebnis „einen Pudding“ zur Folge“ (Spalte 719). „Wir müssen bei diesem bedeutenden Thema weg vom Rührschüssel-Ansatz.“ (Oberhaus, 28. Februar 1988, Spalte 1466). Das würde bedeuten: „eine Spur Christentum, ein Schuss Judentum, eine Scheibe Islam und so weiter durch einen Fruchtcocktail der Weltreligionen.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 420). Stützt sich die Metapher mehr auf das Trinken statt auf das Essen, liegt die Betonung (wie wir im Milch-und-Wasser-Beispiel gesehen haben) immer auf der Vermischung und Abschwächung. Was die Abänderungsanträge zum Thema Christentum zu erreichen versuchen, ist ein Ansatz für den Religionsunterricht, „der nicht den Glauben irgendeiner Konfession oder Religion verwässert.“ (Unterhaus, 21. Juni 1988, Spalte 658). „Ein Personenkreis … glaubt, dass der christliche Glaube unverwässert gelehrt werden sollte; dass er respektvoll und barmherzig gegenüber anderen Glaubensrichtungen sein sollte, wie es das Christentum uns zu sein lehrt, aber dass der Glaube unverwässert sein sollte. Er sollte nicht verpanscht werden, indem man versucht, ihn mit einem Beigeschmack von etwas anderem zu unterrichten, das in ihn einsickert.“ Derselbe Redner fuhr fort, den Standpunkt zu betonen, dass diejenigen, die den multireligiösen Ansatz unterstützten, „versuchen wollen, alles zu verwässern und abzutun.“ (Spalte 660). Die Minderheitsgruppe der Kinder mit einer von der Mehrheit im Klassenraum unterschiedenen Religionszugehörigkeit stellt einen „Rest“ dar, der sich zurückziehen muss, um die Verwässerung zu verhindern (Spalte 720). „Man kann sie nicht alle miteinander vermischen.“ (Oberhaus, 22. Juni 1988, Spalte 851).
Die meistbenutzte und wirkungsvollste Nahrungsmetapher ist der Ausdruck Mischmasch. „Andererseits, wo der christliche Inhalt der Religionsunterrichtsstunden nicht vermindert wird, weil man einem Mischmasch vergleichender Religionen so viel Zeit widmet, wird er aus einem anderen und, wie ich denke, noch schlimmeren Grund vermindert – nämlich, dass nominell zur Erteilung von Religionsunterricht vorgesehene Schulstunden aufgehört haben, überhaupt irgendeinen religiösen Inhalt zu haben.“ (Oberhaus, 18. Mai 1977, Spalte 706). Wird ein besonderer Effekt gesucht, bringt man die Ideen der „Verwässerung“ und der „Vermischung“ zusammen: „die Verwässerung der christlichen Lehre in einem multireligiösen Mischmasch.“ (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalte 1455). Andere Beobachter der Religionsunterrichts-Szene haben in den vergangenen Jahren ebenfalls das häufige Vorkommen des Bildes vom Mischmasch bemerkt. Dr. Brian Gates vom St. Martin‛s College in Lancaster fasst die Ansichten der Kritiker des etablierten Religionsunterrichtes zusammen. „Die moralischen Übel der Nation hängen zusammen mit der Verwirrung über Glaubensüberzeugungen und Werte, die bei Schülern durch einen Religionsunterricht hervorgerufen werden, der oft nichtssagend oder ein Mischmasch ist.“ (Gates, 1989, S. 7). Ein Leserbrief in The Times Educational Supplement vom 26. August 1988 beklagte die allgemeine Gleichgültigkeit, die zum Weltreligionsansatz im Religionsunterrichtgeführt habe. „Weil unser eigener Glaube nicht stark ist und wir ihn zu wenig praktizieren, macht es uns nicht wirklich etwas aus, wenn es keinen Religionsunterricht gibt oder wenn das Gebetbuch geändert wird oder unsere Kinder einen Mischmasch von Weihnachten, Opferfest, Diwali (21) und dem Goldenen Pferd beigebracht kriegen. Ich vermute, andere Religionen sind anspruchsvoller. Respekt vor anderen Religionen und Kulturen ist das angemessene Ziel, nicht Trivialisierung.“ Häufig beschränkt sich der Gebrauch des Wortes nicht auf die Frage nach dem Lehrplan des schulischen Religionsunterrichts, sondern bezieht sich weitergehend auf die kulturelle und sogar ethnisch/rassische (22) Verschiedenheit, die sich unter anderem im Lehrplan der Schule ausdrückt. Diese Verschiedenheit ist durch Einwanderung geschaffen worden, und der Multikulturalismus versucht, eine neue Einheit zu erschaffen. Ein Korrespondent des Guardian bemerkte unter der Überschrift „Der Wert des Multikulturalismus“, er sähe das Problem darin, „ein mehr oder weniger vereinigtes Volk aus dem durch die Masseneinwanderung herbeigeführten ethnischen und religiösen Mischmasch zusammenzuschmieden.“ (The Guardian, 2. Mai 1990). Wenn die Diskussion sich jedoch direkter auf Fragen des Religionsunterrichts verlagert, schleicht sich oft ein Ton der Empörung und Verachtung ein. Einer der Gegner der neuen Lehrplanvereinbarung im Londoner Stadtbezirk Ealing stellt fest: „Was wir im Lehrplan finden, sind Listen allgemeiner Themen wie ‚Ritual‛, ‚Liebe und Hass‛ und ‚Zeichen und Symbole‛. Kinder aller Glaubensrichtungen werden durch diesen multireligiösen Mischmasch betrogen.“ (The Times Educational Supplement 20. Juli 1990). Bei der Diskussion des Lehrplans für Ealing im Radio bemerkte ein Kommentator: „Ich denke, sie machen sich Sorgen darüber, dass die ganze Sache im Augenblick wirklich ein ziemlicher Mischmasch ist“, während der/die (23) Vorsitzende der Lehrplankonferenz von Ealing die Antwort gab: „Wir sagen nicht, dass Religionen in einem Mischmasch zusammengemengt werden. Und der Lehrplan hat auch nicht diese Absicht. Der Lehrplan erlaubt es den Lehrern, im Unterricht auf die verschiedenen Glaubenstraditionen, die in unserer Gemeinschaft vorkommen, einzugehen. Er erlaubt es ihnen, auf Werte zurückzugreifen, die in jeder Religion gegenwärtig sind.“ (BBC Radio 4, Sonntag, 10. Juni 1990, zitiert nach einem offiziellen Transkript der Sendung, das vom BBC transcript service zur Verfügung gestellt wurde).
Es war die Presseberichterstattung über die Parlamentsdebatten zum Religionsunterricht im Jahr 1988, die Mischmasch als die beliebteste Waffe im Vokabular etablierte. The Times Educational Supplement zum Beispiel bezieht sich in ihrem Bericht am 24. Juni 1988 auf die Hoffnung, dass die neuen Religions-Klauseln im Bildungsreformgesetz „den Mischmasch-Ansatz im Religionsunterricht“ beenden. Andere Beispiele finden sich im Independent für den 22. und 24. Juni 1988. Unter dem Titel „Senior Tories fordern mit Nachdruck christliche Erziehung“ berichtete die Times (21. März 1988), dass der Premierminister eine kleine Abordnung empfangen hatte, die sich über „ ‚die Verwässerung christlicher Lehren in einem multireligiösen Mischmasch‛ und ihre Verweltlichung durch die Konzentration auf soziale und politische Themen“ beklagt hatte. Das Vorherrschen der Mischmasch-Symbolik regte andere Bezugnahmen an. Ein antireligiöser Protest in einem Leserbrief unter dem Titel „Frommer Streit“ wollte den Religionsunterricht in Schulen vollständig abschaffen. „Wäre es nicht besser, wenn Freiheit, Unternehmungsgeist und elterliche Entscheidung noch weiter ausgedehnt würden durch die Bestimmung, dass die Anhänger dieses Minderheiteninteresses [das heißt, der Religion] für ihren eigenen außerschulischen Proviant sorgen, egal auf welche miteinander konkurrierenden Geschmacksrichtungen auch immer sie Lust haben?“ (The Times Educational Supplement, 25. März 1988). „Was Wunder“, grübelte ein Kolumnist in The Times Educational Supplement, „dass das Gesetz dermaßen ignoriert wird und dass der Religionsunterricht, verschlungen durch Staatsbürgerkunde und multikulturelle Bewusstseinsbildung, die spirituellen und moralischen Bedürfnisse junger Menschen nicht mehr nähren kann.“ (The Times Educational Supplement, 12. Februar 1988, „Religionsunterricht und Mitgefühl“ (24)). Mit ähnlicher Tendenz meinte der Leserbriefschreiber an die Church Times (30. September 1988): „Wir haben in den vergangenen Jahren Experimente multireligiöser Programme erlebt, bei denen die Gestalt Unseres Herrn meist verborgen blieb hinter anderen religiösen Führern. Anscheinend begreift unser Land, dass das nicht das richtige Rezept für junge Menschen ist, wenn sie in einen eindeutigen Glauben eingeführt werden sollen, der ihr tägliches Leben bestimmt.“
Im Oktober debattierte das Oberhaus über die Zukunft des religiösen Runkfunkwesens. Unter Bezug auf die Zusammensetzung des zentralen religiösen Beirats, der die BBC und die Unabhängige Runkfunk-Behörde in Fragen des religiösen Rundfunks berät, sagte einer der Redner: „Er besteht aus einem Mischmasch von Religionen, in den jeder hineingestopft wird, und es gibt in ihm keine entschiedenen Vertreter des Evangeliums.“ (The Guardian, 2. Oktober 1990).
Als ein letztes Beispiel für die Macht, die Nahrungsmetaphern auf die Vorstellungskraft derer ausüben, die die Betonung der Weltreligionen im gegenwärtigen Religionsunterricht nicht mögen, dürfen wir auf den Leserbrief über die Lehrplanvereinbarung in Ealing zurückkommen, der oben aus The Times Educational Supplement zitiert wurde. Der Korrespondent zog die energische Schlussfolgerung: „Wenn dieser Lehrplan ‚erzieherisch gesund‛ ist, dann bin ich ein gekochtes Ei.“ Dieses ziemlich seltsame Beispiel muss diesen kurzen Überblick über die Nahrungsrhetorik abschließen. Viele andere Beispiele könnten angeführt werden, aber wir müssen nun fortfahren, um zu untersuchen, was das, was wir beschrieben haben, bedeutet.
↑ Kapitel Zwei – Die Bedeutung der Nahrungsmetaphern
Aus dem Zusammenhang der bisher zitierten Beispiele wird dem Leser ersichtlich, dass Mischmasch mit der Tatsache zu tun hat, dass Religionsunterricht in den Schulen von England und Wales normalerweise nicht auf das Christentum beschränkt ist. Mischmasch hat mit dem Umfang des Lehrplans zu tun. Was angegriffen wird, ist ein „multireligiöser Mischmasch“.
Es wäre jedoch ein Missverständnis, den Schluss zu ziehen, dass sich der Protest gegen die Weltreligionen als solche richten würde. Die Debatten betonen häufig, dass andere Religionen bedeutungsvoll sind, respektiert werden müssen und in der Schule gelehrt werden können. „In unserem Land gibt es Situationen, in denen es richtig ist anzuerkennen, dass es Andersgläubige gibt, und sicherzustellen, dass sie eine anständige Unterweisung bekommen.“ (Oberhaus, 21. Juni, Spalte 718). „Es ist ein grundlegendes Prinzip, dass jeder Religionsunterricht, ob christlich oder anders geprägt, Respekt, Toleranz und Verständnis für jene fördern sollte, die anderen Glaubensrichtungen anhängen.“ (Oberhaus, 21. Juni, Spalte 659). In diesen Debatten gibt es gewiss keine Missachtung der spirituellen Rechte von Kindern aus einer Vielfalt religiöser Traditionen. Die Teilnehmer an den parlamentarischen Debatten beziehen sich häufig auf die Ansichten der Führer der muslimischen und jüdischen Gemeinden und sprechen von ihnen immer mit Hochachtung. „Natürlich gibt es starke Argumente dafür – und ich muss das betonen –, im Unterricht auch auf die anderen großen Weltreligionen einzugehen, besonders in einer Gesellschaft, in der diese Religionen praktiziert werden. Ein solcher Unterricht kann das Verständnis und den Respekt steigern, und das sind wesentliche Werte in einer pluralistischen Gesellschaft.“ (Oberhaus, 26. Februar, Spalten 1455-1456). Am 7. Juli 1988 fasste ein Redner im Oberhaus die ganze Debatte der vorherigen Monate zusammen als „eine interreligiöse Bemühung, um die Eigenständigkeit jeder Religion und den Respekt vor allen Religionen sicherzustellen.“ (Spalte 436).
Die Furcht vor dem, was Mischmasch genannt werden sollte, tauchte im Unterhaus am Abend des 9. Februar 1988 auf. Die Bestimmungen für den gemeinsamen Gottesdienst wurden diskutiert, und die Frage wurde aufgeworfen, ob irgendeine religiöse Erfahrung echt sein könne, die bei einem Gottesdienst unter Beteiligung von mehr als einer Religion hervorgerufen würde. Es wurde argumentiert, dass „die Erfahrungen und Empfindungen eines Gottesdienstes in einem multireligiösen Kontext nicht möglich sind. Ich glaube, dass Gottesdienst keine wirkliche Bedeutung haben kann, wenn ein Gott am Montag angebetet wird, ein anderer am Dienstag, wieder ein anderer am Mittwoch, und am Donnerstag eine humanistische Feier abgehalten wird.“ (Spalte 1270). Der Redner fuhr fort: „es ist bedauerlich, dass seit 1974 der Religionsunterricht einen Verfall erlebt hat zu einer vergleichenden Religionskunde statt einer Beschäftigung mit religiösen Gefühlen.“ (Spalte 1270). In diesem Stadium der Debatte wurden der multireligiöse Unterricht und der gemeinsame Gottesdienst abgelehnt, nicht weil sie das Gedankengut junger Menschen, sondern ihre Gefühle verwirren könnten. Der Religionsunterricht könnte den Kontakt mit religiösen Gefühlen verhindern, indem er zu einer „vergleichenden Religionskunde“ wird, und wenn dieser Ansatz im Gottesdienst genutzt würde, dann wären die Emotionen, wenn sie überhaupt geweckt würden, verworren und oberflächlich. Es ist wichtig, wahrzunehmen, dass es zu diesem Zeitpunkt der Debatte energische und gut informierte Reden gab, die beharrlich den erzieherischen und geistlichen Wert des Reichtums und der Vielfalt von Schulgemeinden hervorhoben und betonten, dass ein gemeinsamer Gottesdienst, der aus den verschiedenen Milieus der Kinder schöpft, nicht als für sie bedeutungslos erachtet werden muss.
Der Zusammenhang zwischen Mischmasch und multireligiösem Religionsunterricht geht jedoch über eine Sorge um die religiösen Gefühle der Schüler hinaus. Man macht sich Sorgen über das Gewicht, das dem Christentum vom rein inhaltlichen Gesichtspunkt her gegeben wird. Wie viel Christentum wird gelehrt im Vergleich mit der Zeit und dem Raum, die anderen Religionen zur Verfügung gestellt werden? 1985 waren im vorherigen Parlament darüber Bedenken angemeldet worden. Obwohl die Vielfalt der Glaubensrichtungen anerkannt werden sollte, „… bleibt England ein vorherrschend christliches Land … Stundenpläne in öffentlichen Schulen (25) sollten die Vorherrschaft des christlichen Glaubens und eine Wertschätzung der aktuell gegenwärtigen Glaubensvielfalt widerspiegeln.“ (zitiert im Unterhaus, Ständiger Ausschuss J, 9. Februar 1988, Spalte 1281). Wieder einmal ist es der Beachtung wert, dass in den Debatten die Behauptung, das Christentum erhielte keinen größeren Anteil an der Unterrichtszeit, von gut informierten Teilnehmern immer zurückgewiesen wurde. Unsere gegenwärtige Aufgabe ist es nicht, die Wahrhaftigkeit oder Richtigkeit der Anschuldigungen zu diskutieren, die gegen den Religionsunterricht erhoben wurden, sondern die Art und Weise zu erforschen, in der sich die Philosophie des Mischmasch schrittweise entwickelte.
Bis zum 26. Februar 1988 war klar geworden, dass Mischmasch etwas mehr meinte, als Unterrichtsstoffen aus anderen Weltreligionen als dem Christentum ein übertriebenes Gewicht einzuräumen. Es wird deutlich, dass Mischmasch keine Frage der Ausgewogenheit ist, sondern der Reinheit. Natürlich ist es diesen Debattenrednern zufolge ein Problem, dass nicht genug Christentum gelehrt wird. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass das Christentum in Verbindung mit anderen Religionen gelehrt wird.
Grob gesagt gibt es zwei hauptsächliche Arten des Unterrichts über die Weltreligionen: den systematischen Ansatz und den thematischen Ansatz. Im systematischen Ansatz wird jede Religion mehr oder weniger vollständig in recht ausführlichen Unterrichtseinheiten durchgenommen. Der Lernstoff eines solchen systematischen Unterrichts ist die Religions als Ganze. Der andere Ansatz besteht darin, einen bestimmten Aspekt der Religion mit Hilfe von Material aus verschiedenen religiösen Traditionen zu behandeln. Dieser thematische Ansatz geriet unter Beschuss. Er ist es, der als „Verwässerung christlicher Lehre in einem multireligiösen Mischmasch“ beschrieben wurde (Spalte 1455). Dieselbe Rede fährt damit fort, die Wichtigkeit des Unterrichts über die anderen Weltreligionen zu verteidigen, aber es ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar, wer diesen Unterricht erhalten soll. Zu vermuten ist, dass dieselben Kinder beides erhalten: umfangreiche christliche Unterweisung und Unterricht über die anderen Religionen in geringerem Maße. Was wir vermeiden müssen, ist etwas ganz anderes, nämlich „junge Menschen einer Position des extremen Relativismus auszusetzen, innerhalb dessen alle Glaubenssysteme in einem wertfreien Eintopf dargeboten werden…“ (Spalte 1456). Es ist nicht klar, warum der thematische Ansatz Schüler eher zum Relativismus verleiten sollte als der systematische Ansatz, und wenn das Studium anderer Weltreligionen tatsächlich einen so großen Gewinn darstellt, ist es schwer zu begreifen, warum der Unterricht über das Christentum nicht durch einen thematischen Vergleich lebendiger gemacht werden sollte.
Die Debatte klärt diese Fragen nicht, sondern driftet ab in alarmierende Anschuldigungen, die sich auf Okkultismus und Zauberei beziehen, bis hin zur Schlussfolgerung: „Die ursprünglichen Bemühungen, ein Verständnis anderer Glaubensrichtungen einzubeziehen, waren lobenswert. Aber das rechtfertigt nicht eine Umwandlung des gesamten Lehrplans für den Religionsunterricht in ein Kaleidoskop seichter Ideen über unzählige Glaubenssysteme vom Schamanismus, Ahnenkult und Okkultismus bis hin zu einem Studium anderer Religionen, das den Schülern die fundamentalen Lehren des Christentums vorenthält.“ (Spalte 1456). Wären Eintopf und Mischmasch vermeidbar, wenn Religionslehrer versprächen, niemals Okkultismus, Zauberei oder Schamanismus zu erwähnen? Wäre Mischmasch vermeidbar, wenn nur drei oder vier Religionen gelehrt würden, statt eine große Zahl, ja Myriaden anderer Glaubensrichtungen zu behandeln? Wäre Mischmasch vermeidbar, wenn in diesem Halbjahr die grundlegenden Lehren des Christentums sorgfältig gelehrt würden und im nächsten ebenso sorgfältig die grundlegenden Lehren des Islam? In diesem Stadium der Debatte hätten wir annehmen können, dass diese Fragen zu bejahen wären, aber im Fortgang der Diskussion wurde klar, dass es nicht so einfach ist, Mischmasch zu vermeiden. Diese spezielle Rede schließt mit einem scharfen Angriff auf die Führer der Kirche von England. „Welche anderen Repräsentanten irgendeiner Weltreligion sind so freizügig, dass sie eine Verdünnung ihres Glaubens in einen synkretistischen Relativismus zulassen, der unausgesprochen oder ausdrücklich seine Unverwechselbarkeit und Echtheit unterminiert?“ (Spalte 1458). Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir ein bisschen mehr herausfinden, was getan werden muss, um nicht die Unverwechselbarkeit und Echtheit einer Religion zu unterminieren.
„… Wenn wir den Glauben und die Prinzipien der Religion als das Lebensblut der Nation und all ihrer Bürger betrachten, dann kann eine wirkungsvolle religiöse Unterweisung ebenso wenig von und an Personen einer anderen Religion verabreicht werden, wie eine Bluttransfusion gefahrlos übertragen werden kann, ohne zuerst die Blutgruppenübereinstimmung zu gewährleisten. Wahllose Blutvermischung kann gefährlich sein, ebenso auch die Vermischung von Religionen in der Erziehung.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 419). Nun sehen wir, dass Mischmasch nicht nur eine Frage des Inhalts von Religionsunterricht ist, sondern mit einer adäquaten Übereinstimmung zwischen dem Inhalt und dem Schüler einhergeht. Jedem Schüler, jeder Schülerin soll sein bzw. ihr Glaube gelehrt werden und kein anderer. Unterricht zu halten über einen anderen als den eigenen Glauben ist genau so unnatürlich und gefährlich, als wenn man die Transfusion einer fremden Blutgruppe bekommt. Religionen, genau wie Blutgruppen, schließen sich gegenseitig aus. Der schulische Religionsunterricht, fährt der Redner mit einem Zitat fort, muss anerkennen, „dass es für jeden von uns nur einen Glauben gibt, der mit der persönlichen Überzeugung übereinstimmt; den Glauben unserer Gemeinschaft, unserer Kultur, unserer Familie, unserer Vergangenheit.“ So tritt dieser zentrale Aspekt der Anti-Mischmasch-Ideologie hervor: Religionsunterricht muss in vertikalen Gruppen unterrichtet werden. Jeder Gemeinschaft muss ihre eigene Religion gelehrt werden. Alles andere wäre eine Verunreinigung, eine Entartung. Um der Anklage des Mischmasch zu entgehen, muss der Religionsunterricht zum Werkzeug und Ausdruck einer Art von Stammesdenken, eines Tribalismus, werden.
Die Auswirkungen dieser Vorstellung waren schwer zu fassen. Zwei Vorstellungen wurden in der Debatte verschmolzen. Erstens die Betonung des Christentums als Hauptinhalt des Religionsunterrichts. Zweitens die neuere Vorstellung, dass Schüler in homogenen religiösen Gruppen unterrichtet werden sollten. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Zielsetzungen war jedoch unklar. Am Abend des 3. Mai 1988 diskutierte das Oberhaus die Beschlussvorlage: „Der Religionsunterricht in allen öffentlichen Schulen (26) soll vorherrschend christlich sein.“ (Spalte 502). Das ist eindeutig eine inhaltliche Frage. In einer der anderen Vorlagen ging es um die religiöse Einheitlichkeit in öffentlichen Schulen. „Wo eine öffentliche Schule als konfessionelle Schule errichtet wurde, christlich oder nicht-christlich, soll in dieser Schule der Religionsunterricht dieser bestimmten Konfession stattfinden.“ Konfessionen, so scheint es, haben nicht die Freiheit, übereinander zu unterrichten. Jede Schule in freier Trägerschaft (27) soll eine Insel für sich sein. Eine andere Vorlage wendete die Aufmerksamkeit noch klarer vom Inhalt weg und hin zu den Schülern selbst. Wo es Eltern beantragen, sollen vernünftige Maßnahmen „für den Religionsunterricht von Kindern anderen Glaubens, gemäß ihrer eigenen Religion“, getroffen werden. Die Umrisse der vertikalen Strategie treten nun hervor. Es soll eine Übereinstimmung zwischen dem zu lehrenden Glauben und den Kindern geben, die diesen Unterricht empfangen.
Es war die Formulierung „vorherrschend christlich“ (28), die die Kontroverse auslöste. „Das Wort ‚vorherrschend‛ erlaubt in gewissem Umfang den Unterricht anderer Weltreligionen…“ (Spalte 504). Was man in diesem Stadium im Sinn hat, ist nicht nur eine Frage der geistlichen Zentrierung oder eines allgemeinen Ethos, sondern es geht konkret um den Aufbau des Lehrplans. Der Lehrplan soll vorherrschend christlich sein. Aber wie sollte eine vorherrschend christlich geprägte Lehrplanvereinbarung bewerkstelligt werden? Die gesetzlich festgelegte Konferenz, die eine Lehrplanvereinbarung entwirft, setzt sich aus vier Ausschüssen zusammen. In nur einem dieser Ausschüsse, der die Kirche von England vertritt, ist eine mehrheitlich christliche Stimme zu erwarten. Der andere ausdrücklich religiöse Ausschuss vertritt lediglich „andere Konfessionen“, und das schließt Personen verschiedener Weltreligionen ebenso ein wie nicht-anglikanische Christen. Was die Ausschüsse betrifft, die die Lehrer und die Stadträte vertreten, wie sollte man garantieren, dass sie Christen sind? Außerdem, wenn die Lehrplanvereinbarung nur vorherrschend christlich wäre und zum Teil doch andere Religionen behandeln würde, wäre das Ergebnis nicht doch eine Art Mischmasch? Die Sicht des Bischofs von London zu diesem Zeitpunkt war, dass „Religion und nicht ein Ersatz dafür in unseren Schulen gelehrt werden sollte,“ und dass „die christliche Religion die hauptsächliche, aber nicht die ausschließliche Möglichkeit sein wird, das zu tun.“ (Spalte 512) Fortan drehte sich die Debatte um den Ausdruck „in der Hauptsache“ (29).
Was würde geschehen, wenn sogar in einer Schule der Kirche von England die Mehrheit der Schüler muslimisch wäre? Wie könnte ein vorherrschend christlicher Lehrplan Schülern gelehrt werden, die nicht vorherrschend Christen sind?
Das Problem, einen Mischmasch-freien Lehrplan zu bewerkstelligen, wäre noch schwieriger, wenn sich die Aufmerksamkeit der Durchführung von gemeinsamen Gottesdiensten zuwenden würde. Die Schwierigkeit besteht darin, „dass es viel mehr fast unmerkliche Veränderungen gibt, die die christliche Eigenart des Gottesdienstes in Form multireligiöser Initiativen untergräbt … diese Initiativen führen zu einer Reduktion des Gottesdienstes auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Feier gemeinsamer Werte.“ (Oberhaus, 12. Mai 1988, Spalte 1345). Um das zu vermeiden, sollte es einen besonderen Platz für nicht-christliche Religionen geben. „… wir bieten ihnen die Möglichkeit, auf muslimische Weise anzubeten … wollen aber nicht alle in einer nichtssagenden Veranstaltung zusammenstecken.“ (Spalte 1350).
Der Höhepunkt des Bestrebens zu sagen, was ein Mischmasch wäre, fand im Oberhaus im Juni 1988 statt. Von jetzt an, so ist zu hoffen, werden Lehrplanvereinbarungen „sowohl den Rang des Christentums klar bestätigen“ als auch Sorge tragen für „eine flexible Schwerpunktsetzung in Regionen, wo die große Mehrheit der Schüler anderen Religionen angehört.“ (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 639). Das Paket von Vorschlägen, die der Bischof von London präsentierte, „wird zur Wahrnehmung und Anerkennung der Tatsache führen, dass zur Abwendung von Indoktrination nicht die Einführung eines Mischmasch erforderlich ist. Ebenso wenig ist die Einführung eines neutralen Ansatzes notwendig, der den Religionsunterricht auf nicht mehr als Information über Religion einschränkt.“ (Spalte 640). Unglücklicherweise sollte die darauf folgende Debatte bald zeigen, dass die Gegner eines Mischmasch weit davon entfernt waren, mit der bloßen Vermeidung „vergleichender Religion“ zufrieden zu sein, und die Beteuerung, man wolle nicht einfach neutral sein, entsprach keineswegs ihren Zielvorstellungen. Es ist „notwendig, die Integrität des Christentums und der anderen Weltreligionen zu schützen.“ Zugleich besteht kein Wunsch, Schüler davor zu bewahren, die Religion anderer Leute zu verstehen (Spalte 641). Das Problem ist, dass die Worte „in der Hauptsache“ trotzdem in der Art von Mischmasch gedeutet werden konnten.
Vielleicht ist es lohnenswert, den Leser an diesem Punkt daran zu erinnern, wie Religionsunterricht und gemeinsamer Gottesdienst nun definiert wurden. Es wurde vorgeschlagen, dass jede neue Lehrplanvereinbarung „die Tatsache widerspiegeln soll, dass die wesentlichen religiösen Traditionen Großbritanniens in der Hauptsache christlich sind, unter Berücksichtigung von Lehre und Praxis der anderen in Großbritannien vertretenen bedeutenden Religionen.“ (Spalte 639). In der Hauptsache sollte der gemeinsame Gottesdienst die umfassenden Traditionen des christlichen Glaubens widerspiegeln.
Das Problem war, dass „hauptsächlich“ immer noch als „Vollmacht für irgendeine verwirrende multireligiöse Versammlung“ verstanden werden konnte (Spalte 642). Gewünscht war, dass „christliche Kinder den christlichen Glauben gelehrt bekommen und ihre eigene gemeinsame Gottesdienstfeier haben sollten … Kinder, die anderen Glaubensrichtungen angehören … sollten ihren jeweiligen Glauben gelehrt bekommen und jeweils ihre eigenen gemeinsamen kultischen Feiern haben…“ (Spalten 653-4). Jedes Kind sollte seinen eigenen Glauben gelehrt bekommen.
Wenn Menschen verschiedener Religion in verschiedenen Teilen des Landes getrennt voneinander sesshaft wären, gäbe es kein Problem. Die meisten dieser Regionen wären christlich, und daher wäre es korrekt zu sagen, dass die Lehrplanvereinbarungen die Tatsache widerspiegeln, dass in der Hauptsache das Christentum die Religion des Landes wäre. Das Problem ist: es gibt keine einfache Übereinstimmung zwischen dem religiösen Glauben und dem Wohngebiet. Daher löst der Ausdruck „in der Hauptsache“ nicht das Problem der vielen gemischten Regionen. Was ist in Gegenden zu tun, wo es beträchtliche nicht-christliche Gruppen gibt? „Grob gesagt gibt es nur zwei Wege, um an das Problem heranzugehen. Ein Weg ist der im Antrag Seiner Exzellenz des Prälaten (das heißt, des Bischofs von London) unterbreitete Weg, … dass wir hauptsächlich ein christliches Land sind und daher, um mit der Situation in diesen Regionen umzugehen, einen hauptsächlich christlichen Unterricht haben sollten. Das ist ein Weg, die Angelegenheit zu betrachten. Er läuft jedoch zwangsläufig auf Mischmasch heraus.“ (Spalten 712-713). Dieser Ansatz besagt, dass man bei einer gemischten Bevölkerung „einen abgestuften Unterrichtsansatz“ haben muss. Der andere Weg zur Lösung des Problems ist getrennter Unterricht für Schüler verschiedenen Glaubens. Nur dadurch wird es keine Abstufung nach unten und keine gegenseitige Verunreinigung geben. Die Ausdrücke „in der Hauptsache“ und „hauptsächlich christlich“ lassen die Tür für multireligiöse Interpretationen sowohl für die Arbeit im Klassenzimmer als auch für den gemeinsamen Gottesdienst weit offen.
Um ungefähr Mitternacht am 21. Juni wurde ein beherzter Angriff geführt, um die Tür für Mischmasch zu schließen. „Die Worte ‚in der Hauptsache‛, wenn sie sich auf eine Veranstaltung oder eine Methode beziehen, legen nahe, dass sie teilweise an der Eigenart der einen Sache Teil hat und teilweise, obwohl in geringerem Ausmaß, an der Eigenart einer anderen.“ Das würde die Vorstellung eines „Pudding“ suggerieren, eines vermengten Auflaufs. Auf der anderen Seite könnte „in der Hauptsache“ bedeuten, dass „die Lehrplanvereinbarung normalerweise einen christlichen Unterricht bereitstellen soll, aber im Ausnahmefall etwas anderes. Dieses andere wird erreicht durch die Zusammensetzung des SACRE, des Ständigen Beirats für den Religionsunterricht (30), der Vertreter der religiösen Minderheiten unter den nicht-anglikanischen Konfessionen einschließt. Sie sind in der Lage, innerhalb des Lehrplans den Teil zu erbringen, der für diese Kinder zutrifft…“ (Spalte 719). Das heißt, „wenn es eine Mehrheit christlicher Kinder gibt, gibt es einen christlichen Lehrplan und eine christliche Gottesdienstfeier, die nicht ‚in der Hauptsache‛ christlich ist, sondern christlich – basta! Das ist es, was hauptsächlich geschieht. In den anderen Fällen erlauben die Bestimmungen… ihre Mitwirkung (das heißt, die der religiösen Minderheiten) in den SACREs, um einen fundierten Lehrplan für diese Kinder bereitzustellen. Das ist nicht ein Mischmasch. Es ist genau das Gegenteil.“ (Spalte 720).
Diejenigen, die besorgt waren über die Kluft zwischen den Absichten des Redners und dem tatsächlichen Wortlaut der geplanten Gesetzgebung, hatten absolut Recht. Die Anti-Mischmasch-Interpretation, die im Oberhaus um Mitternacht am 21. Juni 1988 angeboten wurde, war nichts als ein verzweifelter Versuch, um die Situation zu retten. Der Vorschlag, dass die Hindus in der Gruppe der „anderen Konfessionen“ im SACRE (oder den Lehrplanvereinbarungskonferenzen (31)) eine vollständige Lehrplanvereinbarung für hinduistische Schüler entwerfen sollten, und dass die jüdischen Vertreter auf ähnliche Weise eine komplette und angemessene jüdische Lehrplanvereinbarung für die jüdischen Schüler schaffen sollten, ist überhaupt nicht das, was die diskutierten Texte möglicherweise meinen könnten. Die Gesetzgebung besagt nicht, dass es einen Verbund von Lehrplanvereinbarungen geben soll, die die Glaubensrichtungen der Schülerschaft widerspiegeln, sondern dass jede neue Lehrplanvereinbarung diese Eigenschaften haben soll, nämlich eine bestimmte Gegebenheit widerzuspiegeln und bestimmte Lehrmethoden zu beachten. Das sollen die Merkmale gleich welcher und jeder neuen Lehrplanvereinbarung sein. Der Wortlaut gestattet nicht eine Anhäufung von Lehrplanvereinbarungen, sondern eine integrierte Lehrplanvereinbarung, der alle Mitwirkenden als einem angemessenen Lehrplan für alle in der Region von den Schulen betreuten Kinder zugestimmt haben. Die ganze Struktur des SACRE und der Lehrplanvereinbarungskonferenz mit ihrem System repräsentativer Gruppen und ihren Abstimmungsverfahren ist daraufhin konzipiert, eine Übereinkunft zu erzielen. Sie sieht keine Situation vor und der Wortlaut erlaubt keine solche Situation, in der verschiedene religiöse Gruppen einfach darin übereinstimmen, dass sie verschieden sind. Gleichfalls kann die Vorstellung, dass es in Gegenden, wo die Schülerschaft im Wesentlichen oder sogar vollständig christlich ist, einen vollständig christlichen Lehrplan geben sollte, nicht durch den schlichten Sinn der Gesetzgebung gestützt werden. Uns wird nicht gesagt, dass jede neue Lehrplanvereinbarung die Tatsache widerspiegeln soll, dass die wesentlichen religiösen Traditionen Großbritanniens in der Hauptsache christlich sind und, wo es angebracht erscheint, die Lehre und Praxis anderer bedeutender Religionen berücksichtigen soll. Es ist immer angebracht, die anderen Religionen zu berücksichtigen, weil jede Lehrplanvereinbarung diesem Erfordernis zu entsprechen hat.
Kurz nach Mitternacht beseitigte eine eindringliche Frage jeden verbleibenden Zweifel über die Absichten des reformeifrigen Adels. Was wird aus der Minderheit der Kinder, nehmen wir an, sie seien Christen, in einer hauptsächlich jüdischen Schule? „Was geschieht mit der Minderheit in all diesen Fällen?“ „Es wird einen Rest geben.“ „Werden sie einfach nicht kommen?“ (Spalte 720). Die Antwort war ebenso klar wie die Frage: „Meine Herrschaften, wie schon jetzt ziehen sie sich zurück. Das ist weder ein Fortschritt noch ein Rückschritt; es ist die Aufrechterhaltung des Status Quo, was eine gute oder schlechte Sache sein mag; aber ich glaube, das ist unter diesen Umständen hinnehmbar.“ Die Frage hatte ganz klar eine Verlegenheit hervorgerufen, und der Redner fuhr fort: „was Ihnen als Mitgliedern des Oberhauses nun vorliegt, liefert das, was alle diese Leute wollen. Unsere Schwierigkeit besteht darin, zu erklären, wie es das tut.“ (Spalte 720).
Die Frage des Mischmasch hat sich nun entscheidend vom Inhalt weg hin zu den Menschen bewegt. Nicht nur eine Reinheit des Lehrplans, sondern eine Reinheit der Bevölkerung war notwendig. „Ich denke“, sagte ein nachdenklicher Teilnehmer am nächsten Tag, „das Problem ergibt sich daraus, dass sie in der Schule Gottesdienste für einen Mischmasch von Gläubigen und Ungläubigen anbieten.“ (Oberhaus, 22. Juni 1988, Spalte 859). Letztendlich, wie ein ebenso nachdenklicher Redner am vorherigen Abend gesagt hatte, „wird das heißen, dass viel von unserer eigenen Kultur untergeordnet wird. Wir werden am Ende nicht nur einen Mischmasch-Religionsunterricht, sondern einen Mischmasch von fast allem anderen haben, einschließlich Geschichte und Geographie.“ (Spalte 684). Das war, wie der nächste Redner klug beobachtete, ein Schlüssel für die Logik, die hinter diesem Gesetzentwurf steckte.
Diejenigen, die so in Sorge wegen des Mischmasch waren, hatten kein Verlangen nach weiterer Klärung ihrer Position. Sie war nun mehr als genügend klar. Glücklicherweise blieb die Gesetzgebung bemerkenswert unklar. Man kann das auf geschickte Entwurfsgestaltung in einer Situation, die einen Kompromiss erforderte, zurückführen oder auf verwirrtes Denken. Das macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass erzieherische und am Gemeinwesen orientierte Überlegungen am Ende maßgeblich waren. In einer ausgezeichneten zusammenfassenden Rede wurde dem Oberhaus aus der Sicht der Regierung gesagt: „wir wollen so weit wie möglich dafür Sorge tragen, dass die Feier gemeinsamer Gottesdienste wie vorgesehen tatsächlich gemeinsam stattfindet. Da eine solche Gottesdienstfeier eine wichtige Aufgabe erfüllen kann, um die Mitglieder der Schulgemeinschaft zusammenzufügen und ihr Gemeinschaftsfühl entwickeln zu helfen, legen wir in diesem Land die Durchführung des gemeinsamen Gottesdienstes gesetzlich fest… Dieser erzieherische Wert des Gottesdienstes muss klar unterschieden werden von konfessionellen Gottesdienstfeiern, die gemäß ihrer eigenen Ordnung von praktizierenden Christen und Mitgliedern anderer Religionen durchgeführt werden. Die Aufrechterhaltung der Betonung des Gemeinsamen und die Verminderung des Rückzugs der Schüler von der Gottesdienstfeier ist ein geziemendes Anliegen der für die Erziehung Verantwortlichen.“ (Oberhaus, 17. Juli 1988, Spalte 441).
Der Angriff auf den Mischmasch, der sich in der ersten Jahreshälfte 1988 so machtvoll entfaltet hatte, war nicht vollends erfolgreich gewesen. Es war nicht ganz und gar möglich gewesen, die starken Kräfte auszugrenzen, die Bindungen zwischen verschiedenen Kulturen herstellen. Der Wunsch zu trennen und der Wunsch, einander intensiv zu begegnen, hatten im Konflikt miteinander gestanden, und der Wortlaut der Gesetzgebung machte es trotz der anhaltenden Angriffe der Mischmasch-Gegner nicht unmöglich oder illegal, den Weg der Begegnung voranzutreiben.
Wir haben nun den Sinn der Nahrungsmetaphern verstanden. Sie haben die Absicht, die Begegnung unterschiedlicher Kulturen und den Dialog der Religionen lächerlich zu machen und herabzusetzen. Unsere Suche nach ihrer Bedeutung ist beendet, aber unser Bestreben, sie zu verstehen, fängt gerade erst an. Warum gibt es diesen Widerwillen gegen interkulturelles Leben, diese Abneigung gegen den Dialog? Warum sollten starke Abneigungen gegen Nahrungsmittel heraufbeschworen werden, um Emotionen zugunsten des Lebens in getrennten Abteilungen zu wecken?
↑ Kapitel Drei – Bildersprache entschlüsselt: Küche, Klasse und Ideologie
Das Wort Mischmasch war seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts gebräuchlich. Es steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem altenglischen Wort miscian, das „mischen“ bedeutet, und mag auf das deutsche mischen zurückgehen. Vielleicht gibt es eine Verbindung mit dem lateinischen Wort für „mischen“, miscere.
Der Brauereiwirtschaft verdanken wir eine der ersten Bedeutungen des Wortes mash: Malz vermischt mit heißem Wasser. Man findet es auch in der Landwirtschaft für eine Mischung aus gekochtem Getreide, Kleie oder Schrot als warmer Mahlzeit für Pferde oder Rinder. Dieser Gebrauch kann bis ins späte sechzehnte Jahrhundert zurückverfolgt werden, besonders im Ausdruck bran mash, „Kleiebrei“. Ein Brei, mash, ist etwas, das man durch Zerschlagen oder Zerdrücken zu einer weichen Masse verarbeitet. Spät im sechzehnten Jahrhundert haben wir bereits metaphorische Ausläufer des Wortes. Ein Brei, mash, kommt den englischen Ausdrücken confused mixture, jumble, medley oder muddle gleich, was im Deutschen etwa einem unordentlichen Gemenge, einem Durcheinander oder einem Kuddelmuddel entspricht. Mischmasch ist einfach eine Verdopplung des mash, und bereits 1585 haben wir „einen wirren oder unordentlichen Haufen von allen Dingen durcheinander: ein Mischmasch.“ (Oxford English Dictionary, 2. Auflage 1989). Das Wort wird immer abwertend gebraucht, meist mit Verachtung. Der Gebrauch des Wortes, um religiöse Praktiken anzugreifen, die für unrein oder unorthodox gehalten wurden, ist gut verbürgt. Aus dem Jahr 1860 haben wir einen Kommentar zum Propheten Haggai von Pusay, der anmerkt: „Die Samaritaner… (inmitten ihres Mischmasch von Gottesdienst, Anbetung, wie unser Herr ihnen sagt, sie wissen nicht, was sie tun).“ (ebd.)
Hotchpotch, Eintopf, bedeutet weitgehend dasselbe wie Mischmasch. Die ursprüngliche Form ist wahrscheinlich hotch pot und kann bis zu einer ursprünglich französischen Bedeutung „einen Topf schütteln“ zurückverfolgt werden. Ab wenigstens dem fünfzehnten Jahrhundert taucht hotchpotch im Englischen als ein kulinarischer Ausdruck auf. Er mag sich auf das Zusammenrühren von Zutaten in einem Topf wie bei einem Eintopf oder einer Brühe beziehen. Sein Gebrauch als Bezeichnung für einen Missstand in einer religiösen Auseinandersetzung kann bis zum späten sechzehnten Jahrhundert zurückverfolgt werden. So wird J. Udall im Oxford English Dictionary von 1588 zitiert: „Schismen, die einen Eintopf aus wahrer Religion und Papismus machen.“ Die Vorstellung eines Schmelztiegels von Nationen oder Rassen findet sich im Jahr 1682: „Ein Eintopf oder Gemisch vieler Nationen“.
Damit es einen Reim auf hotch gibt, wurde der pot zum potch. Das ist ein Gericht, das viele Zutaten enthält. Interessant genug ist, dass das älteste im Oxford Englisch Dictionary angeführte metaphorische Beispiel aus einer theologischen Quelle stammt, vom englischen Reformator Hugh Latimer, der in seiner dritten Predigt vor Edward VI. sagte: „Sie … machten ein myngle mangle und ein hotchpotch daraus … teilweise Papismus, teilweise wahre Religion miteinander vermischt.“ (1549). Aus dem Jahr 1613 haben wir einen Hinweis auf „diese Eintopf-Religion“, und einher mit dem religiösen Gebrauch wird hotchpotch als Bezeichnung für ein Volk mit uneinheitlicher Abstammung verwendet. Ein Beispiel liefern 1980 die Schriften von Huxley, der von „diesem wundervollen ethnologischen Eintopf“ sprach, den man „fälschlicherweise die lateinische Rasse nennt.“
Hodge podge, etwa Sammelsurium, ist einfach eine verderbte Form von hotchpotch. Bis zum siebzehnten Jahrhundert war das Wort negativ besetzt worden. Man konnte Getränke zusammenmixen und den entstehenden Cocktail so benennen, und ab 1561 haben wir einen typischen religiösen Gebrauch: „Viele machen heutzutage ein hogepotche aus der Papisterei und dem Evangelium.“
Um zu verstehen, warum es als widerwärtig empfunden werden konnte, bestimmte Nahrungsmittel miteinander zu vermischen, müssen wir zuerst den Begriff der Küche im Sinne von Kochkunst, Cuisine, erörtern und dann die Geschichte der Ernährung in asiatischen und europäischen Gesellschaften untersuchen. Die Kochkunst entsteht wie die allgemeinere Kultur, von der sie ein Teil ist, aus dem ziemlichen Mangel an biologischer Spezialisierung der Gattung Mensch. Wenn man ein Vogel mit einem langen spitzen Schnabel ist, der geeignet ist, Insekten aus den Spalten und Rissen der Borke eines Baumes herauszuziehen, wird man nur schwer an einen Apfel oder ein Rumpsteak herankommen. Wenn man ein Elefant ist, sind Insekten so gut wie unerreichbar. Ist man ein Fleischfresser oder Pflanzenfresser, ist eine bestimmte Auswahl der Nahrung bereits für einen getroffen worden. Im Falle einer alles fressenden Gattung mit den zusätzlichen Vorteilen, sowohl Zerkleinerungswerkzeuge nutzen zu können als auch Sprache zum Benennen und Unterscheiden und Weitergeben von Rezepten, sind die Auswahlmöglichkeiten fast unendlich groß. Alles, was nahrhaft ist, kann gegessen werden. Unglücklicherweise kann die Sinneswahrnehmung in die Irre führen. Nicht alles, was zum Reinbeißen aussieht, ist wirklich essbar. Ein angesehener amerikanischer Ernährungspsychologe beschrieb das als ein „Dilemma des Generalisten“ (Rozin, 1988, Seite 139). Wir sind angewiesen auf die Klugheit einer Ernährungstradition, um uns im Blick auf unser Essen zu orientieren.
Die Nahrung, die wir essen, kann mit der Sprache verglichen werden, die wir äußern. Die menschlichen Sprechorgane sind fähig, Hunderte, vielleicht Tausende von Lauten hervorzubringen, aber nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen wird in jeder konkreten Sprache eingesetzt. Verschiedene Sprachen entstehen wegen der Abgrenzung menschlicher Gemeinschaften auf der einen Seite und der nicht spezialisierten Natur des menschlichen Stimmpotentials auf der anderen. Wir müssen wählen, und wenn wir weitgehend getrennt sind, wählen wir nicht alle das Gleiche. In ähnlicher Weise stellen die in jeder besonderen Küche empfohlenen Nahrungsmittel normalerweise nur einen kleinen Teil von dem dar, was dieser Kultur an Essen zur Verfügung steht, obwohl natürlich die geographische Verbreitung bestimmter Pflanzen und Tiere die Wahl einschränkt. Interessant ist jedoch, dass die Kochkunst nicht notwendigerweise jede der häufigsten regionalen Nahrungsquellen einschließt. Frösche sind in England hinreichend verbreitet, genau wie in Frankreich, und Pferde sind wahrscheinlich in beiden Ländern gleich häufig anzutreffen. Die Kochkunst jedoch unterscheidet sich.
Paul Rozin definiert eine Küche als „ein Korpus traditioneller Kenntnisse und Regeln, die sich auf Nahrung als etwas beziehen, das man essen kann … diese schließen ein … die Auswahl der Grundnahrungsmittel, gewisse Zubereitungstechniken und eine Anzahl geschmacksgebender Zutaten, mitsamt Information darüber, wie man diese nach bestimmten Rezepten miteinander verbindet. Obendrein existieren Regeln über die Abfolge von Speisen bei Mahlzeiten oder die Jahreszeiten hindurch und über Anlässe für besonderes Essen.“ (ebd., Seite 137).
Der gemeinsame Gottesdienst in Schulen kann als eine Zeremonie sozialen Essens betrachtet werden. Wir beginnen zu verstehen, warum das Programm für eine gemeinsame Gottesdienstfeier so gerne wie ein Rezept beschrieben wird und warum die Bildersprache der Zwangsernährung so leicht in den Sinn kommt, wenn wir eine Abneigung gegen etwas empfinden, was angeordnet wird. „Kulturelle Faktoren“, bemerkt Rozin, „sind es, die ursprünglich die menschliche Nahrungsauswahl bestimmen“, und „Kulturen haben Vorstellungen oder Theorien über die Beziehung zwischen bestimmten Nahrungsmitteln und Verhaltensweisen.“ (ebd., Seite 137). „Nahrung ist … eingebettet in eine komplexe soziale Matrix, die politische und ökonomische Einflüsse einschließt.“ (ebd., Seite 138).
Das Ergebnis der Ausübung dieser Vorlieben ist der charakteristische Geschmack einer Küche. Alle Gerichte dieser Küche haben eine gewisse Vertrautheit, ein typisches Aroma. Man mag neue Gerichte in den charakteristischen Stil und Geschmack einer Küche einbringen, aber Küchen, das heißt, Kulturen, zu vermischen, würde bedeuten, ein Mischmasch zu erzeugen. Wegen dieser starken Beziehung zwischen Kultur, Küche und Identität ist das Eindringen in die Grenzen der Küche wie ein Eindringen in die Grenzen einer Identität. Das ermöglicht es uns, den Ursprung der Zurückweisung bestimmter Nahrungsmittel in einer Kultur und in der Entwicklung kleiner Kinder zu verstehen. Der Körper und so auch die eigene Person würden verunreinigt durch den Kontakt mit ekelhafter Nahrung. „Der Mund scheint als eine hoch aufgeladene Grenze zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst zu wirken.“ (Rozin und Fallon, 1987, Seite 26). Wesentlich für das Phänomen des Ekels ist die Erwartung seelischer Verunreinigung. Wie kurz der Kontakt und wie winzig seine Konsequenzen gewesen sein mögen, weist man vielleicht doch ein bekömmliches Essen zurück, wenn irgendein Zusammenhang zwischen ihm und einer ekelhaften Substanz besteht. Wenn die Grenzen des Selbst sich jedoch ausweiten, verschwindet der Ekel allmählich. Liebende finden es nicht ekelhaft, sich auf den Mund zu küssen, aber die kleinste Spur von Speichel oder Lippenstift auf einem Glas, aus dem eine fremde Person getrunken hat, ist für die meisten Leute in unserer Kultur widerwärtig. Eltern finden die körperlichen Produkte ihrer kleinen Kinder normalerweise nicht so unangenehm wie die von Erwachsenen oder Fremden. Ekel geht einher mit dem, was für einen selbst fremd ist. Weil die Möglichkeit der Verunreinigung eine Bedrohung für das eigene Selbst ist, wird die anstößige Substanz zurückgewiesen.
Diese Studien von Ernährungspsychologen sind sehr erhellend für unsere Probleme. Es ist interessant zu sehen, dass das Christentum selbst ekelhaft wird, wenn es in Kontakt mit anstößigem Material gekommen ist. Der Mischmasch besteht nicht aus nicht-christlichem Material, sondern aus einer Mischung aus nicht-christlichen und christlichen Stoffen. Die christlichen Elemente sind genau so widerwärtig wie der Rest. Das gute Essen wurde verpestet und nun ist die ganze Rezeptur verdorben. „Ein auffallendes Merkmal ekelhafter Substanzen ist, dass sie ein absolut gutes Essen durch kurzen Kontakt ungenießbar machen, selbst wenn sie keine wahrnehmbare Spur hinterlassen. Die Idee (die Geschichte) des Kontaktes genügt. Wir haben das als das Prinzip der Kontamination bezeichnet.“ (Rozin, Millman und Nemeroff 1986, Seite 704).
Die Gesetze der magischen Übertragung sind ein Stück weit den Gesetzen der Assoziation ähnlich, die von den philosophischen Psychologen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts dargelegt wurden. Ihnen zufolge wurden Vorstellungen assoziiert, wenn Ähnlichkeit und Nähe wahrgenommen wurde. Was zählte, war nicht irgendeine logische Assoziation zwischen den Vorstellungen, ihre Verkettung miteinander in einer zusammenhängenden Bedeutungsstruktur, sondern die bloße Erscheinung von Ähnlichkeit oder die Tatsache, dass sie in Zeit und Raum miteinander verbunden und auf diese Weise im Gedächtnis miteinander verknüpft waren. Nach dieser Erörterung schlussfolgern die Autoren: „… während die Gesetze der Assoziation die Art und Weise von Gedankenverbindungen beschreiben und innerhalb des Kopfes bleiben, beschreiben die Gesetze der Magie Praktiken, die einen Schritt weiter gehen: Menschen benehmen sich, als ob sie glauben, dass die Welt in der gleichen Weise organisiert ist wie ihre Gedanken.“ (ebd., Seite 710).
Im Fall, den wir erörtern, ist es die Nähe von Vorstellungen aus verschiedenen Kulturen, die innerhalb eines einzigen Schulbuches oder auf einer gemeinsamen Liste innerhalb eines Lehrplans stehen, die anstößig zu sein scheint. Die Tatsache, dass Kinder aus diesen verschiedenen Kulturen Seite an Seite miteinander im Klassenraum sitzen, weckt ähnliche Emotionen. Die innere Erfahrung von Verwirrung und möglicher Verunreinigung, die stattfindet, wenn die Identität einer Person durch die Gegenwart alternativer Kulturen bedroht ist, erfordert einen großen Aufwand emotionaler Energie, um ihre eigenen unterscheidenden Eigenschaften aufrechtzuerhalten. Dieser Drang zu innerer Unverwechselbarkeit scheint nach außen projiziert zu werden in die Gesellschaft oder den Klassenraum oder das Schulbuch. Innere Trennung wird aufrechterhalten durch aktive Kampagnen für soziale und unterrichtliche Trennung. Soziale Wirklichkeiten werden im Licht innerer Konflikte interpretiert.
Illustrieren wir das mit Bezug auf die Gesetze über koschere Nahrung innerhalb der jüdischen Tradition. Vorausgesetzt, dass der nicht-koschere Anteil nicht größer als ein Sechzigstel der Gesamtmenge des koscheren Essens ist, besagt die Kaschrut (32), dass das Essen als Ganzes nicht aufhört, koscher zu sein. Gruppen praktizierender und nicht-praktizierender Juden wurden gefragt, ob sie vegetarische Speckimitate essen würden, die so aufbereitet sind, dass sie wie Speck aussehen, aber tatsächlich kein Schweinefleisch enthalten, sondern nur vegetarische Substanzen. Was hier auf dem Spiel stand, war das Gesetz der Ähnlichkeit. Würde man die Speckimitate aus solchen Gründen zurückweisen ungeachtet des tatsächlichen koscheren Status des Essens? Es wurden auch Umstände dargestellt, in denen die Mindestmenge von einem Sechzigstel offensichtlich nicht erreicht war, das heißt, wenn ein einziger winziger Shrimp versehentlich in eine Schüssel mit Apfelmus fiel oder ein Tropfen Milch in eine Hühnerbrühe. Es stellte sich heraus, dass viele Juden dieses Essen als verunreinigt zurückwiesen und so der Ansicht Nachdruck verliehen, dass Ekel auf der ideellen Ebene entsteht, wenn die Identität in Gefahr ist. Tatsächliche oder religiös definierte Verunreinigung ist nicht das Thema. Die bloße Vorstellung genügt, um Zurückweisung hervorzurufen (Nemeroff und Rozin, 1987, Seite 31f.). Wir können alle diese jüdischen Reaktionen mitempfinden, weil sie bezogen auf unsere eigenen menschlichen Erfahrungen Sinn machen. Sie sind in unserer gegenwärtigen Studie von Interesse, weil sie den Grad der Reinheit zeigen, der vorliegen muss, um das Gefühl zu vermeiden, in einen verunreinigten Mischmasch verwickelt zu sein. Je stärker das Gefühl ist, zu einer angeschlagenen Tradition zu gehören, je schärfer der Fokus einer bedrohten Identität, desto geringer wird das sein, was wir die Mischmasch-Schwelle nennen könnten. Die Debatten im Oberhaus zeigten, wie schwierig es ist, Prozentsätze zu nennen, die Mischmasch erzeugen würden. Das Gefühl einer zugleich geschützten Identität und emotionalen Verunreinigung war durchgängig und unverkennbar.
Ein Ekelgefühl gegenüber gewissen verunreinigenden Nahrungsmitteln wird nicht nur durch die Kultur und die Kochkunst erworben, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, sondern in der Entwicklungserfahrung jedes Kindes. Als wir die kulturellen Vorlieben erörterten, verwiesen wir auf die Allesfresser-Natur des Menschen. Wir finden sie vor in der frühen Kindheit. Es ist wohlbekannt, dass Säuglinge manchmal Gras und Seife, Sand und Ameisen essen, zum großen Entsetzen ihrer Eltern. Ernährungs-Erziehung in der frühen Kindheit bedeutet hauptsächlich, zu lernen, was man nicht essen darf. Das kleine Baby saugt oder lutscht an fast allem. Der Mund ist das grundlegende Organ für die Erforschung der Welt. Einverleibung ist der hauptsächliche Weg, um das Selbst zu stärken und zu erweitern.
Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass kleine Kinder dazu neigen anzunehmen, dass „wenn zwei Nahrungsmittel in Ordnung sind (zum Beispiel Spaghetti und Bananen), auch ihre Kombination akzeptabel ist.“ (Rozin, Fallon und Augustoni-Ziskand, 1986, Seite 75). Im Alter von sieben bis elf Jahren übernehmen die meisten Kinder die erwachsenen Regeln für Essens-Zusammenstellungen (ebd., Seite 81). Studien mit Vorschulkindern und Säuglingen zeigten, dass fast alle dazu bereit waren, Kombinationen von Essen in ihren Mund zu stecken, die für ihre Eltern und ihre Kultur nicht akzeptabel waren. „… ein grundlegender Bestandteil der Entwicklung ist der Erwerb ausgearbeiteterer Motivationen der Zurückweisung und infolgedessen eine prozentuale Abnahme möglicher Esswaren.“ (Rozin, Hammer, Oster, Horowitz und Marmora, 1986, Seite 142).
Diese Studien mit kleinen Kindern sind auf doppelte Weise erhellend für unseren Versuch, die Debatte über den Religionsunterricht in England zu verstehen. Erstens helfen sie uns zu verstehen, was geschieht, wenn die Behauptung aufgestellt wird, dass Kinder durcheinandergebracht werden, wenn sie mit mehr als einer Religion in Kontakt kommen. Kinder werden in eine Religion hineinsozialisiert, wie sie in eine bestimmte Küche hineinsozialisiert werden. Die angebliche Verwirrung bezieht sich auf eine traditionelle oder konventionelle Ausgestaltung von Elementen innerhalb eines abgegrenzten Ganzen, das keine Grundlage im natürlicherweise „allesfressenden“ Blick des Kindes auf das Leben hat. Kinder können durch die Assoziationen Erwachsener nicht verwirrt werden, und genau darum ist Erziehung notwendig. Die ozeanische Aufnahmefähigkeit des kleinen Kindes muss umgewandelt werden in eine Anzahl kulturell akzeptabler Vorlieben. Die Furcht, dass Kinder durcheinandergebracht werden, besagt nicht, dass Kinder subjektiv ein Gefühl von Verwirrung erfahren, denn, wie wir gesehen haben, essen kleine Kinder ganz fröhlich alle Arten unorthodoxer Kombinationen. Die Furcht auf der Seite des Erwachsenen ist, dass die Kinder sich nicht in die emotionalen und kognitiven Grenzen einer Tradition hineinsozialisieren lassen. Obwohl sie kein inneres Gefühl von Verwirrung haben, könnte man sie als objektiv verwirrt beschreiben, da sie ohne diese scharfen Abgrenzungen aufwachsen könnten. Das Kind ist unerzogen, aber nicht verwirrt.
Es ist kein Zufall, dass der Höhepunkt der Ernährungserziehung und des religiösen Hineinwachsens in die eigene Kultur während der Grundschuljahre stattfindet, im Alter von sieben bis elf. Die Ausbildung von Vorlieben in der Küche wie in der Kultur ist auf ihrem Gipfel angelangt.
Die zweite Einsicht, die wir aus der Erörterung der Entwicklung von kindlichen Nahrungsvorlieben ableiten können, hat mit emotionaler Energie zu tun. Die erwachsene Zurückweisung ekelhaften Essens ist stark emotionsgeladen nicht nur wegen der Bedeutung der Kochkunst für Kultur und Identität, sondern weil diese Vorlieben in der frühen Kindheit unter emotionalem Druck von den Eltern übernommen wurden. Was das Kind internalisiert, ist der angeekelte Blick der Eltern, wenn das Kind etwas Abscheuliches isst. Es ist erwähnenswert, dass Ekel eine der wenigen Emotionen ist, die leicht identifiziert werden können wegen eines charakteristischen Gesichtsausdrucks, der sie begleitet. Die Lippen gehen auseinander, als wollten sie ausspucken, und die Nase wird krausgezogen, als wolle sie das Eindringen von etwas Bösem verhindern. Wir fangen an zu begreifen, wie natürlich es ist, dass Erwachsene die Metaphern von ekelhafter Nahrung verwenden, um eine kulturelle Verunreinigung zu beschreiben, die sie anstößig finden, und uns geht ein Licht auf, was für eine wirkungsvolle Rhetorik das ist, da die Ausdrucksformen von Abneigung gegen Nahrung leicht ähnliche Gefühle in anderen Erwachsenen hervorrufen.
Auf der anderen Seite, wenn man einen Eindruck von Unbeirrbarkeit und Stärke zu vermitteln wünscht, konzentriert man sich auf das rechtschaffene Rindfleisch, honest beef, des guten alten England. Unter dem Titel „McGregor wirft ‚liberale‛ Examensgutachter raus“ (33), beschrieb die Daily Mail am 4. August 1990, wie „Unternehmer und ‚fortschrittlich denkende‛ Schulleiter hinzugezogen werden sollen, um die beiden entscheidenden Beiräte des Ministers aufzupeppen, wörtlich aufzubeefen (34).“ Diese Formulierung bezog sich auf den Austausch liberaler Pädagogen in den Nationalen Gremien für Lehrplan, Prüfung und Begutachtung an Schulen (35) durch solche, die Verfahrensweisen befürworten, die mehr dem Geschmack der Regierung entsprechen: mehr beef, weniger Mischmasch.
Um die politischen und sozialen Dimensionen des Gebrauchs der Nahrungsmetaphern in der gegenwärtigen Bildungsdebatte zu verstehen, müssen wir den Zusammenhang zwischen Küche und Klasse untersuchen. Die Geschichte des Essens zumindest in Europa und Asien zeigt uns, dass eine luxuriösere und abwechsungsreichere Küche immer verbunden war mit erhöhtem Wohlstand und gesteigerter Macht. Unterschiede in der Ernährungsweise sind hauptsächlich regional bedingt, aber mit verbesserten Transportsystemen wird eine vielseitigere Ernährung möglich. Eine Betonung von Seltenheit, Luxus und Verschiedenheit als solcher ist in der Entwicklung der Essensgewohnheiten der Wohlhabenden im Hellenistischen Zeitalter zu finden. Bereits im zweiten Jahrhundert n. Chr. finden wir Beschreibungen von nicht weniger als 72 verschiedener Brotsorten (Goody, 1982, Seite 103). Diese Unterschiede in der Nahrung dienten dazu, die soziale Rangordnung als solche zu kennzeichnen. Es gab auch einen gesundheitlichen Faktor: wenn Nahrungsmittel sorgfältig unterschieden wurden, wusste man genau, was man aß. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass im Mittelalter die englische Küche fast vollständig durch Einflüsse der sozialen Schicht beherrscht war. „Sowohl bei Festen als auch im Alltag wurden die Rangunterschiede durch Verschiedenheiten der Nahrung und der Bedienung betont.“ (ebd., Seite 142). Im sechzehnten Jahrhundert, als mit der Entwicklung von Essbesteck und -geschirr bei Festessen individuelle Gedecke verwendet wurden, war es nicht länger notwendig, „aus einem gemeinsamen Teller oder Topf zu essen“ (Seite 143). Während des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts wurde das Essen zu einer individuelleren und privateren Angelegenheit. Unüblich und unsauber wurde zunehmend das, was außerhalb des Haushalts lag, jenseits des Familienverbands, „und insbesondere jenseits des Ehepaares, dessen Vereinigung den Haushalt hervorbrachte und dessen Körperflüssigkeiten notwendigerweise miteinander vermischt wurden.“ (Seite 144).
Wir sehen also, dass es bis zum siebzehnten Jahrhundert einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Reinheit der Nahrung, Reinheit der Abstammung und höherer sozialer Stellung gab. Eine „Mischlingskultur“ wäre das Produkt einer unerlaubten Intimität, in deren häusliche, ethnische oder standesgemäße Einheitlichkeit etwas Fremdes eingedrungen wäre. Die oberen Schichten entwickelten verschwenderische Menüs, jeder Gang sorgfältig von den anderen unterschieden, aber die Dienerschaft aß die Speisereste wahllos durcheinander. So wurde ein „Eintopf“ oder ein „Mischmasch“ ein Anzeichen für Unterwürfigkeit, für eine degenerierte soziale Schicht.
Der Soziologe Jack Goody verfolgt die Suche nach einer charakteristischen englischen Küche zurück bis ins siebzehnte Jahrhundert. Zu dieser Zeit entstand „eine mehrdeutige Haltung gegenüber den kulinarischen Einflüssen des ‚Kontinents‛.“ Die regionale Küche sollte einfach und geradlinig sein. „Es ist die Aufwendigkeit des Fremden, die verdächtig ist, in der Kochkunst wie in den Umgangsformen…“ (Seite 145). Es wird nun typisch englisch, einfachen schlichten Rinderbraten zu genießen, aber die Franzosen und Italiener werden durch ihr typisches Essen charakterisiert. Man identifiziert sich selbst und dementsprechend seine Nachbarn durch eine unverwechselbare Küche. Goody fährt fort: „Ohne Frage erhalten solche Unterschiede eine gefährlichere Bedeutung, wenn sie mit tiefgreifenden ideologischen Überzeugungen verbunden sind und wenn die betreffenden Gruppen Seite an Seite leben.“ „… Diese zutiefst verinnerlichten Praktiken und Vermeidungen definieren nicht nur religiöse Zugehörigkeit, sondern können interkulturelle Unruhen von furchterregenden Ausmaßen hervorrufen … wo Weltreligionen in engen Kontakt miteinander kommen.“ (Seite 146). Der Gebrauch solcher Abgrenzungen, die auf Nahrung, Herkunft und Religion beruhen, wird, wie Goody anmerkt, besonders betont in „Gesellschaften, in denen ein Teilbereich auf relativ dauerhafter Basis mehr erreicht hat, als ihm auf Grund ‚natürlicher Gerechtigkeit‛ oder Gegenseitigkeit zusteht…“ (Seite 147). In Zeiten rapiden sozialen Wechsels kann die Küche einen Brennpunkt für Konservatismus darstellen. Kontinuität der Kochkunst ist eine stete Quelle der Behaglichkeit und das ist stimmig mit dem Widerstand gegen Veränderung in anderen Aspekten des sozialen Lebens (Seite 150ff).
Goody betont den Zusammenhang zwischen Essen, Ideologie und Sexualität. „… Die enge und beständige Verbindung zwischen Essen und Sexualität, die häufig zum Gegenstand übertragener Bedeutungen wird, zwischen Produktion und Reproduktion. Die Verbindung erscheint nicht nur auf der Ebene dieser Primäraktivitäten selbst, sondern in den Verboten oder Tabus, die sie umgeben, und zwar in den Bereichen von „Totemismus“ und „Inzest“ ebenso wie in den damit einhergehenden Vorschriften und Vorlieben für Nahrung und Ehefrauen.“ (Seite 191-192).
Es ist diese Verbindung zwischen Essen und Sexualität, die der Rhetorik des Mischmasch ihre hohe moralische Wirkung verleiht. Physischer und moralischer Ekel gehen Hand in Hand. Vermischung des Unangebrachten ist unrein, in ethischer, sozialer und physischer Hinsicht. Es lohnt sich hier, über den Gebrauch des englischen Wortes „adulterate“ (= verderben, verfälschen, Gewalt antun) in Gesellschaft und Geschichte nachzudenken. Die Vermischung von Weinen und Broten mit minderwertigeren Stoffen wurde bereits im späten sechzehnten Jahrhundert als adulteration bezeichnet. Verunreinigung von Nahrung, obwohl nicht unbekannt in einer Agrargesellschaft, ist ein besonderes Merkmal der Industriegesellschaft. Im England des achtzehnten Jahrhundert gab es Literatur zum Thema – Bücher und Flugschriften, die die Praktiken des Nahrungsmittelhandels herausstellten. To adulterate bedeutet „mit einer minderwertigen Zusatzmischung vermengen“. Im sexuellen Sinn kann adultery, Ehebruch, nur von Partnern begangen werden, von denen einer verheiratet ist, sonst könnte es keine verbotene Herabwürdigung einer erhabenen Herkunft durch niederen Verkehr geben. Die höheren Schichten, in denen der Stolz auf die blutsmäßige Abstammung wichtig war, fürchteten den Ehebruch offensichtlich mehr als die bäuerlichen Schichten. Sie hatten mehr zu verlieren, da ihre Abstammung im Wert gemindert würde, während die Bauern schon niedriger Herkunft waren. Bett und Tisch zu teilen, hatte zur Voraussetzung die Annahme einer Gleichwertigkeit, einer Reinheit. Die Nahrungsmittel oder die Betten zu vermischen, war eine Einladung zur Vermischung auch der sozialen Schichten. Es ist kein Zufall, dass der ausgefeilteste Gebrauch der Nahrungsmetaphern nicht im Unterhaus, sondern im Oberhaus stattfand.
Im Januar 1989 kündigte der damalige Bildungsminister Kenneth Baker an, dass der Geschichtsunterricht im Nationalen Bildungsplan „in seinem Kern aus der Geschichte Großbritanniens, den Dokumenten seiner Vergangenheit und seines politischen, verfassungsmäßigen und kulturellen Erbes“ bestehen würde. Dieses Programm würde die Stelle dessen einnehmen, was Mr. Baker anderswo als „den Eintopf“ des schulischen Geschichtsunterrichts bezeichnet hatte. Mit anderen Worten: kritische und erforschende Annäherungen an die Geschichte, gegründet auf weltweite Perspektiven, würden ersetzt werden durch einen kulturell abgeschlosseneren Lehrplan (Searle, 1989a, Seite 36).
Die Verbindung zwischen Nahrung und einer hohen Gewichtung der britischen Kultur, wenn wir es so ausdrücken wollen, kommt noch klarer in einem Artikel aus The Independent on Sunday am 6. Mai 1990 zum Ausdruck. Der Artikel „Ein weißer Mann auf der Suche nach Wählerstimmen“ enthält ein Interview mit zwei Mitgliedern der Britischen Nationalen Partei, die sich 1982 von der Nationalen Front abgespalten hatten. In einem lebhaften, unterhaltsamen Interview gibt einer der Männer zu, „… in indischen Restaurants zu essen. Mr. Smith sagt: ‚Solange sie da sind, nutze ich sie natürlich.‛ ‚Nun, ich nicht!‛ sagt Mr. Walsh. ‚Und ich gehe nicht zu chinesischen Pommesbuden und versuche, Zeitungen oder Getränke nicht in Paki-Shops zu kaufen … aber in der Nacht nach einer Ladung Bier ist es schwer, wenn man keine Limonade oder so etwas kriegt. Ich habe nichts gegen Spaghetti, aber ich würde nie bei einem Itaker (36) essen gehen. Ich esse englische Kost. Was ist daran falsch?‛“ Um zu erklären, was englische Kost ist, setzt Mr. Walsh den „Wand-Test“ ein, wie er ihn nennt. „Stelle einen Russen und einen Engländer an die Wand, und sie sehen mehr oder weniger gleich aus. Europäer sind alle eine rassische Familie. Ich kann ihr Essen essen.“ Der vorangegangene Teil dieses interessanten Interviews deckt die Verbindung auf, die zwischen der Ernährungsweise anderer Rassen und der Aufnahme sexueller Beziehungen zu Fremden besteht. „Ich sah mich um und konnte überall Schwarze sehen, sie überrollen uns. Ich wusste, sie waren nicht wie ich. … Es gibt einige gut aussehende schwarze Mädchen. Aber ich würde nie mit einem gehen.“
Später in dem Artikel trifft der Reporter Milton, dessen Aufgabe es ist, auf den Parteiversammlungen den Union Jack, die britische Flagge, mit sich zu führen. „Milton ist versessen auf rassische Reinheit und auf das Klassensystem. ‚Man braucht die Aristokratie und eine Mittelklasse, sonst hat niemand etwas, auf das er hinarbeiten kann.‛“ (Interessante Beispiele desselben Zusammenhangs zwischen Nahrung, Sexualität und der Reinheit der Kultur oder sozialen Schicht sind zu finden in Chris Searle, Ihre Tagesdosis: Rassismus und „The Sun“, Kampagne für Presse- und Runkfunk-Freiheit 1989, besonders Kapitel 5, „The Sun zum Thema Großbritannien“ (37).)
In diesem Kapitel haben wir die Zusammenhänge zwischen Nahrung und Religion nur flüchtig erwähnt. Da sie im Mittelpunkt der Rhetorik stehen, die wir analysieren, müssen wir sie nun detaillierter untersuchen.
↑ Kapitel Vier – Reinheit der Nahrung und des Glaubens
Einer der wichtigsten Beiträge des Psychologen Erik H. Erikson zum Studium des menschlichen Lebenszyklus betraf den Bereich der Identität. Erikson glaubte, dass die Adoleszenz eine kritische Phase für den Aufbau der Identität darstellt, denn in diesem Alter müssen sich der Sinn für die Kontinuität und die Kohärenz des Selbst ausformen, wenn die Aufgaben des Erwachsenenlebens erfolgreich bewältigt werden sollen. Politische, religiöse und soziale Weltbilder haben einen hohen Stellenwert für Eriksons Verständnis der Identitätsbildung. Durch Ergebenheit und Treue gegenüber den Idealen einer Gruppe, Partei oder Kultur erfahre ich die Grenzen meines eigenen Selbst. Zu wem ich gehöre und wofür ich verantwortlich bin, diese Fragen werden durch die Hingabe an solche Gruppen beantwortet (Erikson, 1968). Die Stelle der Religion ist besonders wichtig in diesem Prozess. Erikson betrachtete Religion primär als „eine Quelle von Ideologien für diejenigen, die Identitäten suchen“ (Erikson, 1958, Seite 22). Es gibt keinen Zweifel, dass Religion beim Aufbau von Identität sehr starke Wirkungen entfalten kann. Hans Mol, der herausragende Arbeit geleistet hat, um Eriksons Identitätstheorie weiterzuentwickeln, betrachtet Religion als die Heiligung der Identität (Mol, 1978, Seite 7). Erikson unterschied zwischen zwei Arten von Identität: die Identität der Absolutheit und die der Ganzheit (Erikson, 1968, Seite 80-89; Erikson, 1975, Seite 175ff.).
Absolutsetzende (38) Identität wird hergestellt, indem ich ausschließe. Ich kenne mich selbst als Europäer genau darum, weil ich kein Afrikaner bin, als Mann genau darum, weil ich keine Frau bin, als Erwachsener genau darum, weil ich kein Kind mehr bin. Entscheidend für eine absolutsetzende Identitätsgestaltung ist es, Grenzen zu schaffen. Innerhalb dieser Grenze bin ich ich selbst, jenseits der Grenze ist etwas anderes, etwas von mir Verschiedenes, das nicht ich bin. Demgegenüber wirkt die Identität, die durch Ganzheit charakterisiert ist, durch Einbeziehung. Obwohl ich Europäer bin, bin ich außerdem ein Mensch und gehöre zusammen mit dem Afrikaner. Obwohl ich männlich bin, ist mir meine Weiblichkeit bewusst. Indem ich erwachsen bin, ist immer noch Kindlichkeit in mir. Ich bin nicht nur das eine; ich bin auch das andere. Zur reifen Identitätsbildung scheint beides erforderlich zu sein, sowohl die absolutsetzende als auch die ganzheitliche Methode. Es gibt eine Zeit, um Grenzen zu ziehen; es gibt eine Zeit, um Grenzen zu überschreiten. Es gibt eine Zeit zum Wegwerfen und eine Zeit zum Sammeln, eine Zeit sich zu umarmen, und eine Zeit, sich aus der Umarmung zu lösen. Vielleicht pendeln die meisten Menschen zwischen Absolutheit und Ganzheit; vielleicht schreitet die Identitätsbildung auf dem Weg einer ansteigenden Spirale voran, in der sich Phasen der Ausgrenzung mit Phasen der Einbeziehung abwechseln.
Die Nahrungsmetaphern, die wir erörtern, haben ihren Ursprung in einer Konzeption von Identität, in der Absolutheit und Ausgrenzung überbetont werden. Statt Religionslehrern zu erlauben, diese Schwerpunkte im Klassenzimmer zu bestimmen, je nach der individuellen Einschätzung der einzelnen jungen Menschen, die sich in ihrer Obhut befinden, wird ein Versuch unternommen, auf Grenzen zu bestehen, Grenzen gesetzlich festzuschreiben und das natürliche Pendeln zwischen den beiden Arten der Identitätsbildung zu verhindern. Es ist dieses Beharren auf der einen Art der Identitätsbildung und der damit einhergehende Angriff auf diejenigen, die sich wenigstens manchmal um eine breitere und inklusivere Identität bemühen, die wir hier untersuchen. Die Metaphern von vermischtem und ekelhaftem Essen werden benutzt, um diejenigen in Verruf zu bringen, die davon überzeugt sind, dass Identität sowohl durch Ausschließung als auch durch Einbeziehung weiterentwickelt werden kann.
Um dieses Bedürfnis, anzugreifen und in Verruf zu bringen, zu verstehen, müssen wir den Charakter des religiösen Absolutheitsanspruchs untersuchen. Das wesentliche Prinzip ist hier das der Reinheit. Um Reinheit aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, sie von Unreinheit zu unterscheiden. Wie bereits erwähnt, ist es typisch für die absolutsetzende Identität, ihre Geschlossenheit durch das Ziehen einer Linie zwischen dem, was man ist und was man nicht ist, zu erreichen. Reinheit ist innen, Unreinheit ist außen. Die Unterscheidung zwischen Reinheit und Unreinheit ist also eine Sache des Raumes oder Ortes. Wenn das, was jenseits der Grenze liegt, nach innen herüberkommen sollte, wäre es fehl am Platz. Seine Charakteristika könnten genau die gleichen sein, aber sein Ort hätte sich verändert, und das würde genügen, um es in Schmutz zu verwandeln.
Schmutz ist Materie, die sich an der falschen Stelle befindet. Gartengeräte gehören nicht in den Kleiderschrank, und selbst blank polierte Stiefel werden nicht zusammen mit dem Essgeschirr aufbewahrt. Benutztes Geschirr ist definitionsgemäß schmutzig, bevor es gespült wird, aber es ist schmutziger, es im Wohnzimmer herumliegen zu lassen, als es neben der Spüle in der Küche aufzustapeln. Schmutz ist eine besondere Form von Unordnung. Bücher können unordentlich auf einem Bücherregal stehen, aber wenn dazwischen Milchflaschen, Glühbirnen und Autoersatzteile liegen, würden viele Leute das nicht nur unaufgeräumt, sondern schlampig finden. Wer Dreck oder Erde an den Händen hat, ist schmutzig, aber Dreck im Garten ist nicht schmutzig, und niemand hat ein Problem damit, wenn man sich bei der Gartenarbeit die Hände schmutzig macht. Aber mit dem Eintritt in das Haus werden die Hände schmutzig.
Schmutz setzt also eine Art von Ordnung oder Gesetzmäßigkeit voraus. „Schmutz ist mithin niemals ein einzelnes, isoliertes Ereignis. Wo es Schmutz gibt, gibt es ein System.“ (Douglas, 1966, Seite 35). Schmutz ist das, was außer Betracht bleibt, wenn die Ordnung oder Systematisierung fertiggestellt ist. Mary Douglas zeigt in ihrer Studie über die Unreinheitsrituale verschiedener Gesellschaften, inwiefern Fragen von Schmutz und Reinheit nicht nur materielle Übereinkünfte, sondern auch symbolische und ethische Fragen umfassen. Es gibt nicht nur schmutzige Hände; es kann auch schmutzige Gedanken geben. „… Unsere Reaktion auf Verunreinigung verdammt jede Sache oder Idee, die in Ehren gehaltene Einstufungen durcheinanderzubringen oder abzuschaffen droht.“ (ebd, Seite 36). Verunreinigung geht mit Kontakt einher. Soll unser Geist oder unsere Seele verseucht werden, wird das normalerweise durch Körperkontakt symbolisiert.
Der Begrenzung des Körpers, der Haut, kommt eine besondere Bedeutung als der Membran zu, die innen und außen voneinander trennt. Die Öffnungen des Körpers sind von besonderer emotionaler und symbolischer Bedeutung, weil durch sie der Transport über die Grenze vor sich geht. Der Symbolismus der Körperöffnungen ist daher nicht auf unsere eigene individuelle Erfahrung im Kleinkindalter beschränkt, obwohl er aus seinen Quellen in der Kindheit viel von seiner emotionalen Kraft bezieht. Körpersymbolik spiegelt auch unser Verständnis der angemessenen Grenzen unserer Gesellschaft, die Regelung unseres religiösen, sozialen und kulturellen Lebens wider. „… Alle Grenzen sind gefährlich. Werden sie so oder so gezogen, wird die Gestalt fundamentaler Erfahrungen geändert. Jegliches Gefüge von Vorstellungen ist verwundbar an seinen Rändern. Es ist davon auszugehen, dass die Öffnungen des Körpers seine besonders verwundbaren Punkte symbolisieren.“ (ebd., Seite 121). Wenn wir die Symbolik des Körpers benutzen und insbesondere die Symbolik von Essen und Nahrung, können damit unsere tiefsten Befürchtungen und Ängste im Blick auf die Gesellschaft ausgedrückt werden. Mary Douglas betont, dass dieser Ausdruck oft die Form des Witzes annimmt. „… Die Symbolik der Körpergrenzen wird in dieser Art nicht-lustiger Witze benutzt, um Gefahr für die Grenzen der Gemeinschaft auszudrücken.“ (ebd., Seite 122). Das erinnert uns an den oben zitierten Leserbrief im Times Educational Supplement (20.7.90). „Kinder aller Glaubensrichtungen werden durch diesen multireligiösen Mischmasch betrogen. Wenn dieser Lehrplan ‚pädagogisch gesund‛ ist, dann bin ich ein gekochtes Ei.“
Wenn diese Grenzen überschritten werden, ist sowohl die Reinheit des Essens als auch des Glaubens bedroht. In Lehrplänen, die sich auf mehrere Religionen beziehen, „werden alle Glaubensrichtungen trivialisiert und der Glaube selbst möglicherweise zerstört.“ Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, „die Integrität des Christentums und anderer Weltreligionen zu schützen.“ (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 641). Multireligiöse Ansätze sind „verwirrend“ und führen zur „Zerstörung der Reinheit des Gottesdienstes“ (Spalte 642), weil „der christliche Glaube unverwässert gelehrt werden sollte … Er sollte nicht verwirrt werden, indem man versucht, ihn mit Untertönen von etwas anderem, das in ihn eindringt, zu lehren.“ (Spalte 660). Diese Sichtweise der Beziehungen zwischen den Religionen hat etwas ziemlich Protestantisches. Johann Baptist Metz hat das in seinem Buch The Emergent Church: the future of Christianity in a postbourgeois world erörtert. „Die Furcht der Reformation vor der Sünde wurde schrittweise zu einer anderen Art von Furcht. Ich nenne sie ‚Furcht vor Kontakt‛, Furcht davor, mit dem in Berührung zu kommen, was von der Erde ist, mit den Sinnen wahrgenommen wird, also mit jenem leiblichen, sozialen Leben, innerhalb dessen die Gnade sich uns zu verleihen wünscht …“ Metz verfolgt diese Furcht vor Verseuchung zurück bis zu dem, was er das Pathos der reinen Lehre nennt, durch das die Kirche eine reine Lehre anstrebte im Gegenüber zum verdorbenen, weltlichen und verkommenen religiösen Leben der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Die Welt wurde als mit weltlichen Kompromissen infiziert angesehen. „Jetzt ist die Idee des ‚Reinen‛ mit dem Inneren, dem Geistlichen, dem Nicht-Sinnlichen verbunden worden. Es ist eine Art des Christentums, die uns zu überzeugen versucht, dass die Gnade sich allein durch den Glauben vermittelt, durch die reine Lehre. Es gibt nichts anzufassen oder zu handhaben, und eine stetige Gefahr besteht darin, dass enger Kontakt die Integrität des Glaubens verdirbt. Das wiederum erzeugte eine Furcht davor, in ‚unsaubere, widersprüchliche soziale Konflikte‛ verwickelt zu werden.“ (Metz, 1981, Seite 51ff.).
Das Konzept der reinen Lehre mit seiner dazugehörigen Furcht vor Kontakt, das von dem europäischen katholischen Theologen J. B. Metz beschrieben wurde, kann mit der Vorstellung vom „rechtgläubigen Protestantismus“ verglichen werden, die der brasilianische protestantische Theologe Rubem Alves in seinem Buch Protestantism and Repression: A Brazilian Case Study entwickelt hat. Die konservativen, gesetzlichen protestantischen Kirchen, die Alves beschreibt, sind um ein Unschuldsbewusstsein herum konstruiert. Der Unterschied zwischen Unschuld und Schuld wird durch verschiedene Kategorien von Sünden begründet, in die sich Gläubige verstricken können. Die Aufrechterhaltung der Disziplin rund um diese Normen ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der inneren Reinheit der Kirche. Christen sind anders. Die Unterschiede erzeugen ein starkes Wir-Gefühl, indem alle, die draußen sind, als fremd identifiziert und Schuldige bestraft werden. Die erste Kategorie von Sünden betrifft die Sexualität, während die zweite darin besteht, das Sabbatgebot zu brechen. An dritter Stelle stehen die Laster wie Rauchen, Trinken und Glücksspiel, an vierter kommen Eigentumsdelikte und an letzter gedankliche Vergehen, das heißt falsche Glaubensvorstellungen. Es ist bemerkenswert, dass all diese Kategorien mit der Überschreitung von Grenzen einhergehen; es wird etwas in Zeit oder Raum an eine Stelle getan, wo es nicht sein sollte. Sexuelle Sünden sind Kontaktsünden, und Sabbatbruch verunreinigt die Heiligkeit der sakralen Zeit, indem man profane Zeit in sie eindringen lässt. Die Laster haben ebenfalls hauptsächlich mit etwas zu tun, was in den Körper eindringt oder aus ihm herauskommt (Rauchen, Trinken) oder was den Mund schmückt (die Benutzung von Lippenstift). Andere Sünden haben mit Geld und Eigentum zu tun. (Alves, ebd., Kapitel 5, „Believers are Different: the personal ethic of RDP“).
Bis jetzt haben wir in diesem Kapitel die gehemmte Form „reiner“ Religion untersucht, die sich gegen die Verunreinigung durch Berührung wehrt. Wir haben festgestellt, dass Anthropologen und Theologen diese Art von Religion in Augenschein nehmen und dass ihre Beschreibungen mit dem übereinstimmen, was wir in unserer Untersuchung der Nahrungsmetaphern herausgefunden haben, die in den englischen Debatten über den Religionsunterricht verwendet wurden. Der aufschlussreichste Hintergrund jedoch, insbesondere zur Beziehung zwischen reiner Religion und reinem Essen, ist in der Bibel selbst zu finden. Viele von denen, die Nahrungsmetaphern verwenden, um einen Religionsunterricht anzugreifen, der die Weltreligionen zum Ausgangspunkt nimmt, betrachten sich selbst als bibelgläubige Christen. Es ist daher nicht verwunderlich, ihre Einstellungen zur Reinheit von Essen und Glauben in der Bibel wiederzufinden.
Bevor die Menschheit in verschiedene Völker aufgeteilt wurde, gab es keine Unterschiede zwischen reinem und unreinem Essen. Entsprechend der ältesten Genesis-Tradition waren Adam und Eva Vegetarier. „Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: ‚Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen‛“ (1. Buch Mose 2, 16-17) (39). Das Verbot richtete sich gegen einen besonderen Baum, nicht gegen eine Auswahl von Nahrung als solcher. Der Sündenfall hatte keinerlei Änderung der Ernährungsweise zur Folge. „… du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen…“ (1. Buch Mose 3, 18-19). Eine nicht mehr vegetarisch eingeschränkte Ernährungsweise scheint nach der Sintflut eingeführt worden zu sein, denn wir lesen, dass Gott zu Noah und seiner Familie sagt: „Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, und über allen Fischen im Meer; in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich’s euch alles gegeben.“ (1. Buch Mose 9, 2-3). Ein Überbleibsel der ursprünglich vegetarischen Lebensweise mag im Verbot, Blut zu vergießen, gefunden werden (Vers 4), aber das muss auch als ein besonderes Verbot gesehen werden und nicht als die Erstellung einer Kategorie unreinen Essens. Jede Nahrung konnte gegessen werden, unter der Voraussetzung, dass diese Bedingung eingehalten wurde. Diese Einheitlichkeit der Ernährung steht in Übereinstimmung mit der Einheit der menschlichen Gattung, da Gott als Folge der Sintflut die Erde aus der einen Familie des Noah neu bevölkerte (1. Buch Mose 9, 1). Die Speisevorschriften für Adam und Eva und für die Familie Noahs bezogen sich im Prinzip auf eine ungeteilte Menschheit. Der Bund mit Mose jedoch wurde nur mit dem Volk Israel geschlossen.
Sofort finden wir, dass mit einer geteilten Menschheit eine geteilte Ernährungsweise einhergeht. Kulturelle und religiöse Unterscheidungen werden in Ernährungsunterschieden ausgedrückt. „Ich bin der HERR, euer Gott, der euch von den Völkern abgesondert hat, dass ihr auch absondern sollt das reine Vieh vom unreinen und die unreinen Vögel von den reinen und euch nicht unrein machet an Vieh, an Vögeln und an allem, was auf Erden kriecht, das ich abgesondert habe, dass es euch unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig sein; denn ich, der HERR, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret.“ (3. Buch Mose 20, 24-26). Das Konzept des Mischmasch wäre nicht möglich ohne das Konzept klarer Unterscheidungen zwischen verschiedenen Nahrungsmitteln und ohne Regeln für ihre Zubereitung in einer Küche. Unterscheidungen dieser Art scheinen jedoch nur aufzutreten, wenn eine Notwendigkeit besteht, Unterschiede zwischen Völkern zu bekräftigen. „Speiseverbote sind in der Tat ein Mittel zur Trennung eines Volkes von anderen Völkern…“ (Soler, 1979 Seite 129).
Jean Soler trägt in seiner Erörterung über reine und unreine Tiere eine Reihe interessanter Argumente vor. Den Kern des Konzeptes bildete die Vorstellung, dass jede Gattung sich in Übereinstimmung mit ihresgleichen fortpflanzt. „Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art.“ (1. Buch Mose 1, 12). „Und Gott sprach: ‚Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art…‛“ (1. Buch Mose 1, 24). Lebewesen wurden in drei Arten aufgeteilt: diejenigen, die auf der Erde liefen, diejenigen, die im Meer schwammen, und diejenigen, die in der Luft flogen. Die unreinen Geschöpfe waren jene, die diese Unterscheidungen nicht beachteten, z. B. Schlangen, die auf der Erde krochen, ohne Beine zu haben, Insekten, die auf der Erde liefen, aber Flügel hatten, usw. Soler bemerkt: „Wenn sie in keine Kategorie passen oder wenn sie in zwei Kategorien auf einmal passen, sind sie unrein.“ (ebd., Seite 135).
Das Prinzip, verschiedene Arten nicht zu vermischen, wurde in der Tierzucht beachtet, aber es ging darüber hinaus. Es erlangte Bedeutung in der Landwirtschaft und beeinflusste sogar die von den Menschen getragene Kleidung. „Lass nicht zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren und besäe dein Feld nicht mit zweierlei Samen und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist.“ (3. Buch Mose 19, 19). Ein ähnliches Verbot findet sich im 5. Buch Mose 22, 11. „Du sollst nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und Leinen zugleich gemacht ist.“ (5. Buch Mose 22, 11). Wir könnten das vielleicht so übersetzen: „Du sollst nicht einen Mischmasch anziehen“, denn worauf es ankommt, ist, dass Wolle zugleich mit Leinen zu tragen, bedeuten würde, Tier mit Pflanze zu vermischen. Es war nicht nur unzulässig, Tiere verschiedener Arten miteinander zu kreuzen, sie durften auch nicht Seite an Seite miteinander arbeiten. „Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind und einem Esel.“ (5. Buch Mose 22, 10). Das hieße, gegen die göttlichen Ordnungen zu verstoßen. Ohne Zweifel sollte diese Weltsicht die Unverwechselbarkeit Israels als eines besonderen Volkes unter den Nationen unterstützen. Da verschiedene Arten sich nicht vermischen dürfen, darf es keine Mischehen geben. Dem Volk Israel war es verboten, Mischehen mit den Kanaanitern zu schließen. „Du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern; eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne.“ (5. Buch Mose 7, 3). Als logische Konsequenz ergibt sich daraus, dass keine Person mit vermischter oder außerehelicher Abstammung an der Versammlung des Herrn teilnehmen durfte (5. Buch Mose 23, 2f). Als dieses Verlangen nach rassischer Reinheit auf die Natur selbst projiziert wurde und zu einer Ideologie wurde, in der Klassifizierung ganz wichtig war, wurde der Mischling zu dem Abscheulichsten, was es gab. Ein Mischling ist eine Kreuzung, ein Ding, durch das zwei andere Dinge ersetzt worden sind. Jean Soler zieht den Schluss: „Unreinheit ist mithin einfach Unordnung, wo auch immer sie auftritt.“ (ebd., Seite 136). Männern war es verboten, Frauenkleider anzuziehen und eine Frau sollte nicht Männersachen tragen (5. Buch Mose 22, 5), nicht um im modernen Freudschen Sinn transvestitische Triebe zu unterdrücken, sondern weil alle sexuellen, kulturellen, sozialen und natürlichen Kategorien die strengstmögliche Trennung widerspiegeln mussten, um Israels Besonderheit unter den Nationen aufrechtzuerhalten. Sollte das nicht die Homosexualität gefördert haben? Keineswegs, denn der Ehemann und die Ehefrau wurden ein Fleisch (1. Buch Mose 2, 24). Diese Vermischung der Gegensätze ist kein Mischmasch, sondern eine ekstatische Einheit, in der die Gegensätze überwunden werden.
Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sexuelle Symbolik ziemlich selten im Alten Testament benutzt wird, nämlich wegen ihrer revolutionären Implikationen. Die herausragende Ausnahme ist natürlich das Lied der Lieder, und das Gespür der frühen Kirche traf genau ins Schwarze, als diese wundervollen Gedichte von sexueller Liebe als Allegorien der neuen Ordnung, der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche, interpretiert wurden. Denn wenn in Mann und Frau die geschlechtlichen Gegensätze überwunden werden können, warum sollte nicht die ganze Schöpfung in ekstatischer Einheit erneuert werden können? Die verwandelnde Kraft des Mischmasch zu untersuchen, die neue Wirklichkeit, in der Unterscheidungen überwunden werden, ist die Aufgabe unseres letzten Kapitels.
↑ Kapitel Fünf – „Er erklärte alle Speisen für rein.“ Ein christlicher Ansatz für den Religionsunterricht
Unsere Untersuchungen der Kultur, Anthropologie und Religion beleuchten unser ehemals sehr unbestimmtes und doch amüsantes Problem so klar wie der helle Tag. Wir können nun in die Welt eindringen, aus der die leichtfertigen, ja widerlichen Nahrungsmetaphern stammen. Wir erinnern uns, wie im Oberhaus in der Nacht des 21. Juni 1988 der Bischof von London, der die Vorstellung, Kinder verschiedener Religion könnten voneinander in Glaubensfragen lernen, nicht völlig zurückgewiesen hatte, mit einer Metapher aus dem Bereich des Sports herausgefordert wurde (Spalte 721). Während eines Fußballspiels würde es der Schiedsrichter nicht plötzlich für angebracht halten, ein bisschen Action nach Rugby-Regeln einzubringen. Im Hintergrund des Witzes erkennen wir eine Welt, die durch starre Einteilungen bestimmt ist. Wenn junge Menschen aus verschiedenen Traditionen miteinander Gottesdienst feiern oder sogar zusammen lernen sollten, würden die voneinander getrennten Einteilungen, auf denen die soziale Abgrenzung beruht, verschwimmen. Man könnte das Spiel nicht mehr nach den üblichen Regeln spielen. Man wüsste nicht, was man tun sollte. Alles würde anfangen, zu entgleiten und ineinanderzufließen. Der Schulgottesdienst kleidet sich in multireligiöse Gewänder (Unterhaus, 9. Februar 1988, Spalte 1270), bis seine geistliche Wirklichkeit verschwindet. Dehnt man die Metaphorik aus, ist es, als ob ein falscher Jakob (der multireligiöse Religionsunterricht) mit fellbedeckten Armen den alten blinden Vater (die christliche Tradition) hintergeht. Er kleidet sich in einen Mischmasch, um den Platz Esaus einzunehmen (die desinteressierten Eltern und ihre Kinder), der bereits sein kostbares Erstgeburtsrecht für einen Linseneintopf verkauft hat. Jeder soll getrennt für sich bleiben nach seiner Art.
Am Abend des 3. Mai 1988 fand eine Debatte im Oberhaus statt, die sich auf den Ausdruck „vorherrschend christlich“ konzentrierte. Der Leitantrag war: „Wo eine öffentliche Schule als konfessionelle Schule errichtet wurde, christlich oder nicht-christlich, soll in dieser Schule der Religionsunterricht dieser bestimmten Konfession stattfinden“, und wo es von den Eltern gewünscht wird, sollen angemessene Vorkehrungen „für den Religionsunterricht von Kindern anderen Glaubens gemäß ihrer eigenen Religion“ getroffen werden. Es darf keine Mischformen geben. In derselben Debatte bemerkte ein Redner, dass das Studium verschiedener Religionen wie das Studium verschiedener Vogelarten sei. Uns entgeht nicht die Bedeutsamkeit der Art und Weise, in der Religionsverschiedenheiten als Unterschiede der natürlichen Beschaffenheit dargestellt werden. Die Vögel, die in der Luft fliegen, sind reinrassig, jeder nach seiner Art, und genau so ist es mit den Religionen der Menschheit. Sie werden nicht als ein Teil der menschlichen Welt gesehen, der geschichtlichen Welt menschlicher Handlungen, Absichten und Aufnahmefähigkeiten, sondern sind Teil der natürlichen Ordnung der Dinge, unwandelbar, von ihrer eigenen biologischen Logik beherrscht (Spalte 510). Nachdem wir nun die Beziehung zwischen religiösem Glauben, Nahrung und Rasse klargestellt haben, können wir mit geschultem Gespür die folgende Metapher würdigen. „Wenn wir die Religion in Glaube und Leben als das geistliche Lebensblut der Nation und all ihrer Bürger betrachten, dann kann ein wirkungsvoller Religionsunterricht genau so wenig von und für Personen einer anderen Religionszugehörigkeit gehalten werden, wie eine Bluttransfusion sicher verabreicht werden kann, ohne zuvor die Blutgruppenübereinstimmung zu garantieren. Wahllose Blutvermischung kann sich als gefährlich herausstellen, genau wie die Vermischung von Religionen im Unterricht.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 419). Wieder einmal werden die Religionen als Naturphänomene betrachtet. Sie sind durch unsere Abstammung in unseren Körpern befestigt. Theologie und Biologie werden hier komplett durcheinandergeworfen in einem echten intellektuellen Mischmasch, der selbst der Inbegriff dessen ist, was er verurteilt. Kein Mischling darf in die Gemeinde des Herrn kommen (40).
Die Zeit ist gekommen, in diesem letzten Kapitel, um die Welt, aus der die Ängste vor Mischmasch herrühren, einer anderen Welt gegenüberzustellen. Als Jesus sagte: „Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Trinkt alle daraus“, tranken seine Jünger alle aus einem gemeinsamen Kelch. Hat Gott nicht „aus einem Blut alle Völker gemacht, damit sie auf dem Angesicht der Erde wohnen?“ (Apostelgeschichte 17, 26 (41)). Diejenigen, die Angst haben vor Mischmasch, sind zutiefst respektvoll gegenüber dem Glauben anderer. Jeder Glaube soll seine Reinheit, seine Integrität bewahren. Jede Religion muss irgendwie für sich getrennt eingeordnet werden. Ich bin heilig, sagt die Anti-Mischmasch-Argumentation, und du bist heilig, aber der Boden zwischen uns ist unheilig, und wir werden uns gegenseitig vergiften, wenn wir uns treffen, weil sich dadurch das Blut in schädlicher Weise mischt. Die andere Haltung, die wir nun erkunden wollen, nimmt den gegensätzlichen Standpunkt ein. Für mich selbst, schlägt sie vor, bin ich nicht besonders heilig, und vielleicht bist du für dich selbst auch nicht wunderbar heilig, aber der Raum zwischen uns ist heilig. Die trennende Grenze soll heiliger Boden werden, gemeinsamer Grund, Gegenseitigkeit von Resonanz und Verantwortung, die uns wahrhaft menschlich macht. Heiligkeit wird entdeckt durch Begegnung.
Eben weil Nahrung und Ernährung eine zentrale Stellung in Israel eingenommen hatten, führten sie zu Kontroversen zwischen Christen und Juden. „Speise“, schrieb Paulus, „wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten, essen wir, so werden wir darum nicht besser sein.“ (1. Korintherbrief 8, 8). „Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.“ (Römerbrief 14, 17). Es hatte einen Konflikt zwischen Petrus und Paulus gegeben, weil Petrus an einem gemeinsamen Tisch mit Heidenchristen gegessen hatte, aber als konservative Judenchristen nach Antiochia kamen, „zog er sich zurück und sonderte sich ab“ (Galaterbrief 2, 12) Wie gehabt wird aus Nahrungsunterschieden eine Art kulinarischer Kultur; sie bringen Unterschiede zwischen Völkern und Religionen zum Ausdruck und verstärken sie.
Das ist nirgends deutlicher zu sehen als in der Vision des Petrus, die in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, beschrieben wird. Kornelius, ein Mann eines anderen Volkes und einer anderen Religion, hatte eine Vision gehabt, in der er beauftragt wurde, Petrus herbeizurufen, um sich von ihm Rat erteilen zu lassen. Während die Boten kamen, betete Petrus. Seine Gebete wurden unterbrochen durch seinen Hunger. Das Verlangen nach Nahrung, das seine Spiritualität störte, führte ihn rasch zu einer Wiedergeburt der Spiritualität. Er „geriet in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels.“ (Apostelgeschichte 10, 10ff.) Das Tuch war in der Tat voll von abscheulichem Mischmasch, durch den die Glaubensreinheit des Petrus verwässert zu werden drohte; Dinge, die sorgfältig voneinander getrennt gehalten wurden, lagen hier wie etwas Gewöhnliches einfach nebeneinander, ein wahrer Rührschüssel-Angriff auf Gottes Gebote war im Begriff, in seinen Magen geschoben zu werden. Als die himmlische Stimme ihn aufforderte, diesen Eintopf zu essen, schreckte Petrus zurück wie ein moderner Abgeordneter vor einem Lehrplan mit multireligiösen Bildungsvereinbarungen und protestierte fromm: „O nein, Herr; denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen.“ (V. 14). Aber die Stimme sagte: „Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten.“
Von nun an konnte Heiligkeit nicht durch die Einhaltung, sondern durch die Überwindung von Unterschieden gefunden werden. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Missachtung der reinen und säuberlichen Trennung auf Jesus selbst zurückgeht. Die zweite Hälfte des zweiten Kapitels im Markusevangelium ist eine Sammlung einer Reihe von Sprüchen Jesu, die sich auf dieses Thema beziehen. Jeder Spruch ist eingebettet in einen kurzen erzählerischen Rahmen, und das ganze Material steht in einer Beziehung zum frühesten galiläischen Wirken Jesu. Er brach die Gesetze der Reinheit, indem er mit denen aß, die rituell unrein und sozial inakzeptabel waren (Markusevangelium 2, 15f.). Seine Jünger hielten nicht die üblichen Fastengebräuche ein (Markusevangelium 2, 18f.). Er riss die Grenzen nieder, die heilige Zeit von weltlicher Zeit trennten (Markusevangelium 2, 23ff.) In all dem war er sich vollkommen bewusst, dass er einen radikalen Bruch mit der Welt der alten heiligen Ordnungen eröffnete. Das brandneue Material konnte das alte Gewand nicht flicken. Der neue Wein hätte die alten Weinflaschen nur gesprengt (Markusevangelium 2, 21f.). Es ist gleichermaßen bemerkenswert, dass er die Grenzen der natürlichen Familie niederriss, indem er die Bluts- und Verwandtschaftsbande durch eine weltweite Gemeinschaft all derer ersetzte, die sich Gott zugehörig fühlten. „Wer ist meine Mutter und meine Brüder? … wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ (Markusevangelium 3, 33.35). Dazu passt, dass er eine Seligpreisung zurückweist, die sich auf die Quelle seiner Ernährung als Säugling bezog. „Eine Frau in der Menge erhob ihre Stimme und sagte zu ihm: ‚Selig ist der Leib, der dich gebar, und die Brüste, die dich gesäugt haben.‛ Er erwiderte: ‚Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren.‛“ (Lukasevangelium 11, 27ff.). Diese Zurückweisung der gefühlsmäßigen Überbetonung der Säuglingsnahrung weckt sowohl buchstäbliche als auch metaphorische Assoziationen, und es ist wieder höchst bedeutsam, dass die Nahrungsmetapher durch ein universales Prinzip ersetzt wird. Grenzen von Stamm, Nation, Volk bzw. Rasse werden prinzipiell zerschlagen (vgl. Lukasevangelium 4, 25-27).
Betrachten wir den Hintergrund von Petrus‛ Mischmaschtraum im Licht der Lehre und des Wirkens Jesu, ist am bedeutsamsten die Debatte über die Speisegebote, die im Markusevangelium, Kapitel 7, zu finden ist (vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 15). Jesus und seine Jünger wurden von denen, die darauf versessen waren, ein religiöses Einordnungssystem rein zu halten, für ihre Nachlässigkeit kritisiert. Umgekehrt bot Jesus eine neue Sicht religiöser Identität an, und zwar eine, die nicht bedroht ist durch Ansteckung oder Verunreinigung von außen, sondern die aufrechterhalten wird durch die Absichten des Herzens, indem diese das Zusammenleben der Menschen beeinflussen. „Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, und kommt heraus in die Grube.“ Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: „Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein; denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Mißgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein.“ (Markusevangelium 7, 18-23). Es ist interessant, dass Johannes der Täufer, der Heuschrecken aß, keinerlei Ekel vor irgendeinem Essen gehabt zu haben schien, und in der Matthäusversion des Spruches über das, was Verunreinigung bewirkt, bezieht sich Jesus besonders auf den Mund. „Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein.“ (Matthäusevangelium 15, 17-18). Es war diese radikale Missachtung von Grenzen, dieses Beiseitestellen göttlich gestifteter Unterscheidungen, aus der das neue Menschsein, die kirchliche Gemeinschaft, sich entwickelte.
Um das im Zusammenhang unserer gegenwärtigen Erörterung besser zu verstehen, müssen wir zu Mary Douglas zurückkehren. Was fehl am Platz ist, kann das System der Reinheit durchkreuzen und daher als Schmutz betrachtet werden. Was fehl am Platz ist, kann aber auch vorherrschende Auffassungen herausfordern und auf diese Weise eine Quelle von Erneuerung und Umgestaltung sein. Wenn die Dinge sich aus ihren eingeschränkten Orten herausbewegen, mag es eine beseligende Vereinigung von Gegensätzen geben, eine Überwindung der alten Widersprüche in einer neuen Ordnung. Diese beiden Tendenzen finden sich in der Religion: die Tendenz zu trennen und die Tendenz zu vereinigen (Douglas, ebd., Kapitel 10). Salz ist schmutzig, wenn es auf den Fußboden oder über die Kleidung verschüttet wird, aber wenn es beim Kochen klug verwendet wird, erhält das Essen die nötige Würze. Jack Goody bemerkt: „Da Unterschiede in der Kochkunst parallel zu Klassenunterschieden verlaufen, tendieren egalitäre und revolutionäre Regierungsformen dazu, wenigstens in den anfänglichen Phasen, die Trennung zwischen der gehobenen und der gewöhnlichen Küche abzuschaffen.“ (Goody, ebd., Seite 147). Es ist daher bedeutungsvoll, dass sich die frühe christliche Bewegung auf ein gemeinsames Mahl als Symbol für das neue Königreich, das neue Menschsein, konzentrierte. Dieses neue Volk hat „den neuen Menschen (42) angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nichtgrieche, Skythe, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus.“ (Kolosserbrief 3, 10-11).
Dagegen könnte eingewendet werden, dass der Zusammenhang unserer gegenwärtigen Erörterung ein Vorschlag ist, Schulkinder in verschiedene Religionsgruppen aufzuteilen und innerhalb von Lehrplänen für den Religionsunterricht die Religionen voneinander zu trennen. Ist es auf Grund der neutestamentlichen Lehre vom neuen Menschsein gerechtfertigt, Unterschiede zwischen Religionen zu missachten? Hier ist nicht der Platz, um in eine ausführliche Diskussion einer christlichen Theologie einzutreten, die auf die Weltreligionen zugeht, aber es sei nebenbei bemerkt, dass in der Theologie des Paulus vom neuen Volk religiöse Unterschiede klar überwunden wurden. Die Beschneidung war das grundlegende Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Die Unterscheidung zwischen Jüdisch und Griechisch war nicht nur eine kulturelle, sondern ganz offensichtlich eine religiöse Unterscheidung. Heute besteht tatsächlich die Gefahr, dass Christen, die ihre Identität auf Grund unreifer Vorstellungen vom christlichen Glauben als bedroht empfinden, sich selbst als eine Art neuen Volksstamm betrachten, der unterschieden werden muss von anderen Stämmen, anderen religiösen Weltkulturen, genau wie einige der Juden im ersten Jahrhundert zwischen sich und den Heiden unterschieden.
Die ganze Bibel hindurch gibt es einen Kampf zwischen Israel für die Israeliten und Israel als einem Licht, um die Heiden zu erleuchten, zwischen Gott als dem Herrn von Israel und Gott als dem Herrn aller Völker. Genau so ist es mit dem Christentum: es kann sich als eigenständigen Volksstamm verstehen (Option der Tribalisierung), wobei die religiöse Unterscheidung betont wird, und es kann sich als weltoffen verstehen (Option der Universalisierung), wobei das Reich Gottes betont wird. Was Jesus begründet hat, war nicht eine neue Religion, sondern ein neues Menschsein. Diese Einsicht ist eine Inspiration für die Beschreibung der neuen kirchlichen Gemeinschaft, in der die alten ethnischen und religiösen Unterscheidungen niedergerissen worden sind. „Denn Er ist unser Friede, der aus beiden [d. h. aus Juden und Heiden] eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe…“ (Epheserbrief 2, 14f.). Dieses Prinzip rührt nicht nur vom gemeinsamen Abendmahl her, sondern ebenfalls von der gemeinsamen Taufe. „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ (Galaterbrief 3, 27f.). Die abschließende Wendung „allesamt einer in Christus Jesus“ sollte nicht im Sinne einer absolutsetzenden Identität, durch Ausschluss, sondern lieber durch Einschließung, im Sinne einer Identität der Ganzheit, verstanden werden. Verdeutlicht wird das durch die unmittelbar folgenden Worte. „Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.“ (Galaterbrief 3, 29). Heißt das, dass alle Christen nun in die physische Abstammung Abrahams einbezogen (tribalisiert) worden, also wörtlich genommen Juden sind? Vielmehr benutzt Paulus den Ausdruck „Abrahams Kinder“ in übertragenem oder geistlichem Sinne, da sowohl Christen als auch Juden „nach der Verheißung Erben“ sind. Die Verheißung ist die universale Verheißung für alle Menschen. Wir sehen also, dass das neue Menschsein in Christus Jesus nach dem Metaphorischen und Spirituellen in allen Buchstaben religiöser Traditionen Ausschau hält und sich nicht von den Unterscheidungen zwischen Christentum und Judentum vereinnahmen lässt. Ich sage nicht, dass eine Diskussion dieser gegenwärtigen Unterscheidungen kein legitimer Teil eines gegenwärtigen interreligiösen Dialogs ist. Ich behaupte jedoch, dass die biblische Vision die Betrachtung sowohl von Israel als auch der Christenheit als Volksstämmen (43) oder ideologischen Blöcken übersteigt und auf eine neue weltweite Gemeinschaft hindeutet. Diese Einsicht ist sowohl in der Tora und den Propheten als auch im Neuen Testament zu finden.
Wir können diesen Teil unserer Erörterung beenden, indem wir uns an die Worte des Heiligen Paulus an die Christen in Kolossä erinnern. Zum Abschluss seiner Diskussion über über das neue Menschsein sagt er: „So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank … Wenn ihr mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt: ‚Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren?‛ Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die nur einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen…“ (Kolosserbrief 2, 16-23). Tausende von Lehrern, Eltern, Schulräten, Pfarrern und Priestern, die für das neue Menschsein eingetreten sind, indem sie Verständnis zwischen religiösen Gemeinschaften aufgebaut und durch Erziehung Bande der Liebe ermöglicht haben, aber durch die Mischmasch- und Eintopf-Vorwürfe in Unruhe versetzt worden sind, sollten aus diesen Worten Trost schöpfen.
Abschließend wollen wir einen christlichen Ansatz für den Religionsunterricht im heutigen Großbritannien erörtern. Wir können unterscheiden zwischen einem absolut christlichen Ansatz und einem ganzheitlich christlichen Ansatz. Der absolut christliche Ansatz begünstigt, was ich anderswo als „ideologische Einfriedung“ bezeichnet habe… (Hull, 1985, Kapitel 1; Hull, 1990). Er blendet aus dem Bildungsplan und wenn möglich aus der gesamten sozialen Welt des Kindes alles aus, was ausdrücklich von der christlichen Religion verschieden ist. In Lehrpläne gegossen, wird der absolutsetzende Ansatz in unseren öffentlichen Schulen neben andere absolutsetzende Ansätze anderer Religionen gestellt werden. Es gibt zweifellos einen absolut muslimischen Unterricht und einen absolut jüdischen Unterricht, die einem absolut christlichen Unterricht entsprechen. Das merkwürdige Paradox bei diesem Ansatz ist, dass es beim Nebeneinanderstellen mehrerer Absolutheiten im selben Lehrplan (was offensichtlich in öffentlichen Schulen mit einer beträchtlichen Anzahl von Schülern verschiedener Religionen der Fall sein dürfte) unmöglich ist, sich nicht zu fragen, welche der Religionen denn nun wirklich den Anforderungen der Absolutheit genügt. Das liegt daran, dass der absolutsetzende Ansatz, wenngleich er entlang paralleler und eigenständiger Linien zu verlaufen scheint, in seinem Wesen einem Wettbewerb entspricht. Es ist letztlich ein Vermarktungsansatz. Die verschiedenen Markenzeichen müssen aus Image- und Loyalitätsgründen einzigartig und getrennt bleiben, und keine Verunreinigung mit anderen Markenzeichen darf das beeinträchtigen. Genau dieser Vorgang verdeutlicht es jedoch im Übermaß, dass auf dem Markt unterschiedliche Markenzeichen existieren. Die Getrenntheit und Besonderheit legen eine Beziehung nahe, die gerade wegen der Weigerung, in einen Dialog einzutreten, notwendigerweise zu einem Konkurrenzkampf führen muss. Wie in der Apartheidspolitik Südafrikas, so auch beim absolutsetzenden Ansatz für den britischen Lehrplan im Religionsunterricht: werden Gemeinschaften rigide voneinander getrennt, kommt es letztendlich dazu, dass sie einander auffressen.
Da der absolutsetzende Ansatz das Konzept einer in sich abgeschlossenen und absolut umfassenden Religion entwirft, getrennt von anderen Religionen, die einen ähnlichen Status haben (warum sollte man sie sonst voneinander trennen?), ist er relativistisch gerade in seinem Versuch, sich absolut zu setzen. Es gehört zur gesunden Ökologie des menschlichen Geistes, dass getrennte Dinge in ihrer Getrenntheit vergleichbar werden, während eingegliederte Dinge eine harmonische Einzigartigkeit hervorbringen. Unverbundene Größen bestehen darauf, sich zu verknüpfen. Das Verdrängte wird zurückkehren. Um das zu verhindern, muss die absolutsetzende Persönlichkeit mehr und mehr Energie investieren, um die Mauern der Trennung aufrechtzuerhalten. Mehr und mehr gesetzliche Festlegungen, genaue und immer genauere Inspektionen, und schon wird aus dem absolutsetzenden (44) Ansatz ein totalitärer. Einmal mehr haben wir das merkwürdige Paradox, dass es in totalitären Welten letztlich keine Rolle spielt, wer an der Spitze steht oder welche Anschauungen vertreten werden. Der absolutsetzende Prozess verselbständigt sich. Die Bedürfnisse der Persönlichkeit richten sich auf die Absolutheit an sich. Es wird gleichgültig, um welche Absolutheit herum die Persönlichkeit absolut gesetzt wird (Arendt, 1967, Seite 407ff.). Die absolutsetzende Ansatz christlicher Erziehung neigt dazu, eine Art christlichen Henotheismus hervorzubringen, da absolute Loyalität dargebracht wird, ohne anderen Loyalitäten die innere Wertigkeit und Wirklichkeit abzusprechen. Das Wort wird benutzt, um religiöse Systeme wie das im Volk Israel vor dem achten Jahrhundert v. Chr. zu beschreiben. Israel hatte seinen Gott, und ebenso hatten die anderen Völker der Erde ihren Gott. Henotheismus ist eine Art von absolutem Parallelismus, und er ist dem Untergang geweiht aus genau dem Grund, den ich nahegelegt habe, nämlich dem impliziten Relativismus der Religion, den diese Tribalisierung mit sich bringt.
Es ist symptomatisch für diese Situation, dass diejenigen, die die Sprache des ekelhaften Essens verwenden, normalerweise voller Respekt gegenüber den religiösen Ansichten anderer sind. Die Parlamentsdebatten sind übersät mit Forderungen, dass der Religionsunterricht Toleranz und Verständnis fördern sollte. Wenn wir fragen, wie das gemacht werden soll, ohne dass die Schüler etwas Fachwissen und einen gewissen Einblick in die tatsächlichen religiösen Glaubensvorstellungen anderer gewinnen, erhält man keine sehr klare Antwort. Ersichtlich wird jedoch, dass die jeder großen religiösen Tradition innewohnenden Qualitäten, unter denen Liebe und Respekt hervorgehoben werden, das automatisch bewerkstelligen sollen. Das ist in Frage zu stellen. Es ist überhaupt nicht klar, dass Gesellschaften, die durch religiöse Trennung geprägt sind, insbesondere was den schulischen Lehrplan betrifft, Haltungen von Toleranz und Verständnis füreinander entwickelt hätten. Die Wahrheit ist, dass in eine Reihe von Religionen theologische Abwehrmaßnahmen gegeneinander eingebaut sind. Um seine Identität in der Trennung vom Judentum zu erringen, musste das Christentum eine absolutsetzende Phase durchlaufen. Wir erinnern uns an Erikson, der betont: In der Entwicklung von Identität können Perioden der Absolutsetzung und Perioden der Ganzheit einander abwechseln. Die ersten Christen fanden es notwendig, sich polemisch gegen das Judentum zu wenden, um zu bekräftigen, warum sie keine Juden waren. Jeder, der das Johannesevangelium mit seinen abfälligen Bemerkungen über die Juden liest, wird das bemerken. In einigermaßen ähnlicher Weise musste sich der Islam vom Christentum abgrenzen, und eine Polemik gegen sowohl das Christentum als auch das Judentum ist in sein Selbstverständnis eingebaut. Es ist sicher möglich, religiöse Traditionen auf intolerante und ausschließende Arten und Weisen zu interpretieren, aber in einer Gesellschaft wie unserer, in der die Erzeugung von Toleranz und Verständnis als ein wichtiges soziales Ziel eingestuft werden muss, scheint es nicht weise zu sein, dieses Risiko einzugehen.
Während der Ansatz, den wir als absolutsetzend beschrieben haben, wesentlich auf der Erfahrung des Christentums als einer absoluten Religion neben anderen absoluten Religionen basiert, würde der Ansatz eines ganzheitlich christlichen Bildungsplans nicht dem Christentum als einer der Weltreligionen entspringen, sondern der Lehre Jesu vom Reich Gottes und der Lehre des Paulus vom neuen Menschsein. Die gegenwärtigen religiösen Traditionen in ihrer vorfindlichen konkreten Form werden sehr ernst genommen, da sie Teil der Geschichte sind, die die Welt prägt. Sie müssen in der vollen Schönheit ihrer Heiligkeit betrachtet werden, ohne Oberflächlichkeit und ohne gehässige Vergleiche, aber auch ohne Furcht vor Ansteckung. Kinder mit ihrem jeweiligen Glauben werden Seite an Seite leben und lernen. Loyalität gegenüber dem eigenen Glauben ist nicht unvereinbar mit einem verständnisvollen Einblick in den Glauben anderer, und das ist für Kinder so wahr wie für Erwachsene. Und auf diese Weise kann der Religionsunterricht seine Rolle beim Aufbau einer neuen Erde spielen.
↑ Hintergrundlektüre
Alves, Rubem A.: Protestantism and Repression. A Brazilian Case Study, London, SCM Press, 1985.
Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism, London, George Allen and Unwin, revised edition 1967 (Erstveröffentlichung 1951).
Douglas, Mary: Purity and Danger. An analysis of concepts of pollution and taboo, London, Routledge and Kegan Paul, 1966.
Erikson, Erik H.: Young Man Luther, New York, W. W. Norton, 1958,
Erikson, Erik H.: Identity, Youth and Crisis, New York, W. W. Norton, 1968
Erikson, Erik H.: Life, History and the Historical Moment, New York, W. W. Norton, 1975.
Gates, Brian: The National Curriculum and Values in Education: Hockerill Lecture, 1989 Hockerill Educational Foundation.
Goody, Jack: Cooking, Cuisine and Class. A study in comparative sociology, Cambridge University Press, 1982.
Hull, John M.: What Prevents Christian Adults from Learning, London, SCM Press, 1985, American Edition: Philadelphic.
Hull, John M.: „‛Mish-Mash‛: Religious Education and Pluralism“, British Journal of Religous Education Band 12, No. 3, Sommer 1990, Seite 121-125 (Editorial).
Hull, John M.: „Religious Education in the State Schools of Late Capitalist Society“, British Joumal of Educational Studies, Band 38 No. 4, November 1990, Seite 335-348.
Metz, Johann Baptist: The Emergent Church, the future of Christianity in a postbourgeois world, London, SCM Press, 1981.
Mol, Hans (Hrsg.): Identity and Religion. International, Cross-cultural Approaches, London, Sage Publications, 1978.
Nemeroff, Carol & Rozin, Paul: „Sympathetic magic in kosher practice and belief at the limits of the laws of kashrut“, Jewish Folklore and Ethnology Review, Band 94, No. 1, 1987, Seite 31-32.
Rozin, Paul: „Cultural Approaches to Human Food Preferences‛“, in John E. Morley et al. (Hrsg.): Nutritional Modulation of Neural Function (UCLA Forum on Medical Sciences), Academic Press, 1988, Seite 137-153.
Rozin, Paul & Fallon, April E.: „A Perspective on Disgust‛“, Psychological Review, Band 94, No. 1, 1987, Seite 23-41.
Rozin, Paul, Hammer, Larry, Oster, Harriet, Horowitz, Talia & Marmora, Veronica: „The Child‛s Conception of Food: differentiation of categories of rejected substances in the 16 month to 5 year age range“, Appetite 7, 1986, Seite 141-151.
Rozin, Paul, Fallon, April & Augustoni-Ziskand, Marylynn: „The Child‛s Conception of Food: the development of categories of accepted and rejected substances“, Journal of Nutrition Education, Band 18, No. 2, 1986, Seite 75-81.
Rozin, Paul, Millman, Linda and Nemeroff, Carol: „Operation of the Laws of Sympathetic Magic in disgust and other domains“, Journal of Personality and Social Psychology, Band 50, No. 4, 1986, Seite 703-712.
Searle, Chris: „From Forster to Baker: the new Victorianism and the struggle for education“, Race and Class, Band 30, No. 4, April/June 1989
Searle, Chris: Your Daily Dose: Racism and the Sun, Campaign for Press and Broadcasting Freedom, 1989.
Soler, Jean: „The Semiotics of Food in the Bible“, in Robert Forster and Orest Ranum (Hrsg.): Food and Drink in History, London, Johns Hopkins University Press, 1979.
↑ Weitere Schriften von John M. Hull über die Auswirkungen des Bildungsreformgesetzes von 1988 auf den Religionsunterricht
The Act Unpacked – The Meaning of the 1988 Education Reform Act for Religious Education, CEM 1989.
„Religion and the Education Reform Bill“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 10, Sommer 1988, Seite 119-121.
„Religion in the Education Reform Bill“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 11, Herbst 1988, Seite 1-3.
„The Content of Religious Education and the 1988 Education Reform Act“ (editorial) British Joumal of Religious Education, Band 11, Frühling 1988, Seite 59-61, 91.
„School Worship and the 1988 Education Reform Act“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 11, Sommer 1989, Seite 119-125.
„Agreed Syllabuses since the 1988 Education Reform Act“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 12, Herbst 1989, Seite 1-5.
„Religious Worship and School Worship“ (editorial), British Joumal of Religious Education, Band 12, Frühling 1990, Seite 63-67.
„Religious Education after the 1988 Education Reform Act“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 13, Sommer 1991, Seite 133-135.
„Religious Education and Christian Values in the 1988 Education Reform Act“, Ecclesiastical Law Journal, Band 7 No. 2, Juli 1990, Seite 63-81.
„Should Agreed Syllabuses be mainly Christian?“ (editorial), British Journal of Religious Education, Band 14, Herbst 1991, Seite 1-3, 65.
Agreed Syllabus Reform in Birmingham (CREDAR Lecture Series No. 3), School of Education, University of Birmingham, 1991.
„Agreed Syllabuses and the Law‛ Resource, Professional Council for Religious Education, Band 14, Herbst 1991, Seite 1-3.
↑ Anmerkungen
Die Anmerkungen stammen komplett von mir, Helmut Schütz, als dem deutschen Übersetzer.
(1) Beispielhaft fasst Eva Hoffmann die Haltung des evangelischen Religionspädagogen Frieder Harz zu diesem Thema zusammen: „Religiöse Erziehung ist für Harz mehr als Religionskunde. Sie ermögliche Sinnstiftung und Weltdeutung, eröffne den Zugang zu Kraftquellen bzw. zu dem Gefühl, in der Welt geborgen zu sein, und leite zu Widerständigkeit und Kritikfähigkeit an“. Das Zitat stammt aus: Eva Hoffmann, Interreligiöses Lernen im Kindergarten? Eine empirische Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt in Diskussionen mit Kindern zum Thema Tod, Berlin 2009, S. 77, unter Bezug auf Frieder Harz, Ist Allah auch der liebe Gott? Interreligiöse Erziehung in der Kindertagesstätte, München 2001, S. 31.
(2) Frieder Harz, Interkulturelles und interreligiöses Lernen in Kindertagesstätten, S. 99. In: Mein Gott – Dein Gott. Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kindertagesstätten. Herausgegeben von Friedrich Schweitzer, Albert Biesinger und Anke Edelbrock, Weinheim und Basel 2008, S. 95-105.
(3) Vor einer „unbewussten und ungewollten Religionsvermischung“ im Zusammenhang mit interreligiösen Gebeten warnt Andreas Renz, S. 370. „Es versteht sich von selbst, dass ein gemeinsames Gebet von Christen und Muslimen oder anderen Gläubigen so gestaltet werden muss, dass jegliche Form von Synkretismus oder auch nur der Anschein eines solchen vermieden werden muss.“ Das Zitat stammt aus: Andreas Renz, Gemeinsames Beten von Christen und Muslimen: Theologische Differenzierungen und praktische Hinweise. In: Andreas Renz, Stephan Leimgruber (Hg.), Lernprozess Christen Muslime. Gesellschaftliche Kontexte – Theologische Grundlagen – Begegnungsfelder, Münster 2002, S. 369-374.
(4) Die Ergebnisse dieses Studienurlaubs sind zusammengefasst in: Helmut Schütz, Geschichten teilen im multireligiösen Kindergarten. Kindern von Gott erzählen nach biblisch-koranischen Traditionen als Baustein für eine Konzeption inklusiver Religions-Bildung.
(5) Dieser Artikel von Christa Dommel wurde zuerst veröffentlicht in: DIE BRÜCKE. Zeitschrift für Schule und Religionsunterricht im Land Bremen. Jg. 4 (1999), Heft 2. Die Religionswissenschaftlerin war 1999 drei Monate lang für das interreligiöse Netzwerk in Birmingham, den 1974 gegründeten Birmingham Council of Faiths tätig.
(6) John M. Hull (1991): Mishmash. Religious Education in Multi-Cultural Britain. A Study in Metaphor. John M. Hull ist Professor für Religious Education an der Universität Birmingham. Der Titel greift die polemische Bildersprache der Gegner des multireligiösen Religionsunterrichts auf und untersucht die in der Debatte häufig gebrauchten Essens-Metaphern („Eintopf“, „Einheitssoße“, „Cocktail“) und ihre emotionalen und kulturellen Hintergründe.
(7) Ebd., S. 9.
(8) Michael Grimmitt (1982): What Can I Do in R.E.? A Guide to New Approaches.
(9) J. M. Sutcliffe (1984): A Dictionary of Religious Education, S. 154.
(10) Robert Jackson and Eleanor Nesbitt (1993), Hindu Children in Britain. Zit. n. Hull (1998).
(11) J. M. Hull (1998): Religious Education and Muslims in England: Developments and Principles. In: Muslim Quarterly, Vol. 15, No. 4, 1998, p. 18.
(12) Erhältlich bei: The Interfaith Education Centre, Children’s Services, Future House, Bolling Road, Bradford BD4 7EB, 0044 – 1274 378405, Email: Interfaith Education Centre.
(13) „Religious Education“ übersetze ich mit „Religionsunterricht“, obwohl im englischen Begriff auch etwas von dem mitschwingt, was mit den deutschen Begriffen „religiöse Erziehung“ oder „Religions-Bildung“ gemeint ist. Für den letzteren Begriff plädiert Christa Dommel mit guten Gründen in ihrer Dissertation „Religions-Bildung im Kindergarten in Deutschland und England. Vergleichende Bildungsforschung für frühkindliche Pädagogik aus religionswissenschaftlicher Perspektive“, Frankfurt am Main und London 2007. Diese und alle folgenden Anmerkungen stammen vom Übersetzer.
(14) Vgl. den zweiten Teil des Literaturverzeichnisses: „Weitere Schriften von John M. Hull“.
(15) Originaltitel: „The man betraying Thatcher’s children“.
(16) Originaltitel: „The history of religion is a perfectly valid subject … but is nothing to do with worship“. Die Begriffe „Religionskunde“ und „religiöse Unterweisung“ treffen den Sinn der englischen Gegenüberstellung von „history of religion“ und „worship“ im Original nur annähernd. Während deutsche Religionspädagogen die grundgesetzlich garantierte Stellung des kirchlich verantworteten Religionsunterrichts in der Schule gegenüber einer reinen Religionskunde verteidigen, bezieht sich der englische Begriff „worship“ auf die gottesdienstlichen Feiern in der Schule, die über den Religionsunterricht hinaus für alle Schüler gemeinsam angeboten werden.
(17) Originaltitel: „Parents press for multi-faith ruling“.
(18) Wörtlich übersetzt: „Dinge in die Kehle hineinschieben“, noch wörtlicher: „in den Rachen hinunterwerfen“.
(19) Wieder wörtlich: „in die Kehlen hinunterschieben“.
(20) Im Original steht hier der Begriff „hotchpotch“ = Eintopfgericht, Durcheinander, Mischmasch, Sammelsurium.
(21) Ein hinduistisches Fest zu Ehren der Göttin Lakshmi.
(22) Im Original steht hier das Wort „racial“. Die englischen Wörter „races“ und „racial“ haben eine weiter gefasste Bedeutung als die deutschen Entsprechungen „Rassen“ und „rassisch“. Gemeint ist eher das, was wir in Deutschland neuerdings „ethnisch“ nennen oder mit dem Begriff des Migrationshintergrundes andeuten. Der englische Begriff „race“ lässt deutlicher als die deutschen Entsprechungen das Problem eines natürlich verstandenen oder kulturellen Rassismus anklingen.
(23) Das englische Wort „chairperson“ lässt nicht das Geschlecht dieser Person erkennen.
(24) Originaltitel: „RE and sympathy“.
(25) Wörtlich: Bezirksschulen, Landkreisschulen („County schools“).
(26) Im Original: „maintained schools“.
(27) Im Original: „voluntary aided school“.
(28) Im Original: „predominantly Christian“.
(29) Im Original: „in the main“.
(30) Im Original: „Standing advisory committee on religious instruction“, abgekürzt: SACRE.
(31) Im Original: „agreed syllabus conferences“.
(32) Die Gesamtheit der jüdischen Speisegesetze.
(33) Im Original: “McGregor kicks out ‘liberal’ exam experts”.
(34) Das englische Wort „to beef up“ mit seinem Bezug auf das englische Rindfleisch ist nicht wörtlich ins Deutsche übersetzbar.
(35) National Curriculum Council and School Examination and Assessment Council.
(36) Wörtlich: “Eyetie”, die Kurzform für das bewusst falsch ausgesprochene und beleidigende englische Wort für Italiener: “Eye-Talian” statt “Italian”.
(37) Im Original: “The Sun on Britain”.
(38) Mit „absolutsetzend“ übersetze ich das von Hull verwendete englische Wort „totalising“ von „to totalise“, das es so wörtlich im Deutschen nicht gibt.
(39) Wenn nicht anders angegeben, sind Bibelzitate nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984, Stuttgart 1985, wiedergegeben.
(40) Hull verweist hier nicht auf die Herkunft dieses Zitats: 5. Buch Mose 23, 3.
(41) Übersetzt nach der alten englischen Bibelübersetzung, die Hull hier verwendet.
(42) Die englische Übersetzung, auf die Hull zurückgreift, ergänzt nicht wie Luther unter Rückgriff auf den vorigen Vers das hier fehlende Wort „Mensch“, sondern verwendet das Wort „nature“.
(43) Ich übersetze hier die Formulierung „tribes or races“ pauschal mit „Volksstämme“, weil das Wort „races“ hier weder mit der Übersetzung „Rassen“ noch „Ethnien“ oder „Völker“ richtig wiedergegeben wäre. Vgl. Anm. 22.
(44) Hier geht mit der Übersetzung von „total“ mit „absolut“ das Wortspiel im Gegenüber zu „totalitarian“ verloren.