Da die Bibel Gottes Wort in der Verpackung menschlicher Worte ist und kein historisches oder naturwissenschaftliches Fachbuch, enthält sie auch Irrtümer und Widersprüche. Das Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer. Von A wie Auferstehung Christi bis Z wie Zeugen Jehovas“ von Walter-Jörg Langbein (2006 Berlin) versucht, theologische Laien darüber aufzuklären. Allerdings unterlaufen auch ihm dabei immer wieder Irrtümer und Fehleinschätzungen.

Inhaltsverzeichnis
Verschiedene Überlieferungen über Abschaloms Kinder
Gendergerechte Bibelverfälschung?
War bereits Martin Luther ein Fälscher der Bibel?
Verfolgte Jahwe nur seinen Rivalen Baal, nicht seine Geliebte Ascherah?
Darf Gott einen verletzlichen Augapfel haben?
Wozu wurde die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt?
JHWH und Baal – Befreiergott gegen Besitzergott
Wozu diente der Bann – der Massenmord im Namen Gottes?
Ist die Mordgeschichte von Kain und Abel lächerlich?
Waren die Cherubim wirklich keine Engel?
Steht und fällt der biblische Glaube mit der historischen Wahrheit der Bibel?
War David weder mächtig noch fromm?
Hat die christliche Erbsündenlehre etwas mit Sippenhaft zu tun?
Nicht unbedingt ein Rechenfehler im Buch Esra
Wurde Empfängnisverhütung mit dem Tode bestraft?
Vom biblischen Geisterzauber zur Hexenjagd
Hat wirklich niemand Gott je gesehen?
Wer tötete den Riesen Goliath – David oder Elhanan?
Wie sich die Vorstellungen von Hölle und Himmel verwandelten
Wie steht die Bibel zur Homosexualität?
Gibt es Indizien für homosexuelle Neigungen Jesu?
„Hosianna in der Höhe“ oder „Befreie uns von den Römern“?
Wie alt ist das Volk Israel – was bedeutet der Name?
Wurden Jerichos Mauern mit dem Schall von Posaunen zum Einsturz gebracht?
Das Buch Josua – Propaganda für die Tora Gottes
Lag das Gelobte Land in Südarabien?
Jakobs Familiengeschichte – romanhaft ausgestaltet
Warum besteht die Bibel aus zwei „Testamenten“?
Beruht der biblische Kanon auf reinem Zufall?
Falsche Fakten über biblische Könige
Wann wurde Lilith zu Adams Frau?
Auszug aus Ägypten – ein unmögliches Märchen?
Verbietet Gott Menschenopfer oder fordert er sie sogar?
Michal: Fünffache Mutter ohne Kinder?
Herrschte in Israel schon immer der Monotheismus?
Ist in der Bibel Mord im Auftrag Gottes in Ordnung?
Wer schrieb die fünf Bücher Mose – wenn nicht Mose?
Die Noah-Story – Plagiat des Gilgamesch-Epos?
War Onan ein Sünder oder ein biblisches Justizopfer?
Gab es die Orgel schon zur Zeit der Bibel?
Sahen Propheten niemals in die Zukunft?
Die Vierquellenhypothese ist längst überholt
Die Rippe – Symbol der Gleichberechtigung!
Schriften im Geist der Weisheit Salomos
Nur Irrtümer in den Schöpfungsberichten?
Wie alt wurde Abrahams Vater Terach – 145 oder 205?
Von Gottes Chefankläger zum teuflischen Lucifer
„Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
Turm zu Babel – altes Material für neuen Glauben
Kann man sterbliche Seelen nach dem Tod berühren?
Kannte die Bibel das sich ausdehnende Universum?
Vegetarismus – Schächtung – Ausländerfeindlichkeit
Symbolhafte Erzählungen und lebensrettende Wale
Die Erde – eine Kugel voll Magma über dem Nichts
Das Buch Ester – ein „Kuckucksei“ aus dem Mittelalter?
Von den Tücken kabbalistischer Zahlenmystik
Zahlenirrtümer oder symbolische Zahlen?
Chronik und Könige – warum so verschieden?
Ist die ganze Bibel wortwörtlich von Gott eingegeben?
Propheten sahen in die Zukunft – aber wie?
Wie wird der Gottesname JHWH ausgesprochen?
Auferstehungserfahrungen in einer großen Vielfalt
War in Bethlehem ein heidnisches Heiligtum?
Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova?
Die Dreieinigkeit ist keine Dreigötterlehre!
Widersprüchliches zu Jesus und dem Thema Ehe
Lässt sich Gott mit seinem Volk erlösen?
Bileams sprechende Eselin und Jesu Ritt auf zwei Eseln
Rudolf Bultmann verbot keine kritischen Fragen
Petrus: griechischer Fels oder aramäischer Steinblock?
Galiläa – Jesu Heimat oder Symbol für Rebellion?
Rief Jesus zum Hass auf? Drohte er Gewalt an?
Hat Jesus wirklich Wasser in Wein verwandelt?
Gab es die Kreuzesinschrift auch auf Aramäisch?
Israel starb im Bett, nicht auf seinen Stab gestützt
Hieß Jesu Mutter Maria und war sie eine Jungfrau?
Wurde ein revolutionärer Satz Jesu falsch übersetzt?
Ein Seil geht (nicht) durchs Nadelöhr
Kindermord von Bethlehem – in welche Welt wird Jesus hineingeboren?
Lanzenstich – Widerlegung oder Beweis für Jesu Scheintod?
Wurde das Wort „Maranatha“ wirklich falsch übersetzt?
Der Mensch Jesus wusste nicht, wann er wiederkommt
Jesus kann in dem Nest „Nazareth“ aufgewachsen sein
Kam Ostern von Ostara, der Osterhase vom Klippdachs?
Konnte nach Petri Verleugnung ein Hahn krähen?
Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund
War Paulus nie im syrischen Damaskus?
Wurde Jesus als Meister oder als Rabbi angeredet?
Jesu Leichnam – auf einem Scheiterhaufen verbrannt?
Waren die Evangelisten gegen die Essener von Qumran?
In den Stammbäumen Jesu stecken spannende Details
Jüngere Evangelien sollten nicht die älteren ersetzen
Jesus taufte nicht – aber war auch Johannes kein Täufer?
Tempelreinigung – historischer Anlass für Jesu Tod?
Homosexualität – eine Strafe, für die man bestraft wird?
Jesu Trostwort meinte kein infernalisches Paradies
Hat Jesus vor Gott seine Gottverlassenheit geklagt?
Welcher Versuchung widerstand Jesus als Sohn Gottes?
Verwerfung der Juden – dachte Paulus antisemitisch?
Weihnachten – eigentlich ein Fest des Mithraskultes?
Wie gelangten Ochs und Esel an die Weihnachtskrippe?
Warum ist die Wiedergeburt keine kirchliche Lehre?
Warum erzählt die Bibel eine Gespenstergeschichte?
Viele Facetten der Heilung eines Gelähmten
Wann wurde „Christus“ zum Nachnamen Jesu?
Myrrhe, Essig, Ysop: Erfüllte Prophetie der Psalmen
Schächer, Räuber oder zelotische Freiheitskämpfer?
Die Bibel ist ein Dokument des Glaubens
↑ Sehr geehrter Herr Langbein,
als evangelischer Pfarrer im Ruhestand habe ich Ihr im Jahr 2006 erschienenes Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer“ mit Interesse gelesen, da es auf leicht lesbare und auch humorvolle Weise in bibelkritische Sichtweisen einzuführen versucht, ohne das Kind des Glaubens an die Liebe Gottes und die Nächstenliebe mit dem Bade falscher Darstellungen und Widersprüchlichkeiten in der Bibel auszuschütten.
Alle Zitate in meiner Buchbesprechung, die nach einer bloßen Seitenzahl ohne weitere Quellenangabe aufgeführt werden, stammen aus Ihrem Buch, dabei sind längere Zitate blau hinterlegt. Wo Sie in Anmerkungen auf Bibelstellen verweisen, nehme ich den Stellenverweis in eckigen Klammern in das Zitat selbst mit hinein. Sonstige Bibelzitate habe ich meiner Gewohnheit entsprechend gelb hinterlegt, Zitate aus anderen Büchern haben weißen Hintergrund.
Ihre Einschätzung, dass die Bibel in erster Linie ein Glaubensbuch ist und (S. 334) „kein vordergründig historisches Nachschlagewerk über geschichtliche Ereignisse“, teile ich voll und ganz (S. 336):
„Wer leugnet, daß die Bibel Irrtümer enthält, der tut der Bibel keinen Dienst, im Gegenteil, sondern unterstützt falsches Entweder-oder-Denken: Entweder die Bibel ist fehlerfrei und wichtig für das Leben der Menschen, oder sie irrt und hat uns nichts mehr zu sagen.“
Sympathisch finde ich auch Ihre Einschätzung, dass nicht nur die Bibel von irrenden Menschen verfasst wurde, „die als Kinder ihrer Zeit oftmals anders dachten als der Mensch zu Beginn des dritten nachchristlichen Jahrtausends“, sondern dass auch moderne Menschen sich in manchem irren, was sie über die Bibel denken (S. 334f.):
„So wurde vor Jahrtausenden manche erstaunlich moderne Aussage getroffen, die modernen Übersetzern zum Opfer fiel: So gab es anscheinend vor Jahrtausenden schon verblüffend exakte Erkenntnisse über Erde und Weltall. So findet sich im ‚Alten Testament‘ auch manch wichtiger Hinweis auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.“
Insofern werden Sie es mir nicht verdenken, wenn ich mir erlaube, auch Sie auf Fehler und Irrtümer hinzuweisen, die Ihnen beim Aufspüren der Irrtümer anderer unterlaufen.
Folgende falsche, weil unzulässig verallgemeinerte Behauptung stellen Sie bereits im Vorwort auf (S. 9):
„Unsere heutigen Bibelausgaben sind keine Originaltexte. Es handelt sich vielmehr um Übersetzungen von Übersetzungen. Durch wiederholtes Übertragen von Texten von einer in die andere Sprache schlichen sich zahlreiche Irrtümer ein.“
Dass unsere heutigen Bibelausgaben keine Originaltexte sind, stimmt. Aber nicht, weil jede Übersetzung immer eine Übersetzung aus einem bereits in eine andere Sprache übersetzten Text ist. Auch das hat es zwar gegeben, zum Beispiel übersetzte Martin Luther das griechische Neue Testament mit Hilfe seiner Kenntnisse der lateinischen Vulgata. Aber bis heute ist es die Absicht jedes Bibelübersetzers, so nahe wie möglich an den Originaltext des jeweiligen biblischen Buches heranzukommen.
Das Problem ist allerdings, dass wir den tatsächlichen Originaltext eines biblischen Buches in keinem Fall besitzen. Es gibt immer nur Abschriften von Abschriften von Abschriften biblischer Bücher, bei denen genau geprüft werden muss, welche dieser oft unterschiedlichen Kopien wohl dem jeweiligen Originaltext am meisten entsprechen mag.
Natürlich können außerdem auch (S. 9) „kleine Übersetzungssünden zu gravierenden Mißverständnissen führen“, und Ihre Frage, ob „versehentliche Irrtümer oder bewußte Verfälschungen“ vorliegen, wird ein besonnener Wissenschaftler vermutlich anders beurteilen als jemand, der sich von Ressentiments gegenüber kirchlichen Institutionen leiten lässt oder zu Verschwörungstheorien neigt.
Im Großen und Ganzen begrüße ich allerdings Ihre Herangehensweise an die Frage, worauf die „biblischen Irrtümer“ beruhen mögen (S. 12):
„Die einzelnen Texte der Bibel wurden von Menschen geschrieben. Ihnen unterliefen Irrtümer. Die verschiedenen Texte wurden von Menschen zur Bibel zusammengefügt. Auch ihnen unterliefen Irrtümer. Die Bibel wurde von Menschen übersetzt. Und wiederum kam es zu Irrtümern. Die Bibel wurde und wird von Menschen interpretiert. Wieder gibt es Fehler.“
Das heißt also, dass Sie vor allem vier Urheber von Irrtümern in den Blick nehmen: die biblischen Autoren, die Hersteller des biblischen Zusammenhangs im je nach Konfession und Religion verschiedenen Kanon (= regelgerecht anerkannte biblische Bücher), die Übersetzer der Bibel und die jeweilige Leserschaft, die sich ihren eigenen Reim auf das Gelesene macht.
↑ Zum Alten Testament
↑ Verschiedene Überlieferungen über Abschaloms Kinder
Für (S. 13) A wie Abschalom stellen Sie zu Recht fest, dass über die Zahl seiner Kinder widersprüchliche Angaben gemacht werden. Die Verfasser der Samuelbücher griffen vermutlich auf unterschiedliche Überlieferungen zurück, deren Widersprüchlichkeit sie vielleicht übersahen oder bei denen sie nicht entscheiden wollten, welche der historischen Wahrheit entspricht.
↑ Gendergerechte Bibelverfälschung?
Zu (S. 14) A wie Ascherah werfen Sie zunächst modernen Bibelübersetzern „Verfälschungen“ des Bibeltextes vor. Der Bibeltext solle modernisiert, „unzeitgemäß gewordene Formulierungen … dem heutigen Zeitgeist angepaßt werden“. In die Bibel solle eine Gleichberechtigung von Mann und Frau hineinmogelt werden, die es zur Zeit der Bibel noch nicht gab. Sie beziehen sich dabei auf den „Zondervan-Verlag in Grand Rapids“ und die „Internationale Bibelgesellschaft in Colorado Springs“, die angeblich „erhebliche Korrekturen der Bibel“ planten, nämlich „sieben Prozent des alten Wortlauts“ zu ändern, könnten allerdings auch die später in Deutschland erschienene „Bibel in gerechter Sprache“ meinen, der ähnliche Vorwürfe gemacht wurden:
„Weil sich das menschliche Denken gewandelt hat, wird nun die Bibel der neuen Zeit angepaßt. Wo die Bibel nicht mehr zeitgemäß ist, wird sie durch Veränderungen (also Verfälschungen!) des Textes aktualisiert.“
Die Absicht derartiger Vorhaben zielt aber gar nicht darauf, die Bibel selbst zu ändern, sondern Sinnverfälschungen früherer Bibelübersetzungen zu überwinden. Das Problem, dass Übersetzungen Irrtümer in das Verständnis eines Textes hineinbringen können, hatten Sie ja selber im Vorwort angesprochen. Das heißt, wenn im Urtext Frauen (mit)gemeint waren, aber durch gängige Übersetzungen unsichtbar gemacht wurden, kann es ein berechtigtes Anliegen sein, diese Sinnverfälschung rückgängig zu machen. So heißt es in einem FAZ-Artikel vom 26.02.2002 zu den von Ihnen erwähnten Übersetzungsprojekten:
Wenn aus dem Kontext der aramäischen, hebräischen und griechischen Quellen hervorgehe, dass Männer und Frauen angesprochen werden, sei die weibliche Formulierung ergänzt oder ein neutraler Ausdruck gewählt worden: Statt „Männer“ heißt es etwa „einige“.
Gendergerechte Bibelübersetzungen mögen zwar über ihr selbstgesetztes Ziel hinausschießen und mehr in die Bibel zurückprojizieren, als wirklich drinsteht. Aber immerhin legen sie Rechenschaft über ihre Zielsetzungen ab, so dass man weiß, woran man ist.
Und was Sie beispielhaft über Brüder, Schwestern und Hirten schreiben, kann man auch anders sehen (S. 15):
„Ist im Original von ‚Brüdern‘ die Rede, ergänzten die modernen ‚Übersetzer‘ noch die ‚Schwestern‘.“ … Wird den Hirten auf dem Felde die Geburt Jesu verkündet, so erfinden die Bibelmodernisierer noch Hirtinnen dazu.
In den gängigen Bibelübersetzungen wird das griechische Wort adelphoi (1) in der Regel mit „Brüder“ übersetzt. Im Altgriechischen gibt es aber kein besonderes Wort für „Geschwister“, so dass mit dem Wort adelphoi, wenn nicht ausdrücklich von einer nur aus Männern bestehenden Versammlung oder Gemeinde die Rede ist, durchaus Männer und Frauen gemeinsam angesprochen sein können.
Ebenso ist das altgriechische Wort poimēn = „Hirte“ zwar ein Wort mit männlichem grammatikalischem Geschlecht, es kann aber ebenso für Schäferinnen gebraucht werden, die es jedenfalls im alten Israel ebenso gab wie männliche Schäfer (siehe z.B. 1. Mose 29,9). Weiter verweise ich zu den Hirtinnen in der „Bibel in gerechter Sprache“ auf ein „Kleines verwundertes Nachwort“ des Mitübersetzers Jürgen Ebach.
↑ War bereits Martin Luther ein Fälscher der Bibel?
In Ihren Augen ist weiterhin bereits der Urheber der berühmtesten evangelischen Bibelübersetzung ein (S. 16) „Fälscher“. Indem Sie zum eigentlichen Thema des Abschnitts „Ascherah: Rückkehr einer Göttin“ kommen, werfen Sie ihm vor (S. 15):
„Dem Reformator Martin Luther war eine mächtige Göttin ein Dorn im Auge: Ascherah. Durch falsche Übersetzungen ließ er ihren Namen aus den Texten des ‚Alten Testaments‘ verschwinden. So lesen wir bei Luther im Buch Richter: ‚Und zerbrich den Altar Baals und haue ab den Hain, der dabeisteht.“ [Richter 6,25f.] Von einem ‚Hain‘, also einem Wäldchen, ist im Original nichts zu finden. Falsch übersetzt Luther weiter: ‚Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Hains, den du abgehauen hast.‘ Es sind keine Bäume gefällt und verbrannt worden.“
Um Luther gerecht zu werden, sollten Sie aber nicht außer Acht lassen, dass an allen von Ihnen in diesem Zusammenhang zitierten Bibelstellen bereits die altgriechische Bibelübersetzung der Septuaginta und die lateinische Vulgata die Ascherah hatten verschwinden lassen. Bereits sie hatten HaˀAScheRaH (2) mit to alsos bzw. nemus oder lucus, also „heiliger Hain“, ins Griechische bzw. Lateinische übersetzt. Luther ist also jedenfalls nicht der ursprüngliche Urheber einer Fälschung, sondern schließt sich einer Falschübersetzung an, ähnlich wie es auch die englische „King James Version“ tut.
Dass in Revisionen dieser Bibelübersetzungen im 20. und 21. Jahrhundert diese Fehler korrigiert wurden, widerspricht übrigens Ihrer im Vorwort geäußerten Behauptung, dass Übersetzungen grundsätzlich immer die Übersetzungen von Übersetzungen seien, statt sich am Urtext zu orientieren.
↑ Verschonte Jahwe nur seinen Rivalen Baal, nicht seine Geliebte Ascherah?
Genau genommen passiert das, was Sie Luther vorwerfen, sogar schon im hebräischen Bibeltext selbst. Die in 1. Könige 18,19 erwähnten Propheten der Ascherah kommen im weiteren Verlauf des Kapitels nicht mehr vor. Der Prophet Elia setzt sich nur mit den Propheten Baals auseinander und vollstreckt in 1. Könige 18,40 auch nur an ihnen die Todesstrafe. Auch eine weitere in 2. Könige 10 erwähnte Vernichtungsaktion von König Jehu richtet sich nur gegen Propheten des Baal und nicht der Ascherah.
Daraus ziehen Sie (S. 17f.) im Anschluss an den Autor Raphael Patai (3) den Schluss, dass „die Verehrung der Ascherah als legitime religiöse Ausübung auch von denen angesehen wurde, die gegen den Baals-Kult waren“. Ja, Sie wollen aus der angeblichen schonenderen Beurteilung Ascherahs in den Bibeltexten, die wiederum angeblich von Martin Luther verschleiert worden sein soll, sogar eine pikante Liebesgeschichte des jüdischen Gottes Jahwe mit Ascherah konstruieren, der aus purer Eifersucht nur den Rivalen Baal blutig verfolgte, nicht aber die Göttin Ascherah, weil sie ja seine Geliebte war. So behaupten Sie unter Berufung auf ein Buch von Barbara Walker (4):
„‚Eine Zeitlang akzeptierte Aschera den semitischen Gott El als ihren Geliebten. Sie war die Himmelskuh, er der Stier.‘ El aber war einer der Beinamen Jahwes.“
Dazu sei angemerkt, dass „El“ nicht ein Beiname für JHWH ist, sondern der allgemeine hebräische Begriff für „Gott“ oder „Gottheit“. Umgekehrt wird das aus vier Buchstaben bestehende sogenannte Tetragramm JHWH im Sprachgebrauch der jüdischen Propheten zum Namen des Einen besonderen Gottes Israels, der die Anbetung aller anderen Götter ausschließt.
Sie allerdings verkünden lieber eine reißerische Geschichte, die einem bestimmten Publikumsgeschmack zusagen mag:
„Jetzt wird klar, wieso Baal als Rivale von Jahwe blutig verfolgt, Ascherah aber geduldet, ja lange Zeit im Tempel Salomos verehrt wurde: Weil Ascherah ursprünglich Jahwe-Els Geliebte und Partnerin war! So ist es nicht verwunderlich, daß Übersetzer wie Luther Ascherah aus den Texten des ‚Alten Testaments‘ verschwinden ließen.“
Was ist davon zu halten? Haben die biblischen Autoren tatsächlich aus solchen Erwägungen heraus Ascherah positiver beurteilt als Baal? Musste Luther deswegen den Ascherah-Kult schamhaft verschweigen bzw. verschleiern?
Womit Sie tatsächlich Recht haben und was Martin Luther noch nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass in der gesamten Periode der staatlichen Existenz Israels, sowohl im Nordreich Israel als auch im Südreich Juda, neben dem Nationalgott Jahwe oder Jahu auch andere Götter verehrt wurden. Und Ascherah wurde zumindest zeitweise auch als Ehefrau Jahwes verehrt. Jahwe war zu dieser Zeit also ein altorientalischer Gott wie jeder andere auch.
Erst um die Zeit des babylonischen Exils herum entwickeln die Propheten Israels den rein monotheistischen Glauben an den Einen Gott JHWH (ich verwende bewusst das Tetragramm, das für den Namen des Gottes steht, den man nicht beschwören, von dem man sich kein festes Bild machen darf, um es anzubeten, und dessen Namen die Juden nicht einmal aussprechen wollten, um ihn nicht zu missbrauchen). Dieser JHWH steht als Gott der Befreiung gegen alle anderen Götter, die als Inbegriff von Unterdrückung und Ausbeutung, Unrecht und Unzucht verstanden werden.
Ob es innerhalb der in Israel praktizierten altorientalischen Kulte Götter-Rivalitäten gab, weiß ich nicht. Das bleibt aber unerheblich, da die in der Bibel erwähnten Vernichtungsaktionen gegen Baal sowieso nichts mit einem Eifersuchtsdrama zwischen Jahwe, Aschera und Baal zu tun haben, sondern eben mit dem Befreiungskampf JHWHs gegen Unterdrücker- und Ausbeutungsgötter (5).
Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sich diese Kämpfe genau so, wie sie erzählt werden, zugetragen haben; vermutlich haben die späteren Propheten JHWHs ihre Verurteilung aller anderen Götter und Göttinnen als falsche Götzen, die keine Anbetung und Duldung verdienten, in die Geschichte Israels und Juda zurückprojiziert.
Das heißt, es hat wohl Erinnerungen an Protestbewegungen gegen Unterdrückerkönige und die ihre Herrschaft legitimierenden Götter und Göttinnen gegeben, die mit Propheten wie Elia und Elisa und Königen wie Jehu, Hiskia und Josia verbunden waren, und diese wurden von den späteren Propheten und den Autoren der Bibel im Sinne ihres reinen JHWH-Glaubens umgestaltet.
Dass mehrere beispielhafte Aktionen Elias und Jehus gegen Baal ausführlich geschildert werden, aber keine solchen gegen Ascherah, lässt jedenfalls nicht den Schluss zu, dass sie die Göttin Ascherah nicht abgelehnt hätten, denn auch sie wird nirgends in der Bibel positiv beurteilt.
Umgekehrt kann auch nicht behauptet werden, nur Jahwe und Ascherah seien zeitweise neben- und miteinander verehrt worden, Baal als Jahwes angeblicher Rivale aber nicht. Denn den biblischen Erzählern war durchaus bewusst, dass die von ihnen erzählten Vernichtungsaktionen Elias und Jehus letztlich erfolglos blieben. Zwar waren nach 1. Könige 19,1 die Baalspropheten bereits von Elia ausgerottet worden; zwar steht in 2. Könige 10,28 nochmals: „So vertilgte Jehu den Baal aus Israel“; dennoch wird nicht nur (S. 18) „unter König Joahaz der Ascherah-Kult weiterhin geduldet“ und blieb die „Statue der Göttin in Samaria … unangetastet“, sondern weiterhin wurde auch Baal verehrt. Da er in 2. Könige 17,16 und 21,3 und 23,4-6 in einem Atemzug mit der gleichfalls vom Erzähler verabscheuten Ascherah genannt wird, ist nichts davon zu spüren, dass die beiden irgendein Eifersuchtsproblem miteinander gehabt haben sollten. Und wenn doch, wie gesagt, dann hätte das keinen Einfluss auf ihre Beurteilung durch die biblischen Erzähler gehabt – sie hätten dann jedenfalls auch eine solche Verehrung Jahwes als Geliebten der Ascherah auf das Schärfste verurteilt.
Am Ende ziehen Sie einen merkwürdigen Schluss aus der Tatsache, dass neuere Bibelübersetzungen die falsche Übersetzung von ˀAScheRaH mit „heiliger Hain“ korrigiert haben (S. 19):
„In den meisten neueren Übersetzungen aber kehrt die Göttin Ascherah zurück. Gibt es eine Rückbesinnung auf religiöse Urkulte, in deren Zentrum Göttinnen standen? Werden die Spuren des Matriarchats, das von den monotheistischen Religionen verdrängt wurde, wiederentdeckt … auch in der Bibel?“
Diese Fragen unterstellen, dass die antike Anbetung von Göttinnen etwas mit mutterrechtlichen Urkulten zu tun hatte, in denen Frauen mehr zu sagen gehabt hätten als Männer. Dagegen ist zu sagen, dass sämtliche antiken Kulturen mit einem polytheistischen Pantheon aus Göttern und Göttinnen nicht weniger patriarchalisch organisiert waren als die jüdisch-monotheistische.
Falls es jemals ein Matriarchat gegeben hat, dann war das vor der Sesshaftwerdung der Menschheit in einer Jäger- und Sammlerkultur, als man vielleicht die Erde als Muttergottheit verehrte (6). Mit der Wiederbesinnung auf solche uralten Gaia-Kulte hat die Erwähnung der Ascherah in der Bibel nichts zu tun. Königin Isebel, die in der Bibel für die Verehrung des Baal und der Ascherah eintritt, ist jedenfalls nicht für eine Politik von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung bekannt, sondern dafür, dass sie unter anderem den Weinbergbesitzer Nabot töten lässt, um ihrem Mann, König Ahab, unrechtmäßig dessen Weinberg zu verschaffen (1. Könige 21,7ff.).
↑ Darf Gott einen verletzlichen Augapfel haben?
Zu (S. 19) A wie Auge Gottes fragen Sie sich, warum die Bibelstelle Sacharja 2,12 oft falsch übersetzt wurde. Noch nach der Lutherbibel von 1984 sagt Gott dort von sich selbst (S. 20): „Wer euch (die Israeliten) antastet, der tastet meinen Augapfel an.“ Dem hebräischen Urtext entspricht aber die korrekte Übersetzung: „Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an.“ So steht es jetzt auch in der Lutherbibel von 2017.
Sie überschreiben diesen Abschnitt mit „Blasphemischer Übersetzungsfehler“, da es nach dem Theologen Georg Fohrer „für den gläubigen Juden blasphemisch“ sei, von „einem Augapfel Gottes zu sprechen“. Eine solche Ausdrucksweise sei „ein Verstoß gegen das mosaische Gesetz [2. Mose 20,4], das es verbietet, sich ein Bild Gottes zu machen.“ Daher wolle der hebräische Originaltext ausdrücken: „Wer Israel Schaden zufügt, der schadet sich selbst, nicht Gott!“
Allerdings wird an anderer Stelle auch im biblischen Urtext der Augapfel Gottes erwähnt, nämlich in 5. Mose 32,10. Da wird erzählt, wie JHWH, der Gott Israels, sein Volk erwählt, das im Vers zuvor Jakob genannt wird:
„Er [JHWH] fand ihn [Jakob] in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel.“
In diesem Satz bezieht sich die Form des Wortes ˁEJNO, „seinen Augapfel“ eindeutig auf Gott. Insofern gibt es zwischen 5. Mose 32,10 und Sacharja 2,12 einen biblischen Widerspruch, den Sie übersehen haben.
Im Hintergrund steht das Problem: Auch die Bibel kommt nicht ohne bildhaftes Reden von Gott aus. In den Schöpfungsberichten handelt Gott wie ein Architekt, wie ein Bildhauer, Landschaftsgärtner, Anästhesist und Chirurg, andauernd ist von Gottes Hand die Rede. JHWH hat menschliche Gefühle, Liebe, Trauer, Zorn, kann etwas bereuen, wacht eifersüchtig darüber, dass das Volk Israel seine Wegweisung der Befreiung und Gerechtigkeit, die Tora, einhält.
Es mag sein, dass einem Juden die bildhafte Rede von Gottes Augapfel dann zu weit geht, wenn unterstellt wird, dass Gott selbst durch eine menschliche Handlung verletzt werden könnte. Aber blasphemisch muss auch eine solche Redeweise nicht sein, wenn man weiß, dass Gott nicht auf dieses Bild festgelegt wird. Sie drückt ja in sehr feinfühligen Worten aus, wie sehr Israel seinem Gott am Herzen liegt.
↑ Wozu wurde die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt?
Dass (S. 20) die Geschichte vom A wie Auszug aus Ägypten nicht den historischen Tatsachen entspricht, sondern „eine erfundene Story“ ist, leugne ich nicht. Was Sie auf den Seiten 24-30 darlegen, kenne ich großenteils aus einem Buch der Archäologen Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman (7). Solchen Erkenntnissen haben sich auch gläubige Menschen und Theologen zu stellen.
Wenn Sie nun allerdings wissen, dass die Story erfunden ist, warum stellen Sie dann doch (S. 21) die „zehn Plagen“, die den tyrannischen Pharo dazu bringen sollen, „das gedemütigte Volk endlich in Freiheit ziehen“ zu lassen, als „durchaus erklärbare Naturphänomene und kultischen Massenmord“ hin? Wenn die Plagen gar nicht geschehen sind, macht es auch keinen Sinn zu sagen, dass es sich bei ihnen um natürliche Ereignisse gehandelt hat. Und dann hat Gott auch keinen Massenmord begangen.
Möchten Sie vielleicht diverse Vorwürfe an die Bibel loswerden, die logisch nicht immer miteinander vereinbar sind?
Vorwurf 1: Die Bibel behauptet, dass die Plagen göttliche Wunder waren. Stimmt nicht, sagen Sie (S. 22): „Für alle zehn Plagen gibt es mögliche natürliche, vernünftige Erklärungen.“
Vorwurf 2: Nachdem Sie jeder Plage eine natürliche Erklärung zugeordnet haben, fällt Ihnen plötzlich auf (S. 23): „Widersprüchliches wird über die Plagen berichtet.“ Wie soll es möglich sein, dass das Vieh der Ägypter mehrfach zu Tode kommt? Letztlich ziehen Sie die biblische Erzählung ins Lächerliche (S. 24):
„Durch die fünfte Plage starb das Vieh der Ägypter. Die sechste Plage brachte den bereits toten Tieren Blattern, die siebente mörderische Hagelkörner und die zehnte Plage ließ nun das eigentlich bereits radikal ausgerottete Vieh nochmals bluten!“
Die biblischen Erzähler empfanden jedenfalls das, was geschah, als göttliches Wunder. Gleichwohl verwendeten sie, worauf der theologisch interessierte Naturforscher Vitus Dröscher (8) nachdrücklich hinwies, durchaus naturwissenschaftlich schlüssige und nachvollziehbare Szenarien für ihre Schilderungen. Dennoch strebten sie keine präzise Plausibilität der Geschichte im Gesamtzusammenhang an; sie betrieben nicht Geschichtsschreibung im modernen Sinn, was Sie selber ja auch unterstrichen haben, sondern erzählten Glaubensgeschichte.
Die entscheidende Frage ist also: Wozu wurde vom Auszug aus Ägypten erzählt? Vom Glauben der Juden her geht es dabei um die Geschichte des erstgeborenen Sohnes Gottes, der immer wieder Unterdrückung erfährt und von Vernichtung bedroht ist, aber von dem Einen Gott JHWH befreit und gerettet wird. Da sich Israel als erstgeborener Sohn Gottes durch die ägyptische Pharaonenmacht bedroht weiß, stellen die biblischen Erzähler in der zehnten und letzten Plage auch den Tod der erstgeborenen Söhne bei Mensch und Vieh der Ägypter in den Mittelpunkt.
So wird das pharaonische Ägypten zum Symbol jedes verhassten Unterdrückersystems, unter dem Israel jemals zu leiden gehabt hatte, sei es der fremdländischen Assyrer oder Babylonier oder auch der Könige des eigenen Volkes von Salomo bis Manasse. Bedrohungs- und Befreiungserfahrungen der Juden in der Zeit um das babylonische Exil herum werden in eine ferne Vergangenheit projiziert und als Entstehungs- und zugleich Befreiungsgeschichten des Volkes Israel erzählt.
Aber (S. 24) steht Gott denn wirklich eindeutig als Befreier „auf der Seite seines Volkes“? „Widersprüchlich“ ist Ihnen zufolge doch auch sein Verhalten, wenn es von ihm heißt (2. Mose 14,8): „Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, daß er den Israeliten nachjagte.“
In solchen Formulierungen spiegelt sich die jüdische Glaubenserfahrung mit einen einzigen allmächtigen Gott wider, der für alles, was man erfährt, verantwortlich sein muss, da es ja keine weitere göttliche Macht neben ihm gibt. Obwohl man weiß, dass der Pharao sich für seine Taten selbst verantworten muss, weiß man im Glauben zugleich, dass selbst die bösesten Taten nicht außerhalb von Gottes Plänen mit seinem Volk geschehen können. Wir berühren hier das Problem der Theodizee bzw. für den Ursprung des Bösen in einer von einem allmächtigen und guten Gott gut geschaffenen Welt, für das es keine logisch befriedigende Lösung geben kann, sondern nur Hoffnung im Glauben (9).
↑ JHWH und Baal – Befreiergott gegen Besitzergott
Unter (S. 29) B wie Baal kommen Sie auf einen Gott zurück, den Sie im Abschnitt A wie Ascherah schon einmal als angeblichen Rivalen Jahwes im Wettstreit um die Liebe der Göttin Ascherah ins Visier genommen hatten. Nun tritt er nochmals allein in den Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit (S. 30):
„Baal, der im Land der Bibel in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Beinamen auftritt, muß als der schärfste Konkurrent Jahwes angesehen werden. Es scheint fast so, als ob auch Baal zum Hauptgott Israels hätte werden können.“
Es scheint nicht nur so, sondern wahrscheinlich war Baal sogar wirklich der einflussreichste Gott der zwei Staaten Israel und Juda. Wie ich schon sagte, standen die Propheten JHWHs als eines Gottes der Befreiung fast immer in Opposition zu den jeweils regierenden Königen und den von ihnen geförderten Götterkulten. Dass Jahwe und Baal Ihnen manchmal „zum Verwechseln ähnlich“ erscheinen, mag daran liegen, dass Ihnen nicht klar ist, worin ihr entscheidender Unterschied liegt: Baal steht für alle Gottheiten, die die Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch andere Menschen legitimieren und fördern. JHWH ist der unaussprechliche Name des Gottes, der sein Volk von Unterdrückung und Unrecht befreit.
Insofern haben Sie Recht (S. 31), dass „Gott Jahwe immer bedroht war“. Bis heute sind alle Freiheitsbewegungen immer bedroht, sei es von außen durch mächtige Unterdrücker, oder sei es von innen, indem sich in der Bewegung selbst erneut unterdrückerische Tendenzen breitmachen. Insofern steht auch JHWH immer in der Gefahr, durch diejenigen, die ihn anbeten, zum Baal, also zu einem Unterdrückergott, gemacht zu werden.
Sie haben auch darin Recht, dass die Gottheit Baal nicht erst durch Königin Isebel, die Frau von König Ahab, eingeführt wurde. Schon in den Erzählungen über die Richterzeit kommt auch der Baalskult vor. Im Zusammenhang mit dem Tanz um das Goldene Kalb im 2. Buch Mose ist allerdings nicht ausdrücklich von Baal die Rede. In der Tendenz macht allerdings die Kritik der biblischen Erzähler ohnehin keine Unterschiede zwischen fremden Göttern, die sie als unterdrückend und ausbeuterisch einschätzen – sie alle stehen dem befreienden und Recht schaffenden Willen des Einen Gottes JHWH entgegen.
Dass Sie das Zusammenspiel von Baal als „Himmels- und Wettergottheit“ mit der Erde, die „als weibliche Gottheit dargestellt“ wurde, einen „Dualismus, bestehend aus Gott einerseits und Göttin andererseits“ nennen, finde ich nicht ganz treffend. Meint das Wort Dualismus nicht in religiöser Hinsicht den Gegensatz zwischen einer guten und einer bösen Gottheit wie im persischen Zoroastrismus oder (nach Wikipedia) eine „Weltsicht, nach der eine geistige und eine materielle Welt von unterschiedlichen Gottheiten geschaffen worden seien“? Aber das nur nebenbei.
Ungenau ist auch Ihre folgende Einschätzung (S. 31):
„Mit der Zunahme des Jahwekults nahm die Bedeutung Baals immer weiter ab. Schließlich wurde aus seinem göttlichen Namen ein banales Wort: Herr oder Besitzer. So konnte schließlich Jahwe selbst als ein Baal bezeichnet werden. So verdrängte Jahwe seinen Konkurrenten: Indem er mit ihm verschmolz! Und wurde Jahwe erst einmal mit Baal gleichgesetzt, wollte er auch nicht mehr Baal genannt werden.“
Dahingestellt sein lasse ich die Frage, ob die Bedeutung des hebräischen Wortes BaˁAL = „Besitzer, Herr“ wirklich aus einer Banalisierung des Götternamen entstanden ist oder nicht vielmehr umgekehrt der Gott Baal seinen Namen bekommen hat, weil er eben als der oberste Herrscher und Besitzergott angebetet wurde. Hätte aber Jahwe den Baal nur verdrängt, indem er mit ihm verschmolz, dann wäre diese Baalisierung Jahwes seine Niederlage gewesen. Er wäre niemals zu dem Befreiergott JHWH geworden, als der er von den Propheten Israels verkündet wurde, der vor allem den Armen ihr Recht verschafft.
Bezeichnend ist, dass Sie die Bibelstelle Hosea 2,18f. falsch zitieren (S. 32):
„Alsdann“, spricht Jahwe, „wirst du mich nennen ‚mein Herr‘ und nicht mehr ‚mein Baal‘. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, daß man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll.“
In Wirklichkeit spricht JHWH hier zu seinem Volk über eine Zukunft, in der es – bildhaft gesprochen – aufgehört hat, mit falschen Göttern herumzuhuren: „da wirst du mich nennen ‚mein Mann‘ und nicht mehr ‚mein Baal‘.“
Im Hintergrund steht, dass Gott nach einem durch den Propheten Hosea offenbarten Wort sein Verhältnis zu Israel mit der Beziehung eines Ehemanns zu seiner Ehefrau vergleicht. In diesem Zusammenhang ist mit dem Ausdruck BaˁALI = „mein Besitzer“ die Vorstellung verbunden, dass das Volk Israel dem „Baal“ genannten Gott in einer untergeordneten, sklavischen Stellung verbunden ist, so wie eine Hure ihrem Freier oder eine Ehefrau unter patriarchalischen Umständen ihrem Ehemann gehört. Aber genau so will JHWH nicht angeredet werden, sondern mit der liebevollen Anrede ˀISchI = „mein Mann“, mit der eine liebende Frau ihren geliebten Mann anredete, der ihr dieselbe Liebe entgegenbrachte.
Nun könnte man sagen, dass patriarchalische Strukturen auch die Zeit der Bibel prägen. Das ist zwar richtig; aber gerade in der Bibel gibt es ebenso Beschreibungen einer respektvollen Beziehung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau. Als Gott in 1. Mose 1,27 die Menschen als sein Ebenbild schafft, erschafft er sie ausdrücklich als „männlich und weiblich“, und in 2. Mose 2,23 wird auch der Mensch erst zum ˀISch = „Mann“, als er seine ˀISchaH = „Frau“ sich gegenüber erblickt und sie begeistert als „Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“ begrüßt und anerkennt. Und auch die Liebeslieder des Hohenliedes besingen eine Liebe abseits patriarchalischer Rollenmuster.
Deutlicher als mit der Anrede ˀISchI statt BaˁALI für Gott kann man den Unterschied zwischen JHWH und Baal also eigentlich nicht herausstellen.
↑ Wozu diente der Bann – der Massenmord im Namen Gottes?
Mit (S. 32) dem Thema B wie Bann sprechen Sie die furchtbarste Seite der Bibel an: Der Ausdruck „steht für den Massenmord im Namen Gottes.“
Auch wenn historisch gesehen nicht sicher ist, ob der „Bann“ jemals in dieser Weise in Israel vollstreckt wurde, haben die entsprechenden biblischen Schilderungen in der späteren Geschichte der christlichen Kirche, vor allem der ideologischen Unterfütterung der Kreuzzüge, eine verheerende Wirkung entfaltet.
Allerdings stimmt nicht alles, was Sie in diesem Zusammenhang äußern. Zu Unrecht bringen Sie nämlich den „Bann“ (S. 33) mehrfach in einen Zusammenhang mit einem „Opfer für Jahwe“ sowie mit (S. 34) „Plünderung“ und „Raub“ (S. 35):
„Das ‚Alte Testament‘ sieht das Plündern, Rauben und Morden verklärt als religiöse Handlung, als Opferritual für Gott. … Gott akzeptiert den Massenmord nur als Opfer. Er fordert und befiehlt ihn immer wieder. Und er reagiert verärgert, wenn der ‚Bann‘ nicht konsequent genug in blutige Tat umgesetzt wird… Es geht nach Aussage der Texte um von Gott angeordneten Massenmord, der als religiöser Opferakt verbrämt wird.“
So fragwürdig und unerheblich eine solche Unterscheidung auch wirkt: Es ging beim „Bann“ zwar um Massenmord an Menschen und Tieren. Aber es ging nicht um Plündern und Rauben. Beute für den eigenen Gebrauch zu machen, war dem Volk Israel im Zusammenhang mit dem Bann ausdrücklich verboten. Alles, was als Beute gemacht werden könnte, sollte ebenso vernichtet werden wie sämtliches Leben im Bereich der Feinde. König Saul wird von Gott gerade deswegen bestraft, weil er wertvolles Vieh als Beute nehmen will und nur das tötet, was „nichts taugte und gering war“ (1. Samuel 15,9).
Der Grund für einen „Bann“ war erst recht nicht der Wunsch JHWHs nach einem möglichst blutigen Opfer für sich selbst. Was im Tempel zu Jerusalem ihm auf unterschiedlichste Weise zum Opfer dargebracht werden sollte, stand auf einem ganz anderen Blatt und wurde kapitelweise im 3. Buch Mose beschrieben. Aber im Zusammenhang mit „Bann“ kommt das Wort „Opfer“ in der Bibel nur wenige Male vor. Wo in 1. Samuel 15 in den Versen 15 und 21 zwei Mal die Wörter „Opfer“ und „Bann“ in einem Atemzug genannt werden, geht es genau darum, dass König Saul seinen Verstoß gegen die Vorschriften des Banns dem Propheten Samuel gegenüber damit rechtfertigen will (1. Samuel 15,15), dass
„das Volk … die besten Schafe und Rinder [verschonte], um sie zu opfern dem HERRN, deinem Gott; an dem andern haben wir den Bann vollstreckt.“
Aber dieses Opfer will Gott gar nicht! Samuel gibt Saul nämlich zur Antwort (1. Samuel 15,22):
„Meinst du, dass der HERR Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.“
Aber was soll die Tötung aller Menschen und Tiere einer Stadt oder eines Volkes im Auftrag Gottes anderes sein als ein Opfer für Gott? Im Sinne der Tora, der Wegweisung des Gottes, der seinem Volk nicht nur Freiheit und Gerechtigkeit verschaffen, sondern es natürlich auch vor der Vernichtung bewahren will, geht es beim kriegerischen Bann ausschließlich um die Erhaltung des Volkes, wenn seine Existenz durch fremde Stämme oder Städte bedroht ist. Nur in einem solchen Fall sollen die radikalen Maßnahmen des „Banns“ zur Anwendung kommen, und zwar ohne jede Beimischung von Motiven des Beutemachens oder der gewaltsamen Eroberung von Menschen, Tieren und anderem Eigentum fremder Völker. Wer das Volk Israel ausrotten will, soll ausgerottet werden. Wer den erstgeborenen Sohn Gottes töten will, dessen erstgeborene Söhne werden getötet!
Das Ziel des Banns wird am deutlichsten ausgesprochen durch den Propheten Sacharja 14,11, der von der Stadt Jerusalem in einer von ihm angekündigten zukünftigen Friedenszeit sagt:
„Und man wird darin wohnen; es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen.“
Sie haben trotzdem Recht, wenn Sie schreiben (S. 35f.):
„Die beschriebenen Grausamkeiten waren zu keinem Zeitpunkt akzeptabel. Planmäßig wurde der Bann, so das ‚Alte Testament‘, an den Bewohnern Kanaans vollzogen. Heute bezeichnet man derlei Massenmorde als Genozid, als Völkermord – und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es muß erlaubt sein, Abscheulichkeiten als Abscheulichkeiten zu bezeichnen. Auch wenn sie in der Bibel stehen!“
Zudem wurde das Plünderungsverbot im Zusammenhang mit dem Bann schon in der Bibel nicht konsequent durchgehalten.
Einerseits fordert Gott (5. Mose 13,18): „lass nichts von dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben“; und als Achan (Josua 7,1) „sich an dem Gebannten“ vergreift, entbrennt „der Zorn des HERRN über die Israeliten“, und er spricht (Josua 7,13): „Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel; darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut.“
Andererseits stehen auch folgende Verse in 5. Mose 2,34f.:
„Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein [die Städte Sihons, des Königs von Heschbon] und vollstreckten den Bann an allen Städten, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen niemand übrig bleiben. Nur das Vieh raubten wir für uns und die Beute aus den Städten, die wir eingenommen hatten.“
und (5. Mose 3,7f.):
„Und wir vollstreckten den Bann an ihnen [den Städten des Königs Og von Basan], gleichwie wir an Sihon, dem König von Heschbon, taten. An allen Städten vollstreckten wir den Bann, an Männern, Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und die Beute aus den Städten raubten wir für uns.“
Im Buch Josua findet sich im Zusammenhang mit der Schilderung der Einnahme der Stadt Jericho (die nach dem in Anm. 7 erwähnten Buch von Finkelstein und Silberman historisch nicht so stattgefunden hat) auch die Grundlage der von Ihnen genannten Einschätzung des Alttestamentlers Gerhard von Rad (S. 34): „Gold und Silber gingen in den Schatz Jahwes über.“ Hier differenziert Josua in dreierlei Hinsicht im Blick auf die Vollstreckung des Banns an der Stadt Jericho (Josua 6,16-19):
„Macht ein Kriegsgeschrei! Denn der HERR hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des HERRN verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind; denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem HERRN geheiligt sein, dass es zum Schatz des HERRN komme.
Ausdrücklich unterstreicht Josua also das Verbot, Beute zu machen – mit zwei Ausnahmen. Die Hure Rahab und alle, die zu ihrem Haus gehören, wird verschont, weil sie die Israeliten unterstützt hat. Und Wertgegenstände aus Metall sollen dem Tempel Gottes zugute kommen.
Der letzteren Ausnahme entspricht auch die Bestimmung des Propheten Hesekiel über die Versorgung der Priester im Tempel von Jerusalem (Hesekiel 44,28f.):
„Und Erbbesitz sollen sie nicht haben; denn ich bin ihr Erbbesitz. Auch sollt ihr ihnen kein Eigentum an Land geben in Israel; denn ich bin ihr Eigentum. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, und alles dem Bann Verfallene in Israel soll ihnen gehören.“
Dahinter steht der Gedanke, dass die Priester in Israel keinen Grundbesitz haben sollten, um sich nicht als Mächtige über das Volk zu erheben. Nur von den Opfergaben und von dem, was im Zusammenhang mit einem Bann erbeutet wurde, sollten sie leben. Dass die Priester sich in der königslosen Zeit nach dem babylonischen Exil trotzdem zu einer grundbesitzenden Schicht entwickelten, die wie ganz normale altorientalische Herrscher ihr Volk ausbeuten, ist leider traurige Realität, obwohl unter Esra die Tora der Gerechtigkeit Gottes offiziell als Staatsverfassung der persischen Provinz Jehud beschlossen wurde (Nehemia 8,2-6).
Diese wenigen Hinweise auf verschiedene Bibelstellen sollen verdeutlichen, dass die Frage des biblischen Banns in der Bibel weitaus widersprüchlicher behandelt wird, als Sie es beschrieben haben. In ihr spiegeln sich sowohl widersprüchliche historische Erfahrungen wider als auch einander widerstreitende theologische Sichtweisen dessen, was der befreiende und gerechte Gott Israels wirklich will.
↑ Ist die Mordgeschichte von Kain und Abel wirklich lächerlich?
Unter (S. 36) B wie Brudermord und Blutrache benutzen Sie die Geschichte von Kain und Abel eigentlich nur, um die Erzähler der Bibel lächerlich zu machen. Kain hätte doch keine Angst vor Blutrache haben müssen, „wenn man den biblischen Text ernst nimmt“, es gab ja außer ihm und dem ermordeten Abel nur noch seine Eltern.
Aber Sie sind es, der den biblischen Text nicht ernst nimmt, denn Sie haben doch selbst deutlich gemacht, dass er als eine Glaubensgeschichte verstanden werden muss, in der es nicht um historische Plausibilität geht. In diesem Fall werden, verpackt in eine Geschichte, Aussagen über die Verantwortung des Menschen vor Gott gemacht. ˀADaM und ChaWWaH (= Eva) heißen schon vom Wortstamm her „Erdling“ und „die Lebendige“ und repräsentieren jeden einzelnen Vertreter der Menschheit. Kain und Abel wiederum stehen für die Frage, wie „der“ Mensch mit seinem Bruder umgeht (10).
Auch die biblische Darstellung der Nachkommen Kains und seiner Gründung der ersten Stadt überziehen Sie mit Spott (S. 37):
„Nachdem Kain mit seiner eigentlich gar nicht vorhandenen Frau einen Sohn gezeugt hatte, gab es Adam, Eva, Kains Frau (die es nach der Bibel eigentlich gar nicht gab!) und Baby Henoch. Selbst wenn Adam und Eva nach Henoch-Stadt gezogen sein sollten, hatte die ‚Stadt‘ ganze fünf Einwohner.“
Natürlich haben Sie Recht gegen diejenigen Christen, die davon ausgehen, dass die Bibel von Anfang bis Ende historisch und faktisch wahr ist, indem Sie sehr schön belegen, wie absurd die Annahme wäre, die Bibel wolle den Anfang der Menschheit historisch beschreiben. Das tut sie aber, wie gesagt, gar nicht, und das wissen Sie ja auch. Darum finde ich die Art, wie Sie hier wider Ihr eigenes besseres Wissen die biblischen Erzähler (an Stelle derer, die sie fälschlich als historisches Nachschlagewerk interpretieren) lächerlich machen, nicht angemessen.
Immerhin kommen Sie mit Manfred Barthel (11) auf die Idee, „die Mordgeschichte einfach symbolhaft [zu] verstehen“. Diese Spur ist genau richtig. Zuerst hat die Erzählung einen theologischen Sinn: Die Menschen sind Brüder, aber was passiert, wenn einer nicht der Hüter des anderen sein will? Vielleicht spiegelt sie weiterhin auch die Gewalt wider, die mit der Sesshaftwerdung der Menschheit und dem dadurch so viel engeren Zusammenleben verbunden war. Aber Kain und Abel eindimensional mit einer bestimmten Kultur zu identifizieren, führt auch in die Irre, was Sie mit Recht gegen eine Interpretation Manfred Barthels ins Feld führen (S. 38):
„Abel steht für den umherziehenden Nomaden, Kain für den seßhaften Bauern. Da irrt der Interpret aber: Kain wird nämlich gar nicht seßhaft, vielmehr muß er ‚unstet‘ umherziehen.“
Aber vielleicht spiegelt die Erzählung noch vielschichtigere Entwicklungen wider: Ausgerechnet der sesshaft gewordene Ackerbauer Kain wird zum Justizflüchtling und im Land NOD (= „Land der Flucht“) zum Städtegründer. So sind Menschen in den umkämpften Regionen Palästinas oft zwischen unterschiedlichen Kulturformen hin- und hergependelt.
↑ Waren die Cherubim wirklich keine Engel?
Unter (S. 38) C wie Cherubim fragen Sie sich, um was für (S. 40) „seltsame Fabelwesen“ es sich bei ihnen wohl gehandelt haben mag, denn – wie Sie nachdrücklich betonen – „Engel waren es nicht“!
Aber da das Wort „Engel“ nichts anderes ist als die Eindeutschung des griechischen Wortes „angelos“ = „Bote“, kann man auch Cherubim unter die himmlischen Boten Gottes einreihen, insofern sie einen bestimmten Auftrag Gottes auszuführen haben, zum Beispiel eben, Wache vor dem Eingang des Paradieses zu stehen (1. Mose 3,24).
Mit den uns heute geläufigen zumeist verniedlichenden Vorstellungen von Engeln hatten die biblischen Engel ohnehin wenig zu tun. Mal haben sie Flügel wie die Serafim in Jesaja 6 oder die Cherubim in Hesekiel 1 und 10. Mal steigen sie an einer Leiter zwischen Himmel und Erde auf- und nieder (1. Mose 28,12). Dann wieder (Richter 13,3ff. und Lukas 1,26ff.) richtet einer von ihnen als „ein Mann Gottes“ einer Frau die Botschaft aus, dass sie ein Kind bekommen wird. Oder er versteht es geschickt (Matthäus 1,18ff.), einen werdenden Vater davon zu überzeugen, dass er seine Verlobte, die nicht von ihm schwanger ist, gefälligst nicht in die Wüste schicken soll, sondern seine Pflichten als Ehemann und Vater für ein kostbares Menschenkind zu erfüllen hat.
↑ Steht und fällt der biblische Glaube mit der historischen Wahrheit der Bibel?
Zu (S. 41) D wie David stellen Sie eingangs fest (S. 42), dass sich die Bibel „in einem zentralen Punkt von allen anderen theologischen Werken“ unterscheide:
„Ausgangspunkt etwa der heiligen Überlieferungen über die ägyptischen Götter Osiris, Isis und Horus ist der erdferne Himmel. Die Geschichte der Bibel aber wurzelt in der irdischen Geschichte. Vermeintlich wahre irdische Historie wird erzählt und soll das konkrete Wirken Gottes in der realen Geschichte bezeugen.“
Ja, die Bibel will auch Geschichte schreiben, ihre Erzähler gehen vermutlich auch naiv davon aus, dass ihre Geschichten sich so, wie erzählt, zugetragen haben. Aber ihr wesentlichstes Interesse ist es nicht, Geschichte historisch plausibel und exakt wiederzugeben, sondern sie deuten menschliche und politische Geschichte theologisch, vom Glauben an Gott her. Die Bibel ist ein Glaubensbuch, nicht ein Nachschlagewerk, das von vorne bis hinten nachprüfbare historische Daten und Darstellungen enthält.
Hinter diese Erkenntnis, die Sie selber im Vorwort geäußert haben, fallen Sie jedoch zurück (S. 42f.), indem Sie eine angeblich von „der theologischen Wissenschaft“ vertretene Auffassung teilen, derzufolge es (S. 43)
„zwei konträre Alternativen [gibt]. Entweder die biblische Historienschreibung ist wahr, dann ist auch der biblische Glaube wahr. Oder aber die biblische Geschichtsschreibung ist fiktiv, dann stimmt auch nicht der biblische Glaube.“
Sie haben zwar Recht, dass es sogar biblische Archäologen gibt (wie William E. Albright und Roland de Vaux), die diese falsche Alternative für richtig halten. Es gibt aber eine dritte Möglichkeit: eine bodenständige, erdnahe Theologie, die Erfahrungen der Menschen mit einem befreienden, Gerechtigkeit stiftenden Gott schildern – und sich dabei unterschiedlicher Erzählformen bedienen – mythischer, geschichtlicher und poetischer, in wechselnden Mischungsverhältnissen. Sie verzeichnen die theologische Forschungslage, wenn Sie so einseitig nur archäologische Biblizisten zu Wort kommen lassen und ihre Alternativen als die angeblich einzig möglichen vor Augen stellen.
↑ War David weder mächtig noch fromm?
Aber nun wirklich zu D wie David. Sie rennen bei mir offene Türen ein, wenn Sie mir erklären, dass viele der von ihm erzählten Geschichten historisch nicht zutreffen. Dass die von Ihnen erwähnte (S. 44) übertriebene Darstellung der Reichtümer, die David „für den Tempelbau zur Verfügung stellte“ in 1. Chronik 22,1-16 nicht den Tatsachen entsprechen kann, ergibt sich schon aus ihren Widersprüchen zu den parallelen Berichten in den Samuel- und Königebüchern. Der Chronik geht es darum, im Rahmen einer ausschließlich auf die Geschichte des Südreiches Juda konzentrierten Erzählung die Pracht des Jerusalemer Tempels möglichst großartig herauszustellen.
Die Berichte über Davids Reichtum sind also „offensichtlich frei erfunden“. War David damit vielleicht auch nur eine erfundene mythische Gestalt? Ihrer Behauptung „David taucht nirgendwo außerhalb der Bibel auf“ widersprechen allerdings die Archäologen Finkelstein und Silberman, die mit einer Inschrift eines aramäischen Königs auf der so genannten Stele von Tell Dan argumentieren (12):
„In diesem Text, der um 835 v. Chr. in Stein gemeißelt wurde, behauptet Hasaël, den König von Israel und seinen Verbündeten, den König des ‚Hauses Davids‘, getötet zu haben. Es ist dies die erste Erwähnung des Namens David in einer außerbiblischen Quelle, in diesem Fall nur rund hundert Jahre nach Davids Lebzeiten. … Die ‚Haus-Davids‘-Inschrift, wie sie seither genannt wird, bezeugt die Existenz eines Königsgeschlechts, das schon im 9. Jahrhundert v. Chr. seine Legitimität auf David zurückführte.“
An späterer Stelle (S. 46) schreiben Sie allerdings auch, dass David wohl wirklich existiert hat:
„Es hieße das sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausschütten, wollte man behaupten, daß David nie gelebt hat und nur eine Ausgeburt frommer Fiktion sei. Frei erfunden ist allerdings die Geschichte von David als König über ein geeintes Reich Israel. … Ein Großreich Davids hat es nicht gegeben“.
So weit gehe ich mit Ihnen konform. Dann allerdings erregen Sie sich darüber, dass König David gar nicht so „fromm“ war, wie man bei dem berühmtesten aller biblischen Könige annehmen müsste (S. 44):
„David war weder mächtig, noch fromm. Er verstieß eklatant gleich gegen mehrere der Zehn Gebote. Bei Samuel lesen wir eine mehr als pikante Geschichte über König David, sexuelle Begierden, einen Ehebruch mit Folgen und die Beseitigung des Nebenbuhlers [2. Samuel 11,1-27].“
Bis hierhin ist Ihre Darstellung korrekt. Aber Ihre anschließende bewertende Äußerung enthält eine verfälschende Unterstellung zum biblischen Moralverständnis (S. 44f.):
„Aus heutiger Sicht ist das damalige Verständnis von Moral nicht nur unverständlich, es ist auch nicht mehr akzeptabel.“
Damit tun Sie so, als ob der biblische Erzähler das Verhalten des Königs einfach hinnehmen würde. Aber wie die Geschichte des Propheten Nathan zeigt (2. Samuel 12,1-12), der David massiv verurteilt, war sein Verhalten schon damals nicht akzeptabel.
Etwas später (S. 45) erwähnen Sie nochmals „Moralvorstellungen jener Zeit“, die uns heute „als völlig unzeitgemäß und ungerecht“ erscheinen, und meinen damit eine Doppelmoral (S. 45f.):
„Wäre Bathsebas Schwangerschaft entdeckt worden, bevor sie der König heiratete, wäre sie als Ehebrecherin überführt gewesen. Als solche wäre sie dann der öffentlichen Verspottung ausgesetzt und schließlich hingerichtet worden. Straflos wäre der König ausgegangen. Es wird deutlich, daß nicht alle biblischen Moralvorstellungen als Richtlinien für das heutige Leben zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus übernommen werden können. Man mag es verurteilen, daß es mancher Zeitgenosse mit der ehelichen Treue nicht so ernst nimmt. Aber niemand wird heute noch die Todesstrafe für Ehebrecherinnen fordern!“
Mit der Zeitbedingtheit etwa der Todesstrafe für Ehebrecherinnen haben Sie natürlich Recht. Aber Doppelmoral gibt es noch heute. Und gerade was Doppelmoral angeht, hat die Bibel durchaus einen kritischen Blick. Ganz so einfach kann man es sich also nicht machen, wie Sie es mit Ihrem abschließenden Satz für diesen Abschnitt tun:
„Und die biblischen Moralvorstellungen in Sachen ehelicher Treue müssen als zeitbedingte Irrtümer angesehen werden.“
Dass übrigens ausgerechnet der bedeutendste König Israels nicht nur als Vorbild hingestellt wird, sondern realistisch als Sünder, ist eine Stärke der biblischen Darstellung. Vermutlich errang er sogar gerade deswegen die höchste Anerkennung von allen biblischen Königen, weil er dazu fähig war, seine Untaten einzusehen und zu bereuen (2. Samuel 12,13):
„Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den HERRN.“
Mit Recht schreiben Sie (S. 46):
„Die Geschichten um David sind keine historischen Berichte über einen mächtigen Herrscher. Es sind fromme Fiktionen, die Jahrhunderte nach der vermeintlichen Ära Davids ersonnen wurden, um den religiösen Glauben an einen starken Gott, der die Geschicke der Menschen lenkt, zu verfestigen.“
Wenn Sie allerdings hinzufügen (S. 47}: „Sie sind frommes Wunschdenken, das falsche Erinnerungen an ein ‚Goldenes Zeitalter‘ produzierte, das es nie gegeben hat“, möchte ich entgegnen:
Sicher dienen die David-Geschichten auch dazu, das Wunschbild einer Einheit Israels und Judas, das erst durch die Flucht von Israeliten aus dem untergegangenen Nordreich ins Südreich Juda entstanden war, in die Vergangenheit zurückzuprojizieren. Aber ihre Bedeutung geht weit darüber hinaus. Sie sind vielschichtiger und beeindrucken gerade durch die Einsicht, dass auch Könige fehlbar und auf Vergebung angewiesen sind.
↑ Hat die Erbsündenlehre etwas mit Sippenhaft zu tun?
Im Fazit zu Ihren Ausführungen über E wie Erbsünde vergleichen Sie die christliche Erbsündenlehre, wie Sie zum Beispiel (S. 51) im „Katechismus der Katholischen Kirche“ vertreten wird, mit der faschistischen Sippenhaft (S. 52):
„Durch die Verfehlung von Adam und Eva wurde demnach der Mensch zur sündigen Natur. Alle Menschen werden demnach für ihre Natur bestraft. … Man ist also Sünder, auch wenn man nicht selbst gesündigt hat. Man ist schuldig, ohne selbst etwas verschuldet zu haben, weil jemand Generationen früher schuldig wurde. Diese Vorstellung ist mit einem modernen Rechtsverständnis unvereinbar. Sie erinnert in höchst fataler Weise an das Unrechtssystem der Nazijustiz. Da gab es die Sippenhaft für echte oder vermeintliche Rechtsbrecher und deren Angehörige.“
Ich gebe Ihnen durchaus Recht, das Konzept der Erbsünde in Frage zu stellen, den Vergleich mit faschistischer Sippenhaft weise ich aber entschieden zurück.
Meines Erachtens erwachsen die Probleme der jeweiligen damit zusammenhängenden Lehren der katholischen und der evangelischen Kirche aus dem fragwürdigen Versuch, viele verschiedene Glaubenserfahrungen der biblischen Erzähler auf einen einzigen gemeinsamen Nenner zu bringen und erzählte Geschichten sowohl als historisch faktisch zu begreifen als auch in eine dogmatische Systematik zu pressen.
Nach Eugen Drewermann (13) spiegelt die Erzählung vom Sündenfall Evas und Adams die Grunderfahrung des Menschen wider, sich nicht vorstellen zu können, immer und überall in den Händen eines guten Gottes in absolutem Urvertrauen geborgen leben zu können. Die Angst vor dem Tod und die Angst, im Leben zu kurz zu kommen, wird im Symbol der Frucht dargestellt, die Gott nach den Worten der Schlange den Menschen nicht gönnt, weil sie ewiges Leben verschafft und ihn wie Gott werden lässt. Dieses Urmisstrauen der Menschen gegen Gott ist zwar nicht gottgewollt, es begleitet aber jeden Menschen sein ganzes Leben hindurch, da er in einer Welt lebt, in der Gott und seine Güte nicht immer klar vor Augen liegt.
Auch die philosophisch-theologische Interpretion der Sündenfallgeschichte durch den Theologen Paul Tillich sagt mir zu, der darauf bestanden hat, sie nicht als historisches Ereignis auszulegen (14), sondern als Symbol für die Entfremdung des Menschen, der in seiner Essenz (seines Wesen) gut erschaffen ist, aber in seiner realen Existenz sich notwendig in Sünde verstricken muss.
Man sollte also wirklich nicht aus Glaubensgeschichten mit vielschichtigen Bildebenen eine quasi biologisch angeborene Sündhaftigkeit der Menschen seit Adam und Eva konstruieren.
Dass auch nach der Bibel jeder Mensch „nur für die eigenen Taten zur Verantwortung gezogen werden [kann], nicht aber für die der Vorväter“, stellen Sie selbst unter Verweis auf 5. Mose 24,16 und Hesekiel 18,20 fest. Sie hätten außerdem noch auf Jeremia 31,29f. und den gesamten Abschnitt Hesekiel 18,2ff. verweisen können. Das dort zitierte Sprichwort „Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“, belegt, dass es schon in biblischen Zeiten Diskussionen über genau die von Ihnen aufgeworfenen Fragen gab.
Dem scheint 2. Mose 20,5 zu widersprechen:
„Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.“
Sie nennen das eine „unakzeptable Vorschrift“ die „jeglichem Gerechtigkeitssinn“ widerstrebt (S. 49): „Drei oder vier unschuldige Generationen müssen büßen, was ein Urvater angerichtet hat.“
In meinen Augen meint dieses Bibelwort jedoch keine Sippenhaft, sondern es drückt die Lebenserfahrung aus, dass alle Generationen, die in einer Großfamilie zusammenleben, von den Folgen der Taten des Seniors unmittelbar betroffen sind. Dass der begrenzten Heimsuchung (15) über wenige Generationen hin tausendfacher Segen für diejenigen gegenübersteht, die Gottes Gebote halten, zeigt deutlich, dass der Gott Israels nicht als tyrannischer Willkürgott erfahren wird.
Bis hierhin bewegen wir uns im Vorstellungsbereich des alttestamentlich-jüdischen Glaubens und Denkens. Wie ist es aber (S. 50), wenn Christen „Abschied von der Erbsünde“ nehmen müssten, etwa wenn sie – wie der Evangelist Carl G. Johnson (16) – zugestehen, dass nach Römer 14,12 (17) „jeder von uns … sich selbst vor Gott rechtfertigen“ muss, so dass jeder Mensch nur „eine angeborene Neigung zur Sündhaftigkeit“ hat? Ist dann nicht auch (S. 51) „der Opfertod Jesu überflüssig“? Für Sie ist das eindeutig so:
„Wenn es keine Erbsünde gibt, dann wird auch die Kreuzigung Jesu bedeutungslos. Nach christlicher Überzeugung erlöste uns Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz von der Erbsünde. Läßt man die Erbsünde weg, verliert der christliche Glaube seine Grundlage: Wenn es keinen Sündenfall mit folgender Erbsünde gab, wird Jesu Kreuzestod sinnlos.“
In Ihrer Neigung zu simplen und reißerischen Alternativen übersehen Sie hier wieder einmal die Vielschichtigkeit theologischer Problemkreise.
Erstens ist es eben die Frage, ob Ihr Satz stimmt, mit dem Sie Ihre Ausführungen über den Evangelisten Johnson abschließen (S. 50f.):
„Der Mensch hätte zwar eine angeborene Neigung zur Sündhaftigkeit, wäre aber durchaus dazu in der Lage, sündenlos zu leben.“
Ein wohlverstandener christlicher Glaube ist sich dessen bewusst, dass niemand (außer Jesus Christus, in dem Gottes Heiliger Geist der Liebe vollkommen wohnte) in der Lage ist, seiner Neigung zur Sündhaftigkeit und seiner Verstrickung in Schuld immer und überall zu widerstehen. Ohne die Erfahrung von unbedingter Liebe kann das Urmisstrauen gegenüber dem Leben und der Welt nicht überwunden werden. Jeder Mensch ist auf Vergebung angewiesen. Dieses Bewusstsein des Verstricktseins und des Gefangenseins in Sünde und Schuld steht in einer unauflösbaren Spannung zu der Verantwortlichkeit des Menschen für seine eigenen Taten. Aber die Freiheit, das Böse zu lassen und das Gute zu tun, gewinne ich erst, indem ich im Gottvertrauen meine Angst überwinde, zu kurz zu kommen oder sowieso verurteilt zu sein, indem ich also aus Liebe und Vergebung lebe.
Zweitens wird der Kreuzestod Jesu in der Christenheit sehr unterschiedlich gedeutet. Zeigt er vielleicht gerade die Unmöglichkeit, dass noch so böse Menschen quasi Gott selbst und seine Liebe ermorden könnten, da Jesus am Kreuz sogar seinen Mördern vergibt (Lukas 23,34) und Gott in Jesus allen Ermordeten in Liebe nahe ist?
Und wenn es ein Sühnetod war, wie ist er zu verstehen? Hat Gott selbst in seinem unschuldigen Sohn die Strafe für alle Schuld der Menschen auf sich genommen, so dass niemand mehr die ewige Verdammnis fürchten muss? Oder brauchte ein in seiner Ehre gerkränkter Gott diesen Tod, um seinen Zorn über die Sünde der Menschen zu besänftigen (18)?
Eugen Drewermann hat gegen alle Vorstellungen, die ein solches sadistisches Gottesbild implizieren, die Überzeugung gesetzt, dass im Leben Jesu bis hin zum „Drama der Kreuzigung“ gerade im Leiden an Menschen, „die so zerstört sind, dass sie nur zerstören können“, eindeutig die Liebe Gottes offenbar wird (19):
„Gott ist väterlicher als jeder Vater und mütterlicher als jede Mutter; er möchte unzweideutig, dass wir leben, und selbst wenn wir wirklich so schlimm sind, wie zu sein wir seit Kindertagen zu befürchten gelehrt wurden, so will Gott dennoch, dass wir leben, jenseits des Todes, jenseits der Schuld, jenseits der Angst; denn erst in diesem Vertrauen Gottes… werden wir merken, wie reich und wie wertvoll wir wirklich sind.“
↑ Nicht unbedingt ein Rechenfehler im Buch Esra
Unter (S. 52) E wie Esra erwähnen Sie, dass die genau angegebene Anzahl von Kostbarkeiten in Esra 1,9-10 im folgenden Vers 11 falsch zusammengezählt wurde. „30 + 1029 + 30 + 410 + 1000“ das ergibt „2499“ und nicht „5400“.
Kein Rechenfehler muss nach Johannes Runkel allerdings vorliegen, wenn man den Vers Esra 1,6 berücksichtigt, in dem es heißt, „dass die Juden, die in Babel blieben, auch etwas von ihrem Besitz gaben. Und zwar werden ausdrücklich auch Silber und Gold erwähnt.“ Dann würde sich die in Vers 11 erwähnte „Summe von 5400 … nicht nur auf die Gegenstände des Tempels (2499 Geräte)“ beziehen, „sondern auch auf die Gaben der in Babel bleibenden Juden. Diese gaben somit die restlichen 2901 Gegenstände.“
Gerade bei Zahlenangaben können aber auch Abschreibfehler vorgekommen sein, bei denen später nicht mehr nachprüfbar war, wie die ursprüngliche Zahl gelautet hatte (wenn nämlich das Original der Schrift nicht mehr vorhanden war). In dem Konflikt, ob man dann später eine offensichtlich falsche Addition eigenmächtig berichtigen oder den vorliegenden Text der Abschrift bewahren sollte, werden sich wohl die meisten Kopisten für Letzteres entschieden haben.
↑ Wurde Empfängnisverhütung mit dem Tode bestraft?
Mit Ihrer Kritik (S. 54) unter F wie Fruchtbarkeit am katholischen Verbot der „künstlichen Empfängnisverhütung“ rennen Sie bei einem evangelischen Pfarrer wie mir offene Türen ein. Sie haben auch Recht mit Ihrem Satz: „Biblisch begründen läßt sich diese Haltung kaum.“
In dem von Ihnen angeführten „Fall Onan“ geht es allerdings gar nicht allgemein um das „Thema Schwangerschaftsverhütung“. Onans Vergehen bestand vielmehr darin, dass er den Vollzug der Levirats- oder Schwagerehe verweigerte, also seine Pflicht, einem verstorbenen Bruder Nachwuchs zu verschaffen. Er wurde auch nicht auf Grund eines Gebotes der Tora zum Tode verurteilt, sondern es heißt einfach (1. Mose 38,10): „Dem HERRN missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben.“
Hätte Onan nach dem Gebot der Schwagerehe in 5. Mose 25,5-10 seine Schwägerin gar nicht erst heiraten wollen, wäre die ihm dafür drohende Strafe eine Entehrung gewesen (Verse 9-10): Die Schwägerin hätte ihm den Schuh vom Fuß gezogen und ihm ins Gesicht gespuckt; sein Haus wäre „Barfüßerhaus“ genannt worden.
↑ Vom biblischen Geisterzauber zur Hexenjagd
Warum (S. 55), so fragen Sie unter G wie Geisterzauber, wendet sich die Bibel in so scharfer Form gegen Zauberei und Geisterbeschwörung, dass sie sogar „die Todesstrafe für Zuwiderhandelnde“ fordert?
Die Menschen sollten ihr Schicksal in die Hand des Einen Gottes legen, dem sie alles verdanken und von dem sie alles erbitten können, und nicht versuchen, höhere Mächte durch magische Praktiken in den Griff zu bekommen. Dass der Name Gottes nicht ausgesprochen werden sollte, hing vielleicht auch damit zusammen, dass man gar nicht erst versuchen sollte, ihn mit Beschwörungsformeln für eigensüchtige Zwecke einzuspannen.
Ob zu biblischen Zeiten die Todesstrafe gegen Zauberer und Hexen allerdings jemals wirklich vollstreckt worden ist, bezweifle ich (vgl. dazu die Ausführungen von Erhard S. Gerstenberger, auf die ich unter T wie Todesstrafe näher eingehe). Gerade die Geschichte der Totenbeschwörerin von En-Dor (1. Samuel 28,3-25), die Sie erwähnen, zeigt jedoch, dass diese Frau sympathischer geschildert wird als der König, der sie verbotenerweise aufsucht (20). Im Zuge dieser biblischen Erzählung wird jedenfalls nicht ihre Verurteilung zum Tod gefordert.
Zwei Einzelheiten zu dieser Geschichte geben Sie übrigens nicht ganz richtig wieder:
Erstens war Sauls Schicksal nicht nur besiegelt, weil er Samuels Totenruhe gestört hatte, sondern schon deswegen, weil er anlässlich eines Banns für eigene Zwecke Beute gemacht hatte (siehe oben: „Wozu diente der Bann…?“).
Zweitens drücken Sie sich missverständlich aus, wenn Sie über Saul schreiben: „So überließ ihn Jahwe seinen Feinden. Die Philister schlugen ihm den Kopf ab.“ Das tun sie erst, nachdem Saul sich in einer Schlacht gegen die Philister selbst getötet hat, um nicht lebendig in die Hand seiner Feinde zu fallen (1. Samuel 31,4.8-10).
Mit Recht prangern Sie es an, dass ausgerechnet in der beginnenden Neuzeit, „der vermeintlich aufgeklärten Zeit von Luther, Galilei und Gutenberg“, unter Berufung auf das biblische Gebot (2. Mose 22,17): „Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen“ Millionen von Hexenprozessen mit Zehntausenden von Todesurteilen stattfanden (die ungefähren Zahlen habe ich aus Wikipedia). Die Kritik an Aberglauben und Zauberei im Namen einer Religion der Liebe darf keinesfalls in gewaltsame Hexenjagden umschlagen.
↑ Hat wirklich niemand Gott je gesehen?
Zu (S. 57) G wie Gesicht Gottes bemühen Sie schwierige Probleme der Aussage-Logik:
„Wie widerlegt man eine Aussage, die den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt? Das ist eigentlich recht einfach: Es genügt ein einziges Gegenbeispiel, um eine solche Aussage ad absurdum zu führen.“
Die Behauptung: „Alle Raben sind schwarz“ wäre also durch die Existenz von Albino-Raben oder auch des Weißbunten Raben, den es vor hundert Jahren noch auf den Färöern gegeben haben soll, widerlegt. Allerdings weiß der Volksmund auch, dass Ausnahmen die Regel bestätigen.
Ebenso allgemeingültig klingt, was Gott in 2. Mose 33,20 sagt:
„Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“
Sie schreiben (S. 57):
„Wenn nur ein einziger Mensch das Gesicht Gottes gesehen haben sollte, wäre schon die Aussage Gottes widerlegt.“
Und tatsächlich sagt Jakob nach einem nächtlichen Ringkampf mit einem geheimnisvollen Wesen am Fluss Jabbok (1. Mose 32,31):
„ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.“
Für Sie (S. 58)
„ist damit eine weitere Behauptung aus der Bibel [widerlegt]. Stellte doch der unbekannte Verfasser des Evangeliums nach Johannes dezidiert fest [Johannes 1,18]: ‚Niemand hat Gott je gesehen.‘ Doch: Jakob hat nach der Bibel Gott sehr wohl gesehen.“
Oberflächlich gesehen handelt es sich hier tatsächlich um einen Widerspruch. Aber die Frage ist wieder einmal, was ein solcher Satz über das Nicht-sehen-Können oder das Sehen Gottes tatsächlich aussagen will.
Sehen in einem faktisch-biologischen Sinn, als sei Gott ein Mensch wie wir, wird ausgeschlossen, zumal wenn man sich Gott als Licht mit einer Energie vorstellt, die unser Augenlicht mehr als jede Sonne zerstören würde.
Sehen im Sinne der Begegnung mit einer quasi-menschlichen Gestalt, die mir als Verkörperung göttlicher Kraft oder Liebe gegenübertritt wie bei Jakob, ist etwas völlig anderes. In der Bibel wird diese Vorstellung sehr unterschiedlich akzentuiert.
Sie selber zitieren ja den Theologen Carl G. Johnson (21), der differenzierend schreibt:
„Gott ist Geist, nicht Form, und Seine ewige Essenz ist für Menschen unsichtbar. Aber der unsichtbare Gott hat sich in einer sichtbaren Form manifestiert.“
Aber damit sei der Widerspruch nicht aufgelöst, denn dann „hat sich Gott eben doch gezeigt“. Aber – wie gesagt – es kann hier immer nur um bildhafte Sprache gehen, nicht um ein reales Sehen. Wenn die Bibel schon nicht durchgehend nachprüfbare historische Geschichte enthält, wie sollte sie beweiskräftige Nachweise darüber enthalten, dass Gott tatsächlich für bestimmte Menschen in einer abfotografierbare Weise sichtbar gewesen ist?
Ähnlich wie die Frage, ob Gott Augäpfel hat, die der Mensch verletzen kann, wird offenbar in der Bibel auch die Frage, ob man (sozusagen mit Augen des Glaubens) Gott sehen kann, unterschiedlich beantwortet.
Auf einige biblische Stellen, die Sie zu erwähnen vergessen haben, möchte ich zur Klärung gerne noch eingehen.
In unmittelbarem Zusammenhang mit 2. Mose 33,20, wo Gott sagt, dass niemand überlebt, der ihn sieht, findet sich drei Verse weiter die Erlaubnis Gottes an Mose (2. Mose 33,23):
„du darfst hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“ (22)
Und bereits 9 Kapitel zuvor im selben biblischen Buch wird eine noch viel spektakuläre Geschichte vom Besuch der Ältesten Israels auf dem Gottesberg Sinai erzählt (2. Mose 24,9-11):
„Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen der Israeliten. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie.“ (23)
Die biblischen Schriftsteller empfanden das offenbar nicht als einen Widerspruch, sonst hätten sie es nicht im selben Buch niedergeschrieben.
Ähnliches gilt für das Neue Testament.
Im selben Johannesevangelium, aus dem Sie 1,18 zitiert haben: „Niemand hat Gott je gesehen“, steht auch der Satz Jesu (Johannes 12,45): „wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.“ (24)
Ein Widerspruch? Nein, denn zwar ist der ewige Gott in seiner wahren Wesenheit für menschliche Augen unsichtbar, aber in der Ausstrahlung, der Liebe, des menschlichen Wesens Jesu Christi ist etwas von der Liebe Gottes wahrnehmbar.
In der Bergpredigt Jesu steht die Seligpreisung (Matthäus 5,8):
„Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.“
In Hebräer 12,14 wird denen, die sich um Frieden und ein heiliges Leben bemühen, versprochen, dass sie Gott sehen werden:
„Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird“. (25)
Am aufschlussreichsten ist vielleicht ein Abschnitt aus 2. Petrus 1,16-19, über den ich einmal einen Gottesdienst mit einer Bildbetrachtung gehalten habe, bei dem eine blinde Frau anwesend war (26). Ich fragte sie nachher, wie es denn für sie war, die Predigt mitzuverfolgen, weil sie doch das Bild, das ich beschrieben hatte, nicht sehen konnte. Sie meinte, dass das völlig in Ordnung gewesen wäre, denn sie hätte das Bild ja durch meine Beschreibung auch in ihrem Kopf sehen können. Außerdem kam uns um so mehr zum Bewusstsein, dass es in diesem Text ja gerade darum geht, dass der Schreiber des Petrusbriefes seine Augenzeugenschaft der Herrlichkeit Gottes in akustischen Bildern beschreibt (achten Sie einmal auf die von mir hervorgehobenen Stellen):
„Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“
Deutlicher kann man wohl nicht machen, was mit dem Sehen Gottes gemeint sein kann, als dieser Apostel, der sicher mit dem Jünger Petrus nicht identisch war und sich doch im Hören auf das Wort von Glaubenszeugen als Augenzeuge der Herrlichkeit Gottes meint verstehen zu dürfen.
↑ Wer tötete den Riesen Goliath – David oder Elhanan?
Im Blick auf (S. 58) G wie Goliath und die legendäre Niederlage des Riesen gegen den jugendlichen David stellen Sie fest, dass „der Kampf auf Leben und Tod zwischen den ungleichen Kontrahenten im ‚Alten Testament‘ in gleich zwei Versionen“ erzählt wird. Der wichtigste Unterschied (S. 60): „In Version 2 tötet nicht David den Koloß, sondern ein Elhanan.“ Und Sie fragen sich:
„Wie ist es möglich, daß der Verfasser der Samuelbücher in seinen beiden Werken zwei einander deutlich widersprechende Versionen von ein und demselben höchst dramatischen Geschehen bietet?“
Zunächst sei nebenbei angemerkt, dass es sich bei den beiden Büchern Samuel nicht um zwei verschiedene Werke desselben Autors handelt; im jüdischen TeNaK gab es nur ein Samuelbuch, das später in zwei Teilen aufgespalten wurde. Erst recht kann man nicht von einem einzigen Autor sprechen, da die Frage, welche Überlieferungen dem Buch Samuel zu Grunde liegen und wer sie wann zusammengestellt hat, wirklich nicht einfach zu beantworten ist. Insofern müssen Sie sich gar nicht groß über die große Uneinigkeit in der „Frage nach der Autorenschaft der Samuelbücher“ wundern, die es sowohl in der jüdischen Tradtion als auch in der christlichen alttestamentlichen Wissenschaft gibt.
Auf der Suche nach der Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage finden Sie dann (S. 61) in 1. Chronik 20,5 noch eine dritte Version der Geschichte, wo Ihrer Ansicht nach „auf eher stümperhafte Art und Weise“ der Widerspruch zwischen den beiden ersten Versionen ausgeglichen werden soll: „Denn da heißt es: Elhanan habe nicht Goliath zur Strecke gebracht, sondern dessen Bruder.“
Und Sie verweisen darauf, dass David keinesfalls, wie in 1. Samuel 17,54 berichtet, den abgeschlagenen Kopf Goliaths nach Jerusalem gebracht haben kann, da David erst im 8. Jahr seiner Regierungszeit als König die Stadt Jerusalem von den Jebusitern eroberte (2. Samuel 5,5ff.).
Schließlich fassen Sie ganz richtig zusammen, was Sie herausgefunden haben:
„David tötete Goliath. Diese biblische Aussage ist falsch. Sie stammt von einem unbekannten Autor aus der Zeit um 580 v. Chr., der schon den jungen David heldenhaft erscheinen lassen wollte. Als Vorlage diente ein älterer Text, der etwa 950 v. Chr. entstand und der Elhanan als Goliathbezwinger feierte.“
Insofern stimmen Sie mit den Erkenntnissen der alttestamentlichen Wissenschaft überein, die der Alttestamentler Walter Dietrich in seinem Werk über die frühe Königszeit in Israel folgendermaßen beschreibt (27):
„Leicht läßt sich vorstellen, daß Informationen aus der frühen Königszeit, statt in Annalen zu geraten und dort zu schriftlicher Kurzform zu erstarren, auch mündlich weitergetragen werden konnten, dabei eine ausführlichere Fassung erhielten und, je länger sie weitererzählt wurden, um so ausführlichere und auch sonst veränderte Formen und Inhalte annahmen. Ein Fall dieser Art ist in den Samuelbüchern dokumentiert: In 2.Sam 21,19 haben wir, im Kontext einer Anekdotenreihe über tapfere Krieger Davids, eine knappe Notiz, daß ein gewisser Elhanan aus Betlehem den riesenhaften Philisterrecken Goliat aus Gat erschlagen habe; in 1.Sam 17 haben wir eine, nein, vermutlich sogar zwei ineinander verflochtene Erzählungen darüber, wie David diese Heldentat beging. Zwischen diesen beiden Texten liegt erkennbar eine lange Überlieferungs- und Erzählspanne, während derer sich dem ursprünglichen Faktum eine Vielzahl von Überzeugungen, Überlegungen, Erfahrungen ankristallisiert haben, so daß aus einer einzelnen Kriegsepisode eine große Helden- und tiefgründige Lehrerzählung geworden ist.“
Mit Ihren anfänglichen Formulierungen und Fragen (S. 58):
„Die beiden Texte widersprechen sich in zentralen Aussagen. Nur eine kann stimmen. Eine muß falsch sein. Aber welche? Wo irrte der biblische Autor?“
fallen Sie allerdings wieder einmal hinter Ihre eigene Einsicht zurück, dass die Bibel kein Geschichtsbuch ist, das von vorne bis hinten nur Tatsachen enthält. Bei Überlieferungen, die sich als erzählte Geschichte begreifen, ist doch immer zu fragen, wie viel davon möglicherweise einem historischen Geschehen entspricht und wie viel aus unterschiedlichsten Erwägungen heraus verändert, ergänzt oder weggelassen wird. Und gerade bei der Bibel als einem Glaubensbuch geht es nicht um die Frage, welcher von zwei Historikern in seiner akribischen Forschungsarbeit möglicherweise einen Irrtum begangen haben mag, sondern zu welchem Zweck bestimmte Geschichten in dieser Weise erzählt werden.
Sie erwähnen abschließend, dass die „rückwirkende Glorifizierung Davids“ später (S. 62) „in der jüdischen Mythologie“ fortgesetzt wurde. Die „magische Kraft“, der „böse Blick“ und ein hilfreicher Engel, die David zur Verfügung standen, hätten ihm, wie Louis Ginzberg (28) zusammenfasst, geholfen, den Riesen Goliath zu bezwingen. Solche Geschichten machen allerdings die ursprüngliche Pointe der David-Goliath-Erzählung in 1. Samuel 17 völlig zunichte, in der es um Davids Gottvertrauen geht, das mangelnde physische Stärke ausgleicht, und nicht um göttlich-magische Wunderkräfte.
↑ Wie sich die Vorstellungen von Hölle und Himmel verwandelten
Zu (S. 62) H wie Hölle und Himmel erwähnen Sie eingangs das Tal der Söhne Hinnoms, auf Hebräisch GeJˀ BəNeJ-HiNNoM, aus dem später die Gehenna werden sollte. Hier machte nach 2. Könige 23,10 König Josia die Opferstätte unbrauchbar, an der Kinder dem Moloch geopfert wurden.
Sie nehmen an (S. 63), dass den „Jahwe-Anhängern … jene Stätte“ nicht deswegen „ein Ort des Grauens“ war, weil „dort gelegentlich Menschen ihr Leben ließen“, sondern weil „dort einem fremden Gott gehuldigt wurde“. Angeblich nur deswegen
„ließ König Josias um 625 v. Chr. das Tal entweihen. Weil es den Anhängern eines fremden Glaubens heilig war, ließ er es in eine stinkende Abfalldeponie verwandeln. Berge von Knochen wurden aufgehäuft und verbrannt. Müll wurde angekarrt und ebenfalls angezündet. Schwefel wurde beigefügt, um die Feuersglut Tag und Nacht nie verlöschen zu lassen. Es entstand ein Ort, der unserer Vorstellung von Hölle recht nahe kommt.“
Aber „Moloch“ muss nicht unbedingt ein assyrischer Gott gewesen sein; das Wort an sich bedeutet einfach „König“; vermutlich war es sogar der eigene Gott Jahu, dem diese Opfer gegolten hatten. Und möglicherweise störte die Anhänger JHWHs, zu deren Unterstützern auch König Josia wurde, eben doch die Grausamkeit vor allem der Kinderopfer, gerade weil sie dem eigenen Gott Jahu dargebracht wurden. Von Josia wird erzählt (2. Könige 22), er habe im Tempel die Tora mit der Wegweisung JHWHs wiedergefunden, und diesen wahren Willen des unsichtbaren Gottes, der „nur Stimme“ ist, nicht bildhaft angebetet werden will und keine Kinderopfer fordert, bemühte er sich mittels eines Bildersturms und einer wahren Kulturrevolution zu erfüllen (29).
Zurück zur „Gehenna“. Ich stimme Ihnen zu: Wo im Alten Testament Menschen eine Strafe in einem „Glutofen“ (Jesaja 31,9) oder „Feuer“ (Jesaja 66,24) zu erwarten haben, da hat diese Vorstellung nichts mit Teufeln und Dämonen zu tun:
„Die biblische Gehenna-Hölle ist ein Ort, an dem Gott strafen wird: Und zwar ausschließlich vom Glauben abgefallene ‚Gottlose‘.“
Wozu ich ergänzen möchte, dass damit nicht Atheisten oder Andersgläubige im modernen Sinn gemeint sind, sondern Menschen, die den guten und gerechten Willen Gottes in ruchloser Weise missachten und zum Beispiel die Würde armer und elender Menschen mit Füßen treten. Man könnte sogar sagen, dass damals eher die JHWH-Anhänger als „Atheisten“ betrachtet worden sein könnten, weil sie von ihrem Gott keine Bilder anfertigten und weil sie alle Götter außer ihm verabscheuten.
Nicht ganz stimmt Ihre Bemerkung (S. 64), dass das Alte Testament den Himmel nur „als das Firmament, das sich über den Menschen wölbt“, kennt. Stattdessen wird sehr häufig davon gesprochen, dass Gott vom Himmel her in das Geschehen auf der Erde eingreift, etwa beim Turmbau zu Babel (1. Mose 11,1-9), und nach Josua 2,10 „ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.“ Wenn allerdings in Psalm 2,4 von Gott die Rede ist, „der im Himmel wohnt“, und Salomo in 1. Könige 8,27 zu Gott betet: „Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen“, wird deutlich, dass die Menschen des Alten Testaments sich dessen bewusst waren, dass die Rede vom Himmel als dem Wohnort Gottes ein Bild ist, das man nicht wörtlich nehmen darf.
Die Vorstellung eines Himmels, in den die an Gott glaubenden Menschen nach ihrem Tod hineinkommen, hat sich allerdings wirklich erst viel später entwickelt. Erste Spuren davon finden sich im Neuen Testament in der von Ihnen erwähnten Vorstellung (Lukas 16,22), dass der arme Lazarus in Abrahams Schoß sitzt, oder (Lukas 23,43) in dem Versprechen Jesu an einen der mit ihm Gekreuzigten: „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“
Voll und ganz Recht gebe ich Ihnen gerne in Ihren abschließenden Bemerkungen zu diesem Thema (S. 64):
„Die biblischen Bilder – auch jene von Hölle und Himmel – sind das Ergebnis einer Entwicklung über viele Jahrhunderte hinweg, die vielleicht niemals abgeschlossen ist. Die christlichen Glaubensvorstellungen – etwa von Hölle und Himmel – sind nicht als fertige Gedanken übernommen worden. Sie haben sich nach Beendigung der Arbeit an den biblischen Texten nach und nach entwickelt. Das zeigt, daß Glaube sich seit mehr als zwei Jahrtausenden verändert. Diese Erkenntnis gibt zu Hoffnung Anlaß: Auch heute und morgen wird sich Glauben ändern. Nur dann kann er langfristig dem suchenden Menschen Hilfe bieten.
Ein Glaube, der einmal stehenbleibt, ist ein Auslaufmodell und verschwindet irgendwann in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit.“
↑ Wie steht die Bibel zur Homosexualität?
Mit (S. 64) dem Thema H wie Homosexualität „gehen die christlichen Kirchen“ auch nach der Einführung der Ehe für alle in Deutschland sehr unterschiedlich um. Stolz bin ich auf meine Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, in der es mittlerweile selbstverständlich ist, dass gleichgeschlechtliche Paare auch kirchlich getraut werden und schwule Pfarrer oder lesbische Pfarrerinnen mit ihren Ehegatten mit vollem Rückhalt der Kirchenleitung im Gemeindepfarramt eingesetzt werden. Die katholische Kirche und andere christliche Konfessionen sind noch lange nicht so weit. Und gesamtgesellschaftlich wächst nicht nur die Akzeptanz von gleichgeschlechtlich lebenden Menschen, sondern auch der Hass auf sie. Allerdings wird das Thema intensiv diskutiert; das Titelthema der kritisch-christlich-unabhängigen Zeitschrift Publik-Forum (Nr. 14) vom 26. Juli 2019 lautet zum Beispiel: „Homosexualität und Religion. Wo ist das Problem?“
In den vier Bibelstellen (S. 65), die nach dem von Ihnen zitierten „Katechismus der Katholischen Kirche“ angeblich homosexuelle Handlungen verurteilen, nämlich 1. Mose 19,1-29, Römer 1,24-27, 1. Korinther 6,9-10 und 1. Timotheus 1,10, finden sich, wie Sie richtig sagen, „Hinweise auf Homosexualität eher angedeutet als konkret ausgedrückt“.
Was in 1. Mose 19 verurteilt wird, ist die sexuelle Gewalt, die die Männer der Stadt Sodom den Gästen Lots androhen. Die Erwähnung der „Lustknaben“ und „Knabenschänder“ in 1. Korinther 6,9 und von „Unzüchtigen“ und „Knabenschändern“ in 1. Timotheus 1,10 lässt vermuten, dass die antike Praxis älterer Männer, sich mit heranwachsenden Jungen als Sexobjekten zu umgeben, angeprangert wird.
Und im Römerbrief geht Paulus zwar ganz selbstverständlich davon aus, dass homosexuelle Handlungen widernatürlich seien (was sich ja als kulturelles Phänomen bis in die heutige Zeit hinein erhalten hat), aber wie Sie richtig sagen, betrachtet Paulus diese (Römer 1,26) in seinen Augen „schändlichen Leidenschaften“ als (Römer 1,18) Ausdruck von „Gottes Zorn“, der „vom Himmel her offenbart [wird] über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.“
Weiterhin fragen Sie (S. 66):
„Warum verweist der katholische Katechismus auf diese eher vagen Aussagen der Bibel über Homosexualität? Wieso wird diskret ein weit konkreterer Text übergangen? Dort verurteilt die Bibel Homoerotik nicht nur als Sünde, sie fordert kurz und knapp die Todesstrafe [3. Mose 20,13]: ‚So sollen beide des Todes sterben!‘“
Um nicht vorwegzunehmen, was ich an späterer Stelle zu dieser im Alten Testament mehrfach vorkommenden Formulierung „soll(en) des Todes sterben“ ausführen werde, verweise ich dazu auf den Abschnitt T wie Todesstrafe. Hier soll es zunächst nur um das Thema der Homosexualität selbst gehen und nicht um die Frage, ob es die rechtliche Sanktion der Todesstrafe in diesem Zusammenhang wirklich gab.
Sie äußern sich hier sehr widersprüchlich. Einerseits begrüßen Sie „das Eingeständnis“ auch katholischer Theologen, „daß die Aussagen der Bibel je nach aktuellem Empfinden immer wieder neu interpretiert werden dürfen.“ Andererseits beklagen Sie, dass „die klare Aussage des ‚Alten Testaments‘ übergangen“ wird:
„Das mosaische Gesetz fordert ohne Einschränkung die Todesstrafe für homosexuellen Verkehr. Von diesem eindeutigen Gebot ist die christliche Kirche abgerückt. Als moderner Mensch kann man dies nur als Schritt in die richtige Richtung begrüßen. Unbestreitbar ist aber: Damit verliert die Bibel die Autorität als Wort Gottes. Denn wenn gestern Homosexualität mit der Todesstrafe bedroht wurde, heute aber in zunehmendem Maße als eine von mehreren Lebensformen akzeptiert wird, dann hat die Bibel als für alle Zeiten gültiges Wort Gottes ausgedient.“
Damit (ich muss mich wiederholen) verstoßen Sie erneut gegen Ihre eigene Forderung, die Bibel als Glaubensbuch zu lesen und ernstzunehmen (S. 64), „daß Glaube sich seit mehr als zwei Jahrtausenden verändert“. Es müsste nach diesen Worten doch genau in Ihrem Sinne sein, wenn ein einseitiges Verständnis von Gottes Wort als wortwörtlich inspiriert und für alle Zeiten gleichbedeutend aufgegeben wird, zumal bereits in der Bibel die einzelnen Bestimmungen der Gebote durchaus im Fluss waren, wie sich an Formulierungsunterschieden an diversen Stellen zeigt, und im Talmud die Rabbiner heftig über die Auslegung jedes einzelnen Verses streiten.
Die falsche Alternative, die Sie hier zum wiederholten Male ins Feld führen, ist letztlich eine von religiösen Fundamentalisten und Fanatikern vertretene Falle (S. 67):
„Entweder die Bibel ist Wort Gottes. Dann sind die Gebote Gottes als göttliches Gebot uneingeschränkt zu befolgen, ohne Wenn und Aber. Dann müßte aber jedes Gebot befolgt werden. Dann müßten Homosexuelle wie im mosaischen Gesetz verlangt, getötet werden. Ein solches Verbrechen wird aber kein Mensch fordern. Wenn aber einzelne Gebote weiterhin gepredigt, andere aber dem modernen Zeitgeschmack angepaßt werden, steht menschliches Wort über vermeintlichem Gotteswort.“
Genau das ist der Knackpunkt: Nicht jede Neuinterpretation des Wortes Gottes von seinem ursprünglichen Geist her in eine neue Situation hinein ist eine Verfälschung im Sinne der Anpassung an einen Zeitgeist oder Zeitgeschmack. Darum ist sehr genau zu prüfen, welche Interpretation der Bibel tatsächlich im Einklang mit dem Heiligen Geist steht, der nicht nur in der Bibel, sondern auch in unserer modernen Zeit dort weht, wo er will.
Eine solche eingehende Prüfung hat der profunde Kenner des Alten Testaments, Prof. Erhard S. Gerstenberger, im Blick auf das Thema der Homosexualität in der biblischen Tora unternommen, und ich halte es für angemessen, einen Teil seiner Ausführungen in der Veröffentlichung „Homosexualität im Alten Testament – Geschichte und Bewertungen“ der Justus-Liebig-Universität Gießen hier zu zitieren.
Zunächst (S. 154) nennt Gerstenberger die Gründe für die Verurteilung homosexueller Handlungen im 3. Buch Mose 18 und 20 und stellt sie in ihren zeitbedingten Zusammenhang:
„Die harte Verwerfung homosexueller Handlungen in Lev 18 und 20 ist … eine zeit- und strukturbedingte Maßnahme, die gleichzeitig eine Reihe von anderen sexuellen Verhaltensweisen betrifft. Der Gedanke der Verunreinigung der göttlichen Heiligkeitssphäre, die in Israel dinghaft anwesend ist, steht im Hintergrund. ln predigtartiger Ermahnung an die Gemeinde wird die Angst vor Beschmutzung und Entwürdigung der Heilszone mit der Todesdrohung überhöht.
Die Welt war nach Vorstellung der damaligen Überlieferer geteilt in einen Bereich substantieller Reinheit und die Zonen der Unreinheit. Berührung mit dem Unreinen brachte Unheil und Tod. Sexualität war in sich und von alters her ein Bereich unheimlicher Kräfte. Das Blut der Menstruierenden war gefährlich. Diese Distanz und Scheu vor der weiblichen Sexualität entstand bei Männern. Aber sie hatten in der nachexilischen Gemeinde alle Kult- und Glaubensfragen in der Hand…
Die Vorsichtsmaßnahmen gegen sexuelles Fehlverhalten sind darum als reine Männertheologie verständlich. Das gilt auch für die Beurteilung der männlichen Homosexualität, die weibliche ist den verantwortlichen Tradenten der Leviticus-Texte entweder nicht bekannt oder für sie uninteressant. Wenn aber die heterosexuelle Liebe schon katastrophale Folgen haben, d. h. ‚verunreinigen‘ kann, dann sind männliche homophile Handlungen noch unheilsträchtiger.
Sie – so mögen wir rationalisieren – bringen den männlichen Samen an einen falschen Ort; sie sind mit einer Schändung des ‚Opfers‘ verbunden; sie tragen nicht zum Erhalt der Genealogie bei; sie fordern den Zorn Gottes heraus; sie zerstören am Ende die Gemeinde: dies und viel mehr mag in der Vorstellung von der Verletzung und Verunreinigung göttlicher Heiligkeit mitschwingen. Mit Sicherheit ist der Angriff auf das Heilige das zentrale Motiv der besagten beiden Verdammungen.“
Diese Ausführungen besagen aber: Da für uns moderne Menschen all diese kulturellen Tabus gegenüber der sexuellen Sphäre nicht mehr aktuell sind, können wir sie auch als zeitbedingt hinter uns lassen, ohne die für uns wesentlichen Glaubensaussagen des Alten Testaments aufgeben zu müssen.
Noch wichtiger ist ein weiterer Abschnitt im Aufsatz von Gerstenberger (S. 153), in dem er herausstellt, warum sich diese Verurteilungen vom biblischen Gebot der Nächstenliebe her nicht auf die homosexuelle Liebe, wie wir sie in unserer Zeit kennen, beziehen:
„Bei der äußersten Kargheit des Quellenmaterials ist es schier unmöglich, gezielte Fragen über die Bewertung der Homosexualität durch die vielhundertjährige Geschichte lsraels hindurch an die Bibel zu stellen. Außerdem hat sich der Ort unseres Fragens im Fortgang der Menschheitsgeschichte verändert. Wir sehen nicht nur auf eine mehr als zweitausendjährige Leidensgeschichte homosexueller Menschen zurück…, sondern sind durch Beobachtungen und Selbstzeugnisse mit einem detaillierten Wissen über homosexuelle, dauerhafte Orientierung und zeitweise Neigungen bei einer Minderheit von 4 bis 6 % der Bevölkerung ausgestattet. Ferner wissen wir von Tausenden von Menschen, daß sie dauerhafte homosexuelle Lebensgemeinschaften, denen niemand das Attribut der hingebungsvollen, am anderen ausgerichteten Liebesbeziehung absprechen kann, suchen und aufrechterhalten. Kein einziger biblischer Text betrachtet Homosexualität unter diesem Gesichtspunkt, weil die homophile Prägung damals nicht erkannt war. Andere Minderheiten aber – Arme, Waisen, Witwen, Fremde, Tagelöhner – werden im Alten Testament sehr wohl als Randgruppen erkannt und mit Solidarität bedacht. Also werden wir in Analogie zu ihnen auch die Frage der homosexuellen Minderheit an das Alte Testament herantragen können.“
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass hier nicht Gebote einfach, wie Sie es formulieren (S. 67), „dem modernen Zeitgeschmack angepaßt werden“. Immerhin finden Sie es selber ja auch gut, dass im „konkreten Fall der Homosexualität … die explizite Aussage der Bibel (Todesstrafe!) als Irrtum des biblischen Verfassers für ungültig erklärt und ad acta gelegt“ wird – vermutlich da sie auch für Sie nicht im Einklang mit dem Glauben an einen Gott der Liebe und Gerechtigkeit steht.
Trotzdem wiederholen Sie nochmals einen Satz, den man – genau betrachtet – als inhaltslos betrachten muss (S. 68):
„Wenn aber ein einziges angeblich ‚göttliches Gebot‘ außer Kraft gesetzt werden muß und kann, dann hat damit das generelle Gebot, alle biblischen Gesetze müßten befolgt werden, an Gültigkeit verloren!“
Warum ist dies ein nichtssagender Satz? Seine logische Grundlage stimmt nicht! Nur Fundamentalisten und Fanatiker behaupten, dass alle biblischen Gesetze wortwörtlich befolgt werden müssen. Wer dagegen danach fragt, ob angeblich göttliche Gebote nach dem Gesamtzusammenhang des biblischen Glaubens wirklich im Einklang mit dem Heiligen Geist Gottes stehen, der kann durchaus zu der Einsicht kommen, dass eine ganze Reihe biblischer Bestimmungen mit Recht als zeitbedingt aufzugeben ist.
Im Übrigen kann Ihre Bemerkung (S. 67f.), dass man der „blutrünstigen Forderung der Bibel … zuletzt in großem Maßstab im Nazideutschland“ Folge leistete, „als man Homosexuelle in Konzentrationslager sperrte und ermordete“, insofern kaum zutreffen, als Nazis sich sicher nicht dem biblischen Gebot verpflichtet fühlten, das ja von den ihnen verhassten Juden stammte.
↑ Gibt es Indizien für homosexuelle Neigungen Jesu?
Ihre Vermutung (S. 68), dass ein junger Mann, der nach der Verhaftung Jesu nackt davonläuft, „auf eine bi- oder homosexuelle Neigung Jesu“ hinweisen könnte, klingt wiederum etwas sensationslüstern. Im Text steht zum Beispiel gar nicht, dass der Jüngling „sich rasch etwas über[zog], um seinem Meister zu folgen“, sondern der Text lautet kurz und knapp (Markus 14,50-52):
„Da verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt.“
Sie stellen dazu die Frage:
„Wer war dieser Nackte? Ein unscheinbares Wort im griechischen Originaltext gibt unerwartet Aufschluß, wer gemeint sein könnte. Demnach trug der Jüngling nur ein sindon. Ein sindon aber war eigentlich ein Leichentuch und kein Kleidungsstück. Soll damit auf Lazarus angespielt werden, den Jesus angeblich von den Toten erweckte [Johannes 11]?“
Das altgriechische Wort sindon ist aber von der Grundbedeutung her einfach nur ein Baumwoll- oder Leinentuch, das ganz normal als Untergewand getragen wurde.
Nach dem (S. 68f.) „Geheimen Evangelium des Markus“ allerdings, aus dem gegen Ende des 2. Jahrhundert n. Chr. der Theologe Clemens von Alexandria (30) einige Passagen zitiert, soll sich nach der Jesu Auferweckung des Lazarus vom Tode folgendes zugetragen haben (S. 69):
„Aber der Jüngling, als er ihn ansah, liebte ihn und fing an, ihn anzuflehen, daß er bei ihm sein möge. Und sie gingen aus dem Grab heraus und kamen in das Haus des Jünglings, denn er war reich. Und nach sechs Tagen sagte ihm Jesus, was er tun solle, und am Abend kommt der Jüngling zu ihm, ein leinenes Tuch über seinem nackten Körper tragend. Und er blieb diese Nacht bei ihm, denn Jesus lehrte ihn das Geheimnis des Reiches Gottes.“
Natürlich eignet sich ein solcher Text dazu, Verschwörungstheorien darüber zu entwickeln, dass die Kirche eine peinliche Enthüllung zu unterdrücken versuchte.
Allerdings ist nicht klar, ob das Geheime Markusevangelium überhaupt ein echtes Dokument aus der Antike ist, und wenn ja, dann ist es wohl in die Zeit um 100 Jahre nach Jesu Tod zu datieren, enthält also kaum Aufschlüsse über die reale Geschichte Jesu. Es kann also sein, dass bestimmte Kreise eigene Vorstellungen in die Geschichte Jesu zurückprojizieren wollten, oder vielleicht auch, dass die Person Jesu bewusst verunglimpft werden sollte.
Die Person des jungen Mannes, der voller Panik nackt entflieht, kann man aber möglicherweise mit einer anderen Person im Markusevangelium in Verbindung bringen. Die einzige Stelle, an der Markus außer in 14,51 einen neaniskos = „Jüngling“ erwähnt, ist Markus 16,5 – dort sehen die Frauen, die am Ostermorgen Jesu Leichnam einbalsamieren wollen, „einen jungen Mann“ in der Gruft sitzen, „bekleidet mit einem weißen Gewand“ (31). Als Engel wird dieser Jüngling erst von den anderen Evangelisten bezeichnet.
↑ „Hosianna in der Höhe“ oder „Befreie uns von den Römern“?
Unter (S. 70) H wie Hosianna stellen Sie in Frage, ob Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem wirklich mit den Worten „Hosianna in der Höhe“ begrüßt worden ist.
Der Ruf HOSchIˁAH NNˀA steht ursprünglich in Psalm 118,25 und bedeutet wörtlich: „Hilf jetzt!“ Aber die Zusammenstellung dieser Bitte mit den Worten „in der Höhe“, die nur in Markus 11,10 vorkommt, auf Griechisch: hōsanna en tois hypsistois, kommt Ihnen sinnlos vor (S. 72):
„Übersetzt man ‚Hosianna‘ richtig, ergibt der Ausruf zunächst überhaupt keinen Sinn mehr: ‚Hilf uns in der Höhe!‘ Einen solchen Unsinn haben die Jerusalemer mit Sicherheit nicht geschrien.“
Darum fordern Sie, den Urtext anzusehen. Allerdings liegt uns kein aramäischer oder hebräischer Urtext des Markusevangeliums vor, so dass nur eine Rückübersetzung aus dem Griechischen versucht werden kann:
„Wir müssen uns den Wortlaut im Original ansehen: ‚ba meorim‘ heißt ‚in der Höhe‘. Die Juden hofften auf Hilfe Jesu gegen die Römer. Sinnvoll wäre dann der Ausruf gewesen: ‚Steh uns bei gegen die Römer!‘ Hebräisch heißt Beistand gegen die Römer ‚Hilfe vor/von den Römern‘ – ‚mi-haromim‘. Und schon wird klar: Ein Fehler liegt vor!“
Tatsächlich ist eine solche Verwechslung denkbar. In völlig korrekter Umschrift ist die Ähnlichkeit von BaMeROMIM = „in den Höhen“ mit Mi-HaROMˀIM = „von den Römern“ sogar noch deutlicher. Allerdings kann ein Hilferuf an Gott in der Höhe ebenso plausibel sein. Ob „ein Irrtum der biblischen Chronisten“ vorliegt oder „man die Kritik an der römischen Herrschaft durch falsche Übersetzung elegant verschwinden lassen“ wollte, lässt sich also weiterhin nur vermuten, nicht beweisen.
Dass die Menschen in Jerusalem allerdings auf Jesus politische Hoffnungen setzten, ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich (S. 71):
„Die Römer wurden von den meisten jüdischen Zeitgenossen Jesu gehaßt. Sie warteten sehnsüchtig auf den Messias, der sie von dieser Plage befreien sollte. Jesus sollte die römische Oberherrschaft beenden. Die Römer sollten vertrieben werden. Ihre Diktatur sollte durch ein neues Israel ersetzt werden, in welchem nach den Vorschriften der biblischen Schriften gelebt wurde. War diese Hoffnung unbegründet?“
Sie beantworten diese Frage mit Nein, weil die Juden sich an zwei „erfolgreiche Aufstände“ erinnern konnten, zum einen den Aufstand Jehus gegen die Königsfamilie Ahabs, zum andern den Aufstand der Makkabäer gegen die Fremdherrschaft der Seleukiden.
Ob allerdings wirklich gerade diese beiden Erfahrungen in der Zeit Jesu die Grundlage für besondere Hoffnungen auf eine Beseitigung der römischen Herrschaft bildeten, ist fraglich. Die Zeit Jehus lag immerhin bereits über acht Jahrhunderte zurück, und die Herrschaft der Hasmonäer, die durch die Makkabäerkriege an die Macht kamen, war zum Schluss dermaßen ununterscheidbar geworden von der hellenistischen Despotie der Seleukiden, dass es sogar Juden gab, die im Jahr 63 v. Chr. die Eroberung des Landes durch Pompejus zunächst als Befreiung empfunden hatten.
Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass sich die Hoffnungen eher auf die großen in der hebräischen Bibel gefeierten Befreiungserfahrungen aus ägyptischer Unterdrückung und babylonischer Gefangenschaft bezogen und durch die prophetischen Verheißungen eines Messias gestützt wurden.
Jesus selbst allerdings scheint alle politischen Hoffnungen, die auf ihn gesetzt wurden, sofern sie mit einem gewaltsamen Aufstand verbunden waren, abgelehnt zu haben. Jedenfalls enthalten die Darstellungen der Evangelien, die alle nach dem Jüdischen Krieg mit dem für die Juden katastrophalen Ausgang (65-71 n. Chr.) entstanden sind, eine deutliche Kritik an zelotischen Bestrebungen, das Joch der Römer mit Gewalt abzuschütteln, und stellen Jesus zwar im Kampf gegen die römische Fremdherrschaft dar, jedoch als konsequenten Verfechter der Gewaltfreiheit.
↑ Wie alt ist das Volk Israel – was bedeutet der Name?
Zu (S. 72) I wie Israel stellen Sie mit Recht fest, dass Jakob, der Stammvater des Volkes Israel, zwei Mal von Gott den Namen „Israel“ bekommt, zum ersten Mal (1. Mose 32,29), nachdem er als fast hundertjähriger Greis mit Gott gekämpft und gesiegt hat, und zum zweiten Mal (1. Mose 35,10), als er nach Bethel zurückkehrt, wo er viele Jahre zuvor (1. Mose 28,12) im Traum die Himmelsleiter gesehen hatte.
Sie bestätigen auch (S. 74), dass „man den Namen Israel auf das hebräische Verb ‚schara‘ und ‚El‘, die Kurzform von Gott, zurückführen“ könnte, frei übersetzt mit „der mit Gott gekämpft hat“. Exakter wäre die Umschrift SsaRaH für das hebräische Wort mit der Bedeutung „streiten“.
Allerdings wundern Sie sich darüber, dass
„Jakob seinen alten Namen bei[behält] und … auch im weiteren Verlauf des biblischen Textes sehr häufig weiter als Jakob und nicht als Israel bezeichnet [wird]. … Warum? Vermutlich ist die Schilderung des Kampfes wie auch die zweite Umbenennung erst später in den Text eingeschoben worden. Deshalb behält Jakob in den älteren Texten (Geschehnisse vor und nach dem Kampf und vor und nach der zweiten Umbenennung) seinen alten Namen bei. Ersonnen hat man den Kampf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil man nachträglich dem Namen Israel einen ganz besonderen Sinn verleihen wollte. Aber welchen? Historisch ist der Sachverhalt nicht. Nach der Zeitrechnung der Bibel fand der Kampf um 2000 v. Chr. statt. Das ist wohl Wunschdenken der Verfasser, die ihrem Volk eine möglichst alte Geschichte verleihen wollten.“
Der genaue ursprüngliche Sinn des Namens Israel ist tatsächlich nicht zu ergründen. Und die erste außerbiblische Erwähnung einer Völkergruppe namens „Israel“ findet sich auf der Siegesstele des Pharao Merenptah von Ägypten aus dem Jahr 1208 v. Chr.
Dass Jakob aber neben seinem neuen Namen Israel auch weiterhin mit dem alten Namen bezeichnet wird, lässt keine Rückschlüsse auf evtl. Einschübe des Namens Israel in ältere Texte zu. In der Bibel gibt es auch noch andere Personen, die mit mehr als einem Namen bezeichnet werden, etwa Simon Petrus oder Saulus/Paulus.
↑ Wurden Jerichos Mauern mit dem Schall von Posaunen zum Einsturz gebracht?
Zu (S. 74) J wie Jericho merken Sie zunächst an, dass die Übersetzung des hebräischen Wortes SchOFaR mit „Posaune“ nicht stimmt (S. 75):
„Posaunen gab es zu biblischen Zeiten nicht. Die imposanten Instrumente machen sich aber beim modernen Leser besser als die ursprünglichen Widderhörner des hebräischen Textes.“
Es war schon Martin Luther, der vor 500 Jahren das Wort so ins Deutsche übertrug, indem er, wie er sagte, dem Volk aufs Maul schaute, damit die Leute sich eine ihnen vertraute Vorstellung von dem Geschehen machen konnten. In anderen deutschen Übersetzungen (Elberfelder, Zürcher, Einheitsübersetzung) finden wir heute allerdings die korrekten Widderhörner.
Weiterhin kommen Sie auf Experimente aus dem Jahr 1964 zu sprechen, in denen nachgewiesen wurde, dass Schall tatsächlich „massive Mauern zum Bersten bringen“ kann. Allerdings gibt es (S. 76) aus der Zeit um 1200 v. Chr. keine archäologischen Nachweise für in dieser Zeit eingestürzte Stadtmauern von Jericho. Stattdessen hatte schon mindestens drei „Jahrhunderte zuvor … ein gewaltiges Erdbeben Jericho heimgesucht, die Mauer zum Einsturz gebracht.“ Und auch weitere mit grausamen Einzelheiten erzählte Geschichten der kriegerischen Einnahme von Städten wie Ai erweisen sich durch archäologische Nachweise als (S. 78) „ebenso frei erfunden wie die Mär von der Eroberung Jerichos.“
Sie haben völlig Recht (S. 78f.):
„Versteckt in anderen biblischen Büchern finden sich Hinweise, wie der Einzug ins Gelobte Land tatsächlich ablief. Von einem schnellen Eroberungskrieg kann nicht die Rede sein. So heißt es im Buch der Richter [1,19] lapidar: ‚Dennoch war der Herr mit Juda, daß es das Gebirge einnahm; es konnte die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten.‘ Einige der angeblich geschlagenen Gegner waren in Wirklichkeit überlegen und blieben unbesiegt. Erobert wurden, wenn überhaupt, nur kleine, verstreute Gebiete, hauptsächlich im dünn besiedelten Gebirgsland.“
Mir ist die von Ihnen angeführte Vorstellung des Althistorikers Manfred Claus von der Universität Frankfurt am Main sehr sympathisch (S. 79), dass „die militante Landnahme eine erfundene Legende ist“ und sie tatsächlich eher „friedlich und zumeist ohne spektakuläre Maßnahmen“ verlief, bis nach etwa 200 Jahren „aus verschiedenen nomadisierenden Stammesverbänden nach und nach ein geschlossenes Staatsgebilde entstand.“
Und wieder einmal fragen Sie:
„Lügt also die Bibel? Wer auch immer das Buch Josua schrieb, wollte rückwirkend seinem Volk eine imposante Historie verpassen. Tatsachen scheinen nur am Rande von Interesse gewesen zu sein. Die eigenen Vorfahren sollten dank des Beistandes Gottes als unbesiegbare Helden ohne Skrupel erscheinen. Wir unterliegen einem gewaltigen Irrtum, wenn wir aneinandergereihte Geschichten mit Geschichte verwechseln!“
Mit dem letzten Satz rücken Sie den moralischen Vorwurf, der in der Frage nach der Lüge steckt, in angemessener Weise zurecht. Wir sind es nämlich, die irren, wenn wir in allen Geschichten der Bibel ohne nähere Prüfung tatsächlich geschehene historische Ereignisse sehen wollen.
Ganz richtig ist es allerdings nicht, dass die biblischen Erzähler vor allem die imposante Geschichte des Volkes und ihrer unbesiegbaren, skrupellosen Helden im Sinn hatten. Im Hintergrund stand nämlich die Vorstellung, dass der befreiende machtvolle Gott JHWH seinem Volk, das sich von der Tora der Gerechtigkeit leiten lassen sollte, ein Land geben wollte, in dem diese Tora verwirklicht werden konnte – und deswegen fanden sie, dass Gott auch das Recht hatte, dieses Land jenen Völkern mit Gewalt wegzunehmen, die sich seinem Volk in den Weg stellten.
↑ Das Buch Josua – Propaganda für die Tora Gottes
Zu (S. 79) J wie Josua beklagen Sie (S. 80) massive Eingriffe in den Text des Buches Josua, die nur deswegen vorgenommen worden seien, weil einst „am grünen Theologentisch“ entschieden wurde, dass Josua der Autor des Buches Josua gewesen sei.
„Die ursprüngliche Fassung berichtete aber über Ereignisse, die sich lange nach dem Ableben Josuas abspielten. Deshalb trennte man eine umfangreiche Passage ab und stellte sie an den Anfang des Richterbuches. … Auch heute, da es keinen Zweifel am echten Textumfang mehr gibt, wird trotzdem nicht der Text rekonstruiert. So wird ein Irrtum künstlich aufrechterhalten.“
Dieser Vorwurf ist aber nicht gerechtfertigt. Auch wenn man meint, mit guten Gründen ältere Fassungen rekonstruieren zu können, bleibt es sinnvoll, eine einmal kanonisch festgelegte Zuordnung bestimmter Abschnitte zu bestimmten Büchern beizubehalten. Wer sollte denn darüber entscheiden, welcher von vielen Vorschlägen für neue Aufteilungen biblischer Bücher verbindlich sein sollte? Schon theologische Wissenschaftler könnten sich darüber kaum einigen, und erst recht nicht die Konfessionen der Weltchristenheit.
Dann greifen Sie auf Inhalte zurück, um die es bereits im vorigen Abschnitt über Jericho ging und schreiben durchaus richtig:
„Wer glaubt, das Buch Josua sei historisch korrekt, irrt gewaltig. Man muß das Werk als Propaganda bezeichnen. Schildert doch das Buch Josua die Einnahme des Gelobten Landes als erfolgreichen ‚Blitzkrieg‘. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Die Landnahme erfolgte eben nicht als glorreicher, schneller Eroberungsfeldzug. Vielmehr sickerten die Vorfahren der späteren Israeliten im Lauf von mehreren Jahrzehnten langsam ein. Die ortsansässige Bevölkerung wurde nicht im militärischen Triumph besiegt, sondern nach und nach verdrängt.“
Ich möchte nur – ebenfalls mich wiederholend – ergänzen, dass es im Buch Josua um Propaganda für die Tora Gottes ging. Die Wegweisung der Gerechtigkeit Gottes bekommt von Gott ein Land für ihre Verwirklichung zugewiesen, allerdings mit schon von den Maßstäben der Bibel her fragwürdigen Mitteln.
Gegen die „Vertreter der ‚Und die Bibel hat doch recht!‘-Theorie“ führen Sie mit Recht ins Feld, dass es „trotz intensiver Recherche faktisch keine greifbaren archäologischen Belege“ für eine Eroberung des Landes Kanaan „im 13. und 12. Jahrhundert v. Chr.“ gibt.
Dass Sie das wiederum als Lüge bezeichnen, trifft den Sachverhalt allerdings insofern nicht unbedingt, weil man mit einer Lüge in der Regel ein bewusst verfälschendes Vorgehen bezeichnet. Aber wenn zum Beispiel (S. 81) „die Stadt Ai zur Zeit der Landnahme schon längst nicht mehr besiedelt war“ und der „in der Bibel so ausführlich beschriebene Eroberungskampf … also gar nicht stattgefunden haben“ kann, weil die „Stadt … damals ein menschenleerer Trümmerhaufen“ war, dann ist es doch auch möglich, dass die Geschichte von der militärischen Eroberung Ais erzählt wurde, um genau diesen Trümmerhaufen zu erklären – und zwar im Sinne ihres Glaubens, dass der allmächtige Gott ihnen das Land auch gegen starke Widerstände in ihre Hände geben konnte.
↑ Oder lag das Gelobte Land in Südarabien?
Dann machen Sie in Ihrer Argumentation einen überraschenden Schlenker. Eine Bemerkung des Archäologen Yigael Yadin (32): „Noch ist nicht bewiesen, daß der Teil, den man mit Ai identifiziert, tatsächlich das alte Ai ist“, nehmen Sie zum Anlass, sich mit einer ganz ungewöhnlichen Hypothese des aus dem Libanon stammenden Wissenschaftlers Kamal Salibi zu befassen. Der (S. 82) bezweifelt nämlich (33), dass sich die biblischen Geschichten bis zur Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in Palästina zugetragen haben, sondern behauptet:
„Das Gelobte Land lag nicht im Gebiet des heutigen Israel, sondern in den saudi-arabischen Provinzen Hedschas und Asir. Auf dem etwa 600 mal 200 Kilometer kleinen Areal fand der Wissenschaftler immerhin fast 80 Prozent aller biblischen Ortsnamen wieder.
Im Gebiet des heutigen Israel hingegen konnte er nur etwa fünfzehn bis zwanzig Namen biblischer Orte identifizieren.“
Ich habe mir Salibis Buch „Die Bibel kam aus dem Lande Asir“ daraufhin einmal angeschaut. Seine Schlussfolgerungen haben wirklich etwas Bestechendes, da es viele Ähnlichkeiten der Wurzeln althebräischer oder aramäischer Ortsbezeichnungen mit heutigen arabischen Bezeichnungen der Geographie gerade in dem Gebiet Saudi-Arabiens südlich von Mekka gibt. Manchmal zählt er allerdings so viele verschiedene Ortsnamen auf, die für die Lokalisierung eines bestimmten Ortes der Bibel in Frage kommen, dass man sich auch als Laie fragt, ob seine Forschungsergebnisse nicht doch darauf beruhen, dass die konsonantische Schrift der hebräischen, aramäischen und arabischen Sprache eine Vielzahl rein zufälliger Übereinstimmungen geographischer Namen ermöglicht.
Da letzten Endes auch Salibis Sicht der Geschichte Israels in die traditionelle spätjüdische Geschichte nach dem babylonischen Exil im Land Palästina einmündet, wohin angeblich auch zuvor schon sowohl Philister als auch Israeliten eingewandert sein sollen, ändert sich für den gläubigen Juden oder Christen übrigens gar nicht so viel, wenn seine Sicht der Dinge stimmen sollte.
Anders wäre das allerdings, wenn Kamal Salibi auch mit einem anderen Buch Recht hätte, das er über die angeblich wahre Identität der Person Jesu verfasste. Er geht nämlich auf Grund der Überlieferungen über Isa im Koran davon aus (34), dass im Neuen Testament „ein israelitischer Prophet namens Issa, … ein arabischer Fruchtbarkeitsgott namens Al lssa… und … der historische Jeshu“ miteinander verschmolzen seien und dass „Paulus über die wahre Geschichte Jesu“ in Arabien etwas erfahren habe, „was Petrus um jeden Preis geheim halten wollte“. Dieses Buch baut auf dem ersten auf, enthält aber weitaus mehr an verschwörungstheoretischen Gesichtspunkten, so dass man es schon deshalb nur mit äußerster Skepsis betrachten kann.
↑ Jakobs Familiengeschichte wurde romanhaft ausgestaltet
Unter (S. 83) K wie Kamele (S. 85) kommen Sie abschließend zu dem Fazit, „die Berichte über Jakob, Josef und seine Brüder als romanhafte Fiktion an[zu]sehen“, mit der (S. 83) wegen der Beschreibung des „Exodus aus dem Pharaonenreich als Tatsache“ erklärt wird, „wie denn das Volk Israel in diese mißliche Lage kam, aus der [es] nur mit Gottes Hilfe befreit werden konnte.“
Ihre Zweifel am historischen Wahrheitsgehalt dieser Berichte begründen Sie zu Recht mit folgenden Argumenten (S. 85):
„Nach der Bibel wurde Josef um 2000 v. Chr. an eine Karawane mit Kamelen verkauft, die aber erst um 1000 v. Chr. als Lasttiere benützt wurden. Die Karawane führte Harz, Balsam und Myrrhe mit sich, Produkte, die erst im 8. bis 7. Jahrhundert v. Chr. rege gehandelt wurden. Josefs Großvater Isaak begegnete laut Bibel dem König der Philister Abimelech um 2000 v. Chr., obwohl die Philister erst 1000 Jahre später in Kanaan erreichbar waren.
Sollten die Hungersnot und der Zug Israels nach Ägypten eintausend Jahre später stattgefunden haben als die Bibel behauptet? Dann müßte es erst recht außerbiblische Hinweise auf diese gravierenden Ereignisse geben. Sie fehlen aber.“
Das heißt allerdings nicht, dass alle Einzelheiten mündlich überlieferter Erzählungen von Jakob und seiner Familie erfunden sein müssen. Historische Nachweise sind jedoch nicht möglich.
↑ Warum besteht die Bibel aus zwei „Testamenten“?
Unter (S. 85) dem Stichwort K wie Kanon beschäftigen Sie sich zunächst mit der Frage, warum Christen vom Alten und Neuen Testament reden, und Sie führen diese Bezeichnungen auf Übersetzungsfehler zurück (S. 86):
„Im Hebräischen sprach man nicht vom ‚Alten Testament‘, sondern von ‚Gesetz, Propheten und Schriften‘. Für den gläubigen Israeliten waren die heiligen Texte Zeugnis für eine Vereinbarung zwischen Gott und den Menschen: Gott würde seinem Volk in allen Lebenslagen helfen, sein Volk wiederum würde ausschließlich Gott verehren und anbeten. Diese Vereinbarung bezeichnet das hebräische Wort ‚berit‘. Berit wurde ins Griechische übersetzt als ‚diatheke‘, was soviel wie ‚Anordnung‘ heißt. Ins Lateinische übertragen wurde daraus schließlich ‚testamentum‘, was wiederum falsch mit Testament übersetzt wurde. Die korrekten Bezeichnungen wären aber eher ‚Alter Bund‘ und ‚Neuer Bund‘.“
Recht haben Sie damit, dass sich durch die Übersetzung des hebräischen Wortes BəRITh = „Bund“ mit diathēkē ins Griechische und mit testamentum ins Lateinische die Bedeutung verschiebt. Zu kurz greift allerdings Ihre Argumentation am Schluss, denn auch die Bezeichnung der von den Juden selbst als TeNaK (35) bezeichneten hebräischen Bibel als „alter Bund“ wäre falsch, denn Juden erkennen in dem in Jeremia 31,31 angekündigten „neuen Bund“ eine Verheißung Gottes an ihr eigenes Volk und würden diesen nicht mit der im Neuen Testament niedergelegten Geschichte Jesu Christi und seiner Apostel identifizieren wollen.
Tatsächlich wurde die Bezeichnung „Altes Testament“ für die jüdische Bibel erst im 2. Jahrhundert n. Chr. von Christen verwendet, nachdem Theologen wie Markion die jüdischen Schriften insgesamt verwerfen wollten, weil angeblich Jesus Christus als Gott der Liebe den bösen Schöpfergott der Juden überwunden hätte. Gegen Markion entschied sich die entstehende katholische Kirche dafür, die jüdischen Schriften als „Altes Testament“ im Sinne eines verbrieften Zeugnisses von Gottes Wort anzuerkennen, in dem die Verheißung eines in Jesus Christus erfüllten „Neuen Bundes“ enthalten sei, der wiederum in den Schriften des „Neuen Testaments“ bezeugt werde.
Heutzutage gehen auch viele Christen dazu über, die Bezeichnungen „Altes“ und „Neues Testament“ nur sehr zurückhaltend zu benutzen, um den Eindruck zu vermeiden, als sei die jüdische Bibel „alt“ im Sinne von „überholt“ und als hätte Gott seinen Bund mit dem Volk Israel seit Jesus Christus aufgekündigt.
↑ Beruht der biblische Kanon auf reinem Zufall?
Das Wort Kanon führen Sie (S. 87) „auf das Hebräische ‚qanä‘ zurück, was so viel wie Richtschnur, Regel und Norm bedeutet.“ Nach Wikipedia kommt es
„von altgriechisch … kanōn, deutsch ‚gerader Stab‘, ‚Stange‘, ‚Messstab‘, ‚Richtschnur‘, daraus lateinisch canon ‚Maßstab‘, ‚festgesetzte Ordnung‘, ‚Regel‘“.
Dieses Wort hatte, wie Sie richtig sagen, für die „frühe Kirche“ zwei Bedeutungen:
„Die Bibel war Richtschnur für das menschliche Leben. Und der Kanon regelte, welche Texte in die Bibel gehören und welche nicht. Damit erfolgte eine Wertung: Die einen Texte wurden als heilig angesehen, die anderen nicht.“
Leider machen Sie gar nicht deutlich, welche konkreten Maßstäbe benutzt wurden, um eine Schrift als kanonisch anzuerkennen. Im Großen und Ganzen wurden nur solche Schriften in den Kanon aufgenommen, die (beim TeNaK) von einem Propheten JHWHs bzw. (bei der christlichen Bibel) von einem durch Jesus Christus ausgesandten Apostel stammten, weil man darin eine Garantie sah, dass aus ihnen Gottes Wort zu den Menschen sprach.
Die Entscheidung über den Umfang des TeNaK wurde von den Juden etwa im Zeitraum zwischen 200 v. Chr. und 100 n. Chr. getroffen; die Christen legten den Kanon ihrer Bibel zwischen 100 bis 400 n. Chr. fest.
Zur Rolle der sogenannten „apokryphen“ (wörtlich = „verborgenen“) Bücher schreiben Sie unter Bezugnahme auf das Judentum nicht ganz korrekt:
„Als ‚apokryph‘ bezeichnete man Texte, die man aus der griechischen Übersetzung des ‚Alten Testaments‘ übernahm. Man schätzte sie als den Glauben unterstützende Erbauungsliteratur, hielt sie aber nicht für würdig genug, in den Kanon aufgenommen zu werden.“
Erstens waren die Texte, die Sie hier meinen, gerade nicht Schriften des Alten Testaments, die ins Griechische übersetzt worden waren, sondern ursprünglich in griechischer Sprache verfasste jüdische Schriften aus der Zeit des Hellenismus (Weisheit, Tobit, Sirach, Makkabäer usw.). Sie gehörten nie zum jüdichen TeNaK, wurden aber von der entstehenden katholischen Kirche in den Kanon der christlichen Bibel übernommen. Zur griechischen Übersetzung des TeNaK, der Septuaginta, wurden diese Texte also von Christen, nicht von Juden hinzugefügt.
Darum waren zweitens die eben genannten Schriften für die katholische Kirche gar nicht apokryph, sondern kanonisch. Aus dem biblischen Kanon verbannt und in „eine Art Anhang zum Kanon“ verschoben wurden sie erst viel später durch die evangelischen Theologen der Reformationszeit. Diese nannten sie „Apokryphen“ und verstanden sie, wie Sie schreiben, im Sinne einer „den Glauben unterstützende[n] Erbauungsliteratur“.
Drittens gab es im Umfeld des Judentums und der frühen christlichen Kirche weitere religiöse Schriften, die nicht in den jeweiligen biblischen Kanon aufgenommen wurden, aber nur von den Christen „apokryph“ genannt wurden; Juden bezeichneten nicht zum Kanon des TeNaK gehörende Bücher nach Wikipedia als „außenstehend“.
Eine weitere Bezeichnung der zuletzt genannten Schriften beurteilen Sie mit dem Theologen Georg Fohrer als „unglücklich gewählt“, nämlich den Ausdruck „Pseudepigraph“ = „unter anderem Verfassernamen“. In vielen dieser Texte wird nämlich gar kein Autor angegeben, sie müssten also anonym und nicht pseudepigraphisch genannt werden.
Viel wichtiger ist aber, dass nach dem Maßstab der Pseudepigraphie auch viele kanonische Schriften nicht zum Kanon gehören dürften, da sie tatsächlich nicht von den Propheten oder Aposteln stammen, denen sie nach der jüdischen oder kirchlichen Tradition zugeordnet sind. Zum Beispiel waren die „vier Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes … ursprünglich anonym“, und auch (S. 88) „die fünf Bücher Mose sind nach heutigem Kenntnisstand der theologischen Wissenschaft nicht von Mose selbst verfaßt worden und sind demnach pseudepigraph.“
Ist dann aber nicht (S. 87) grundsätzlich „die Unterscheidung zwischen ‚kanonisch‘ und ‚nicht kanonisch‘ als willkürlich“ zu beurteilen? Sie ziehen daraus jedenfalls den Schluss (S. 88):
„Was apokryph bezeichnet wird, könnte aus rein formalen Gesichtspunkten genauso in der Bibel stehen!“
Ich nehme dagegen mit Wikipedia an:
„Die theologische und literarische Qualität vieler Apokryphen bleibt allerdings tatsächlich oft deutlich hinter den kanonischen Schriften zurück.“
Zum Beispiel enthält das vielgerühmte Thomasevangelium eine ziemlich elitäre und zum Teil abstruse Theologie, während die apokryphen Bücher Weisheit und Sirach immerhin wirklich, wie schon Luther meinte, „nützlich und gut zu lesen“ sind.
Sie aber beklagen unter Berufung auf Richard Sisson (36), dass sich
„nicht in nachvollziehbarer Weise begründen [lässt], warum schließlich 27 Texte in das ‚Neue Testament‘ aufgenommen und unzählige andere ausgeschlossen wurden. Richard Sisson: ‚Darüber wurde im vierten Jahrhundert von einer Gruppe von Kirchenführern abgestimmt. Die 66 Bücher, aus denen sich unsere geliebte Bibel zusammensetzt, wurden zur Heiligen Schrift erklärt bei einem Abstimmungsergebnis von 568 zu 563.‘
Heute kann diese Entscheidung nicht mehr nachvollzogen werden, da wir viele der Texte, die damals mit zur Auswahl standen, gar nicht mehr kennen. So erwähnt das vierte Buch Mose [21,14] ein ‚Buch von den Kriegen Jahwes‘. Und Josua [10,13] erwähnt am Rande ein ‚Buch von Jasher‘.“
Die zuletzt erwähnten Bücher spielten in dem Konzil von Laodizea, auf dem über den biblischen Kanon entschieden wurde, aber sicher keine Rolle, da sie bereits seit Jahrhunderten verschollen waren. Stattdessen ging es um jede Menge an Ergänzungen zu den kanonischen Evangelien, die diese mit immer großartigeren Wundern phantasievoll ausschmückten, oder um gnostische Abhandlungen, die Vorstellungen einer besonderen religiösen Elite vertraten, oder um einseitig ausgerichtete Schriften verschiedenster religiöser Gruppierungen.
Führten also „Zufälle … zur Zusammenstellung der Texte, die wir heute als ‚Bibel‘ kennen“, oder wurden (S. 89) genau diejenigen ausgewählt, „die nach göttlichem Ratschluß in der Bibel zu stehen hatten“? Sie schreiben: „Für welche Seite man sich entscheidet, das ist keine Frage des Wissens, sondern des Vermutens oder Glaubens.“ Ich denke (als durchaus glaubender Mensch), dass Zufälle eine Rolle bei der Zusammenstellung des Kanons gespielt haben – aber wer lässt die Zufälle zufallen, wenn nicht Gott?
↑ Falsche Fakten über biblische Könige
Zum (S. 89) Stichwort K wie Könige greifen Sie nochmals das Problem auf, dass zwar so „mancher biblische Text … den Anspruch auf geschichtliche Korrektheit“ erhebt, tatsächlich aber in den Büchern der Könige oder dem Buch Daniel „eklatante Widersprüche“ zu finden sind.
Das ist nichts Neues. Sie haben Recht. Wie andere antike Werke, die geschichtliche Ereignisse wiedergeben, müssen auch die biblischen Schriften gründlich auf die Stimmigkeit und Richtigkeit ihrer Daten hin geprüft werden.
Zum Buch Daniel möchte ich zusätzlich anmerken, dass es schon deswegen kaum als Geschichtswerk zu begreifen ist, da es eine apokalyptisch-politische Analyse von Zuständen in der Zeit des Hellenismus in eine nur unzureichend bekannte Situation der Vergangenheit zurückprojiziert (37).
↑ Wann wurde Lilith zu Adams Frau?
Unter (S. 90) L wie Lilith beschäftigen Sie sich mit einer Gestalt der jüdischen Mythologie, die zu ausschweifenden Phantasien Anlass gegeben hat. Im Alten Testament kommt sie, wie Sie mit Recht sagen „ein einziges Mal vor“.
Zu Unrecht allerdings behaupten Sie (S. 91): „Einmal taucht der Name Lilith im hebräischen Originaltext bei Jesaja [34,14] auf. In Übersetzungen sucht man ihn vergebens.“ In der revidierten Elberfelder Übersetzung von 1993 finden wir Lilit, ebenso in der Einheitsübersetzung von 1980 (mit „Nachtgespenst“ in Klammern); auch die Lutherbibel von 2017 hat die früheren Übersetzungen „Nachtgespenst“ (1984) oder „Kobold“ (1912/1545) durch „Lilith“ ersetzt.
Angeblich verschweigt nun die Bibel, dass nach (38)
„jüdischer Überlieferung … nicht wie weithin angenommen Eva die erste Frau Adams [war], sondern Lilith. Louis Ginzberg, der große Kenner uralter jüdischer Traditionen, faßte zusammen: ‚Der göttliche Beschluß, dem Adam (der von einem Gefühl der Einsamkeit befallen worden war, als die Tiere in Paaren zu ihm kamen, um benannt zu werden) eine Gefährtin zu verleihen, entsprach den Wünschen Adams. Um seine Einsamkeit zu vertreiben, wurde Lilith dem Adam als Frau gegeben. Wie er war sie aus dem Staub der Erde geschaffen worden. Sie blieb aber nur eine kurze Zeit bei ihm, denn sie bestand darauf, völlige Gleichberechtigung mit ihrem Mann zu genießen. Sie leitete ihre Rechte von ihrem identischen Ursprung ab.‘“
Sie irren allerdings insofern, als die Bibel diese erste Frau Adams gar nicht verschweigen konnte, weil die Lilith-Legende erst über 1000 Jahre später erzählt wird. Prof. Melanie Köhlmoos gibt dazu folgende Erläuterungen:
Eine gewisse Popularität erlangte die Ansicht des jüdischen Philosophen Philo (1. Jh. n. Chr.), nach dem die Menschheit zweimal geschaffen wurde, einmal als ‚Idee‘ (Gen 1) und einmal als konkrete Wesen (Gen 2). Dieses Konzept von den zwei Schöpfungen wurde sowohl im Christen- als auch im Judentum durch Antike und Mittelalter in immer neuen Variationen durchbuchstabiert.
In diesen Zusammenhang gehört das Motiv von Lilith als Frau Adams.
Belegt ist es zum ersten Mal in dem jüdischen Text aus dem Mittelalter ‚Alphabet des Jesus Sirach‘ (zwischen 700 und 1000 n. Chr.), der anscheinend eine Satire auf bestimmte Themen und Texte der rabbinischen Bibelauslegung ist.
Verständlich wird die nachträgliche Erfindung der Lilith-Legende, weil sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition zu dieser Zeit die Unterordnung Evas unter Adam als ausgemachte Tatsache gilt (vgl. zum Beispiel 1. Timotheus 2,13-14). In den Kapiteln 2 bis 4 des 1. Buchs Mose selbst wird allerdings Eva dem Adam als gleichwertiges Geschöpf auf Augenhöhe gegenübergestellt (siehe oben die letzten Absätze des Abschnitts „JHWH gegen Baal – Befreiergott gegen Besitzergott“), und es ist Eva, die viel öfter zu Worte kommt als Adam, sowohl (1. Mose 3,1-6) in der Auseinandersetzung mit der Schlange als auch (1. Mose 4,1 und 25) in der Kommentierung der Namen ihrer drei Kinder (39).
Sie spekulieren weiterhin (S. 92) über die evtl. Herkunft der biblischen Lilith in sumerischen oder babylonischen Göttermythen mit dem knappen Fazit:
„Am Anfang war die Gottheit. Sie wandelte sich zu Adams erster Frau. Im Mittelalter schließlich wurde sie ein gefürchtetes Monster“.
Damit erwecken Sie nochmals den falschen Eindruck, als ob Lilith bereits zu biblischen Zeiten als Frau Adams vor Eva eine Rolle gespielt hätte. Tatsächlich wurde Lilith, wie gesagt, erst im Mittelalter zu Adams Frau, nachdem sie bereits zuvor als dämonisches Wesen betrachtet worden war, wie Prof. Köhlmoos erläutert:
„Erst in den Texten des rabbinischen Judentums (Belege bei Frey-Anthes), d.h. vom 1. Jh. n. Chr. an wird L. auch in theologischen Texten etwas breiter erwähnt, erscheint dort jedoch ausschließlich als männerverführende Teufelin. Dass sich die Rabbinen mit ihr auseinandersetzen, zeigt, dass sie recht populär gewesen sein muss, auch wenn sie keine biblische Grundlage hat.“
↑ Ist der Auszug aus Ägypten nur ein unmögliches Märchen?
Unter dem Stichwort (S. 93) M wie Massenflucht machen Sie den zentralen Glaubensinhalt der jüdischen Religion lächerlich. Obwohl Sie genau wissen (S. 99), dass es nach Erkenntnissen des Archäologen Israel Finkelstein (40) historisch gesehen „keinen Exodus des Volkes Israel aus Ägypten gab“, tun Sie sieben Seiten lang so, als stünde und fiele damit jeglicher Sinn der Exodusgeschichte. Am Ende ziehen Sie das Fazit (S. 100):
„Die Geschichte ist schlecht erfunden. Die Zahlen passen nicht zu den inhaltlichen Behauptungen! Fazit: Die Massenflucht ist ein unmögliches Märchen!“
Aber wollten Sie nicht eigentlich die Überlieferung der Bibel besser verstehen helfen? Dazu leisten Sie zumindest hier nicht den geringsten Beitrag. Sie nehmen nämlich gerade nicht (S. 93) „die Angaben der Bibel ernst“, sondern versuchen sie gegen besseres Wissen als historische Daten zu lesen, und können der Bibel daher lauter Absurditäten nachweisen, indem Sie alle Zahlenangaben penibel miteinander auf Richtigkeit und Stimmigkeit überprüfen.
Den biblischen Autoren ging es um die Glaubenserzählung, wie der erstgeborene Sohn Gottes, verkörpert in den Nachkommen des Stammvaters Jakob = Israel, im fremden Ägyptenland groß wird und in Unterdrückung und tödliche Gefahr gerät, aus der er durch Gottes wunderbare Machttaten errettet werden muss. Diese theologische Aussage wird unter Rückgriff auf unterschiedliche Überlieferungen erzählt, wobei die Treue zur Überlieferung manchmal ebenso zu Widersprüchen führt wie die Lust an möglichst hohen Zahlen. Die Frage sollte immer sein: Was will die Geschichte vom Befreiungshandeln Gottes an seinem Volk erzählen? Welcher Gott streitet hier gegen welche fremden Götter? Worin besteht Israels Gottvertrauen, Israels Versagen, Israels Hoffnung? Und, wie schon oft gesagt, die biblischen Erzähler projizierten auch zeitgenössische Erinnerungen und Erfahrungen in diese ferne Vergangenheit zurück.
Irgendwann fragen Sie sich selbst (S. 95), wenn es historisch gesehen „die Massenflucht aus Ägypten gar nicht gegeben hat“, ob es
„dann nicht müßig [ist], herauszufinden zu versuchen, wie viele Menschen den einzelnen Generationen in der Zeit der Sklaverei angehörten? Auch wenn höchstwahrscheinlich die Geschichte erfunden ist, so muß doch angemerkt werden, daß sie in sich unlogisch ist! Aus einem Häuflein von 70 Menschen werden innerhalb einiger Generationen nicht zwei Millionen!“
Wie gesagt, es ging den Erzählern um die Glaubensgeschichte, nicht um historische Genauigkeit. Bei der Auflistung zahlenmäßiger Widersprüche haben Sie übrigens noch vergessen, dass der Aufenthalt in Ägypten einerseits nur über vier Generationen hin, nach 2. Mose 12,40 aber 430 Jahre lang gedauert haben soll.
Im Zusammenhang der unmöglich zu bewerkstelligenden „Organisation eines Marsches von zwei Millionen Menschen“ aus Ägypten heraus und durch das Rote Meer beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Vers 2. Mose 13,18, in dem es nach der Lutherbibel 1545, „in moderne Rechtschreibung übertragen“, heißt (S. 96 – alle aus der Bibel übersetzten Worte bis zum nächsten Abschnitt zitiere ich nach Ihrem Text): „Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus Ägyptenland.“ Englische Versionen benutzen noch militärischer klingende Formulierungen: „armed“ = „bewaffnet“ oder „equipped for battle“ = „ausgerüstet für die Schlacht“, oder aber sie übersetzen: „in martial array“, also „in kriegerischer Militäraufstellung“, bzw. „like a marching army“, also „wie eine marschierende Armee“. Die Lutherbibel 1984 nimmt eine weniger martialische Übersetzung vor: „Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland“, ähnlich die „New King James Version“ mit den Worten: „in orderly ranks“ = „in geordneten Reihen“. Sie akzeptieren nicht die Auskunft der „New English Translation 1996-2002“, dass das so verschieden übersetzte hebräische Wort ChaMuSchIM „unglücklicherweise ein seltenes Wort mit ungewisser Bedeutung“ sei, sondern geben sich erst mit der Übersetzung der „21st Century King James Version“ zufrieden (S. 96f.):
„And the Children of Israel went up by five in a rank out of the land of Egypt.“ Zu deutsch: „Und die Kinder von Israel zogen hinauf in Reihen zu fünf aus Ägypten.“
Daraufhin fragen Sie sich (S. 97):
„Warum verschwindet dieser klare Sachverhalt bei den meisten Übersetzungen? Vermutlich weil die Übersetzer rechnen können und die biblische Aussage als absurd erkannt haben! Man rechne mit: Wenn 2 000 000 Menschen in einer Kolonne in Fünferreihen gehen, dann gibt dies 400 000 Fünferreihen. Wenn nun die Kinder Israels extrem aufeinander gedrängt gingen, kurz hintereinander, so daß der Abstand von Mensch zu Mensch nur 25 cm betrug, dann hätte das eine Marschkolonne von 100 Kilometern Länge ergeben. Bei einem vernünftigeren Zwischenabstand von Reihe zu Reihe von einem Meter hätte das eine Kolonnenlänge von 400 Kilometern bedeutet. Leider macht der Text der Bibel keinerlei Angaben über die Abstände zwischen den Marschierenden.“
Mal abgesehen davon, dass Ihre Rechnerei außer Acht lässt, wie müßig es tatsächlich ist, die Unmöglichkeit von etwas beweisen zu wollen, von dem man weiß, dass es so nicht geschehen ist, ist die Übersetzung des Wortes CHaMuSchIM nicht wirklich so eindeutig.
Zwar ist die Grundbedeutung von ChaMeSch „fünf“, im Plural ChaMiSchIM kann es allerdings auch „fünfzig“ bedeuten. Auch dann wäre eine Kolonne von 40 000 Reihen zu 50 Menschen immer noch stolze 40 Kilometer lang gewesen. Aber selbst wenn sich der Ausdruck im militärischen Gebrauch von einer Formation in Fünferreihen herleitet (wofür ich nirgends einen Nachweis finde), bezieht er sich in Josua 1,14 und 4,12 und Richter 7,11 sehr allgemein auf die zum Kampf gerüsteten Israeliten; und solche Bilder von späteren Kriegszügen mögen in die Marschformation des aus Ägypten ausziehenden Volkes zurückprojiziert worden sein.
Abschließend weisen Sie dann auch noch nach, aus welchen Gründen es absurd wäre (S. 97), „das Wunder der Meeresteilung“ als tatsächliches historisches Geschehen nachweisen zu wollen. Dabei vergessen Sie sogar einige Einzelheiten zu erwähnen:
Nach 14,16 soll Mose den Stab erheben, nach Vers 21 und 27 erhebt er seine Hand. Nach Vers 16 und 22 wird das Meer in zwei Teile geteilt und steht wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken; nach Vers 21 weicht das Meer durch einen Ostwind zurück. Das heißt: Die biblischen Erzähler verbinden verschiedene Überlieferungen ohne Furcht vor Unlogik miteinander – denn es geht ihnen darum, die Erfahrung wunderbarer Hilfe darzustellen, wie auch immer sie zu Wege gebracht wird. Ich betone nochmals: Exakte historische Geschichtsschreibung ist auch in der Erzählung von der Massenflucht aus Ägypten nicht beabsichtigt. Wer nur danach sucht, versteht nichts von ihrem wahren Sinn (41).
↑ Verbietet Gott eindeutig Menschenopfer oder fordert er sie sogar?
Zu (S. 100) M wie Menschenopfer fragen Sie, ob in der Bibel „das Menschenopfer von Gott gefordert oder verboten“ wird. Ihre Antwort lautet: „Eindeutig läßt sich diese Frage nicht beantworten.“
Im Zusammenhang mit dem Opfer der Tochter Jephtas (Richter 11,30-40) behaupten Sie: „Jahwe akzeptiert das Opfer.“ Allerdings steht davon nichts ausdrücklich im Text (42).
Zu „Mescha, König von Moab“, der (S. 101) „seinen eigenen Sohn dem Kemos, dem Schutzgott seines Volkes, als Menschenopfer dar[bringt]“, stellen Sie fest: „Der Feind Israels besiegt das Volk Jahwes. Das Menschenopfer erweist sich als höchst wirksam.“
Dazu ist zu sagen, dass die Praxis des Menschenopfers in der Antike weit verbreitet war und auch als wirksam angesehen wurde, so dass auch anscheinend auch in Israel nur sehr schwer überwunden werden konnte (siehe oben zum Stichwort H wie Hölle oder Tal der Söhne Hinnoms in Jerusalem).
Die von Ihnen ebenfalls erwähnte Geschichte der von Gott geforderten Opferung des Sohnes Abrahams, die er dann doch nicht durchführen lässt, wird denn auch von vielen Theologen als Ausdruck der endgültigen Abschaffung aller Kinderopfer im Volk Israel gedeutet.
Allerdings reicht die Bedeutung dieses Kapitels 1. Mose 22 über eine solche Auslegung weit hinaus. Es ist weitaus vielschichtiger (43).
Möglicherweise identifizierte sich das Volk Israel in Zeiten auswegloser Bedrohung und nationaler Katastrophen wie der zweimaligen Zerstörung Jerusalems mit dem Schicksal Isaaks und fragte, indem es sich gemeinsam mit Abraham auf dem Weg zum Berg Morija wusste, ob Gott das Volk tatsächlich dem Tode preisgeben würde.
Und nicht nur für die Juden ist die „Bindung Isaaks“ ein zentraler Bestandteil ihrer Religion. Die Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn für Gott zu opfern (Sure 37, 99-111), ist sogar die Basis eines der wichtigsten Feste des Islam, des Opferfestes (44).
Muss man aber die Forderung Gottes in der Tora Israels (2. Mose 22,28), „daß ihm der erstgeborene Sohn zu ‚geben‘ sei“, von Hesekiel 20,25f. her interpretieren, wie Sie es tun? Dort gibt Gott ja zu, dass er dem Volk Israel, weil es ihm ungehorsam war, praktisch auch schlechte Gebote auferlegte, um es zu strafen:
„Darum gab auch ich ihnen Gebote, die nicht gut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten, und ließ sie unrein werden durch ihre Opfer, als sie alle Erstgeburt durchs Feuer gehen ließen, damit ich Entsetzen über sie brachte und sie so erkennen mußten, dass ich der HERR bin.“
Sie urteilen (S. 102):
„Gott forderte demnach unmenschlichen Gehorsam von seinem Volk. Zum Bild eines gütigen, gnädigen Gottes paßt das nicht!“
Allerdings passt die Wahrnehmung solcher dunkler Seiten im Gottesbild der Israeliten durchaus zu den Glaubenserfahrungen von Menschen, sie sich der Güte ihres Gottes eben nicht immer sicher sind, und zu den tatsächlichen historischen Erfahrungen in Israel, denn es gab nun einmal auch in Israel Kinderopfer. Vielleicht spiegelt der aus Hesekiel zitierte Vers genau den Kampf der Propheten gegen den tief verwurzelten Volksglauben wider, dass ohne Kinderopfer das Volk seinen Feinden hilflos ausgeliefert wäre.
Dass das Gottesbild in Israel immer in Bewegung war, zeigt auch die bereits erwähnte Abrahamsgeschichte, die letzten Endes das stärkste Argument für die Ablösung des Menschenopfers bildete.
Insofern wird zwar sowohl in 2. Mose 22,28 als auch in 2. Mose 13,1-2 die Heiligung der Erstgeburt „bei Mensch und Vieh“ für JHWH gefordert. Aber zugleich legt die Tora fest, dass diese Erstgeburt im Falle des Menschen nicht als Opfer für JHWH getötet werden darf. Stattdessen soll der gesamte Stamm Levi nach 4. Mose 3,12 und 8,16 „statt der Erstgeburt aller Israeliten“ JHWH gehören, indem er Priesterdienst für ihn leistet. Auf diese Weise erfahren die Israeliten ihren Gott letztendlich doch eindeutig als den befreienden Herrn, der ihnen gütig und gnädig zugewandt ist.
↑ Michal: Fünffache Mutter ohne Kinder?
Zu (S. 102) M wie Michal stellen Sie mit Recht fest, dass im Blick auf die patriarchalische Gesellschaftsstruktur „die Bibel ein Dokument der Gesinnungen ihrer eigenen Zeit ist“, denn Michal, die „Tochter des ersten Königs über alle Stämme Israels wurde als ohnmächtige Kreatur von ihrem Vater wie eine Schachfigur hin- und hergeschoben.“
Außerdem unterstellen Sie der Bibel widersprüchliche Angaben über die Mutterschaft der Michal (S. 103):
„An einer Stelle heißt es, daß sie keine Kinder hatte [2. Samuel 6,23]: ‚Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes.‘
Im gleichen biblischen Buch heißt es aber auch [2. Samuel 21,8]: ‚Also nahm der König … die fünf Söhne von Michal, der Tochter Sauls, die sie … geboren hatte.‘“
Angeblich greifen nun „manche Bibelausgaben zu einem Trick“, um „diesen Widerspruch verschwinden zu lassen“:
„Im hebräischen Text steht zwar eindeutig, daß Michal fünf Söhne hatte. Trotzdem machen sie aus Michal Merab. Man greift zu einer kuriosen Hilfskonstruktion: Michal hatte keine Kinder. Aber ihre Schwester Merab, Frau des Adriel, hatte welche. Michal adoptierte die Söhne der Schwester und zog sie auf. Warum sollte sie ihrer eigenen Schwester die Kinder weggenommen haben?
Liest man aber den Bibeltext genau, so stellt man fest, daß diese ‚Erklärung‘ nicht mit der Bibel übereinstimmt: ‚Also nahm der König … die fünf Söhne von Michal, der Tochter Sauls, die sie … geboren hatte.‘ Michal wird eindeutig als leibliche Mutter bezeichnet. Von Adoption der Kinder der Schwester ist nirgendwo die Rede.“
Ich musste Sie so ausführlich zitieren, um deutlich zu machen, an welchen Stellen Sie sich hier im Irrtum befinden.
Das ganze Problem ist in diesem Fall nämlich eindeutig nur ein scheinbares. Adoptiert hat Michal die Kinder ihrer Schwester tatsächlich nicht. Aber in 2. Samuel 21,8 hat ein Abschreiber der Bibel schlicht und einfach die beiden Namen verwechselt und aus der Mutter der fünf Kinder fälschlich Michal statt Merab gemacht 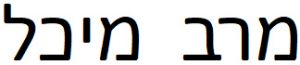 (wie ähnlich die beiden Namen im Hebräischen sind, zeigt die nebenstehende Grafik – rechts steht M-R-B, links M-I-CH-L. Dass hier tatsächlich ein Abschreibfehler vorliegt, lässt sich dadurch belegen, dass es auch Kodices gibt, in denen Merab steht, erst recht aber wird die leibliche Mutterschaft Merabs für diese fünf Kinder durch 1. Samuel 18,19 bestätigt:
(wie ähnlich die beiden Namen im Hebräischen sind, zeigt die nebenstehende Grafik – rechts steht M-R-B, links M-I-CH-L. Dass hier tatsächlich ein Abschreibfehler vorliegt, lässt sich dadurch belegen, dass es auch Kodices gibt, in denen Merab steht, erst recht aber wird die leibliche Mutterschaft Merabs für diese fünf Kinder durch 1. Samuel 18,19 bestätigt:
„Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriël von Mehola zur Frau gegeben.“
Eben diesem Adriël hat aber die in 2. Samuel 21,8 genannte Frau ihre fünf Söhne geboren – seinen Namen lassen Sie allerdings an beiden Stellen, an denen Sie diesen Vers zitieren, mit Hilfe von Pünktchen einfach aus. Michal hat also keineswegs ihrer Schwester die Kinder weggenommen. Aber nach Ihrer Version müsste sie ihrer Schwester den Mann weggenommen haben, wenn sie tatsächlich die Mutter seiner fünf Kinder gewesen wäre.
Daher ist Ihr schön klingendes Fazit: „Michal war also – laut Bibel – eine fünffache Mutter ohne Kinder“ ein Irrtum. In Wirklichkeit war Michal kinderlos, aber eine Tante von fünf Neffen, die ihre Schwester Merab ihrem Ehemann Adriël geboren hatte.
↑ Herrschte in Israel schon immer der Monotheismus?
Unter (S. 104) M wie Monotheismus fragen Sie sich (S. 105), warum Gott in 1. Mose 1,26 in der Mehrzahl spricht: „Lasset uns Menschen machen“. Und Sie stellen mit Recht fest:
„Der Gott, der im deutschen Text am Anfang Himmel und Erde schuf, verwandelt sich im Hebräischen zum Mehrzahlwort: Elohim.“
Ein klassischer „Pluralis majestatis“, bei dem „Subjekt und Verb beide im Plural“ stehen, liegt in 1. Mose 1,1 allerdings nicht vor:
„Elohim heißt wörtlich ‚Götter‘, also Mehrzahl. Buchstabengetreu übersetzt: ‚Am Anfang schuf Götter Himmel und Erde.‘ Das Subjekt steht in der Mehrzahl, das Verb aber in der Einzahl.“
Wie ist das zu erklären? Zunächst einmal ist das Wort El oder Elohim (die exakte Umschrift lautet ˀÄLoHIM) der allgemeine hebräische Ausdruck für Gott oder Gottheit, während Baal, Aschera, Jahu oder später JHWH als Namen für die besonderen Götter der verschiedenen Völker gebraucht werden.
Im Hebräischen ist ˀÄLoHIM die Mehrzahl des Wortes ˀÄLOHa = „Gott“. Wenn das Wort für die (in den Augen der Juden falschen) Götter anderer Völker gebraucht wird, meint es auch wirklich „Götter“. Da der Gottesname JHWH im Judentum aber grundsätzlich nicht ausgesprochen wird, bezeichnet man auch den Einen Gott Israels sehr häufig mit der Pluralform ˀÄLoHIM, zugehörige Tätigkeitswörter und Beifügungen stehen dabei aber normalerweise (nicht immer) in der Einzahl. Dass mit ˀÄLoHIM der Gott Israels gemeint ist, wird entweder mit Hilfe des bestimmten Artikels (HaˀÄLoHIM = „der Gott“) oder durch besondere Ergänzungen (zum Beispiel „Gott der Treue“) eindeutig klargestellt.
Das heißt: Das Wort ˀÄLoHIM in der Bibel ist mit „Gott“ oder „Götter“ zu übersetzen, je nachdem, ob ein einzelner Gott, speziell der Gott Israels, oder die Götter anderer Völker gemeint sind.
In gewisser Weise haben Sie also Recht (S. 106), wenn Sie schreiben:
„Die Spuren des Vielgottglaubens sind im ‚Alten Testament‘ nicht zu übersehen. An den alten Vielgottglauben erinnern auch die Elohim. Geschickt setzte man die Mehrzahlbezeichnung Elohim (Götter) mit dem monotheistischen Ein-Gott gleich. Der Göttername blieb und mit ihm die Erinnerung an polytheistische Viel-Götter-Zeiten.“
Man könnte aber auch sagen: Indem der Begriff Elohim mehr und mehr ausschließlich für den einen Gott JHWH als wirklich legitim und angemessen angesehen wurde, weil alle anderen Götter in Wirklichkeit gar keine Götter waren, wird die Erinnerung an die alten Götter tendenziell ausgelöscht.
Das bestätigen Sie selbst (S. 106), indem Sie unter Berufung auf eine persönliche Mitteilung von Prof. Schindler-Bellamy schreiben, dass Jahwe „alte Felsheiligtümer“ übernahm, „um die Erinnerung an andere Gottheiten auszulöschen“, und deshalb „Jahwe häufig als ‚Fels‘ bezeichnet“ wird, etwa in Psalm 18,3 oder 62,7.
Für die Zeit Israels vor dem babylonischen Exil stimmt allerdings Ihre Einschätzung (S. 105):
„Die Existenz von Göttern wird im ‚Alten Testament‘ nicht geleugnet. Jahwe verbietet aber jeden fremden Götterkult.“
Nicht ganz korrekt formulieren Sie: „Verboten ist auch die Herstellung von Bildnissen anderer Götter [2. Mose 20,23]“, denn auch die Herstellung von Bildnissen für den eigenen einen und einzig wirklichen Gott ist in der Bibel streng verboten. Gerade die von Ihnen erwähnte (S. 106) „Anbetung des ‚goldenen Kalbes‘ [2. Mose 32]“ unmittelbar nach der Befreiung „aus der ägyptischen Sklaverei“ wird ja streng bestraft.
Richtig (S. 105) stellen Sie wiederum fest: Fremde Götter
„sollen vergessen werden, ihre Namen dürfen nicht mehr ausgesprochen werden, ihre Statuen sollen zerstört werden. Jahwe beansprucht für sich allein Verehrung und Gebet.“
Wichtig dabei ist aber, wie ich schon mehrfach betont habe: JHWH wird zum Gegner aller anderen Götter, weil er ein Gott der Befreiung und Gerechtigkeit ist. Er steht gegen die Götter der Unterdrückung und Ausbeutung und will (nach der Vorstellung der biblischen Erzähler!) auch in Israel keinen König legitimieren, der so ist wie die Herrscher in Assur, Babel und Ägypten.
Dennoch widerspreche ich Ihrem Satz (S. 105)
„Noch zu Zeiten des streng monotheistischen Jahwekults wurden im Heiligen Land auch andere Götter verehrt“
nur insofern, als es um die alleinige JHWH-Verehrung in der nationalen Realität der Königreiche Israel und Juda sogar noch schlimmer stand: Sie war wahrscheinlich bis vielleicht auf die Zeit der Könige Jehu, Hiskia oder Josia nur eine Forderung oppositioneller Propheten und ihrer Anhängerschaft.
Es stimmt also auch, was Sie auf Seite 107 sagen:
„Die anderen Götter neben Jahwe waren in der Glaubenswelt Israels fest verwurzelt.“
Die unmittelbar folgenden Sätze sind allerdings in doppelter Weise wiederum nicht ganz richtig:
„Eine umfassende, wissenschaftlich erschöpfende Erforschung des Vielgottglaubens im alten Israel steht noch aus. Wird sie je geschrieben werden? Das scheint unwahrscheinlich. Weder in der Theologie noch in der theologischen Forschung der Universitäten ist ein echtes Interesse an den Wurzeln des Eingottglaubens im Vielgottglauben zu erkennen.“
Erstens gibt es durchaus Theologen, die sich mit dem Vielgottglauben im alten Israel beschäftigt haben, so zum Beispiel Erhard S. Gerstenberger (45), der bereits im Jahr 1988 auf das Zusammenspiel zwischen Jahwe und seine Aschera eingeht und Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollen und dem Bild von Gott, das man sich macht, beschreibt.
Zweitens ist es fraglich, ob man wirklich sagen kann, dass der Eingottglaube seine Wurzeln im Vielgottglauben hatte. Höchstens insofern, als der israelitische Glaube an JHWH sich aus dem Protest gegen alle als Unterdrücker und Ausbeuter wahrgenommenen anderen Götter heraus entwickelt hat.
Zur (S. 106) von Ihnen angenommenen Verschmelzung der Verehrung Baals mit dem Kult für JHWH verweise ich auf das, was ich dazu bereits unter B wie Baal dargelegt habe. Ebenso möchte ich zu Ihrer Verurteilung (S. 108f.) des Königs Jehu als „scheinheilig“, weil er angeblich nur „blutig … unter den Baalsjüngern“ wütete, „andere Götterkulte“ aber „weiter bestehen“ ließ, auf meine Ausführungen zum Abschnitt A wie Ascherah verweisen.
↑ Ist in der Bibel Mord im Auftrag Gottes in Ordnung?
Zu (S. 108f.) M wie Mord stellen Sie fest:
„Mord wird im ‚Alten Testament‘ mit der Todesstrafe geahndet. Gleichzeitig aber ist Mord gestattet, wenn er den Zielen Jahwes dient. Selbst heimtückische Bluttat wird dann offensichtlich als gottgefällig angesehen.“
Als Beispiel führen Sie (S. 109) die Tötung Siseras durch Jaël mit einem Holzpflock an (Richter 4,21), erwähnen allerdings nicht den Hintergrund dieser Tat. Sie trägt nämlich dazu bei, eine zwanzig Jahre lange gewaltsame Unterdrückung Israels durch den Herrscher Jabin (Richter 4,2) zu beenden. So kann Jaëls Tat mit der Entscheidung Dietrich Bonhoeffers verglichen werden, sich an einem Attentat gegen Hitler zu beteiligen und dem Rad tausendfacher Gewalt in die Speichen zu fallen. Ähnlich ist es mit dem Attentat auf den mit Gewalt und Unterdrückung herrschenden König Abimelech, das ebenfalls von einer Frau verübt wird (Richter 9,53f.).
In 2. Könige 9,33f. wiederum ist es Königin Isebel, die auf Befehl des für JHWH eifernden Königs Jehu getötet wird und deren sterbliche Überreste (S. 110), wie es der Prophet Elia im Auftrag Gottes angekündigt hatte, von Hunden gefressen werden. Sie und ihr Mann, König Ahab, sind beispielhaft für den Kampf zwischen JHWH und Baal bzw. Ascherah. Es ist allerdings nicht angemessen, diesen Kampf nur als einen Religionskrieg zu interpretieren. Als Widerspiegelung von sozial-revolutionären Umwälzungen kann man die verübten Grausamkeiten zumindest in Ansätzen nachvollziehen, wenn auch aus unserer Sicht in einer ganz anderen Zeit und Situation nicht unbedingt akzeptieren.
In diesem Sinne schreiben Sie (S. 110):
„Für den Gläubigen zu Beginn des dritten nachchristlichen Jahrtausends sind kriegerische Grausamkeiten und mörderisches Gemetzel eher Teufelswerk. Der gläubige Bibeltextautor lebte in einer über weite Zeiträume von Kriegen gekennzeichneten Zeit. Er sah Gottes Wirken auch im Krieg. Den ‚Guten‘ half Gott, den ‚Bösen‘ setzte er in oft unmenschlicher Weise zu.“
Damit bewegen Sie sich schon einen Schritt in die richtige Verständnisrichtung. Aber nicht um abstrakt Gute oder Böse ging es in der Bibel, sondern um Unterdrückte, die Freiheit und Gerechtigkeit erkämpfen wollten, bzw. um das nackte Überleben gegen Despoten.
↑ Wer schrieb die fünf Bücher Mose – wenn nicht Mose?
Zum Stichwort (S. 111) M wie Mose stellen Sie zunächst mit Recht fest, warum Michelangelo ihn mit Hörnern gemalt hat. In den drei Bibelversen 29, 30 und 35 aus 2. Mose 34, in denen Moses Gesicht beschrieben wird, wie es „nach seiner Begegnung mit Gott strahlte“, wurde nämlich das Wort, das in seiner hebräischen Grundform QaRaN mit „strahlen“ zu übersetzen ist, durch den Kirchenlehrer Hieronymus fälschlich mit „behornt“ ins Lateinische übertragen, wahrscheinlich weil QaRaN in der Form des Hifil tatsächlich „mit Hörnern versehen“ bedeutet (wie in Psalm 68,32).
Weiterhin haben Sie auch mit folgender Behauptung Recht (S. 112):
„Den biblischen Mose hat es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als historische Gestalt gar nicht gegeben. Demnach kann er auch nicht die nach ihm benannten ‚fünf Bücher‘ geschrieben haben. Sie stammen auch nicht aus der Feder eines einzelnen Verfassers, vielmehr gehen sie auf eine Vielzahl von Autoren aus unterschiedlichen Zeiten zurück.“
Allerdings (S. 114) scheint Mose schon in der Antike nicht unbedingt als Verfasser der fünf Bücher Mose gegolten zu haben, sondern „als der Mann, der die Gebote Gottes niederschrieb“.
In der Neuzeit (S. 117) kam die historisch-kritische Erforschung der Bibel zu dem Ergebnis, dass die „fünf Bücher Mose … das Ergebnis eines komplizierten Prozesses [sind], der jahrhundertelang währte“. Die von Ihnen dargestellte Vierquellenhypothese allerdings, derzufolge die fünf Bücher Mose aus vier zwischen dem 9. und 5. Jahrhundert v. Chr. verfassten Quellen (Jahwist, Elohist, Deuteronomium und Priesterschrift) zusammengefügt worden sind, wird am Anfang des 3. Jahrtausends kaum noch in dieser Form vertreten. Der Alttestamentler Erhard S. Gerstenberger (46) etwa geht nicht mehr von Quellenschriften mit so hohem Alter aus, sondern von einem komplexen Überlieferungsprozess, der seinen schriftlichen Niederschlag um das babylonische Exil herum gefunden hat. Erst unter persischer Oberherrschaft entstanden nach Gerstenberger die Grundvoraussetzungen für die Abfassung der meisten Texte der hebräischen Bibel.
Doch noch einmal zurück zu Mose und speziell zu Ihren Bemerkungen über seine Geburtsgeschichte (S. 112): Wenn die MoseGestalt unhistorisch ist, dann sind auch Ihre Spekulationen überflüssig, ob die Israeliten in Ägypten „davon überzeugt [waren], daß der Nil unter dem Schutz einer mächtigen Göttin stand“. Auf der Erzähl-Ebene der biblischen Geschichte vertraut die Mutter des Mose natürlich nicht auf eine Göttin des Nils, sondern auf den Gott Israels.
Im Zusammenhang damit, dass die ägyptische Prinzessin, die den kleinen Mose rettet (S. 113), ihm den hebräischen Namen MoSchäH gibt, der auf das Wort MaSchaH = „(aus dem Wasser) herausziehen“ zurückgeführt wird, erinnern Sie sich daran, dass die Geschichte schon deswegen nicht historisch sein kann, weil „eine Ägypterin höchsten Ranges … niemals einem Findelkind einen hebräischen Namen verpaßt“ hätte. Allerdings gibt es durchaus Historiker, die den Namen Mose mit ägyptischen Wurzeln in Verbindung bringen, da es ja auch Pharaonen mit dem Namen Ahmose, Kamose oder Thutmosis gegeben hat.
Den Ursprung der Geschichte von der Rettung Moses führen Sie mit Recht auf „eine Biographie des legendären Königs Sargon von Babylonien“ zurück, von dem „etwa 2300 v. Chr.“ erzählt wurde:
„Meine Mutter empfing mich, sie brachte mich im geheimen zur Welt. Sie legte mich in ein Rohrkörbchen, mit Pech versiegelte sie den Deckel. Sie übergab mich dem Fluß, der mich nicht verschlang.“
↑ Noah: Die Flutstory – ein Plagiat?
Zu (S. 118) N wie Noah stellen Sie zwei Behauptungen auf, die im Großen und Ganzen stimmen, erstens (S. 120):
„Die Story um Noah ist kein Tatsachenbericht. Sie spiegelt die Vorstellung wider, daß der Mensch nach und nach immer sündhafter wurde und deshalb von Gott bestraft wurde.“
Zweitens schreiben Sie über die Herkunft der Noah-Überlieferung, ebenfalls grundsätzlich zutreffend (S. 118):
„Hat sich der unbekannte Autor der Sintflut-Story die Geschichte einfach ausgedacht? Nein, er hat sie abgeschrieben. Als Vorlage diente das babylonische ‚Gilgameschepos‘.“
Dabei kann man das Wort „abgeschrieben“ allerdings nur als saloppe Ausdrucksweise durchgehen lassen. In Wirklichkeit hat natürlich der biblische Erzähler nur Motive der babylonischen Mythologie übernommen und im Sinne des biblischen Glaubens an den Einen Gott umgestaltet – etwa wie Ulrich Hub und Jörg Mühle in ihrem Kinderbuch „An der Arche um Acht“ die Noah-Geschichte tiefsinnig weiter ausspinnen oder wie Thomas Mann in seinem Roman „Josef und seine Brüder“ die entsprechenden Partien aus dem 1. Buch Mose auch nicht nur „abgeschrieben“ hat.
Im Gilgamesch-Epos (Elfte Tafel) erfährt zum Beispiel Utnapischtim nur deswegen von dem Plan der „großen Götter…, eine Sintflut kommen zu lassen“, weil es ihm der „klarsichtige Gott Ea“ gegen den Willen der anderen Götter offenbart hat (47). Die Menschen sind im Grunde Spielbälle im großen Schicksalsspiel der Götter.
In der Bibel dagegen steht die Sintflutgeschichte unter dem Leitgedanken, welche Entscheidung des Einen Gottes über die Menschheit angesichts ihrer bleibenden Bosheit angemessen ist – entweder (1. Mose 5,5-7) Ihre Erschaffung zu bereuen und sie zu vernichten, oder (1. Mose 8,21-22) Vergebung walten zu lassen und auf Grund des Vertrauens von Menschen wie Noah der Menschheit, „solange die Erde steht“, noch eine neue Chance zu geben.
Nebenbei möchte ich anmerken, dass Werner Papke die Überlieferungssituation zwischen der Noah-Geschichte und dem Gilgamesch-Epos umzukehren versucht, und zwar unter anderem auf Grund der Einzelheiten, die Sie wie folgt skizzieren (S. 119):
„Utnapischtim schickt nacheinander drei Kundschafter los: eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben. Letzterer zeigt an: Land in Sicht! Utnapischtim opfert dankbar den Göttern.“
Nach Papke lassen sich die meisten Einzelheiten des Gilgamesch-Epos in den Sternbildern des 24. Jahrhunderts v. Chr. wiederfinden – Taube und Rabe allerdings nicht, während die Schwalbe zum damaligen Sternenhimmel gehörte. Er zieht den Schluss (48):
„Offensichtlich gehörte die Aussendung des Raben und der Taube im 24. Jahrhundert v. Chr. bereits zum festen Bestand der Sintflutgeschichte, so daß der Dichter des Gilgamesch-Epos sie als allbekannt erwähnen mußte, obwohl Rabe und Taube astronomisch nicht realisierbar sind! Andererseits mußte die Schwalbe (SIM.MACH) aus astronomischem Grund nachträglich (!) in die Sintfluterzählung des Epos integriert werden…
Die Bibel berichtet uns das Sintflut-Ereignis ohne allen sekundären astronomischen Ballast! Wenn der Genesis-Bericht der Sintflut immer genau dort vom Epos abweicht, wo im Epos aus astronomischem Grunde etwas hinzugefügt werden mußte – wie im Falle der Schwalbe (SIM.MACH)…, dann ist es sehr unwahrscheinlich, daß die akkadische Sintfluterzählung die Vorlage für den biblischen Bericht gewesen ist, wie es in theologischen Kreisen seit über hundert Jahren immer noch behauptet wird. Vielmehr muß die Sintfluterzählung des Gilgamesch-Epos bereits auf eine ältere Vorlage zurückgehen, die dem biblischen Bericht bis in Details hinein entsprach, im Epos aber aus astronomischen Erwägungen nachträglich verfälscht worden ist.“
Ich behaupte nicht, dass Werner Papke Recht hat, wenn ich auch seine Argumentationen in vieler Hinsicht bestechend finde. Sein Buch ist allerdings ein Beleg dafür, wie unterschiedlich im Blick auf antike Überlieferungen geurteilt werden kann.
Zurück zu Ihrer Betrachtung des Gilgamesch-Epos. In ihm kommt nicht nur mit Utnapischtim eine parallele Figur zu Noah vor, sondern Sie sehen in der Heldengestalt des Enkidu, der von der Göttin Aruru aus Ton erschaffen wird, eine Parallele zu Adam, den Gott in der Bibel aus Erde vom Acker formt (S. 121):
„Adam ist kein biblisches Original, sondern nur Kopie. Adam, das biblische Pendant zu Enkidu, hat einen sumerischen Namen, der auf ‚adamah‘ zurückgeführt werden kann. ‚Adamah‘ bedeutet ‚Lehm, Erdklumpen‘.“
Wiederum stimmt es nicht, dass Adam „nur“ Kopie ist. Dass Götter Menschen aus Lehm formen, ist in antiken Mythologien so weit verbreitet, dass nicht einmal sicher ist, ob sich die Erzählung von Adam überhaupt auf die Erschaffung von Enkidu zurückbezieht. Die amerikanischen Mayas (49) etwa beschreiben „in der sogenannten ‚Maya-Bibel‘ – dem Popul Vuh“ die Erschaffung der Menschen aus „Erde“, die allerdings im Gegensatz zum Schöpfungsbericht der hebräischen Bibel zu einem Misserfolg führt:
„Aus Erde machten sie des Menschen Fleisch. Aber sie sahen, dass es nicht gut war. Denn es schwand dahin, es war zu weich, es bewegte nicht den Kopf, das Haupt hing zu einer Seite, der Blick war verschleiert, es konnte nicht rückwärts blicken. Wohl sprach es, aber es hatte keine Vernunft. Bald weichten es die Wasser auf, und es sank dahin.“
Mehr Ähnlichkeiten zur biblischen Erschaffung Adams als dieser Mythos weist auch die sumerische Enkidu-Story nicht auf. Zum Beweis zitiere ich nur ihren Anfang, wie Werner Papke ihn zusammenfassend wiedergibt (50):
„Die Handlung selbst beginnt damit, daß Gilgamesch, der ‚Hirte‘ von Uruk, kraftstrotzend wie ein ‚Wildstier‘ die Einwohner Uruks bedrängt. Sie klagen den Göttern ihr Leid und werden erhört. Die Göttin Aruru erschafft dann auf Befehl des Anu, des höchsten Gottes, den Enkidu, einen vollkommenen Helden, der vom Gebirge herabkommt und in der Steppe mit den Tieren in friedlicher Eintracht lebt. Er befreit sie aus den gefährlichen Fallen eines Jägers, nährt sich von Kräutern und Früchten und eilt ohne Scheu mit dem Wild zur Tränke.
Der aufgebrachte Jäger beklagt sich erst bei seinem Vater und dann bei Gilgamesch über Enkidu und erhält den Rat, die Dirne Schamchat mit zur Tränke zu nehmen. Sie soll Enkidu mit ihren verführerischen Künsten dem freien Leben in der Natur entfremden. Enkidu erliegt den weiblichen Reizen und teilt sechs Tage und sieben Nächte mit der Dirne das Lager.“
Mehr ist wohl nicht nötig, um zu zeigen, dass der biblische Schöpfungsbericht davon wahrlich keine bloße Kopie ist. Die einzigen Zeilen, die man halbwegs als Parallele zur Adam-Geschichte betrachten könnte, beziehen sich im Gilgamesch-Epos (Erste Tafel) auf das Material, aus dem die Göttin den Enkidu erschafft (51):
„33. Als Aruru dies vernahm, schuf sie in ihrem Inneren ein Ebenbild des Anu.
34. Die Hände wusch Aruru sich, kniff Lehm sich ab und legt‘ ihn in die Steppe.“
Von daher würde ich Adam nicht einmal als „Pendant zu Enkidu“ bezeichnen wollen. Und ob Adams Name tatsächlich sumerischen Ursprungs ist, finde ich jedenfalls in keinem hebräischen Wörterbuch. Im Gesenius (52) wird ˀADaMaH als genuin hebräisches Wort aufgeführt und lediglich mit dem assyrischen Wort „admânu Gebäude, Haupt“ in Verbindung gebracht. Im Gilgamesch-Epos taucht der Name Adam jedenfalls überhaupt nicht auf.
↑ War Onan ein Sünder oder ein biblisches Justizopfer?
Unter (S. 120) O wie Onan begehen Sie selber eine ganze Menge Irrtümer, indem Sie versuchen, der Bibel Irrtümer nachzuweisen. Sie waren ja auf Onan bereits unter F wie Fruchtbarkeit eingegangen. Dort hatte ich bereits erwähnt, dass Onan nicht nur nichts mit Onanie, sondern auch nichts mit dem modernen Problem der Empfängnisverhütung zu tun hatte. Onans Vergehen bestand vielmehr darin, dass er den Vollzug der Levirats- oder Schwagerehe verweigerte, also seine Pflicht, einem verstorbenen Bruder Nachwuchs zu verschaffen.
Darauf gehen Sie allerdings mit keinem Wort ein. Sie tun so, als sei (1. Mose 38,8) Judas Anweisung an seinen zweiten Sohn Onan, mit seiner zur kinderlosen Witwe gewordenen Schwiegertochter Thamar Kinder zu zeugen, ein willkürlicher Befehl.
Und dass (1. Mose 38,9-10) Gott den Onan zur Strafe für seinen Ungehorsam sterben lässt, beurteilen Sie dementsprechend erst recht als ungerecht, denn (S. 121):
„Die ‚mosaischen Gesetze‘ existierten ja noch gar nicht, konnten ihm noch gar nicht bekannt sein. Erst Mose bekam sie viel später von Gott diktiert und machte sie publik. Mußte Onan sterben, weil nach einem späteren Gesetz [5. Mose 21,18] widerspenstige Söhne gesteinigt werden mußten?“
Damit aber nicht genug. Sie werfen sowohl Juda als auch Gott zusätzlich vor, Onan in eine unausweichliche Double-Bind-Situation zu verstricken, denn nach 3. Mose 20,21 gilt ja das Gebot (S. 121):
„Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet.“
Daraus ziehen Sie den Schluss:
„Wie sich Onan auch entscheiden würde, er würde gegen ein göttliches Gebot verstoßen, das ihm gar nicht bekannt war. Wenn er sich widerspenstig dem Vater widersetzte, war er nach göttlichem Gesetz zu steinigen. Gehorchte er dem Vater, verstieß er gegen das Gebot der Schwagerehe.
Warum mußte Onan also sterben? Weil er ohne es zu wissen ‚sündigte‘? Oder weil er gegen ein mosaisches Gesetz verstieß, das er noch gar nicht kennen konnte? Wobei er, wie er auch handeln würde, immer gegen ein ‚göttliches Gesetz‘ verstoßen mußte.“
Wäre auch der letzten Satz mit einem Fragezeichen versehen, hätten Sie immerhin offen gelassen, ob Ihre Fragen nicht auch anders beantwortet werden könnten, als Sie es offenbar tun.
Tatsächlich irren Sie in diesem Abschnitt in dreierlei Hinsicht.
- Sie vergessen schon wieder Ihre eigene Grundeinsicht, dass die Bibel kein folgerichtig aufgebautes historisches Werk, sondern eine Zusammenstellung von Glaubenserzählungen ist. Und für diese ist es klar, dass Gottes Tora schon ewig besteht und auch für Onan gilt.
- Onan verfällt nicht als widerspenstiger Sohn der Strafe Gottes (nach 5. Mose 21,18-21 hätte er dann im Übrigen von den Leuten seiner Stadt gesteinigt werden müssen). Sondern Gott straft ihn deswegen, weil er die nach dem Tod seines Bruders von ihm geforderte Schwagerehe mit seiner kinderlos gebliebenen Schwägerin verweigerte, die im 5. Mose 25,5-10 gefordert wird.
- Eben deswegen kann natürlich das Verbot der Schwagerehe von 3. Mose 20,21 für Onan gar nicht gelten, da sein Bruder ja nicht mehr lebt und er mithin nicht dessen Ehe bricht.
Hätten Sie 1. Mose 38,9 genau gelesen, dann wüssten Sie, dass es Onan ausdrücklich nicht passte, dass die Kinder, die er mit Thamar zeugen würde, „nicht sein Eigen sein sollten“. Im Sinne der Tora (= Wegweisung) Gottes im Alten Testament war es aber, dass auch ein kinderlos gestorbener Mann mit Nachkommen gesegnet sein sollte – nämlich dadurch, dass einer seiner Brüder sich dazu bereit erklärt, die Witwe des Bruders zu heiraten und seinen ersten von ihr geborenen Sohn als Sohn des Bruders gelten zu lassen.
Dass Gott Onan wegen des Nichtvollzug der Schwagerehe sterben lässt, entspricht übrigens nicht einer üblichen Bestrafung nach der Tora. Nach den Bestimmungen von 5. Mose 25,5-10 hätte er sich weigern können, seine Schwägerin überhaupt zu heiraten. Als Strafe dafür wäre er lediglich auf folgende Weise entehrt worden (Verse 9-10): Die Schwägerin hätte ihm den Schuh vom Fuß gezogen und ihm ins Gesicht gespuckt; sein Haus wäre „Barfüßerhaus“ genannt worden.
↑ Gab es die Orgel schon zur Zeit der Bibel?
Nein, natürlich nicht, stellen Sie zu Recht (S. 121) unter dem Stichwort O wie Orgel fest. Allerdings (S. 123) stand wohl früher in mancher europäischen Übersetzung des Gotteslobs in Psalm 150,4: „Lobe ihn mit Saiteninstrumenten und Orgel“, weil man das hebräische Wort ˁUGaB ins Griechische und Lateinische mit den Wörtern organon bzw. organum = „(musikalisches) Instrument“ wiedergegeben hatte und das wiederum wörtlich ins Englische oder Deutsche mit „organ“ oder „Orgel“ übertrug. So kann man in der englischen „Holy Bible, King James Version“ noch heute lesen: „Praise him with stringed instruments and organs.“
Was wirklich mit ˁUGaB gemeint war, lässt sich leider nicht mehr herausfinden. Die verschiedensten Übersetzungen schwanken zwischen „Pfeifen“, „Flöten“ oder „Schalmei“.
Schaut man sich allerdings einmal die Herkunftsgeschichte des Wortes „Orgel“ an, dann kann man noch auf eine andere Idee kommen. Im „Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache“ findet man nämlich zu diesem Stichwort folgende Etymologie:
Orgel f. größtes Musikinstrument, bei dem durch Tasten sowie Pedal und Luftzuführung Pfeifen in verschiedenen Klangfarben zum Tönen gebracht werden. Ahd. organa (9. Jh.), Plur. (mit Dissimilation) orgalūn (Hs. 12. Jh.), mhd. organā, organe, orgene, orgel(e) ist entlehnt aus lat. organa, dem häufig gebrauchten Plural von lat. organum ‚Musikinstrument, Pfeifen-, Orgelwerk‘, auch ‚Werkzeug‘, griech. órganon (ὄργανον) ‚Werkzeug, Gerät, Instrument, Sinneswerkzeug, Organ‘…
Diese Erklärung legt nahe, dass es auch so gewesen sein kann: Weil in der griechischen und lateinischen Bibel das Wort organon bzw. organum für ein unbekanntes Musikinstrument zum Lobe Gottes verwendet wurde, legte man dem neu erfundenen großartigsten Instrument eben den Namen „Orgel“ bei.
↑ Sahen Propheten niemals in die Zukunft?
Wenn Sie (S. 124) unter P wie Propheten der gewöhnlichen Ansicht widersprechen, dass deren wichtigste Eigenschaft die „Gabe, in die Zukunft blicken zu können“, gewesen sei, haben Sie völlig Recht. Propheten waren (S. 125) für Aristoteles „Interpretatoren und Kommentatoren“, und in 2. Mose 7,1 „wird Aaron als ‚Prophet des Mose‘ bezeichnet“, also im Grunde als ein Sprecher für Mose, weil dieser „nicht besonders redegewandt“ war.
Aufschlussreich finde ich übrigens diesen von Ihnen nur teilweise zitierten Vers 2. Mose 7,1 in seiner Gesamtheit:
Der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein.
Obwohl natürlich vorausgesetzt bleibt, dass JHWH der einzige Gott Israels im eigentlichen Sinn bleibt, geht Gott sozusagen auf die polytheistische Vorstellungswelt des ägyptischen Königs ein und versieht Mose mit der Autorität eines Gottes. Und da dieser Gott zu hoch über dem Pharao steht, als dass er dessen Stimme direkt vernehmen könnte, braucht er einen Propheten als sein Sprachrohr.
Genau das ist nach biblischem Verständnis die Hauptaufgabe der Propheten, was Sie auch selber knapp zusammenfassen (S. 126):
„Biblische Propheten sprachen nach alttestamentarischem Verständnis für Gott. Sie redeten ihm aber nicht nach dem Munde, sondern übten auch lautstark heftig Kritik an ihm.“
Letzteres tut etwa der Prophet Habakuk (1,4), der vor dem gerechten Gott darüber klagt, dass „das Gesetz ohnmächtig“ ist und „der Gottlose … den Gerechten [übervorteilt]“, oder der Prophet Jeremia (12,1), der die anklagende Frage stellt: „Warum geht‘s den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle?“
In der Regel waren allerdings die Propheten diejenigen,
„die ‚ihre‘ Könige öffentlich barsch kritisierten und ihnen ihre Verfehlungen vorhielten. So beschimpft Prophet Natan den mächtigen König David vehement [2. Samuel 12,7]: ‚Du bist der Mann, der die Armen beraubt und Ehebruch begeht!‘“
Nebenbei bemerkt sind Sie auf diese Kritik Nathans an David oben unter D wie David allerdings gar nicht eingegangen.
Weitere Aufgaben der Propheten, die Sie zusätzlich erwähnen (S. 125) – Geschichtsschreiber, Musiker, Missionare, Wunderheiler – können zum Profil eines biblischen Propheten hinzutreten, gehören aber nicht unbedingt dazu.
Nun fragen Sie sich allerdings (S. 126):
„Bei der Vielfalt prophetischer Arbeitsbereiche, gibt es nicht auch Vorhersagen für die Zukunft aus Prophetenmund? Wirkten sie also doch auch als Hellseher, wie es nach unserem Verständnis Propheten tun?“
Dem widersprechen Sie sehr vehement (S. 127):
„Propheten waren also äußerst vielseitig begabt. Nur Hellseher waren sie nicht.“
Und Sie führen dafür zwei Argumente an, die allerdings beide nicht ganz überzeugend ausfallen:
Erstens berufen Sie sich auf den Propheten Jona. Als der dem (S. 126f.) „König von Ninive … den Untergang der großen Metropole“ verkündet, tritt dieser Untergang nicht ein. „War also Jonas ein falscher Prophet, weil er etwas vorausgesagt hat, was dann nicht eintraf?“
Nein, das war er nicht. Propheten wollen zur Umkehr rufen. Sie tun das auch durchaus, indem sie Unheil voraussagen – und zwar für den Fall der Nicht-Umkehr! Eine quasi neutrale Faktenvorausschau ist jedoch nicht ihr Ding. Insofern sind Propheten tatsächlich keine Hellseher – Menschen können ihre von Propheten vorausgeschaute Zukunft ändern.
Jona allerdings ist ein ironisches Beispiel für einen Propheten, der die Nichterfüllung der eigenen Prophetie beklagt und am Ende von Gott (Jona 4,1-11) eine Lehrstunde in göttlicher Barmherzigkeit erfährt.
Zweitens führen Sie den auch von mir sehr geschätzten jüdischen Theologen Pinchas Lapide (53) an (S. 127), der mit Recht als „hauptsächliche Aufgabe der ‚Propheten‘“ hervorhebt,
„als Gewissen des Volkes die Sehnsucht nach dem Rechten und Guten zu erwecken… Kurzum, die ‚Propheten‘ beschäftigen sich mit allem möglichen – oft auch unmöglichen – mit einer bemerkenswerten Ausnahme: der eigentlichen Prophetie im klassischen Sinne des Wortes, nämlich als das Vorhersagen der Zukunft.“
Aber, wie gesagt, es gibt in der Verkündigung der Propheten doch auch den Aspekt der Zukunftsvorausschau – nicht nur im Sinne der bereits erwähnten Mahnung, sondern auch der Ermutigung. Wenn das Volk in Verzweiflung zu versinken drohte, stellten die Propheten ihm tröstliche Hoffnungsbilder der Zukunft vor Augen.
Oft wird in der Bibel auch auf die Vorausschau eines Propheten zurückgeblickt, die man in späteren Ereignissen bestätigt fand, sei es im Alten Testament das babylonische Exil, das als zuvor angekündigte Strafe Gottes verstanden wurde, oder seien es die Verheißungen des kommenden Messias, die im Neuen Testament auf Jesus bezogen wurden.
↑ Quellen: Irrt die Wissenschaft?
Zum Stichwort (S. 127) Q wie Quellen kommen Sie noch einmal auf die bereits oben erwähnte Vierquellenhypothese zu sprechen (von denen Sie allerdings hier nur drei Quellen erwähnen). Ihr zufolge wurden die fünf Bücher Mose aus vier zwischen dem 9. und 5. Jahrhundert v. Chr. verfassten Quellen (Jahwist, Elohist, Deuteronomium und Priesterschrift) zusammengefügt.
Ihre Behauptung (S. 128), dass die „theologische Wissenschaft [sich] weitestgehend einig ist über die Richtigkeit der ‚Quellen-Theorie‘“, trifft inzwischen nicht mehr zu, wie ich bereits oben zu dieser Frage mit Bezug auf den Alttestamentler Erhard S. Gerstenberger ausgeführt habe. Insofern rennen Sie mit Ihren kritischen Bemerkungen zu dieser Art Quellenscheidung bei mir offene Türen ein.
Interessant finde ich es, dass Sie auf die einzige innerhalb der Vierquellenhypothese vertretene Quelle, die vielleicht wirklich einmal als schriftliche Urform des 5. Buchs Mose bestanden haben mag, nämlich das Deuteronomium, überhaupt nicht eingehen, ja, diese Quelle nicht einmal erwähnen.
Unrichtig ist es übrigens auch, die Vierquellentheorie auf die Urform des gesamten Alten Testaments zu beziehen; es ging dabei immer nur um eine Quellenscheidung innerhalb der fünf Bücher Mose. Insofern passen auch Ihre Bemerkungen etwa zum Propheten Hesekiel nicht so ganz in diesen Zusammenhang (S. 129):
„So ist man beispielsweise davon überzeugt, daß Hesekiel um 500 v. Chr. lebte. Hesekiels Angaben zur Person lassen diesen Schluß durchaus zu. Aber schrieb Hesekiel wirklich um 500 v. Chr. jenen Text, der als ‚Der Prophet Hesekiel‘ in das ‚Alte Testament‘ aufgenommen wurde? Warum gibt es dann nicht auch nur ein einziges Bruchstück eines Hesekiel-Textes, das auch nur annähernd 2500 Jahre alt ist? Auch die ältesten Kopien von Hesekiel stammen aus Qumran und sind somit rund maximal 2100 Jahre alt. Wieder fehlen die originalen Quellen!“
Dieses Fehlen sehr alter Quellen ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass antikes Schreibmaterial nur in seltenen Fällen so beständig war, dass es Jahrtausende überdauerte. Im Übrigen geht die alttestamentliche Wissenschaft auch bei Hesekiel nicht mehr davon aus, dass sein Buch vollständig auf einen Propheten mit diesem Namen zurückging. Vieles muss unklar bleiben.
Abschließend beziehen Sie sich in diesem Abschnitt auf den „Kritiker Uwe Topper“ (54), dem zufolge es „diese angeblichen uralten Quellen in Wirklichkeit nie gegeben“ hat. Um Toppers Ansichten allerdings auch nur annähernd einschätzen zu können, sollte man wissen, dass seiner Auffassung nach alle biblischen Quellen erst im Mittelalter entstanden, also komplett gefälscht worden sind. Er geht auch davon aus, dass keine zuverlässige Chronologie vor die Zeit der Renaissance zurückreichen kann, wofür er kosmische Katastrophen verantwortlich macht, die wiederum Sprünge in der Präzession der Erdachse hervorgerufen haben (55):
„Ein Präzessionssprung verursacht eine kalendarische Lücke, deren Unkenntnis oder Nichtbeachtung sich auf die Rückberechnungen der Geschichtszahlen, wie sie in der Renaissance für die Aufstellung der Chronologie grundlegend verwendet wurden, mit dermaßen hohen Fehlern auswirkt, daß kleinere Berichtigungen, wie sie später vorgenommen wurden, die Zeitskala nicht mehr geradebiegen konnten.“
Wenn Sie allerdings Uwe Toppers Hypothese tatsächlich für bare Münze nehmen wollen, können Sie Ihr ganzes Buch vergessen und auch Ihre Beteuerung, ihr Buch sei kein Angriff auf die Bibel. Sollten seine Annahmen zutreffen, würde das gesamte Weltbild der etablierten Wissenschaft und auch aller Religionen in seinen Grundfesten erschüttert.
↑ Das Bild von der Rippe – ein Symbol der Gleichberechtigung!
Ein wenig verwundert lese ich, dass Sie 40 Seiten nach Ihrer Einschätzung (S. 91) zu L wie Lilith: „Adam wollte eine Untergebene, keine gleichberechtigte Partnerin“ Ihre Meinung geändert haben, denn zum Stichwort (S. 129) R wie Rippe betonen Sie (S. 131):
„Ganz im Gegensatz zum orientalischen Denken biblischer Zeiten wird Eva im Bild von der ‚Rippe‘ als gleichberechtigte Partnerin gesehen.“
Sie begründen das unter Berufung auf eine persönliche Mitteilung von Hans Schindler-Bellamy damit, dass nach 1. Mose 2,21f. nicht in wörtlich zu nehmender Weise
„Eva … aus einer Rippe Adams gefertigt wurde, sondern daß sie von seiner Seite genommen wurde. Sie ist damit nach rabbinischem Verständnis dem Mann ebenbürtig, ihm gleichwertig.“
Dieser Einschätzung pflichtet auch Pinchas Lapide bei, dessen Erläuterung der Haltung der Rabbiner Sie ausführlicher zitieren (56):
„Hätte Gott der Frau beschieden, über den Mann zu herrschen, so hätte er sie aus Adams Kopf geschaffen – wie etwa Pallas Athene, die Schutzgöttin der Griechen, aus dem Haupt des Zeus gebildet wurde. Hätte Er ihr hingegen beschieden, Adams Sklavin zu sein, so hätte Er sie aus dessen Füßen gestaltet (gemäß der Bildhaftigkeit der orientalischen Symbolik). Er aber nahm sie aus Adams Seite, weil Er sie zu Adams gleichberechtigter Gefährtin bestimmt hat – auf daß sie beide Seite an Seite den Lebensweg beschreiten und vollenden mögen.“
Tatsächlich kommt das normalerweise mit „Rippe“ übersetzte hebräische Wort TseLAˁ von dem Wortstamm TsaLAˁ = „sich krümmen“. Davon können sowohl die Bedeutung „Rippe“ als auch „Seite“, „Türflügel“ und „Seitenbau“ abgeleitet werden.
Ihrem Fazit zu diesem Abschnitt kann ich uneingeschränkt zustimmen (S. 131f.):
„Manchmal irrt die Bibel, wenn sie einen Standpunkt vertritt, der heute unakzeptabel geworden ist. In der Gleichstellung von Mann und Frau war sie aber schon vor Jahrtausenden ihrer Zeit weit voraus. Ja es wäre wünschenswert, wenn sich heute die biblische Forderung nach Gleichberechtigung wirklich überall durchsetzen würde!“
↑ Salomo, der Kleine
Zum Thema (S. 132) S wie Salomo legen Sie mit Recht ausführlich dar, dass die Ausdehnung seines Machtbereichs, seine Bautätigkeit und sein Reichtum in der Bibel maßlos übertrieben dargestellt werden (57) (S. 136):
„Salomo war in Wirklichkeit kein Beherrscher eines Großreiches, sondern ein unbedeutender Lokalfürst mit einer Handvoll von Untergebenen. Er war kein Bauherr von Bedeutung. Er wurde nicht von der Königin von Saba besucht.“
War Salomo aber wenigstens (S. 134) „ein Literat von beachtlichem Format?“ Immerhin sollen „Das Hohelied Salomos“, „Die Sprüche Salomos“ und „Der Prediger Salomo“ aus seiner Feder stammen. Aber auch das ist nicht der Fall. Dass Salomo eine ganze Reihe von Werken der Weisheit zugeschrieben werden, hängt mit der Geschichte (1. Könige 3,4-15) zusammen, dass er sich Weisheit statt Macht und Reichtum von Gott erbittet und dann auch dieses beides noch hinzu bekommt.
So wird Salomo in der Bibel einerseits als idealer Herrscher charakterisiert, der auf der anderen Seite jedoch harte Kritik erfährt, als ihm sein Reichtum zu Kopfe steigt und seine vielen Frauen ihn zur Anbetung fremder Götter verführen – und auch zur Versklavung der eigenen Untertanen. Im Grunde ist Salomo nicht nur der Inbegriff eines weisen und strahlenden Herrschers, sondern zugleich mahnendes Beispiel für einen Herrschaftsstil ägyptischen Ausmaßes – er führt ägyptische Verhältnisse in Israel ein – was nach der Darstellung von 1. Könige 12 schon bei seinem Tod zur Trennung der beiden Reiche führt (die historisch gesehen allerdings nie eine Einheit gebildet hatten).
Mit Recht nehmen Sie an (S. 134), dass die Salomo zugeschriebenen Bücher der Bibel auf Grund eben dieser „Autorenschaft … in die Bibel aufgenommen“ wurden. Wie unter K wie Kanon ausgeführt, war ja der Hauptmaßstab für die Aufnahme in den biblischen Kanon, dass die jeweilige Schrift von einem Propheten stammt – oder, wie bei Salomo, von einem ausdrücklich von Gott mit Weisheit beschenkten Mann.
Ist das „Hohelied Salomos“ mithin zu Unrecht in die Bibel gelangt, weil es erstens nicht von Salomo stammt und zweitens sowieso keinen „religiösen Charakter“ hat, wie Sie schreiben?
Richtig ist: „Gott kommt darin … überhaupt nicht vor.“ Jedenfalls nicht das Wort ˀÄLoHIM oder der Gottesname JHWH. Und Verse wie (Hoheslied 1,2) „Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes“, (2,16) „Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter Lotosblüten weidet“, (7,4) „Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle“ oder (7,12f.) „Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen… Da will ich dir meine Liebe schenken“ zeigen eindeutig, dass wir hier eine Sammlung erotischer Liebeslieder vor uns haben.
Oder sollte es sich doch nicht (S. 134) um rein „weltlich-erotische Dichtung“, sondern „um umgearbeitete religiöse Texte aus heidnischer Zeit“ handeln? „Überliefert das Hohelied erotische Liebeslyrik oder Erinnerungen an uralte Götterkulte und rituelle Paarungen zwischen männlichen und weiblichen Himmlischen?“ (58) Ich denke, dass tatsächlich Ersteres zutrifft. Wenn dem Hohenlied wirklich Erinnerungen an fremde Götterkulte zu Grunde liegen sollten, ist die Fassung der Bibel doch auf allein menschliche Erotik zurechtgestutzt worden.
Zu der von Ihnen angeführen Kritik des Alttestamentlers Georg Fohrer (59) (S. 134f.), dass „seit nunmehr fast 2000 Jahren den Texten nachträglich ein vermeintlich religiöser Sinn beigemessen wird“, indem „aus einem Liebespaar Christus und die Kirche, die einzelne Seele oder Maria“ wird, möchte ich anmerken:
Tatsächlich kann man es kritisch sehen, dass sowohl jüdische als auch christliche Theologen das Hohelied allegorisch auslegten, weil sie annahmen, dass rein weltliche Liebeslieder in einem heiligen Text nichts zu suchen hätten. Ganz abwegig ist das jedoch insofern nicht, als auch Propheten wie Hosea und Jeremia das Bild von Braut und Bräutigam auf Gott und sein Volk anwendeten.
Heutzutage denken allerdings viele Theologen, so zum Beispiel Helmut Gollwitzer (60) und auch ich, dass die Liebeslieder des Hohenliedes gerade in ihrem wörtlichen Sinn eine partnerschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau auf Augenhöhe abseits patriarchalischer Ehestrukturen widerspiegeln, die sehr gut zur Erschaffung von Mann und Frau als Ebenbild Gottes gemäß 1. Mose 1,27 passt und auch zu Ihren Ausführungen zu R wie Adams Rippe. Indem die erotische Liebe als Gottesgeschenk gepriesen wird, ohne Gottes Namen im Munde zu führen, hat das biblische Buch dann doch in einem sehr tiefen Sinn einen religiösen Charakter.
Zum Buch „Prediger Salomo“ schreiben Sie (S. 135): es „beanspruchte ursprünglich gar nicht, aus der Feder Salomos zu stammen. In der hebräischen Überschrift heißt es lediglich: ‚Worte des Qohelet, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem‘.“ Mit diesen Worten wird allerdings in der Bibel sicher der unmittelbare Nachfolger Davids auf dem Königsthron, nämlich Salomo, gemeint sein und nicht irgendein späterer König. Das heißt, obwohl das Buch erst in der hellenistischen Zeit entstanden ist, versuchte man es ganz klar mit der Person des weisen Königs Salomo zu verbinden.
Weiterhin meinen Sie (S. 136):
„Was ‚Qohelet‘ bedeutet, ist unklar. Gibt es eine Verwandtschaft zum hebräischen ‚kahal‘? Kahal heißt Versammlung. Ist also Qohelet ein Titel einer Person, die etwas mit der Versammlung zu tun hat? Gemeint sein könnte ‚Prediger‘, aber auch ‚Lehrer‘ oder ‚Leiter der Versammlung‘. Die Übersetzung des Buchtitels mit ‚Der Prediger‘ ist also willkürlich und könnte falsch sein. Ebenso berechtigt wären ‚Versammlungsleiter‘ oder ‚Der zur Versammlung ruft‘.
Das einzige, was an diesen Ihren Ausführungen nicht stimmt, ist der erste Satz. Die Bedeutung von QoHäLäTh haben Sie sogar sehr klar herausgearbeitet, weil das Wort tatsächlich von QaHaL = „versammeln“ oder „Versammlung“ kommt, womit die Vollversammlung aller verständigen Israeliten gemeint war, vor die etwa Esra in Nehemia 8,2 die Tora Gottes bringt, damit sie ihr feierlich als Verfassung einer nach Gottes Willen konstituierten Bürgergemeinde oder Torarepublik zustimmt. QoHäLäTh ist also tatsächlich eindeutig der Versammler oder Versammlungsleiter in der jüdischen Gemeinde, die als solche wohl erst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil entstanden ist.
Folgende Erwägungen schließen Sie an:
„Und übersetzt man streng wörtlich, dann stellt man fest, daß der Ausdruck im Hebräischen weiblich ist. Dann müßte eigentlich in unseren Bibeltexten ‚Predigerin‘ oder ‚Versammlungsleiterin‘ stehen.“
Dazu finde ich in einer Bibelarbeit über Prediger 3,9-13 von Jürgen Ebach auf dem Stuttgarter Kirchentag 2015 unter dem Titel „Einsicht in die Endlichkeit und ein Geschmack der Ewigkeit“ folgende Erklärung:
„Kohelet“ heißt so etwas wie „Versammler“: Übrigens ist kohelet grammatisch eine weibliche Form und an einer Stelle des Buches (7,27) ist sie auch mit der femininen Verbform „sie spricht“ verbunden. Obwohl Kohelet in seinem Buch immer wieder eindeutig als Mann ins Bild kommt, will ich dieses kleine gender-Queering nicht unterschlagen.
In einer Anmerkung ergänzt Ebach:
Vielleicht liegt in 7,27 eine fehlerhafte Textüberlieferung vor. Die feminine Wortform könnte aber auch, dafür gibt es Parallelen, eine Amtsbezeichnung sein, die dann zum Eigennamen geworden ist. Von Ferne vergleichbar wäre ein weiblicher Ehrentitel wie Eminenz oder Exzellenz, der weit überwiegend Männer bezeichnet.
↑ Nur Irrtümer und Widersprüche in den Schöpfungsberichten?
Ihren Abschnitt zu (S. 137) S wie Schöpfungsberichte beenden Sie mit dem Fazit (S. 139):
„Zwei Schöpfungsberichte stehen am Anfang der Bibel: Sie weisen Irrtümer und Widersprüche auf. Es wurde nicht der geringste Versuch unternommen, die Texte zu harmonisieren.“
Wieder einmal vergessen Sie Ihre eigene Einsicht, dass die Bibel nicht als historisches korrektes Buch über geschehene Tatsachen zu verstehen ist und schon gar nicht als ein naturwissenschaftliches Werk über die Entstehung der Welt.
Stattdessen enthält die Bibel nicht nur am Anfang zwei unterschiedliche Schöpfungserzählungen, sondern sie wartet mit weiteren Schöpfungsliedern und Gedichten auf, die in den Psalmen, im Buch der Sprüche oder im Buch Hiob versteckt sind. Und diese alle sind, wenn Sie so wollen, widersprüchlich, da sie mit mannigfaltigen Bildern in unterschiedlichen Regionen und Situationen eben auch verschiedene Sichtweisen der Schöpfung widerspiegeln.
Sie selbst haben ja schon zu N wie Noah angedeutet, dass die biblischen Autoren dabei auch mythisches Material anderer Völker aufgreifen und im Sinne des biblischen Glaubens an den Einen Gott umgestalten. Eigene Erfahrungen des Volkes Israel im trockenden Wüstenland spiegeln sich in 1. Mose 2 wider, wo ein bewässerter Garten zum Inbegriff des Lebensraums für den Menschen wird. Der Aufenthalt im oft von Überschwemmung bedrohten babylonischen Zweistromland wird in Hintergrund erkennbar, wenn in 1. Mose 1 die Schöpfung als Überwindung eines alles verschlingenden Chaoswassers verstanden wird.
Und Jürgen Ebach hat darauf aufmerksam gemacht, dass die zweite Gottesrede in Hiob 40-41 die Erschaffung der Tiere nicht wie 1. Mose 1 und 2 in erster Linie in ihrer Zuordnung zum Menschen betrachtet (dem sie nach 1. Mose 1,27 untertan sind bzw. der ihnen nach 1. Mose 2,19f. Namen gibt), sondern (61):
„Über den Behemoth sagt Gott, er habe ihn geschaffen mit Hiob. Jenes Riesenvieh also ist ebenso Geschöpf Gottes wie Hiob. Beide gehören zu Gottes Welt, und damit auch der zwischen beiden bestehende Gegensatz. Der Behemoth ist weder für noch gegen Hiob (den Menschen) geschaffen, sondern mit ihm. Die Diastase zwischen der von Gott bereiteten Welt und dem Tier, das in ihr als Repräsentant des sie bedrohenden Chaos vorhanden ist, wird durch die Aussage, auch der Behemoth sei von Gott geschaffen, nicht befriedet, aber doch schöpfungstheologisch einbegriffen. Auch die Elemente, die die Schöpfung in Frage stellen, sie bedrohen, ihr feindlich sind, sind Bestandteile der Schöpfung. Der Widerspruch zwischen ‚Chaos‘ und ‚Weltordnung‘ wird damit in die Schöpfung verlegt. Der Behemoth ist – so verstanden – Gottes Feind und Gottes Geschöpf.“
Bei all dieser Vielfalt unterschiedlichster Schöpfungsvorstellungen ist es wahrlich nicht zu beklagen, wie Sie es tun, dass die Texte nicht harmonisiert wurden. Sonst wäre sicherlich ein großer Teil des tieferen Sinnes sämtlicher Erzählungen, Gedichte und Lieder verlorengegangen.
Aus Ihrer Analyse greife ich nur einige Punkte heraus. Zum Beispiel machen Sie sich über den Irrtum im ersten Schöpfungsbericht lustig, dass der Tag vor der Sonne erschaffen wird (S. 137):
„Wie kann es die Einteilung in Tag und Nacht geben, wenn die Sonne noch gar nicht existiert? Wie kann es Licht und Finsternis geben, ohne daß es die Sonne gibt? Und obwohl der Text gleich zu Beginn vermerkt, daß Gott Licht und Dunkelheit trennte, wiederholt er diese eigentlich nun überflüssige Arbeit am vierten Tag.“
In diesem Zusammenhang fällt mir die Vorlesung über 1. Mose 1 ein, die ich im Wintersemester 1975/76 bei eben jenem Jürgen Ebach hörte, den ich schon mehrfach zitiert habe und der damals als junger Dozent an der Ruhr-Universität Bochum lehrte. Er machte uns deutlich, dass der Erzähler von 1. Mose 1 im Rahmen seines antiken Weltbildes und durchaus auf der Höhe der Einsichten seiner Zeit, acht Schöpfungswerke auf sechs Tage verteilt:
An den ersten drei Tagen werden Lebensräume geschaffen.
Tag 1: Das Licht vertreibt die Finsternis.
Tag 2: Ein Firmament, das wie eine Käseglocke über der Erde errichtet wird, weist die Chaosmächte des Wassers über und unter der Erde in ihre Schranken und schafft sowohl den Lebensraum für die Gestirne als auch den Luftraum unter dem Himmel für die Vögel.
Tag 3: Durch die Scheidung von Festland und Meer werden die Lebensräume für Fische, Landtiere und Menschen bereitgestellt. Und am selben Tag entsteht die Vegetation, damit Lebewesen sich ernähren können.
Nun folgen die zweiten drei Tage, an denen die jeweiligen Lebensräume bevölkert werden.
Tag 4: Die Gestirne bewohnen das Firmament, wobei die biblischen Autoren mit einem ironischen Seitenhieb gegen die babylonischen Mythologie feststellen, dass deren Sonnengott Marduk und die anderen Sternengötter nichts als Lampen und Lichtzeichen am Himmel darstellen, aber keinerlei göttliche Macht beanspruchen können. Sie übernehmen unter anderem die Aufgabe, die Scheidung zwischen Licht und Finsternis, die Gott in Vers 4 grundsätzlich unternommen hatte, den Menschen tagtäglich im Wechsel von Tag und Nacht anzuzeigen. Sie mögen eine solche Wiederholung überflüssig finden; dem biblischen Erzähler war aber gerade der Vorgang des Scheidens, hebräisch BaDaL, zwischen Chaos und Ordnung, Finsternis und Licht, Nacht und Tag, (Chaos-)Wasser und als Lebensraum geeigneten Räumen ausgesprochen wichtig.
Tag 5: Das Wasser wird mit Fischen, der Raum unter dem Himmel mit Vögeln ausgestattet. Und auch hier erlaubt sich die Bibel wieder etwas Ironie: In den großen ThaNNINiM = „Seeungeheuern“, die in 1. Mose 1,21 erwähnt werden, spiegelt sich eine Erinnerung an die babylonische Meeresgöttin Tiamat wider, die hier eine weitaus bescheidenere Rolle als im ursprünglichen Mythos zu spielen hat.
Tag 6: Landtiere und Menschen werden am selben Tag erschaffen, was man durchaus so deuten kann, dass den Erzählern die enge Verwandtschaft zwischen den höher entwickelten Landtieren und dem Menschen irgendwie bewusst war.
Zur Erschaffung des Menschen stellen Sie ebenfalls Widersprüche fest (S. 138):
„Im ersten Schöpfungsbericht erschafft Gott das erste Menschenpaar nach seinem Bilde. Im zweiten Schöpfungsbericht nimmt Gott zunächst den Mann und setzt ihn in den Garten Eden. Erst später stellte er die Frau aus einer Rippe Adams her. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, nach seinem Bilde von Gott erschaffen. Im zweiten Bericht ist das ganz anders! Von einer Ähnlichkeit oder Gleichheit des Menschen mit seinem Schöpfer ist da nicht die Rede. Erst durch den Genuß der verbotenen Frucht [1. Mose 3,6-7] wird der Mensch wie Gott [1. Mose 3,22]. Was im ersten Schöpfungsakt erwünscht ist, das ist in der zweiten Version verboten und wird bestraft.“
Aber so unterschiedlich die beiden Erzählungen sind – in diesem Punkt besteht gerade kein inhaltlicher Widerspruch! Vielmehr kommt hier zum Tragen, wie genial die biblischen Redaktoren vorgegangen sind, indem sie die verschiedenen Schöpfungshymnen einfach nebeneinander gestellt haben.
Die Gottesebenbildlichkeit bedeutet eben keine Gleichheit des Geschöpfs mit dem Schöpfer in puncto Allmacht oder in puncto „Ich setze mir meine eigenen egoistischen Regeln“. Gleich sein soll der Mensch dem Schöpfer in puncto „Verantwortung für die Schöpfung“ und das wird in beiden Schöpfungserzählungen deutlich gemacht, im ersten durch das Wort „untertan“, was nicht die Erlaubnis zur Ausbeutung, sondern die Pflicht zur Bewahrung einschließt, im zweiten durch die Pflicht, den Garten Eden „zu bebauen und zu bewahren“.
Und im Dialog der Schlange mit Eva wird ein Missverständnis des „Seins wie Gott“ an den Pranger gestellt – der Mensch bleibt auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Wo er ihr gegenüber misstrauisch wird, versucht er sich auch zu nehmen, was ihm nicht zusteht, verstößt er gegen die guten Gebote Gottes, und es kommt am Ende sogar dazu, dass der Mann die Frau beherrscht, dass die Beherrschung der Natur zur Qual wird und dass der Bruder sich gegen den Bruder erhebt. Demgegenüber bewahrt die Schöpfungserzählung die Erinnerung daran, dass Gott ursprünglich die Erde als einen Garten konzipiert hat, in dem die Menschen einander so sehr vertrauen, dass sie sich voreinander nicht schämen, obwohl sie nackt sind.
Weiterhin schreiben Sie (S. 138):
„Der Sündenfall kommt erst im zweiten Bericht zur Sprache. Der erste weiß davon noch nichts:
Im ersten Report dürfen die Menschen von allen Bäumen essen. Ein Verbot einer bestimmten Frucht wird nicht ausgesprochen. Erst im zweiten Bericht heißt es, daß vom Baum der Erkenntnis nicht gekostet werden dürfe. Warum weiß der erste Bericht davon nichts?“
Hier unterstellen Sie mit dem „noch“ im ersten Satz, dass der Text im ersten Kapitel älter sei als der im zweiten Kapitel. Vermutlich war es aber genau andersherum – das Wüstenszenario im Hintergrund von Kapitel 2 deutet auf eine Entstehung in Palästina vor der Exilszeit hin, während die Chaoswasser im Hintergrund von Kapitel 1 von den Israeliten erst im babylonischen Exil erfahren werden konnten.
Im Übrigen sind beide Erzählungen keine „Reports“, keine Berichte mit wissenschaftlichem Anspruch. Es sind Lieder, Hymnen, Lobpreisungen der Schöpfung in bildhafter Sprache. Und beide Texte wissen voneinander deswegen nichts, weil sie unabhängig voneinander entstanden sind und die Redaktoren sich davor hüteten, sie nur deswegen verändern zu wollen, weil sie vielleicht einige Einzelheiten widersprüchlich fanden.
Ihre Einschätzung (S. 138f.), dass „die Rolle, die Adam und Eva zu spielen haben, … in beiden Texten keineswegs die gleiche“ ist, teile ich nicht. Denn der in 1. Mose 1,28 gegebene Befehl, „sich alles untertan zu machen und über alles zu herrschen“, wurde in biblischen Zeiten jedenfalls niemals als Erlaubnis zur Tierquälerei oder zur Zerstörung der Umweltressourcen verstanden, zumal in Israel auch jeder Herrscher den gerechten Geboten der Tora unterworfen war. Insofern kann man 1. Mose 2,15 geradezu als Interpretationshilfe für 1. Mose 1,28 begreifen. KaBaSch = „unterwerfen“ und RaDaH = „beherrschen“ hat in Bezug auf die Erde die Bedeutung, dass sie und alles, was auf ihr lebt, „bebaut und bewahrt“ werden soll.
↑ Auch Tiere haben eine Seele – welche Seelsorge brauchen sie?
Unter (S. 139) S wie Seele verweisen Sie auf die christliche Lehrmeinung, nach der es angeblich „nicht zuletzt die Seele [ist], die den Menschen zur Krönung der Schöpfung macht. Als minderwertig wird das Tier angesehen.“ Sie zitieren den US-Theologen John R. Rice (62), der den Stadtpunkt vertritt, dass nach der Bibel „Tiere keine unsterbliche Seele haben im Sinne, wie Menschen eine besitzen. Sie sind nicht nach dem Bilde Gottes gemacht. Sie haben kein Leben nach dem Tode.“ Diese Ansicht stellen Sie in Frage:
„Unterscheidet die Bibel wirklich zwischen dem Menschen als beseeltes und dem Tier als seelenloses Wesen? Das Gegenteil ist der Fall.“
Zur Begründung zitieren Sie zunächst Prediger 3,19-21:
„Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: Wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärtsfahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre?“
Dieser Text ist Ihrer Auffassung nach (S. 140)
„eindeutig: Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, also auch nicht die Seele. Demnach sind also Mensch und Tier beseelte Wesen.“
Ganz so eindeutig ist sie Sachlage aber doch wieder nicht, denn es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Seele schon in der Bibel und erst recht in der späteren Theologie. Das Alte Testament kennt jedenfalls noch keine Vorstellung einer unsterblichen Seele wie später die katholische Kirchenlehre. NäPhäSch bezeichnet in der Schöpfungsgeschichte einfach den Atem Gottes, der allen Lebewesen von Gott eingehaucht wird, Mensch und Tier gleichermaßen. Erst durch ihn werden sie zu belebten Wesen.
Klar ist bei dem Prediger bzw. Qohelet lediglich, dass Mensch und Tier mit dem Tod zu Staub werden. Aber was dann mit dem ihnen eingehauchten „Odem Gottes“ geschieht, weiß niemand. Jedenfalls gibt es im Alten Testament keinerlei Belege dafür, dass eine unsterbliche Seele von Mensch oder Tier nach dem Tod „in den Himmel“ kommt.
Widersprüchlich argumentieren Sie, wenn Sie einerseits der Lutherbibel vorwerfen, sie habe NäPhäSch HaJJaH bei der Erschaffung des Menschen nicht wörtlich als „lebendige Seele“, sondern als „lebendes Wesen“ übersetzt, andererseits aber unterstellen:
„Durch falsche Übersetzung wurden die Tiere lediglich lebende Wesen und nur der Mensch korrekt als lebende Seele bezeichnet. Diesen Unterschied macht der hebräische Text nicht!“
Die Lutherbibel macht aber ebenfalls nicht diesen Unterschied. Und da das Wort NäPhaSch viele Bedeutungen haben kann („Seele, Lebewesen, Leben, Selbst, Person“ usw.), kann es auch nicht falsch sein, Tier und Mensch gleichermaßen als „lebende Wesen“ zu bezeichnen.
Allerdings: Obwohl Menschen und Tiere nach dem Alten Testament lebendige, beseelte Wesen sind, bleiben die Tiere doch dem Menschen nach- und untergeordnet. Warum? Weil nur die Menschen nach dem Bild Gottes als verantwortungsfähige Wesen geschaffen sind, bekommen sie auch die Verantwortung („Herrschaft im Sinne des Bewahrens“) für die Tierwelt übertragen – wie eben unter S wie Schöpfungsberichte dargelegt.
Ihnen scheint es allerdings vor allem darum zu gehen (S. 141), dass es „für den gläubigen Christen … ein großer Trost sein [muss], im Jenseits nicht nur die geliebten Verstorbenen wiedersehen zu dürfen, sondern auch die treuen Tiere.“
Kurz darauf finden Sie jedoch im Widerspruch dazu „die Vorstellung der unsterblichen Seele“ als
„unklar und für den Menschen zu Beginn des dritten Jahrtausends mehr als schwer nachvollziehbar… Mit dem Tod löst sie sich vom Körper. Irgendwann einmal gibt es eine Auferstehung des Leibes, mit dem sich die Seele dann vereint. Wo sich in der Zwischenzeit die unsterbliche Seele aufhält, verraten weder die Bibel noch der Katechismus.“
Wie können Sie denn die Vorstellung der unsterblichen Seele anzweifeln und es zugleich als tröstlich empfinden, wenn Hundebesitzer ihre treuen Hunde im Himmel wiedersehen? Ihr „Irrtum“ in dieser Hinsicht besteht darin, dass Sie die Bildersprache des Glaubens in die Sprache einer naturwissenschaftlich oder historisch faktisch nachvollziehbaren Logik zu übersetzen versuchen, und zugleich vergessen, dass sich Glaubensvorstellungen im Laufe der Jahrtausende entwickeln können, was sich auch in Ihrer Interpretation von Hesekiel 18,20 wieder einmal zeigt (S. 142):
„Eine Aussage des Katechismus allerdings ist nach einer konkreten Aussage der Bibel falsch. Die Seele ist unsterblich, heißt es klipp und klar mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Nach Hesekiel allerdings wird manche Seele sehr wohl dahingerafft, nämlich die Seele des Sünders. Da aber nach der christlichen Lehre von der Erbsünde jeder Mensch durch seine Geburt ein Sünder ist, müßten konsequenterweise alle Seelen sterben.“
Wie schon gesagt, kennt das Alte Testament die Vorstellung einer unsterblichen Seele noch gar nicht. Auch Hesekiel 18,20 – wo es ganz wörtlich heißt: „Die Seele, die sündigende, sie wird sterben“, spricht hier einfach vom Menschen als mit dem Lebenshauch Gottes versehenen Wesen. Dieses Leben wird dem Sünder genommen – rein diesseitig. Damit meint Hesekiel nicht, dass die Seele nicht-sündigender Menschen ein Leben im Jenseits zu erwarten haben – nach seiner Vorstellung dürfen sie im Diesseits am Leben bleiben und irgendwann alt und lebenssatt sterben.
Was meinen Sie aber wohl mit Ihrer Forderung, dass „Seelsorger“ sich auch „um das Seelenheil der Tiere bemühen“ müssten, da doch „nach der Basis christlichen Glaubens, nach der Bibel, Mensch wie Tier beseelt sind“? Ironisch klingt Ihre Interpretation von Sprüche Salomos 12,10 (S. 143):
„Wörtlich steht da … im Hebräischen: ‚Der Gerechte erbarmt sich der Seele seines Viehs.‘ Wie soll das geschehen? Durch Verzehr von Tieren?“
Auf jeden Fall versteht das Alte Testament die Seele von Tieren nicht romantisiert im Sinne einer Partnerschaft zwischen Mensch und Tier auf Augenhöhe. Wenn man wirklich von einer Seelsorge für Tiere sprechen will, müsste sie anders aussehen als die Seelsorge für Menschen, da Tiere nun einmal nicht mit einer Verantwortung vor Gott ausgestattet sind.
Sprüche 12,10 haben übrigens auch Sie nicht ganz wörtlich übersetzt. Als Verb steht dort eine Form von JaDAˁ mit der Grundbedeutung „kennen“. Wenn nun demzufolge also „der Gerechte die NäPhäSch seines Viehs kennt“, dann kann damit auch gemeint sein, dass er weiß, was Tiere brauchen und wie sie artgerecht zu halten sind. Gefordert ist allerdings nicht, dass der gerechte Viehzüchter sein Vieh nicht schlachten darf, weil es eine Seele hat, sonst wäre die gesamte Viehwirtschaft der Antike undenkbar gewesen. In der Neuzeit könnte man aber auf der Basis dieses Verses ein Verbot tierquälerischer Tiertransporte und Massentierhaltung fordern. Eine nähere Beschäftigung mit vegetarischer Ernährungsweise in der Bibel verschiebe ich auf den Abschnitt V wie Vegetarismus.
↑ Wie alt wurde Abrahams Vater Terach – 145 oder 205 Jahre alt?
Zu (S. 143) T wie Terach, dem Vater des biblischen Stammvaters Abraham, interessiert es Sie, wie alt dieser wirklich geworden ist.
„Einerseits erfahren wir, daß Terach 70 Jahre alt war, als sein Sohn Abram geboren wurde [1. Mose 11,26]. Abram machte sich laut Bibel 75 Jahre später, nach dem Tod seines Vaters, auf Wanderschaft [1. Mose 12,4]. Das ergibt ein stolzes Alter von 145 Jahren für Terach. Andererseits erfahren wir aber auch an anderer Stelle [1. Mose 11,32]: „Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran.“
Sie sehen darin einen offensichtlichen Widerspruch:
„Welche Angabe aus dem ersten Buch Mose stimmt denn nun? Starb Terach mit 145 Jahren, als Sohn Abram 75 Jahre war, wie die Bibel auf der einen Seite behauptet? Oder wurde Terach 205 Jahre alt, wie die Bibel auf der anderen Seite aussagt? Abram verließ nach Terachs Tod die Heimat mit 75 Jahren. Das hieße aber, daß Terach 130 war und nicht 70 Jahre, als Abram geboren wurde.“
Ich verkneife es mir, auch noch die anderen absurden Möglichkeiten aufzuzählen, die Sie (S. 144) aus den „unterschiedlichen Altersangaben“ zu rekonstruieren versuchen.
Stattdessen schaue ich einmal, wodurch der Widerspruch hervorgerufen wurde. Des Rätsels Lösung findet sich in einem neutestamentlichen Text, nämlich Apostelgeschichte 7,4. Nur dort heißt es nämlich, dass Abraham erst von Haran wegzog, „als sein Vater gestorben war“. Im 1. Buch Mose ist eine solche Angabe nicht zu finden.
Lukas als Autor der Apostelgeschichte mag die alttestamentlichen Angaben so (miss)verstanden haben, weil von Abrams Auszug aus Haran erst die Rede ist (1. Mose 12,1-4), nachdem im Vers zuvor die Gesamtzahl der Lebensjahre seines Vaters Terach angegeben wurde (1. Mose 11,32). Das muss aber nicht heißen, dass Terach auf der Erzählebene des 1. Buchs Mose bereits gestorben war, als sich Abram von Haran aus auf den Weg machte. Nicht immer wird in der Bibel eine Geschichte streng nach ihrem chronologischen Ablauf erzählt. Ein Irrtum wie der des Lukas kann einem so sorgfältig arbeitenden Autor wie ihm um so leichter unterlaufen, als die Erzählungen, auf die er zurückgreift, auf unterschiedliche Traditionen zurückgehen, die lange Zeit mündlich überliefert worden waren.
Es gibt auch Kommentatoren, die die widersprüchlichen Altersangaben für Terach so erklären, dass Abram erst 60 Jahre nach Haran, seinem älterem Bruder geboren worden wäre – und nur der wäre im 70. Lebensjahr von Terach zur Welt gekommen. Dafür, dass Haran im Sinne der Geschichte so viel älter als Abram war, könnte sprechen, dass er nach 1. Mose 11,28 bereits vor seinem Vater Terach in dessen Ursprungsheimat Ur in Chaldäa gestorben war und sein Bruder Nahor eine Tochter Harans zur Frau nimmt.
Wie auch immer und ob überhaupt Irrtümer in den biblischen Erzählungen zu erklären sind – um ihren Sinn zu verstehen, spielen sie keine Rolle, da es – wie der bedeutendste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth (63), einmal sagte – „nicht einzusehen [ist], warum die Bibel als das wahre Zeugnis von Gottes wahrem Wort durchaus historisch reden müsse und nicht auch in Form von Sage reden dürfe.“
↑ Vom Chefankläger in Gottes Hofstaat zum teuflischen Lucifer
In Ihren Ausführungen (S. 144) über T wie Teufel stellen Sie ausführlich und korrekt fest (S. 145), wie aus dem Satan als Chefankläger Gottes im Alten Testament der teuflische Gegenspieler Gottes im Neuen Testament wurde. Erst in der Offenbarung 12,9 heißt es, dass der Teufel und seine Engel aus dem Himmel „auf die Erde geworfen“ werden. Und erst (S. 144) Papst Gregor I. entwirft um 600 n. Chr. das Bild der schwarzen, stinkenden Teufelsgestalt mit Hufen und Blitzen, indem er auf Eigenschaften heidnischer Götter zurückgreift.
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang (S. 146), wie der Teufel den positiven Namen „Lucifer“ = „Lichtbringer“ erhielt. Als Hieronymus in der Zeit um 400 n. Chr. die Bibel ins Lateinische übersetzte, stellte er das Prophetenwort aus Jesaja 14,12 „über den Sturz des Königs von Babylon“:
„Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern!“
mit dem Jesuswort in Lukas 10,18 zusammen:
„Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.“
Ihrer Beschreibung, wie die beiden Texte die Vorstellung vom Teufel verändert haben, ist nichts hinzuzufügen:
„Beide Texte entstanden unabhängig voneinander, haben keinen sachlichen Bezug zueinander. Und doch läßt sich ein Berührungspunkt konstruieren. Und zwar so: Jesaja bezeichnete den Herrscher von Babylon als gefallenen „Morgenstern“. Und den kannte man in der römischen Mythologie als Luzifer. Das war durchaus positiv gedacht, wie man leicht nachempfinden kann! Noch ist es Nacht, die Dunkelheit ist düster, bedrückend. Doch der Tag naht schon. Er hat einen Vorboten, der noch in der Finsternis erscheint, nämlich die Venus. Sie bringt erstes Licht: Venus ist also Luzifer (deutsch: Lichtbringer).
Jesus will nun Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzend gesehen haben. Da bei Jesaja der Morgenstern vom Himmel fiel, setzte Hieronymus nun den Satan aus dem Jesuswort mit dem Morgenstern gleich und so wurde aus Satan der Lichtbringer Luzifer. So entstand das Kuriosum, daß der böse Satan einen positiven Beinamen erhielt!“
Ihr Fazit zu diesem Abschnitt lautet (S. 148):
„Die Bibel ist menschliches Reden über Gott – und den Teufel. Sie vermittelt nicht feststehende Erkenntnisse, sondern zeigt Entwicklungen in Glaubensfragen auf. Gerade was die Bibel über Satan aussagt, belegt, daß sich der Glauben ständig änderte. Dieser Prozeß wird in der Bibel selbst dokumentiert. Man kann annehmen, daß sich der Glaube auch weiterentwickelt hätte, wäre die Bibel fortgeschrieben worden. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist: Muß man nicht Glaubenssätze und Vorschriften der Bibel dahingehend überprüfen, ob sie noch zeitgemäß sind?“
Dem kann ich nur zustimmen. Sicher muss man ständig die Glaubenssätze der Bibel überprüfen, erstens im Hinblick darauf, wie sie überhaupt zu verstehen sind, damals im Kontext der Aussagen anderer Texte und auch im Zusammenhang der antiken Kulturen, und zweitens, auf welche Weise die damaligen Glaubensaussagen in die jeweilige heutige Gegenwart, ebenfalls im Kontext der jeweiligen kulturellen Gegebenheiten hineinsprechen können. Inwiefern sich dabei die Glaubensaussage selbst ändern muss, ist aber genau zu prüfen; auch Sie wehren sich ja gegen vorschnelle Anpassungen an den Zeitgeist, die vom Geist des Glaubens und vom Gesamtkontext der Bibel her nicht zu rechtfertigen sind.
↑ „Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
Zum Thema (S. 148) T wie Todesstrafe belegen Sie an Hand verschiedener Beispiele: „das ‚Alte Testament‘ bejaht eindeutig und fordert die Todesstrafe“, zum Beispiel in 3. Mose 24, 17 (64):
„Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben.“
Sie fügen dann eine Reihe von für uns befremdlichen Beispielen an, für welche Taten die Todesstrafe vorgesehen war, und haben selbstverständlich Recht mit Ihrer Mahnung zur Vorsicht (S. 149): „Wer meint, man könne biblisches Rechtsverständnis auf heutige Zeiten übertragen, der irrt gewaltig!“
Aber Vorsicht ist auch geboten gegenüber vorschnellen Urteilen über das alttestamentliche Rechtswesen. Wer sich darüber ein differenziertes Bild verschaffen will, ob es tatsächlich im Alten Testament ein sogenanntes „apodiktisches“ Recht oder „Todes“-Recht gab (erkennbar häufig an Formulierungen wie MOTh JuMaTh = „der soll des Todes sterben“), demzufolge über bestimmte strafwürdige Vergehen ohne weitere gerichtliche Prüfung sozusagen kraft der Rechtsgewalt Gottes die Todesstrafe zu verhängen war, dem empfehle ich die Lektüre eines Aufsatzes von Erhard S. Gerstenberger (65), in dem er genau diese in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vertretene Auffassung kritisch hinterfragt.
Ich greife wegen der großen Bedeutung dieser Frage einige Passagen aus diesem Aufsatz heraus, um Denkanstöße zu geben. Gerstenberger schreibt (S. 18 – seine Zitierung der Namen alttestamentlicher Bücher gleiche ich an die von Ihnen verwendete an; hebräische Wörter zitiere ich in deutscher Umschrift):
„b) Die erzählende Literatur weiß nichts von einer rücksichtslosen Verurteilung von gewissen Kapitalverbrechern (Mörder; Elternschänder; Menschenräuber; Homosexuelle usw). Die erhaltenen kasuistischen Rechtssätze, die mit solchen Vergehen befaßt sind, sehen andere Rechtsmittel als Ausrottung vor (66). Die erkennbare Rechtswirklichkeit der alttestamentlichen Zeit ist mit den rekonstruierten sakralen Rechtsinstitutionen nicht in Einklang zu bringen (67).
c) Die beiden … Beispielgeschichten vom Gotteslästerer (3. Mose 24) und vom Sabbatschänder (4. Mose 15) sowie vom ‚mißratenen Sohn‘ (5. Mose 21,18-21) sind keine Gegenbeweise; sie bezeugen weder kultisches Gericht noch reale Ausführung der Todesstrafe durch Steinigung. Vielmehr sind sie Anzeichen für eine rein abstrakte, lehrhafte Behandlung dieser Fälle. Denn ihrer Struktur nach sind diese ‚Erzählungen‘ ganz klar künstliche, aufgrund der MOTh JUMaTh-Sätze gebildete Illustrationen.
Worauf will Gerstenberger also hinaus? Darauf, dass zum Beispiel der von Ihnen mehrfach erwähnte Fall des missratenen Sohnes, der gesteinigt werden soll, gar kein israelitischer Rechtssatz war, sondern eine drastische ethische Ermahnung.
Mir fällt dazu als Parallele die drastische Erzählweise von Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ ein, den sich meine Enkelkinder – 5 und 8 Jahre alt – zur Zeit gerne vorlesen lassen und den wohl niemand als Lehrbuch des deutschen Rechtswesens im 19. Jahrhundert betrachten würde.
Also im Klartext: Natürlich geht, wie Sie schreiben (S. 150), „die Todesstrafe für widerspenstige Söhne … entschieden zu weit“, aber nach Gerstenberger war diese schon im Alten Testament niemals geltendes Recht.
Außerdem irren Sie, wenn Sie dieses Thema auf „die sogenannte antiautoritäre Erziehung“ beziehen. Bezeichnenderweise lassen Sie in Ihrem Zitat von 5. Mose 21,20 die Worte „er ist ein Prasser und Säufer“ weg. Nicht freche Gören und pubertierende Söhne im Kindheits- oder Jugendalter sind also hier im Blickfeld, sondern längst erwachsene Söhne, die den angestammten Besitz in Gefahr bringen und der Trunksucht erlegen sind. Auch das würde natürlich nicht die Todesstrafe legitimieren, macht aber deutlich, warum die Ermahnung dieser Söhne so drastisch ausfällt: Es geht um nichts Geringeres als die Existenz der Großfamilie!
In ähnlicher Weise verharmlosen Sie auch andere Fälle, die mit der Beziehung erwachsener Kinder zu ihren alt gewordenen Eltern zusammenhängen. In unüberbietbarer Drastik wird auch Kindern, „die ihre Eltern verfluchen [2. Mose 21,17] oder schlagen [2. Mose 21,15]“, angedroht, dass sie „des Todes sterben“ sollen. Aber warum? Nicht aus den folgenden Gründen, die Sie verniedlichend anführen (S. 150):
„Wem ist nicht schon einmal ein Fluch über die Lippen gekommen? Wer sich beim Umgang mit Werkzeug mit einem Hammer auf den Finger schlägt und ein ‚Verdammt noch mal‘ hören läßt, ist ein Flucher und schlimmer Sünder. Nach biblischem Verständnis muß er gesteinigt werden [3. Mose 24,14].“
Solche banalen Alltagsflüche sind in den biblischen Zusammenhängen definitiv nicht gemeint. Im Blick sind zum Beispiel Todesflüche gegen die Eltern, denen im magischen Denken der Antike durchaus wirksame Kraft zugemessen wurde, oder Tätlichkeiten gegen hilflos und pflegebedürftig gewordene alte Eltern.
Im Fall von 3. Mose 24,14, auf den Sie nur hinweisen, aber nicht näher eingehen, geht es um die Verfluchung des „Namens“, hebräisch HaScheM. Gemeint ist die öffentliche Schmähung des Gottesnamens JHWH, der nach der biblischen Tora als Inbegriff von Freiheit und Recht in Israel galt; wer diesen Gott lästerte, stellte die Grundlagen der jüdischen Torarepublik in Frage.
Insofern stimmt zwar Ihr Satz (S. 151):
„Zu verehren ist ausschließlich der offizielle Gott der Bibel Jahwe. Wer andere Götter anbetet, soll gesteinigt werden! [5. Mose 17,2-5]“
Aber damit ist im Rahmen der Bibel eben nicht einfach dasselbe gemeint, was wir heute unter einem Aufruf verstehen würden, „Anhänger anderer Religionen zu steinigen“. Der Glaube an JHWH und die Verehrung anderer Götter wurden einfach nicht auf einer vergleichbaren religiösen Ebene gesehen, die wir erst seit der Aufklärung kennen, so dass jeder nach seiner Façon selig werden soll. Stattdessen stand JHWH für ein völlig anderes Gesellschaftsmodell der (68) „Autonomie und Egalität“, das mit den normalen durch polytheistische Götter legitimierten altorientalischen Königreichen unvereinbar war.
Im Übrigen entstanden die Ansätze dessen, was wir unter Religion oder einer religiösen Gemeinschaft verstehen (also unabhängig von ihrer unlösbar mit der Legitimation des Gesellschaftssystems verbundenen Funktion), gerade erst in der Perserzeit, als die Juden (mit Ausnahme der Makkabäer- und Hasmonäerzeit) keinen eigenen König mehr hatten und sie eine jüdische Bürgergemeinde mit der Tora als Verfassung konstituierten (die Ton Veerkamp „Torarepublik“ nennt).
Zum Schluss fassen Sie Ihre grundsätzliche Kritik an der Todesstrafe in der Bibel noch einmal zusammen, wobei Sie mit Recht betonen, dass sich das biblische Rechtssystem natürlich nicht insgesamt auf heute übertragen lässt:
„Es ist nicht akzeptabel, in welch großem Umfang für echte und vermeintliche ‚Vergehen‘ die Todesstrafe gefordert wird. Die Texte der Bibel entstanden als Dokumente längst vergangener Zeiten und einer teilweise fremden und sehr befremdlichen Denkweise. Die Strafforderungen des ‚Alten Testaments‘ sind auf unsere Zeiten in ihrer Gesamtheit nicht übertragbar! Aus heutiger Sicht irrt die Bibel, wenn sie zum Beispiel freche Kinder oder junge Frauen, die nicht als Jungfrauen heiraten wollen, steinigen läßt.“
Zu der Frage, ob es sich bei den von Ihnen erwähnten „Strafforderungen“ im Alten Testament aber wirklich um geltende israelitische Rechtsnormen handelte, möchte ich allerdings noch einmal Erhard S. Gerstenberger mit seinem Fazit in dem oben zitierten Artikel zu Worte kommen lassen (S. 20):
„Sind die Termini ‚apodiktisches‘ und ‚Todes‘recht zur Bezeichnung alttestamentlicher rechtlicher Normen brauchbar? Sie sind es nicht, und zwar aus einem doppelten Grund: Einmal gehört die Vorliebe für ein starkes, autoritäres Recht, das ohne Wenn und Aber durchgesetzt wird (zu wessen Gunsten?), in die deutsche Geschichte der zwanziger und dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts. War es damals sicher schon theologisch und politisch bedenklich, für ein unbedingtes und rücksichtsloses Recht zu plädieren und das schwache, nicht mehr auf den Staat, aber auf den Einzelmenschen und seine Würde bedachte Recht als überholt zu diskreditieren, so ist dies heute, nach den Erfahrungen der vierziger Jahre vollends unmöglich. Um es theologisch zu sagen: Der Gott, der willkürlich ‚sein‘ Recht durchsetzt, ist nicht der Gott Jesu Christi, der noch dem letzten Verlorenen und Schuldigen nachgeht. Er ist auch nicht der barmherzige und gerechte Gott des Alten Testaments. Der zweite Grund, weswegen die in Frage gestellten Begriffe für ihre Aufgabe untauglich sind, ist ein textimmanenter. Die relevanten, von Albrecht Alt so genannten ‚apodiktischen Rechtsformulierungem haben sämtlich mit der ‚Rechtsgemeinde im Tor‘, der ‚Rechtsfindung‘ und der jurisdiktionellen Gerechtigkeit nichts zu tun. Sie kommen aus anderen Lebensbereichen, aus Ethos und Religion, zu uns. Sicher, Ethos und Religion sind rechtskonstituierende Bereiche, sie stellen die Fundamente für das positive Recht. Aber die alttestamentlichen Rechtssammlungen haben die Begründung des Rechts nicht thematisiert und als solche reflektiert. Sie stellen einfach das praktizierte Recht mit allen seinen ungenannten Prinzipien unter die Oberaufsicht des Gottes vom Sinai [2. Mose 19 bis 4. Mose 10]. Die jedem bekannten Grundregeln und Grundmuster menschlichen und jahwistischen Verhaltens sind damit geheiligt. Einer anderen Rechtskonstitution bedarf es nicht. Die einschlägigen Regeln und Normen aber werden je an ihrer Stelle und mit ihren spezifischen Sprachformen funktional gebraucht, in Unterweisung und Katechese, Liturgie und Gebet. Die Rechtsprechung im Alten Israel, besonders in der exilisch-nachexilischen Spätzeit, war alles andere als ‚apodiktisch‘ und ‚todesrechtlich‘, sondern zutiefst basisbezogen und demokratisch.“
Auch zu Ihrer Frage (S. 149), warum das „Thema Sexualität … die biblischen Rechtsprecher besonders interessiert zu haben“ scheint, hat Gerstenberger eine Antwort gegeben: „Sexualität war in sich und von alters her ein Bereich unheimlicher Kräfte“. Was er dazu im Zusammenhang schreibt, habe ich schon im Abschnitt unter H wie Homosexualität zitiert.
↑ Turmbaugeschichte – altes Material für eine neue Glaubensgeschichte
Zu (S. 151) T wie Turmbau stellen Sie fest (S. 152), dass die „absurde These von der angeblichen Einsprachigkeit vor der Zerstörung des Turms zu Babel … in eklatantem Widerspruch zur Bibel selbst [steht]! Nur wenige Verse vor dem Bericht über den ‚Turmbau zu Babel‘ heißt es: ‚Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen und Geschlechtern und Völkern.‘ [1. Mose 10,5] … Wenn das kein Widerspruch ist!“
Nur ist das wieder keine Sensation, sondern es entspricht der Tatsache, dass die Bibel eben unterschiedliche Überlieferungen (S. 154) „wie ein Mosaik zusammenfügte“ und dabei aus „Respekt vor den einzelnen Textteilen“, wie Sie selber schreiben – lieber Widersprüche ertrug, als die Texte miteinander auszugleichen. Historische Geschichtsschreibung in unserem Sinn ist dabei nicht beabsichtigt, sondern theologische Deutung menschlicher Geschichte. Und das wissen Sie ja auch.
Dass (S. 153) „die von der Bibel angebotene sprachliche Erklärung von Babel völlig falsch“ ist, „Babel … sich eindeutig vom babylonisch-sumerischen ‚bab-ili‘ her[leitet], zu deutsch von ‚Tor der Götter‘“ und nicht von „dem hebräischen ‚balal‘, zu deutsch ‚verwirren‘,“ bestätigt ebenfalls die Absicht der biblischen Autoren, nicht etwa objektiv-historisch altorientalische Geschichte zu schreiben, sondern „das großartige Bauwerk“ zur Verehrung „der babylonischen Götter“ in die Glaubensgeschichte an ihren Einen Gott einzuordnen.
Wo Sie das „Kuriosum“ kommentieren, dass die „biblischen Urväter … alle wahrhaft methusalemisch alt geworden sein“ sollen, unterläuft Ihnen der kleine Irrtum, dass Methusalem gar nicht zur (S. 154) Liste der „Urväter des Volkes Israel“ gehört, die in 1. Mose 11,10-32 verzeichnet ist, sondern zu den Urvätern der Menschheitsgeschichte vor der Sintflut (1. Mose 5,21-23), als die Menschen laut 1. Mose 6,3 noch weitaus älter wurden als 120 Jahre. Der Widerspruch, dass nach der Sintflut im Stammbaum der Semiten dennoch bis zu 600 Jahre alte Menschen auftauchen, ist Ihnen nicht einmal aufgefallen.
Zu den Aussagen des von Ihnen zitierten Alttestamentlers Georg Fohrer (69) über „ursprünglich fremdes Gut, das ihnen [den biblischen Berichten] im Laufe der Jahrhunderte zugewachsen ist“, ohne welches „die Patriarchenüberlieferung auf wenige Notizen und Erzählungen zusammen[schmilzt]“, wiederhole ich meine bereits mehrfach wiederholte Feststellung, dass die biblischen Autoren fremde Traditionen jedenfalls nicht einfach abgeschrieben, sondern kreativ genutzt haben, um ihren eigenen Glauben gegen die scheinbare Übermacht der polytheistischen Kultur anderer Nationen zu bezeugen.
Im Fall der Turmbaugeschichte bauten sie das überlieferte Material im Sinne einer Kritik an technologischer oder architektonischer Hybris zusammen und verbanden damit die Frage, warum sich Menschen global oft nicht „verstehen“. Nicht um historische Geschichtsschreibung oder um eine Urgeschichte der menschlichen Sprache geht es, sondern um den Zusammenhang zwischen menschheitlichem Größenwahn und dem Unfrieden in der Welt.
↑ Auch sterbliche Seelen kann man nach dem Tod nicht anfassen
Im Abschnitt (S. 154) über U wie Unsterblichkeit setzen Sie Ihre widersprüchliche Argumentation über die Vorstellung von der Seele im Alten Testament fort. Recht haben Sie damit, dass „das ‚Alte Testament‘ … die Vorstellung von Unsterblichkeit nicht“ kennt. Wenn Sie aber schreiben: „Ausdrücklich wird aber darauf hingewiesen, daß die Seele, die sündigt, sterben soll [Hesekiel 18,20]“, vermischen Sie – wie schon unter S wie Seele – moderne Vorstellungen von Seele mit der alttestamentlichen Auffassung, dass NäPhäSch einfach die Lebendigkeit eines Lebewesens bezeichnet. Recht haben Sie wiederum damit (S. 155), dass die biblischen Autoren eben nicht wie in „Griechenland … den Tod als Trennung von Leib und Seele“ ansahen, sondern „der Mensch war Seele“. Damit wird Ihre Ausdrucksweise in dem Satz „Wurde einem Menschen das Leben gerettet, so lebten sein Körper und seine Seele weiter“ aber missverständlich, weil sie ja gerade eine Unterscheidung zwischen Körper und Seele voraussetzt, die es für das hebräische Denken gar nicht gibt. Wer also wie Abram um sein Leben fürchtet, der fürchtet eben deswegen um seine Seele, weil NäPhäSch einfach der Inbegriff seiner Lebendigkeit ist.
Irreführend ist auch (S. 156) Ihre Formulierung „wer den toten Leib eines Menschen berührte, der berührte damit auch die tote Seele des Menschen“, eben weil ja das Alte Testament gar keine Vorstellung einer vom Körper getrennten Seele hatte. Ihre angeblich wörtliche Übersetzung von 4. Mose 19,13: „Jeder der berührt (einen) Toten, die Seele und sich nicht entsündigen will, der macht die Wohnung Gottes unrein“, ist übrigens doch nicht ganz so wörtlich, denn BeMeTh BeNäPhäSch HaˀADaM würde, ganz wortgetreu übersetzt „einen Toten, die Seele eines Menschen“ bedeuten. Allerdings ist mit der „Seele eines toten Menschen“ nichts anderes gemeint als der ehemals mit Gottes Atem versehene Mensch, also der Leichnam. Bestätigt wird das eindeutig durch Bibelstellen wie 3. Mose 19,28; 22,4 und 4. Mose 5,2; 9,6.7.10, wo das Wort NäPhaSch sogar ohne das dazugestellte Wort MeTh = „Verstorbener“ einfach „Leiche“ bedeutet, an der man sich verunreinigt.
Ich widerspreche Ihnen also gar nicht in Ihrem Hinweis darauf, dass es für „den gläubigen Menschen des ‚Alten Testaments‘ … die untrennbare Einheit von Leib und Seele“ gab und dass die
„christliche Vorstellung, wonach nach dem physischen Tod die Seele den Körper verläßt und ins Jenseits reist, … den Aussagen des ‚Alten Testaments‘ [widerspricht]: Der Mensch wird als Ganzheit aus Leib und Seele gesehen. Und beide, Leib und Seele, sterben. Die Unsterblichkeit gab es für den Menschen des ‚Alten Testaments‘ nicht: Weder für den Leib, noch für die Seele.“
Ich denke nur, dass Sie diese Sichtweise selber nicht ganz konsequent durchhalten, indem Sie sich so ausdrücken, als ob man im Alten Testament gemeint hätte, dass man noch bei Verstorbenen die tote Seele hätte anfassen können. Nein, man konnte nur den Leichnam anfassen – und machte sich eben dadurch unrein.
Anmerken möchte ich allerdings, dass es schon im Alten Testament die Vorstellung von der Entrückung einzelner Menschen zu Gott hin gab (nicht auf ihre unsterbliche Seele beschränkt), wie Henoch (1. Mose 5,24) oder Elia (2. Könige 2,11). Und im Buch Jesaja 25,8 finden wir sogar eine Hoffnung auf Gott, die erst im Neuen Testament näher entfaltet wird: „Er wird den Tod verschlingen auf ewig.“
Zu bedenken gebe ich außerdem, dass es auch in der christlichen Theologie durchaus unterschiedliche Auffassungen zum Thema Leib-Seele-Einheit und Unsterblichkeit gibt. Ich selber neige zu der alttestamentlichen Haltung, dass der Mensch eine psychosomatische Einheit darstellt, die mit dem Tod vergeht. Vom Glauben an den allmächtigen Gott her kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass Gott den leiblich-seelisch vollständig toten Menschen in einem unvorstellbaren Jenseits oder Himmel neu erschafft. Hoffnungen über den Tod hinaus sind grundsätzlich nur bildhaft beschreibbar, wie zum Beispiel auch das Bild vom Geschenk des göttlichen Lebenshauches, das den Menschen im Tode verlässt und zu Gott zurückkehren mag, worauf man keine Unsterblichkeitsspekulationen aufbauen sollte.
↑ Kannte die Bibel das sich ausdehnende Universum?
Zum Stichwort (S. 156) U wie Urknall gehen Sie von der landläufigen Ansicht des modernen Menschen aus, die Glaubensaussage (S. 157), dass „Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat“, stehe der wissenschaftlichen
„Idee der Evolution entgegen. Das Universum ist demnach nicht das Produkt göttlichen Wirkens und Handelns, ist nicht urplötzlich erzeugt worden. Vielmehr ist es das Ergebnis eines laufenden Prozesses, der auch heute noch nicht zum Abschluß gekommen ist.“
Mit Recht betonen Sie, wie unvorstellbar die Schlussfolgerungen der kosmologischen Wissenschaft sind, dass die gesamte „Materie, aus der Planeten, Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen bestehen, die heute auf das gesamte Universum verteilt ist“, in ihrem Urzustand, beim sogenannten Urknall, „in unvorstellbarer Weise verdichtet [war]. Sie war auf die Größe eines mathematischen Punktes konzentriert“, aber (S. 158) ohne dass bereits Raum existierte, der diesen Punkt umgab. Raum und Zeit selbst entstanden erst mit dem Urknall!
In diesem Abschnitt wollen Sie nun nicht wie sonst der Bibel Irrtümer nachweisen, sondern Sie behaupten, dass die Bibel bereits manches wusste, was der „vermeintlich aufgeklärte Zeitgenosse“, ihr nicht zutraut, und zwar konkret: „Die Lehre vom sich ständig ausdehnenden Universum war ursprünglich sehr wohl bekannt.“
Um dies zu beweisen, stützen Sie sich auf eine alternative Übersetzung der hebräischen Worte HaNNOTäH CaDoQ SchaMaJiM in Jesaja 40,22 durch den Sprachforscher Karel Claeys (70). Gewöhnlich werden sie so verstanden: Gott „spannt den Himmel aus wie einen Schleier“, wörtlicher übersetzt heißt es von Gott: „ausbreitend – wie einen Schleier – den Himmel“. Von seiner Wurzel DaQaQ her hat das Wort DoQ allerdings (S. 159) die Grundbedeutung „etwas in feine Teilchen zermahlen, zermalmen, zerstoßen“. Und für das Verb NaTaH soll nach „Königs Hebräischwörterbuch (71) … weniger eine Bewegung des Ausbreitens (wie eine Decke) als der Expansion, der Ausdehnung also“ zum Tragen kommen. Auf Grund dieser Alternativbedeutungen, die möglich sind, aber nicht zwangsläufig hier zutreffend sein müssen, stoßen Sie im
„hebräischen Originaltext … auf eine in höchstem Maße genau zutreffende Aussage. Gott wird als Erschaffer des Universums angesehen. Aber er kreierte das Universum der Sterne ‚ausdehnend gleich einer Menge Stäubchen‘. Damit wird in leicht poetischer Sprache ausgedrückt, was auch heutige Anhänger der Big-Bang-Theorie vertreten: Die Sterne expandieren wie eine Menge Stäubchen.“
Die Schlussfolgerung, mit einer solchen Formulierung hätte der Autor von Jesaja 40 heutige kosmologische Weltentstehungsmodelle vorweggenommen, halte ich aber für allzu weit hergeholt. Warum lassen Sie ihn mit seiner poetischen Beschreibung des Himmels nicht einfach von seinem eigenen Wissenshorizont ausgehen? Ich bestreite nicht, dass wir seine theologischen Aussagen auf heutige Weltentstehungsmodelle übertragen können, müssen aber nicht annehmen, dass er diese damals schon kannte.
Ich hege ja den Verdacht, dass Sie in diesem Abschnitt auf die Paläo-SETI-Hypothesen von Dieter Vogl und Nicolas Benzin in ihrem Buch „Die Entdeckung der Urmatrix“ anspielen, zu dessen erstem Band Sie ein begeistertes Vorwort geschrieben haben. Soll Jesaja über die moderne Kosmologie vielleicht bereits deswegen Bescheid gewusst haben, weil er auf ein Wissen zurückgreifen konnte, das ihm durch außerirdische Wesen zugänglich war? Ich lasse es dahingestellt sein, da Sie darauf in diesem Buch mit keiner Silbe eingehen.
Aber zurück zur Bibel. Sie sind überzeugt davon (S. 160), bei
„Jesaja … noch einige weitere deutliche Hinweise auf Gott als Kraft [zu finden], die hinter der Ausdehnung des Big Bang steht, allerdings nur in der wörtlichen Übersetzung! Die Aussage der Texte ist so verblüffend korrekt, daß ich gleich mehrere leicht unterschiedliche Formulierungen des identischen Sachverhalts anführen möchte – wortgetreu nach dem hebräischen Text…“
Allerdings handelt es sich in all den hier von Ihnen angeführten Bibelstellen um keinerlei neue Argumente, weil Sie sich überall auf die nicht wirklich eindeutige Bedeutung von NaTaH = „sich ausdehnen“ beziehen – an vier Stellen steht NoTäH SchaMaJiM = „die Himmel ausbreitend bzw. ausdehnend“ (Jesaja 44,24; 51,13; Hiob 9,8; Sacharja 12,1), in Jesaja 42,5 ist der Ausdruck etwas erweitert: „erschaffend die Himmel und sie ausspannend bzw. ausdehnend“. Hinzufügen möchte ich noch Jeremia 10,12 und 51,15, wo NataH SchaMaJiM steht: „er breitet den Himmel aus“.
Widerlegt wird Ihre Interpretation letztendlich durch das von Ihnen angeführte Psalmwort 104,2. Sie übersetzen diesen Vers bezeichnenderweise unvollständig mit „(Jahwe), du bist ausbreitend die Himmel ausdehnend“ und verfälschen dadurch den Sinn. Der ganze Satz lautet nämlich: NOTäH SchaMaJiM CaJeRIˁAH = „er spannt den Himmel aus wie ein Zelt / eine Zeltdecke“.
Damit schließt sich der Kreis: Dieser Vergleich des Himmels mit einem Zelt bestätigt, dass wohl auch in Jesaja 40,22 wirklich ein poetischer Vergleich des Himmels mit einem Schleier vorliegt und keine naturwissenschaftlich-kosmologische Aussage. Oder wollen Sie auch die Zeltdecke in „feine, sich ausdehnende Staubteilchen“ umzudeuten versuchen?
Von daher mögen Menschen in der Moderne, wenn sie religiös sind, Gott durchaus als Urheber der kosmischen Ausdehnung betrachten, während religiöse Skeptiker dies bestreiten. Keineswegs müssen Skeptiker allerdings zugeben, dass schon „Autoren des ‚Alten Testaments‘ … das Prinzip der ständig anhaltenden Ausdehnung des Universums bekannt“ war.
↑ Vegetarismus, Schächtung, Ausländerfeindlichkeit und Zoologie
Unter (S. 160f.) V wie Vegetarimus fragen Sie sich:
„Was soll der Mensch nach den Vorschriften der Bibel essen? Fordert der Gott der Bibel den Menschen zum Fleischverzehr auf? Oder zum Vegetarismus? Die Bibel bietet Antworten, die einander vollkommen widersprechen.“
Es stimmt: In der Bibel gehört zur Vorstellung eines gottgewollten paradiesischen Urzustandes auch die vegetarische Lebensweise. 1. Mose 1,29 zufolge soll sich der Mensch nur von Pflanzen ernähren. Es hat immer wieder auch christliche Gruppen und Personen gegeben, die unter anderem auf Grund solcher Bibelstellen für radikale Positionen des Tierschutzes eingetreten sind (72).
Erst nach der Sintflut (1. Mose 9,3f.) darf die Menschheit auch tierische Nahrung zu sich nehmen, außer wenn im Fleisch Blut – als Symbol des Lebens – enthalten ist. Sie finden diese „konträren Aussagen der Bibel“ einfach nur „widersprüchlich und teilweise unverständlich“, aber mir scheint es schon nachvollziehbar, wenn die vegetarische Lebensweise einem Zustand zugeordnet wird, in dem der Mensch in vollkommenem Einklang mit Gott, seinem Mitmenschen und auch der Tierwelt ohne jede Gewalt gesehen wird, während die Erlaubnis, Fleisch zu essen, mit den Erfahrungen einer aus diesem Urzustand herausgefallenen Welt einhergeht – vom Misstrauen gegen Gott über den Brudermord und die Hybris des Turmbaus bis hin zur Sintflut als Strafe für eine von Grund auf verdorbene Menschheit. Nicht-vegetarisch zu leben ist sozusagen ein Zugeständnis an nicht-vollkommene, fehlbare Menschen.
Wenn Sie nun behaupten, dass „der Mensch zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nachvollziehen kann“, was die Bibel für die Schlachtung von Tieren vorschreibt, dann blenden Sie heutige Juden und Muslime aus, die doch auch Menschen des 21. Jahrhunderts sind. Ich kenne mich mit den Vorschriften für die Schächtung nicht genau aus, weiß aber, dass nicht alle Muslime jede Betäubung beim Schächten ablehnen; das Problem wird intensiv diskutiert. Auf einer jüdischen Internetseite fand ich Erläuterungen zur Schächtung, die davon ausgehen, dass bei verantwortungsbewusster Durchführung des Schächtungsvorgangs die Tiere nicht unnötig leiden müssen.
Über die Ursachen der alttestamentlichen Speisegebote kann auch ich nur spekulieren (73). Hygienische Gründe genügen höchstens zu einem kleinen Teil als Erklärung; vielleicht entsprachen viele von ihnen altüberkommenen Gewohnheiten, die später religiös überhöht wurden; bei den Juden dienten sie auf jeden Fall auch als rituelle Symbole der Zugehörigkeit zu dem besonderen von Gott auserwählten Volk.
Ihrer in diesem Zusammenhang geäußerten pauschalen Unterstellung einer (S. 162) „unakzeptablen Ausländerfeindlichkeit“ des jüdischen Volkes widerspreche ich insofern, als sich zwar das Volk Israel tatsächlich als heiliges Volk im Gegensatz zu den Fremdvölkern, den Gojim, empfand, aber nach 5. Mose 7,7f. nicht etwa aus einem Überlegenheitsgefühl heraus, sondern als kleines und kräftemäßig den Gojim unterlegenes Volk, das sich nur durch Gottes Macht vor den Gojim schützen kann:
„Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat“.
Neben den Geboten zur Abgrenzung von den Gojim gibt es in der Bibel im Übrigen auch immer wieder Geschichten von der Überschreitung dieser Grenzen – von Moses Heirat der Midianiterin Zippora (2. Mose 2,21) bis zur Urgroßmutter des Königs David, der Moabiterin Ruth. Zudem erinnerte sich Israel an die eigene Erfahrung, selber Fremdling und Flüchtling gewesen zu sein, so dass zu den wichtigsten Geboten der Tora auch 3. Mose 19,33-34 gehört:
„Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott.“
Dass Juden ihren nichtjüdischen Nachbarn Fleisch verkaufen durften, das nicht koscher war (5. Mose 14,10), hatte sicher nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, zumal es diesen nicht zwangsweise aufgenötigt, sondern nur angeboten wurde.
Dass sich in der Bibel auch Irrtümer der biologischen Zuordnung von Tieren zu bestimmten Arten finden, die Sie „skurril-witzig“ finden, verschafft Ihnen erkennbare Befriedigung. Hat man den Hasen vielleicht als Wiederkäuer eingestuft, weil er seinen eigenen Kot frisst? Wie dem auch sei – natürlich zeigt sich hier nur erneut, dass die Bibel auch kein von Gott offenbartes zoologisches Lehrbuch ist.
↑ Symbolhafte Erzählungen der Bibel und lebensrettende Wale
Im Blick auf (S. 163) Jona, der vom W wie Walfisch verschlungen und wieder ausgespuckt wurde, beherzigen Sie endlich einmal Ihre im Vorwort ausgesprochene Einsicht, dass biblische Texte als Glaubensgeschichte ernstgenommen werden und nicht im Sinne historisch und naturwissenschaftlich unrichtiger Faktenwiedergabe missverstanden bzw. lächerlich gemacht werden sollten. Sie haben Recht (S. 164f.):
„Man muß einen Text nicht nur Wort für Wort übersetzen, um ihn zu verstehen. Im Fall von orientalischen Texten werden auch Bilder benützt, die symbolhaft auszulegen sind.“
Und auch Ihrem Fazit zu diesem Abschnitt stimme ich zu (S. 165):
„Der Bibelleser irrt, der den Text als kuriosen Bericht über ein Ereignis versteht, das sich so wie beschrieben nicht abgespielt haben kann. Erst wenn nicht nur die fremdsprachigen Worte der Bibel, sondern auch symbolhafte Bilder in unsere heutige Sprache übersetzt werden, wird die Aussage der Bibel verständlich. Ob man sie akzeptiert oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt.“
Allerdings – gerade zur Frage, ob ein „noch so großer Walfisch einen Menschen verschlucken und ihn lebendig und gesund nach drei Tagen wieder ausspucken kann“, gibt es neuerdings durchaus zustimmende Antworten – mal abgesehen davon, dass ein Wal ein Säugetier und kein Fisch ist. Der Naturforscher Vitus B. Dröscher (74) hält es etwa für möglich, dass ein Mensch in der Maulhöhle eines Wals überleben kann:
„Von Delphinen wissen wir auch seit der griechischen Antike, dass sie ertrinkende Menschen an die Meeresoberfläche heben und ans rettende Ufer bringen. Der Drang zu dieser paradiesischen Hilfeleistung entstammt dem Verhalten dieser ‚Wunderkinder des Meeres‘ bei der Geburt. Sobald das Neugeborene erschienen ist, schieben sich zwei, drei, manchmal sogar noch mehr Lebensretter unter das Baby und tragen es nach oben, damit es seine ersten Atemzüge tun kann. Auch verletzten Schwarmgenossen leisten sie so lange diesen Rettungsdienst, bis diese wieder gesund sind und aus eigener Kraft atmen können.
Ganz ähnlich verhalten sich auch Pottwale. Ist während der Geburt aber nur eine ‚Hebamme‘ zur Stelle, kann diese das immerhin schon vier Meter lange Junge nicht mit ihrem Kopf oder Rücken tragen, da es immer wieder seitlich abrutscht. In diesem und nur in diesem Fall öffnet die Helferin ihr Riesenmaul, umfasst mit ihm ganz zärtlich das Neugeborene und bringt es so zum Luftholen an die Oberfläche.“
Was Dröscher hier beschreibt, wurde im März 2019 in einem Bericht der „Welt“ bestätigt.
Trotzdem setze ich nicht voraus, dass die Jona-Geschichte ein Tatsachenbericht ist – es mag aber sein, dass die Erzähler der Episode mit dem Wal sich durchaus an lebensrettende Erfahrungen mit Meeressäugern erinnern konnten und sie darum in ihre Glaubenserzählung eingebaut haben.
Genau wie Sie halte ich es auch für müßig, darüber nachzugrübeln (S. 164), „ob Jesus an ‚Jonas im Wal‘ glaubte oder nicht.“ Tatsache ist, dass er nach den Aussagen der Evangelisten jedenfalls den dreitägigen Aufenthalt von Jona im Wal durchaus bildlich auf seinen eigenen dreitägigen Aufenthalt im Totenreich bezogen hat. Auch damit wird bestätigt, dass es hier nicht um Zoologie und historische Geschichtsschreibung, sondern um Glaubenserfahrungen geht.
↑ Die Erde in der Bibel – eine Kugel voll Magma über dem Nichts
Zum Stichwort (S. 165) W wie Weltbilder legen Sie zunächst ausführlich dar, dass zur Zeit des Kolumbus durchaus nicht nur er bereits wusste (S. 168), dass „die Erde eine Kugel ist“. Ebenso halten Sie es für einen Irrtum, den Autoren des Alten Testaments das falsche „orientalische Weltbild“ zu unterstellen, das wie folgt aussah:
„Glaubten sie an eine scheibenförmige Erde, die auf massiven Säulen steht wie eine Plattform? Darunter muß man sich das Totenreich vorstellen. Über der Scheibe wölbt sich eine harte Kuppel, an der Sonne und Mond sowie die Sterne kleben wie an einer schlichten Theaterkulisse einer Laienspielbühne. Die Kuppel trennt uns von den himmlischen Wasserspeichern darüber, die gelegentlich ihre Schleusen öffnen kann. Dann regnet es, oder es bricht eine neue Sintflut über uns herein.“
Ihre Zweifel daran, dass die Bibel dieses Weltbild teilt, stützen Sie mit der Feststellung, dass
„es nirgendwo im ‚Alten Testament‘ eine zusammenhängende Beschreibung [gibt], der man entnehmen könnte, wie zu biblischen Zeiten Erde und Weltall gesehen und verstanden wurden. Es gibt einzelne, verstreute Hinweise. Die gilt es nun zu interpretieren. Die Übersetzer gingen vom altorientalischen Weltbild aus und bestätigten ihre von Anfang an feststehende Überzeugung. Irrten die Übersetzer? Vermutlich ist das so!“
Bevor Sie allerdings (S. 169) die angekündigte Interpretationsarbeit mittels „detektivischer Recherche“ leisten, staunen Sie schon einmal im Voraus darüber, „wie modern und korrekt das biblische Weltbild war.“
Dann kommen Sie erstens wieder auf die Bibelstelle Jesaja 40,22 zurück, die Sie schon vergeblich bemüht haben, um in der Bibel die Vorstellung vom sich ausdehnenden Universum wiederzufinden.
Die Übersetzung „Er (Gott Jahwe) thront über dem Kreis der Erde“ wollen Sie nicht auf eine „Erdscheibe“ bezogen wissen, „die zu Füßen Jahwes lag“, weil das von Luther mit „Kreis“ übersetzte Wort ChUG nach dem Bibelforscher Karel Claeys von dem Verb ChaGaG abgeleitet sein soll, das zunächst „sich kreisend drehen oder rotieren“ bedeutete, woraus im „weiteren Sinne“ die „tanzende Bewegung“ wurde.
Tatsächlich ist ChaGaG in der Bibel fast immer mit der Bedeutung „Feste feiern“ belegt, in Psalm 107,27 heißt es einmal „taumeln“, bezogen auf schwankende Schiffe im Meer. Abgesehen davon muss ChUG nicht wirklich von ChaGaG abgeleitet sein; näher liegt die Ableitung von der Wurzel ChUG = „einen Kreis beschreiben, abzirkeln“.
Sehr vollmundig schreiben Sie:
„Der niederländische Bibelforscher Karel Claeys kommt nach sorgsamer Überprüfung aller Varianten von ‚chug‘ im ‚Alten Testament‘ zu folgender Erkenntnis: ‚Beim Überdenken der einzelnen Begriffe wird deutlich, daß sie alle eine Umspannung, ein Umfassen, ein Bedecken oder Bekleiden eines bestimmten dreidimensionalen Körpers, und zwar eines rundlichen Körpers, bezeichnen.‘ (75) Nach Claeys muß es sich dabei um die ‚Kugelschale‘ oder ganz einfach ‚die Kugel‘ gehandelt haben.“
Nun kommt das Wort ChUG tatsächlich außer in Jesaja 40,22 nur noch drei Mal in der Bibel vor. Bei meiner Überprüfung all dieser Stellen ist mir nichts aufgefallen, was zwingend auf die Beschreibung von etwas Kugelförmigem hindeuten würde:
In Sprüche 8,27 beschreibt die personifizierte Weisheit, dass sie dabei war, als Gott als Schöpfer „einen Kreis über dem Angesicht der Tiefe“ abmaß, wobei TheHOM = „Tiefe“ gleichbedeutend ist mit der antiken Vorstellung des Chaoswassers. Eine Erdkugel über einer Wasseroberfläche abzumessen, macht jedenfalls im modernen Weltbild keinen Sinn. Dass zwei Verse weiter von Gott die MOSsaD = „die Grundfesten“ der Erde abgemessen werden, spricht im Übrigen eher dafür, dass hier eben doch die tragenden Pfeiler für eine Erdscheibe in die Wassertiefen eingerammt werden sollen.
Auch in Hiob 26,10 geht es um eine Grenze, die als Kreis über der Fläche des Wassers bzw. am Rand des Wassers gezogen wird. Auch hier macht die Bedeutung „Kugel“ keinen Sinn.
In Hiob 22,14 schließlich wird jemand zitiert, der Gott nicht zutraut, durch die Wolken hindurchsehen zu können, und Gott unterstellt, dass er nur „am Kreis bzw. am Rande des Himmels“ einhergehen kann. Es würde keinen Sinn machen, von Gott zu sagen, dass er „auf der Kugel des Himmels“ wandeln würde.
Die Übersetzung von Jesaja 40,22 mit „Er (Jahwe) thront über der Kugel der Erde“ ist mithin alles andere als zwingend geboten.
Zweitens (S. 169f.) zitieren Sie einen Vers, der eindrucksvoll modern klingt, nämlich Hiob 26,7: „Er (Jahwe) hängt die Erde über das Nichts.“ Wenn Sie (S. 170) die wörtliche Übersetzung von BeLI-MaH = „Nicht-Etwas“ aber in „moderne Wissenschaftssprache“ mit „Vakuum“ übertragen wollen, überziehen Sie eindeutig die induktive Beweiskraft Ihrer Schlussfolgerungen, denn nicht alles, was man in der Antike mit dem Begriff „Nichts“ gemeint hat, muss identisch sein mit der sehr eingegrenzten Bedeutung des modernen Begriffs „Vakuum“.
Zwar können Sie gerne biblische poetische Ausdrucksformen mit modernen Vorstellungen assoziieren, somit auch Jesaja mit Hiob verbinden: „Gott hängte die Erdkugel über das Nicht-Etwas.“ Aber dass „der Ausdruck für Kugel das Moment des Drehens enthält“, würde ich schon mal nicht als zwangsläufige Nebenbedeutung ansehen, und erst recht kann man aus der Bibel nicht „diese Information“ herauslesen: „Die Erde wurde als eine sich drehende Kugel über oder im Vakuum gesehen.“ Da haben Sie Eisegese statt Exegese getrieben – nicht Auslegung, sondern Hineinlegung eines modernen Sinnes in einen antiken Text mit anderen Verständnisvoraussetzungen.
Und selbst wenn Sie für diesen einen Vers im Buch Hiob Recht haben sollten – wie passt es dazu, dass in Hiob 9,6 und 26,11 von den ˁAMMUDI = „Pfeilern“ der Erde und des Himmels die Rede ist und dass unmittelbar vor der Aufhängung der Erde über dem Nichts in Hiob 26,6 vom ScheˀOL = „Totenreich“ die Rede ist? Ein solches Weltbild-Mixing zwischen modern und antik wäre doch sehr eigenartig.
Drittens wollen Sie unter Bezug auf Psalm 146,6 (fälschlich nennen Sie einen nicht existierenden 246. Psalm – wohl auf einen Druckfehler zurückzuführen) nachweisen, dass im Alten Testament auch schon „Hinweise auf das Erdinnere“ zu finden sind. Tatsächlich steht in diesem Vers aber nicht wirklich, dass „unser Planet Gott Jahwe“ gehört“, und schon gar nicht ist die Rede davon, „was darinnen ist“, nämlich im Kern dieses Planeten, sondern er spricht vom Himmel, von der Erde, vom Meer und von allem, was sich „in“ diesen als Lebensräumen verstandenen Bereichen befindet, nämlich von den „unter“ dem Himmel, „im“ Meer und „auf“ der Erde lebenden Geschöpfen (die hebräische Präposition Bə deckt in diesem Zusammenhang alle diese Bezugnahmen ab).
In Ihrer Anmerkung 6, die aber keinen Bezug zum Text hat, erwähnen Sie außerdem Psalm 24,1 – in dessen Lutherübersetzung kommt zwar auch die Formulierung „was darinnen ist“ vor, aber hier ist Luther schlicht ungenau. Wörtlich steht in diesem Vers nämlich nicht, wie es nach Luther heißt: „Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen“, sondern die Elberfelder Übersetzung von 2006 ist näher am Urtext: „Des HERRN ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen.“ Das Wort TheBeL, hier mit „Welt“ übersetzt, ist zwar gleichbedeutend mit „Erde“, aber das Wort BaHH, das wörtlich auch mit „in ihr“ übersetzt werden könnte, kann sich hier nicht auf das Erdinnere beziehen, denn welche Lebewesen sollten innerhalb der Erdkugel wohnen? Also muss korrekt „auf ihr“ bzw. „darauf“ übersetzt werden; gemeint ist alles, was die (Oberfläche der) Erde erfüllt und was „auf“ dem Erdkreis lebt. Somit bestätigt dieser Vers die richtige Lesart auch von dem, was in Psalm 146,6 „auf“ und nicht „innerhalb“ der Erde zu suchen ist.
Dass Sie außerdem noch Psalm 136,6 von Gott, „der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat“, auf das im Inneren der Erde befindliche Magma beziehen wollen, entbehrt nicht der Komik. Selbst wenn das hebräische Wort MaJiM = „Wasser“ vielleicht ursprünglich, wie der „Sprachkundler und Lexikograph König“ (76) meint, eine „leicht strömende und zerrinnende Masse“ bezeichnete, wäre wohl niemand, der den Psalm 136 betete, darauf gekommen, sich unter dem Allgemeinbegriff MaJiM, den jeder mit Wasser verband, an dieser Stelle ausnahmsweise die „leicht strömende und zerrinnende Masse“ des Magma im Erdinnern vorzustellen. Noch heute macht sich ja wohl kaum ein Durchschnittsbürger tagtäglich bewusst, was sich unter seinen Füßen im Erdkern verbirgt.
Sie begründen Ihre abwegige Argumentation allerdings damit, dass die traditionelle Übersetzung des Verses „eigentlich unverständlich“ ist. Das ist aber insofern keineswegs der Fall, da Gott nach dem antiken Weltbild und nach einigen auch von mir oben schon zitierten Bibelversen (etwa Sprüche 8,27) die Erde mit ihren Grundfesten oder Pfeilern ja genau über dem Abgrund der Tiefen des Chaoswassers errichtet hat. Darunter konnten sich die Menschen damals durchaus mehr vorstellen als unter irgendeiner undefinierbaren „leicht strömenden und zerrinnenden“ Masse.
Viertens finden Sie (S. 171) in Psalm 136,6 das Verb „ausbreiten“, auf Hebräisch RaQAˁ, interessant. Da das Wort RaQ (unter anderem) „dünn“ heißen kann, legt sich der von Ihnen schon oft als Kronzeuge angeführte Karel Claeys (77) bei der Bedeutung von RaQAˁ auf „das Ausbreiten einer dünnen Schicht“ fest. Soll man Psalm 136,6 daraufhin wirklich mit „Der die Erde über der leicht strömenden und zerrinnenden Masse in einer dünnen Schicht ausgebreitet hat“ übersetzen können? Derart naturwissenschaftlich neuzeitlich hat damals sicher niemand denken können oder auch nur wollen.
Dass man als Mensch „zu Beginn des dritten Jahrtausends“ Ausdrucksweisen der Bibel, die auf ein anderes Weltbild bezogen waren, heute mit Recht darauf beziehen darf, dass etwa „die Erdteile … ‚wie Eisschollen im Wasser auf dem schweren magmatischen Untergrund‘ (78)“ schwimmen, ist für mich in Ordnung. Aber die Behauptung, dass diese moderne Erkenntnis bereits einem biblischen Psalmdichter zugänglich war, ist auch durch spitzfindige hebräische Wortuntersuchungen nicht zu beweisen. Ein solcher Beweis müsste auch wenigstens ansatzweise eine Erklärung dafür liefern, wie die biblischen Autoren zu diesen Erkenntnissen gekommen sein könnten.
Widersprüchlich finde ich übrigens an Ihrer Argumentation, dass Sie einerseits unter dem Stichwort S wie Schöpfungsberichte der Bibel jede Menge doch wohl auch einem falschen Weltbild geschuldete Irrtümer nachweisen wollen, während Sie unter U wie Urknall oder W wie Weltbilder umgekehrt den Übersetzern der Bibel den Irrtum unterstellen, die Autoren der Bibel auf ein überholtes antikes Weltbild festzulegen.
↑ Das Buch Ester – ein „Kuckucksei“ aus dem Mittelalter?
Zu (S. 172) X wie Xerxes beschäftigen Sie sich mit dem Buch Ester, das Sie als „Kuckucksei“ der Bibel bezeichnen (S. 173), unter anderem weil es angeblich „fremdartig unreligiös“ ist und „überhaupt nicht in die Bibel“ passt. Insbesondere (S. 175) fällt das
„Buch Esther … aus dem Rahmen, weil nirgendwo auf Gott hingewiesen wird. Da drohte den Juden ein gemeinsames blutiges Ende, aber sie beteten nicht. Sie jammerten und wehklagten, zerrissen ihre Kleider und hüllten sich in Sack und Asche.“
Befragt man allerdings Wikipedia zum Buch Ester, dann erfährt man eine differenziertere Deutung des religiösen Gehalts dieses Buches:
„Das Tetragramm für den Gottesnamen JHWH (‚Herr‘ in der Übersetzung Martin Luthers) und das Wort Gott kommen in der hebräischen Originalfassung im ganzen Buch nicht explizit vor; sie erscheinen allerdings in der längeren griechischen Version. Trotz dieses ‚Gottesschweigens‘ ist das Buch Ester ein ‚hoch-theologisches Buch‘, da es ‚urbiblische Gottesgewissheit‘ vermitteln will [Erich Zenger]: Die Leser sollen selbst schlussfolgern, dass die vordergründig durch Ester und Mordechai bewirkte Rettung der Juden auf Gott zurückzuführen sei.“
Nach demselben Wikipedia-Artikel ist Ihnen in Ihrer historischen Einordnung des Buches Ester vollständig Recht zu geben:
„Nach dem Urteil der heutigen historisch-kritischen Forschung besteht ‚äußerste Skepsis‘, ob das Buch Ester einen tatsächlichen historischen Hintergrund hat: ‚Primär handelt es sich um ein literarisches Kunstwerk, um Dichtung, nicht um einen historischen Bericht‘ (Esther Brünenberg). Es wird auch angenommen, dass das Buch Ester wohl erst nachträglich die Legende zum Purimfest geworden ist, welches vorgegeben war und wohl ‚als eine Art Neujahrsfest im persischen oder mesopotamischen Raum vom Judentum übernommen‘ wurde [Werner H. Schmidt].“
Das Buch Ester mit Uwe Topper erst ins 12. Jahrhundert n. Chr. zu datieren und demzufolge als „Kuckucksei aus dem Mittelalter“ zu betrachten, halte ich für unangemessen, zumal Topper, nebenbei bemerkt, alle biblischen Bücher als mittelalterliche Fälschungen betrachtet. Historisch-kritische Forscher vertreten nach dem erwähnten Wikipedia-Artikel (meines Erachtens zu Recht)
„eine Datierung des Buches Ester in das 3. Jahrhundert v. Chr. … Dafür spricht…, dass das Thema Judenverfolgungen in der Zeit der Diadochenkämpfe nach dem Tod Alexanders des Großen aktuell war [Erich Zenger].“
Bei Rabbinern und Kirchenvätern der ersten nachchristlichen Jahrhunderte war das Buch Ester jedenfalls bereits bekannt, sei es, weil sie seine Kanonizität bestritten oder es als zweitrangig ansahen.
Noch etwas, was Sie (S. 173) beim Buch Ester als „einzigartig“ bezeichnen, nämlich dass wir „in unseren Bibeln nur einen Teil des ursprünglichen Werkes“ finden, „nämlich Kapitel 1 bis Kapitel 10, Vers 3“, trifft erstens mit dem Wort „ursprünglich“ nicht den wahren Sachverhalt. Zum von der evangelischen Kirche anerkannten und in der Lutherbibel vorausgesetzten biblischen Kanon gehören tatsächlich alle ursprünglichen in hebräischer Sprache abgefassten Teile des Buches Ester. Griechisch verfasste Teile kamen erst später hinzu, wie man in Wikipedia lesen kann:
„Das Esterbuch in der Septuaginta hat erhebliche Veränderungen und Zusätze zum hebräischen Text, die wohl erst einige Zeit später geschrieben wurden (1. Jahrhundert vor Christus). In der Lutherbibel stehen die Zusätze als ‚Stücke zu Ester‘ unter den Apokryphen.“
Zweitens ist das Buch Ester nicht das einzige, zu dem es griechische Ergänzungen in der Septuaginta gibt; so stehen zusätzlich zum Buch Daniel in den Apokryphen der Lutherbibel auch die nicht-kanonischen „Stücke zu Daniel“. In der katholischen Kirche werden übrigens die Ergänzungen sowohl zu Ester als auch zu Daniel als zum biblischen Kanon gehörig anerkannt.
↑ Kabbalistische Zahlenmystik und symbolische Zahlen in der Bibel
Zum Buchstaben Y fiel Ihnen wohl nichts Passendes im Alten Testament ein, so dass Sie (S. 177) den nicht gerade zentralen Begriff Y wie Yesod aus der jüdischen Kabbala verwendet haben, um sich ein wenig mit kabbalistischen Interpretationen hebräischer Worte auf Grund ihres zahlenmäßigen Buchstabenwerts zu beschäftigen. Schwierig ist es, auf Deutsch im Internet etwas über „Yesod“ herauszufinden, denn in deutscher Umschrift lautet der hebräische Begriff eigentlich JeSsoD oder vereinfacht Jesod, aber dann hätte er ja nicht mehr unter Y aufgeführt werden können.
Die anthroposophische Internetseite AnthroWiki weiß über das Wort folgendes zu sagen:
Jesod (hebr. … [=] Fundament) ist die neunte Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Hod (Pracht, Majestät) und Nezach (Sieg) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.
Jesod bildet den neunten Pfad der 32 Pfade der Weisheit und repräsentiert die reine Intelligenz.
Auf dem mystischen Weg, wie sie etwa in der Einweihung der Essener beschritten wurde, erlebte man die Trias von Nezach, Hod und Jesod bei der Versenkung in den eigenen Astralleib.
Aus diesen Ausführungen geht allerdings nicht hervor, was nach Ihrem Gewährsmann Schindler-Bellamy „das Geheimnis von Yesod“ sein soll, nämlich „die verschlüsselte Bedeutung von Worten, die sich einer Übersetzung entzieht“. Verschiedene Methoden einer solchen kabbalistischen Zahlenmystik werden nach Wikipedia vielmehr Gematria, Notarikon und Temura genannt. Da Sie sich in diesem Abschnitt konkret auf das Notarikon beziehen, müsste er eigentlich mit N wie Notarikon überschrieben sein. Dazu steht im genannten Wikipedia-Artikel:
„Notarikon wird auch synthetisierende Zahlenmystik genannt und erfolgt durch Erweiterung und Ergänzung von Buchstaben und Worten.“
Als Beispiel dafür führen Sie (S. 178) genau wie Wikipedia das Wort „Nimrezet“ in 1. Könige 2,8 an, das Ihrer Ansicht nach „Flüche“ bedeutet und dessen Anfangsbuchstaben den von König David in seinem Testament genannten „Simei“ (genauer SchiMˁI = Schimi) folgendermaßen charakterisieren sollen:
„Der Nachkomme Ruths soll ein grausamer, gewalttätiger Mensch sein, der Ehebruch begangen und gemordet hat.“
Allein in diesen wenigen Angaben stecken zwei Fehler.
Erstens heißt das Wort NiMRäTsäTh (79) gar nicht „Flüche“. Es kommt von der Wurzel MaRaTs = „grausam, schmerzvoll sein“ und bezeichnet die Härte des Fluchs, der „schlimm“ oder „krank machend“ war. Die Verfluchung selbst wird doppelt mit zwei von der Wurzel QaLaL abgeleiteten Worten ausgedrückt: QaLeLaNI QeLaLaH NiMRäTsäTh = „er verfluchte mich – mit einem Fluch – einem krank machenden“.
Zweitens ist Simei kein „Nachkomme Ruths“. Sie kommen darauf, weil Sie die Anfangsbuchstaben des Wortes „nmrzt“ als Abkürzungen für folgende Wörter nehmen:
N für „noeph“ (Ehebrecher),
M für „Moabiter“ (von Ruth abstammend),
R für „rozeach“ (Mörder),
Z für „zores“ (Gewalttätiger),
T für „thoeb“ (Grausamer).
Dabei verbinden Sie das M wie Moabiter fälschlich mit der Abstammung von Ruth, als ob alle Moabiter Nachkommen Ruths sein müssten. Ironischerweise waren zwar sowohl König David als auch sein Sohn Salomo Nachkommen Ruths (Urenkel bzw. Ururenkel), aber nicht Simei. Der gilt nach der Methode des Notarikon einfach als Moabiter ohne irgendeinen positiven Bezug auf die Ausnahmegestalt der Ruth, also als Angehöriger eines mit Israel verfeindeten Volkes (80).
Im Folgenden gehen Sie dann auch noch, ohne ihren Namen zu nennen, auf eine zweite Methode der Zahlenmystik ein:
„Der kundige Leser von Schriften aus dem ‚Alten Testament‘ hatte ein schier unerschöpfliches Betätigungsfeld. So galt es zu bedenken, daß jeder Konsonant zugleich auch einen Zahlenwert hatte. Worte konnten also in Zahlen ausgedrückt werden. Auch ermittelte man den Zahlenwert von Worten, indem man die Zahlenwerte ihrer Konsonanten zusammenzählte. Worte mit gleichem Zahlenwert hatten eine innere Verbindung miteinander und durften zudem, davon war man überzeugt, im Text gegeneinander ausgetauscht werden. ‚Achad‘ (Einheit) und ‚ahabha‘ (Liebe) haben beide den Zahlenwert 13.“
Bei dieser Methode handelt es sich um die kabbalistische Gematria, zu der es im oben erwähnten Wikipedia-Artikel heißt:
Gematria wird auch identisierende Zahlenmystik genannt. Beispiel: Das hebräische Wort AChaD … bedeutet „ein“ und hat den Zahlenwert 13 (1+8+4). Das hebräische Wort AHaWA … bedeutet „Liebe“ und hat ebenfalls den Zahlenwert 13 (1+5+2+5). Beide Worte sind laut der Gematria austauschbar:
„Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch.“ (1. Buch Mose 2,24)
Die Gematria überführt ein Wort in seinen Zahlenwert, um eine verborgene oder andere Bedeutung zu finden. Dann wird aus dem gleichen Zahlenwert ein neues Wort gebildet. Das Wort ein – im obigen Vers – kann dementsprechend zum Wort Liebe umformuliert werden, weil beide den gleichen Zahlenwert haben:
Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein liebendes Fleisch.
Sehr interessant und beherzigenswert finde ich in diesem Zusammenhang Ihre Bemerkung:
„Zahlen wiederum haben eine tiefe, innere Bedeutung, die auch bei Übersetzungen nicht zu erkennen ist. Häufig werden in der Bibel Zeitangaben gemacht. Es ist aber ein Irrtum, anzunehmen, daß sie wörtlich und konkret zu nehmen sind. Auch hier gibt es wieder den tieferen, inneren Sinn.“
Eigenartig ist aber, dass Sie selbst schon mehrfach gegen Ihren eigenen Rat verstoßen haben, indem Sie sich über widersprüchliche biblische Zahlen oder zu hohe Altersangaben lustig gemacht haben, die nicht der Realität oder der historischen Geschichte entsprechen können.
Im Zusammenhang mit König Saul übersehen Sie übrigens einen biblischen Widerspruch bzw. Irrtum. Sie schreiben: „Saul, David und Salomo regierten je 40 Jahre.“ Für Saul gibt es dazu nur die neutestamentliche Angabe in Apostelgeschichte 13,21. In 1. Samuel 13,1 heißt es aber:
„Saul war… Jahre alt, als er König wurde, und zwei Jahre regierte er über Israel.“
Das heißt: An der Originalstelle im Alten Testament ist die Altersangabe Sauls schlicht ausgefallen, und dass die Regierungszeit Sauls tatsächlich nur zwei Jahre betrug, ist angesichts der Vielzahl von Berichten über sein Königtum unwahrscheinlich; viele Bibelwissenschaftler vermuten daher, dass hier ursprünglich zwanzig oder zweiundzwanzig gestanden habe. Die Zeittafel der Lutherbibel 1984 nimmt eine Regierungszeit von 1012-1004 v. Chr. an.
Für den Archäologen Israel Finkelstein ist klar (81):
„Die jeweils vierzigjährige Regierungszeit Salomos und Davids muss als eine symbolische Zahl betrachtet werden. Auch die zeitlichen Angaben zu Sauls Herrschaft sind höchst unzuverlässig. Die drei frühisraelitischen Könige Saul, David und Salomo aufeinander folgen zu lassen, könnte das Werk eines späteren Bearbeiters gewesen sein.“
Finkelstein nimmt im Übrigen an, dass es nie ein Großreich Israel unter Saul, David und Salomo gegeben hat, sondern dass Saul und David mit sich überschneidenden Regierungszeiten unterschiedliche kleine Königreiche im Norden und im Süden Palästinas beherrscht haben. Er gesteht zu, dass man „den Kern der Geschichte über das saulidische Reich als eine authentische, wenngleich vage Reminiszenz an den Norden betrachten“ kann (82):
„Mir scheint, dass Überlieferungen zu Saul im späten 8. Jahrhundert nach dem Untergang des Nordreichs mit israelitischen Flüchtlingen nach Juda gelangten, möglicherweise in mündlicher Form.“
So viel zu einem möglichen Zusammenhang zwischen Archäologie bzw. historischer Forschung und einer Ausgestaltung überlieferten Materials in theologisch deutender Absicht.
Nach einer Aufzählung vieler Bibelstellen, die die Zahlen 40 und 7 erwähnen, kommen Sie zu dem Fazit (S. 180):
„Der heutige Bibelleser muß bei der Lektüre zwangsläufig irren: Weil er nicht erkennen kann, was sich hinter Buchstaben und Zahlen bildhaft oder symbolisch ausgedrückt verbergen kann. Es ist an der Zeit, daß in aktuellen Bibelausgaben auf die Aussagen hinter den Aussagen verwiesen wird. Denn nur dann besteht für jeden die Chance, die Bibel wirklich zu verstehen.“
Was ist von diesem Vorwurf zu halten? Nicht viel. Denn es gibt ja bereits Erklärungsbibeln, die sich der interessierte Bibelleser anschaffen kann, um etwas über die Hintergründe der Bibelauslegung zu erfahren (83). Gängige Bibelübersetzungen in handlichem Format dagegen bieten überhaupt nicht genügend Raum, um auch nur ansatzweise den Feinheiten der Bedeutung einer bestimmten Bibelstelle gerecht zu werden. Schon die vielen in Ihrem Buch aufgeführten Probleme zeigen ja, dass es eine Unzahl strittiger Fragen der Bibelauslegung gibt, die man in kurzen Erläuterungen gar nicht ausschöpfen geschweige denn eindeutig klären könnte. Letzten Endes reichen Tausende von Büchern und Millionen von Predigten nicht aus, um die Wahrheit der biblischen Botschaft in ihrer Vielfalt und Tiefgründigkeit auszuschöpfen. Ein Leben genügt nicht, sie zu verstehen!
↑ Zahlen: Hier irrt die Bibel
Ausgerechnet unmittelbar nach Ihrer Einsicht, dass die Zahlenangaben der Bibel häufig symbolisch zu verstehen sind (S. 180), reiten Sie unter Z wie Zahlen nun doch wieder auf historischen Irrtümern der Bibel herum, die sich durch widersprüchliche Zahlenangaben belegen lassen.
Dabei ist es doch völlig normal, in einem Werk der Glaubensgeschichte zwar davon auszugehen, dass die Autoren ihre Überlieferungen so getreu wie möglich weiterzugeben versuchen, dass aber dennoch alle Zahlenangaben mit großer Vorsicht zu betrachten sind. Das ist ja sogar der Fall, wenn objektive Geschichtsschreibung beabsichtigt wird. Man denke nur an die je nach Interessenlage voneinander abweichenden Angaben der Teilnehmerzahl an den großen Friedensdemonstrationen der 1980er Jahre.
Einige der von Ihnen angeführten Zahlen-Widersprüche oder -Irrtümer lassen sich bequem darauf zurückführen, dass es sich um symbolische Zahlen handelt, die etwa mit 40 und 7 zu tun haben, worauf Sie im vorigen Abschnitt hingewiesen hatten, zum Beispiel die „siebenhundert Wagen und vierzigtausend Mann“ in 2. Samuel 10,18 und (S. 181) die „siebentausend Wagen und … vierzigtausend Mann“ in 1. Chronik 19,18. Da der Bericht sowieso weitgehend fiktiv ausgestaltet ist, ist es letztlich auch unerheblich, welche der beiden Zahlenangaben nicht stimmt – mit der Historie haben beide Angaben nichts zu tun!
Auch beim Tempelbau Salomos finden wir eine symbolische Bauzeit von „sieben Jahren“ (nebenbei noch „70 000 Lastträger“), so dass es keinen Grund gibt, sich künstlich darüber aufzuregen, welche
„enormen Ausmaße … der Tempel gehabt haben [muss], damit über sieben Jahre hinweg so viele Menschen mit seinem Bau beschäftigt waren? Hätte nicht ein Weltwunder wie eine der ägyptischen Pyramiden entstanden sein müssen?“
Im Sinne der biblischen Autoren handelte es sich tatsächlich um ein Weltwunder, auch wenn die tatsächlichen Ausmaße des Tempels nur sehr bescheiden waren, denn es ging ja um den Ort, an dem die gewaltige Herrlichkeit des befreienden Gottes Israels angebetet werden sollte. Im Übrigen hatte der von Salomo errichtete Tempel nach einer Forschergruppe um Israel Finkelstein ursprünglich wohl noch bescheidenere Ausmaße als in der Bibel berichtet; gegen Ende des 9. Jahrhunderts v. Chr. könnte er von König Joas vergrößert worden sein (84).
Auch (S. 182) die Zahlenangaben für die Pferde, Pferdeboxen bzw. Gespanne Salomos riechen mit 4000, 40 000 und 4000 geradezu nach einer symbolischen Ausdrucksweise für den vollkommenen Reichtum dieses legendären Königs, wobei die extrem übertriebene Zahl 40 000 vermutlich auf einem simplen Kopierfehler beruht.
Nach Finkelstein und Silberman (85) lässt übrigens die
„anachronistische Beschreibung von Salomos Handel mit Pferden … den Schluß zu, daß man hier auf vage erinnerte Details des Pferdehandels im Nordreich Israel des 8. Jahrhunderts (und möglicherweise auch auf den sehr viel bescheideneren Pferdehandel in Juda) zurückgriff“.
Am Ende Ihrer Beschäftigung mit widersprüchlichen Zahlenangaben in der Bibel kommen Sie immerhin zu dem Fazit (S. 183):
„Zahlen über Zahlen werden von der Bibel angeboten. Widersprüche sind unübersehbar. Aber sind diese Irrtümer überhaupt von Bedeutung? Sie spielen keinerlei Rolle, wenn es um die rein geschichtlichen Abläufe der Bibel-Historie geht.“
↑ Warum stimmt die Chronik nicht exakt mit den Königebüchern überein?
Am Rande beklagen Sie im Abschnitt zu Z wie Zahlen auch (S. 182), dass „die Bücher der Chronik und die Bücher der Könige“ in ihren beeindruckenden Zahlenangaben häufig „stark … voneinander abweichen, wo sie eigentlich identisch sein und exakt übereinstimmen sollten“.
Das ist dadurch zu erklären, dass die Chronikbücher erst im 4. Jahrhundert v. Chr. in der persischen Provinz Jehud mit ganz anderen Interessenschwerpunkten entstanden als das im 6. Jahrhundert v. Chr. fertiggestellte „deuteronomistische Geschichtswerk“. Letzteres wurde wohl in einem langen Zeitraum aus alten Überlieferungen nach und nach zusammengetragen und schilderte die Geschichte Israels und Judas in den Büchern Josua, Richter, Samuel und Könige. Es wurde „deuteronomistisch“ genannt, weil es in seinen theologischen Bewertungen sehr stark vom 5. Buch Mose = Deuteronomium (= „zweites Gesetz“) geprägt war.
Aber warum wird in den Chronikbüchern die Rolle der uralten Könige David und Salomo noch viel stärker hervorgehoben als in dem vorangegangenen Geschichtswerk? Nach Erhard S. Gerstenberger hängt das damit zusammen, dass die nach dem babylonischen Exil im Perserreich entstandene jüdische Glaubensgemeinschaft die Erinnerung an diese Könige dazu nutzt, um sich der Grundlagen Ihrer Religion neu zu vergewissern (86):
„Jedes Kapitel der Chronikbücher hält der im persischen Großreich existierenden Jahwegemeinschaft vor: Seht, so haben unsere Vorfahren diese unsere Glaubensgemeinschaft begründet und eingerichtet. Die jetzt gültigen Regeln, Riten, Strukturen stammen vor allem aus der David- und Salomozeit (in teilweisem Gegensatz zur dtr. [deuteronomistischen] und zur übrigen pentateuchischen Geschichtskonstruktion, die allein Mose als Begründer der Ordnungen gelten lässt).“
Dabei werden die Könige nicht mehr als politisch handelnde Herrscher dargestellt, sondern als verantwortliche Leiter der gottesdienstlichen Versammlungen im Tempel. Der Tempel wird in der Chronik so dargestellt, wie man ihn im 4. Jahrhundert kannte.
In diesem Zusammenhang werden die durchaus respektierten älteren Überlieferungen im deuteronomistischen Geschichtswerk zwar teilweise in die Chronikbücher übernommen, aber aus den Gegebenheiten und Interessen ihrer Zeit heraus doch auch erheblich verkürzt, umgestaltet und ergänzt. Zum Beispiel spielt in den Chronikbüchern die Geschichte Nordisraels fast keine Rolle mehr, nicht einmal die Propheten Elia und Elisa werden erwähnt, denn sie wirkten (S. 123)
„ja im untergegangenen Norden, dem man im damaligen Jerusalem anscheinend keine Träne mehr nachweinte“.
Interessant ist nach Gerstenberger insbesondere, zu welchem Zweck die Autoren der Chronik auf geschichtliche Überlieferungen zurückgreifen (S. 128):
„Der Geschichtsstoff mit seiner Ausrichtung auf die Infrastruktur der judäischen Religionsgemeinschaft eignete sich sehr gut zur ldentitätsbildung in der Jerusalemer Kultgemeinde und ihren Ablegern in der Diaspora.“
Historisch vermittelt die Chronik mithin indirekt mehr Informationen über die Zeit ihrer Abfassung als über die in ihr erzählte Geschichte (S. 129):
„So sind denn die Chronikbücher nur in verschwindend geringem Maß als historische Quellen zu werten. Sie haben jedoch einen unschätzbar hohen Quellenwert im Blick auf die Sitten und Gebräuche, Institutionen und Ämter, und die ethischen und theologischen Anschauungen der nachexilischen, judäischen Gemeinde.“
↑ Ist die ganze Bibel von Gott eingegeben und wortwörtlich wahr?
Schließlich kommen Sie unter Z wie Zahlen auf eine heutige (allerdings nicht wirklich neue, sondern schon in der Vergangenheit weit verbreitete) „theologische Tendenz“ zu sprechen (S. 183),
„die die biblischen Texte zumindest als von Gott inspiriert ansieht. Menschliche Autoren sind dann nur noch ‚Sekretäre‘ Gottes. Diese Theologie sieht die Bibel als vollkommen fehlerfrei an. Sie beruft sich auf Worte wie: ‚Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.‘ [2. Timotheus 3,16]“
Aber beweist dieser Bibelvers wirklich zwangsläufig, dass der Autor des Briefes annahm, jedes niedergeschriebene Wort der Bibel sei wortwörtlich von Gott eingegeben und faktisch wahr?
Diese Bedeutung ergibt sich nur dann, wenn man in diesem Satz das Wort „die Schrift“ als Subjekt nimmt und die beiden Adjektive „von Gott eingegeben und nützlich“ gemeinsam als Prädikat. Dann ergibt sich die Übersetzung etwa der Elberfelder Bibel: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre…“. Dabei muss im Deutschen das Wörtlein „ist“ als Verbindungswort oder Copula ergänzt werden, während im Griechischen eine solche Copula auch fehlen kann (87).
Es ist aber eine alternative Übersetzung möglich. Das Wort kai zwischen den Worten „alle Schrift, von Gott eingegeben“ und dem Rest des Verses kann man hier auch mit „auch“ ins Deutsche übertragen, wie es zum Beispiel die katholische Einheitsübersetzung oder die Zürcher Bibel tun: „Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich…“.
Dann hat das Wort theopneustos = „von Gott eingegeben“ als (trotz der Endung –os feminines) Adjektiv zum Subjekt graphē = „Schrift“ einen einschränkenden Sinn, indem die folgende Aussage nur für diejenigen von Menschen verfassten Worte der Heiligen Schrift gelten soll, in denen tatsächlich Gottes Geist seine Wirksamkeit entfaltet, der ja weht, wo er will.
Das Prädikat dieses Satzes besteht dann aus dem mit „auch nützlich“ beginnenden Teil. Das heißt: Für jede inspirierte Schrift gilt – durchaus sinnvoll – die Aussage, dass sie „auch nützlich ist“, und zwar zur Bildung, zur Aufdeckung von Schuld, zur Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit.
↑ Propheten sahen doch in die Zukunft – aber nicht als Hellseher!
Unter (S. 183) Z wie Zedekia wiederholen Sie, was Sie bereits unter P wie Propheten dargelegt hatten:
„Der biblische Prophet war kein Hellseher, wie gewöhnlich fälschlich angenommen wird, sondern ein Mensch, der für Gott sprach. Er war das Sprachorgan Gottes. Warum setzt man dann Propheten gern mit Hellsehern gleich? Eine mögliche Erklärung ist: Tatsächlich verkündeten Propheten mitunter auch Ereignisse von morgen und übermorgen. Aber wenn sie das taten, dann nicht als Ergebnis eigenen Vorhersehens, sondern auch dann als die angebliche Stimme Gottes. Sie gaben stets an, sie würden Ankündigungen Gottes verkünden: ‚So spricht Gott der Herr …‘“
Hier widersprechen Sie eindeutig Ihren obigen Ausführungen zum selben Thema. Unter P wie Propheten hatten Sie sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Hellseherei keinesfalls zur Tätigkeitsbeschreibung eines biblischen Propheten zählte. Jetzt räumen Sie ein, dass „Propheten mitunter auch Ereignisse von morgen und übermorgen“ verkündeten. Ein paar Sätze später werden Sie sogar schreiben (S. 184): „Nun sind unzählige Prophezeiungen im ‚Alten Testament‘ überliefert.“
Vollends schräg ist Ihre Begründung dafür: Nicht etwa die Propheten selbst können hellsehen, denn sie betreiben ihre Zukunftsschau ja im Auftrag Gottes! Aber das ist unlogisch. Propheten tun doch alles andere auch im Auftrag Gottes. Also hätten Sie schon oben getrost auch die Zukunftsschau in die Aufgabenbereiche der Propheten einreihen können.
Die Schlussfolgerung aus Ihrer jetzigen Argumentation wäre also: Nicht die biblischen Propheten sind Hellseher, sondern Gott. Dem widersprechen Sie nun aber auch wieder (S. 183f.):
„Denn würde Gott der Allmächtige selbst offenbaren, was die Zukunft bringt, dann würden doch die Vorhersagen durch die Ereignisse bestätigt. Der allwissende Gott irrt sich nicht!“
Auf dieser Basis fahren Sie dann wieder schön auf Ihrer „und die Bibel irrt sich doch!“-Schiene umher, weil ja der angeblich nicht irren könnende Gott sich in vielen Fällen eben doch geirrt hat.
Oder ist vielleicht einfach diese Basis falsch? Haben Sie das Konzept der Prophetie im alten Israel etwa immer noch nicht vollständig verstanden?
Wie ich oben schon sagte: Die wichtigste Aufgabe der Propheten ist es, im Auftrag Gottes zur Umkehr zu rufen, und zwar manchmal auch, indem sie Unheil voraussagen – für den Fall, dass Menschen nicht umkehren. Es geht nicht darum, quasi neutral irgendwelche Ereignisse ganz genau vorherzusehen. Es geht darum, das Volk und vor allem seinen König vor einem sozial/politisch/kultisch unverantwortlichen Verhalten (was damals eine Einheit bildet) zu warnen, weil es verheerende Folgen mit sich bringen wird. Und manchmal malen Propheten dem Volk auch Bilder der Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft vor Augen, um eine bleiern lähmende Verzweiflung zu überwinden.
Auch eine solche Zukunftsschau im Auftrag Gottes ereignet sich im Gehirn und durch die Sprache der Propheten. Sie ist also eine menschliche Tätigkeit, die von ihnen zugleich als göttliches Wort oder als von Gott kommende Vision erlebt und verkündigt wird. Von daher ist es ganz normal, dass nicht alle Voraussagen ganz genau so eintreffen – nämlich eben weil es auch nicht um göttliche Hellseherei geht, sondern weil Aufrufe zur Umkehr oder zu neuer Hoffnung in einer komplexen Wechselwirkung mit dem tatsächlichen Verhalten des Volkes und den zukünftigen Ereignissen stehen. Echte Prophetie rechnet damit, dass Unheilsankündigungen eben doch nicht eintreffen müssen, wenn Menschen zur Umkehr bereit sind.
Manchmal werden Voraussagen auch rückwirkend gestaltet worden sein (als sogenannte vaticinia ex eventu = „Weissagungen vom Ereignis her“), was man böswillig als einen Trick bezeichnen kann, eine Erzählung als glaubwürdig hinzustellen.
Und die ersten Christen, die an Jesus als den Messias Israels glaubten, waren natürlich bemüht, an allen Ecken und Enden des Alten Testaments Voraussagen auf den Messias zu finden, um durch sie den Anspruch zu bekräftigen, dass dieser Messias eben in Jesus gekommen sei. Ob es sich bei den entsprechenden alttestamentlichen Stellen um tatsächliche Vorhersagen des Wirkens Jesu handelte, lässt sich nicht beweisen; im Glauben an Jesus Christus ist es allerdings nachvollziehbar, in seinem Leben und Wirken, Sterben und Auferstehen die Erfüllung von Verheißungen des Alten Testamentes zu erkennen.
Aber zurück zu konkreten Beispielen der prophetischen Zukunftsschau, die Sie anführen.
Im Fall von Zedekia sehen Sie (S. 184) mit Recht den Fall einer positiven Voraussage (Jeremia 34,4-5), „allerdings unter der Bedingung, daß er Jahwe gehorcht. Das tut er nicht. Voreiligen Bibelkritikern zum Trotz bewahrheitet sich mit seinem grausamen Tod die Vorhersage.“
Die Voraussage für König Josia zitieren Sie allerdings nicht ganz vollständig. Nicht ein „friedlicher Tod“ steht im Zentrum des Wortes, das die Prophetin Hulda ihm ausrichten lässt, denn der ganze Text lautet folgendermaßen (2. Könige 22,18):
„Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Stätte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder.“
Wenn man genau hinsieht, wird Josia kein friedlicher Tod vorausgesagt, sondern dass er ein ehrenvolles Begräbnis erhalten wird (anders als es bei König Saul der Fall war, dessen Kopf die Philister nach seinem Tod aufspießten und zur Schau stellten). Und ihm soll es erspart bleiben, das Unheil für das Volk Juda zu sehen, das mit dem babylonischen Exil kommen sollte. Natürlich ist das trotzdem kein Beweis für eine exakte Voraussage, zumal sie vermutlich nachträglich, als vaticinium ex eventu, formuliert wurde.
Was ist nun aber von Psalm 89,4-5 zu halten, wo Gott dem König David schwört: „Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für.“ Vordergründig heißt das natürlich (S. 185): „Bis in alle Ewigkeiten würde der König Israels aus dem Hause David stammen.“ Aber tatsächlich gab es (S. 186) nach Zedekia überhaupt keinen Davididen mehr auf dem Thron Israels (nicht nur „rund ein halbes Jahrtausend“ lang, wie Sie schreiben), denn die Hasmonäer, die durch die Makkabäeraufstände auf den Thron Israels gelangten, gehörten nicht zur Dynastie Davids. Nach dem babylonischen Exil gab es zwar noch Serubbabel als Thronanwärter, der aber in der Perserzeit dann doch nicht König wurde. Stattdessen wurde die Provinz Jehud eine von Priestern geführte autonome Torarepublik unter der Oberherrschaft des Königs von Persien. Trotzdem können Christen Psalm 89,4-5 im übertragenen Sinn auf die ewige Herrschaft des Messias Jesus beziehen, und Juden hoffen, so weit ich weiß, auch noch immer auf das Kommen des Messias.
Sehr interessant finde ich (S. 185) Ihren Hinweis auf „Hesekiel“ als einen der
„ehrlichen Propheten, die einräumen, daß sie sich irrten. In den Kapitel 26 bis 28 [Hesekiel 26,1 – 28,19] offenbart er eine konkrete Zukunftsvision im Auftrag Gottes. Demnach wird die Festungsstadt Tyrus im Auftrag Gottes vom assyrischen König Nebukadnezar belagert und erobert werden. Die Prophezeiung sieht glasklar den assyrischen Herrscher als Sieger über Tyrus. Das vorausgesagte Ereignis findet aber nicht statt! Die Inselstadt aber erweist sich als uneinnehmbar und Nebukadnezar muß unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die geplatzte Prophezeiung wird von Hesekiel selbst wenige Verse später zugegeben [Hesekiel 29,17-20].“
Dieser Zusammenhang war mir überhaupt nicht bewusst. Hier handelt es sich tatsächlich um einen deutlichen Beleg dafür, dass biblische Prophetie sich nicht einfach als simple Abfolge von Prophezeiung und exaktem Eintritt des Vorhergesagtem abspielt. Beeindruckend finde ich auch, dass diejenigen, die das Buch Hesekiel später bearbeitet haben, diese doch eigentlich peinliche Nichtübereinstimmung von Vorhersage und Erfüllung nicht geglättet oder durch Änderungen am Text miteinander in Einklang gebracht haben. Mit Recht schreiben Sie – ganz im Gegensatz zu Ihren Forderungen an anderen Stellen, inzwischen als Irrtum erwiesene Bibelstellen zu ändern – (S. 189):
„Dies spricht für die Wahrhaftigkeit der Bibel: Falsche Prophetenworte von gestern wurden nicht aus den Texten gestrichen, wenn morgen die realen Ereignisse völlig anders verliefen als vorhergesagt.“
Offenbar gab es also schon zur Zeit der Bibel die Einsicht, dass die Wahrheit der biblischen Botschaft nicht daran hängt, die Propheten oder andere biblische Autoren von jeglichem Irrtum freisprechen zu müssen.
Schließlich möchte ich noch auf Ihre Bemerkung (S. 187) über das eingehen, was „den Propheten besonders wichtig war“, und die ich nur in eingeschränktem Maße richtig finde:
„Sie sahen die Macht oder Ohnmacht der Menschen stets als Folge der richtigen oder falschen Religion. Wer den richtigen Gott anbetete, konnte mit seiner Unterstützung auch in weltlichen Belangen rechnen. Wer in den Augen der Propheten falsche Götter verehrte, der war zum Untergang verdammt.“
Was Sie hier übersehen, ist wieder einmal der Aspekt, dass für Juden die Anbetung fremder Götter immer mit einem Verstoß gegen die guten Gebote des befreienden Gottes JHWH einherging. Nicht ein bloßer Religionswechsel, wie wir ihn uns heute vorstellen, ist also im Blick, sondern eine Absage an Recht und Gerechtigkeit durch die jeweils herrschenden Schichten. Wer ägyptische oder babylonische Zustände wollte, wer dem König von Tyrus und seinen Göttern verfiel, der sagte damit in den Augen der biblischen Autoren zugleich Nein zum Recht der Rechtlosen in Israel.
↑ Wie wird der Gottesname JHWH in der Bibel ausgesprochen?
Zu (S. 189) Z wie Zeugen Jehovas finde ich zunächst in Ihrer Anmerkung 1 die Bemerkung: „Streng genommen müßte es Jehowa heißen!“ Abgesehen davon, dass die Vokalisierung dieses Wortes sowieso nicht korrekt ist, worauf Sie ja später selbst eingehen, ist die Umschreibung des Konsonanten Waw mit V statt W allerdings nicht problematischer als Ihre Umschreibung des Konsonanten J mit Y im Abschnitt Y wie Yesod – schließlich handelt es sich einfach um die im englischen Sprachraum übliche Umschrift.
Dann gehen Sie erst einmal auf die Behauptung ein: „Die Israeliten durften den Gottesnamen Jahwe nicht aussprechen, weil er zu heilig war!“ Ein Irrtum ist das, so meinen Sie:
„Diese Aussage ist in ihrer Absolutheit definitiv falsch. Jesaja liefert keinerlei Anhaltspunkt für ein Verbot, den Namen Gottes zu gebrauchen. Er betont ausdrücklich, daß der Gottesname auch den Feinden bekannt gemacht werden müsse [Jesaja 64,1]. Sie sollten erzittern vor Gottes Namen. Die frommen Israeliten wurden aufgefordert [Psalm 113,1-2]: „Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit!“ Das ging schlecht, ohne den Gottesnamen auszusprechen. Der Gottesname Jahwe wurde auch keineswegs nur in sakralen Texten zum Gottesdienstgebrauch verwendet. Im 7. Jahrhundert kommt er in Alltagsbriefen häufig vor.“
Ganz so einfach ist es wieder einmal nicht. Es ist erforderlich, zu differenzieren.
Richtig ist, dass der Gottesname Jahwe oder Jahu in der vorexilischen Zeit als ganz normaler Name eines normalen altorientalischen Gottes gebraucht wurde.
Propheten wie Hosea begannen den Namen JHWH aber programmatisch im Sinne einer Protestbewegung gegen jeden bildhaft angebeteten Gott zu verstehen, und dieser Name stand zugleich für das befreiende und Recht schaffende Handeln JHWHs für sein Volk und vor allem für die Armen und Unterdrückten in Israel. Dieses Programm der Befreiung wird vor allem in der etymologischen Herleitung des Namens JHWH in 2. Mose 3,14 angedeutet, denn er wird mit dem Wort ˀÄHJäH ASchäR ˀÄHJäH umschrieben, was wörtlich so viel bedeutet wie „ich geschehe, als der ich geschehe“, also kein statisches Sein, sondern ein befreiendes Handeln, ein Werden, ein Geschehen.
Die Scheu, den Namen JHWH auszusprechen, entstand vermutlich auch aus der Absicht, diesen Namen nicht als Beschwörungsformel zu missbrauchen. JHWH sollte nicht verwechselt werden mit handhabbaren, verfügbaren Göttern, die benutzt werden als Legitimatoren für eigene Wünsche und für die Unterdrückung von Völkern.
Dass ein Jude übrigens den Namen Gottes sehr gut loben kann, ohne ihn auszusprechen, indem er nämlich statt der vokalisierten Buchstaben des Tetragramms JHWH ein Ersatzwort ausspricht, wissen Sie selber sehr genau, wie später in diesem Abschnitt deutlich werden wird.
Das spätere Verbot, den Namen JHWH auszusprechen, verbinden Sie mit mit einer irrtümlichen Auslegung von 3. Mose 24,16 durch Abba Schaul, der im 2. Jahrhundert n. Chr. (S. 190) „schon das laute Aussprechen von Jahwe“ als Gotteslästerung betrachtete.
Ihr Versuch einer wörtlichen Übersetzung dieses Verses ist ziemlich holperig (S. 189f.):
„Ein Lästernder den Namen Jahwes Töten er werde getötet – Überschütten müssen sie ihn überschütten – alle von der Gemeinschaft wie die Leute mit Gastrecht …“.
Tatsächlich sind die Redewendungen MOTh JUMaTh und RaGOM JiRGeMU-BO (88) wörtlich etwa so zu übersetzen: „zu sterben werde er getötet, zu steinigen steinige man ihn“.
Inhaltlich bin ich im Abschnitt über T wie Todesstrafe schon ausführlich darauf eingegangen, dass solche apodiktischen Forderungen, jemanden zum Tode zu bringen, niemals geltendem israelitischen Recht entsprachen, sondern drastisch formulierte Ermahnungen waren.
Der (S. 189) „übereifrige Schriftgelehrte Abba Schaul“ hätte ohnehin „um das Jahr 150 n. Chr.“, als es nach dem 2. Jüdischen Krieg kein eigenständiges jüdisches Staatswesen mehr gab, kaum eine Chance gehabt, ein solches Todesurteil unter den Bedingungen des Lebens im Römischen Reich vollstrecken zu lassen.
Dann argumentieren plötzlich Sie widersprüchlich. Eben noch haben Sie behauptet, dass erst um 150 n. Chr. das Verbot auftaucht, den Namen JHWH auszusprechen. Nun stellen Sie fest (S. 190), dass bereits 400 Jahre früher bei der Übersetzung der Bibel ins Griechische das Wort JHWH durch „Kyrios“ (Herr) ersetzt wurde. Damals wurde aus der oben erwähnten Wendung „Ich geschehe, als der ich geschehe“ in 2. Mose 3,14 nach dem völlig anderen griechischen Sprachgefühl der Satz „Ich bin der Seiende“, was die mit Bewegung verbundene hebräische Gottesvorstellung statischer werden ließ. Insgesamt beweist dieser schwierige Prozess der Übertragung des Gottesnamens in eine andere Kultur, dass schon vor der Entstehung der griechischen Septuaginta eine Scheu bestand, den Namen JHWH auszusprechen.
Über ein Jahrtausend weiter nach vorn springen Sie sodann in die Zeit zwischen 700 und 100 n. Chr., in der die sogenannten Masoreten die Aussprache des Textes der hebräischen Bibel einheitlich festlegten, indem sie die „reine Konsonantenschrift“ mit Vokalen versahen. Dazu verwendeten sie (S. 191) „ein System aus Punkten und Strichen“, die nach dem sich schließlich durchsetzenden „infralinearen tiberischen Vokalisationssystem“ (89) vorwiegend unter die Konsonanten gesetzt wurden.
Ein Irrtum ist Ihre Einschätzung: „Dank der vokalisierten Texte wissen wir nun, wie der heilige Gottesname ausgesprochen wurde.“ Nein, eben nicht, er selbst wurde ja nie ausgesprochen. Stattdessen wurde bei der Vokalisierung von JHWH unterschieden zwischen dem, was geschrieben war (Ketib), und dem, was zu lesen war (Qere).
Und das wissen Sie auch, denn Sie beschreiben ja die Vorschrift, dass man für JHWH das Ersatzwort ˀADONaJ = „(mein) Herr“ auszusprechen hatte, wenn es mit den Vokalen dieses für die Anrede Gottes reservierten Wortes versehen war. Ganz exakt hätte ich dieses Ersatzwort übrigens mit ˀəDONaJ umschreiben müssen, da das anfängliche „a“ sehr schwach, fast wie ein nur gemurmeltes „e“, ausgesprochen wird. Darum erhält JHWH in diesem Fall eben auch die Vokale „ə – o – a“, und wenn man die irrtümlicherweise zusammen mit den Konsonanten von JHWH auszusprechen versucht, kommt man auf die falsche Aussprache von JHWH mit JəHoWaH. Insofern haben Sie Recht: Es ist „ein Irrtum, anzunehmen, der Gott Israels habe Jehova geheißen.“
Allerdings irren auch Sie mit Ihrem Satz: „6828mal kommt in der hebräischen Ausgabe des ‚Alten Testaments‘ die Kombination Jehova vor.“ Die Anzahl der Stellen stimmt zwar. Aber Sie wollen ja sagen, dass an all diesen 6828 Stellen, an denen in der Bibel JHWH vorkommt, diese Konsonanten mit den Vokalen von ˀADONaJ versehen sind. Es gibt aber auch andere Ersatzwörter und damit verbunden andere Vokalisationenen von JHWH, wie man bei Wikipedia im Artikel über den Gottesnamen JHWH erfahren kann:
Ein zweites Ersatzwort für JHWH mit der Vokalisierung „ä – o – i“ ist ˀÄLoHIM = „Gott“, das vor allem dort verwendet wird, wo JHWH im hebräischen Text zusammen mit dem Wort ˀADONaJ vorkommt. Das ist oft im Buch des Propheten Hesekiel der Fall, zum Beispiel im Ausdruck „So spricht Gott der HERR!“ (Hesekiel 2,4). Im Urtext steht ˀADONaJ JHWH, und JHWH mit den Vokalen „ä – o – i“ muss als ˀÄLoHIM ausgesprochen werden. Wörtlich wäre also „So spricht der Herr Gott“ zu übersetzen.
Drittens kann JHWH auch mit den Vokalen des Wortes HaScheM = „der Name“ versehen sein – allerdings, was die Sache noch komplizierter macht, in seiner aramäischen Form ScheMAˀ → „e – a“. Eine Faustregel mag sein, dass ˀADONaJ eher als Anrede für JHWH im Gebet verwendet wurde, während man bei Sprechen von oder über JHWH den Ausdruck „der Name“ benutzte.
Als mir auffiel, dass in der von mir verwendeten Bibelausgabe die Vokalisierung für JHWH oftmals sogar von diesen drei Formen abweicht, stieß ich bei einer weiteren Recherche im Internet auf eine Seite von Michael Neuhold, der dafür eine nachvollziehbare Erklärung liefert:
Die aktuelle wissenschaftliche Textausgabe des AT, die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), die auf dem Codex Leningradensis beruht, vokalisiert immer ohne O, also Schwa-A bzw. Schwa-I … Die BHS hat auch nach Adonaj zumeist ein einfaches Schwa (z.B. Amos 7,1; Ausnahmen: Gen 15,2.8 …). Man kann vielfach lesen, die Vokalisation Schwa-A sei von dem aram. … šema „der Name“ genommen. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß durch diese Vokalisation das Tetragramm unaussprechbar gemacht werden soll. Bemerkenswert ist die Form des Tetragramms in Ps 144,15 mit Schwa compositum…
Ist es fair, ans Ende meiner Kommentierung Ihrer Ausführungen zum Alten Testament dieses Zitat mit einigen unerklärten Begriffen zu setzen? Wohl eher nicht. Also schiebe ich noch zwei Erläuterungen dazu nach:
Der Codex Leningradensis ist nach Wikipedia „die älteste bekannte vollständige Handschrift der hebräischen Bibel. Sie wurde 1008 geschrieben und befindet sich in der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Petersburg (früher Leningrad)“.
Das „Schwa“ ist ein kurzer, nur gemurmelter Laut wie das „e“ am Ende von „bitte“, im Hebräischen vokalisiert mit einem Zeichen unter dem Konsonanten, der wie ein Doppelpunkt aussieht; hier habe ich es umschrieben mit ə. Ein Schwa compositum wird mit anderen Vokalen zusammengesetzt und erhält dann deren Klangfarbe (als „halbes“ a, e oder o) (90).
↑ Zum Neuen Testament
↑ Abendmahl – Widersprüche und eine mögliche Erklärung
Ihre Untersuchung des Neuen Testaments (S. 195) zum Stichwort A wie Abendmahl beginnen Sie, indem Sie beim alttestamentlichen Passafest einsetzen. Anscheinend lieben Sie die Geschichte der zehn ägyptischen Plagen so sehr, dass Sie sie hier nochmals (wie schon unter A wie Auszug aus Ägypten) nacherzählen, und zwar nicht ohne sich über die Vorschrift lustig zu machen, dass mit dem Blut des Passalamms „beide Pfosten an der Tür“ zu bestreichen sind „an den Häusern, in denen sie es essen“ (S. 196):
„Gott ist nicht nur unglaublich grausam, er braucht auch ein blutiges Zeichen, um nicht Ägypter und Israeliten miteinander zu verwechseln. Zu einem gütigen und allwissenden Gott paßt beides nicht.“
So kann man leicht die zentralen Symbole einer Religion lächerlich machen. Wer sich wirklich für den Sinn eines tief verwurzelten Glaubens interessiert, wird sich fragen, in welche Gedankenwelt die Erzählung eingebettet ist und was das Blut bedeuten soll. Zumal Sie ja wissen, dass die Erzählung sowieso eine Fiktion ist.
Vor dem Hintergrund der bedrückenden Sklaverei und der Tötung israelitischer Babies in Ägypten ist Gott insofern nicht grausam, sondern gerecht, als der Tod der Erstgeburt der Ägypter der tödlichen Bedrohung des ersten Sohnes Gottes, nämlich Israels, entspricht.
In 2. Mose 12,38 ist übrigens davon die Rede, dass „viel Mischvolk“, Erev-Rab, sich den Israeliten bei Ihrem Auszug aus Ägypten anschließt; die Befreiung ist also keine rein ethnische Angelegenheit, sondern eine Sache des Gehorsams gegenüber der Tora der Freiheit und der Gerechtigkeit. Nach der Logik der Geschichte gibt es also auch Ägypter, die ihre Türpfosten aus Solidarität mit den Juden ebenfalls mit dem Zeichen des Blutes bestreichen und mit ihnen gerettet werden (91).
Der nächste Irrtum, den Sie dem alttestamentlichen biblischen Autor unterstellen ist, dass er „behauptet, das Pessachfest sei erst bei der Flucht der Israeliten aus Ägypten entstanden.“ Nein, schreiben Sie unter Berufung auf Marcello Craveri (92):
„Es ist Jahrtausende älter und stammt aus archaischen Zeiten. Ein Opfertier wurde mit Gott gleichgesetzt und stellvertretend verspeist, ‚um die restlose Vereinigung mit Gott selbst zu erneuern und damit göttliche Lebenskraft zu gewinnen‘.“
Aber wenn Sie hier überhaupt von einem Irrtum reden wollen, dann treffen Sie jedenfalls nicht die Kernpunkte dessen, worum es hier geht. Denn:
Erstens ist natürlich das Passafest historisch gesehen tatsächlich nicht bei der Flucht der Israeliten aus Ägypten entstanden. Das geht schon deswegen nicht, weil es diese Flucht so gar nicht gegeben hat. Wie wir schon gesehen haben und wie Sie auch genau wissen, ist die Geschichte vom Auszug aus Ägypten eine Glaubensgeschichte Israels, die spätere Erfahrungen in eine fiktive Frühzeit des Volkes zurückprojiziert.
Zweitens ist darum das Passafest in dem Sinn, wie es von Juden als Fest der Befreiung bis heute gefeiert wird, vermutlich frühestens in die Zeit des Königs Josia zu datieren. Möglicherweise war er es, der mit der Umwandlung des ehemaligen Frühlingsfestes Pesach in ein Befreiungsfest aus dem Sklavenhaus die Tora in der Erinnerung des Volkes verankert (2. Könige 23,21-23) – wobei die Tora eben jenes heilige Buch war, das zur Zeit Josias im Tempel „wiedergefunden“, aber vielleicht auch eben erst als geltende Wegweisung von Gott in Kraft gesetzt wird (2. Könige 22,13).
Drittens hat es also tatsächlich archaische Feste gegeben, auf denen das israelitische Passafest aufgebaut hat. Aber mit ihnen ist das Volk Israel ähnlich umgegangen wie mit den alten schriftlichen Traditionen anderer Völker, die angeblich von den biblischen Autoren nur abgeschrieben wurden: Genau wie fremde Überlieferungen im Sinne der eigenen Glaubensvorstellungen so stark verändert wurden, dass kaum noch ein Stein auf dem andern blieb, wurden auch archaische Feste radikal umgestaltet. Schon die Einführung des Passafestes im Zuge der Kulturrevolution Josias spricht dafür, dass hier nicht einfach eine alte Tradition übernommen wurde; im Gegenteil, es fand ein strikter Bruch mit alten Opfertraditionen statt. Vor allem wurde das jüdische Passalamm keinesfalls mit Gott gleichgesetzt.
Erst im christlichen Abendmahl als dem Nachfolgefest des jüdischen Passafestes, so könnte man viertens sagen, gibt es dann doch wieder die Vorstellung, dass Gott sich selbst für die Menschen opfert und dass sogar der Leib zumindest des Gottessohnes (symbolisch) gegessen wird (93).
Zurück zu Ihren Ausführungen, die sich nunmehr ebenfalls dem christlichen Abendmahl zuwenden. Ob Jesus (S. 198f.) das Passafest zusammen mit Essenern einen Tag vor dem orthodoxen Passafest der Juden gefeiert hat, wozu Sie interessante Indizien vorbringen, traue ich mich nicht, letztgültig zu beurteilen und lasse es dahingestellt sein.
Wie Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat, wird man nicht mehr genau rekonstruieren können. Sie legen sich in dieser Hinsicht ziemlich fest, indem Sie schreiben (S. 199):
„Jesus veränderte … die Pessach-Zeremonie. Aus der jüdischen Danksagung für die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei wurde ein Fest der Erinnerung an Jesus und der Hoffnung auf das kommende Reich Gottes.“
Dabei halten Sie es für erwiesen, dass Jesus selbst noch nicht seinen eigenen Leib, der getötet werden würde, oder sein eigenes Blut, das vergossen werden würde, mit dem Brot und dem Kelch der gemeinsamen Feier verglichen hat. Zu einer solchen Vorstellung sei es erst später es durch die „Theologie des Paulus“ gekommen: „Aus dem Rebensaft wird das Blut Jesu und aus dem Brot der Leib Christi.“
Auch im Lukasevangelium findet man allerdings im Kapitel 22 die Verse 19b-20, in denen Jesus vom Brot sagt: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird“, und vom Kelch: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“
Sie allerdings berufen sich auf diejenige Abschrift des Lukasevangeliums, die in der Handschrift des „Codex Bezae Cantabrigiensis“ überliefert ist. Dort fehlen genau diese Verse. Sind sie später hinzugefügt worden, um sie mit der inzwischen üblich gewordenen Abendmahlsvorstellung in Übereinstimmung zu bringen?
Zu denken geben muss allerdings, dass der Ihnen zufolge angeblich spätere Paulus seinen 1. Korintherbrief bereits 30 bis 40 Jahre vor der Urfassung des Lukasevangeliums geschrieben hat. Also reicht seine Abendmahlsüberlieferung vielleicht doch weiter zurück. Welche Version der Abendmahlsworte ursprünglich ist und ob sie überhaupt auf Jesus zurückgehen, bleibt umstritten (94).
Die Behauptung des Jesusbiographen Marcello Craveri (95) allerdings (S. 199f.):
„In Anlehnung an griechisch-orientalische Riten überträgt Paulus die Vorstellung, daß der Uneingeweihte, der an der Mahlzeit teilnimmt, von Gott bestraft wird (unter Umständen sogar mit dem Tode)“
weise ich entschieden zurück. Denn Paulus lehnt sich gerade nicht an griechisch-orientalische Riten an, wenn er unwürdige Abendmahlsteilnehmer tadelt. Sein Tadel gilt nämlich nicht uneingeweihten Abendmahlsgästen, sondern reicheren Gemeindemitgliedern, die vor dem Abendmahl ihr mitgebrachtes Essen zu sich nehmen und damit die ärmeren, die nichts zum Essen mitbringen konnten, beschämen (1. Korinther 11, 20-22 und 27).
Auf jeden Fall kann man dem Apostel Paulus noch nicht die wortwörtliche Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi anlasten. Seine Vision bestand vielmehr darin, dass die beim Abendmahl versammelte Gemeinde symbolisch den Leib Christi verkörpert (1. Korinther 12,27), in dem menschliche Grenzen und Schranken überwunden sind (Galater 3,28):
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“
Annähernd richtig geben Sie die spätere Position der evangelischen Kirche wieder – allerdings nicht ganz korrekt:
„Der lutherische Protestantismus ging wieder einen Schritt zurück. Demnach werden mit Brot und Wein Leib und Blut Christi nur symbolhaft konsumiert.“
Genau genommen schildern Sie hier die reformierte Abendmahlsversion des Schweizer Reformators Zwingli. Luther vertritt eine Zwischenposition; er beharrt darauf, dass Jesus gesagt habe: „Das ist mein Leib“, aber ohne eine magische Wandlung zu vertreten.
Mir gefällt die Art, wie sich Eugen Drewermann die Wandlung vorstellt: Nicht die Substanz der Abendmahlselemente wandelt sich, sondern der Mensch, der sie empfängt, und darin besteht das Wunder (vgl. Anm. 93). Die von Ihnen angeprangerten Skurrilitäten der späteren römisch-katholischen Lehre von der Wandlung der Elemente der Eucharistie finde ich auch zu blöd, um darüber zu streiten. Sie machen aus dem Abendmahlswunder eine magisch missverstandene Absurdität.
↑ Auferstehungserfahrungen der Bibel in einer großen Vielfalt
In Ihrem Abschnitt (S. 200) zu A wie Auferstehung Christi zählen Sie jede Menge Widersprüche in den Auferstehungsberichten der vier Evangelisten auf. Eine Erklärung für dieses Osterrätsel bieten Sie allerdings nicht an.
Dabei ist es so einfach: Auch hier handelt es sich um Glaubenserzählungen, die nicht historisch berichten wollen, was faktisch passiert ist. Jeder Jünger und jede Jüngerin hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht, und diese Erfahrungen sind in Form von Geschichten weitererzählt worden. Dabei hat man auch auf Überlieferungen aus dem Alten Testament zurückgegriffen, um die eigenen Erfahrungen zu bestätigen oder näher zu deuten.
Übrigens haben Sie bei den Widersprüchen der Osterberichte noch Paulus vergessen: der erwähnt in 1. Korinther 15,1-11 keine einzige Frau als Osterzeugin, sondern nur Männer.
Näher eingehen möchte ich nur auf Ihre Verwunderung darüber (S. 203), dass der auferstandene Jesus Maria Magdalena „mit einer seltsamen Begründung“ zurückweist (Johannes 20,17): „Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Himmel!“
„Nachzuvollziehen ist diese Begründung nicht. Maria darf Jesus nicht berühren, da er noch nicht gen Himmel gefahren sei. Aber nach der Himmelfahrt kann sie ihn nicht mehr berühren, da er dann ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr greifbar ist. Bei Matthäus [28,9] gibt es dieses Tabu nicht.“
Verstärken möchte ich Ihre Verwunderung noch dadurch, dass ich ergänze: Auch für Johannes gibt es kein solches grundsätzliches Tabu. Thomas darf Jesus berühren. Warum er, warum nicht Maria? Eine plausible Erklärung bietet Jane Schaberg an, die Maria Magdalenas Verhältnis zu Jesus mit der Beziehung des alttestamentlichen Propheten Elisa zu seinem Lehrer Elia vergleicht (96).
↑ War in Bethlehem ursprünglich ein heidnisches Heiligtum?
Zu Ihren Ausführungen (S. 204) über B wie Bethlehem mit dem Leitmotiv „So wurde ein heidnischer Kultort christianisiert“ möchte ich Sie zunächst fragen, ob Ihnen bewusst ist, dass auf der Website von Manfred Gebhard die Inhalte dieses Abschnittes ohne Quellenangabe übernommen wurden.
Die Frage „Wo wurde Jesus geboren?“ stellen Sie wieder auf der Basis der Unterstellung, in der biblischen Geschichte sei exakte historische Geschichtsschreibung beabsichtigt worden. Aber Sie wissen doch selbst: Alles, was über die Geburt Jesu erzählt wird, ist mindestens 80 Jahre nach seiner Geburt durch die Evangelisten Matthäus und Lukas rückblickend konstruiert worden (möglicherweise auf Grund etwas älterer mündlicher Erzählungen), um die Bedeutung Jesu als des Gottessohnes für Menschen, die an ihn glauben, näher zu beleuchten. Und das taten die Evangelisten vor allem im Rückgriff auf alttestamentliche Voraussagen, die sich auf den Messias bezogen und die sie in Jesus erfüllt sahen.
So soll zum Beispiel die Erzählung von der Reise Josefs nach Bethlehem, die er anlässlich der Volkszählung unter Kaiser Augustus gemeinsam mit Maria unternimmt, unter anderem Jesu Abstammung von David, der aus Bethlehem stammte, belegen.
Aber hätte Josef überhaupt seine Stammeszugehörigkeit noch feststellen können? Sie bezweifeln das (S. 205):
„Die Unterteilung in zwölf Stämme war mehr als tausend Jahre vor Jesu Geburt erfolgt. Den meisten Juden wäre es damals kaum noch möglich gewesen, festzustellen, zu welchem Stamm seine Vorväter einst gehörten und wo seine Ahnen einst – vor mehr als tausend Jahren – gelebt hatten.“
Hier unterläuft Ihnen ein Irrtum. Denn wer zu welchem Stamm gehört, das wussten und wissen Juden insofern relativ genau, weil sie ihre eigene Abstammung eben auf den einen oder anderen der zwölf Söhne Jakobs zurückführen, und zwar unabhängig davon, ob sich ihr Stammbaum historisch lückenlos auf die Zeit zurückführen lässt, in der angeblich die Verteilung des Landes an die zwölf Stämme vorgenommen worden sein sollte.
Bezüglich der Frage, wo Jesus geboren wurde, nämlich „in welchem Bethlehem“, konstruieren Sie eine Art Verschwörungstheorie, als ob darüber unter Ausschluss der Öffentlichkeit „schon vor Jahrhunderten intern in Theologenkreisen diskutiert“ wurde, um die „Laienwelt“ nicht zu irritieren. Soweit ich weiß, gab es seit der Aufklärung aber immer wieder evangelische Pfarrer, die ihren Gemeinden durchaus auch historisch-kritisches Wissen zugemutet haben, was allerdings bei traditionell denkenden Gemeindemitgliedern nicht immer wohlwollend aufgenommen wurde.
Warum aber wundert es Sie, dass der Theologe Ethelbert Stauffer (97) sich in der Frage des Geburtsorts Jesu „für das Bethlehem südwestlich Jerusalems“ entschied? Natürlich kann „seine hypothetische Annahme“ nichts mit „historischer Forschung“ zu tun haben, denn die Geburtslegende ist doch gerade höchst unhistorisch unter anderem zu dem Zweck erzählt worden, um Jesus als Davidssohn zu erweisen. Darum kann auf der Erzählebene der Geburtsgeschichten sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas (S. 206) nur dasjenige Bethlehem gemeint sein, „das auch als Geburtsort Davids angesehen wird“. Auch Stauffer geht ja nicht davon aus, dass man den Geburtsort Jesu historisch ermitteln könnte, sondern welches Bethlehem die urchristlichen Schriftsteller als Geburtsort Jesu für plausibel gehalten haben könnten.
Was ist aber nun davon zu halten (S. 208), dass Sie Bethlehem auch als ursprüngliches „religiöses Zentrum“ heidnischer Gottheiten mit Jesu Geburt in Verbindung bringen? Wollen Sie damit andeuten, dass der christliche Glaube auf diesen heidnischen Kulten aufbaut oder sie sogar einfach fortsetzt?
„Verehrt wurde die babylonische Gottheit Lah. Bet-Lahama war das Haus des Gottes Lah. Ein alter heidnischer Kultplatz wurde so in den neuen Glauben integriert. Es fiel den Anhängern des alten Glaubens dann leichter, den neuen anzunehmen.“
Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Fall von Bethlehem ein solcher Zusammenhang besteht, da dieser Ort ja schon vor der Zeit Jesu seit Jahrhunderten im jüdischen Land lag. Ist es möglich, dass sich uralte heidnische Kulte hier so lange gehalten haben?
Beim intensiven Googeln habe ich zwar babylonische Götter mit „Lah“ im Namen gefunden (Venus und Mars), aber ohne jeden Bezug zu Bethlehem. Einen Mondgott „Lah“ scheint es im alten Arabien gegeben zu haben, dessen Name später vielleicht sogar in den allgemeinen Gottesbegriff „Allah“ übergegangen sein mag. Aber wieder ist kein Bezug zu Bethlehem vorhanden.
Der Name Bethlehem hat mit „Haus des Brotes“ (hebräisch) oder „Haus des Fleisches“ (arabisch) zu tun, für eine Verbindung mit einem Gott „Lah“ finde ich nirgends einen Beleg.
Plausibler klingt Ihre weitere Hypothese (S. 209), dass der „etwa zweieinhalb Jahrtausende vor Christus“ kultisch verehrte „Dumu-zi“ oder „Tammus … ein früher Vorläufer Jesu“ war, allerdings nicht in dem Sinne, dass dieser Kult von den Christen fortgesetzt wurde, sondern dass eine alte Kultstätte „in einer Höhle“ bei Bethlehem umfunktioniert wurde, um den alten durch einen neuen Kult zu ersetzen:
„Sein Name läßt sich mit ‚rechter Sohn‘ übersetzen. Freiwillig stieg er in die Unterwelt hinab, um dann wieder Auferstehung zu feiern. Noch etwa um 500 v. Chr. wurde in wiederkehrenden Feiern sein Tod beweint, wie Hesekiel [8,14] bitter beklagt. Dies war den frühen Christen ohne Zweifel ein Dorn im Auge. Sie vermochten es nicht, einen uralten Glauben auszurotten. Also vereinnahmten sie ihn für die neue Religion. Wo Dumu-zi als ‚rechter Sohn‘ jahrtausendelang angebetet worden war, wurde nun ein anderer ‚rechter Sohn‘ verehrt: Jesus. Die heilige Grotte des Dumu-zi wurde zur Geburtsstätte Jesu umfunktioniert. Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde über dem heidnischen Heiligtum die Geburtskirche Jesu errichtet.“
Sicher zu beweisen ist das aber nicht. Im Internet wird hier und da die Auffassung vertreten, dass der römische Kaiser Hadrian um 135 an der Stelle, an der die Christen bereits die Geburtsgrotte Jesu verehren, einen Tempel für Tammuz/Adonis bauen lässt, um den christlichen Kult zu verdrängen.
↑ Stern von Bethlehem: Planetenkonjunktion, Komet, Supernova?
Zum Stichwort (S. 209) C wie CMB machen Sie sich darüber lustig, dass in Matthäus 2,2 die Magier angeblich sagen: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, ihn anzubeten.“ Dazu Ihr Originalton:
„Die geographischen Angaben sind knapp und können so nicht stimmen. Die Magier kamen aus dem Osten, von Jerusalem aus betrachtet. Der Stern muß ihnen also von ihrer Heimat aus gesehen im Westen erschienen sein, nicht im Osten.“
Aber für ganz so blöd dürfen Sie den Evangelisten Matthäus nun doch nicht halten. Er meinte natürlich, dass die Magier den Stern gesehen haben, als sie noch im Osten, im Morgenland, waren. Das Wort en tē anatolē muss und kann sich daher natürlich nicht auf die Richtung beziehen, in der sie den Stern sahen.
Aber welcher Stern (S. 211) „mag nun Astrologen aus Persien ins Land der Bibel gelockt haben?“ Haben sie möglicherweise ihr Wissen über einen neugeborenen König der Juden aus außergewöhnlichen „Planetenkonstellationen“ herausgelesen? Keine der von Ihnen erwogenen Möglichkeiten stimmt allerdings mit den in den Evangelien erwähnten politischen Gegebenheiten überein, nämlich der Herrschaft Herodes‘ des Großen und einer Volkszählung durch Kaiser Augustus.
Wieder muss bedacht werden, dass die Geburtsgeschichten Jesu zwar auf historische Ereignisse und auch astrologisches Wissen Bezug nehmen, aber nicht als solche historisch erweisbar sind. Vielleicht hat man damals bekannte Sternenkonstellationen nachträglich auf Jesus bezogen, etwa das Geburtshoroskop von Kaiser Augustus.
Auch wenn dem wahrscheinlich so ist: Spannend finde ich trotzdem Erwägungen von Hans-Erdmann Korth (98) über „Himmelsereignisse im Neuen Testament“ und „Komet Halley‘s Stillstand vor den ‚3 Königen‘“, die allerdings implizieren, dass ein Zeitraum von knapp 300 Jahren aus der uns geläufigen Chronologie herausgeschnitten werden müsste. Nach Korth würden biblische Beschreibungen sowohl historischer Ereignisse als auch astronomischer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Geburt Jesu besser in die Jahre 295 bis 297 nach dem Beginn unserer Zeitrechnung passen als in die Jahre um den Beginn dieser Zeitrechnung selbst.
Fasziniert haben mich auch die allerdings auf in verdächtiger Weise allzu präzise Datierungen hinauslaufenden Erwägungen von Werner Papke, der den Stern von Bethlehem folgendermaßen identifiziert (99):
„Der Stern des Messias war eine Supernova, die am Abend des 30. August 2 v. Chr., als Jesus geboren wurde, 31,7 Grad vom Himmelsäquator entfernt unweit des galaktischen Nordpols im Schoße der Jungfrau (ERUA) erschien. Zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne ‚in‘ der Jungfrau, der Mond unter ihren Füßen, und alle klassischen Planeten (außer Saturn) waren bei der Jungfrau versammelt. Das Sternbild der Jungfrau (ERUA) ist vom Verfasser nach den verfügbaren Quellen seit dem dritten Jahrtausend v. Chr. rekonstruiert worden.“
Abschließend bewerten Sie noch (S. 211) „eine Information, die wir bei Matthäus finden“ als „eindeutig falsch“:
„Herodes ließ demnach ‚alle Hohenpriester‘ zusammenkommen, um von ihnen zu erfahren, wo denn der neue König das Licht der Welt erblicken würde [Matthäus 2,4]. Es gab aber stets nur jeweils einen Hohenpriester und niemals mehrere.“
Aber nochmals muss ich Ihnen entgegnen: Ganz so blöd war Matthäus nicht, wie Sie ihn hinstellen. Hier sind Sie es, der sich irrt. Denn archiereis im Plural bedeutet schlicht „Oberpriester“; sie bildeten die Priesteraristokratie, die zum Beispiel auch im Synhedrion, dem Hohen Rat, vertreten war. Das Wort archiereōs im Singular und mit bestimmtem Artikel dagegen meint hingegen in der Regel den amtierenden Hohenpriester, der das religiöse Oberhaupt der Juden darstellte und als Vorsitzender des Synhedrions auch erheblichen politischen Einfluss ausübte.
↑ Dreieinigkeit – keine Dreigötterlehre, sondern Bibel-kompatibel!
Zum Thema (S. 212) D wie Dreifaltigkeit behaupten Sie, dass verschiedene Bibeltexte diesem Dogma widersprechen. Im Zuge der Entfaltung dieser Widersprüche machen Sie allerdings deutlich, dass Sie das Wesen der Lehre von der Dreieinigkeit nicht wirklich begreifen.
Zum Beispiel fragen Sie sich: „Wenn Gottvater und Sohn eins sind, wie ist es dann möglich, daß der Vater etwas weiß, was dem Sohn unbekannt ist?“ Ganz einfach. Jesu Wort „Ich und der Vater sind eins“ (Johannes 10,30) will sagen, dass die Liebe Gottes, des Vaters (= Gottes Heiliger Geist) vollkommen in ihm, dem Sohn Gottes wohnt. Zugleich bleibt aber Jesus voll und ganz Mensch. Er ist kein Halbgott im griechisch-römischen Sinn. Von daher ist es vollkommen klar, dass Jesus sich in seinen menschlichen Eigenschaften von Gott, dem allmächtigen Vater, unterscheidet.
Jesu Wort in Markus 10,18 „Was heißt du mich gut? Niemand ist gut als allein Gott!“ werten Sie als deutliche Distanzierung „von der Vorstellung der Dreifaltigkeit“. Man kann dieses Wort aber auch als Mahnung verstehen, die Vorstellung der Dreieinigkeit eben nicht falsch im Sinne der simplen Vergottung der menschlichen Person Jesu zu interpretieren. Jesus als Sohn ist nicht identisch mit Gott dem Vater. Aber er verkörpert voll und ganz die Liebe Gottes, die auf der Seite des Menschen ein Angewiesensein auf Gottes Erbarmen voraussetzt. Darum kann man Jesu Gottessohnschaft so begreifen, dass er der einzige Mensch ist, der tatsächlich dem Ebenbild der Liebe Gottes voll entspricht.
Insbesondere fragen Sie sich (S. 213), wie Jesus, wenn er doch selber Gott war, in seiner Verzweiflung im Garten Gethsemane beten konnte. „In seiner Not betete er zu Gott: zu sich selbst?“ Klarer könnten Sie Ihr fundamentales Missverstehen der Lehre von der Dreieinigkeit nicht ausdrücken.
Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist nicht mehr und nicht weniger als eine bildhafte Ausdrucksweise für die verschiedenen Arten und Weisen, in denen sich Gott uns offenbart: über uns in der Allmacht des Vaters, bei uns in der Begleitung durch den Bruder Jesus, in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Eins sind alle diese Weisen, Gott zu erfahren, in der Liebe, die Gott ist. In Begriffen der hebräischen Bibel kann man auch sagen: In Jesus verkörpert sich die befreiende und Gerechtigkeit schaffende Kraft des Einen Gottes der Juden, des NAMENS (100).
Insofern gebe ich dem Theologen Karl-Heinz Ohlig (101) nicht Recht, wenn er behauptet, dass die Lehre von der Dreifaltigkeit „keinerlei biblische Grundlage“ besitzt. Zwar gibt es in der Bibel diese Lehre in ihrer später entfalteten dogmatischen Form noch nicht, aber sie kann sich mit guten Gründen auf die Bibel berufen.
Sie hingegen stellen die Frage: „Wenn aber die Bibel die Dreifaltigkeit gar nicht kennt, wie entstand dann die christliche Lehre?“
Ihr Missverständnis der christlichen Trinität setzt sich darin fort, dass sie „uralte Vorläufer“ in heidnischen Religionen dort erkennen wollen, wo deren „Götterhierarchie“ durch ein „göttliches Dreigespann“ angeführt wird, wie bei den Sumerern, Babyloniern oder Ägyptern. Aber eben mit einer Dreigötterlehre hat die christliche Lehre vom drei-einigen Gott absolut nichts zu tun. Darum ist auch Ihre folgende Behauptung einfach nur falsch:
„Wann und wie genau die Dreifaltigkeit im Christentum aufkam, ist nicht exakt zu bestimmen. Offenbar wurden die jüdische Vorstellung vom alleinigen Gott mit Göttervorstellungen aus dem hellenistischen Bereich miteinander vereint.“
Genau das eben nicht. Der Theologe Larry W. Hurtado (102) widerlegte im Jahr 2005 mit sehr guten Argumenten die etwa hundert Jahre zuvor von Wilhelm Bousset vertretene Lehrmeinung, erst hellenistische Einflüsse seien für die Anbetung Jesu als „Kyrios Christos“ = „HERR Jesus“ verantwortlich zu machen. So wies Hurtado überzeugend nach, wie die urchristliche Verehrung von Jesus als Messias und Gottessohn auf Grund einzigartiger religiöser Erfahrungen mit Jesus schon sehr früh genau aus dem jüdischen Monotheismus heraus erwuchs; und zwar kam es zunächst zu einer (wie er es nennt) „binitarischen“ = sozusagen „zwei-einigen“ Anbetung des Vaters gemeinsam mit dem Sohn Jesus Christus.
Dabei wird natürlich Jesus nicht im heidnischen Sinn als leiblicher Sohn Gottes verstanden, sondern entsprechend der Art, in der Gott auch von dem Volk Israel sagen kann (2. Mose 4,22): „Israel ist mein erstgeborener Sohn“, ist Jesus der eine von Gott Erwählte, Berufene, Gesalbte, der Gott tatsächlich die Liebe und den Gehorsam entgegenbringt, die Gott innerhalb des Bundes mit seinem Volk Israel von diesem erwartet. Als diesem einen sündlosen Messias, der vollkommen dem Ebenbild Gottes entspricht, kann ihm innerhalb des jüdischen Monotheismus eine göttliche Verehrung zukommen, die in ihm die Verkörperung der Herrlichkeit des heiligen NAMENs Gottes erblickt.
Erst im Laufe der Zeit komplettierte der Heilige Geist die Dreieinigkeit, indem weitere biblische Elemente mit der Verehrung von Gott und dem Christus Jesus verknüpft wurden.
Dass (S. 214) „frühe Theologen“ mit dem Begriff der „Dreifaltigkeit“ durchaus „Unterschiedliches“ verbanden und sich eine „Vielzahl von Lehrmeinungen … einander gegenüber“ standen, ist richtig. Ton Veerkamp sieht in den dogmatischen Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts den mühsamen Versuch der Verhältnisbestimmung zwischen den neu entstehenden christlichen Glaubensformen und dem überlieferten jüdischen Glauben an den einen befreienden Gott der Tora.
↑ Jesus und das Thema Ehe – frauenfreundlich, aber judenfeindlich?
Zum Thema (S. 215) E wie Ehe beurteilen Sie Jesu Vorstellungen „zur Ehescheidung“ (S. 216) als „weitaus strenger als das allgemein als hart angesehene mosaische Gesetz“, aber als
„durchaus frauenfreundlich gemeint und auch so zu verstehen: Nach mosaischem Gesetz war die Frau nichts anderes als Besitz des Mannes. … Im ‚Alten Testament‘ galt die Frau juristisch als Sache, von der sich der Mann ohne Schwierigkeit durch eine formlose Ehescheidung trennen konnte. Eine Scheidung konnte nur zu Ungunsten der Frau verlaufen. Getrennt vom Ehemann, war sie in der Regel mittellos und ohne jegliche Versorgung.
Der einfach zu vollziehenden Trennung zum Nachteil der Frau setzte Jesus das strikte Verbot der Ehescheidung entgegen.“
Die ebenfalls frauenfreundlich auslegbare Geschichte von der Frau, die nach Johannes 8,1-11 wegen Ehebruchs gesteinigt werden soll, von Jesus aber verschont wird, unterziehen Sie (S. 218) folgender Kritik:
„So gut die Geschichte in das Bild des mildtätigen Jesus paßt, dem ein Menschenleben wichtiger ist als strikte buchstabengetreue Befolgung von Geboten und Gesetzen, so irrte der Verfasser doch. Die ausschließlich im Evangelium nach Johannes geschilderte Episode kann sich nicht abgespielt haben. Zu Jesu Zeiten gab es die Todesstrafe für Ehebruch nur noch im Text des mosaischen Gesetzes. Praktiziert wurde sie längst nicht mehr. Palästina stand unter römischer Gerichtsbarkeit. Es galt römisches Gesetz. Jüdische Glaubensgesetze, die die Hinrichtung eines Menschen forderten, waren aufgehoben.
Deutlich zu erkennen ist die antijüdische Tendenz der Geschichte um die Ehebrecherin. Dem guten Jesus auf der einen Seite stehen die bösen Schriftgelehrten auf der anderen Seite gegenüber.“
Recht haben Sie damit, dass diese Geschichte wohl keine historische Tat Jesu widerspiegelt, da sie erst spät ergänzend in den Text des Johannesevangeliums eingefügt worden ist (S. 219).
„Es ist ein Irrtum, anzunehmen, es habe den Urtext der Bibel gegeben. Unsere heutigen Bibelausgaben sind das Ergebnis einer Entwicklungsgeschichte. Auf dem Weg zu unserem heutigen Text gab es voneinander abweichende Versionen, die erst nach und nach miteinander verwoben und verarbeitet wurden.“
Allerdings ist es auch fraglich, wie ich schon oben des öfteren zu bedenken gegeben habe, ob die Todesstrafe für Ehebruch im Judentum tatsächlich überhaupt früher geltendes und praktiziertes Recht gewesen war. Denn die einzige Stelle im Alten Testament (S. 217), die „für Ehebruch die Todesstrafe“ vorsah, ist 3. Mose 20,10:
„Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat.“
Und das ist eine jener MOTh-JUMaTh-Stellen (von Luther mit „des Todes sterben“ übersetzt), von denen Erhard S. Gerstenberger nachgewiesen hat, dass sie nichts darstellten als ethische Ermahnungen in außerordentlich drastischer Form.
Ob man die Geschichte der Ehebrecherin antijüdisch auslegen muss, stelle ich ebenfalls in Frage. Im Anschluss an eine Interpretation der Erzählung von Andreas Bedenbender habe ich sie in dem Gottesdienst „Politikverdrossenheit und die Ehebrecherin“ in einen alternativen Zusammenhang hineingestellt.
↑ Engel hatten keine Flügel
Ihren sehr differenzierten und umfassenden Ausführungen zum Thema (S. 119) E wie Engel habe ich nichts hinzuzufügen – außer einer Kleinigkeit. Mit der Forderung in 1. Korinther 11,10 (S. 223f.): „Darum soll eine Frau ein Tuch auf dem Haupte haben um der Engel willen“, bezieht sich Paulus nicht ganz allgemein auf irgendwelche Dämonen, sondern auf die in 1. Mose 6,2 erwähnten „Gottessöhne“. Von denen heißt es dort, dass sie „sich zu Frauen [nahmen], welche sie wollten“. Später interpretierte man sie als aus dem Hofstaat Gottes herausgefallene, böse, dämonische Engel.
↑ Erlöst – nicht Erlöser
Für Ihren Hinweis unter (S. 224) E wie Erlöst auf Sacharja 9,9 bin ich Ihnen dankbar. Denn dass an dieser Stelle der göttliche König zugleich als gerecht und als errettet dargestellt wird, war mir bei meinem bisherigen Bibelstudium entgangen.
Sie haben Recht (S. 225), die gängigen Bibelübersetzungen gehen über die passive Form des zweiten Wortes in dem Ausdruck TsaDIQ WeNOSchAˁ einfach hinweg – auch in der Lutherbibel 2017 steht noch „Helfer“, die Einheitsübersetzung hat „er hilft“, und sowohl die Elberfelder als auch die Zürcher Bibel übersetzen mit „siegreich“, vielleicht weil ein vor der Niederlage geretteter König wenigstens indirekt als siegreich bezeichnet werden kann.
Die Erklärung von Rabbi Abbahu aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., dass es in diesem Wort „um die Erlösung Gottes“ gehe, sich demnach „auch Gott selbst zusammen mit seinem Volk Israel erlösen“ lässt, finde ich sehr sympathisch. Denn wie soll man die Allmacht Gottes begreifen, wenn so viel Leid in der Welt existiert, dessen Gott scheinbar nicht Herr wird? Die von Ihnen skizzierte Vorstellung zeigt einen durchaus gangbaren, nachvollziehbaren Weg:
„Gott ist am Anfang allmächtig. Gott aber nimmt sich selbst zurück, um Platz für die Schöpfung zu lassen. Die ersehnte Erlösung wird dann nicht nur der Schöpfung (den Menschen) zuteil werden, sondern dem Schöpfer selbst. Überträgt man das Prophetenwort auf Jesus, so wird auch er vom Erlöser zum Erlösten.“
Gerade von Jesus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich selbst in seinem Gegenüber zum guten Gott (trotz seines Bewusstseins, mit Gott eins zu sein) als erlösungsbedürftig angesehen hat, ja, dass er gerade, indem er sich in vollkommener Weise als auf Gottes Liebe angewiesener und auf Gott vertrauender Mensch verstand, der Gottessohn wurde, der zugleich ganz Mensch und ganz Gott war.
In meinem Gottesdienst „Gottes Seele ist in Christus lebendig“ habe ich in genau diesem Sinne das Wort aus 1. Timotheus 3,16 ausgelegt, in dem es von Jesus Christus heißt, dass auch er gerechtfertigt wurde.
↑ Bileams sprechende Eselin und Jesu Ritt auf zwei Eseln
Zum Stichwort (S. 225) E wie Esel erinnern Sie an zwei biblische Geschichten. Die „märchenhafte Darstellung“ der sprechenden Eselin des Propheten Bileam (4. Mose 22), die im Gegensatz zu ihm (S. 226) „auch die Welt der unsichtbaren Kräfte“ wahrnimmt, möchten Sie (S. 227) auf drei verschiedene Weisen verstehen:
„Für den skeptischen Bibelleser ist die Bileam-Episode Beweis dafür, daß die Bibel märchenhafte Texte bietet, an die der vernünftige Mensch nicht glauben kann. Der Esoteriker mag sie als bildhafte Beschreibung verstehen: Tiere nehmen eine geistige Welt wahr. Nur wundergläubige Menschen werden glauben, daß Gott der Eselin den Mund öffnete und sie vernehmbar und verständlich redete.“
Man könnte sie allerdings, auch wenn man kein Esoteriker ist, als weiteren Beleg dafür akzeptieren, dass es der Bibel nicht um Fakten und Historie geht, sondern um Glaubenserzählungen (103).
Aber ritt Jesus tatsächlich auf zwei Eseln gleichzeitig in Jerusalem ein, wie es beim Evangelisten Matthäus 21,6-7 zu lesen ist?
„Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eselin und das Füllen … und Jesus setzte sich auf sie.“
Ihr Kommentar zu diesem Vers:
„Die Unsinnigkeit dieser Behauptung ist augenscheinlich. Niemand kann auf zwei Eseln gleichzeitig sitzen, geschweige denn reiten.“
Die allegorische Deutung des Thomas von Aquin, dass „die Eselin für die Synagoge“ stehe und „das Eselfohlen für ‚das freie Heidenvolk‘“, dass also „Jesus sinnbildlich sowohl vom alten Judentum als auch vom noch nicht bekehrten Heidentum ‚getragen‘“ wird, halten Sie für nicht „sehr überzeugend“. Stattdessen erkennen Sie in der Übertragung der Verheißung des Messias in Sacharja 9,9 auf Jesus einen Übersetzungsfehler. Matthäus 21,4-5 zitiert den alttestamentlichen Propheten so:
„Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: ‚Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.‘“
Im Urtext des zitierten Propheten Sacharja 9,9 stand aber, so übersetzen Sie aus dem Hebräischen:
„Siehe, dein König kommt zu dir … und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin.“
Und daraus folgt:
„Es waren demnach zwar zwei Esel vorhanden, das Muttertier und das Fohlen. Jesus ritt auf dem Fohlen: auf dem Esel, dem Jungen einer Eselin. Im Evangelium nach Matthäus wurde aus ‚auf dem Esel, dem Jungen einer Eselin‘ völlig sinnentstellend ‚auf dem Esel und dem Jungen einer Eselin‘. Und schon ritt Jesus gleichzeitig auf zwei Eseln statt auf einem!“
Zur Ehrenrettung des Matthäus möchte ich allerdings anmerken, dass man diesen Übersetzungsfehler sehr leicht begehen kann. Auch Ihre Übersetzung „reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen“ ist nämlich nicht ganz korrekt. Im hebräischen Urtext steht nämlich dort, wo Sie nur ein Komma stehen haben, durchaus das Verbindungswörtchen Wə: ˁAL-ChaMOR WəˁAL-ˁAJiR BäN-ˀAThoNOTh = „auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen, dem Sohn einer Eselin“. Dass dieses Wə an dieser Stelle mit „und zwar“ übersetzt werden muss, während es doch in den meisten Fällen wirklich „und“ bedeutet, kann man leicht übersehen.
Vielleicht hat Matthäus nicht einmal in den hebräischen Urtext hineingesehen, sondern sich an die griechische Version der Septuaginta gehalten. Und die hatte auch schon das hebräische Wə mit einem einfachen kai = „und“ übersetzt: epi hypozygion kai pōlon neon = „auf einem Lasttier und einem jungen Fohlen“. Daraus macht Matthäus die Version: epi onon kai epi pōlon hyion hypozygiou = „auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Sohn eines Lasttiers“.
↑ Rudolf Bultmann verbot keine kritischen Fragen zu den Evangelien
Zum Thema (S. 229) E wie Evangelien erläutern Sie zunächst (S. 230) die Bedeutung dieses Wortes „‚frohe Botschaft‘: ‚eu-aggélion‘ (Griechisch), verdeutscht: Ev-angelium“. Allerdings gab es
„über Jesus und sein Leben … Dutzende von Evangelien… Warum wurden gerade die vier Evangelien, die wir aus der Bibel kennen, ausgewählt? Weil wir wissen, wer die Texte schuf?“
Zu Recht gehen Sie davon aus, dass alle vier kanonischen Evangelien ursprünglich anonym verfasst und erst nachträglich mit Aposteln Jesu in Verbindung gebracht wurden: mit den Jüngern Matthäus und Johannes, mit Lukas, einem Begleiter des Paulus, und (Johannes) Markus, einem Schüler des Paulus, der später auch ein Dolmetscher des Petrus gewesen sein soll.
Ihre Unterstellung, dass die heutigen Bezeichnungen der Evangelien als Evangelium „nach“ Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes eine tatsächlich von dem genannten Autor verfasste Urform der jeweiligen Schrift voraussetzen würde, ist allerdings Unsinn; eine solche Vorstellung vertritt niemand. Traditioneller denkende Christen glauben nach wie vor an die unmittelbare Autorschaft der Apostel bzw. Apostelschüler, die historisch-kritische Forschung hat an der anonymen Verfasserschaft keine Zweifel.
Ein kleiner Irrtum unterläuft Ihnen im Zusammenhang mit dem Johannesevangelium, indem Sie schreiben (S. 232):
„Doch anders als bei den drei älteren Evangelien taucht im Falle Johannes der Verfassername eindeutig auf: im 21. Kapitel! Ganz klar und eindeutig wird hier Johannes als der Jünger bezeichnet, „der von diesen Dingen zeugt und geschrieben hat [Johannes 21,15 und 24].“
Sie haben zwar darin Recht, dass das „gesamte Kapitel 21 … eindeutig von späteren Bearbeitern nachträglich angefügt“ wurde, aber weder im Johannesevangelium selbst noch in diesem angehängten Kapitel wird der Name des Jüngers Johannes auch nur ein einziges Mal erwähnt! Überall, wo der Name „Johannes“ im Johannesevangelium auftaucht, ist entweder Johannes der Täufer gemeint oder der Vater des Jüngers Simon Petrus – letzterer und nicht der Jünger Johannes steht auch in der von Ihnen angeführten Stelle Johannes 21,15.
Aber wie kam man dann darauf, dass der Jünger Johannes das Johannesevangelium geschrieben hat? Im Anhang des Evangeliums selbst 21,20-24 wird als Verfasser der Jünger genannt, „den Jesus liebhatte“ (und der außerdem noch in Johannes 13,23; 19,26; 20,2 und 21,7 vorkommt). Den wiederum identifizierte man später mit dem in anderen Evangelien genannten Johannes, einem der Söhne des Zebedäus. Im Johannesevangelium werden diese Zebedäussöhne übrigens auch nur im Nachtragskapitel 21,2 erwähnt, aber ohne sie bei ihren Namen zu nennen.
Ihre Kritik (S. 233) an der Ihnen „als befremdlich“ erscheinenden Art, wie die wissenschaftliche Theologie in Deutschland mit der Hypothese einer möglicherweise hinter den gemeinsam von Matthäus und Lukas benutzten Traditionen Quelle „Q“ umgeht, erscheint mir nicht ganz fair. So schreiben Sie:
„Einerseits wird in der deutschsprachigen Theologie kein Zweifel an der Existenz von ‚Q‘ zugelassen. Andererseits wird höchst Widersprüchliches über ‚Q‘ diskutiert.“
Aber soweit ich weiß, gilt in Deutschland die Existenz der Quelle „Q“ keinesfalls als bewiesen (104). Viele Theologen sind allerdings nach wie vor davon überzeugt, dass sich durch diese Hypothese eine Menge erklären lässt. Manches aber auch nicht. Sie allerdings behaupten einfach (S. 234):
„Während für deutsche Theologen ‚Q‘ unbezweifelbare Realität ist, sehen das französische Theologen ganz anders. In Frankreich gehen führende Theologen davon aus, daß es ‚Q‘ gar nicht gegeben hat. Beide Seiten sehen sich als Verfechter und Anwender strenger wissenschaftlicher Grundsätze. Aber eine Seite irrt. Welche?“
Sie scheinen von der irrigen Ansicht auszugehen, dass in der Wissenschaft eine Hypothese relativ leicht als richtig oder falsch zu erweisen sein müsste. Aber so einfach ist das eben nicht. Daher ist es völlig normal, dass sich in der wissenschaftlichen Forschung gegensätzliche Standpunkte gegenüberstehen, die mehr oder weniger starke Argumente für ihre Positionen geltend machen.
Schlicht und einfach falsch ist Ihr Urteil über den Theologen Rudolf Bultmann, dem Sie geradezu das Gegenteil von dem unterstellen, was sein Hauptanliegen war:
„Für Bultmann stellt sich gar nicht die Frage, ob denn ein beschriebenes Ereignis wahr ist oder nicht. Was in den Evangelien steht, das hat als Gottes Wort zu gelten und darf nicht bezweifelt werden. Für den Christen gibt es nur eine Frage: Will er glauben oder will er es nicht.“
Auf diese Weise ausgerechnet Bultmann, der ein Programm der „Entmythologisierung des Neuen Testaments“ entwickelte, vorzuwerfen, dass er sozusagen gefordert hätte, den Verstand an der Kirchentür abzugeben, stellt die Wahrheit auf den Kopf. Er vertrat nach Wikipedia stattdessen die Überzeugung:
„Um eine überholte Gedankenwelt nicht zur Voraussetzung des Glaubens werden zu lassen, sei es Aufgabe der Theologie, den vom mythologischen Weltbild unabhängigen Kern der christlichen Verkündigung herauszuarbeiten“.
Zu Ihrer Fehleinschätzung kommen Sie offenbar durch ein Missverständnis des von Ihnen angeführten Zitat Bultmanns (105), „daß nach der historischen Zuverlässigkeit des Überlieferten nicht gefragt werden darf“. Bultmann fordert gerade nicht, das in der Bibel Überlieferte als unbeweifelbare historische Realität zu glauben. Im Gegenteil: In seinen Augen ist die historische Zuverlässigkeit der biblischen Geschichte für den Glauben dermaßen unerheblich, dass es sogar überflüssig ist, nach ihr zu fragen. Nicht ohne Grund war Rudolf Bultmann noch in der Zeit meiner Jugend ein Hassgegner derjenigen, die auf einer wörtlichen Auslegung der Bibel und ihrer historisch-faktischen Wahrheit beharrten.
Rudolf Augstein meint mit seinem Vorwurf (S. 234): „Gefragt werden darf nicht, ohne Fragen muß geglaubt werden, Rückfrage ist schon Ablehnung“ sicher nicht Rudolf Bultmann, der ja intensiv nach der Wahrheit des Evangeliums jenseits des mythologischen Weltbildes fragte. Augsteins Satz: „wer fragt, hört auf zu glauben“ hätte Bultmann allerdings nicht zugestimmt – denn der Glaube hing für ihn nicht von der historischen Wahrheit der Bibel ab.
↑ War Petrus ein griechischer Fels oder ein aramäischer Steinblock?
Zum Stichwort (S. 235) F wie Fels zitieren Sie eine „der wichtigsten ‚Erklärungen‘ für einen biblischen Namen“, die „sich auf Simon, der auch Petrus genannt wurde“, bezieht. Nach dem Evangelisten Matthäus 16,18 bestimmt Jesus: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde.“
Die Erklärung halten Sie für „unlogisch“, denn „Jesus sprach Aramäisch und nicht Griechisch“. Wieso sollte Simon also von Jesus einen griechischen Beinamen erhalten haben?
Unter Berufung auf George M. Lamsa (106) erläutern Sie nun:
„Der Name Simon (aramäisch Schimun) wurde von vielen Müttern gewählt, die um einen Sohn gebetet hatten und erhört worden waren. Dankbar nannten sie ihr Kind dann Schimun, nämlich im Sinne von ‚Gott hat mich erhört!‘ Schimun bedeutet nämlich ‚gut hörend‘, allerdings auch ‚schnell begreifend‘.
Nun war aber Simon, Lamsa weist darauf hin, alles andere als schnell von Begriff, sondern schwerfällig und langsam im Denken. Deshalb wurde er von Freunden offensichtlich spöttisch Kepa, also Steinblock, gerufen, eben, weil er träge im Denken war.“
Einen Beleg dafür, dass Simon bereits vor seiner Begegnung mit Jesus wegen seiner Schwerfälligkeit mit dem Spitznamen „Kepa“ gerufen wurde, führt Lamsa allerdings nicht an; er erschließt diesen Zusammenhang nur auf Grund seiner Kenntnisse der aramäischen Sprache. Die griechische Form dieses Namen (kephas) wird in Johannes 1,42 und von Paulus in Galater 2,7 mit dem ins Griechische übersetzten Namen petros in Verbindung gebracht. Hat vielleicht doch erst Jesus ihn kepa = kephas = „Fels“ oder „Stein“ genannt – möglicherweise mit einem ironischen Unterton?
↑ Galiläa – Jesu Heimat oder Symbol für Rebellion?
Zum Stichwort (S. 236) G wie Galiläa stellen Sie zunächst die Frage, ob „Jesus in Galiläa zu Hause“ war (107). Der Theologe Günther Bornkamm scheint diese Frage zu bejahen, weil „Jesu Muttersprache … das galiläische Aramäisch“ ist. Der von Ihnen geschätzte George M. Lamsa (108) geht ebenfalls davon aus, dass Jesus aus Galiläa stammte, zumal sein Messiasanspruch ja in Jerusalem deswegen sogar bestritten wurde:
„Wie konnte der Christus aus Galiläa stammen, so fragten die Juden sich, da in ihren Schriften doch erklärt wurde, Er werde aus Bethlehem und vom Stamme Juda kommen?“
Dagegen scheint sich der Theologe Willi Marxsen (109) auszusprechen, indem er darauf hinweist, dass „alle Galiläa-Stellen im Markus-Evangelium redaktionell sind“, also „erst nachträglich eingefügt“ wurden. Das könnte folgenden Grund haben:
„Für die Autoren und Bearbeiter der Texte stand nicht die Erstellung einer historisch korrekten Biographie im Vordergrund des Interesses. Sie schufen nach Jesu Tod Beschreibungen des Lebens Jesu in Anlehnung an möglichst viele ‚prophetische Texte‘ des ‚Alten Testaments‘. Und bei Jesaja [8,23] heißt es, ‚Er (der „Friedensfürst‘)‘ werde ‚zu Ehren bringen das Galiläa der Heiden‘. Und da in ihren Augen Jesus eben dieser ‚Friedensfürst‘ war, mußte er aus Galiläa stammen.“
Letzten Endes ist historisch nicht zu entscheiden, ob Jesus wirklich ein Galiläer war. Auf Grund alttestamentlicher Voraussagen verortet man ebenso seine Geburt in Bethlehem wie sein Wirken im Galiläa der Heiden, womit historisch weder etwas bewiesen noch widerlegt werden kann.
Es mag sogar sein (S. 237), dass man Jesus durch das Schlüsselwort „galiläisch“ bewusst „als Widerständler gegen Rom“ kennzeichnen wollte. Allerdings war er nicht in normale Schubladen des gewaltsamen zelotischen Kampfs gegen die Römer einzuordnen. Stattdessen beschritt er einen gewaltfreien Weg der Solidarität mit Armen, Kranken und Entrechteten, verbunden mit konsequenter Leidensbereitschaft. Möglicherweise meint Marxsen so etwas mit seiner Idee, dass Jesus nicht wortwörtlich gesehen aus Galiläa stammt, sondern dass Markus Jesus in einem übertragenen Sinn in die galiläische Landschaft einordnet (110):
„Markus schreibt ein ‚galiläisches Evangelium‘, so Willi Marxsen. Ihm zufolge wollte er damit nicht nur zum Ausdruck bringen ‚Jesus hat in Galiläa gewirkt; sondern umgekehrt: wo Jesus gewirkt hat, ist GaliIäa.‘ lm Sinne einer präsentischen Esohatologie des Osterglaubens kann man sogar sagen: Überall dort, wo Jesus heute noch wirkt, ist Galiläa.“
↑ Rief Jesus zum Hass auf und drohte er in Gleichnissen Gewalt an?
Zu (S. 237) H wie Hass fragen Sie sich zum Jesuswort Lukas 14,26: „Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein!“, ob „Jesus ein Missionar des Hasses und nicht der Liebe“ ist. „Des Rätsels Lösung: Hier wurde keine vermeintlich ‚verborgene Aussage Jesu‘, sondern eine falsche Übersetzung entdeckt.“
Richtig beziehen Sie sich dann darauf, dass in der Muttersprache Jesu, dem Aramäischen, das hier mit „hassen“ übersetzte Wort auch die Bedeutung „zur Seite setzen“ haben kann. Damit nehmen Sie folgende Aussagen von George M. Lamsa (111) auf, den Sie an dieser Stelle allerdings nicht zitieren:
„Im orientalischen Wortlaut heisst es jedoch: ‚Wer zu mir kommt und seinen Vater, … nicht zur Seite setzt, …‘ Diese Aussage stimmt besser mit Jesu Lehre vom Liebhaben und Ehren der Eltern überein. Missionare setzen heutzutage auch ihre Eltern beiseite, um in das ferne Missionsfeld zu ziehen; das heisst aber nicht, dass sie ihre Eltern hassen! Das aramäische Wort saney bedeutet beides: ‚zur Seite setzen‘ und ‚hassen‘.“
Ihre beiläufige Bemerkung, dass der aramäische Text des Evangeliums nach wie vor erhalten sei, geht sicher auch auf Lamsa (112) zurück, der
„von einem traditionellen Lehrsatz ab[weicht], nach dem die griechischen Manuskripte die ältesten uns zugänglichen Aufzeichnungen des Neuen Testaments sein sollten“.
Nach Wikipedia geht allerdings die theologische Wissenschaft im Allgemeinen davon aus, dass die Peschitta, auf die sich Lamsa bezieht, „eine Bibelübersetzung in die zum östlichen Zweig der aramäischen Sprachen gehörende Syrische Sprache“ und nicht den Urtext der neutestamentlichen Evangelien darstellt.
Nachdem Sie klargestellt haben, dass der angebliche Aufruf Jesu zum Hass gegen die eigene Familie auf einem Irrtum beruht, behaupten Sie dann aber doch (S. 238):
„Und wir irren uns, wenn wir annehmen, daß es nur den Liebe predigenden Jesus gab. Auch richtig übersetzte Jesus-Worte können sehr brutal sein. So sagt Jesus nach Lukas [19,27]: ‚Doch jene meiner Feinde, die nicht wollen, daß ich über sie herrsche, bringt sie her und macht sie vor mir nieder.‘ Ältere Ausgaben wie die Luther-Bibel von 1915 sind in der Ausdrucksweise drastischer. Da sollen dann Jesu Feinde vor seinen Augen ‚erwürgt‘ werden.“
Aber hier irren Sie – oder Sie führen sogar bewusst in die Irre. Denn nicht Jesus spricht hier von seinen Feinden und wie er sie behandelt, sondern Jesus erzählt ein Gleichnis, in dem ein König, der den Bürgern so verhasst war, dass sie ihn nicht als König wollten, seine Feinde niedermachen lässt.
Die gängige allegorische Auslegung des Gleichnisses bezieht allerdings den König auf Gott. Ist also Gott so brutal, dass er seine Feinde erschlagen lässt? Auch das ist nicht gemeint, denn in der Regel werden Gleichnisse Jesu als Parabeln verstanden, in denen jeweils nur ein bestimmter Zug den Vergleichspunkt mit dem Reich Gottes bildet, von dem Jesus bildhaft sprechen will. In diesem Fall geht es in diesem Sinne nur um den Umgang der drei Knechte des Königs mit den ihnen anvertrauten Pfunden.
Außer Acht bleiben allerdings bei dieser traditionellen Auslegung sämtliche Züge des Gleichnisses, die an zeitgenössische historische Ereignisse erinnern. Die Theologin Luise Schottroff (113) ist in ihrer sozialgeschichtlichen Auslegung der Gleichnisse Jesu darauf eingegangen und sieht Lukas 19,11-27 unter der Überschrift „Wir wollen keinen König wie Herodes“ als eine politische Anklage gegen die Thronanwärter aus der Familie des Herodes, die in das „ferne Land“ Rom reisen, um sich „ihr Vasallenkönigtum“ vom Kaiser übertragen zu lassen. Zugleich hält Jesus die „Erwartung einer wunderbaren Befreiung Jerusalems“, die sich an seine Person knüpft, für unrealistisch (114):
„Das Gleichnis erläutert den Umstehenden also, warum Jesus ihre messianische Hoffnung für einen Irrweg hält. Seine politische Analyse ist radikal: Das römische Imperium ist gnadenlos auf Geld und Gewalt aufgebaut. Ihr wisst doch, wie dieses Imperium funktioniert. Wer aufbegehrt, wird umgebracht (19,27).“
In diesem Zusammenhang sieht Schottroff die Erzählung von den anvertrauten Pfunden als Gegenbild zur Zachäusgeschichte, indem der dritte Sklave sich den Ausbeutungsmechanismen des Mammon widersetzt.
Würde Schottroffs Auslegung nicht genau zu Ihren Überlegungen zum „galiläischen“ Rebellentum gegen Rom passen?
↑ Hat Jesus wirklich Wasser in Wein verwandelt?
Zu (S. 238) H wie Hochzeit zu Kana wundert es mich zunächst, dass Sie nach den Zweifeln an der galiläischen Heimat Jesu nun so unbefangen davon ausgehen, dass es Jesus die „fruchtbaren Gefilde um den See Genezareth … angetan“ hatten und dass Jesus Kana, „diesen kleinen Ort, der heute Kefar Kana heißt, öfter besucht“ hat. Das klingt, als sei das ausgemachte historische Tatsache oder als seien Sie selbst dabei gewesen.
Nach dem Johannesevangelium vollbringt Jesus bei einer Hochzeit in Kana sein erstes Wunder (S. 139). „Unverständlich“ finden Sie in der Lutherbibel 1984 zunächst die barschen Worte, die Jesus an seine Mutter richtet (Johannes 2,4): „Was geht‘s dich an, Frau, was ich tue?“, und Sie erläutern:
„Wiederum liegt ein Übersetzungsfehler vor: Im Original wurde gar keine Frage gestellt. Im Original steht, wortwörtlich übersetzt und damit etwas holperig: ‚Etwas ist mir, etwas ist dir, Frau.‘ Wie mag das zu verstehen sein? Wieder im Kontext: Der Wein ist von den Gästen schon fast verkonsumiert. Jesu Mutter ist unruhig. Ihr Sohn beschwichtigt: ‚Ich mache mir keine Sorge. Etwas ist mir, etwas ist dir, Frau, schon möglich.‘ Oder etwas freier: ‚Der Wein ist alle? Ich mache mir keine Sorgen. Etwas wird uns schon einfallen!‘“
Aber in dem griechischen Ausdruck ti emoi kai soi = „was mir und dir?“ ist das ti doch ein Fragewort. Er geht auf die exakt gleiche hebräische Wendung MaH-LI WaLaK zurück, die so viel bedeutete wie „nicht mein Problem – dein Problem“. Wie in Richter 11,12 und 2. Samuel 16,10 wird „ein gemeinsames Anliegen zwischen zwei Personen in Frage gestellt“ (115).
Aber will Jesus seiner Mutter wirklich nur etwas so Banales wie „ist doch kein Problem, dass der Wein alle ist“ sagen? Nach Ton Veerkamp (116) „kann nicht die Rede davon sein, daß Jeschua irgendeiner Hochzeitsgesellschaft aus irgendeiner Verlegenheit hilft und sich als Wundermann erweist. Das Urbild der Hochzeit ist die Hochzeit zwischen Israel und seinem Gott… Der Zweck des ‚Zeichens‘ besteht darin, daß die Schüler Vertrauen in Jeschua finden…“. Interessant ist, dass in Veerkamps Augen (117) der Evangelist Johannes die „Mutter des Messias“ mit Israel identifiziert, die wiederum „Jeschua und seine Schüler“ als Repräsentanten „der messianischen Gemeinde“ darauf aufmerksam macht, dass kein Wein da ist, und zwar Wein als Symbol dafür, dass der in Jesaja 5,1ff. besungene Weinstock Israel noch keine Früchte, keine Trauben gebracht hat. Nach dem Johannesevangelium in der Auslegung von Ton Veerkamp läuft die Erzählung vom Weinwunder auf Folgendes hinaus (118):
„Das toratreue Israel im Lande (die sechs Gefäße, gefüllt mit Wasser) muß zum messianischen Israel werden (zu sechs Gefäßen, gefüllt mit Wein). Freilich bleibt die Frage: warum sechs?“
Als mögliche Erklärung verweist Veerkamp auf 1. Könige 18,34. Dort lässt der Prophet Elia in seinem Schaukampf mit den Propheten des Gottes Baal zwölf Eimer voll Wasser auf sein Brandopfer schütten, nachdem er (1. Könige 18,31f.) „zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs“ zum Bau des Opferalters genommen hatte. Ist hier in Kana nur „das ‚halbe‘ Israel“ versammelt? Wird in Johannes 10,16: „Andere Schafe habe ich, die sind nicht von diesem Hof“ von der anderen Hälfte gesprochen, mit denen im Johannesevangelium möglicherweise die Samaritaner gemeint sein könnten (oder die heidnischen Völker)?
Auch Sie beantworten die Frage (S. 240): „Bediente sich Jesus der Zauberei?“ mit „Wohl kaum!“ Stattdessen ist die
„Pointe des Textes … tatsächlich bildhaft zu verstehen. Jesus schenkt Wasser aus. Und ‚verwandelt‘ es in Wein.“
Und die Art dieser Verwandlung, die sich auf die geistige Kraft der Lehre Jesu bezieht, legen Sie mit einem Zitat von George M. Lamsa (119) dar:
„Dieses erste Wunder Jesu hat geistige Bedeutung. Seine Lehre war die beste, welche die Galiläer bisher je gekostet hatten. Sollte Jesus die Kraft, die er besaß, wirklich dazu gebraucht haben, um Menschen, die schon zu viel getrunken hatten, noch mehr von dem berauschenden Getränk zu verschaffen? Die Heilige Schrift verurteilt die Betrunkenheit: ‚Lasset euch nicht irreführen! Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener… noch die Trunkenbolde… werden das Reich Gottes ererben.‘ (1. Kor. 6 : 9, 10).“
Auch diese Interpretation der Erzählung von der Hochzeit zu Kana macht Sinn. In einer Betrachtung der Alzeyer Allgemeinen Zeitung zum Thema „Wunder gibt es auch in Alzey“ habe ich einmal einen ähnlichen Gedankengang entwickelt.
↑ Die Kreuzesinschrift gab es auch auf Aramäisch – nicht wirklich?
Zum Stichwort (S. 240) I wie INRI fragen Sie sich zunächst, wie wohl das Kreuz ausgesehen hat, an dem Jesus gestorben ist. Die (S. 241) griechische Bezeichnung „staurós“, die in den Evangelien verwendet wird, „bezeichnet … im klassischen Griechisch einen stehenden Stamm oder Pfahl, keineswegs aber einen Stamm mit Querbalken“.
Dass aber (S. 242f.) „das Kreuz mit dem senkrechten Balken, der über den waagrechten Balken hinausragt, … das Ergebnis einer rein praktischen Überlegung“ sein soll, die Sie wie folgt skizzieren, halte ich allerdings für ziemlich weit hergeholt (S. 242):
„Angeblich war ja am Kreuz Jesu eine Inschrift angebracht. Der so genannte ‚titulus‘ wird von allen vier Evangelisten erwähnt. Die ideale Form eines Kreuzes mit einem guten Platz für ein Täfelchen ist die klassische! Der senkrechte Kreuzbalken ragt über den waagrechten hinaus. Und ganz oben, am senkrechten Pfahl und über dem Querbalken, kann gut so etwas wie ein Schild mit einigen Worten angebracht werden.“
Diese Überlegungen sind ohnehin müßig, da Sie sowieso davon ausgehen (S. 245), dass es „bei den Römern zu keiner Zeit den Brauch gegeben [hat], am Kreuz eines zum Tode Verurteilten und Hingerichteten so etwas wie eine Tafel anzubringen.“
Trotzdem fragen Sie sich (S. 244) im Blick auf die Behauptung des Johannesevangeliums, dass „mehrsprachig auf den Mann am Kreuz“ hingewiesen worden sei, und zwar „in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache“ (Johannes 19,20):
„Warum fehlt dann ausgerechnet Aramäisch, die einzige Sprache, die die Mehrheit der Juden verstanden?“
Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort: Aramäisch fehlt gar nicht, denn das griechische Wort Hebraisti, das allerdings in allen mir bekannten deutschen Übersetzungen mit „Hebräisch“ übersetzt wird, kann ebenso gut auch „Aramäisch“ bedeuten. Das zeigt sich etwa in Johannes 19,13 und 17, wo die aramäischen Ortsnamen Gabbatha und Golgotha als Worte in Hebraisti bezeichnet werden.
Trotzdem hat es historisch gesehen sicher keine Kreuzinschrift gegeben; es ist gar nicht notwendig, das noch zusätzlich mit dem folgenden unzutreffenden Argument zu untermauern:
„Wie unzuverlässig Johannes in Sachen Kreuzinschrift ist, beweist ein unscheinbarer Vers. Angeblich beschwerten sich die Hohenpriester bei Pilatus. Jesus dürfe nicht als ‚König der Juden‘ bezeichnet werden, sondern als ‚der, der gesagt hat, er sei der König der Juden‘ [Johannes 19,21]. Es ist freilich eine unumstößliche Tatsache, daß es im alten Israel stets nur einen einzigen Hohepriester gegeben hat und niemals mehrere. Beschwerden von den Hohenpriestern kann es also nicht gegeben haben. Wer immer auch das Evangelium nach Johannes verfaßt hat, kann sich mit den Grundkenntnissen jüdischen Glaubens nicht ausgekannt haben.“
Aber, wie unter C wie CMB schon einmal ausgeführt: Die biblischen Schriftsteller haben sich sehr wohl mit den Grundkenntnissen jüdischen Glaubens ausgekannt. Wieder einmal sind Sie es, der sich irrt, denn archiereis im Plural bedeutet schlicht „Oberpriester“; diese bildeten die Priesteraristokratie, die auch im Synhedrion, dem Hohen Rat, vertreten war. Der archiereōs im Singular und mit bestimmtem Artikel meint hingegen in der Regel den amtierenden Hohenpriester, dessen Amt tatsächlich auf nur eine Person beschränkt ist (Johannes 18,13 und Lukas 3,2 nennen parallel zum Hohenpriester Kaiphas auch seinen Schwiegervater Hannas, der auch Hoherpriester gewesen war). In Matthäus 26,3 wird dieser Sachverhalt bestätigt, indem unterschieden wird zwischen den Hohenpriestern (Mehrzahl), die gemeinsam mit des Ältesten des Volkes unter dem Vorsitz des Hohenpriesters (Singular) Kaiphas eine Versammlung abhalten:
„Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas…“
↑ Israel starb im Bett, nicht im Gebet +auf seinen Stab gestützt
Nun kommt die Geschichte, die aufzudröseln mir in Ihrem Buch am meisten Spaß gemacht hat. Unter (S. 245) I wie Israel behaupten Sie nämlich, in der Bibel zwei einander völlig widersprechende „Versionen von Israels Tod“ gefunden zu haben:
„Nach dem ersten Buch Mose verschied er im Bett [1. Mose 47,31]: „Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin.“ Nach dem Hebräerbrief [11,21] war es ganz anders: Der unermüdliche, gottesfürchtige Wandersmann starb im Stehen. Demütig „neigte er sich gegen seines Stabes Spitze.“
Nun haben Sie die entsprechenden Stellen aber nicht gründlich in ihrem Zusammenhang überprüft.
In dem von Ihnen zitierten Vers 1. Mose 47,31 ist zwar, genau wie Sie es zitieren, davon die Rede, dass Jakob/Israel sich
„anbetend über das Kopfende des Bettes hin“
neigt, nachdem er seinem Sohn Josef das Versprechen abgenommen hat, seinen Leichnam in Palästina zu bestatten. Aber das ist nicht der Augenblick, in dem er stirbt!
Sein Tod erfolgt erst zwei Kapitel später, nachdem er zunächst die Söhne Josefs (Kapitel 48) und dann alle seine zwölf Söhne (Kapitel 49) gesegnet hat. Dann stirbt Jakob/Israel tatsächlich im Bett. Nach 1. Mose 49,33
„tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied…“.
Auch der Vers Hebräer 11,21:
„Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich über die Spitze seines Stabes“
beschreibt nicht den unmittelbaren Todeszeitpunkt Jakob/Israels. Denn dieser Vers ruft das Gebet Jakobs aus 1. Mose 47,31 zusammen mit der Segnung seiner Enkel in 1. Mose 48 (120) in Erinnerung, was beides zwar an verschiedenen Tagen, aber in der Zeit kurz vor seinem Tod geschehen ist.
Obwohl nun nach dem Alten Testament klar ist, dass nach 1. Mose 49,33 Jakob/Israel eindeutig im Bett verstorben ist, gewinnen Sie durch einen merkwürdigen Gedankengang (S. 246)
„eine klare Antwort auf die Frage: ‚Wo also starb Israel?‘: Stehend, auf seinen Stock gestützt, das Haupt geneigt.“
Wie genau kommen Sie darauf?
„Wo die gängige Fassung des Verses nach Mose lautet ‚Kopfende des Bettes‘, da steht im hebräischen Original ‚mth‘. Diese drei Konsonanten können für zwei Worte stehen, nämlich für Bett, aber auch für Stab. Ob ‚Bett‘ oder ‚Stab‘ gemeint ist, hängt von den Vokalen ab, die ursprünglich in der Konsonantenschrift des alten Hebräischen nicht auftauchten. Erst im 9. Jahrhundert n. Chr. fügten die sogenannten Masoreten Zeichen für die Vokale hinzu, um Irrtümer beim Lesen zu vermeiden.“
Soweit ist Ihre Argumentation richtig. Die Wörter MaTTäH = „Stab“ und MiTTaH = „Bett“ unterscheiden sich tatsächlich nur durch ihre Vokale, so dass aus dem Stab, über den sich Jakob während des Gebetes in Gegenwart seines Sohnes Josef beugte, erst durch die falsche Vokalisierung der Masoreten versehentlich ein Bett wurde. Betrachtet man von dieser Voraussetzung her nochmals die in 1. Mose 47,29-31 beschriebene Begegnung Israels mit Josef, so stellt man fest, dass in der ganzen Szene kein Bett erwähnt wird. Dazu passt auch, dass es erst im folgenden Vers 1. Mose 48,1 von Jakob heißt, dass er krank ist.
Dass in 1. Mose 47,31 ursprünglich „Stab“ und nicht „Bett“ gemeint war, bestätigt auch die griechische Übersetzung der Septuaginta, denn sie hat den Text: „er neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes“. Und es ist genau diese Übersetzung, die wiederum im Brief an die Hebräer übernommen worden ist. Sie haben sogar Recht mit Ihrem Satz: „Beim Brief an die Hebräer kann eindeutig nur der Stab gemeint sein. Die Doppeldeutigkeit gibt es hier nicht.“
Trotzdem ist Ihre abschließende Schlussfolgerung, die Sie darauf aufbauen, ein eindeutiger Irrtum:
„Damit ergibt sich eine klare Antwort auf die Frage: ‚Wo also starb Israel?‘: Stehend, auf seinen Stock gestützt, das Haupt geneigt.“
Denn, wie gesagt, auch wenn sich Jakob/Israel (1. Mose 47,31) im Gebet eindeutig auf seinen Stab gestützt hat, gestorben ist er erst einige Zeit später (1. Mose 49,33), und zwar im Bett!
↑ Hieß Jesu Mutter Maria und was bedeutet die Jungfrauengeburt?
Zu (S. 246) J wie Jungfrau betonen Sie, dass „im christlichen Glauben katholischer wie evangelischer Prägung das Wunder der jungfräulichen Geburt Jesu“ von „zentraler Bedeutung ist“. Um zu zeigen, dass das auch für die evangelische Kirche gilt (S. 248), zitieren Sie den großen Theologen Karl Barth (121), der allerdings mit seiner Auffassung, dass „zum wirklichen christlichen Glauben auch die Bejahung der Lehre von der Jungfrauengeburt“ gehört, nicht unbedingt repräsentativ für die mehrheitliche Überzeugung sowohl der Gemeindeglieder als auch der Pfarrerschaft der evangelischen Kirche ist.
Und sogar Barth selbst schreibt auf der von Ihnen zitierten Seite der „Kirchlichen Dogmatik“ auch den Satz:
„Es ist gewiß nicht ausgeschlossen, daß jemand auch ohne Bejahung der Lehre von der Jungfrauengeburt das Geheimnis der Person Jesus Christus erkennen und also wirklich christlich glauben kann.“
Karl Barth (122) sieht das Dogma von der Jungfrauengeburt also tatsächlich als zweitrangige Lehre an, die allerdings in seinen Augen die wichtige Aufgabe hat, „das Geheimnis der Offenbarung“ zu bezeichnen, nämlich
„daß Gott am Anfang steht, wo wirkliche Offenbarung stattfinde, Gott und nicht die willkürliche Klugheit, Tüchtigkeit oder Frömmigkeit eines Menschen.“
Aber was sagt eigentlich das Neue Testament über Maria, die Mutter Jesu? Mit Recht stellen Sie fest: Paulus als „der früheste Zeuge … nennt weder Maria noch Josef als Eltern Jesu.“
Aber wenn Sie schreiben:
„Evangelist Markus erwähnt Jesu Mutter nur am Rande, ohne ihren Namen zu nennen. Jesus behandelt sie aus heutiger Sicht eher geringschätzig [Markus 3,31-35]“
– dann irren Sie. Nicht mit der geringschätzigen Behandlung – es ist wahr, dass Jesus diejenigen, die Gottes Willen tun und ihm nachfolgen, als seine eigentliche Familie bezeichnet. Aber in Markus 6,3 erwähnt der Evangelist Maria sogar in einer besonderen Art und Weise, nämlich indem er Jesus ho hyios tēs Marias = „Marias Sohn“ nennt. In der Antike war das ein Indiz dafür, dass seine Geburt als unehelich beurteilt wurde.
Vollkommen falsch ist Ihre folgende Behauptung (S. 248):
„Maria als Name taucht in der Form Mirjam gelegentlich bei Matthäus und bei Lukas auf. Die entsprechenden Verse sind bei Matthäus vielleicht, bei Lukas aber mit großer Wahrscheinlichkeit erst später eingefügt worden.“
Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Der hebräische Name Mirjam kommt nirgends im Neuen Testament in dieser Form vor (obwohl natürlich die reale Mutter Jesu genau wie ihr Sohn mit einem aramäischen Namen angesprochen worden ist, aber im griechischen Neuen Testament sind nur die griechischen Übersetzungen bzw. Umschreibungen – wie kephas für Petrus – überliefert). Sowohl Matthäus als auch Lukas erwähnen Maria in der griechischen Form Maria im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, Matthäus fünf Mal, Lukas sogar zwölf Mal. Maria ist gerade bei Lukas so eng mit der gesamten Erzählung verwoben, dass eine spätere Einfügung ihres Namens vollkommen ausgeschlossen ist.
Richtig ist wieder, dass der Evangelist Johannes zwar die Mutter Jesu erwähnt, aber nicht ihren Namen. Ob allerdings Johannes 19,25 tatsächlich ein Indiz dafür sein kann, dass ihr Name nicht Maria war, weil dort ihre Schwester Maria genannt wird, bezweifle ich doch stark. Erstens weil eben alle anderen Evangelisten ihren Namen als Maria bezeugen. Zweitens könnten die Schwestern auch Halbschwestern aus verschiedenen Ehen gewesen sein. Oder war drittens an dieser Stelle vielleicht sogar von insgesamt vier Frauen die Rede, wenn nämlich die Schwester der Mutter und die Ehefrau des Klopas mit Namen Maria zwei unterschiedliche Personen waren? Dann muss die Schwester der Mutter Jesu doch nicht Maria geheißen haben.
Ihre Vermutung (S. 249), der Name der Maria könnte auf die Prozedur des Erinnerungsspeisopfers von 4. Mose 5,12-31 zurückzuführen sein, mit der Josef ihre mögliche Schuld hätte ans Licht bringen wollen, ist aus vielen Gründen abwegig.
- Wir wissen über die Umstände von Jesu Geburt sowieso nichts historisch Sicheres.
- Auf der Erzählebene der Geschichte unternimmt Josef eben gerade keine rechtlichen Schritte gegen Mariam, sondern zunächst gedenkt er (Matthäus 1,19), „sie heimlich zu verlassen“, wird dann aber durch einen geschickten Engel Gottes überzeugt (Matthäus 1,20-24), das Kind als Kind „von dem Heiligen Geist“ zu akzeptieren und „seine Frau zu sich“ zu nehmen.
- Das „bittere, fluchbringende Wasser“ von 4. Mose 5,18 heißt wörtlich MeJ HaMMaRIM, was nur sehr entfernt an den Namen Mirjam erinnert.
- Das „Buch von der Geburt der seligen Maria und der Kindheit des Erlösers“, in der die Treue-Probe auftaucht, ist als spätes apokryphes Werk von keinerlei historischem Wert, und es ist kaum anzunehmen, dass man vorher, ohne eine solche Geschichte zu erzählen, einen derart ehrenrührigen Namen erfunden hätte.
- Schließlich kannte man den Namen Mirjam (= Maria in griechischer Übersetzung) als den Namen der Schwester von Mose und Aaron bereits aus dem Alten Testament, und er war in der Zeit Jesu der häufigste Frauenname überhaupt.
Noch einen weiteren biblischen Textzusammenhang betrachten Sie in diesem Zusammenhang kritisch (S. 250), nämlich dass mit der Geburt Jesus angeblich eine Prophezeiung des Propheten Jesaja erfüllt werde (Matthäus 1,23):
„Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben.“
Sie beklagen nun, dass der alttestamentliche „Text, auf den sich Matthäus bezieht, … alle Jahre wieder in weihnachtlichen Gottesdiensten zitiert“ wird, jedoch leider „völlig aus dem Zusammenhang gerissen!“ (123) In Wirklichkeit bezieht sich das Prophetenwort des Jesaja gar nicht auf eine ferne Zukunft und schon gar nicht auf den von einer Jungfrau geborenen Messias, sondern auf ein Kind, das schon in kurzer Zeit zur Welt kommen wird.
Sie haben damit Recht, und doch zeichnet der Evangelist Matthäus die Erzählung vom Messias Jesus in die Prophezeiung dieses Immanuel = „Gott mit uns“ hinein, so wie viele jüdische Ausleger der Bibel alte Prophezeiungen später auch noch einmal auf eine andere Weise lasen, als sie ursprünglich gemeint waren. Worauf es dem Jesaja wirklich ankam, dass eine Machtpolitik wie die von König Ahas scheitern muss, aber die Welt dennoch nicht in Blut und Tränen untergehen muss, das erfüllt sich erst in einem König, der den Namen „Immanuel“ = „Gott mit uns“ mit vollem Recht trägt.
Ihrem Fazit (S. 251) kann ich insofern zustimmen, als die „Evangelien nach Matthäus und Lukas … um das Jahr 90 n. Chr. verfaßt“ wurden.
„Die Texte stammen nicht von Augenzeugen, ja nicht einmal von Zeitgenossen Jesu. Sie wurden von Mitgliedern der jungen christlichen Gemeinde verfaßt, die davon überzeugt waren, daß Jesus der Messias war. Die Autoren versuchten erst gar nicht, eine historische Biographie zu verfassen. Ihr Ziel war es, ihren Glauben zu begründen. So wurde aus einer jungen Frau, deren Namen wir nicht sicher kennen, Maria, die als Jungfrau gebar.“
Aus welchen Gründen die „jungfräuliche Geburt“ erzählt wurde, ist umstritten, ihre Deutung ebenfalls. Sie beschreiben ausführlich, wie die Geschichte der Maria im Lauf der Kirchengeschichte immer weiter ausgeschmückt wurde und welche Karriere Maria im Dogma der katholischen Kirche machte.
Im Anschluss an die amerikanische Theologin Jane Schaberg kann man die Jungfrauengeburt Jesu allerdings auch ganz anders interpretieren. Man mag sich sogar die Frage stellen: „War Maria ein missbrauchtes Mädchen?“ und kann Maria als eine biblische Gestalt verstehen, mit der sich Frauen und Mädchen identifizieren können, die sexuelle Gewalt erlitten haben (ohne damit historisch etwas über die reale Mutter Jesu beweisen zu wollen).
↑ Wurde ein revolutionärer Satz Jesu falsch übersetzt?
Zu (S. 254) K wie Kaiser interpretieren Sie das Wort Jesu (Markus 12,17; Matthäus 22,21; Lukas 20,25): „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ im Sinne einer revolutionären Zurückweisung der gotteslästerlichen kaiserlichen Münze (S. 256), „da sie gegen das strikte Bilderverbot verstieß.“ Denn das Wort apodidōmi heißt wörtlich „zurückgeben“, und Jesu Ausspruch bedeutet nach dem jüdischen Theologen Pinchas Lapide (124) also eindeutig:
„Gebt dem Kaiser doch sein sündiges Geld zurück und benützt es nicht, wie ich es euch eben demonstriert habe, auf daß ihr Gott geben könnt, was Gottes ist, nämlich die Anerkennung Seiner Alleinherrschaft über die ganze Schöpfung ohne Heidentyrannei und ohne Götzendienst.“
Ihre Ansicht nach forderte
„Jesus … also nicht, man möge sowohl dem Kaiser als auch Gott dienen. Für Jesus schloß das eine das andere aus. Wer gottgefällig leben wollte, der mußte dem Kaiser sein sündiges Geld zurückgeben. Luthers Lehre von den zwei Reichen läßt sich nicht mehr begründen, wenn man das brisante Wort Jesu richtig übersetzt.“
Ganz so eindeutig ist aber apodidōmi nun doch nicht mit „zurückgeben“ zu übersetzen. In der griechischen Septuaginta bittet Jakob seinen Bruder Esau mit diesem Wort (1. Mose 25,31), ihm sein Erstgeburtsrecht zu „verkaufen“. Später bittet Jakob seinen Schwiegervater Laban (1. Mose 29,21), ihm seine Frau zu „geben“. Lukas benutzt in Apostelgeschichte 7,9 das Wort apodidōmi für den „Verkauf“ Josefs nach Ägypten. In allen drei Fällen ging es nicht um eine „Rückgabe“. Paulus verwendet das Wort in Römer 13,7 sogar eindeutig für die legitime Zahlung der Steuer:
„So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.“
Insofern kann man den Worten von Pinchas Lapide (125) doch nicht uneingeschränkt zustimmen:
„Die jesuanischen Worte damals in Jerusalem waren für die Römer unanfechtbar – für die Juden aber ein deutliches Fanal zum Aufbruch. Für deutsche Bibelleser bleiben sie leider bis auf den heutigen Tag sinnentstellend falsch übersetzt.“
Ich bestreite nicht, dass Jesus in gewisser Weise ein Revolutionär war. Tatsächlich (S. 257) legt „Jesu Kreuzestod“ den Schluss nahe: „Jesus wurde von den Römern als Aufständischer hingerichtet, der die römische Autorität nicht anerkannte.“ Aber nicht zu beweisen ist, dass Jesus ein Zelot war, der im gewaltsamen Aufstand über Leichen gegangen wäre, um eine zudem eher zweifelhafte Chance auf einen Sieg gegen die Weltordnung der Römer auszunutzen. Klüger und menschenfreundlicher war Jesus insofern, als er kreative gewaltfreie Widerstandsformen inszenierte (Matthäus 5,40-41) und davon ausging, dass letztlich nur die Liebe, die auch dem Gegner, sogar dem Feind, Gutes tut, nachhaltigen Erfolg verspricht (Matthäus 5,43-48). Es war nicht seine Sache, mit schmutzigen Mitteln die hehren eigenen Ziele zu verraten.
Richtig ist allerdings, dass das spätere Verhältnis der Kirche zur staatlichen Macht oft reichlich unkritisch ausfiel. Aber die „vermeintlich biblische Begründung, man müsse ja der weltlichen Macht gehorchen“, war nicht unbedingt insofern „vermeintlich“, als man apodidōmi falsch übersetzt hätte. In Ländern, wo staatliche Institutionen zeitweise völlig ihrer Macht beraubt waren wie auf dem Balkan nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens oder im Irak oder in Libyen nach ausländischen Interventionen, hat sich deutlich gezeigt, welche wichtige Funktion auch ein diktatorischer Staat ausüben kann. Es mag sein, dass vor allem Paulus in Römer 13 auf eine solche Wahrheit hinweist. Allerdings gibt es genug andere biblische Zusammenhänge, von den Propheten bis zur Offenbarung des Johannes, mit denen man eine Kritik an missbräuchlicher staatlicher Machtausübung tatsächlich fundiert begründen kann.
↑ Ein Seil geht (nicht) durchs Nadelöhr – oder vielleicht doch?
Zum Stichwort (S. 258) K wie Kamel erklären Sie richtig, dass sich in das Wort Jesu (Markus 10,25; Matthäus 19,24; Lukas 18,25):
„Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes komme“
ein Übersetzungsfehler aus dem Aramäischen eingeschlichen hat. Zwar ist Ihre Annahme, dass ein ursprünglicher aramäischer Text des Neuen Testaments erhalten sei, nicht nachweisbar, aber trotzdem liegt es nahe, dass das aramäische Wort gamala, das „verschiedene Bedeutungen haben“ kann, hier nicht mit „Kamel“ oder „Balken“, sondern mit „Seil“ übersetzt werden sollte:
„Es ist leichter, daß ein Seil durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes komme.“
Nun fragen Sie sich in diesem Zusammenhang, ob Jesus „ein Kommunist gewesen sein“ könnte, der „die himmlische Seligkeit jedem Reichen verwehrt“ und (S. 259) „nur Armen ein glückliches Leben nach dem Tode gönnte“. Dass Jesus seinen Satz nicht so gemeint haben kann, weil er „seine Aussage sogleich wieder“ widerrief (Markus 10,27; Matthäus 19,26; Lukas 18,27):
„Bei den Menschen ist‘s unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich“
interpretieren Sie als einen Widerspruch im Denken Jesu:
„Erst heißt es: Genausowenig wie ein Seil durch ein Nadelöhr paßt, kommt ein Reicher in den Himmel. Und dann: Aber bei Gott ist alles möglich, also kann ein Reicher doch ins Paradies eingehen. Jesus widerspricht sich also innerhalb weniger Sätze.“
Es könnte aber auch sein, dass Suie beide Sätze und ihren Zusammenhang missverstanden haben. Für Jesus ist Reichtum ein schwerwiegendes Hindernis, um ein erfülltes Leben im Sinne der Liebe, der Gerechtigkeit, der Befreiung aller Menschen zu führen. Es ist ein Wunder Gottes notwendig, um das zu ermöglichen.
↑ Kindermord von Bethlehem – in welche Welt wird Jesus hineingeboren?
Zu (S. 259) K wie Kindermord führen Sie gute Gründe dafür an, dass es den „legendären Kindermord von Bethlehem“ durch Herodes den Großen (Matthäus 2,13-21) „nicht gegeben hat“. Allerdings (S. 260) konstatieren auch Sie, dass
„Herodes tatsächlich sehr grausam war. Kaiser Augustus soll über Herodes gesagt haben: ‚Lieber ein Schwein des Herodes als sein Sohn!‘ Auch dieses Zitat ist umstritten, basiert es doch auf einem Wortspiel im Griechischen: ‚Lieber ein Hys (Schwein) des Herodes als sein Hyios (Sohn).‘ Und warum sollte der römische Kaiser Augustus, der doch Lateinisch sprach, eine Äußerung getan haben, die nur im Griechischen als Wortspiel zu erkennen ist?“
Umstritten kann dieses Zitat nur bei denjenigen sein, die nicht wissen, dass Griechisch im Römischen Reich nicht nur die Weltsprache der Gebildeten war, sondern auch offizielle Amtssprache neben dem Lateinischen.
Auf jeden Fall gab es genug Gründe, um „Herodes das Verbrechen von Bethlehem“ anzudichten, seien es „in der engsten Familie des Herodes“ auftretende „Verschwörungen gegen ihn“, auf die er „mit brutaler, blutiger Gewalt“ reagierte, oder sei es die Gleichsetzung von „Jesus und Mose“:
„Zur Zeit Jesu erwarteten die gläubigen Juden einen Messias, der sie vom Joch der verhaßten Römer befreien würde. So wie angeblich einst Mose das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft führte, so sollte der neue Messias die Kinder Israels von der Unterdrückung durch die Römer erlösen. Da lag es nahe, Jesus und Mose gleichzusetzen. Mose wurde der fiktiven Überlieferung nach schon nach dem Leben getrachtet, als er noch ein Kleinkind war. Auf Befehl des ägyptischen Herrschers sollten alle neugeborenen Knaben der Hebräer getötet werden [2. Mose 1,15-17].“
Auch wenn also die Geschichte vom Kindermord nach Motiven aus dem Alten Testament erfunden wurde, erzählt sie dennoch die Wahrheit über Jesus, der als Sohn Gottes in eine grausame Welt hineingeboren wird. Wie sich die biblische Botschaft der damit gegebenen Herausforderung stellt, habe ich in meinem Gottesdienst „Weihnachtsfreude für Bethlehems Kinder?“ zu beantworten versucht.
Weiterhin schreiben Sie zu Recht (S. 261), dass auch die Flucht Josefs mit seiner Familie nach Ägypten „nach einer Vorlage aus dem ‚Alten Testament‘ formuliert“ wurde:
„Beim Propheten Hosea heißt es nämlich [Hosea 11,1]: ‚Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten.‘ Deshalb mußte die Flucht nach Ägypten erfolgen: um einen Text, der eigentlich gar nicht als Prophetie gedacht war, im nachhinein doch als solche zu bestätigen.“
Hier benennen Sie wohl auch eine der prophetischen Vorlagen, nach der bereits im Alten Testament die Geschichte vom Auszug der Kinder Israel aus Ägypten gestaltet wurde.
Und Sie stellen mit Recht klar und deutlich heraus (S. 262):
„Nicht um eine wahrheitsgetreue Biographie ging es dem Verfasser des Evangeliums, sondern um eine Bestätigung seines Glaubens. Er sah Jesus als den Messias an, der schon als Baby durch ein Wunder dem sicheren Tod entgeht.
Den Autoren ging es nicht um historisch belegbare Biographie. Sie faßten ihren Glauben an das Wundersame in Worte. Sie ersannen Geschichten, die für sie ‚wahr‘ waren, weil sie ihren Glauben greifbar machten.“
↑ Lanzenstich – Widerlegung oder Beweis für den Scheintod Jesu?
Zu (S. 264) L wie Longinus kommen Sie (S. 265) auf den erst in der späteren apokryphen Literatur so benannten und zunächst „namenlosen ‚Soldaten‘“ zu sprechen, der den am Kreuz hängenden Jesus mit einem Speer durchbohrt, um das Prophetenwort Sacharja 12,10 zu erfüllen (Johannes 19,34):
„‚Einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus.‘ Diskret wird verschwiegen, daß es sich bei dem Mann nur um einen römischen Soldaten gehandelt haben kann. Die Autoren der frühen Evangelien-Texte waren sehr darauf bedacht, nicht den Groll der römischen Obrigkeit auf sich zu lenken. Jede Schuld von Römern am Tod Jesu wurde möglichst intensiv bestritten.“
Grundsätzlich stimmt es, dass die Evangelien die Verantwortung für den Tod Jesu mehr auf die jüdische Führungsschicht als auf die Römer verlagern (bei Johannes werfen die jüdischen Oberpriester sogar Pilatus vor, er würde gegen den Kaiser handeln, wenn er Jesus nicht verurteilte). Aber nicht zu erwähnen, dass der Soldat ein römischer war, ist keine diskretes Verschweigen; was für ein Soldat sollte es denn sonst gewesen sein? Die Römer wussten doch, dass keine anderen Soldaten im Land waren als ihre eigenen Besatzungssoldaten.
Sie schreiben weiter:
„Das doch sehr drastische, blutige Detail wird nur von Johannes, sonst aber von keinem anderen der übrigen Evangelisten erwähnt. Das spricht gegen die Historizität des Lanzenstichs. Zu vermuten ist: Der Verfasser des Evangeliums nach Johannes hat seine Beschreibung so verfaßt, daß die ‚Prophetenworte‘ in Erfüllung gingen. … Vor allem hatte die Einführung des Soldaten auch rein praktische Gründe. So sollte von vornherein sichergestellt werden, daß Jesus auch wirklich am Kreuz gestorben war und nicht scheintot überlebt hatte.“
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Johannes Fried (126) diesen Lanzenstich gerade umgekehrt als historischen Beweis dafür wertet, dass Jesus nur einen Scheintod erlitt und seine Kreuzigung überlebte (127). Aber das nur nebenbei; es gibt wohl kaum ernstzunehmende Wissenschaftler, die ihm beipflichten.
↑ Wurde das Wort „Maranatha“ wirklich falsch übersetzt?
Zum Stichwort (S. 266) M wie Maranatha gehen Sie auf ein aramäisches Wort ein, das in der Offenbarung des Johannes 22,20 mit erchou kyrie = „komm, Herr“ übersetzt wird, während es der Apostel Paulus am Ende eines seiner Briefe unübersetzt stehen lässt (1. Korinther 16,22). Vermutlich kennt Paulus das Wort als Ausdruck judenchristlicher Verehrung Jesu und will so seine Verbundenheit mit den judäischen Gemeinden ausdrücken.
Nun behaupten Sie: „Die Übersetzung von ‚Maranatha‘ ist aber alles andere als eindeutig“, denn es gab verschiedene Möglichkeiten, dieses Wort auszusprechen: „Maran-atha“, „Marana-tha“ oder „Mar-antha“. Im ersten Fall lautet die Übersetzung: „Unser Herr ist (in der Vergangenheit) gekommen“ oder „Unser Herr ist das Zeichen!“ Nur im zweiten Fall wäre die „Befehlsform“ der Offenbarung richtig (S. 266f.): „Herr, komm!“ Die dritte Form wäre mit „Ein Herr bist du!“ zu übersetzen. Wegen dieser Unklarheiten fragen Sie sich (S. 267):
„Hat man deshalb im ersten Brief an die Korinther das ‚Maranatha‘ im Aramäischen stehen lassen und nicht übersetzt, weil schon der griechisch schreibende unbekannte Autor der biblischen Apokalypse nicht mehr so recht wußte, was denn nun gemeint war? Und war vielleicht Luther etwas voreilig?“
Diese Fragen sind unsinnig formuliert – besonders das „schon“. Warum sollte Paulus das Wort nicht übersetzt haben, weil fünfzig Jahre später in der Apokalypse das Wort in einer bestimmten Weise übersetzt wurde, die Luther auch richtig ins Deutsche übersetzt? Oder denken Sie, die Apokalypse (= Offenbarung des Johannes) sei vor den Paulusbriefen geschrieben worden?
Aber worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Sie meinen:
„Es geht um die wahrscheinlich wichtigste Frage nicht nur des ‚Neuen Testaments‘, sondern der Bibel überhaupt. Denn schon die Verfasser der Schriften des ‚Alten Testaments‘ glaubten an einen Erlöser-Messias.
Die Sehnsucht nach eben diesem Messias bestimmte auch das Denken vieler Zeitgenossen Jesu. Und dieses wirklich zentrale Thema kommt in diesem kurzen Wortgebilde zum Ausdruck!
Heißt nun ‚Maranatha‘, ‚der Herr (‚Messias‘) ist (in der Vergangenheit bereits) da gewesen?‘ Müssen, ja können wir gar nicht mehr auf ihn warten? Oder gilt vielmehr: ‚Der Messias ist (eben) gekommen?‘ Ist damit Jesus gemeint? Oder heißt es: ‚Messias, komm doch!‘ Steht die Ankunft also noch bevor?“ (128)
So dramatisch sich Ihre Schilderung anhört – hier beschäftigen Sie sich mit einem Scheinproblem. Natürlich waren die Christen der festen Überzeugung, dass Jesus als Messias bereits gekommen war – natürlich meinten die nichtchristlichen Juden das Gegenteil. Aber das Wort „Maranatha“ hieß für die Christen trotzdem: „Jesus, komm doch!“, weil sie seine baldige Wiederkunft erhofften und erwarteten. Insofern gibt es hier überhaupt keinen Übersetzungskonflikt.
Recht haben Sie trotzdem mit Ihrer Aussage (S. 268): „Es ist an der Zeit, daß wir uns vom Glauben an die richtige Übersetzung verabschieden.“ Aber Ihr Wunsch (S. 267f.), in Bibelübersetzungen „bei Problembegriffen wie ‚Maranatha‘ zumindest in einer Fußnote auf abweichende Übersetzungsmöglichkeiten hinzuweisen“, wird sich kaum umfassend in die Tat umsetzen lassen, da dann die Bibel ein Mehrfaches ihres Umfangs erreichen würden. Wie viele verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten es für jede Bibelstelle gibt, ist doch schon an der Vielzahl der unterschiedlichen Übersetzungen zu erkennen.
↑ Der Mensch Jesus Christus wusste nicht, wann er wiederkommt
Zu (S. 268) M wie Messias stellen Sie zutreffend dar, wie sich in Israel „der Wunsch nach einem ‚Gesalbten‘“, also einem Messiaskönig, der „als Vorbote himmlischer Gerechtigkeit … das Ende der Zeiten einleiten“ würde, im Lauf der Zeit änderte, und wie (S. 269) schließlich im 1. Jahrhundert „Jesus für viele Zeitgenossen zum Hoffnungsträger wurde“, der seine eigene Wiederkunft gemäß den „Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas“ bereits für „die Generation der Zuhörer“ ankündigt.
Mich wundert ein Widerspruch in Ihren Ausführungen: Hier wissen Sie, dass Jesus, obwohl er bereits als Messias gekommen ist („Jesus Christus“ = „Jesus Messias“), bald wieder zurück erwartet wird. Im Abschnitt zu M wie Maranatha unmittelbar zuvor taten Sie so, als bestünde ein Widerspruch zwischen dem Kommen des Messias Jesus und der Frage, ob seine Ankunft noch bevorstünde.
Im Blick auf den Zeitpunkt seiner Wiederkunft haben sich Jesus und die frühen Christen tatsächlich geirrt. Allerdings werden von Jesus im Zusammenhang der Ankündigung seiner baldigen Wiederkehr auch diese Worte überliefert (Markus 13,30-32):
„Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.“
Insofern wussten die ersten Christen von der menschlichen Irrtumsfähigkeit auch ihres Herrn Jesus Christus.
↑ Jesus kann durchaus in dem Nest „Nazareth“ aufgewachsen sein
Zum Thema (S. 270) N wie Nazareth stellen Sie zunächst zum „Vornamen“ Jesu fest (S. 271), dass der „Jude Jesus … mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von seiner Mutter Jeschua und garantiert nicht Jesus gerufen“ wurde. Allerdings ist der griechische Name Iēsous bereits in der Septuaginta die Übersetzung alttestamentlicher Namen wie JeHOSchuAˁ = „Josua“ oder JeSchUAˁ = „Jeschua“ mit der Bedeutung „JHWH hilft“.
Zum „Nachnamen“ Jesu behaupten Sie:
„Der Sachverhalt scheint klar zu sein: Er hatte den beigefügten Namen ‚von Nazareth‘, weil er aus Nazareth stammte. Auch diese Annahme ist ein Irrtum, der allerdings fest verwurzelt ist im ‚Neuen Testament‘!“
Richtig stellen Sie fest, dass der Ausdruck Nazōraios im Johannesevangelium vorkommt (18,5.7 und 19,19). Da ist tatsächlich (S. 272) wörtlich von „Jesus dem Nazoräer“ die Rede, genau wie übrigens auch in den Evangelien nach Matthäus 2,23 bzw. 26,71 und Lukas 18,37. Möglich ist es tatsächlich (129), dass „der Ausdruck ‚der Nazoräer‘ erst nachträglich mit einer Ortsbezeichnung ‚Nazareth‘ in Verbindung gebracht wurde.“ Nicht ausgeschlossen ist aber auch die Möglichkeit, dass es einen Ort Nazareth gegeben hat, zumal dieser Ort in verschiedenen griechischen Schreibweisen „Nazareth“, „Nazaret“ bzw. „Nazara“ in allen vier Evangelien vorkommt (Markus und Johannes haben nur „Nazaret“, Lukas „Nazareth“ und „Nazara“, Matthäus alle drei Schreibweisen).
Allerdings erwähnt, wie Sie sagen, im Zusammenhang mit der Taufe Jesu nur Markus (Markus 1,9), dass er „von Nazareth in Galiläa“ kommt:
„Dieses wichtige Ereignis aus dem Leben Jesu wird auch im Evangelium nach Matthäus beschrieben. Der Evangelist spricht freilich [Matthäus 3,13] lediglich von ‚Jesus aus Galiläa‘, einen Ort namens ‚Nazareth‘ nennt er nicht. Lukas [3,21] und Johannes [1,29] begnügen sich beide mit dem Vornamen Jesus und verzichten auf einen Beinamen.“
Das ist zwar jeweils für diese Taufszene richtig, aber an anderen Stellen nennen auch die drei anderen Evangelisten durchaus Nazareth als Ort, wo Jesus aufgewachsen ist.
Und das wissen Sie auch zumindest für Matthäus 2,23, denn zum Thema K wie Kindermord hatten Sie die Frage gestellt (S. 262): „Warum ließ … der Bibelautor Josef seine Familie nach Nazareth in Galiläa bringen?“ Und in Matthäus 4,13 ist ausdrücklich von der Übersiedlung Jesu aus seinem Herkunftsort Nazareth in seinen neuen Wohnort Kapernaum die Rede.
Lukas wiederum erwähnt schon in seinen Geburtslegenden mehrfach den Wohnort Nazareth der Familie Jesu und sagt in 4,16 ausdrücklich: „er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war“. Weiter unten (S. 273) werden Sie diese Stelle selber zitieren.
Und Johannes erwähnt Nazareth zwar nicht in 1,29, wohl aber gleich zwei Mal in 1,45f., wo Philippus ihn „Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth“ nennt, worauf Nathanael antwortet: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen!“
Weiterhin argumentieren Sie (S. 272):
„Wie wurde aus Jeschua Jesus von Nazareth? Überprüfen wir weiter das ‚Neue Testament‘! Es heißt in diversen Übersetzungen korrekt dem griechischen Original entsprechend im Evangelium nach Markus [3,20]: ‚Und er (Jesus) kam nach Hause, und da kam abermals das Volk zusammen.‘ Sowohl in der katholischen ‚Jerusalemer-Bibel‘ (Freiburg 1969) als in der evangelischen ‚Senfkornbibel‘ (Frankfurt 1971) wurde in Zwischenüberschriften klammheimlich Nazareth eingefügt. Damit kam eine klare Ortsangabe in Bibelausgaben, die im Originaltext nicht zu finden ist.“
Die beiden von Ihnen genannten Bibelübersetzungen kenne ich nicht. Wenn dort an dieser Stelle „Nazareth“ eingefügt wurde, dann ist das falsch. Denn wenn die Wendung in Markus 3,20 „er kam in ein Haus“ die Bedeutung haben sollte „er kam nach Hause“, dann bezieht sich das nicht auf Nazareth, sondern auf Kapernaum, wo er sich als Prediger und Heiler offenbar häufig in einem bestimmten Haus aufhielt (Markus 1,21; 2,1; 9,33).
Warum aber sollte „das eindeutige Bestreben des ‚Neuen Testaments‘“ darauf gerichtet sein, „Jeschua und Nazareth miteinander in Verbindung zu bringen“, wenn es den Ort Nazareth, wie Sie annehmen, überhaupt nicht gab? Die von Ihnen angeführten Stellen Matthäus 21,11, Markus 10,47 und 16,6 sowie Lukas 4,16 belegen doch eher, dass die Existenz eines solchen Ortes vielleicht doch wahrscheinlicher ist, als Sie denken.
Wikipedia geht jedenfalls von der Existenz eines wenn auch unbedeutenden kleinen Nestes namens Nazareth aus:
„Nazareth war damals ein unbedeutendes Dorf von höchstens 400 Einwohnern, wie archäologische Gebäude- und Geschirrfunde belegen. Es kommt im Tanach nicht vor. Diese Bedeutungslosigkeit spiegeln überlieferte Einwände gegen Jesu Messianität (Joh 1,45; Joh 7,41).“
Sie versuchen allerdings unter Berufung auf Schalom Ben-Chorin (130) nachzuweisen, dass „Jesus … ein Heimatort Nazareth angedichtet [wurde], um nachträglich eine Prophezeiung aus dem ‚Alten Testament‘ in Erfüllung gehen zu lassen.“ Und zwar soll sich die Prophezeiung (Matthäus 2,23) „Er soll Nazoräer heißen“ (131) „auf den Propheten Jesaja“ beziehen (Jesaja 11,1-2):
„‚Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.‘
Mit Reis ist ein Zweig oder ein Sprößling gemeint, im übertragenen Sinne ein Nachkomme aus dem Stamm Isais. Isai war der Vater von König David. Aus seiner Nachkommenschaft sollte der Messias als Sprößling oder Reis hervorgehen. Zweig oder Sprößling heißt auf hebräisch ‚nezer‘. Jesus bekam demnach den ‚Wohnort‘ Nazareth verpaßt, damit er das Prophetenwort vom ‚nezer‘ erfüllt.“
Bei einer solch „dünnen“ Übereinstimmung von Nazōraios und NeTsäR kann es aber auch umgekehrt sein: Matthäus suchte eine Bestätigung für den Wohnort Jesu, der ihm bekannt war, in Voraussagen des AT und fand ihn im Wort „nezer“.
↑ Kam Ostern von Ostara und der Osterhase vom Klippdachs?
Zum Stichwort (S. 274) O wie Ostern gehen Sie zunächst (S. 275) darauf ein, dass man in der Urchristenheit „zunächst mehr des Kreuzestodes Jesu und nicht, wie heute, seiner Auferstehung“ gedachte und lange Zeit um „den genauen Zeitpunkt von Ostern stritt“, bis man sich „im Jahr 325 n. Chr. auf dem Konzil von Nizäa auf den heute noch gültigen Termin“ einigte.
Dann behaupten Sie, dass der „Ursprung“ von Ostern „alles andere als christlich“ sei:
„Ostern hatte zwei heidnische Vorläufer: ein germanisches Frühlingsfest und die Feierlichkeiten zu Ehren der Göttin Ostara. Auf sie geht auch der Name Ostern zurück. Über die nordische Gottheit Ostara gelingt aber wiederum der Brückenschlag, so erstaunlich das klingen mag, zur Bibel: Die Frühlingsgöttin entspricht der biblischen Astarte.“
Diese Rückschlüsse sind allerdings inzwischen sehr umstritten, wie man in Wikipedia zu den Stichworten „Wie Ostern zu seinem Namen kam“ und Ostara nachlesen kann. Und selbst wenn das Osterfest an die Stelle von heidnischen Vorläuferfesten getreten sein sollte, so hat es inhaltlich doch von der Bibel her einen völlig anderen Sinn erhalten.
Über die Identität von Ostara und Astarte wollen Sie das angeblich heidnische Osterfest auch mit König Salomo in Verbindung bringen, der die Astarte verehrte (1. Könige 11,5.33 und 23,13), wofür er sich allerdings „den Zorn Gottes“ zuzog. Und weil Astarte „eine Tochter von Ascherah und El“ war, „der im ‚Alten Testament‘ häufig mit Jahwe gleichgesetzt wird“, legen Sie nahe, dass der Eine jüdische Gott zur gleichen Götterfamilie wie die heidnische Göttin Ostara gehört. Allerdings wird El nicht etwa mit JHWH gleichgesetzt, sondern El ist der allgemeine hebräische Begriff für „Gott“, während JHWH der konkrete Name des Gottes Israels ist.
Mehrfach habe ich allerdings schon darauf hingewiesen, dass in der Königszeit Israels und Judas vor dem babylonischen Exil der Gott Jahwe oder Jahu tatsächlich noch nicht durchgängig der eine Gott Israels war, neben dem es keinen anderen gab, sondern durchaus als Staatsgott mit seiner Göttin Aschera gemeinsam angebetet wurde. Das alles wurde aber von den späteren Propheten des Einen Gottes JHWH heftig angeprangert und hat mit dem noch viel späteren Osterfest absolut nichts zu tun.
Ihre Hinweise darauf (S. 276), dass „Astartes Name … ursprünglich, sinngemäß übersetzt, ‚die, die gebärt‘“, bedeutete und „als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt“ wurde, dass aber auch „Ostara, die Namensgeberin des Osterfestes“ (wenn das denn überhaupt stimmt) eine „Göttin der Fruchtbarkeit“ war, sollen dann einen Bezug zur sprichwörtlichen Fruchtbarkeit der Hasen herstellen:
„Wie aber kam der Osterhase zu Ostern? Darüber wurde viel spekuliert. Ist der Hase das Symboltier für Ostara geworden, weil er so besonders fruchtbar und ein wahrer Meister der Vermehrung ist? Kam deshalb der Hase zum Osterfest?
Es ist Salomo, der dafür – indirekt – die Verantwortung trägt. Die Spur läßt sich fast lückenlos verfolgen. In seinen Sprüchen erwähnt der legendäre König eine Tierart, die einem gewissen Onkelos, dem Übersetzer des hebräischen Textes ins Griechische, nicht bekannt war. Bei Salomo steht [Sprüche 30,26]: ‚Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen.‘ (132) Da nun Onkelos im 2. Jahrhundert n.Chr. den Klippdachs nicht kannte, suchte er nach einer Tierart, die ihm passend erschien. Er wählte den Hasen. Und so hieß es dann in der griechischen Fassung der Sprüche Salomos: ‚Die Hasen, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen.‘
Da Luther die griechische Fassung des ‚Alten Testaments‘ für seine Übersetzung benutzte, kam so der ‚salomonische Hase‘ auch in den deutschsprachigen Raum.“
Hier unterlaufen allerdings auch Ihnen wieder ein paar kleine Irrtümer. Erstens wissen Sie selber, dass nicht König Salomo das Buch der Sprüche verfasste, sondern dass es ihm als dem Inbegriff der Weisheit nur zugeschrieben wurde. Also nicht „der legendäre König“ erwähnt den Klippdachs, sondern ein unbekannter Sprüchedichter. Und zweitens bedeutet das griechische Wort choirogryllioi nicht „Hasen“, sondern „Kaninchen“, was dann auch Martin Luther in seine Bibelübersetzung von 1545 übernimmt.
Aber stimmen nun wenigstens Ihre Ausführungen über die urchristliche Missionspredigt? Was Sie darüber schreiben (S. 277), belegen Sie mit keinem einzigen Quellenverweis:
„So kam der Hase ins ‚Alte Testament‘, aber auch schon in die Predigten der frühen Missionare. Und er wurde nun stark mit dem christlichen Glauben des ‚Neuen Testaments‘ verknüpft. War nicht der Fels das Fundament, auf dem die Kirche Jesu gebaut werden sollte? Und als Bewohner des Felsens galt, welch absurde Vorstellung, eben der Hase! Und so wie der Hase in der falschen Bibelübersetzung als Fundament seines kleinen Tierlebens den Fels hat, so war für den missionierten Neuchristen von seiner Taufe an Jesus das Fundament des frommen Lebens.
So kam der Hase in die christliche Predigt über das ‚Neue Testament‘. Wie er aber zum Osterhasen mutierte, ist unbekannt.“ (133)
↑ Gab es Hähne in Jerusalem und wird von der Verleugnung des Petrus
folgerichtig erzählt?
Unter dem Stichwort (S. 277) P wie Petrus bezweifeln Sie, dass Jesus seinem Jünger Petrus angekündigt haben kann (Johannes 13,38): „Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnest!“
„Experten wie Schindler-Bellamy und English wenden ein: Derlei könne Jesus gar nicht gesagt haben, da es zu seinen Lebzeiten ein Verbot von Federviehhaltung in Jerusalem gab.“ (134)
Richtig daran ist (135), dass im Babylonischen Talmud (Baba Qamma) unter „Zehn Dingen“, die „von Jerusalem gelehrt“ werden, auch der Satz steht: „Man züchte da keine Hühner.“ Nun ist es allerdings mit Gesetzen oft so, dass es sie deswegen gibt, weil das Verbotene trotzdem praktiziert wurde. Und da Jerusalem zur Zeit Jesu eine Stadt war, in der ein König und Hoherpriester von Roms Gnaden herrschten und sich Soldaten der römischen Besatzung aufhielten, wird man kaum annehmen dürfen, dass ein solches religiöses Gebot strikt durchgehalten worden ist. Außerdem scheint es im Talmud auch eine Stelle zu geben, an der von der Steinigung eines Hahnes in Jerusalem die Rede ist.
Abgesehen davon ist ohnehin klar: Zu beweisen ist sowieso nicht, ob die Szenen der Voraussage der Verleugnung und die Verleugnung Jesu durch Petrus selbst historische Ereignisse sind.
Nun wollen Sie den Evangelisten Markus und Johannes aber noch einen inneren Widerspruch ihrer Verleugnungsgeschichte nachweisen (S. 278):
„Richtig ist, daß alle vier Evangelisten von einer dreifachen Verleugnung Jesu durch Petrus berichten. Allerdings krähte der Hahn nach Markus [14,68], anders als von Jesus vorhergesagt, schon nach dem ersten Verrat und nicht erst nach dem dritten. Und bei Johannes [18,27] erklingt schon nach der zweiten Verleugnung die Stimme des Hahns. …
Nach zwei der vier Evangelisten geht die präzise formulierte Prophezeiung nicht wirklich in Erfüllung.“
Hier sind Sie es wieder einmal, der sich im Blick auf beide Evangelisten im Irrtum befindet:
Nach Markus krähte der Hahn zwar nach dem ersten Verrat zum ersten Mal, aber erst nach dem dritten Mal zum zweiten Mal (Markus 14,72), wie bei Markus angekündigt.
Und bei Johannes haben Sie übersehen, dass er nicht nur in 18,25 und 26 zwei Verleugnungen des Petrus überliefert, sondern bereits in 18,17 eine erste Verleugnung gegenüber einer Sklavin.
Auch wenn also die Episode tatsächlich unhistorisch ist, sind die entsprechenden Erzählungen in sich doch folgerichtig aufgebaut.
Inhaltlich stellen alle Evangelien mit der Verleugnung des Petrus die wichtige Frage, ob man es in Todesgefahr wagt, sich zu Jesus Christus zu bekennen, und was mit denjenigen geschehen soll, die als lapsi (= „Abgefallene“) ihrem Glauben untreu geworden sind. Petrus jedenfalls erfährt nach Johannes 21,15-17 Vergebung für seine Verleugnung bzw. wird von Jesus trotzdem mit der Verantwortung für die Leitung der Gemeinde betraut.
↑ Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund
Im Blick auf (S. 278) P wie Pilatus haben Sie insofern Recht, als erstens (S. 279) die „dramatisch-packend“ erzählten „biblischen Geschehnisse um Jesus und Pilatus“ mit „der Realität im Sinne von geschichtlichen Tatsachen“ nichts zu tun haben und „Pilatus“ (S. 280) „ein grausamer Mensch [war], in dessen Amtszeit schlimme Zustände herrschten.“
Ob Pilatus für die Evangelien allerdings tatsächlich „der milde, ja fürsorgliche Menschenfreund“ war, lasse ich einmal dahingestellt sein. Immerhin war er für Juden wie erste Christen damals der Repräsentant der Römischen Weltordnung, deren Sturz sie apokalyptisch von Gott her erhofften. Völlig entlastet von der Verantwortung für die Kreuzigung Jesu werden die römischen Behörden jedenfalls nicht; spürbar muss zum Beispiel geblieben sein, wie perfide es etwa von Pilatus war, den Unterdrückten selber die Wahl zwischen Barabbas und Jesus zuzuschieben und seine eigenen Hände in Unschuld zu waschen.
Richtig ist allerdings auch, dass die Evangelien – sei es aus Selbstschutzgründen oder wegen des wachsenden Antijudaismus – die Rolle der jüdischen Autoritäten bei der Verurteilung Jesu mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Das geht offenbar bei Johannes so weit, dass er es in der Schwebe lässt, ob Pilatus vielleicht sogar die Kreuzigung selbst durch die führende Priesterschaft der Juden durchführen lässt (Johannes 19,6 und 16).
Letzten Endes können es aber auch bei Johannes nur römische Soldaten gewesen sein, die Jesus kreuzigen und um sein Gewand losen. Bei den anderen Evangelisten sind es eindeutig römische Soldaten, denen Pilatus Jesus zur Geißelung, Verspottung und Kreuzigung überantwortet. Doch auch auf der Erzählebene des Johannes behält Pilatus alle Fäden der Verantwortung im Zusammenhang mit der Kreuzigung in der Hand, sowohl was die Kreuzesinschrift betrifft (Johannes 19,19.22) als auch die Bestattung von Jesu Leichnam (Johannes 19,31.38).
↑ Qumran: Damaskus lag am Toten Meer
Zu (S. 281) Q wie Qumran gehen Sie auf die Frage ein, ob Paulus tatsächlich, wie in Apostelgeschichte 9,1-2 berichtet, „vom Hohenpriester in Jerusalem Schreiben“ bekommen haben könnte, „die ihm Autorität in Damaskus verschaffen sollten“. Sie bestreiten das unter Berufung auf Joseph Klausner (136), da König Aretas IV. Philodemos, zu dessen Hoheitsgebiet das „syrische Damaskus“ damals gehört, sich eine „Einmischung in seine souveräne Landespolitik“ sicher verbeten hätte:
„Einen Gesandten aus Israel hätte er vermutlich als Spion gefangengenommen und – so er bei guter Laune gewesen wäre – außer Landes verwiesen. Ein von der Priesterschaft aufgesetztes Schreiben hätte er hohnlachend zerfetzt. Die Autorität der in Jerusalem mächtigen Geistlichkeit endete an seiner Landesgrenze.“
Allerdings geht die Apostelgeschichte gar nicht davon aus, dass die Briefe des Hohenpriesters dem König von Damaskus ausgehändigt werden sollten. Es waren vielmehr Briefe an die dortigen Synagogen.
Dass Paulus sich tatsächlich mindestens einmal im syrischen Damaskus aufgehalten und sogar indirekt mit dem dortigen König Aretas zu tun gehabt hat, beweist er selbst mit einer kurzen Notiz in 2. Korinther 11,32-33:
„In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen, und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen.“
Selbst wenn man also der insgesamt historisch unzuverlässigeren Apostelgeschichte nicht glauben will (die vom selben Ereignis ausführlicher in 9,25 berichtet), muss es keineswegs (S. 282) „eindeutig historisch falsch“ sein, dass sich Paulus „von Jerusalem aus nach Syrien aufgemacht“ hat. Denn nach eigenem Zeugnis war er ja jedenfalls im syrischen Damaskus. Ebenso denkbar ist es, dass er vorher – mit Briefen des Hohepriesters an die Synagoge in Damaskus versehen – so mutig war, dort Anhänger des neuen Weges aufspüren und mit nach Jerusalem nehmen zu können – vor dem König Aretas hatte er ja offenbar zu keinem Zeitpunkt Angst.
Nun bestreiten Sie den Aufenthalt des Paulus in Syrien nicht ohne Grund. Dadurch wollen Sie die These von Pinchas Lapide in seinem Buch „Paulus zwischen Damaskus und Qumran“ plausibel machen (S. 283), der auf „essenisches Gedanken- und Glaubensgut im Schrifttum des Paulus“ hinweist und nachweisen will (S. 284), dass Paulus „nicht ins syrische Damaskus, sondern zu den Qumran-Einsiedlern“ in das „Damaskus … am Toten Meer“ reiste.
Nicht deutlich werden in Ihrer Bezugnahme auf Lapide allerdings die komplizierten Fragen, ob Paulus der Verfechter eines Glaubens „an“ Jesus Christus als Sohn Gottes gewesen ist oder lediglich ein Judentum mit Jesus als Messias vertreten habe. Darauf geht Karl Kartelge in seiner Buchbesprechung „Ist Paulus für die Christologisierung Jesu verantwortlich? Anmerkungen zu Pinchas Lapides neuem Paulus-Buch“ ausführlich ein, in der er auch „seine Qumran-Paulus-These“ bespricht. Kartelges Fazit:
„Zu kurz und zu brüchig geraten … die ‚Pfeiler‘ in L[apide]s ‚Beweisführung von der Identität des qumranischen und des Paulinischen ‚Damaskus‘ mit Qumran‘… . Der ‚Paulus‘ dieses Buches erweist sich als ein Konstrukt, mit dem der biblische Paulus nicht viel zu tun hat.“
↑ Rabbi: Wie Jesus wirklich angeredet wurde
Zu (S. 284) R wie Rabbi erwähnen Sie eine ganze Reihe von Stellen in den Evangelien, in denen „Jesus … mit dem Titel ‚Meister‘ bedacht“ wird (S. 285):
„Überall schallt dieser ‚Meister‘ Jesus entgegen. Allerdings nur in unseren Übersetzungen.
Wie aber wurde Jesus wirklich angeredet? Mit Rabbi! Warum verschwand ‚Rabbi Jesus‘? Warum wurde er in ‚Meister Jesus‘ umgewandelt? Die Antwort finden wir bei Johannes: ‚Sie aber sprachen zu ihm: ‚Rabbi – das ist verdolmetscht Meister – wo bist du zu Hause?‘ [Johannes 1,38]‘“
Nun wissen Sie selber, dass im griechischen Urtext dort, wo die meisten Bibelübersetzungen mit „Meister“ übersetzen, das Wort „didaskalos“ = „Lehrer“ steht (diese Übersetzung bietet auch die Elberfelder Bibel), und Sie geben dazu die Erläuterung:
„Unterrichtet haben in den jüdischen Gemeinden die gleichen Männer, die auch das Wort Gottes in den Synagogen predigten: die Rabbis. Und Rabbi war ganz offensichtlich der ehrerbietige Titel Jesu. Nur in unseren Bibelübersetzungen ist er weitestgehend verschwunden.
Warum? Sollten da immer noch antijüdische Ressentiments anklingen? Hoffentlich nicht!“
Hier ist tatsächlich kein Antijudaismus im Spiel. Denn das griechische Wort didaskalos wurde ja schon im Urtext an den meisten Stellen als Anrede für Jesus benutzt. Und die von Ihnen angeführte Stelle Johannes 1,38 zeigt, dass Jesu Anrede als „Rabbi“ in den Übersetzungen gerade nicht verschwindet.
Sie irren übrigens gründlich, wenn Sie annehmen, dass das die einzige Stelle in der Bibel wäre, an der die Anrede „Rabbi“ für Jesus auftaucht. Jesus wird sowohl im Urtext als auch in den Übersetzungen mit „Rabbi“ angeredet:
- Matthäus 26,25+49 und Markus 14,45 von Judas,
- Markus 9,5 und 11,21 von Petrus,
- Johannes 1,38 von zwei Johannesjüngern,
- Johannes 1,49 von Nathanael,
- Johannes 3,2 von Nikodemus,
- Johannes 4,31; 6,25; 9,2; 11,8 von allen seinen Jüngern.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass von Jesus auch ein Wort überliefert wird, in dem er die Sucht, mit besonders ehrenvollen Titel angeredet zu werden, kritisiert (Matthäus 23, 8-11):
„Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater: der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein.“
↑ Jesu Leichnam – sicher nicht auf einem Scheiterhaufen verbrannt!
Zu (S. 285) S wie Scheiterhaufen greifen Sie auf die alternative Übersetzung eines Bibelverses durch Francesco Carotta zurück, wobei Sie dessen Absicht nicht einmal richtig einordnen.
Sie wollen deutlich machen, dass es oft nicht einfach ist (S. 286), den „Aussagen der Bibel auf den Grund zu gehen“, da etwa bei Worten aus dem Altgriechischen, „die auf den ersten Blick ganz einfach verdeutscht werden können, komplexe Mehrdeutigkeiten“ vorliegen können.
Als Beispiel nehmen Sie das altgriechische Wort „stauroō“ (137), das in allen Bibelübersetzungen mit „kreuzigen“ übersetzt wird. Und nun bringen Sie Francesco Carotta (138) ins Spiel. Er macht
„darauf aufmerksam, daß die Grundbedeutung dieses Verbs gar nicht ‚kreuzigen‘, sondern ‚Pfähle aufstellen oder Latten oder eine Palisade‘ heißt.“
Herkömmlich wird Matthäus 27,35 (139) so übersetzt (S. 286f.):
„‚Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen sie das Los darum.‘ Nach Carotta (140) könnte sie aber auch so heißen: ‚Und während sie Pfähle, Latten und Palisaden um ihn aufstellten, zerteilten sie die Kleider und warfen die guten Stücke darauf.‘ Seine Schlußfolgerung: ‚Ein seltsamer Satz. Er scheint eher die Aufstellung eines Scheiterhaufens und das rituelle Daraufwerfen von Totengaben zu beschreiben als die Aufrichtung eines Kreuzes.‘
Wahrlich, das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Sollte der Leichnam Jesu auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden sein? Eine wirklich ungewohnte Vorstellung. Es gibt allerdings keinen Hinweis dafür, daß die Römer hingerichtete Menschen verbrannten.“
Mit dem letzten Satz machen Sie deutlich, dass Sie den Zusammenhang nicht kennen oder nicht verstanden haben, in dem Francesco Carotta seine alternative Übersetzung vorbringt. Ihm geht es nämlich gar nicht um die Frage, ob Jesus nach seiner Hinrichtung möglicherweise auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden ist.
Er behauptet ja vielmehr, unzweideutig nachgewiesen zu haben, dass Jesus nie existiert hat und dass die Geschichten, die in den Evangelien erzählt werden, in Wahrheit vom vergöttlichten Julius Cäsar handeln. So abwegig es klingt (141), er geht allen Ernstes davon aus, dass die Szene, die wir als Kreuzigung Jesu kennen, in Wirklichkeit die öffentliche Verbrennung des Leichnams von Julius Cäsar nach seiner Ermordung widerspiegelt.
Darum will er den Ausdruck staurōsantes de auton = „ihn aber gekreuzigt habend“ umdeuten in ein „Pfähle um ihn aufgestellt habend“, wobei das im Akkusativ stehende auton allerdings nicht wörtlich mit „um ihn“ übersetzt werden kann. Näher würde dann noch die Übersetzung „ihn gepfählt habend“ liegen, aber das passt überhaupt nicht in seine Dramaturgie der Leichenbestattung Caesars.
Beim Teilen der Kleider (142) soll es wiederum nicht um die Kleider Jesu gehen, die die Soldaten – ballontes klēron = „das Los werfend“ unter sich aufteilen, sondern um Kleider, die von Trauernden zerrissen werden, wobei die besten Stücke als Opfergaben auf den Scheiterhaufen geworfen werden, um verbrannt zu werden.
„Carottas Überlegungen“ sind in der Tat „weit hergeholt“!
↑ Hatten die Evangelisten etwas gegen die Essener von Qumran?
Zum Stichwort (S. 287) S wie Simon der Aussätzige beschäftigen Sie sich mit dem sensationellen Fund uralter heiliger Texte bei den „Ruinen von Qumran“, die dort von „der Klostergemeinschaft der Essener“ versteckt worden waren, und fragen sich (S. 288) mit Manfred Barthel (143), warum das Neue Testament die Essener
„mit keinem Wort erwähnt! Dabei waren sie mindestens so populär wie die immer wieder erwähnten Pharisäer und Sadduzäer. Flavius Josephus nennt zum Beispiel diese beiden und die Essener in einem Atemzug als gleichwertig. Warum also werden sie im ‚Neuen Testament‘ totgeschwiegen?“
Nun behaupten Sie, dass ein simpler „Schreibfehler“ dazu geführt hat, die Erwähnung eines bedeutenden Esseners in den Evangelien nach Markus und Matthäus unkenntlich zu machen (S. 288f.):
„Sowohl Markus als auch Matthäus vermelden ein Ereignis, das, so wie beschrieben, auf keinen Fall stattgefunden haben kann. Bei Matthäus [26,6] lesen wir: ‚Als nun Jesus in Betanien war im Hause Simons, des Aussätzigen …‘ Bei Markus [14,3] heißt es: ‚Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen …‘ Es ist undenkbar, daß zur Zeit Jesu in Betanien auch nur ein Aussätziger lebte. In Betanien galten wegen der Nähe zur Heiligen Stadt besondere Reinheitsbestimmungen, die es strikt untersagten, daß ein Aussätziger mitten unter den gesunden Menschen wohnte.“
Für „eine erfundene fromme Legende“ wollen Sie diesen Bericht aber dennoch nicht halten (S. 289):
„Auch das wäre ein Irrtum! Die Lösung ist einfach: Simon wurde durch einen ‚Schreibfehler‘ zum Aussätzigen! Dem Historiker Josephus Flavius war ein Simon namentlich bekannt. In der griechischen Fassung seines ‚jüdischen Krieges‘ erwähnt er einen ‚Simon, der zu den Essenern gehörte‘. Der Schriftgelehrte hat demnach zu Jesu Zeiten gelebt.“
Sie gehen zum davon aus (S. 290), dass die Evangelisten aus dem Essener „Schim‘on ha Zanua“ einen Aussätzigen „Schim‘on ha Zarua“ gemacht haben:
„Beide Begriffe unterscheiden sich im Hebräischen nur in einem Buchstaben: Zarua und Zanua. Das hebräische r (resch) und das n (nun) können leicht verwechselt werden.“
Und Sie unterstellen den Evangelisten sogar Absicht:
„Zu Jesu Zeiten gab es einen Essener namens Simon, der als Schriftgelehrter berühmt war. Aus diesem Essener wurde bei Matthäus und Markus ein Aussätziger. Versehentlich? Vermutlich nicht! Die Essener haßten die Besatzungsmacht der Römer. Und für die Römer waren die Essener Staatsfeinde, deren Fanatismus gefürchtet war. Als die Evangelien niedergeschrieben wurden, galt es auf die römischen Herrscher Rücksicht zu nehmen. So verschwanden aus dem ‚Neuen Testament‘ die Essener. Aus einem Schriftgelehrten, der Experte in Sachen religiöser Reinheitsgebote war und strikt jeden Kontakt mit Aussätzigen mied, wurde – bewußte Ironie? -im Text des ‚Neuen Testaments‘ selbst ein Aussätziger.“
Auch wenn Ihre Schlussfolgerungen nicht ganz auszuschließen sind, möchte ich doch dagegen einwenden:
- Es gab zur Zeit Jesu den Namen Simon sehr häufig, Jesus muss also nicht gerade bei diesem Essener eingeladen gewesen sein.
- Die Zeloten waren weitaus militantere Gegner der Römer als die zurückgezogen lebenden Essener und trotzdem erwähnt Lukas 6, 15 sogar einen Jünger mit dem Beinamen ‚Zelot‘, übrigens auch einen Simon.
- Der Beiname ‚der Aussätzige‘ kann sich darauf beziehen, dass dieser Schriftgelehrte einmal aussätzig gewesen war, auch wenn er jetzt wieder gereinigt unter den Menschen lebt (144).
Die parallele Erzählung des Evangelisten Lukas 7, 36-50, beim dem „aus dem Aussätzigen ein Pharisäer“ wird, versuchen Sie dadurch mit Ihrer Deutung in Einklang zu bringen, dass ja Aussätzige „isoliert leben“ mussten, man sie also auch „als Abgesonderte bezeichnen“ konnte, denn auch die
„Pharisäer grenzten sich als besonders eifrige Befolger religiöser Vorschriften ab. Man kann den Namen dieser zahlenmäßig kleinen Gruppe mit ‚die Abgesonderten‘ übersetzen.“
Aber die Pharisäer sonderten sich ja gerade wie die Essener aus Reinheitsgründen ab, Aussätzige dagegen wurden von Menschen wie den Pharisäern ausgesondert. Ich glaube kaum, dass Lukas jemanden, der aussätzig genannt wird, nur deswegen mit einem der „Peruschim“, die wir Pharisäer nennen identifiziert hätte.
Im Gegensatz zu Ihrer Darstellung waren die Pharisäer übrigens gerade keine kleine, sondern die zahlenmäßig bedeutendste Bewegung unter den Juden, die nach dem Jüdischen Krieg im „rabbinischen Judentum“ die ausschließliche führende Rolle übernahm (145).
Auch dass in Lukas 16,8 mit dem Satz (S. 290f.) „Die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts“ ausdrücklich die „Essener“ getadelt werden sollen, „ohne daß ihr Name explizit genannt wird“, ist keineswegs so klar, wie Sie es annehmen. In Epheser 5,8 steht die gleiche Formulierung in positiver Wertung; und im Gleichnis Jesu bei Lukas werden die Kinder des Lichts nicht etwa grundsätzlich negativ gesehen, sondern es wird nur im Ausnahmefall sogar einmal ein Kind der Welt gelobt. Sonst wird in Lukas 1,78; 2,32; 8,16; 11,33-36; 12,3 das Licht immer als gut angesehen und erst recht bei Johannes an vielen Stellen.
↑ Stammbaum Jesu: Widersprüche und eine falsche Lösung
Zum Thema (S. 291) S wie Stammbaum Jesu setzen Sie sich mit der Auffassung auseinander, dass die Unterschiede in den „zwei Stammbäumen“ der „biblischen Evangelisten“ auf einfache Weise zu erklären seien:
„Matthäus gebe die Vorfahren Josefs wieder, während Lukas jene der Maria aufliste. Diese Behauptung ist falsch: Beide Evangelisten beziehen sich eindeutig auf die väterlichen Vorfahren.“
Soweit haben Sie Recht. Im einzelnen fragen Sie sich dann (S. 292):
„Wer war der Großvater Jesu? Im Evangelium nach Lukas heißt es: ‚Und Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis.‘ Bei Matthäus hingegen wird behauptet: ‚Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria.‘ Wer war nun Jesu Großvater: Elis oder Jakob?“
Elis war es schon mal gar nicht, weil das der Genitiv des Namens Eli ist, der in der Lutherübersetzung verwendet wird.
Indem Sie „eine weitere Generation zurück“ gehen, finden Sie für den „Urgroßvater Jesu“ bei Lukas und Matthäus (146) die fast identischen Namen „Mattat“ und „Mattan“ und ziehen den Schluss:
„Mattat/Mattan war sowohl nach Matthäus als auch nach Lukas der Urgroßvater Jesu. Wenn nun Matthäus tatsächlich Jesu Vorfahren väterlicherseits und Lukas seine Vorfahren mütterlicherseits auflisten würde, hätte das geradezu tragische Konsequenzen. Da in beiden Stammbäumen ein und derselbe Urgroßvater auftaucht, müßten Jesu Großeltern mindestens Halbgeschwister gewesen sein.“
Darin stimme ich Ihnen insofern zu, als sich auf diese Weise sehr gut aufzeigen lässt, wohin fundamentalistische bzw. biblizistische Bestrebungen führen können, die von der wortwörtlichen historischen Wahrheit aller biblischen Erzählungen ausgehen.
Mit keinem Wort gehen Sie darauf ein, wozu die Bibel überhaupt Stammbäume auflistet und wozu sie es nicht tut.
- Sowohl Matthäus als auch Lukas tun es gerade nicht nur, um Jesus eine ganz besondere menschliche Abstammung beizulegen. Eine solche Absicht müsste schon daran scheitern, dass beide Stammbäume blutsmäßig nur auf Josef hinauslaufen – Jesus wurde nur (Lukas 3,23) „gehalten für einen Sohn Josefs“, Josef war nur (Matthäus 1,16) „der Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus.“
- Bezeichnend für den Stammbaum des Matthäus ist, dass er zwar auf Abraham, David und das babylonische Exil als drei Ankerpunkte der Abstammung Jesu zurückgreift. Aber innerhalb der patriarchalen Ahnengalerie tauchen auch fünf Frauen auf, die (für einen männlichen Blick!) in zweifelhaftem Licht erscheinen: Tamar, Rahab, Rut, Batseba – und Maria, die in Josefs Augen der Unzucht verdächtig ist. Mir scheint, dass Matthäus durchaus die Absicht verfolgt, diskret auf die Doppelmoral ehrenwerter Herren wie Juda hinzuweisen, der die von ihm selbst geschwängerte Schwiegertochter Tamar wegen Unzucht steinigen lassen will, und Jesus gerade nicht auf Vorfahren mit fleckenlosen weißen Westen zurückzuführen (147).
- Trotzdem will Matthäus Jesus durchaus als legitimen Messiaskönig darstellen und bezieht sich daher im Gegensatz zu Lukas auf die offizielle davidische Dynastie der Herrscher im Königreich Juda, und zwar von Salomo an bis zum letzten Davididen Serubbabel, der nach dem babylonischen Exil Anspruch auf den Thron erhob, ohne ihn allerdings unter den Persern gewährt zu bekommen.
- Dahinter, dass Lukas an Stelle von Salomo den nur in 2. Samuel 5,14 und 1. Chronik 3,5 erwähnten Davidssohn Nathan in seinen Stammbaum Jesu aufnimmt, kann man die Absicht vermuten, mehr an die Kritik des Propheten Nathan an König David anknüpfen zu wollen.
- Auch der Stammbaum des Lukas läuft allerdings auf die beiden letzten bekannten Davididen zur Zeit von Esra und Nehemia hinaus, nämlich Schealtiël und Serubbabel. Das ist nicht nur ein Beleg dafür, dass diese Generationenabfolge künstlich konstruiert sein muss, sondern legt zweitens nahe, dass auch Lukas Jesus in die Reihe der legitimen Nachkommen Davids einordnen will. Allerdings nennt er vielleicht absichtlich gerade nur die beiden, die ihren Anspruch auf den Davidsthron tatsächlich nicht in Anspruch nehmen konnten, da er in Jesus ja auch keinen Anwärter auf ein realpolitisches königliches Amt in Judäa erblicken will.
↑ Jüngere Evangelien sollten keineswegs die älteren ersetzen
Nun fragen Sie sich „angesichts der offensichtlichen Widersprüche zwischen den Stammbäumen Jesu“ nach dem Grund für „zahllose ganz konkrete Dissonanzen und Diskrepanzen“, und Sie geben zur Antwort:
„Die ‚Bücher‘, die wir heute in der Bibel finden, waren ursprünglich als Einzelwerke gedacht, nicht als Teil eines umfangreichen Gesamtwerkes.
Die verschiedenen Evangelien, von denen nur ganze vier in den Text der Bibel aufgenommen wurden, waren nicht als Ergänzungen zueinander gedacht. Sie entstanden als eigenständige Bücher. Zudem sollten vermutlich neuere Bücher ältere ersetzen. Die Autoren der Evangelien nach Matthäus und Lukas verwendeten Markus als Quelle, fast wie Baumeister einen Steinbruch. Um im Bild zu bleiben: Ein altes Gebäude wird abgetragen, damit ein neues entstehen kann. Bewohnt wird das neue, nicht mehr das alte. Wer will schon lieber weiter in einer Ruine leben, wenn ein neues Haus zur Verfügung steht?
Als die Evangelien nach Matthäus und Lukas vorlagen, war damit das Markusevangelium veraltet und wurde von der jungen Christengemeinde kaum noch benutzt.“
Diesem Gedankengang kann ich nicht zustimmen, denn das Markusevangelium hat man ja immerhin so hoch eingeschätzt, dass es in den Kanon aufgenommen wurde, ohne es an die anderen Evangelien anzupassen. Und für mich ist es tatsächlich ausgesprochen plausibel, dass sowohl Matthäus als auch Lukas, denen ja das Markusevangelium vorlag, in einer weiteren neuen Schrift all das ergänzten und veränderten, was ihnen bei Markus in unzureichender Weise beschrieben erschien oder schlicht fehlte.
Auch Matthäus und Lukas mit ihren schon damals offensichtlichen Unterschieden ließ man ebenso im biblischen Kanon wie das noch später entstandene Johannesevangelium. Zwar hat man, um die Diskrepanzen der Evangelien auszugleichen, den Versuch unternommen, Evangelienharmonien herzustellen, wie die des Tatian, aber in den Kanon haben es diese nicht geschafft – die Kirche schätzte die originalen Evangelien höher ein. Ihre Widersprüche störten wohl deswegen weniger als uns heute, weil es eben um Dokumente des wunderbaren Handelns Gottes an seinem Volk und der Gemeinde Jesu ging und nicht um möglichst objektive Geschichtsschreibung.
Ihre Einschätzung (S. 294), dass „an einem Nebeneinander möglichst vieler unterschiedlicher Texte … wenig Interesse“ bestand, ist also jedenfalls im Blick auf die vier kanonischen Evangelien unzutreffend. An der Vielzahl anderer Schriften, die sich ebenfalls Evangelien nannten, bestand aus verständlichen Gründen kein offizielles kirchliches Interesse, da sie weithin in übertriebenen Szenarien biblischer Wunder schwelgten oder zu elitären gnostischen Spekulationen neigten.
Dass, wie Gerd Lüdemann (148) meint, „das Johannesevangelium die drei älteren Evangelien nicht ergänzen, sondern ersetzen wollte“, mag zutreffen, es ist aber trotzdem schon bald von der römisch-katholischen Kirche in den offiziellen Kanon der Bibel übernommen worden und hat darin sogar einen Ehrenplatz erhalten – und zwar ohne dass man „Widersprüche“, die zu den anderen Evangelien bestehen, zu „harmonisieren“ versuchte.
↑ Taufe: Jesu großer Irrtum
Zum Thema (S. 294) T wie Taufe stellen Sie die Frage (S. 295), ob „die heute geübte Praxis, Babys zu taufen, von Jesus initiiert“ wurde (S. 296):
„Die heutige Praxis der Kindertaufe läßt sich weder mit der Bibel allgemein noch mit einem Jesuswort im besonderen belegen. Keinen Zweifel scheint es daran zu geben, daß Jesus Erwachsene getauft hat. Oder doch? Hat Jesus nun getauft oder nicht? Zwei einander entgegenstehende Aussagen finden sich im Evangelium nach Johannes!
Text A: ‚Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb daselbst eine Weile mit ihnen und taufte.‘ [Johannes 3,22]
Text B: ‚Obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger.‘ [Johannes 4,2]“
Diese beiden Stellen spiegeln wider, wie man sich in der johanneischen Gemeinde mit der Frage auseinandersetzte, wann die christliche Taufe eigentlich entstanden ist. Offenbar gab es zur Zeit der Entstehung des Johannesevangeliums unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Jesus selbst getauft hat oder nicht.
Um diese Frage zu beantworten, beschäftigen Sie sich mit dem Umfeld, in dem Jesus zuerst auftrat, nämlich mit Johannes dem Täufer, der „mit seiner öffentlich demonstrierten Haltung gegen die herrschende Priesterklasse seiner Zeit“ protestierte und den Sie (S. 297) in einen engen Zusammenhang mit dem „Orden der Essener“ einordnen:
„Die Essener lehrten – wie Johannes – Askese und Armut. Ihre Kost war karg. Sie ernährten sich – wie Johannes – von gerösteten Heuschrecken. Wie Johannes taufte, so vollzogen die Essener rituelle Waschungen, um den Leib von Sünden zu befreien. Wie Buddha, Johannes der Täufer und Jesus praktizierten die Essener eine Weltflucht. Sie wollten mit dem Wohlleben der Reichen und Begüterten nichts zu tun haben.“
Einige dieser Übereinstimmungen in Lehre und Praxis der Essener und der Bewegung um Johannes den Täufer treffen tatsächlich zu. Die Weltflucht, die Sie betonen, gehört allerdings nicht dazu. Johannes suchte ja gerade die Öffentlichkeit, bzw. die Menschen suchten ihn auf, um seinen Ruf zur Umkehr zu hören.
Und Jesus war erst recht nicht weltflüchtig. Er zog predigend und heilend durch die Ortschaften Galiläs und Judäas, hielt sich sogar im samaritanischen oder heidnischen Umland auf, erregte öffentlich durchaus Anstoß. Wohl war sein Reich nicht „von dieser Weltordnung“ (so kosmos in Johannes 18,36 angemessen übersetzt), aber er zog sich nicht in eine klösterliche Gemeinschaft in der Abgeschiedenheit der Wüste zurück.
Aus den Schriften der Essener ziehen Sie den Schluss (S. 298):
„Die Essener erwarteten einen Messias, der die Welt radikal ändern würde. In der neuen Ordnung würde weder für die Römer, noch für ihre Vasallen Platz sein. Wie aber sah das Messias-Bild des Johannes aus? Erwartete er nur einen religiösen Neuerer? Oder war sein Denken von den revoluzzerischen Essenern geprägt?“
Dazu ist zu sagen, dass die apokalyptische Zukunftshoffnung aller damaligen jüdischen Gruppen außer den Sadduzäern sowohl religiös als auch politisch geprägt war. Der Unterschied lag in der Militanz ihres Auftretens: Wartete man zurückgezogen auf Gottes Eingreifen wie die Essener? Kämpfte man für die vollständige Einhaltung der Tora im ganzen Volk Israel wie die Pharisäer? Griff man zusätzlich zu gewaltsamen Mitteln, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, wie es die Sikarier und Zeloten taten? Oder rief man öffentlich zur Umkehr auf wie Johannes, der vielleicht den Essenern nahe stand, aber öffentlich auftrat? Sie sind im Blick auf ihn der festen Überzeugung (S. 299):
„Johannes der Täufer muß konkrete Kritik an den Römern geübt haben. Er hatte, wie die Essener, ein höchst negatives Bild von den römischen Besatzungstruppen. Er hielt sie für gewalttätige Verbrecher. Rief er sie doch expressis verbis dazu auf, auf Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung zu verzichten und damit zu einem die Autorität ihrer Vorgesetzten zersetzenden Dienst nach Vorschrift. ‚Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und laßt euch genügen an eurem Sold!‘ [Lukas 3,13-14]“
Gerade in dieser Bußpredigt des Johannes an die römischen Soldaten kann ich keinen Aufruf zum zersetzenden Dienst nach Vorschrift erkennen. Wäre Johannes ein Zelot gewesen, hätte er die Legionäre zur Desertion auffordern müssen, aber er erwartet von ihnen nichts anderes, als sich an ihre eigenen Gesetze zu halten.
Sie sehen das anders:
„Die Soldaten sollten mit ihrer Bezahlung zufrieden sein und sich den Sold nicht durch Plünderung und Raub aufbessern. Warum wurde Johannes der Täufer von den Römern verhaftet und nach römischem Recht hingerichtet? Liegt die Antwort nicht auf der Hand?“
Nein, hier liegt gar nicht auf der Hand, was Sie behaupten. Denn (S. 299f.) nicht etwa geben „Matthäus, Markus und Lukas … als Grund für das Vorgehen der römischen Besatzungsmacht die Kritik Johannes‘ des Täufers an Herodes an“, sondern der Vasallenkönig Herodes selbst ist es, der Johannes gefangengesetzt und auf Wunsch seiner Tochter Salomo köpfen lässt (Markus 6,16.27; Matthäus 14,9-10; Lukas 9,9).
Nun kommen Sie zurück zum Thema der Taufe (S. 300):
„Die Essener kannten keine Taufe, wohl aber das tägliche Ritualbad im Toten Meer, das im Hinblick auf das nahende Gericht mit Eifer absolviert wurde. Und Johannes der Täufer? Prof. Dr. Pinchas Lapide, jüdischer Schriftgelehrter und spezialisiert auf das ‚Neue Testament‘ (149): ‚Johannes war kein ‚Täufer‘ im deutschen Sinne dieses Wortes, sondern nur ein Aufrufer zur Selbsttaufe und dann der Taufzeuge.‘
Bestätigung bietet die Handschrift ‚Codex Bezae‘ vom Evangelium nach Lukas. Da heißt es klipp und klar: ‚Und sie tauften sich vor (150) Johannes.‘ [Lukas 3, 7]“
Nur beruft sich Pinchas Lapide hier nur auf eine einzige Handschrift, die an einer einzigen Stelle zu bestätigen scheint, dass die Menschen nicht „von“, sondern „vor“ Johannes dem Täufer getauft wurden. Alle anderen Bibelstellen bezeugen die allgemein vertretene Ansicht, dass der Täufer tatsächlich ein Täufer war.
Schließlich (S. 301) kommen Sie auf die Frage zurück, ob „Jesu Verständnis … sich von dem seines Mentors Johannes oder jenem der endzeitbezogenen Essener“ unterschied:
„Auch Jesus war ein Apokalyptiker. Auch Jesus war davon überzeugt, daß die Endzeit unmittelbar bevorstehe. Nach seinen Worten, die von Matthäus, Markus und Lukas in fast wortwörtlicher Übereinstimmung zitiert werden, stand die Endzeit unmittelbar bevor. So konnten oder mußten Jesu Zeitgenossen damit rechnen, noch zu Lebzeiten vor das ‚Jüngste Gericht‘ gestellt zu werden.“
So weit, so richtig. Aber was schlussfolgern Sie daraus?
„Es gibt keinen Zweifel: Jesus dachte wie die Essener und wie Johannes. Auch für Jesus kann die Taufe nur das Abwaschen der Sünden im rituellen Tauchbad gewesen sein, als Zeichen der Abkehr vom sündigen Leben im Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende Jüngste Gericht. Unser heutiges Verständnis von der Taufe als ‚Eintrittskarte zur Kirche‘ entbehrt damit jeder echten jesuanischen Grundlage! Jesus irrte sich gewaltig, denn das von ihm für die unmittelbare Zukunft erwartete Weltende blieb bis heute aus.“
Ihre These lautet also in Kurzform: Jesus irrte sich im Blick auf die Taufe, weil er sie erstens wie die Essener und Johannes nur als jüdisch verstandenes Reinigungsbad vor dem Eintreten des Weltendes verstand und weil zweitens dieses dann trotzdem nicht eintrat.
Aber erstens haben Sie keineswegs bewiesen, dass Johannes nicht doch eine andere Taufpraxis gehabt hat als die Essener. Er scheint selber Menschen getauft zu haben, sicher als konkretes Zeichen der Umkehr im Blick auf das baldige Weltende, aber – wie vor allem die Taufe Jesu zeigt – als einmalige Handlung.
Zweitens hat vermutlich nicht Jesus selber Taufen durchgeführt. Die einzigen Aufrufe zur Taufe, die Jesus selbst zugeschrieben werden, beziehen sich in Matthäus 28,19 und im unechten Markusschluss 16,16 auf den auferstandenen Jesus. Das heißt, dass wohl wirklich erst Jesu Apostel die Taufe als Eintrittskarte in die neu entstehende Jesusgemeinschaft verstanden haben. Und dass Jesus sich im Blick auf das schon bald eintretende Weltende geirrt hat, darauf bin ich schon unter dem Stichwort M wie Messias eingegangen.
Eine Frage ist allerdings noch offen geblieben: Dachte Jesus in jeder Hinsicht wie ein Essener? Sollte sich Jesus selbst als Messias verstanden haben, dann passte er jedenfalls nicht in die Schublade (S. 299), die Sie im Blick auf die „Essener, Verfasser der legendären Schriftrollen von Qumran“, aufgezogen haben:
„Erwartet wurde ein mächtiger Mann, ein neuer David, ein neuer Salomo, ein jüdischer Kyros.“
Ein solcher wollte Jesus definitiv nicht sein. Da er konsequent das apokalyptische Eingreifen Gottes von oben erwartete, hielt er den Ruf zu den Waffen für einen falschen Weg, um das Böse zu besiegen und die als verdorben beurteilte Römische Weltordnung zu überwinden. Nach dem von den Evangelisten verkündeten Jesus kann man Feindschaft nur besiegen, indem man Feindesliebe übt (Matthäus 5,43-45; Lukas 6,27-28).
↑ Kann Jesu Tempelreinigung historisch stattgefunden haben?
Zu (S. 302) T wie Tempelreinigung bezweifeln Sie die
„Historizität der dramatischen Episode… Jesu Aktion hätte einen wüsten Tumult ausgelöst, den die römische Obrigkeit sofort mit brachialer Gewalt unterdrückt hätte. … Jesu lautstarke Empörung hätte zu seiner sofortigen Verhaftung geführt. Und mit ihm wäre mit großer Wahrscheinlichkeit sofort „kurzer Prozeß“ gemacht worden.“
Dass genau so etwas passiert sein könnte, halte ich für sehr wahrscheinlich. Eine der Tempelreinigung vergleichbare Symbolhandlung im Tempel mag wirklich die Römer auf Jesus aufmerksam gemacht haben. Vielleicht konnte er sich noch ein paar Tage absetzen, aber dann wurde er doch geschnappt und sicher ohne große Verhandlung abgeurteilt – wie viele andere selbsternannte Messiasse der Juden auch.
Dabei ist die synoptische Datierung, die die Tempelreinigung ans Ende seines Wirkens setzt, sicher näher an der geschichtlichen Wahrheit als die johanneische, die – am jüdischen Festkalender orientiert – mehrere Auftritte Jesu im Tempel zu verschiedenen Anlässen schildert.
↑ Ist Homosexualität eine Strafe Gottes für Ungläubige? Wird Homosexualität
mit der Verstoßung durch Gott bestraft?
Zum Thema (S. 303) H wie Homosexualität haben Sie und ich im Zusammenhang des Alten Testaments schon ausführlich Stellung genommen. Sie wiederholen hier Ihre Einschätzung:
„Das mosaische Gesetz verurteilt Homosexualität auf das schärfste und fordert die Todesstrafe.“
Dazu verweise ich erneut empfehlend auf die klärenden Ausführungen des Alttestamentlers Erhard S. Gerstenberger, der sowohl im Blick auf die Todesstrafe als auch speziell auf das Thema Homosexualität im Alten Testament zur äußersten Zurückhaltung mahnt.
Im Neuen Testament sieht Paulus Ihnen zufolge (S. 304) einerseits homosexuelles Empfinden und Verhalten als „Gottes Strafe für Unglauben“ (Römer 1,24.26-27), andererseits sind es nach 1. Korinther 6,9-10
„auch Homosexuelle, denen der Zugang zum Reich Gottes verwehrt werden wird. Das ‚Neue Testament‘ fordert zwar keine Todesstrafe, prophezeit aber etwas, was für den Gläubigen noch schlimmer ist. Er ist verstoßen von Gott. Das ‚Neue Testament‘ ist also keineswegs ‚milder‘ als das ‚Alte‘!“
Damit sprechen Sie eine Frage an, die bis heute von traditionell denkenden Christen, Juden wie Muslimen so beantwortet wird, dass Homosexualität eben keine natürliche Veranlagung des Menschen ist – sondern entweder Krankheit, die man behandeln muss (151), oder eine Strafe Gottes für Abgötterei darstellt (siehe Römer 1).
Wenn man bedenkt, seit wie kurzer Zeit erst man in der westlichen Öffentlichkeit anders über Homosexualität denkt, ist es kein Wunder, dass die Bibel in dieser Hinsicht so hart – und im heutigen Sinne ungerecht – geurteilt hat.
Man muss allerdings auch zugestehen, dass Paulus im Hinterkopf das Knabenschänder- und Lustknaben-Wesen hatte, das er wohl mit Recht abscheulich fand. Etwas anderes wird in 1. Korinther 6,9 auch gar nicht angesprochen.
Einvernehmliche gleichgeschlechtliche Partnerschaften in heutigem Sinn hatten jedenfalls im Plausibilitäts-Horizont der damaligen Zeit noch keinen Platz. Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt dazu am Anfang des 3. Jahrtausend eine andere Haltung und nimmt inzwischen auch kirchliche Trauungen gleichgeschlechtlich verheirateter Paare vor.
↑ Bildhafte Worte Jesu meinten kein infernalisches Paradies!
Zum Stichwort (S. 304) U wie Unterwelt sprechen Sie im Zusammenhang mit der Leidensankündigung Jesu (Markus 8,31 und Parallelstellen) zum dritten Mal einen angeblichen Irrtum der Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas an, der in Wirklichkeit keiner ist:
„Kurioserweise sprechen die drei Evangelisten völlig übereinstimmend von den Hohenpriestern, die Jesus nach seiner Vision schlimmes Leid zufügen würden.
Es ist unbegreiflich, wie den Autoren ein derart schlimmer Irrtum unterlaufen konnte: Es gab stets nur einen Hohenpriester, niemals mehrere.“
Also zum wiederholten Male: Im Plural meint archiereis die aristokratische Schicht der Oberpriester im Gegensatz zu den hilfspriesterlichen Leviten und nicht den einen archiereōs = „Hohenpriester“.
Aber eigentlich geht es Ihnen in diesem Abschnitt ja darum (S. 305), dass sich die Leidenerwartung Jesu erfüllte:
„Er wurde gedemütigt, erniedrigt und gekreuzigt, und er ist am dritten Tage auferstanden…
Die Auferstehung am dritten Tag und die folgende Himmelfahrt Jesu widersprechen aber einer Aussage Jesu, die wir allerdings nur im Evangelium nach Lukas [23,39-43] finden. Einer der Männer, die mit Jesus gekreuzigt wurden, lästerte über ihn. Der andere aber verteidigte Jesus. Sie selbst würden zu Recht am Kreuz sterben, Jesus aber sei unschuldig. Schließlich schöpft er reuevoll Hoffnung und bittet: ‚Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst!‘ Jesus antwortete darauf: ‚Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.‘
Wie ist das möglich? Wie kann Jesus zusammen mit dem gläubigen Schächer noch am gleichen Tage, also am Todestag selbst, im Paradies sein, da er doch erst am dritten Tage auferstehen würde? Wie kann Jesus nach seinem Tod am Kreuz in die Unterwelt (152) („Hölle“) hinabfahren und am dritten Tage gen Himmel fahren und gleichzeitig schon am Tag des Todes im Paradies sein? Der Widerspruch scheint unauflösbar.“
Nein, ist er nicht. Sie vergessen wieder einmal, dass in biblischen Glaubensaussagen oft eine bildhafte Redeweise verwendet wird. Wunderbare Bilder des Glaubens und der Hoffnung müssen jedoch, wenn man sie wortwörtlich missversteht, zu absurden Schlussfolgerungen führen.
Wie schön, dass der Widerspruch der wörtlichen Auslegung hier so deutlich hervortritt – dass Jesus dem Schächer den Trost vom Paradies genau so herzlich vermittelt, wie seine Jünger den Trost der Auferstehung am dritten Tage erfahren und wie scheinbar verlorene Seelen den Gang Jesu durch die Unterwelt als letzte Hoffnung in ihrer Verzweiflung empfinden können. Alle Aussagen über Auferstehung sind immer Bilder – wie auch Paulus in seinen Ausführungen über Verweslichkeit und Unverweslichkeit andeutet – anders kann man von dieser Wirklichkeit nicht sprechen. Hier ist nichts als faktisch-historisches Geschehen beweisbar.
Recht gebe ich Ihnen von daher natürlich (S. 305f.), wenn Sie die abenteuerliche „Gedankenkonstruktion“ von Gleason L. Archer (153) als „etwas befremdlich“ beurteilen , dass angeblich „Jesus und der namenlose ‚Schächer‘ nach dem irdischen Tod am Kreuz“ in eine „Unterwelt“ gelangten, „die Hölle und Paradies zugleich war. Nur so konnte Jesu Prophezeiung erfüllt werden. Am dritten Tage dann kam es zur Auferstehung. Jetzt stieg das Paradies aus der Unterwelt in den Himmel empor.“ Die Vorstellung eines solchen „infernalischen Paradieses“ ist eher dazu geeignet, den christlichen Glauben lächerlich zu machen.
↑ Verlassen vom Vater: Jesu letzte Worte wurden falsch übersetzt
Zum Stichwort (S. 306) V wie Verlassen befassen Sie sich mit der Frage, ob die letzten Worte Jesu am Kreuz nach Markus 15,34 und Matthäus 27,46 in den Übersetzungen der Bibel richtig wiedergegeben werden. Mit Recht weisen Sie darauf hin, dass die Lutherübersetzung die aramäischen Worte Jesu an beiden Stellen mit „Eli, Eli, lama asabtani?“ wiedergibt, obwohl im griechischen Original bei Markus elōi elōi lema sabachthani steht und bei Matthäus ēli ēli lema sabachthani (154).
Was in der Lutherbibel angeführt wird, entspricht der wörtlichen Umschrift des hebräischen Satzes aus Psalm 22,2, den Jesus nach Markus und Matthäus am Kreuz gebetet hat: ˀELI ˀELI LaMaH ˁAZaBThaNI. Ob damit seine verzweifelte Gottverlassenheit ausgedrückt werden sollte oder sein Vertrauen auf Gott (das im weiteren Verlauf des Psalms 22 dann doch zum Durchbruch kommt), muss Auslegungssache bleiben.
Hat Jesus tatsächlich am Kreuz den Psalm 22 gebetet? Hat man den Beginn dieses Psalms wirklich mit einem Ruf nach dem Propheten Elia verwechselt? Das ist historisch unbeweisbar, aber nicht unmöglich.
Letztlich wollen Sie (S. 309) auf die alternative Auslegung von George M. Lamsa (155) hinaus, der das aramäische Eli, Eli lmana shbakthani mit „Mein Gott, mein Gott, für dieses Los wurde ich aufgespart!“ oder auch: „Für dieses Schicksal wurde ich auserkoren!“ übersetzt wissen will. Unmöglich ist das nicht, aber eindeutig zu beweisen ebensowenig.
Interessant fand ich, als ich Lamsas Ausführungen in seinem Buch nachgelesen habe, dass er sogar auf Psalm 22,1 eingeht, eben den Psalm, den Jesus nach Ansicht der westlichen Kirchen gebetet habe. Dagegen argumentiert er folgendermaßen (156):
„Er führte nicht Psalm 22 : 1 an, der nach dem östlichen Text folgendermassen lautet: ‚Mein Gott, mein Gott, für welch ein Schicksal hast du mich aufgespart? Du hast meine Rettung fern von mir gehalten wegen meiner törichten Worte‘. David war damals entmutigt und ungeduldig und wunderte sich, weshalb Gott – obwohl er seinen Auftrag nicht rasch genug erfüllen konnte – ihn noch weiterleben liess. Dies ist der Gedankengang der Orientalen, wenn sie das Gefühl haben, sie hätten versagt. Sie bitten dann Gott, Er möchte ihr Leben beenden. Man vergleiche auch die Stelle in 1. Kön. 19 : 4: ‚Elia ging hin in die Wüste eine Tagereise und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe‘.“
Das heißt aber doch: In der aramäischen Übersetzung des hebräischen Psalms 22 stehen nach Lamsa dieselben Worte, die auch Jesus am Kreuz ausgerufen haben soll. Aber dennoch soll er nicht den Psalm gebetet haben, weil angeblich David damals etwas völlig anderes gemeint hat als später Jesus. David soll voll Lebensüberdruss wie Elia unter dem Wacholder um die Beendigung seines Lebens gebeten haben, während Jesus seinen nicht ersehnten Tod als Erfüllung seines Schicksals verstanden habe.
Mir erscheint es plausibler, dass sowohl David als auch Jesus ihre Gottverlassenheit beklagt haben – aber nicht als Ungläubige, sondern als Menschen, die vor Gott ihre Verzweiflung herausschreien. Gerade damit boten die Psalmen, die Klagelieder Jeremias, die Reden Hiobs und letztlich Jesus am Kreuz den verzweifelten Menschen aller Zeiten ein Vorbild für ein Beten jenseits scheinbar harmlos-frommer Gottergebenheit.
Schließlich fragen Sie (S. 310), ob „es überhaupt Sinn“ macht, „Jesu Worte psychologisierend zu interpretieren“. Wir können
„allenfalls über die Gedanken der Verfasser der Evangelien nach Matthäus und Markus spekulieren. Wir können Mutmaßungen darüber anstellen, wie sie sich die letzten Minuten Jesu am Kreuz vorstellten. … Was Jesus kurz vor seinem Tode am Kreuz wirklich sagte, wenn er dazu überhaupt noch in der Lage war, wissen wir nicht.“
So Recht Sie damit haben – es macht Sinn, diesen Tod von Psalm 22,2 her als Überwindung von Gottverlassenheit zu interpretieren.
↑ Welcher Versuchung widerstand Jesus als Sohn Gottes?
Zum Thema (S. 310f.) V wie Versuchung stellen Sie zunächst in den Texten zur Versuchung Jesu durch den Satan fest, dass angeblich „in den griechischen Texten der Evangelien … nur von einem ‚hyos Theou‘, einem ‚von Gott Geschützten‘ die Rede [ist], nicht aber von Jesus als von Gottes Sohn.“
Ich weiß nicht, in welchen griechischen Texten Sie nachgeschaut haben. Ich finde bei Matthäus und Lukas zwei Mal das Wort hyios, und das heißt eindeutig „Sohn“ Gottes. Das Wort hyos, das Sie hier (fälschlich) in griechischer Umschrift anführen, steht übrigens in der Bibel nur in der Septuaginta-Übersetzung von Sprüche 11,22 – es bedeutet „Sau“:
„Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase.“
Aber das ist nur eine Nebensächlichkeit. Inhaltlich fragen Sie sich zur Versuchungsgeschichte (S. 311):
„Ob die biblischen Verse auf Tatsachen beruhen? Kann man sie rational erklären? War Jesus durch das Fasten in der Wüste in ein Delirium gefallen und nicht mehr Herr seiner Sinne? Hatte ihn der Nahrungsentzug ekstatische Visionen erleben lassen? Kam es zu Halluzinationen? Oder wurden die vermeintlichen Wüstenerlebnisse lediglich erfunden, um Jesus als kraftvollen Gegner des bösen Satans erscheinen zu lassen, dem der Widersacher überhaupt nichts anhaben konnte?“
Alle diese Spekulationen sind müßig, da sich ein solches Erlebnis der Versuchung ohnehin nicht historisch beweisen lässt. Aber die Evangelisten machen sich in dieser erzählerischen Form darüber Gedanken, wie Jesus seine Gottessohnschaft und damit verbundene Wundermacht interpretiert haben mag. Wollte er mit magischen Hilfsmitteln zum Weltherrscher werden? Oder bestand seine Wundermacht gerade darin, dass er den Willen des gerechten Gottes Israels erfüllte und auf jedes Machtstreben verzichtete?
Da weiterhin (S. 310) nach Jakobus 1,13 niemand sagen soll, „daß er von Gott versucht wird“, fragen Sie sich (S. 311f.), wie
„Jesus in das bekannteste Gebet des Christentums, nämlich in das Vaterunser die Bitte einfügen [konnte]: ‚Und führe uns nicht in Versuchung.‘ [Matthäus 6,13; Lukas 11,4]. Unterstellt er damit nicht zumindest die Möglichkeit, daß Gott den Menschen in Versuchung führt? Denn wenn eine entsprechende Gefahr gar nicht besteht, ist ja die ausdrückliche Bitte sinnlos.“
Zur Verdeutlichung, was im Vaterunser tatsächlich gemeint ist, verweisen Sie auf George M. Lamsa (157), der diese Bitte des Vaterunser aus dem Aramäischen so übersetzt:
„Lass uns nicht in Versuchung fallen.“
„Führ‘ uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen.“
↑ Verwerfung der Juden – fördert Paulus antisemitisches Denken?
Zum Stichwort (S. 313) V wie Verwerfung unterstellen Sie, dass Paulus in seinem Brief an die Römer 11,15 „die Begründung für Antisemitismus liefert“, indem er über die Juden schreibt:
„‚Denn wenn ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten!‘ Was sagt dieser für unsere Ohren merkwürdig klingende Vers aus? … Versuchen wir etwas moderner zu formulieren: ‚Wenn die Ablehnung/Verurteilung der Juden der Welt Versöhnung ist …‘ Das heißt: Wenn man die Juden verurteilt, dann gereicht das zum Frieden der Welt.
Zum zweiten Teil des Verses: Die Annahme der Juden ist nichts anderes als Leben aus den Toten. Leben aus den Toten ist unmöglich, ein Paradoxon. Der Text bezeichnet also die Akzeptanz der Juden als Unmöglichkeit.
Der Text behauptet also: Dem Frieden auf der Welt stehen die Juden entgegen. Das besagt der etwas verquer formulierte Vers – allerdings nur in der Übersetzung.“
Verquer drückt sich Paulus wirklich im Römerbrief oft aus – er ist nicht leicht zu interpretieren und wurde tatsächlich oft im Sinne eines Antisemitismus missverstanden.
Ich frage mich nun allerdings (S. 314), ob wirklich ausschließlich die von Ihnen favorisierte alternative Übersetzung von apobolē autōn mit „ihr Verwerfen“ und von proslempsis mit „ihr (zukünftiges) Annehmen“ den Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Paulus entkräften kann. Diese würde, wie Sie schreiben, darauf hinauslaufen, dass die „Nichtanerkennung Jesu als Messias“ durch die Juden „zur Missionsarbeit der Jünger Jesu“ führte. Und (S. 314f.)
„wenn die Juden Jesus annehmen werden als Messias, dann ist das wie Leben aus den Toten. Der Sinn verändert sich bei der neuen Konstellation vollkommen. Es wird Bezug genommen auf den christlichen Glauben der Auferstehung: Leben aus den Toten.
Was sagt der Text richtig übersetzt wirklich aus: Schon die Ablehnung Jesu durch die Juden brachte der Welt die Frohe Botschaft. Frieden wird sein, wenn auch die Juden Jesus als den Messias anerkennen.“
Ich denke aber, dass auch die gängige Übersetzung erstens möglich ist und zweitens nicht mit einem Antisemitismus seitens des Apostels Paulus verbunden sein muss.
- Rein grammatikalisch kann apobolē autōn auch „ihre Verwerfung“ und proslempsis auch „(ihre zukünftige) Annahme“ bedeuten. Dafür spricht, dass Paulus in Vers 17 davon spricht, dass bildlich gesprochen vom Ölbaum des Friedens, den Israel darstellt, „einige von den Zweigen ausgebrochen wurden“, und zwar (Vers 20) „um ihres Unglaubens willen“.
- Antisemitisch versteht Paulus das schon deswegen nicht, weil er selber Jude ist und (Römer 9,2-3) „große Traurigkeit und Schmerzen“ wegen seiner „Stammverwandten … nach dem Fleisch“ empfindet, die Christus nicht annehmen und daher (Römer 10,3) „die Gerechtigkeit nicht [erkennen], die vor Gott gilt, und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten“. Umgekehrt warnt Paulus die Heiden, die (Vers 18-20) bildlich gesprochen in den Ölbaum Israels eingepfropft wurden, vor Überheblichkeit gegenüber den Juden. Und den Juden (Vers 23), die „nicht im Unglauben bleiben“, stellt er in Aussicht, dass sie wieder „eingepfropft werden“. Ja, Paulus ist sogar der festen Überzeugung (Vers 26), dass „ganz Israel gerettet werden“ wird.
↑ Weihnachten – eigentlich ein Fest des Mithraskultes?
Zum Stichwort (S. 315) W wie Weihnachten fragen Sie sich, wie es zum Termin unseres Weihnachtsfestes gekommen ist. Möglicherweise (S. 317) vereinnahmte „die junge christliche Kirche“ einen Festtag des populären Mithraskultes, der im Römischen Reich bereits anerkannt war,
„und setzte den 25. Dezember als Geburtstag des jungfräulich geborenen Jesus fest. Heidnische Himmelsgöttinnen wurden durch Maria, unbefleckt geborene Sonnensöhne durch Jesus ersetzt. So konnten vermutlich jahrtausendealte Feiern weiter zelebriert werden, nur daß sie nach und nach christianisiert wurden. Unter Kaiser Konstantin (306-337) war es offiziell. Der junge Sonnengott war nun Jesus. Astarte und Isis, die Himmels göttinnen, waren nun Maria. Zwei im Ansatz ähnliche Religionen waren miteinander verschmolzen.“
Eine solche völlige Verschmelzung halte ich nun aber doch für unwahrscheinlich, obwohl es sicherlich gegenseitige Beeinflussungen von Mithras- und Christuskult gab. Immerhin schreiben Sie dann auch: „Der alte heidnische Brauch hatte zunächst seine Konturen verloren. Nun war er aus dem Bewußtsein der Menschen verschwunden.“ Die jüdischen Wurzeln des Christentums waren doch zu sehr ausgeprägt, als dass sich der Ein-Gott-Glaube hätte einfach unterdrücken lassen. Das Christentum nutzte also allenfalls Formen des Mithraskultes, um ihn inhaltlich zu überwinden.
↑ Wie gelangten Ochs und Esel an die Weihnachtskrippe?
Dass wir von Jesu Geburt historisch absolut nichts wissen, war schon in anderen Zusammenhängen angesprochen worden. Darum sind auch sämtliche Spekulationen darüber müßig (S. 319), ob „Jesus nun in einem Stall oder in einem Haus geboren“ wurde. Wir wissen es nicht! Legenden dürfen sich die Szenerie ausmalen, wie sie wollen. Biblische Legenden haben allerdings das Interesse, eine Verknüpfung mit den Verheißungen des Messias im Alten Testament zu belegen, sie begreifen Jesus als den, der damals schon verheißen wurde.
Eine solche Verknüpfung (S. 320), nämlich die Einordnung von „Ochse und Esel ins fromme Bild“ der Weihnachtskrippe, halten Sie nun (S. 320) für „das Ergebnis eines dummen Übersetzungsfehlers aus dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr.“ (158). Sie führen sie zurück auf die Bibelstelle Habakuk 3,2:
„Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, HERR! Mache es lebendig in naher Zeit, und lass es kundwerden in naher Zeit.“
Was Luther hier mit „in naher Zeit“ übersetzt, heißt im hebräischen Original wörtlich BeQäRäB SchaNIM = „inmitten der Jahre“. Die griechischen Übersetzer des Buches Habakuk haben nun in dem hebräischen Ausdruck BeQäRäB SchaNIM ChaJJeJHU = „inmitten der Jahre mache es lebendig“ offenbar das Wort SchaNiM = „Jahre“ mit ScheNIM = „zwei“ verwechselt (die Konsonanten beider Worte sind identisch, und eine Vokalisation durch Punkte gab es noch nicht), und das nachfolgende Wort von der Wurzel ChaJaH = „Leben“ mit zōōn = „Lebewesen“ übersetzt. So kam in die Septuaginta die Übersetzung en mesō dyo zōōn = „inmitten zweier Lebewesen/Tiere“. Daraus folgern Sie:
„Jetzt war nun nicht mehr von ‚zwischen den Zeiten‘, sondern plötzlich von ‚zwischen den Tieren‘ die Rede! Und weil ‚zwischen Tieren‘ zu allgemein formuliert war, entschied man sich, um die Geschichte plastischer und konkreter werden zu lassen, für Ochs‘ und Esel.“
Hier greift Ihre Erklärung – so richtig sie vom Ansatz her ist – doch zu kurz. Denn die konkrete Erwähnung von Ochs und Esel ist alles andere als zufällig. Sie bezieht sich nämlich auf Jesaja 1,3:
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt’s nicht, und mein Volk versteht’s nicht.“
Im übertragenen Sinn sollte ausgedrückt werden: Das Vieh im Stall von Bethlehem hat den Messias besser erkannt als die Mehrheit des Volkes Israel.
↑ Warum ist die Wiedergeburt keine zentrale kirchliche Lehre?
Zum Thema (S. 321) W wie Wiedergeburt fragen Sie sich, warum die Kirche im Jahr 553 „auf dem Konzil von Konstantinopel … die Reinkarnationslehre scharf“ verurteilt und (159) „mit dem Kirchenbann belegt.“ Sogar (S. 322) den bedeutenden „Kirchenvater Origenes Adamantius (ca. 185-254 n.Chr.) … exkommuniziert“ man wegen der Vertretung solcher Lehren „rückwirkend“. Sie führen das darauf zurück, dass sich die Kirche „in ihrer Existenz bedroht“ sah:
„Der Christ glaubt, daß er je nachdem, wie er gelebt hat, nach dem Tode gerichtet wird. Für seine guten Taten wird er belohnt, für seine Sünden wird er bestraft. Er ist auf christliche Gnade angewiesen. Der Anhänger der Reinkarnationslehre hingegen ist davon überzeugt, daß er nicht nur ein Leben, sondern mehrere hat. Und damit bietet sich ihm immer wieder die Chance, begangene Sünden in einem künftigen Leben selbst wieder gutzumachen. Er ist nicht auf die Gnade Gottes angewiesen.“
Allerdings sagen Sie richtig, dass „in den Schriften des ‚Neuen Testaments‘ … da und dort die Vorstellung von der Wiedergeburt“ aufblitzt (S. 322):
„So ist bei den Evangelisten Matthäus [14,1-2; 16,13-14], Markus [6,14-16; 8,27-28] und Lukas [9,7-9.18-19] überliefert, daß man Jesus … für einen wiedergeborenen bedeutungsvollen Menschen hielt. Man war sich nur nicht darüber einig, wer Jesus in seinem früheren Leben war. Viele dachten: ‚Das ist Johannes der Täufer; er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten.‘ Andere wiederum waren der Ansicht, Jesus sei der wiedergeborene Prophet Elia. Wiederum andere wollten sich nicht festlegen. Sie meinten: ‚Einer von den alten Propheten ist auferstanden!‘“
Deutlich ist jedoch, dass eine solche Vorstellung nicht zu den Verkündigungsinhalten des Neuen Testaments selbst gehörte, eben weil die Bibel davon ausgeht, dass jeder Mensch in seinem einen realen Leben für die eigenen Taten geradezustehen hat und sich nicht damit herausreden kann, dass ihm ja noch andere Leben zur Wiedergutmachung zur Verfügung stehen.
Im Übrigen ist es auch ein Missverständnis fernöstlicher Reinkarnationslehren, diese Wiederkehr als einen Segen zu begreifen; der Buddhismus beispielsweise begreift sie als Fluch der Wiederholung des Leidens und strebt eine Aufhebung des ewigen Kreislaufs der Wiedergeburten durch Erleuchtung und Erreichen des Nirwana an.
Abschließend fragen Sie (S 323), „welche Geisteshaltung für den Erhalt der Umwelt besser geeignet ist“ und fassen „die Ergebnisse einer Diskussionsrunde von Naturwissenschaftlern und Theologen“ im Jahr 1970 mit Lynn White (160) „sinngemäß so zusammen“ (S. 323f.):
„Das biblische Gebot, der Mensch solle sich die Erde untertan machen, führt eher zu einer Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Erde. Anhänger der Wiedergeburtslehre gehen viel schonender mit anderen Lebewesen als auch mit der natürlichen Umwelt um.“
Allerdings liegt dabei ein Missverständnis des alttestamentlichen Gebots zu Grunde, das die Beherrschung der Erde mit der verantwortungslosen Ausbeutung und Zerstörung ihrer Ressourcen verwechselt und das Gebot vergisst (1. Mose 2,15), den Schöpfungsgarten der Erde „zu bebauen und zu bewahren“, was ich bereits zum Thema S wie Schöpfungsgeschichten herausgestellt habe.
↑ Warum erzählen zwei Evangelisten eine Gespenstergeschichte?
Zum Stichwort (324) W wie Wunder beschäftigen Sie sich ausführlich mit
„Jesu Spaziergang über den See. Generationen von Theologen diskutierten: echtes Mirakel oder Lügengeschichte? Die Antwort ist einfach! Das vermeintliche Wunder hat nicht so stattgefunden, wie uns unsere Bibeltexte glauben machen wollen! Erst durch einen simplen Übersetzungsfehler wurde aus einem normalen Spaziergang ein Staunen erregendes Wunder.“
In Ihren Versuchen, dieses Wunder wegzuerklären (S. 325), berufen Sie sich auf die „aramäische Version des ‚Neuen Testaments‘“, die angeblich „bis in unsere Zeiten erhalten geblieben“ ist, was aber auch nicht dadurch wahrer wird, dass Sie es zum soundsovielten Male wiederholen. Jedenfalls soll im aramäischen Text al yama gestanden haben, was „am See“ bedeutet und nicht „auf dem Wasser“. Für die letztere Bedeutung hätte der Ausdruck apey = „auf dem Gesicht“ des Wassers benutzt werden müssen.
Dagegen spricht nicht nur das Fehlen eines Beweises dafür, dass es wirklich Urevangelien in aramäischer Sprache gab, sondern auch die Banalität der von Ihnen rekonstruierten Story. Die Jünger verwechseln Jesus mit einem Gespenst, als er einen Spaziergang am Ufer macht, und er kann sie beruhigen – „keine Angst, ich bin‘s nur!“
Ihre Interpretation scheitert auch daran, dass weitere wunderhafte Elemente erzählt werden, auf die Sie hier gar nicht eingehen: Erstens, dass sich durch Jesus der Sturm beruhigt, und zweitens, dass in Matthäus 14, 28-32 auch Petrus auf dem Wasser zu gehen versucht. Das wäre völlig unsinnig, wenn Jesus es nicht zuvor erfolgreich gemeistert hätte.
Auch ich will nicht die historische Faktizität des Seewandels beweisen. Mir geht es um eine ganz andere Frage: Welchen Sinn haben die Wundergeschichten wirklich? Sie erzählen unter Rückgriff auf den Glauben der Menschen an Magie und an das wundersame Eingreifen Gottes etwas von den realen Wundern, die Menschen mit Jesus erleben – etwa dass sie in den Sturmfluten ihrer Angst oder Trauer oder Verzweiflung nicht untergehen. Sie erzählen auch von ihrem Vertrauen auf Jesus, in dem sie den Namen des Gottes verkörpert sehen, der im Alten Testament die Urfluten des Weltabgrundes und des Todes in seine Schranken weist und sogar mit dem Leviathan spielt.
Sie allerdings wollen (S. 326) die „eine Frage“, die Ihrer Meinung nach „zu klären“ bleibt: „Warum fürchteten sich die Jünger, als sie Jesus sahen?“, und die Erläuterung von „Matthäus und Markus…, Jesu Gefolgsleute hätten ihn für ein Gespenst gehalten“, sehr simpel damit beantworten, dass man
„zu Jesu Zeiten … nicht als abergläubisch [galt], wenn man Angst vor Geistern hatte. lm Gegenteil! Wer die Existenz von Spukgestalten leugnete, galt als leichtsinnig. … Als die Jünger in der Dunkelheit der Nacht vom Boot aus am Ufer eine Gestalt sahen, lag für sie die Vermutung nahe, daß sich ihnen da ein unheimliches Wesen aus der Schattenwelt jenseits des Todes zeigte. Jesus akzeptierte ihre Ängste.“
Ganz anders geht Ton Veerkamp (161) mit der „Gespenstergeschichte“ um, die Matthäus und Markus erzählen. Sie setzen sich nach der Katastrophe des Judäischen Krieges
„mit Paulus auseinander. In der für uns verbindlich gewordenen Sammlung von Evangelien ist die Auseinandersetzung mit dem rabbinischen Judentum einerseits und der mysterienreligiösen Aufblähung des Paulusmessianismus andererseits ein Element der Grundstruktur unserer Texte.“
Nach Veerkamp ist nämlich mit dem Untergang der realpolitischen messianischen Erwartungen der Zeloten im Jahr 70 n. Chr. auch die von Paulus verkündete Hoffnung auf den Messias Jesus massiv in Frage gestellt:
„Das, was nicht geschehen sollte, durfte, ist geschehen. Wenn also je Messias war und dies geschah, dann wäre dieser Messias, überhaupt jeder Messias, ein Gespenst; damit sei Jesus Messias erledigt. Rom, die ‚Welt‘, das ganze durchorganisierte System mit seinen schwarzen Löchern der Korruption, Plünderung, Willkür und gnadenlosen Ausbeutung vor allem in abgelegenen Provinzen, habe sich über den Messias, über dessen verzweifelt kämpfendes, heillos zerstrittenes Volk durchgesetzt. Deswegen mußten die Synoptiker und Johannes die Geschichte von Jesus Messias völlig neu erzählen. So entstanden ‚Evangelien‘, und in diesen Evangelien Gespenstererzählungen.“
Wie Ton Veerkamp das genau entfaltet, ist spannend zu lesen – es führt viel weiter in die Tiefe der biblischen Texte als Ihre reichlich harmlos erscheinende Deutung.
↑ Viele Facetten der wunderbaren Heilung eines Gelähmten
Zu (S. 326) W wie Wunderheilung gehen Sie auf die „Heilung des Gelähmten“ ein, die Ihnen zufolge „von allen vier Evangelisten anscheinend übereinstimmend überliefert“ wird.
Betrachtet man allerdings die vier von Ihnen angeführten Stellen Matthäus 9,1-8, Markus 2,1-12, Lukas 5,17-26 und Johannes 5, 1-9a, so fallen gravierende Unterschiede auf, zum Beispiel, dass bei Johannes im Gegensatz zu den anderen Evangelisten keine „hilfsbereiten Menschen den Kranken auf seiner Lagerstatt mühsam herbeitransportieren“, sondern der Kranke sagt: „Herr, ich habe keinen Menschen…“.
Auch die folgende von Ihnen angeführte Übereinstimmung gilt nur für die drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas (S. 327):
„Übereinstimmend lassen sie Jesus zum Kranken sagen: ‚Deine Sünden sind vergeben!‘ Demnach sah Jesus die Lähmung des Mannes als eine Folge seiner Sünden an. Mit der Wegnahme dieser Sünden durch Jesus erfolgte auch die Heilung.“
Ganz so einfach ist es sicher nicht – in der Geschichte kann man aber die Zusammenhänge zwischen seelisch-körperlich verursachter Lähmung und wirklicher oder zugeschriebener Schuld verdichtet ausgedrückt finden.
Gerade das Johannesevangelium setzt sich in Kapitel 9,2-3 bei der Heilung des blind Geborenen mit der Frage auseinander, ob tatsächlich einer Krankheit immer eine Sünde zu Grunde liegt. Und die Heilung des Gelähmten verbindet Jesus in Johannes 5,8 gerade nicht mit einer Zusage der Sündenvergebung. Wohl aber fordert Jesus den Geheilten dazu auf, nicht mehr zu sündigen – was möglicherweise damit zu tun hat, dass dieser nach seiner Heilung allen weitererzählt, dass es Jesus war, der ihn dazu angestiftet hat, die Sabbatruhe zu brechen.
Inwieweit die „Texte von der Wunderheilung“ auf „Tatsachenberichte von Zeitzeugen“ zurückgehen, wird sich nicht klären lassen. Sie nehmen die Darstellung des Lukas 5,19, „daß der Gelähmte erst auf Umwegen zu Jesus gelangen konnte“, als Indiz, das gegen einen Tatsachenbericht spricht (S. 327f.):
„Er wurde zunächst auf das Hausdach geschafft, dann mußten die Ziegel entfernt werden. Schließlich seilte man ihn durch die Lücke ins Innere des Hauses ab.
Nur: Ziegeldächer hat es zu Jesu Zeiten nicht gegeben. Der Verfasser kann mit dem Leben im Lande Jesu nicht besonders vertraut gewesen sein.“
Sie übersehen, dass die Erzählung des Lukas auf der Vorlage des Markus beruhte. Und Markus 2,4 spricht anders als Lukas vom „Aufgraben“ eines Lehmdaches, wie es in Galiläa wohl üblich war. Lukas ging wohl davon aus, dass seine Leser nur Ziegeldächer kannten, und veränderte den Text entsprechend.
Dass (S. 328) in den Wunderheilungserzählungen „Jesus als wundertätiger Held gefeiert werden … und seinen ‚Vorgänger‘ Elisa übertreffen [sollte], der bereits im ‚Alten Testament‘ einen aramäischen Feldhauptmann namens Naeman vom Aussatz befreite“, mag richtig sein. Vieles wird von Jesus erzählt, womit er Elisa übertrifft. Aber das ist nur eine vordergründige, oberflächliche Sichtweise. Tiefer geht die Frage, inwiefern sowohl Elia und Elisa als auch Jesus mit ihren Wundertaten die wunderbare Macht der Liebe Gottes in konkrete Heilungstaten umsetzen (162).
Abschließend weisen Sie darauf hin, dass der „Hinweis auf die ‚Sündhaftigkeit‘ des Gelähmten … als späterer Einschub betrachtet“ wird (163). Auch das mag sein. Aber gerade dieser Zug der Geschichte sorgt für eine Vertiefung des Nachdenkens über den Zusammenhang zwischen eigener Verantwortlichkeit und Gesundheit, sowie zwischen Fremdzuschreibungen von Schuld und psychosomatischen Erkrankungen.
↑ Wurde „Christus“ schon in der Bibel zum Nachnamen Jesu?
Zum (S. 328) Buchstaben X fiel Ihnen nichts anderes ein als das Christussymbol, das mit dem griechischen Buchstaben Chi beginnt und der wie ein X in unserem Alphabet aussieht. Und Sie meinen (S. 328f.):
„Der vielleicht am weitesten verbreitete Irrtum ist: Jesus hieß Christus mit Nachnamen. Das ist falsch. Zu Jesu Zeiten gab es in seiner Heimat keine Nachnamen. Christus ist kein Name, sondern ein Titel und bedeutet ‚Gesalbter‘. Schon in den biblischen Apostelbriefen wurde aus ‚Jesus, der Gesalbte‘ oder ‚Gesalbter Jesus‘ zum Namen Jesus Christus. So irrte ein biblischer Text bereits wenige Jahrzehnte nach Jesu Kreuzestod.“
Damit widersprechen Sie sich aber selbst. Gerade weil es zu Jesu Zeiten noch keine Nachnamen gab, muss das Wort christos in den Apostelbriefen keineswegs als Eigenname verstanden worden sein. Paulus verwendet das Wort „Christus“ definitiv im Sinne des Messias-Titels, stellt er doch manchmal Christos vor und manchmal nach den Namen „Jesus“, in Galater 6,2 spricht er sogar von dem Gesetz tou Christou = „des Messias“ mit dem bestimmten Artikel. Die ersten Christen wussten definitiv noch, dass christos das griechische Wort für das hebräische Wort MaSchIaCh = „Gesalbter“ war. Von einem Irrtum könnte man erst sprechen, wenn man diese jüdische Ursprungsbedeutung nicht mehr im Sinn hatte.
↑ Myrrhe, Essig, Ysop: Erfüllte Psalmen-Prophetie an Jesu Kreuz
Zum Stichwort (S. 329) Y wie Ysop spekulieren Sie zunächst darüber, ob Jesus bei seiner Kreuzigung die „mitleidige Geste“ eines betäubenden Tranks ablehnt, sei es (Matthäus 27,34) „Wein mit Galle vermischt“ oder (Markus 15,23) „Myrrhe in Wein“, weil in Psalm 69,21 vorausgesagt wird: „Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine.“
Was Jesus tatsächlich dachte, wissen wir natürlich nicht. Auf der Erzählebene meinten die Evangelisten vermutlich, dass der Trank entweder die Qualen verstärkt hätte und er deswegen ablehnte, oder dass Jesus bewusst die Schmerzen ertragen wollte. Aber nicht sozusagen aus Trotz wegen der angeblich falschen Voraussage eines Psalms – nach dem Motto: „Dumm gelaufen – die haben ja doch Mitleid – geschieht ihnen Recht, dass ich auf ihre Hilfe pfeife, wenn sie einen Propheten ins Unrecht setzen!“
Dann schreiben Sie: „Am Kreuz leidend bat Jesus – und darin stimmen die Evangelisten überein – um etwas zu trinken.“ Damit irren Sie schon wieder! Zwar bekommt Jesus bei allen Evangelisten Essig zu trinken, aber nur bei Johannes bittet er darum. Nach Markus und Matthäus bekommt er Essig, als man denkt, er rufe den Elia. Bei Lukas bringen ihm die Soldaten den Essig, während sie ihn verspotten. Mag sein (S. 329f.), dass „die Autoren wiederum die Psalmen-Prophetie erfüllt sehen [wollten]: ‚Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.‘ [Psalm 69,22]“
Die Erwähnung (S. 330) eines „Ysoprohrs“ in Johannes 19,29, auf das ein „Schwamm mit Essig“ gesteckt wird (164), finden Sie „kurios“ bzw. „absurd“, da die „Ysop-Pflanze … mit ihren kurzen, zarten Stengeln vollkommen ungeeignet dafür [ist], einen mit Flüssigkeit getränkten Schwamm vor Jesu Mund zu halten.“ Sie fragen sich, ob eine Verwechslung von „hyssopo“ = „Ysopzweig“ mit „hysso“ = „Lanze/Speer“ vorliegen kann, aber einen Beleg für das letztere Wort kann ich nirgends finden. Ihre Vermutung, dass das „Ysoprohr“ aus Psalm 51,9 – „Entsündige mich mit Ysop“ – stammen könnte, trifft wahrscheinlich zu:
„Für den Christen wäscht Jesus durch seinen Tod der Welt ihre Sünden ab. Die Ysop-Pflanze reinigt rituell.
Für den Skeptiker erfanden die Evangelisten ihre Texte in Anlehnung an Propheten. Für den Gläubigen erfüllten sich Prophezeiungen wirklich. Wer mag im Recht sein?“
Für mich als Glaubenden erzählen die Evangelisten von Jesus in Anlehnung an die Schriften des Alten Testaments, weil ihr Glaube an den Gott Israels sich im Leben und Sterben des Messias Jesus erfüllt hat – in ihm verkörpert sich die Liebe Gottes, und das stellen sie auf jede nur mögliche Weise dar. Es geht ihnen nicht um historisch exakte Reportage.
Auf Grund Ihrer Beschreibung der Ysop-Pflanze kommt mir die Idee: Die römischen Legionäre werden sicher kein Ysop verwendet haben, weil sie um die rituelle Bedeutung bei den Juden nicht wussten. Johannes mag sich aber vorgestellt haben, dass durch den Essig, der ihm mit dem Ysop-Büschel gereicht wurde, seine Entsündigung oder Sündlosigkeit bestätigt wurde.
↑ Wer wurde mit Jesus gekreuzigt: Räuber oder zelotische Freiheitskämpfer?
Zum letzten Stichwort (S. 330) Z wie Zeloten stellen Sie die Frage, wer auf Golgatha mit Jesus zusammen gekreuzigt wurde. „Nach älteren Lutherbibeln waren es zwei ‚Schächer‘, die mit Jesus hingerichtet wurden. Später wurden daraus ‚Räuber‘.“
Aber was steht im Urtext (S. 331)?
„Das griechische Original bei Matthäus [27,38] und Markus [15,27] ist sehr aufschlußreich: ‚lestes‘ steht da. Schlägt man irn Wörterbuch nach, findet sich die Übersetzung ‚Räuber‘. Aber obwohl rein formal die Bibelübersetzung mit ‚Räuber‘ richtig liegt, irrte der Übersetzer trotzdem!
Räuber wurden nicht erst vor Gericht gestellt. Diese Mühe machte man sich erst gar nicht. Räuber wurden auch nicht gekreuzigt. Man tötete sie ohne viel Aufhebens. … Für die Römer waren aufständische Zeloten ‚lestes‘, die man schon durch die Bezeichnung herabwürdigen wollte.
Mit solchen ‚Räubern‘ hatte es die römische Justiz sehr häufig zu tun! Es waren Rebellen, die sich gegen das übermächtige Rom erhoben.“
Damit haben Sie zweifelsohne Recht. Sie leiten daraus folgende Schlussfolgerung ab (S.332):
„die junge, langsam entstehende Gemeinde der Christen wollte sich auf keinen Fall den Zorn der Römer zuziehen. Deshalb nannten sie in ihren Evangelien die Aufständischen nach römischem Sprachgebrauch ‚Räuber‘.“
Ich denke, man muss differenzierter urteilen. Sicher wollten die frühen Christen nicht ohne Not die römischen Behörden provozieren. Wer die „lestes“ wirklich waren, wussten sie sicher noch. Allerdings waren sie auf diese „Zeloten“ vermutlich nicht unbedingt gut zu sprechen, da sie sie als Hauptschuldige am Jüdischen Krieg ansahen, der gegen die Römer nicht zu gewinnen war.
Was ist nun aber von Ihrer Forderung an Bibelübersetzer zu halten?
„Aber ist es nicht an der Zeit, in unseren Bibelausgaben die immer noch verbal geschmähten Rebellen nicht mehr als Räuber, sondern als Aufständische zu bezeichnen?
Es ist längst überfällig, die beleidigenden Ausdrücke, die immer noch in Bibelübersetzungen anzutreffen sind, endlich durch zutreffendere zu ersetzen.“
Fordern Sie hier nicht genau das, was Sie auf S. 14 im Zusammenhang mit gendergerechten Bibelübersetzungen abgelehnt haben?
„Weil sich das menschliche Denken gewandelt hat, wird nun die Bibel der neuen Zeit angepaßt. Wo die Bibel nicht mehr zeitgemäß ist, wird sie durch Veränderungen (also Verfälschungen!) des Textes aktualisiert.“
Ich denke, es wäre keine redliche Übersetzung, wenn man Ausdrücke, die einem in der Bibel nicht passen, einfach durch Worte mit anderer Bedeutung ersetzt, die einem zutreffender erscheinen. Kritische Kommentare sind natürlich erlaubt, aber sie gehören in die Auslegung, in die Kommentierung, in Predigten hinein, während eine Übersetzung danach fragen sollte, was dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommen mag.
↑ Nachwort: Was ist die Bibel?
Im (S. 333) Nachwort stellen Sie mit Recht fest:
„Die Bibel ist menschliches Reden über Gott. Weil Menschen sich irren können und nicht allwissend sind, ist es nur zu gut verständlich, daß den biblischen Autoren Fehler und Irrtümer unterliefen.“
Zugleich betonen Sie (S. 334):
„Wird die Bibel dadurch zum wertlosen Dokument? Keineswegs. Wird die Bibel dadurch entwertet? Nein. Wir müssen uns fragen: Was ist die Bibel überhaupt? Sie ist in erster Linie kein vordergründig historisches Nachschlagewerk über geschichtliche Ereignisse. Ginge es nur um Historienschreibung, so wäre die Bibel schon längst vergessen… Was also ist das ‚Buch der Bücher‘ dann?“
Auch der Antwort, die Sie darauf geben, kann ich voll und ganz zustimmen (S. 335):
„Die Bibel … stammt von Menschen, die zutiefst gläubig waren. Absicht dieser Menschen war es nicht, geschichtliche Daten zu vermitteln, sondern den eigenen Glauben zu bekunden. Und als Dokument des Glaubens wurde die Bibel zum erfolgreichsten Buch aller Zeiten. Sie wurde und wird nicht gelesen, um Geschichtliches zu erfahren. Die Menschen greifen zur Bibel, wenn sie Hoffnung suchen.“
Da wir uns also in den entscheidenden Fragen, die die Bibel betreffen, einig sind, hoffe ich, dass Sie auch meinen kritischen Anmerkungen gegenüber Ihrer Kritik aufgeschlossen begegnen. Dass auch ich mich hier und da geirrt haben kann, will ich nicht ausschließen.
Ich danke Ihnen für Ihr Buch, das mich zum intensiven Nachdenken und Nachforschen über viele biblische Fragen angeregt hat und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer i. R. Helmut Schütz
↑ Anmerkungen
(1) Für die Wiedergabe altgriechischer Wörter verwende ich eine einfache deutsche Umschrift, bei der ich zur Unterscheidung der beiden e- und o-Laute den Oberstrich verwende: Eta = ē, Omega = ō.
(2) Für hebräische Namen und Begriffe verwende ich meist allgemein übliche Eindeutschungen. Wenn ich hebräische Wörter genauer wiedergeben will, greife ich zur deutschen Umschrift auf Großbuchstaben für Konsonanten und kleine Buchstaben für Vokale zurück. Großgeschriebene Vokale tauchen nur als Umschrift für die hebräischen Konsonanten Jod und Waw auf, wenn sie als Vokal für I bzw. O oder U stehen, oder für die beiden Knacklaute Aleph und Ajin, die beide im Anlaut mit A, Ä oder E ausgesprochen werden können und die ich zusätzlich mit ˀ bzw. ˁ umschreibe (im Deutschen werden Knacklaute nicht besonders bezeichnet, z.B. der Laut, mit dem Wörter wie „arbeiten“ oder die zweite Silbe in dem Wort „geehrt“ beginnen). Das unbetonte erste „e“ in dem genannten Wort „geehrt“ entspricht dem hebräischen Schwa, das ich mit „ə“ umschreibe.
(3) Sie zitieren ihn nach: Raphael Patai, „The Hebrew Goddess“, 3., erweiterte Auflage, Detroit 1990, S. 43.
(4) Sie zitieren sie nach: Barbara Walker, „Das Geheime Wissen der Frauen“, Frankfurt 1993, S. 67.
(5) Vgl. dazu drei Bücher von Ton Veerkamp, „Die Vernichtung des Baal. Auslegung der Königsbücher (1.17 – 2.11), Stuttgart 1983, „Autonomie und Egalität. Ökonomie, Politik und Ideologie in der Schrift“, Berlin 1993, sowie „Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung“, Berlin 2013. Zum letzteren Buch ist hier eine ausführliche Einführung zu finden.
(6) So sehen das jedenfalls der Evolutionsbiologe Carel van Schaik und der Historiker Kai Michel in ihrem Buch „Das Tagebuch der Menschheit: Was die Bibel über unsere Evolution verrät“, Reinbek 2016, zu dem ich hier eine Einführung gegeben habe.
(7) „Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel“, München 2002, S. 61ff: „Hat sich der Auszug aus Ägypten wirklich zugetragen?“
(8) Vitus B. Dröscher, Über die Tierwunder der Bibel, Esslingen 1990. Vgl. auch meinen Gottesdienst über „Die Zehn ägyptischen Plagen als Umweltkatastrophe“.
(9) Der Theologe Ingolf U. Dalferth hat dazu ein sehr lesenswertes Buch geschrieben: „Malum. Theologische Hermeneutik des Bösen“, Tübingen 2008. Das Buch schließt auf S. 547 mit folgenden Worten:
„Die Hoffnung des Glaubens auf Gott ist die Hoffnung und Zuversicht, dass nichts so böse und kein malum [Übel] so groß ist, dass es die Menschen von der Liebe Gottes trennen, ihnen also ihr gegenüber immun und für sie unerreichbar machen könnte. Wer hofft, glaubt an die größere Kraft der Liebe Gottes gegenüber allem Bösen, die nicht in dessen Nivellierung besteht, sondern in der Unterscheidung und Rettung der davon betroffenen Menschen von dem, was sie als Böses in ihrem Leben betrifft. Gottes Liebe gilt den Menschen in ihrem Leiden an den Übeln ihres Lebens, und zwar auch dann, wenn das Leiden an diesen ihr Leben zu zerstören scheint. Dass Gottes Liebe semper maior [immer größer] ist, ist keine Verharmlosung des Bösen, sondern gerade umgekehrt das Lob der Macht der göttlichen Liebe, dort nicht an ihre Grenzen zu stoßen, wo nicht nur die Möglichkeiten, sondern sogar die Vorstellungskraft der Menschen versagt. Gott liebt das Geschöpf ins Leben – in sein Leben. Und daraus kann es durch kein Übel, das es betrifft, und kein Böses, das es zu vernichten scheint, herausfallen.“
(10) In dem Gottesdienst „Brüderliche Menschheit“ und in besinnlichen Worten anlässlich einer Sitzung der Christlich-Islamischen Gesellschaft Gießen bin ich auf die Frage eingegangen, was uns die Erzählungen von Kain und Abel heute noch zu sagen haben.
(11) Sie zitieren ihn nach: Manfred Barthel, „Was wirklich in der Bibel steht“, Düsseldorf, Wien 1987, S. 47.
(12) Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman, „David und Salomo. Archäologen entschlüsseln einen Mythos“, München 2006, S. 233.
(13) Eugen Drewermann, „Strukturen des Bösen. 3 Bde. Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht, in psychoanalytischer Sicht und in philosophischer Sicht“, Paderborn 1988.
(14) Paul Tillich, Systematische Theologie, Band II, Stuttgart 41973, S. 35:
„Die Theologie muß klar und unzweideutig den ‚Fall‘ als Symbol für die universale menschliche Situation darstellen, nicht als Titel einer Geschichte, die sich einmal ereignet haben soll.“
Auf den folgenden Seiten entfaltet er seine Unterscheidung von Essenz und Existenz und seine Vorstellung der Entfremdung des Menschen.
(15) Nicht nur im deutschen Wort Heimsuchung, sondern auch im hebräischen Wort PhaQaD = „sich kümmern um“ schwingt neben der Bedeutung des Strafens auch die Sorge um einen Menschen mit, den Gott für einen guten Lebenswandel zurückgewinnen will.
(16) Sie zitieren ihn nach Carl G. Johnson, „So the Bible is Full of Contradictions?“, Grand Rapids, Michigan, S. 20.
(17) Nicht Vers 32, wie in dem von Ihnen angeführten Zitat angegeben.
(18) Vgl. dazu meine Ausführungen zum Thema „Muss der Tod des Gottessohnes den Zorn Gottes versöhnen?“ und „Gott vernichtet nicht und leidet mit den Leidenden“.
(19) Die Zitate stammen aus Eugen Drewermann, „Das Markusevangelium. Erster Teil: Mk. 1, 1 bis 9, 13“, Olten 1987, S. 71, 49 und 79.
(20) Vgl. den Gottesdienst „Der Könige und die Hexe“, den ich gemeinsam mit einigen am Geisterglauben interessierten Konfirmand(inn)en gehalten habe.
(21) Sie zitieren ihn nach Carl G. Johnson, „So the Bible is Full of Contradictions?“, Grand Rapids 1983, S. 22.
(22) Vgl. den Gottesdienst: „Mose sieht Gottes Herrlichkeit – seinen Namen“.
(23) Vgl. den Gottesdienst: „Abendessen mit Gott“.
(24) Vgl. den Gottesdienst: „Jesus als das Lichtbild Gottes“.
(25) Vgl. den Gottesdienst: „Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer“.
(26) Und zwar den Gottesdienst: „Augenzeugen des Wortes Gottes“.
(27) Walter Dietrich, Die frühe Königszeit in Israel. 10. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart Berlin Köln 1997, S. 233f.
(28) Sie zitieren ihn nach: Louis Ginzberg, „The Legends of the Jews“, Vol. IV; „From Joshua to Esther“, London 1998, S. 87 u. 88, Übersetzung durch den Verfasser.
(29) Vgl. dazu das bereits erwähnte Buch von Ton Veerkamp, „Die Welt anders“ und meine kurze Einführung „Josia und die Tora“.
(30) Sie zitieren nach: „Der Brief des Clemens von Alexandrien an Theodorus“ in der von der Universität Bremen per Internet veröffentlichten Fassung. http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark.html. Diese Belegstelle ist im Internet allerdings nicht mehr auffindbar.
(31) Die zwei Gottesdienste „Der fliehende nackte junge Mann“ und „Der junge Gefangene und der fliehende Jüngling“ bieten eine angemessene Deutung der Geschichte auf dieser Grundlage.
(32) Sie zitieren ihn nach: Manfred Barthel, „Was wirklich in der Bibel steht“, Aktualisierte und ergänzte Neubearbeitung, Düsseldorf 1987, S. 117.
(33) Kamal Salibi: „Die Bibel kam aus dem Lande Asir“, Reinbek bei Hamburg 1985.
(34) Kamal Salibi, „Die Verschwörung von Jerusalem. Wer war Jesus wirklich?“, München 1994, S. 2.
(35) Ein Kunstwort aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe TORaH = „Gesetz, Wegweisung“, NəBIIM = „Propheten“ und KəTUBIM = „Schriften“.
(36) Sie zitieren ihn nach: Richard Sisson, „Answering Christianity‘s Most Puzzling Questions“, Chicago 1982, Band 1, S. 6.
(37) Vgl. Ton Veerkamp, „Die Welt anders“, und meine Hinweise auf die Apolitische Politik der Apokalyptik und auf den Propheten Daniel.
(38) Sie zitieren Louis Ginzberg, „The Legends of the Jews“, Vol. One, „From the Creation to Jacob“, Philadelphia 1909, S. 65. Übersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser.
(39) Vgl. dazu meinen Gottesdienst „Drei Söhne von Eva, der Mutter aller Lebenden“.
(40) Sie zitieren ihn nach: „Religionsgeschichte: War Moses ein Ägypter?“, „Geo Magazin“ 2002/01.
(41) In dem Gottesdienst „Grüne Welle für das Rote Meer“ haben wir in der Pauluskirche Gießen die Geschichte als Befreiungs- und Ermutigungsgeschichte aufgegriffen und alle historischen Fragen dahingestellt sein lassen.
(42) Vgl. dazu meine Erwägungen im Kapitel „Batjah – vom Vater geopfert, eine Gottestochter“ des Buches „Missbrauchtes Vertrauen“.
(43) In dem Gottesdienst „Gott sieht!“ habe ich versucht, dieser Vielschichtigkeit gerecht zu werden.
(44) In der Kinderandacht „Jamal und das Opferfest“ habe ich in der Kindertagesstätte der Evangelischen Paulusgemeinde Gießen den Kindern verschiedener Religionszugehörigkeit zu erklären versucht, was diese Geschichte wohl bedeutet.
(45) Erhard S. Gerstenberger, „Jahwe – ein patriarchaler Gott?“, Stuttgart 1988.
(46) Erhard S. Gerstenberger, „Israel in der Perserzeit. 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.“, Stuttgart 2005.
(47) Ich beziehe mich auf die Übersetzung des Gilgamesch-Epos in dem Buch von Werner Papke, „Die geheime Botschaft des Gilgamesch. 4000 Jahre alte astronomische Aufzeichnungen entschlüsselt“, Augsburg 1993, S. 367.
(48) Ebenda, S. 157.
(49) Das folgende Zitat stammt aus dem von Peter Krassa verfassten Vorwort zu dem Buch von Dieter Vogl und Nicolas Benzin, „Die Entdeckung der Urmatrix. Die genetische Rekonstruktion menschlicher Organe“, Band III: „Der Baum des Lebens“, S. 9 und 11.
(50) Vgl. das in Anm. 47 erwähnte Buch von Werner Papke, S. 38f.
(51) Ebenda, S. 315.
(52) Wilhelm Gesenius‘ Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Leipzig 141905.
(53) Sie zitieren ihn nach: Pinchas Lapide, „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Gütersloh 1986, S. 43.
(54) Sie zitieren ihn nach: Uwe Topper, „Die große Aktion“, Tübingen 1998, S. 157-180.
(55) Uwe Topper, „Das Jahrkreuz. Sprünge im Verlauf der Zeit“, Tübingen 2016, S. 444. Es würde zu weit führen, das Phänomen des Präzessionssprungs hier erklären zu wollen; vielleicht reicht es aus, anzumerken, dass die Präzession der Erdachse, die auf der eben verlinkten Astronomieseite als gleichbleibend betrachtet wird, sich nach Topper durch kosmische Katastrophen sprunghaft verändert haben soll.
(56) Sie zitieren ihn nach: Pinchas Lapide, „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 2, Gütersloh 1994, S. 20.
(57) Vgl. dazu Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman, „David und Salomo. Archäologen entschlüsseln einen Mythos“, München 2006.
(58) Sie verweisen hierzu auf: H. Schmökel, „Zur kultischen Deutung des Hohenliedes“, in: „Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft“ 64, 1952, S. 148-155 und H. Schmökel, „Heilige Hochzeit und Hoheslied“, o. O. 1956.
(59) Sie zitieren ihn nach: Georg Fohrer, „Einleitung in das Alte Testament“, 11. Auflage, Heidelberg 1969, S. 326 und 327.
(60) Helmut Gollwitzer, „Das hohe Lied der Liebe“, München 1978.
(61) Jürgen Ebach, „Streiten mit Gott. Hiob. Teil 2: Hiob 21-42, Neukirchen-Vluyn 22005, S. 148.
(62) Sie zitieren ihn nach: John R. Rice, „Dr. Rice, Here is my Question“, zitiert nach McKinsey, C. Dennis: „The Encyclopedia of Biblical Errancy“, Amherst 1995, S. 330, übersetzt vom Verfasser.
(63) Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Band III/1, Zollikon-Zürich 1947, S. 89. Im Blick speziell auf Erzählungen wie die Schöpfungsgeschichte schrieb er, S. 287:
„Daß wir es in diesen ganzen Texten mit einer wirklichen Schau, wirklicher Ereignisse, Personen und Dinge, aber eben mit einer Schau und also nicht mit einer historischen Sicht und also mit solchen Konstruktionen zu tun haben, die nicht in der Beobachtung, sondern in der Phantasie ihren Ursprung haben, das wird gerade hier zum Greifen deutlich.“
(64) Nebenbei fragen Sie sich, warum dieses Gebot sich wohl „in vielen Bibelausgaben“ unter der „Überschrift ‚Gesetze über die Lampen und Schaubrote‘“ versteckt.
„Wer vermutet unter dieser eher langweilig und für den heutigen Zeitgenossen unwichtig erscheinenden Titulierung ein Gesetz über die Todesstrafe?“
Die Überschrift bezieht sich in der Lutherbibel von 1984 allerdings nur auf die Verse 1-10, dann folgt die weitere Überschrift: „Strafen für Gotteslästerung, Totschlag und Gewalt“. Im Übrigens sind die Überschriften nicht Teil des ursprünglichen Bibeltextes, sondern lediglich Hilfen zum Verständnis durch die jeweiligen Übersetzer.
(65) Erhard S. Gerstenberger, „Apodiktisches“ Recht – „Todes“ Recht? ln: Gottes Recht als Lebensraum. Festschrift für Hans Jochen Boecker. Hg. von Peter Mommer u.a., Neukirchen-Vluyn 1993, 7-20. Der Aufsatz kann auch als pdf-Dokument von einer Seite der Justus-Liebig-Universität Gießen heruntergeladen werden.
(66) In seiner Anmerkung 42 zählt Gerstenberger folgende Beispiele dafür auf:
„Vgl. Totschlag: 2. Mose 21,13; 5. Mose 19,4-7; Menschenraub: 5. Mose 24,7; Verletzung der Eltern: 5. Mose 21,18-21; Sprüche 20,20; 30,17; sexuelle Vergehen: 2. Samuel 11,1-5 + 12,7-15; Sprüche 6,20-35. Wenn auch gelegentlich (literarisch!) außerhalb von MOTh JUMaTh-Sätzen die Todesstrafe ausgesprochen wird, dann doch unter sorgfältiger Eingrenzung des Falles!“
(67) Unter seiner Anmerkung 43 schreibt Gerstenberger:
„Der Jurist Wolfgang Preiser will nur sechs Sakralrechtsfälle der hebräischen Überlieferung gelten lassen: Josua 7 (Achan); Richter 19f. (Benjamin); 1. Samuel 14 (Jonathan); 2. Samuel 21 (Sauliden); 1. Könige 21 (Naboth); Jeremia 26 (Jeremia)… Die im Pentateuch erwähnten Beispiele schließt er als sagenhaft aus…“
(68) Vgl. dazu Anm. 5.
(69) Sie zitieren ihn nach: Georg Fohrer, „Das Alte Testament“, Band 1, S. 40, 2. überarbeitete Auflage, Gütersloh 1969.
(70) Sie verweisen hierzu auf: Karel Glaeys, „Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft“, Stein am Rhein 1987, S. 483 und 125.
(71) Sie zitieren es nach: E. König, „Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament“, Leipzig 1936.
(72) Zu ihnen gehört Christa Blanke, die von 1978 bis 2000 Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau war und im Jahr 2000 unter Verlust der Rechte des geistlichen Standes und aller Versorgungsansprüche aus der Kirche austrat.
(73) Lesenswert, wenn auch nicht in allem überzeugend, finde ich die Begründung der Speisegebote der Bibel auf der Internetseite von Torsten Seidel.
(74) Vitus B. Dröscher, Über die Tierwunder der Bibel, Esslingen 1990, S. 119f.“. Vgl. dazu meinen Gottesdienst „Jona im Wal und Daniel in der Löwengrube“.
(75) Sie zitieren ihn nach: Karel Claeys, „Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft, Stein am Rhein 1987, S. 460.
(76) Sie zitieren ihn nach: E. König, „Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament“, Leipzig 1936.
(77) Sie zitieren ihn nach: Karel Claeys, „Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft“, Stein am Rhein 1987, S. 630-639.
(78) Von Ihnen zitiert nach „Bertelsmann Lexikothek“, Band 5, Gütersloh 1983, S. 363.
(79) Nach der von mir verwendeten Umschrift, bei der das hebräische Tsade, das man wie das deutsche Z ausspricht, mit Ts bezeichnet wird.
(80) In Wikipedia heißt es zu den Moabitern:
„Die Moabiter werden in der Bibel fast immer als Gegner der Israeliten erwähnt, was möglicherweise mit dem unter ihnen vorherrschenden Baals-Kult zusammenhing. Dennoch war die Moabiterin Ruth (Buch Rut) Urgroßmutter von König David (Rut 4,17.20–22; vgl. 1 Sam 22,3–4) und somit eine Stammesmutter des Geschlechts Davids. Dabei ist jedoch vermutlich nicht die ethnische Abstammung ausschlaggebend, sondern die Loyalität und Gefolgstreue Ruths.“
(81) Israel Finkelstein, „Das vergessene Königreich. Israel und die verborgenen Ursprünge der Bibel“, München 2014, S. 62.
(82) Ebenda, S. 60.
(83) Im Jahr 2008 hat der Theologe Thomas Naumann einige Erklärungsbibeln empfohlen.
(84) Vgl. Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman, „David und Salomo. Archäologen entschlüsseln einen Mythos“, S. 154f.
(85) Ebenda, S. 149.
(86) Erhard S. Gerstenberger, „Israel in der Perserzeit. 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.“, Stuttgart 2005, S. 128. Auch die folgenden drei Zitate, auf die ich nur mit einer Seitenangabe verweise, stammen aus diesem Buch.
(87) Nach Friedrich Blass, „Grammatik des neutestamentlichen Griechisch“, S. 286, „kann ausgelassen werden: was nach der Satzstruktur selbstverständlich ist wie die Copula“.
(88) Beide Konstruktionen eines Verbs zusammen mit dem Verb derselben Wurzel im absoluten Infinitiv dienen im Hebräischen als Verstärkung der Aussage, was ins Deutsche schwer zu übertragen ist. Luthers Umschreibung „des Todes sterben“ kann man als kongeniale Eindeutschung der Wendung MOTh JUMaTh ansehen.
(89) Vgl. Wikipedia zum Thema „Masoretischer Text“.
(90) Nach F. H. W. Gesenius, „Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebaünde der hebräischen Sprache mit Vergleichung der verwandten Dialekte“, Leipzig 1817, S. 74.
(91) Nach diesem Mischvolk hat sich die religiös-politisch engagierte Gruppe Erev Rab benannt.
(92) Sie zitieren ihn nach: Marcello Craveri, „Das Leben des Jesus von Nazareth“, Stuttgart 1970, S. 66.
(93) Vgl. mein Kurzreferat zum Thema „Fremder Blick auf Jesu Tisch“ und darin insbesondere der Abschnitt „Noch ein fremder Blick: Katholisch-tiefenpsychologisch“ zu den Vorstellungen Eugen Drewermanns „von dem Gott, der auf die Erde kommt und sich töten lässt, um durch sein Fleisch und Blut zur Speise der Menschen zu werden“.
(94) Vgl. dazu das Referat aus meinem Theologiestudium „Ein Beitrag der neutestamentlichen Forschung in der Abendmahlsfrage“.
(95) Sie zitieren ihn nach Marcello Craveri, „Das Leben des Jesus von Nazareth“, Stuttgart 1970, S. 372 und 373.
(96) Vgl. mein Gottesdienst „Maria Magdalena sieht Jesus“.
(97) Sie zitieren ihn nach: Ethelbert Stauffer, „Jesus“, Bern 1957, S. 25.
(98) Hans-Erdmann Korth, „Der größte Irrtum der Weltgeschichte: Von Isaac Newton 1689 entdeckt – bis heute unvorstellbar“, Leipzig 2013.
(99) Werner Papke, „Das Zeichen des Messias. Ein Wissenschaftler identifiziert den Stern von Bethlehem“, Bielefeld 1995, S. 102.
(100) Ausführlich bin ich auf die Lehre der Dreieinigkeit in einer Predigtreihe über das christliche Glaubensbekenntnis eingegangen.
(101) Sie zitieren ihn nach: Karl-Heinz Ohlig, „Ein Gott in drei Personen“, Mainz, Luzern 1999.
(102) Larry W. Hurtado, „Lord Jesus Christ: devotion to Jesus in earliest Christianity“, Grand Rapids, Michigan 2005. Das Buch scheint es bis jetzt nur auf Englisch zu geben; für eigene Zwecke habe ich das Buch ins Deutsche übersetzt.
(103) Vgl. meinen Gottesdienst „Bileams störrische Eselin und der Engel mit dem Schwert“.
(104) Für Wolfgang Stegemann, „Jesus und seine Zeit“, Stuttgart 2010, S. 272, Anm. 598, ist „die Logienquelle … eine hypothetische Größe“.
(105) Sie zitieren ihn nach: Rudolf Bultmann, „Zu Schiewinds Thesen das Problem der Entmythologisierung betreffen“, in: „Kerygma und Mythos “, Band 1, Hamburg 1967, S. 132, wobei Sie den Titel nicht ganz richtig wiedergeben: Er lautet korrekt: „Zu Schniewinds Thesen das Problem der Entmythologisierung betreffend“.
(106) Sie zitieren ihn nach: George Lamsa, „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 364 und 365.
(107) Auf S. 308 sagen Sie selbst: „Jesus war ein Galiläer“.
(108) George M. Lamsa, „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Bern/Lugano 31963, S. 72. Vgl. im selben Buch zwei weitere Stellen – S. 27:
„Noch heute sprechen die Assyrer in Kurdistan und Teilen Mesopotamiens aramäisch. Dies war die Sprache Jesu und Seiner Jünger in Galiläa.“
Und S. 38:
„Die Apostel Jesu waren Galiläer, mit Ausnahme des Judas Ischarioth, der Ihn verriet. … Jesus hatte drei Jahre predigend in Galiläa zugebracht, und die meisten Seiner Nachfolger waren deshalb Galiläer.“
(109) Sie zitieren ihn nach: Willi Marxsen, „Einleitung in das Neue Testament“, Gütersloh 1978, S. 144.
(110) Zitiert nach: Joachim Kügler, Eric Souga Onomo, Stephanie Feder (Hrsg.), „Bibel und Praxis: Beiträge des Internationalen Bibel-Symposiums 2009 in Bamberg“, S. 19.
(111) George M. Lamsa, Die Evangelien in aramäischer Sicht,
Bern/Lugano 31963, S. 41.
(112) Ebenda, S. 479, in einem Text zur Ankündigung des Buches von George M. Lamsa, „Ursprung des Neuen Testaments“.
(113) Luise Schottroff, „Die Gleichnisse Jesu“, Gütersloh 2005, S. 239-246.
(114) Ebenda, S. 246.
(115) So Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21“, in der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte 109-111, S. 46. Vgl. Ton Veerkamp, „Das Evangelium nach Johannes“, Texte & Kontexte, Sonderheft 3 (2015), S. 20f.
(116) An der eben zuerst genannten Stelle, S. 45.
(117) Ebenda, S. 46 und 48.
(118) Ebenda, S. 47.
(119) George M. Lamsa, „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Bern/Lugano 31963, S. 368.
(120) Vgl. dazu meinen Gottesdienst „Segen über Kreuz“.
(121) Karl Barth: „Die kirchliche Dogmatik“, Band I, 2, 8Zürich 1990, S. 198.
(122) Ebenda, S. 199.
(123) In meinem Gottesdienst „Von Adam zu Immanuel – Gott mit uns!“ bin ich auf den Jesaja-Text im Zusammenhang eingegangen.
(124) Sie zitieren ihn nach: Pinchas Lapide, „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 2, Gütersloh 1994, S. 58.
(125) Ebenda, S. 58 und 59.
(126) Johannes Fried, „Kein Tod auf Golgatha: Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus“, München 2019.
(127) Vgl. dazu das Streitgespräch zwischen ihm und Magnus Striet „Tod auf Golgatha?“ in: Publik-Forum 8/2019, S. 26ff.
(128) Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf: Rudolf Schnackenburg, „Jesus Christus im Spiegel der vier Evangelien“, Freiburg, Basel und Wien 1998. Siehe auch: Theißen, Gerd: „Der Schatten des Galiläers“, Gütersloh 1999.
(129) Sie verweisen auf Walter Bauer, „Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur“, Berlin 1963, Spalte 1053.
(130) Sie zitieren ihn nach: Schalom Ben-Chorin, „Mutter Maria / Maria in jüdischer Sicht“, München 1994, S.34.
(131) Sie zitieren (S. 274) nicht ganz wörtlich: „Er soll Nazarener heißen“.
(132) Sie verweisen hierzu auch auf: Pinchas Lapide, „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Gütersloh 1994, S. 75 und 76.
(133) Dazu bietet Wikipedia einige Vorschläge an.
(134) Sie zitieren nach: Hans Schindler-Bellamy, „Und der Hahn krähte nicht“, unveröffentlichtes Manuskript. English: Zitiert nach McKinsey: „The Encyclopedia of Biblical Errancy“, Amherst 1995, S. 341.
(135) Lazarus Goldschmidt, „Der babylonische Talmud: Baba qamma“, 1933, S. 277:
„Zehn Dinge wurden von Jerusalem gelehrt: Ein Haus verfällt nicht in diesem. Es bringt nicht das genickgebrochene Kalb. Es wird keine abtrünnige Stadt. Da ist der Häuseraussatz nicht verunreinigend. Da dürfen keine Vorsprünge und keine Balkone hervorragen. Man errichte da keine Misthaufen. Man baue da keine Schmelzöfen. Man lege da keine Gemüse- und Obstgärten an, mit Ausnahme der Rosengärten, die sich da seit der Zeit der ersten Propheten befinden. Man züchte da keine Hühner. Man lasse da keine Leiche übernachten.“
(136) Sie zitieren ihn nach: Joseph Klausner, „Von Jesus zu Paulus“, Frankfurt 1980, S. 303.
(137) Nebenbei bemerkt umschreiben Sie die Grundform falsch mit „stauró“, am Ende steht nämlich nicht nur ein „o“, sondern beide griechische Versionen des „o“, Omikron und Omega hintereinander.
(138) Sie zitieren ihn nach: Francesco Carotta, „War Jesus Caesar?“, München 1999, S. 52.
(139) Sie geben das Zitat fälschlich mit Matthäus 25,35 an; abgesehen davon bezieht sich Carotta genau genommen auf die Parallelstelle Markus 15,24.
(140) Sie zitieren ihn nach: Francesco Carotta, „War Jesus Caesar?“, München 1999, S. 53.
(141) Carotta versucht auf Seite 45 des erwähnten Buches mit Hilfe von Umdeutungen angeblich gleichartiger Requisiten, die in einander entsprechenden Schriftzeugnissen enthalten sein sollen, folgende „Parallelen zwischen Caesar und Jesus … beim Vergleich der jeweiligen Leidensgeschichte“ aufzuzeigen:
„Bei Caesar haben wir a) die Verschwörung, b) das Attentat, c) den postumen Prozeß, d) die Feuerbestattung, e) die Auseinandersetzung um sein Erbe, f) die Nachfolge.
Bei Jesus haben wir a) die Verschwörung, b) die Gefangennahme, c) den Prozeß, d) die Kreuzigung, e) die Grablegung, f) die Auferstehung.
Man erkennt eine strukturelle Übereinstimmung. Der Hauptunterschied ist, daß beim Attentat Caesar getötet wurde, Jesus nur verhaftet. Alle anderen Unterschiede resultieren daraus: Beim Prozeß ist der Unterschied nur, daß der eine schon tot ist, der andere noch am Leben.“
(142) Carotta, S. 56, sieht darin Erinnerungen an Caesars Bestattung, wie sie von seinen Biographen erwähnt werden, etwa von
„Sueton: ‚… und sofort schleppte die Menge der Umstehenden dürres Reisig, Gerichtsbänke und Richterstühle, und was sich dort sonst für eine Leichengabe eignete, zusammen. Die Flötenspieler und Schauspieler legten die Gewänder ab, die sie für die Triumphzüge bekamen und zu diesem Anlaß anhatten, zerrissen sie und warfen sie in die Flammen, ebenso die altgedienten Soldaten unter den Legionären ihre Waffen, unter deren Schmuck sie die Leichenfeier begingen; auch viele Familienmütter opferten auf die gleiche Weise die Schmuckstücke, die sie trugen, sowie die goldenen Halskapseln und die purpurverbrämte Tunika ihrer Kinder.‘ [Sueton Jul 84]
Es ist leicht zu erkennen, daß der Markustext die Kurzfassung davon ist: Es kommen dieselben Requisiten vor. Der Unterschied ist nur in unserem Kopf. Daß Caesar verbrannt wurde und Jesus gekreuzigt, wissen wir: Hier, in den zitierten Sätzen, im Originaltext, haben wir nur dieselben Requisiten. Die unterschiedliche Deutung bringen wir mit.“
(143) Sie zitieren ihn nach: Manfred Barthel, „Was wirklich in der Bibel steht“, Düsseldorf 1987, S. 255.
(144) Interessant zum Thema ist ein Beitrag des Bibelbunds (obwohl ich die Haltung des Bibelbunds etwa in puncto „Heilung“ von Homosexuellen absolut nicht teile).
(145) So Jochen Hasenburger, „Religiöse Gruppen zur Zeit Jesu“, S. 9:
„Die Pharisäer waren mit mehr als 6000 Mitgliedern die zahlenmäßig größte Gruppierung in der jüdischen Parteienlandschaft und hatten breite Unterstützung im Volk.“
(146) Dass Sie hier von Markus sprechen, muss wohl ein Druckfehler sein.
(147) Vgl. dazu mein Gottesdienst: „Männer und Frauen im Stammbaum Jesu“.
(148) Sie zitieren ihn nach: Gerd Lüdemann, „Das Unheilige in der Heiligen Schrift“, Stuttgart 1996, S. 24 f.
(149) Sie zitieren ihn nach: Pinchas Lapide, „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 2, Gütersloh 1994, S.70.
(150) Sie verweisen auf das Wort im griechischen Urtext: „enopion“, sich taufen vor, sich selbst taufen vor.
(151) Vgl. dazu die Kritik des Bibelbundes am von Gesundheitsminister Spahn ins Auge gefassten Verbot der sogenannten Konversionstherapien.
(152) Sie verweisen dazu auf Erduard Lohse, „Unterwelt des Neuen Testaments“, Göttingen 1994.
(153) Sie zitieren ihn nach: Gleason L. Archer, „Encyclopedia of Bible Difficulties“, Grand Rapids 1982, S. 367.
(154) Sie geben unter Berufung auf Kurt Aland (Herausgeber): „Synopse der vier Evangelien“, 26. Auflage, Stuttgart 1989, S. 320 links, siehe 347. Moritur, die Umschrift folgendermaßen nicht ganz richtig wieder: In der Markusversion „Eloi Eloi lema sabakhtami“ müssten die „o“s als Omega gekennzeichnet sein, in der Matthäusversion „Eli Eh lema sabakhtami“ die beiden Anfangs-„e“s als Eta und das Wort „Eh“ als zweites „ēli“; in beiden Versionen ist das, was Sie als „kh“ umschreiben, ein schlichtes „ch“.
(155) Sie zitieren ihn nach: George M. Lamsa, „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 204 und S. 205.
(156) Ebenda, S. 206f.
(157) George M. Lamsa: „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Bern/Lugano 31963, S. 94 bzw. S. 7.
(158) Da Sie sich auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta beziehen, müssen Sie wohl das 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus meinen. Oder Sie meinen nicht den Übersetzungsfehler selbst, sondern die christliche Deutung dieses Fehlers im Sinne von Ochs und Esel an der Weihnachtskrippe.
(159) Sie zitieren hier Barbara G. Walker, „Das Geheime Wissen der Frauen“, Frankfurt, 1993, S. 824.
(160) Sie verweisen dazu auf Raphael Patai, „Myth and modern Man“, Englewood Cliffs 1972, S. 135ff.
(161) Ton Veerkamp, „Gespenster von Jesus“, in der Zeitschrift „Texte & Kontexte“ Nr. 87, 3/2000, S. 19f.
(162) In diesem Sinne habe ich eine große Anzahl von Wundergeschichten der „Propheten Elia und Elisa“ und von „Jesu Wundertaten“ in Gottesdiensten ausgelegt.
(163) Sie verweisen dazu auf Gerd Lüdemann, „Jesus nach 2000 Jahren“, Lüneburg 2000, S. 29. Der Hinweis auf diese Fußnote fehlt allerdings in Ihrem Text.
(164) In der Lutherbibel 2017 wird die Stelle mittlerweile etwas anders übersetzt:
„Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund.“
