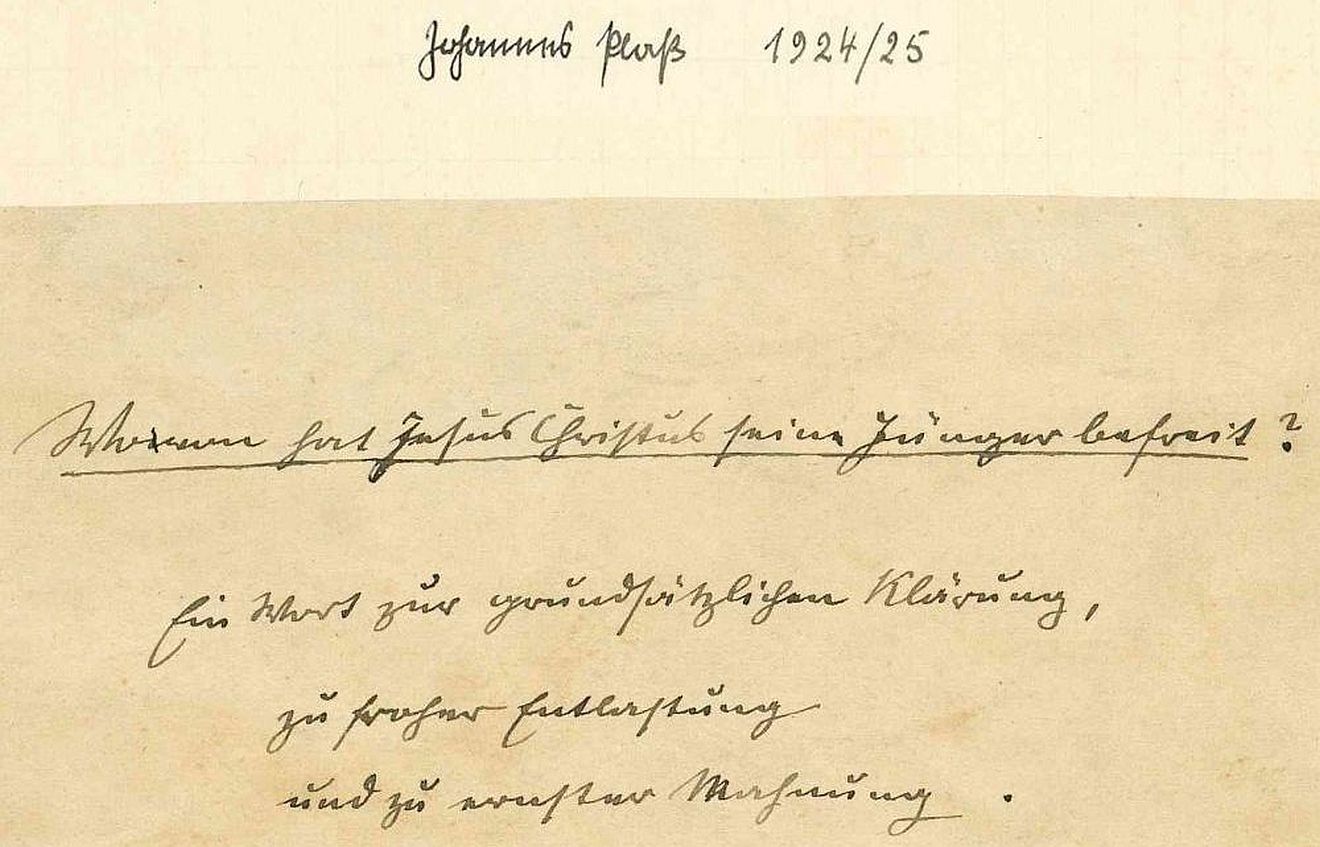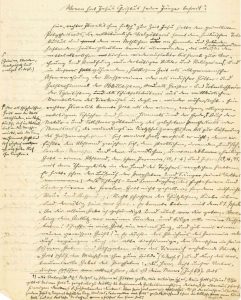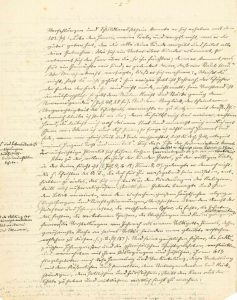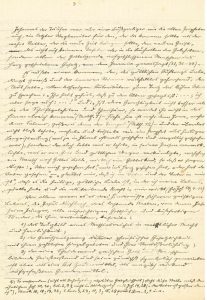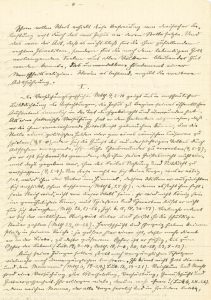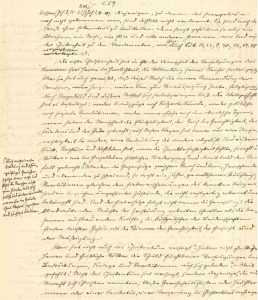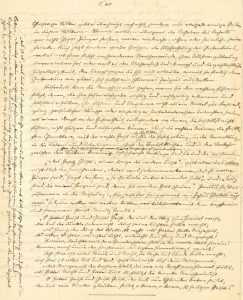Johannes Plaß hat seinen 1924/25 geschriebenen Aufsatz, den er als theologisches Vermächtnis verstand, natürlich nicht selbst ins Internet gestellt. Sein Enkel Gerhard Plaß hat ihn mir aus seinem Nachlass zur Verfügung stellen lassen, sein Urenkel Reiner Plaß hat mir erlaubt, ihn auf der Bibelwelt zu veröffentlichen.
Helmut Schütz
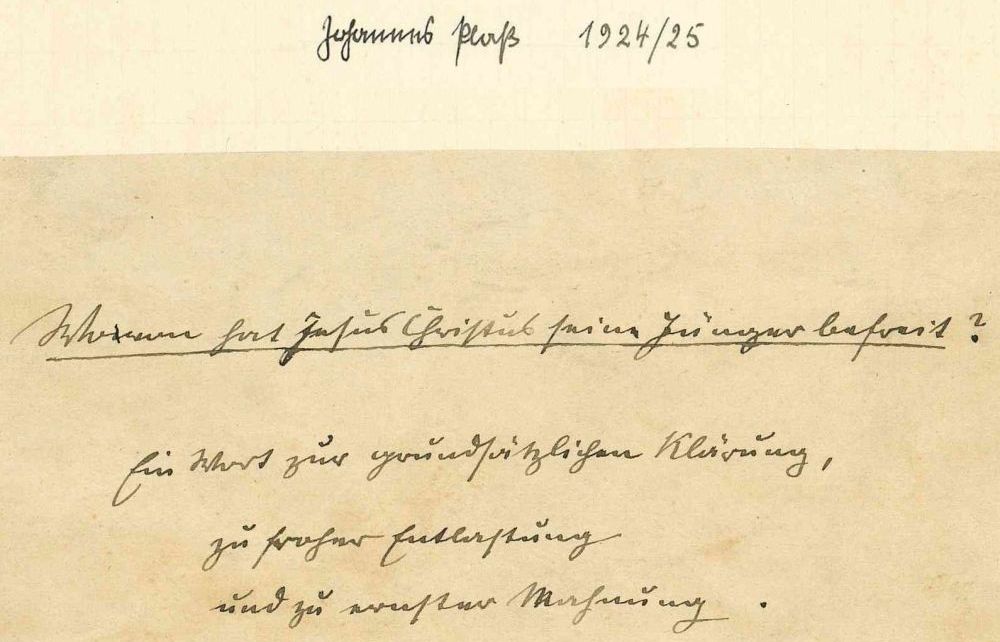
Die ersten vier Seiten bis zum Beginn des ersten von drei Hauptkapiteln und die letzten beiden Seiten seines insgesamt 60 Seiten umfassenden Manuskripts sind in der folgenden Bildergalerie in seiner originalen Handschrift zu sehen. In meiner Abschrift ist der Beginn jeder neuen Seite des Manuskripts in eckigen Klammern angezeigt; die Zahlen in runden Klammern führen per Link zur jeweiligen Anmerkung am Ende der Seite, von wo aus man wiederum mit einem Klick zurück zur Textstelle gelangt.
Ein „rechter Israelit ohne Falsch“ zur Zeit Jesu hatte den primitiven Polytheismus, die volkstümliche Vielgötterei samt der heidnischen Totenkultur und den am Stofflichen und an Formeln und Gebärden haftenden Zauberglauben bereits überwunden, das alles unter anderen Namen in den mittelalterlichen Kirchen wiederauflebte bis herab zur Verehrung und Anrufung wundertätiger Bilder und Reliquien (1), und in unserer gährenden, haltlosen Zeit als altgermanische Ahnenverehrung der Rassereinen oder als indischer Götter- und Geisterhimmel der Okkultisten, als Geister- und Totenbeschwörung der Spiritisten, als Schicksalsdeuterei aus den willkürlichen Sternbildern des Tierkreises u. dergl. m. wieder aufersteht. Ein rechter Israelit kannte Gott als den einen, ewigen, allgegenwärtigen Schöpfer und Herrn Himmels und der Erde (2). Auch der Natur- und Selbstvergötterung des gelehrten Pantheismus oder Monismus, die neuerdings in Nietzsches Zarathustra bis zur Lästerung des Größenwahnsinn sich verirrt hat (3), verfiel er nicht; denn er fühlte den Abstand zwischen sich, dem sterblichen, irrenden und fehlenden Menschen und dem unendlichen, unwandelbaren, heiligen Gott – einen Abstand, den schon Jeremia (18, 1-6) und Jesaia (29, 16; 45) mit dem Thongebilde in der Hand des Töpfers verglichen hatten. Er hatte schon den Bußruf der Propheten und Sänger seines Volkes vernommen: daß die Schlacht- und Brandopfer, das Fasten, das Festefeiern und Liederplärren der Frevler Gott nicht gefallen, sondern aufrichtige Reue und Besserung, Recht schaffen den Schutzlosen, Liebe üben und demütig sein vor Gott. Er konnte beten mit dem 51. Psalm: „An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten! Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen gewissen Geist!“ – Er durfte das Gleichnis des Jeremia aber auch ergänzen durch das alte tiefsinnige, den Menschen in seinen höheren Gaben und Aufgaben über das Tierreich erhebende Wort: „Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde“ (1. Mos. 1) und durch das vertrauensvolle Gebet des Propheten: „Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her; das ist dein Name“ (Jes. 63). Aus [2] Verfehlungen und Schuldbewußtsein konnte er sich erlaben mit dem 103. Ps.: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten; denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind; er gedenket daran, daß wir Staub sind.“ Wo Menschenkraft versagte, ließ er sich mahnen: „Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahweh, der Schöpfer der Enden der Erde! Er wird nicht müde, nicht matt; sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden“ (Jes. 40, 28f.). Und dem Unglück, der scheinbaren Ungerechtigkeit des Schicksals, vermochte er zu trotzen mit dem 73. Ps.: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ Auf diese Höhe der Frömmigkeit konnte der aufrichtige Israelit sich führen lassen. (4)
Aber zu der vollen Freiheit der Kinder Gottes, zu der völligen Liebe, in der keine Furcht ist (1. Joh. 4, 16-19; Röm. 8, 15) gelangte er dennoch nicht. Die h. Schriften des A. T., die doch für ihn maßgebend sein mußten, enthielten zu vieles, das sich noch teils in den Niederungen der Religion, teils auf außerreligiösen, staatlichem Gebiete gewegte und ihm den Blick verwirrte, von den einfachen, großen Hauptsachen abzogen (Rechtsfragen und Strafbestimmungen, Vorschriften über den Dienst der Priester und Hohenpriester, die verschiedenen Opfer, die Feste, die Zehnten, das Fasten, die verbotenen Speisen, die Waschungen und Reinigungen, die Beschneidung, ferner die Duldung der Vielweiberei und Sklaverei, die Vorstellungen von Jahweh als einem Volksgotte Israels, dessen grausamste Rache an seines Volkes Feinden man glaubte erflehen zu dürfen, s. z. B. Ps. 137). Und seine geistlichen Führer, die sadduzäischen Hohenpriester und die pharisäischen Schriftgelehrten, verstärkten und vermehrten mit ihren Auslegungen und Zusätzen, ihren 613 Einzelgeboten noch diese Hemmung und Verdunkelung, diese Verkettung mit dem Äußerlichen und Formellen, dem Untergeordneten und Rückständigen, dem Politischen und Juristischen, statt den Kern aus der Schale zu heben und mit diesem wirklich Ernst zu machen.
[3] Johannes der Täufer war nur ein Bußprediger wie die alten Propheten auch, ein letzter Wegbereiter für den, der da kommen sollte als der wahre Retter, der die neue Zeit bringen sollte, den neuen Geist, das nicht auf steinerne Tafeln oder in die Buchrollen der Gelehrten, sondern allen der Gottesgnade aufgeschlossenen Menschen ins Herz geschriebene Gesetz, von dem Jeremia geweissagt (31, 31-34).
Es mußte einer kommen, der, des göttlichen Auftrags unbedingt gewiß und der inneren Stimme rückhaltlos gehorchend, den Mut hatte, allen bisherigen Autoritäten zum Trotz das kühne Wort zu sprechen: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: …; ich aber sage euch: …!“ und: „Ist eure Gerechtigkeit nicht besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen“ (Matth. 5) – „Siehe, hie ist mehr denn Jona, mehr denn Salomo, größeres denn der Tempel“ (Matth. 12) – und der überdies nicht bloß lehrte, mahnte und tröstete wie ein Prophet aus heiliger Begeisterung (was ja in Israel oftmals geschehen und vergeblich geschehen war), sondern der auch lebte was er lehrte, in seiner Person verwirklichte, was er von Gott und göttlichen Dingen verkündigte, wahrhaft ein Mensch nach Gottes Bilde, wirklich ein Gotteskind, so daß er sagen durfte: „Wer mich gesehen hat“, mir ins Herz gesehen hat, „der hat den Vater gesehen“ – „glaubt mir, daß ich im Vater und der Vater in mir ist“, daß es die heilige, göttliche Liebe ist, in der ich meine Lebensquelle habe und die als treibende Kraft in mir wirkt (bes. Joh. 14, 4-13). (5)
Vor allem waren es drei Hindernisse höheren geistigen Lebens, die Jesus durchbrach, drei lastende Ketten, von denen Jesus seine Jünger, alle aufrichtigen Gottsucher und bußfertigen Sünder, die ihm vertrauten, befreite:
- das Trugbild eines Messiasreiches in weltlicher Macht und Herrlichkeit;
- der Gewissenszwang pharisäischer Gesetzlichkeit mit ihren zahllosen Einzelgeboten und ihrer Veräußerlichung;
- der eine Scheidewand zwischen Gott und Menschen bildende Priesterstand und seine zunächst symbolisch gemeinten, oft aber als eine Art Zaubermittel, als magisch wirkend aufgefaßten Gnadenmittel.
[4] Ihren vollen Wert erhielt diese Befreiung von dreifacher Belastung erst durch das was Jesus an deren Stelle setzte. Und das war der Art, daß es nicht bloß für die ihm zufallenden rechten Israeliten, sondern für die nach dem lebendigen Gott verlangenden Seelen aus allen Völkern bleibendes Gut werden konnte, das unwandelbare Fundament einer Menschheitsreligion. Worin es bestand, ergibt die weitere Ausführung.
I.
Die Versuchungsgeschichte Mtth. 4, 2-10 zeigt uns in anschaulicher Bilddichtung die Anfechtungen, die Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens innerlich in der Tat durchgekämpft und überwunden hat. Als eine satanische Versuchung hat er den Gedanken abgewiesen, daß er die ihm innewohnende Gotteskraft gebrauchen könne, um die Rolle eines politischen Helden oder gar eines römischen Cäsaren zu spielen (4, 8-10), oder sich die Gunst des unvernünftigen Volkes durch Aufsehen erregende, öffentliche Schauwunder zu erwerben (4, 5-7); ja er ist sich bewußt geworden, daß ihm seine Geistesmacht nicht einmal dazu gegeben war, ihm des Leibes Nahrung und Notdurft zu verschaffen (4, 2-4). Um diese macht er sich keine Sorgen; was er nötig hat, wird ihm der Vater im Himmel, dessen Willen er auszurichten sich anschickt, schon bescheren (Mtth 6, 25ff). Denn es steht ihm fest: sein Reich wird „nicht von dieser Welt“ sein. Er wird nicht König sein im gewöhnlichen Sinn, mit Spießen und Schwertern läßt er nicht für sich kämpfen (Mtth. 26, 51-56; Joh. 6, 15; 18, 36-37). Vielmehr ordnet er sich der weltlichen Obrigkeit unter und heißt ihr die schuldige Steuer zahlen (Mtth 22, 15-22). Herrschaft und Ehrgeiz haben keinen Platz in seinem Reich: je größer hier einer ist, desto mehr dient er in der Liebe, zu desto größerem Opfer ist er fähig, bis zum Opfer des Lebens (Luk. 14, 7-14; Mtth. 18, 1-6; 20, 20-28; 23, 5-12).
Auch seine Jünger sollen statt nach vergänglichen Schätzen vielmehr nach unvergänglichen trachten. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mtth. 6, 19-24; Luk. 12, 13-21). Reichtum und Macht sind eine Versuchung zur Überhebung, Verhärtung, Genußsucht und Gottvergessenheit. Ihr erliegen viele; darum wehe ihnen! (Luk. 6, 24-26) Dem reichen Manne, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt, [5] den armen Lazarus aber vor seiner Türe liegen läßt, unbarmherziger als die Hunde, die doch des Kranken Schwären lecken, hilft es nicht aus der Verdammnis, daß er Abraham seinen Vater nennt, denn Lieblosigkeit scheidet von dem Gotte, der die Liebe ist (Luk. 16, 19ff; Mtth. 25, 31ff). Lieber soll man auf der Erde Güter verzichten, als daß man sich an sie verliert. Vollends darf der sein Herz nicht an sie hängen, den Jesus zu seinem Apostel beruft (Mark. 10, 20-27 (6); 8, 34-37). Von besonderem Verdienst der Reichen bei Gott, wenn sie fromm und wohltätig sind, ist auch keine Rede; denn sie sind ja nur seine Haushalter, und das Opfer von der Armut wiegt schwerer als die Gaben vom Überfluß (Mrk. 12, 41-44). Ursache zum Beneiden anderer um irdische Güter hat der Jünger Christi nicht, denn im Gottesreich gibt es höhere Güter. Es werden oft die ersten die letzten und die letzten die ersten sein. Alles aber was wir empfangen, ist Gnade und Güte (Matth. 20, 1-16).
Nicht bloß auf Besitz, sogar auf Freundschaft und Verwandtschaft muß der Christ um des Himmelreiches willen verzichten können, wenn sie ihn daran hindern. Die Liebe der Mitjünger wird ihm Ersatz bieten, wie auch Jesus selbst einmal sagen mußte: „Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter“ (Mrk 3, 31-35). Ja, was Jesus Mrk 10, 28-30 in Aussicht stellt, hat sich oft erfüllt: selbst Häuser und Äcker hat die christliche Liebe denen gestiftet, die ihr Leben in den Dienst selbstloser Liebe gestellt haben.
Aber zunächst haben Jesu Jünger, wie er selbst, statt eines Wohllebens in Macht und Glanz vielmehr Haß und Verachtung, Verfolgung und Tod zu erwarten (Mtth. 10, 16ff; 16, 21-26). Auch das müssen sie leiden können um des Gottesreiches willen. Kein Gedanke darf ihnen kommen, daß sie dafür Rachen nehmen oder ihrerseits sich zu Ketzerrichtern aufwerfen, Feuer vom Himmel erbitten oder Scheiterhaufen errichten wollten: Luk. 9, 51-56; vielmehr sollen sie das Böse, das man ihnen antut, durch Gutestun überwinden: Mtth. 5, 38-48 vg. Röm 12, 14-21.
Der Glaube der Juden, um ihrer vermeintlichen Gerechtigkeit willen von Jahweh mit der Weltherrschaft belohnt zu werden, [6] ist eitel. Sie, die Gottes Propheten stets mißachtet und mißhandelt haben und auch ihn, „den Sohn“, den Verkünder und Anfänger des wahren Gottesreiches, töten werden, rufen dadurch selber das Gericht auf sich herab (Luk. 13, 32-35; 19, 41-44; 20, 9-19). Statt ihrer werden viele aus aller Heiden Länder ins Himmelreich eingehen (Matth. 8, 10-12; Luk. 13, 29).
So schwer es den Jüngern auch anfangs geworden zu sein scheint, ihrem Meister in diesen Gedanken zu folgen, sie haben es doch, nachdem er alles für sie geopfert, von ihm gelernt, „sanftmütig und von Herzen demütig“ zu werden wie er. Und die apostolischen Briefe ermahnen die Gemeinden, nicht nach eitler Ehre, Prunk und Reichtum zu trachten, sondern sich genügen zu lassen, brüderlich einander zu helfen, einer den andern höher zu achten als sich selbst (Phil. 2, 1ff; 4, 10-13; 1. Tim. 6, 6-19; Jak. 2, 1-9 u. a.), der Obrigkeit aber untertan zu sein (Röm. 13, 1-7; 1. Petr. 2, 13-17; Tit. 3,1), wenn sie nicht fordert was gegen das Gewissen ist (Apost. Gsch 4, 19; 5, 29). Solange die Kirche die verfolgte oder nur geduldete war, unterlag sie nicht leicht der Versuchung, zu vergessen, „welches Geistes Kind“ sie war; der äußere Druck stählte um so mehr die innere Kraft, wie es Paulus 2. Kor. 6, 1-10 u. Röm. 8, 35-39 bekennen durfte – Worte, die einem Triumphlied ähnlicher klingen als einer Klage.
Als aber die Kirche die Gunst der Staatsgewalt erlangte, geriet sie in schwerste Gefahr, an ihrem wahren Wesen Schaden zu nehmen. Einerseits erlitt sie das Übergreifen des Staates in ihre inneren Angelegenheiten und das Einströmen unlauterer und unwürdiger Elemente. Das rief dann die Weltflucht, die nicht ursprünglich geistliche Absonderung eines Mönchsstandes (7) hervor, der aber oft selbst wieder der Verweltlichung und Zuchtlosigkeit verfiel. Andererseits wurde aus der unterdrückten Kirche die herrschende, aus der verfolgten die verfolgende. Und verfolgt wurde nicht nur das alte Heidentum und Judentum, sondern auch innerhalb der Kirche die sog. Ketzerei. Und was wurde nicht alles zu Ketzerei gestempelt! Nicht etwa bloß die Verkehrung des Evangeliums wie es Jesus und seine Apostel verkündet und gelebt hatten, sondern oft gerade die Forderung der Rückkehr zum ursprünglichen Evangelium, zu dem Ernst und der Einfachheit der apostolischen [7] Gemeinden; vor allem der Ungehorsam gegen die Hierarchie; daneben jede Abweichung von den Lehrbegriffen und -sätzen, welche die Spitzfindigkeit oder Grübelei der jeweilig herrschenden Theologen ausgeklügelt hatte, den Schwerpunkt des Christentums aus dem religiös-sittlichen in das philosophisch-verstandesmäßige verschiebend; endlich sogar die Verschiedenheiten in Äußerlichkeiten, wie z. B. Festesetzung der Zeit des Osterfestes, Gebrauch von gesäuertem oder ungesäuertem Abendmahlsbrot, Verehelichung der Priester. Die um den Vorrang streitenden Patriarchen von Rom und Konstantinopel verketzerten sich gegenseitig um solche Dinge, bis es 1054 zum völligen Bruch kam. Und als im Abendlande i. J. 1378 zwei Päpste gewählt wurden, verfluchten diese einander. Inzwischen waren die Ketzerverfolgungen der Kirche fast grausamer geworden als es einst die Christenverfolgungen der römischen Kaiser waren. Die Inquisitionsgerichte, von Papst Gregor IX. (1232) den Dominikanern übertragen, zeigen den Höhepunkt dieser Entartung. Zur Wahrung eines christlichen Scheines vollstreckten freilich die Kirchengewalten nicht die Verurteilungen; den Henker ließen sie die Staatsgewalt machen. Unwürdige Sophistik erfand die Begründung dafür: die Obrigkeit habe die Verbrecher zu bestrafen, Ketzerei sei das schlimmste Verbrechen, folglich habe die Obrigkeit die Ketzer zu verbrennen. Das Werk des Ketzerhasses hat später der Orden Loyolas am eifrigsten fortgesetzt.
Der Traum von einem Messiasreiche mit weltlicher Macht und Pracht war von Jerusalem nach Rom gewandert. Symbolisch dafür ist, daß die römischen Päpste sich eine dreifache (8) Krone aufgesetzt haben, die Kardinäle sich in Purpur kleiden und Bischöfe und Erzbischöfe den Fürstentitel führen. Papst Bonifazius VII. (1294-1303) schrieb dem Könige von Frankreich: „Wir tun dir zzu wissen, daß du in geistlichen und weltlichen Dingen uns untergeben bist“ und in einer anderen Bulle: „Wir erklären, sagen, bestimmen und verkünden, daß die Unterwürfigkeit unter den römischen Pontifex aller menschlichen Kreatur durchaus zur Seligkeit notwendig ist“. Das Papsttum wollte im Mittelalter „alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ (Mtth. 4, 8) zu seinen Füßen liegen haben und hat dieses Ziel noch nicht aufgegeben. (9) Das Programm des Christus Gottes war ein anderes; es steht Mtth. 5, 3-16 geschrieben. Seine „Statthalter“, Nachfolger oder Mitarbeiter sind nur diejenigen, die mit seinem Geiste die Welt innerlich durchdringen und erneuern helfen.
[8] Von der russischen Zarenkirche können wir jetzt schweigen, nachdem sie von der Staatsgewalt getrennt u. aus einer unterdrückenden zu einer hart unterdrückten geworden ist. Vielleicht wird ihr aber gerade das ein Anlaß, aus der langen Erstarrung sich zu erheben und in Fühlung mit den gesamten durch die Reformation entbundenen Kräften sich neu zu befruchten.
Der römische Sauerteig ist auch in protestantischen Gebieten nicht sofort überall ausgefegt worden. Luther hat allerdings entschieden die Verquickung von Kirchenamt und Staatsgewalt bekämpft. Weltliche Obrigkeit, sagt er, müsse sein, um Zucht und Ehrbarkeit, Friede und Recht zu erhalten. Aber die in Kirchenämtern seien, hätten einen anderen Auftrag, nämlich das Evangelium zu predigen; wer es nicht annehmen wolle, den könnten sie von der Kirche ausschließen, aber nicht mit Händeanlegen noch mit dem Schwerte strafen. Sie hätten das Wort allein, andern damit zu dienen, aber nicht dazu, daß sie sich zu Herren machen oder weltlicher Weise regieren sollten. Jedoch sei eine Ordnung und ein Unterschied: nicht der Macht, aber der Gaben und damit auch der Berufe, wie Eph. 4, 11 Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer unterschieden werden, ebenso 1. Kor. 12, wo noch weitere Gaben hinzugefügt werden, so auch die der Leitung oder Verwaltung. Aber dadurch, daß Luther die Landesherren als die vornehmsten Gemeindeglieder ersuchte, „sich aus Liebe und um Gottes willen dieser Sache anzunehmen“, nämlich der Sache des Evangeliums, war doch wieder der Vermengung von Kirchen- und Staatswesen Vorschub geleistet. Tatsächlich haben denn auch weltliche Machthaber bald ihren Auftrag als Schutzpatrone, Schirmväter der Kirche dazu mißbraucht, bzw. den theologischen Zeloten ihren Arm dazu geliehen, die Gewissen zu vergewaltigen und sogar die Andersdenkenden, selbst solche anderer evangelischer Richtung, als Verbrecher zu behandeln, wie es vorher in römisch-katholischen Ländern geschehen war und ferner geschah. Der Augsburger Religionsfriede 1555 erhob diesen Zustand zum rechtlichen Vertrag mit dem durchaus unchristlichen Grundsatz: Wessen Gebiet, dessen Religion. Erst das 18. Jahrhundert hat die evangelische Erkenntnis zum Gemeingut gemacht, daß die Staatsgewalt sich nicht in innerkirchliche Angelegenheiten mischen darf, vielmehr jeder Religion, die sich nicht in Widerspruch zum Rechtsleben und zur guten Sitte setzt, Duldung zu gewähren hat. Auch die päpstliche Kirche nimmt, wo sie in der Minderheit ist, die Toleranz, ja die Gleichberechtigung für sich in Anspruch, gewährt sie aber anderen Kirchen nicht, wo sie die Macht hat.
[9] Zwingli und Calvin, besonders der letztere, und ihre Nachfolger haben noch weniger als Luther klare Scheidung gemacht, haben noch mehr weltliche Machtmittel für kirchliche Ziele in Anspruch genommen – aber später haen doch die erlittenen Verfolgungen zur Selbständigkeit reformierter Gemeinden und zu eigenen, auf das allgemeine Priestertum (1. Petr. 2, 5.9.10) der Gemeindeglieder aufgebauten Kirchenverfassungen geführt, die im 19. Jahrhundert teilweise auch den deutschen lutherischen und unierten Landeskirchen zum Vorbild gedient haben. Die politisch so verhängnisvolle Revolution von 1918 hat zu weiterer Selbständigkeit der deutschen Landeskirchen und zu ihrem längst ersehnten Zusammenschluß im deutschen evangelischen Kirchenbund geführt. Das kann ihnen zum Segen gereichen, wenn die Gemeinden und Synoden zu ihren Führern Männer wählen, die ihren Dienst wahrhaft im Geist Jesu Christi versehen. Denn Verfassungen sind zwar notwendig, als zusammenfassender, schützender Rahmen; aber der Rahmen kann verschiedener Art sein, braucht nicht immer und überall einerlei Form zu haben. Wesentlich ist, wie er ausgefüllt wird.
II.
Den Segen, den die alten mosaischen Gebote in sich trugen, verkehrte der Pharisäismus in sein Gegenteil, in unerträgliche Last, ja für die Gewissenhaften in schwere Gewissensnot, durch die Veräußerlichung der Gebote, die Verkennung ihrer Motive, die Zerlegung in zahllose Einzelvorschriften und spitzfindige Unterscheidungen. Jesus fordert die rechte Gesinnung, aus der sich in Freiheit die rechte Erfüllung der göttlichen Absicht ergibt. „Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst“: in dieser Summe ist alles enthalten, was Mose und die Propheten gefordert haben; mehr bedarf es nicht: Mtth. 22, 35-40; Luk. 10, 25-42; Joh. 13, 34.35. Ein heiliger Grimm aber erfaßt ihn über die blinden Führer, die Toren und Heuchler, die den aufrichtigen, frommen und suchenden Seelen meinen das Himmelreich absprechen zu können und doch selbst so fern von ihm sind. Mtth. 23, 13-36.
Der gemeinsame Ruhetag als Tag „der Herrn, deines Gottes“ (5. Mos. 5, 14.15) sollte eine Wohltat sein für das arbeitende Volk zur Erquickung und Erholung von der schweren Mühe um das tägliche Brot und zur Erhebung der Seele im gemeinsamen Gottesdienst. „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen; so ist des Menschen Sohn ein Herr auch des Sabbats“ – verkündet Jesus. Aus der rechten Herzensstellung heraus [10] entscheidet er frei, was am Feiertag recht oder unrecht ist zu tun oder zu lassen. Denn gemeinsames Feiern ist zwar nicht möglich ohne Vereinbarung bestimmter Zeiten, aber kein Tag, kein Wochentag und kein Jahrestag ist an sich heilig, sondern die Gottes- und Nächstenliebe heiligt ihn: Mrk. 2, 23-28; 3, 1-6; Luk. 13, 11-17; 14, 1-6; John. 7, 22-24. So lehren auch die apostolischen Briefe: Röm. 14, 5-8; Gal. 4, 8-11; Kol. 2, 16f; 3, 16.17; Hebr. 10, 24.25; Jak. 1, 27. Trotz dieser klaren und kräftigen Zeugnisse sind doch öfters die Kirchen, besonders die römische und die englische, in ängstliche Gesetzlichkeit zurückgefallen, während auf anderer Seite der Segen des Feiertags von unfrommem Wesen verschmäht oder gar durch Ausschweifungen verdorben wird.
Ist das Gebot die Einkehr des Menschen in sein innerstes Heiligtum, das Nahen der Seele zu Gott und Gottes Nahen zu uns, so kann es keine ärgere Verkehrung desselben geben, als wenn jüdisches und katholisches Heidentum es zu einem wortreichen Geplapper veräußerlichen, die Gebote und ihre Wiederholungen abzählen und gegen die Sünden aufrechnen oder ein Schaustück aus dem Beten machen: Mtth. 6, 5-13. Im Vaterunser hat Jesus ein Beispiel und Muster gegeben, wie Christen schlicht und kurz um das wichtigste beten können. Und eben diesen Edelstein hat man sich nicht gescheut durch endlos wiederholtes Ableiern in den Staub zu treten, ihn wie ein mechanisch wirkendes Zaubermittel zu mißbrauchen.
Die Werke der Barmherzigkeit haben auch nur Wert, wenn sie wirklich kein anderes Ziel haben, als dem Mitmenschen aus seiner Not zu helfen. Geschehen sie, um Lob und Ehre bei den Leuten zu ernten, rechnet und zählt man sie gar sich oder Gott vor, so „haben sie ihren Lohn dahin“. Denn die rechte Liebe will keinen anderen Gotteslohn als die Freude, andere froh gemacht zu haben. Sie bewährt sich aber nicht bloß im Geben, sondern ebensosehr im Vergeben, im ungezählten, auch darin dem himmlischen Vater nachahmend. Mtth. 6, 1-4; 18, 21-35.
„Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine, äußere Zucht“, ein vom Genuß beschwerter Leib findet die Erhebung der Seele zum Höchsten. Wer aber aus dem, was nur als Mittel zur inneren Sammlung, zur Förderung der Andacht seinen Wert haben kann, eine Schaustellung vor den Leuten macht, kasteiet sich umsonst: Mtth. 6, 16-18; vgl. Jes. 58, 1-10; Sach. 7, 5ff.
Im übrigen darf der Mensch, dem durch Christus der Zugang zu Gottes Unterfangen aufgetan ist, sich auch der irdischen Güter erfreuen, die das reiche Vaterhaus ihm beschert: Mtth. 9, 14-15; 11, 18.19; vgl. Röm. 12, 15; Kol. 2, 16-23; 1. Tim. 4, 1-5; 1. Kor. 13, 3. Willkürliche und unnatürliche Selbstkasteiung ist falsche Geistlichkeit und nicht der Dienst, den der himmlische Vater von seinen Kindern begehrt, geschwiege denn daß solches Tun als besonders verdienstlich vor ihm gelte. Ist doch selbst die Erfüllung seines Willens kein Verdienst, sondern selbstverständliche kindliche Schuldigkeit: Luk. 17, 10.
[11] Reinlichkeit ist ein Gebot der Gesundheit und deshalb auch des Schöpfers Wille. Aber der vielen peinlichen Einzelvorschriften kann der entraten, der den Zweck im Auge behält. Das Mittel soll nicht zum Zweck gemacht werden. Wichtiger als das Waschen der Hände, Schüsseln und Becher ist die Reinhaltung der Seele von unsauberen, argen Gedanken und Begierden: Mrk. 7, 14-23; Mtth. 5, 21-30; 12, 33-37. Wenn wer schlaff sich gehen läßt, sich nicht in Zucht hält, kann in der reinen Höhenluft des Gottesfriedens nicht bleiben, sinkt auch bald tiefer und tiefer hinab zu bösen Worten und Taten. Wie bitter ernst wir das nehmen sollen, sagen die natürlich nicht buchstäblich auszuführenden Hyperbeln (überstarke Ausdrücke) Mtth. 5, 29-30.
Machen wir uns zum Knecht von Menschen und Menschengeboten, so sind wir überdies in Gefahr, die natürlichen Gottesordnungen über den Priester- und Theologensatzungen zu vergessen und zu verflüssigen. Das geschah und geschieht z. B. Wenn man seinen Angehörigen die schuldige Hilfe entzieht, um den Priestern Stiftungen zu machen: Mrk. 7, 1-13.
Eine andere schlimme Folge der Gesetzlichkeit ist das lieblose Richten und Verdammen: Mtth. 7, 1-5. Gottes Urteil entscheidet anders. Der bußfertige Zöllner steht ihm näher als der selbstgerechte Pharisäer: Luk. 18, 9-14.
So hat Jesus recht, wenn er von seinen Jüngern eine bessere Gerechtigkeit fordert, als sie bei den damals so hoch angesehenen oder sich selbst so hoch stellenden Pharisäern und Schriftgelehrten zu finden war. Von innen heraus muß die Besserung kommen. Liebst du Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten als dich selbst, so bedarfst du keiner Gesetze, keiner peinlichen Einzelvorschriften, noch weniger der willkürlichen geistlosen Auslegungen und Zusätze der Buchstabentreter, sondern entscheidest frei, was du im Einzelfall zu tun und zu lassen hast. Gott selbst aber schenkt dir diese Liebe, dadurch daß er dich zuerst geliebt hat – trotz deiner Sünde! Liebe erweckt Gegenliebe, selbstloses Sichhingeben in Treue erweckt vertrauende Hingabe und Treue (im N. T. „Glaube“ genannt) (10). In dem, der sich demütig und doch seiner göttlichen Sendung vollbewußt „den Menschensohn“ nannte (vgl. Hesek. 2 u. Ps. 8 mit Dan. 7, 13), tritt uns die göttliche Liebe persönlich entgegen, die vollkommene Liebe, die allen gütig ist und auch den Sünder überwindet und gewinnt. An dem Pharisäer Simon und dem sündigen Weibe sah man es: der Schuldner, dem sein Gläubiger am meisten geschenkt hat, liebt diesen am meisten; „welchem aber wenig vergeben wird, [12] der liebet wenig“ (Luk. 7, 36-50). Deshalb gehen die Zöllner und Sünder ins Himmelreich ein vor den Selbstgerechten. Die freundliche Einkehr Jesu beim Zachäus macht diesen zu einem neuen Menschen, macht ihn fähig und willig, nunmehr die Hälfte seiner Güter den Armen zu geben und das Übervorteilte vierfach zu erstatten (Luk 19, 1-10). „Das Christentum“, schreibt der japanische Christ Kanso Utschimura, „hilft uns unsere eigenen Ideale erreichen, es ist Heidentum plus Leben; das Christentum zeigt uns nicht bloß das Gute, sondern es macht uns auch gut.“
Darum ist Christus „des Gesetzes Ende“ und zugleich die rechte, ganze Erfüllung des göttlichen Willens. Darin sind Paulus, Johannes und Jakobus einig: Röm. 10, 4; 3, 31; 13, 8-10; Gal. 5, 6.13.14; 6, 15; 1. Tim. 1, 5; 1. Joh. 4, 7-21; Jak. 1, 25; 2, 8. Denn „die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung“. (11)
Wiederum bekommen solche, die es mit der Erfüllung der Gebote am ernstesten nehmen, das empfindlichste Gewissen, fühlen ihr Zurückbleiben hinter dem Ziel am schmerzlichsten und nehmen deshalb das Evangelium von der vergebenden Gnade am dankbarsten auf. Auch in diesen erwacht drum die große Liebe zu dem Retter, die sich ausströmt in der Liebe zu den Mitwanderern auf dem Wege zu Gott. So konnten aus den ehrbaren Fischern Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus dankbare, begeisterte Jesusjünger, aus dem Gesetzeseiferer Saulus der Christusapostel Paulus, aus dem Mönch Luther der Reformator Luther werden. Denn wie Paulus, so seufzete und rang auch Luther einst unter dem „Knechtesjoch“ der Gesetzlichkeit (Gal. 5, 1; ApGsch. 15, 10.11; Mtth. 23, 4; vgl. als Gegensatz 11, 28-30); die römische Kirche hatte es erneuert und den Christen auf den Hals gelegt mit ihren Kirchengeboten, ihrer Kasuistik und ihren Klostersatzungen. Die Kasuistik d. h. Die Sucht, für jeden besonderen Fall Verhaltungsregeln auszutüfteln, führte schließlich zur Verkehrung der Sittlichkeit in ihr Gegenteil, zum Volksbetrug in schlimmem Überlisten und Einschläfern des Gewissens. Die berüchtigten Beispiele haben später Jesuiten (vom Volksmund deshalb „Jesuwider“ genannt) und die ihnen geistesverwandten Redemptoristen geliefert: 1) eine sittlich zweifelhafte Handlung ist als erlaubt anzusehen, wenn man einen angesehenen Theologen findet, der sie billigt; 2) der Zweck heiligt oder rechtfertigt die Mittel, weil, wenn der Zweck erlaubt ist, auch die Mittel erlaubt sind; 3) um eines guten Zweckes willen ist es erlaubt, bei einer Antwort, einem Versprechen oder einem Eide stillschweigend einen Vorbehalt [13] oder eine Einschränkung zu machen, die den Sinn ändert oder ins Gegenteil verkehrt, oder einen doppelsinnigen Ausdruck zu gebrauchen, bei dem man das Gegenteil von dem meinen kann, was der andere versteht. Solche Grundsätze untergraben natürlich alle Wahrhaftigkeit und alles Vertrauen im menschlichen Verkehr, weshalb das Verbot dieses Ordens in verschiedenen, auch katholischen Staaten und seine zeitweilige Aufhebung durch den Papst Clemens XIV. (1773) durchaus begreiflich ist. An der Sittlichkeit hat auch die Toleranz ihre Grenzen; Staaten und Kirchen, welche die Untergrabung der Sittlichkeit dulden, geben sich selbst auf.
Zu diesem auf ethischem Gebiete liegenden Gesetzesjoch hatte die Kirche des Mittelalters noch ein zweites auf dem Gebiet der Erkenntnis liegendes hinzugefügt: das dogmatische. Längst hatte man das Wort Jesu Mtth. 11, 25 überhört: „Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, daß du solches Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart“ – und das Pauluswort 1. Kor. 13: „Wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle; und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts… Unser Erkennen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören… Nun aber bleibt: Vertrauen (Glaube), Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
Der von endlichen Bildern und beschränkter Erfahrung ausgehende Mensch kann das Göttliche, das Unendliche stets nur einseitig, nur annähernd erfassen. Mannigfaltigkeit der Lehrweisen ist deshalb eine notwendige Folge, auch kein Schade, eher ein Gewinn. Denn nur bei Freiheit zu solcher Mannigfaltigkeit kann der heilige Geist die Kirche „in alle Wahrheit leiten“, sie zu immer tieferer und reinerer Erkenntnis führen. Kurzsichtige und engherzige Dogmatiker aber wollten Meister vollkommener Erkenntnis sein und beanspruchten deshalb das Recht, alle anders denkenden zu verdammen. Daraus mußten dann immer und immer wieder Streitigkeiten und Spaltungen entstehen, wie die Kirchengeschichte von Anfang an bis auf diesen Tag uns zeigt, ganz zu schweigen von den schon erwähnten rohen, den Christennamen entehrenden Verfolgungen.
[14] Meinte die römisch-katholische Kirche dieser Zerteilung zu entgehen, indem sie erst ihre Concilien, dann die Päpste für unfehlbar erklärte, so nahm sie für diese in Anspruch, was selbst ein Paulus sich nicht anmaßte (12), auch ein Petrus nicht, der sich nach Gal. 2, 11-21 von Paulus zurechtweisen ließ. Sittlich-religiöse Wahrheiten lassen sich nicht durch äußere Autoritäten aufnötigen, sondern können sich nur durch sich selbst an Herz und Gewissen bezeuen und im Leben ergeben. „Meine Lehre ist nicht mein“, sagt Jesus nach Joh. 7, 16.17, „sondern des, der mich gesandt hat; so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selber rede“. Der Philosoph fichte drückt das so aus: „Zu dem was der heillige Mensch tut, lebt und liebt, erscheint Gott nicht mehr im Schatten und bedeckt mit einer Hülle [wie in dem verstandesmäßigen Denken und dem philosophischen Begriff], sondern in seinem eigenen unmittelbaren und künftigen Leben… Es ist dasjenige, was der ihm ergebene und von ihm begeisterte tut. Willst du Gott anschauen, wie er in sich selber ist, von Angesicht zu Angesicht? Suche ihn nicht jenseit der Wolken! Du kannst ihn allenthalben finden, wo du bist. Schau an das Leben seiner Ergebenen, und du schaust ihn an. Ergib dich selbst ihm, und du findest ihn in deiner Brust.“ Die Autoritäten müssen ja selbst erst die Berechtigung ihres Anspruchs erweisen, und sie können das auf diesem Gebiet auch nur durch den Wert dessen was sie sind und geben. Nicht auf allen Versammlungen der Bischöfe und Theologen herrschte der Geist des Heilandes; und auf dem römischen Stuhle saßen etliche, zu denen Jesus nicht sagen würde, was er nach Mtth. 16, 17-19; 18, 18 u. Joh. 20, 21-23 zu Petrus und den andern Aposteln gesagt, sondern was er Mtth. 7, 21-23 angekündigt hat: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! In das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Viele werden zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Nicht in deinem Namen viele Krafttaten getan? – Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!“
[15] Auch die Bibel kann ihre Autorität nur durch den Wert ihres Inhaltes erweisen, nicht durch ein vorweg aufgestelltes Dogma von ihrer Inspiration. (13) Freilich gibt es, wie eine künstlerische, so auch eine prophetische Inspiration, deren Gebiet das Sittlich-religiöse ist. Auch von dieser gilt – und zwar in besonderem Grade – das Wort Goethes: „Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende aperçu, jede Erfindung, jeder große Gedanke, der Früchte bringt und Folge hat, steht in niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben. Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat.“ Aber die Bibel ist ja nicht ein einheitliches Buch, sondern besteht aus zwei bzw. drei Sammlungen sehr verschiedenartiger Schriften: aus dem A. T., d. i. der Sammlung heiliger Schriften Israels, aus den ihm angefügten Apokryphen, einer kleinen Sammlung nicht allgemein anerkannter Schriften, und aus dem N. T., einer Sammlung derjenigen christlichen Schriften, die der alten Kirche die wertvollsten waren. Die Verfasser der einzelnen Schriften kennen wir nur zum Teil, und diejenigen, deren Namen wir kennen, sind zum Teil Männer, von denen wir sonst wenig wissen. So kann nur der Wert des Inhaltes über den Anspruch der einzelnen Schriften auf Geltung entscheiden. Und an dem Höchsten, das in ihrer Gesamtheit enthalten ist, muß das übrige gemessen werden. Deshalb hatte Luther recht, wenn ihm die Bibel „Gottes Wort“ war, weil und soweit sie „Christum treibt“, und ihm, nein schon der alten Kirche, nicht alle Schriften gleich hoch standen. Die stets auf den Kern, auf das Wesentliche dringende und deshalb so freie und sichere Stellung Jesu zu den Schriften des A. T. Ist bereits angedeutet.
Ein lehrreiches Beispiel dafür, wie weit die Dogmatiker sich von Jesus und Paulus entfernen konnten, ist das sog. Symbolum Athanasianum (das aber nicht von dem 373 verstorbenen Athanasius verfaßt, sondern erst viel später im Abendland aufgetreten ist). Es beginnt: „Wer da selig werden will, der muß vor allen Dingen den rechten christlichen Glauben haben. Wer denselben nicht ganz und reine hält, der wird ohne Zweifel ewig verloren sein. Das ist aber der rechte christliche Glaube, daß wir…“ Nun folgen 41 Sätze, von denen 35 rein verstandesmäßige, haarspaltende und doch nur Widersprüche unvermittelt hinstellende Definitionen über die Trinität und die zwei Naturen in Christo [16] sind. (14) Deren Anerkennung, die natürlich auch nur eine rein verstandesmäßige Aneignung bzw. blinde Unterwerfung sein kann, heißt hier „Glaube“, ja „der rechte christliche Glaube“! und von ihr soll die ewige Seligkeit abhängen! Was würde Jesus dazu sagen? Wohl dasselbe, was er Mtth. 23 von den Schriftgelehrten und Pharisäern sagte: „Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie selbst aber wollen sie nicht mit einem Finger regen… Weh euch, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, lasset ihr nicht hineingehen.“ Die römisch-katholische Dogmatik behandelt auch jetzt noch den Glauben als eine Sache des Verstandes, ein Fürwahrhalten der kirchlichen Satzungen, die naiver Weise mit der lebensvollen Gottesoffenbarung gleichgesetzt werden. Aber wie 1. Kor. 13, so ist auch 1. Joh. 4, 16 ausdrücklich „erkennen“ und „glauben“ unterschieden. Da beider Gegenstand die göttliche Liebe ist, so ist auch das Erkennen hier nicht das Begreifen einer Lehre oder deren Annahme auf Autorität hin, sondern ein Aufmerken und Erfassen mit dem unmittelbaren sittlichen Gefühl, und das Glauben ist die vertrauende Hingabe. Luther schrieb einmal kurz und bündig: „An Gott glauben heißt Gott vertrauen.“ Er hat zwar nicht immer die Konsequenzen dieser treffenden Erklärung gezogen; aber seine Grundauffassung ist es immer geblieben , daß der christliche Glaube die durch Christus uns geschenkte gewisse Zuversicht zu Gottes Macht und Gnade sei. Seine Nachfolger haben oft noch weniger folgerichtig zu handeln verstanden, wie ihr Verhalten in den Lehrstreitigkeiten zeigt. Sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, daß jenes symbolum, eine solche unevangelische Verkehrung des Glaubensbegriffs, auch in einigen alten protestantischen Liturgien verwendet, in das Konkordienbuch von 1580 aufgenommen und sogar noch 1865 von dem Lutheraner Schöberlein in seinem „Schatz des liturgischen Chor- und Gemeindegesangs“ abgedruckt wurde. Man hielt nämlich (daraus erklärt sich das Verfahren) dieses symbolum für ein ökumenisches d. h. In der ganzen Christenheit gebräuchliches. Aber das war ein Irrtum: die griechisch-katholische und alle östlichen Kirchen haben es nicht; was übrigens auch von dem sog. Apostolicum gilt, das eine spätere abendländische Erweiterung [17] eines etwas kürzeren römischen Taufbekenntnisses ist. (15)
Der denkende Christ hat das Bedürfnis, seines Glaubens sich auch klar bewußt zu werden. Deshalb ist ihm auch die Erkenntnis wert, und hat die Kirche von Anfang an die Lehre nicht vernachlässigt (ApG. 2, 42; Kol. 3, 16). Und Paulus zählt auch die Erkenntnis und Lehre zu den mancherlei Gottesgaben, nach denen die Korinther streben sollen. Aber er macht einen Unterschied: Höher als das Reden in Verzückung („in Zungen“) stellt er die Erkenntnis und Lehre, höher als diese das Weissagen d. i. das kraftvolle begeisterte Zeugnis. Wesentlich zum Christsein aber gehören für ihn nicht diese Gaben, sondern das durch Jesus Christus der Menschheit geschenkte neue geheiligte Leben in dankbarem, demütigem, tapferem Gottvertrauen, das auch für die Zukunft eine Hoffnung hat, und in tatkräftiger, opferwilliger, versöhnlicher Bruderliebe (1. Kor. 12-14; vgl. Kap. 1 u. 2 und Eph. 3, 14-19; Gal. 5, 6; 6, 15). Denn „das Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf“ (1. Kor. 8, 1).
Wie in allen Lebensäußerungen der Kirche, so müssen wir auch im N. T. (Paulus gibt uns ja selbst dazu die Aufforderung) das vergängliche Stückwerk von den bleibenden Werten, die zeitgeschichtlichen Formen von dem wesentlichen Gehalt unterscheiden. Zu solchen wandelbaren Formen gehört z. B. die Art der Beweisführung bei Paulus, die zuweilen, wie Gal. 3, 16, an die jüdische Scholastik erinnert, oder, wie 1. Kor. 9, 9-10 u. Gal. 4, 21ff, die damals beliebte Allegorie verwendet, was er selbst hier anmerkt (Gal. 4, 24 lautet wörtlich übersetzt: „das ist allegorisch“, hat einen anderen, tieferen Sinn). Solche Umdeutung erscheint uns doch heute allzu künstlich und willkürlich. Allzu kühn und unvermittelt oder kindlich unbefangen erscheint den historisch Denkenden auch manchmal die Art, wie im N. T. Stellen aus dem A. T. als unmittelbare Weissagung auf Christus gedeutet werden; deshalb bleibt es doch wahr, daß das Gesetz der „Zuchtmeister auf Christum“, der Erzieher und Vorbereiter für Christus gewesen ist und noch sein kann, und daß in Jesus Christus alle Gottesverheißungen ihr Ja, ihre rechte Erfüllung gefunden haben (Gal. 3, 24; 2. Kor. 1, 20). – Um den Zeitgenossen das Christentum nahe zu bringen, ihnen einen Anknüpfungspunkt zu geben, sind auch Ideen der damaligen Religionsphilosophie im N. T. verwertet. Ähnlich wie im A. T. und in den Apokryphen „die Weisheit“ als ein selbständiges, aus Gott uranfänglich hervorgegangenes schöpferisches Wesen geschildert wird (Spr. Sal. 8, 22ff; Weish. Sal. 7, 21 – 8, 9; 9, 9; Jes. Sirach 24, 1-14), was man dort als poetische Personifikation ansehen kann: so wurde in der alten Philosophie „der Lógos“ d. h. „das Wort“ oder die sich im Worte offenbarende göttliche Vernunft personifiziert, wie ein selbständiges Wesen neben Gott, eine Art Untergott, aber als der eigentliche Weltschöpfer [18] betrachtet. 1. Mos. 1 ist es dagegen Gott selbst, sein Schöpfergeist, der im Worte sich auswirkt. Bei Johannes und bei Paulus, der zwar den Namen nicht gebraucht, aber von „dem Herrn“ das gleiche aussagt, wird nun die Idee von dem schöpferischen Worte auf Jesus Christus übertragen, das ewige schaffende Wort als in ihm persönlich, leibhaftig erschienen angesehen (Ev. Joh. 1, 1-18; 1. Joh. 1, 1-4; 1. Kor. 8, 6; Kol. 1, 15-17; auch Hebr. 1, 1-3), aber zugleich betont, daß nur ein Gott ist (Joh. 17, 3; 1. Kor. 12, 6; Eph. 4, 6) und Jesus, der geliebte, rechte Gottessohn, ihm untertan, ein Mensch und Menschensohn, auch menschlichen Schranken, Leiden und Versuchungen unterworfen (Joh. 14, 12.28; 4, 34; 5, 19; 1. Kor. 11, 3; 15, 28; Röm. 1, 3; 1. Tim. 2, 5) (16), aber als der Menschensohn doch der erhoffte Messias, der König des Gottesreiches ist (Joh. 5, 27; Mrk. 14, 61.62 nach Dan. 7, 13.14) und es sein kann, weil er Gottes eingeborner (genauer übersetzt: einziggeborener) Sohn ist (Ev. Joh. 1, 14; 3, 16; 1. Joh. 4, 9) d. h. In einziger, vollkommner Art das ist, was alle, die ihna ls ihren Führer und Retter annehmen, werden sollen: aus seinem heiligen Geiste wiedergeboren und damit „aus Gott geborne“ Kinder des himmlischen Vaters (Ev. Joh. 1, 12.13; 3, 3-8; 1. Joh. 3, 1; 4, 12.13; 5, 1.4; Röm. 8, 9.14-16; Gal. 4, 6). Man wollte den Philosophenjüngern zeigen: Was ihr an eurer „das Wort“ oder „die Weisheit“ genannten Gottesoffenbarung zu haben meint, das haben wir vollkommener in unserer mit Jesus Christus uns geschenkten Offenbarung. Der ist nicht ein Untergott; sondern der eine wahre Gott selbst hat sich in ihm uns offenbart. Und unser Gott ist nicht bloß die den Kosmos erschaffende und durchwirkende Allmacht und Weisheit, sondern auch die uns Menschen von den niederen Elementen dieser Welt emporziehende Heiligkeit und Liebe, die läuternde (sittliche) Wahrheit und die erlösende (vergebende und helfende) Gnade, „Licht“ und „Leben“ zugleich – als solcher ist er uns nicht bloß verkündigt von Jesus (wie etwa auch von den Psalmsängern und Propheten Israels), sondern in „dem Menschensohn“ persönlich, menschlich anschaulich nahe getreten. In diesem Sinn, als persönliche Offenbarung göttlichens Wesens, göttlicher Heiligkeit und Liebe in Jesus Christus, ist die Idee vom Logos mit dem Christentum vereinbar, trifft sie sogar seinen Mittelpunkt. Wenn in Anlehnung an sie Johannes „das Wort“ und Paulus „den Herrn“ zugleich als Mittler der Weltschöpfung hinstellen, so erklärt sich dies daraus, daß sie mit diesen Namen die Offenbarung des göttlichen Geistes bezeichnen (wie ja Paulus 2. Kor. 3, 17.18 geradezu „den Herrn“ und „den Geist“ gleichsetzt) und daß es derselbe eine Gottesgeist ist, der in der Weltschöpfung und in Jesus Christus wirksam ist. Solche Schlußfolgerung ist freilich schon Theologie, geht über das schlichte Evangelium hinaus, ist aber, richtig verstanden, noch mit ihm vereinbar. Dagegen ist die [19] ursprüngliche philosophische Form der Logosidee abzulehnen, wie wir auch die verschiedenen weiteren Folgerungen, welche die Grübler und Dogmatiker innerhalb und außerhalb der kirchlichen Orthodoxie aus ihrer Anwendung auf Christus gezogen haben (z. B. die Theorien von den zwei Naturen und ihrem Verhältnis zu einander, und die von einem Scheinleib u. dergl. m.) beiseite lassen. (17) – Die Idee vom Logos schließt auch den Gedanken seiner vorweltlichen Existenz ein. Wie ein Kunstwerk, ein Bild, im Geiste des Künstlers lebt, ehe er es für die Sinne wahrnehmbar darstellt, so hat auch das Urbild der Schöpfung zuvor in Gott gelebt. Eine solche, wenn nicht vorweltlich, so doch vorirdische Existenz wurde in jüdischen, besondern in apokalyptischen Schriften auch im Einzelnen von hervorragenden Personen und Dingen ausgesagt: u. a. von den Erzvätern, dem Gesetz, dem Tempel, dem Jerusalem der Endzeit und (unter Berufung auf Dan. 7, 13; Mich. 5, 1; Jes. 9, 5.6; Ps. 72, 17) von dem erhofften Messias. Dieser Gedanke ist also nicht erst aus dem Christentum erwachsen, sondern bei den Christen als etwas bekanntes vorausgesetzt, nur jetzt übertragen auf ihren „Gesalbten“, Jesus Christus (Phil. 2, 6; Joh. 1, 1.2; 8, 58; 17, 5); und ihr neues, oberes, himmlisches Jerusalem (Offb. 21, 2; vgl. Gal. 4, 26; Hebr. 12, 22); er befriedigt auch mehr das grübelnde Nachsinnen über das göttliche Geheimnis der Person Jesu, als die Gewissensfrage nach dem Frieden mit Gott und der rechten Bewährung des Christen. Aber Paulus wie Johannes würden mit uns einstimmen in das Hohelied v. Zinzendorfs:
welche Tiefen reicher Gnad,
daß wir dem in Herze sehen,
der das Herz der Liebe hat!
Daß der Vater aller Geister,
der der Wunder Abgrund ist,
daß du, unsichtbarer Meister,
uns so sichtbar nahe bist!
Laß uns so vereinigt werden,
wie du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erden
kein getrenntes Glied mehr ist!
Und allein von deinem Brennen
nehme unser Licht den Schein!
Also wird die Welt erkennen,
daß wir deine Boten sein.
Gott hat sich uns Menschen durch Menschen offenbart. Die Propheten haben Gottes Wege und Willen ihrem Volke gedeutet. Jesus hat mehr getan: er hat die heilige Liebe nicht bloß gelehrt, sondern auch in seiner Person, seinem Leben und Wirken, Tun und Leiden abgebildet. Und seine Apostel haben ihm darin nachgestrebt, den Gemeinden zum Vorbild. So kann Paulus schreiben: „Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, daß aufleuchte (durch uns) die Erkenntnis von der Herrlichkeit [20] Gottes im Angesichte Jesu Christi“ (2. Kor. 4, 6), und kann er die Christen ermahnen, ihn nachzuahmen, wie er Christo (1. Kor. 11, 1). Darum sind nun die Gottesoffenbarungen verknüpft mit äußeren Begebenheiten, menschlichen Erlebnissen, Zeitereignissen. Wir haben die himmlischen Schätze in irdischen Gefäßen, die göttlichen Wesensoffenbarungen in menschlichen Gestalten. Ohne dieses Kleid, diese Erscheinungsformen, diese Wirklichkeitsbilder können sie uns nicht nahe, würden sie uns nicht lebendig, würden sie Herz und Gewissen nicht rühren. Aber die Form ist nicht das Wesen, das sinnlich wahrnehmbare ist nicht der geistige Gehalt. Der Glaube an Jesus Christus ist etwas ganz anderes als das Fürwahrhalten der Berichte von den äußeren Begebenheiten seines Lebens, einschließlich der außerordentlichen, wunderbaren. Dazu kommt, daß die dankbare Verehrung der Menschen stets ihre Führer und Retter mit ihrer Phantasie umgibt, deren Leben gerne sich ausmalt, mit Lebenden schmückt. Diese sind oft nur ein willkürliches Spiel der Phantasie, wovon die vielen Heiligenlegenden und die wohl wenig bekannten Neutestamentlichen Apokryphen Beispiele bieten, oft aber auch Einkleidung eines tiefen Gedankens, hierin den Gleichniserzählungen ähnlich. Am leichtesten erkennen wir das an den Geschichten im 1. Buch Moses. Kap. 18 z. B. will uns die große Güte, Geduld und Langmut Gottes veranschaulichen; wenn es dies in der Form eines Gespräches zwischen Gott und Abraham tut, Gott aber in Gestalt eines Wanderers auftreten läßt, der sogar Gebäck und Braten, Dickmilch und Süßmilch bei Abraham und Sarah speist, so stünde das, wenn wir die Erzählung buchstäblich nehmen wollten, in schroffem Widerspruch zu der schriftlichen Erkenntnis, daß Gott Geist ist, von niemand je gesehen (Ev. Joh. 1, 18; 4, 24; 1. Joh. 4, 12; 1. Tim. 1, 17). – Wie viel Mühe hat dogmatisch befangene Bibelverehrung sich gegeben, die Schöpfungsgeschichte 1. Mos. 1 mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dem heutigen Weltbilde in Einklang zu bringen – ganz vergeblich! Nicht Naturwissenschaft haben wir hier zu suchen, sondern ein von der unmittelbaren Anschauung ausgehendes Lobgedicht auf die Herrlichkeit des Schöpfers und seiner Werke, dem 104. und 8. Psalm vergleichbar.
Auch im N. T. noch müssen wir zuweilen durch die poetische Hülle vordringen zu ihrem religiösen Gehalt. Auf die Versuchungsgeschichte (Mtth. 4) [21] ist schon hingewiesen, und gezeigt, wie das als äußere Begebenheiten geschilderte hier als inneres Erleben Jesu verständlich und für die Ziele seines Wirkens bedeutungsvoll wird. Sie schließt sich folgerichtig an die Taufe Jesu an (Mark. 1, 9-11; Mtth. 3, 13-17). Denn bei dieser ist ihm durch eine innere Schau und Stimme, die auch dort in die Form äußerer Erscheinungen gekleidet ist, die Gewißheit seines Heilandsberufes geworden, die Gewißheit, daß er mehr zu geben hatte als der Bußprediger Johannes, daß in ihm sich die Weissagungen Jes. 11, 1-3; 42, 1-7 erfüllen sollten. Vorbereitet war das durch die von Jugend auf gepflegte fromme Versenkung in die heiligen Schriften seines Volkes. Da hatte sein tiefer, reicher Geist und sein starkes, reines Wollen die echten bleibenden Werte erkannt, das Gold aus den Schlacken geschieden und auf dieser Grundlage das neue hohe Ideal vom Gottesreiche aufgebaut, hinter dem die herrschende Schriftgelehrsamkeit und Frömmigkeitsübung so weit zurückblieben. Jetzt brach – das bedeuten die Vorgänge bei der Taufe – die Erkenntnis, wozu er berufen war, vollends durch und zugleich der Entschluß, dem inneren Rufe zu folgen. Den festen Willen, dem erkannten Ideale die Treue zu halten, sich durch die falschen weltlichen Ziele und Hoffnungen der Menge und ihrer Führer nicht beirren zu lassen, bekundet danach die Versuchungsgeschichte. – Ein andersartiges Beispiel bieten die zart poetische Erzählung Luk. 1, 26-38 und die mehr lehrhaft nüchterne Mtth. 1, 18-25 (18), in die der wahre Gedanke eingekleidet ist, daß die Gottesoffenbarung, die wir an Jesus haben, nicht aus der natürlichen Menschheitsentwicklung erklärbar ist, sondern nur aus besonderer Wirkung des Gottesgeistes. In der griechisch- und römisch-katholischen Kirche hat die Erzählung bekanntlich – trotz (!) Mrk. 3, 21.31-35; 6, 3; Luk. 11, 27.28; Joh. 2, 4 – die Erhebung der Maria zur jungfräulichen Himmelskönigin und „Mutter Gottes“ und die Übertragung des im N. T. für Jesus geforderten Vertrauens auf seine Mutter veranlaßt. Da aber durch diese, wenn sie von sündhaften Eltern erzeugt war, die Sündlosigkeit Jesu nicht genügend verbürgt erschien, ging die mittelalterliche Phantasie einen Schritt weiter und übertrug in der Behauptung der unbefleckten Empfängnis der Maria das Wunder auch auf deren Mutter; und Papst Pius IX. erhob 1854 diese Legende, obgleich sie auch von katholischen Dogmatikern, besonders den Dominikaner, bestritten war, zum Glaubenssatz. Die vermeintliche Bürgschaft blieb aber unzulänglich, wenn sie sich zugleich auf alle früheren Ahnen ausgedehnt wurde, was denn doch unmöglich war. Da zeigt sich die Unhaltbarkeit dieser ganzen Anschauung. Die natürliche Art der Zeugung des Menschen ist an sich nicht unheilig, nicht sündhaft, sondern eine zur Fortpflanzung notwendige Ordnung des Schöpfers; hindert auch nicht das Wirken des heiligenden Gottesgeistes, wie das Beispiel der Propheten und Apostel zeigt; wobei wir nicht vergessen, daß es [22] in Jesus ein besonderes, ein höchstes Maß erreicht hat (vgl. Apg. 10, 38; Joh. 3, 34 „nicht nach Maß“ d. h. ohne Maß, reichlich, in Fülle). Sündhaft ist dagegen der Mißbrauch des Geschlechtstriebes, der Mißbrauch der Freiheit, die dem Menschen gegeben ist und ihn zu Besonnenheit und Selbstbeherrschung verpflichtet, während das Tier durch die Naturtriebe angetrieben und zugleich in Schranken gehalten wird. – Einige Wundergeschichten können wir auf unser Leben nur anwenden, wenn wir sie sinnbildlich verstehen, weil wir sie, wörtlich genommen, nie erleben. Der Evangelist Johannes leitet selbst dazu an, wie er überhaupt freier verfährt, sich nicht, wie meistens die anderen Evangelisten, wörtlich an die Überlieferung hält, sondern in seinem, ihm eigentümlichen Stile erzählt, auch die Reden in dieser Weise, aber aus christlichem Geiste heraus, frei ausführt. Das Wunder von der Verwandlung des Wassers in Wein z. B. ist mit den Barmherzigkeitswerken Jesu nicht gleichzustellen. (19) Es müßte als ein in die Apokryphen gehörendes Zauberstück erscheinen, wenn der Erzähler Joh. 2, 6 nicht andeutete, daß er dieses Wunder sinnbildlich verstanden wissen will: daß er nämlich Jesus feiern will als den, der das schale Wasser jüdischer Gesetzlichkeit in den Feuerwein heiligen Geistes verwandelt hat (vgl. Joh. 1, 33; Luk. 3, 16). – Nach der Erzählung von der Speisung der 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen und von den 12 Körben übrig gebliebener Brocken leitet der Evangelist Joh. 6, 27ff noch deutlicher die Gedanken auf das geistige Leben: auf die Speise, die nicht vergänglich ist, auf den, der selber das Brot des Lebens ist, sich selbst uns zur Speise gibt (hiermit deutlich auf die Abendmahlsfeier hinweisend), was dann 6, 63 noch ausdrücklich geistig gedeutet wird: „der Geist ists, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben“ (vgl. 2. Kor. 3, 6).
Das Weltall ist voll der Wunder; seine bloße Existenz das größte Wunder. Alles Leben, von den geringsten Geschöpfen an bis hinauf zu den am reichsten ausgestalteten, wir selbst nicht am wenigsten, sind und bleiben uns ein unerklärtes Rätsel. Wie sollte es mit der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden und mit dem Höchsten, das wir hier kennen, der Erscheinung Jesu Christi, anders sein? – Aber es ist kindliche Einfalt und mehr als das, es ist Verkennung des eigentlichen Wesens des Christentums, wenn eifernde Christen die Gläubigkeit ihrer Mitchristen danach bemessen wollen, ob sie alle biblischen Geschichten, insbesondere alle Wundergeschichten, oder gar alle Heiligenlegenden buchstäblich für historische Berichte halten. Die jüdischen Schriftgelehrten waren, gleich der Heidenwelt, wundergläubig, ja wundersüchtig, forderten von Jesus noch erstaunlichere Zeichen als er tat, und waren doch seine Feinde; vgl. [23] Luk. 11, 29; 10, 20; Joh. 4, 48; 1. Kor. 1, 22; 13, 2; Mtth. 7, 22.23. Die Berichte von dem äußeren Leben Jesu sind nur insoweit für uns wertvoll, als sie uns seine innere Hoheit erkennen lassen. Paulus hat den Juden und Heiden, die ihn hören wollten, Jesus Christus als Gekreuzigten wie vor Augen gemalt (Gal. 3, 1); aber darauf kommt es ihm an, daß Gott in diesem Sterben des Heilandes seine Liebe gegen uns, obwohl wir noch Sünder waren, erwiesen hat, und daß diese Liebe nun auch in unser Herz ausgegossen wird, wodurch ein neuer Geist, heiliger Geist in uns mächtig wird, wir neue Menschen werden (Röm. 5, 5.8; Gal. 2, 19.20). Seine Mitchristen und Mitarbeiter will der Apostel deshalb nicht mehr „nach dem Fleisch“, nach ihrem natürlichen, äußeren Wesen und Wert beurteilen, sondern danach, ob sie dem Herrn und nicht sich selbst leben. Er hat wohl auch Christus einst gekannt „nach dem Fleisch“, aber so kennt er ihn „jetzt nicht mehr“, das kommt für ihn nicht mehr in Betracht, seit er sein inneres Leben, die Offenbarung göttlichen Wesens in ihm erkannt hat (2. Kor. 5, 14-19 vgl. Luk. 13, 26.27). An diesem Maßstab gemessen, erscheinen auch die kirchlichen Bekenntnisschriften oft als zu oberflächlich, sofern sie vorwiegend nur Anerkennung von Begriffsbestimmungen oder Fürwahrhalten äußerer Geschehnisse fordern. Nicht die rechte Erkenntnis, noch das rechte Wissen macht den rechten Christen, sondern die Bestätigung aufrichtiger christlicher Gesinnung.
„Feuer entzündet sich an Feuer, leben an Leben.“ Das gilt erst recht vom Christenleben. Das Wort, die Predigt, ist nur dann Leben werkend, wenn sie aus Leben geboren, von echter Begeisterung getragen ist. Weil man eben dieses an ihnen spürt, sind die Schriften des N. T. und manche Stücke des A. T. so wirksam bis heute und werden es immer bleiben – trotz dem Vergänglichen in ihnen: dem Zeitgeschichtlichen, dem Legendenhaften und dem Erkenntnisstückwerk, das menschlicher Weise sich mit ihnen verknüpfen mußte. Wer nur immer den Kern in der Schale, das göttliche Leben in er menschlichen Form sucht, wird an dieser Türe nicht vergeblich anklopfen. Eine schwere Verantwortung aber laden diejenigen auf sich, die das vergängliche Stückwerk zu einem für alle verbindlichen göttlichen Gesetz machen und dadurch für viele die Türe verschließen.
[24] Daß „Christus Gestalt gewinne“ in ihnen, darum ringt der Apostel mit seinen Gemeinden, insbesondere mit denen, die in Gefahr standen, aus der inneren Freiheit des Evangeliums, dem freien Dienst der Liebe, in die Knechtschaft äußerer Gesetzlichkeit zurückzusinken (Gal. 4, 19). Und jeder, in welchem Christus Gestalt gewonnen hat, kann wieder anderen ein Führer zu Christus werden und damit zu einem Leben, das aus Gott ist, auch ohne daß er Missionar, Prediger oder Pfarrer ist. Das ist dann die wahre „apostolische Nachfolge“, eine bessere fürwahr als die der Bischöfe und Päpste, die auf ihr von der Hierarchie ihnen übertragenes Amt gepocht und auf ihre Priesterweihe wie auf eine Zauberformel sich verlassen haben, und daraufhin Seelenhirten oder auch Seelentyrannen zu sein beanspruchten, auch wenn sie vom Geiste Jesu Christi gänzlich verlassen waren.
III.
Jesus war kein Revolutionär. Er trieb zwar in heiligem Zorn die Schacherer und Wucherer aus dem Bethause; aber er forderte das Volk nicht auf, Tempel und Altar einzureißen, Priester und Hohepriester zu verjagen oder zu erschlagen. Wie er der vorhandenen Obrigkeit sich unterwarf, so auch dem noch bestehenden Tempeldienst. Er zahlt die Tempelsteuer (Mtth. 17, 24ff), obgleich er sich als den geliebten Sohn seines himmlischen Vaters fühlt und Kinder Gottes der priesterlichen Vermittelung nicht bedürfen. Er verbietet nicht die Opfergabe, aber erklärt sie für Heuchelwerk, wenn der Opfernde nicht bereit ist, sich mit seinem Nächsten zu versöhne, das an ihm begangene Unrecht gut zu machen oder ihm seine Schuld zu vergeben (Mtth. 5, 23-26; Mrk. 11, 25.26). Den geheilten Aussätzigen (Mrk. 1, 40-45) heißt er zum Priester gehen und die von Mose befohlene Gabe zu opfern, freilich mit dem Bemerken: „zu einem Zeugnis über sie“ – das will sagen: auch seine Gegner müßten, wenn sie ihrem Gewissen gehorchten, aus dieser wunderbaren Heilung seine göttliche Sendung erkennen und ihm folgen, womit sie allerdings ihr Priesteramt überflüssig machten. Das kommt noch schärfer zum Ausdruck, wenn Mtth. 9, 13 u. 12, 7 auf das Prophetenwort Hos. 6, 6 hingewiesen wird: [25] „Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ – Nicht durch gewaltsamen äußeren Umsturz konnte ein solches Gottesreich, wie Jesus es errichten wollte, sich verwirklichen; sondern, wie es innerlichster Art war, konnte es auch nur von innen heraus sich Bahn brechen. In die Herzen mußte es kommen. War es dort eingewurzelt, so würde es – das durfte Jesus wohl erwarten – durch die Kraft eigener Entwickelung auch die alten Formen sprengen; wie es denn auch geschehen ist.
Einen Priesterstand als privilegierten Mittler zwischen Gott und dem Volk, als alleinigen Verwalter von Gnadenmitteln, die das Seelenheil verbürgen, kennt das Evangelium nicht mehr. An seine Stelle setzt Jesus die freie väterliche Gnade Gottes und den freien Zugang jedes aufrichtigen Herzens zu ihr. Eine andere Bedingung stellt er nicht, als das innige Verlangen nach Befreiung von allem, was die Seele niederzieht, von Schuldgefühl und Sündendienst, das Hungern und Dürsten nach Kraft von oben zu einem reineren, höheren, edleren Leben, Mtth. 5, 6. Er verlangt nicht, daß man sich zuvor den Satzungen der Theologen oder den Zeremonien der Priester unterwerfe. Darin befindet sich Jesus in Übereinstimmung mit den Sehern und Sängern des alten Bundes: Ps. 50, 7-15; 51, 18.19; Jes. 57, 15.16; Mich. 6, 6-8 u. a. Und diese ehrliche Aufgeschlossenheit für das Göttliche findet er mehr bei den schlichten, kindlichen, gottgelassenen Gemütern, den Not- und Leidgeprüften, ja mehr bei denen, die das gemeine Urteil für die Verlorenen hält, als bei den Wohlhabenden, Wissens- und Tugendstolzen (Mtth. 5, 3-5; 11, 25; 18, 1-5; 19, 13-15; Luk. 14, 16-24). Denen wendet sich deshalb vornehmlich seine Liebe zu. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und verlorenen Sohn sagen es uns (Luk. 15). Dem Gelähmten belohnt er sein und seiner Träger Vertrauen und verkündet ihm offen und frei, unbekümmert um die emporte Amtsmiene der Schriftgelehrten: „Mein Sohn, deine Sünden sind vergeben!“ und befreit ihn, nachdem er ihm die Seele frei gemacht, auch von der körperlichen Fessel (Mark. 2, 1-12). Dem reuevollen Schächer am kreuz erfüllt er seine Bitte und verheißt ihm seine Gemeinschaft im Paradiese (Luk. 23, 39-43). Nicht das Gefallen am Niedrigen, Unheiligen zieht den Heiland zu den Verachteten, [26] wie die Pharisäer ihm unterschieben möchten, sondern die Barmherzigkeit, die Liebe, die helfen, aus der Niedrigkeit emporziehen, aus der Gottesferne heimführen möchte (Mtth. 9, 9-13).
Woher aber kam den Menschen das unerhörte Vertrauen zu Jesus, daß sie von ihm nicht bloß Heilung von allerlei körperlichen Leiden erwarteten, sondern auch ihr Seelenheil aus seinen Händen nahmen? – Ein Mensch kann vergeben, was an ihm selbst gesündigt ist; aber kann er vergeben, was an Gott gesündigt ist? – daß sie Jesus bereits für Gottes Sohn im Sinne von Luk. 1, 34. 35 u. Mtth. 1, 18-20 gehalten und daraus seine göttliche Vollmacht gefolgert hätten, wird nirgends angedeutet; ist auch nicht anzunehmen, da nach Mark. 3, 21 u. 31-35 selbst Jesu Mutter und Brüder ihn noch für einen überspannten Schwärmer hielten, der sich selbst in Unglück stürzen müßte. Ebenso wenig ist anzunehmen, daß jene schlichten, ungelehrten Leute die Logosidee von Anfang an auf Jesus übertragen hätten. Das konnte dicg azcg vib deb Jzbdugebm wue den Evangelisten Johannes und dem Apostel Paulus erst geschehen, nachdem ihnen die volle innere Größe Jesu aufgegangen war. Die ersten Krankenheilungen konnten wohl den Zulauf vieler anderer Kranker veranlassen, konnten auch für Wohlwollende eine Bestätigung seiner göttlichen Sendung sein; aber ein guter Arzt des Leibes braucht noch nicht ein guter Seelenarzt zu sein. Und letzteres zu sein, hielt Jesus doch für seinen eigentlichen Beruf: s. Mrk. 1, 38; 2, 5.17. Vollzogen sich doch auch die leiblichen Heilungen vornehmlich von innen heraus, durch Erzeugung seelischer Kräfte in den Leidenden, und blieben deshalb aus, wo der Glaube fehlte (Mrk. 6, 1-6; vgl. Apg. 3, 16). Endlich konnte der gewaltige Eindruck der Reden Jesu viele Hörer ihm zuführen. Aber die Bewunderung für einen geistesmächtigen Prediger ist noch nicht das sich hingebende Vertrauen zum Heiland.
Wir müssen nach einem tieferen, inneren Grunde für das Vertrauen suchen. Die in der Seele Jesu zu lesen verstanden, mußten bald erkennen, daß sein tiefes Mitgefühl, sein brennendes Verlangen zu helfen die Triebkraft alles seines Wirkens war. [27] Aber wenn aus Mitleid etwa ein Zöllner zu dem anderen, eine Sünderin zu der anderen gesagt hätte: „Dir sind deine Sünden vergeben“ – würde es Glauben gefunden haben? würde es die gequälten Gewissen getröstet haben? Würde ein solches Wort aus unheiligem Munde nicht mit Recht als eine Lästerung empfunden sein? – Aber wenn solches Wort von einem gesprochen wurde, der es mit der Sünde so ernst, so tief ernst nahm wie niemand sonst, der bis ins Innerste der Herzen drang mit seiner Forderung der Reinheit, dem auch seine bittersten Feinde keine Sünder nachweisen konnten, und der dennoch, weil er „versucht war allenthalben gleichwie wir“, in Demut bekannte: „Niemand ist gut denn der einige Gott“ – wenn der ihnen vergab, so durften sie es glauben, daß auch Gott ihnen vergab, denn die Liebe, die sich hier ihrer erbarmte, war nicht das weichliche, oberflächliche, unfromme Mitleid, das gerne ein Auge zudrückt, sondern heiligste Liebe, göttliches Erbarmen. In ihm sahen sie das Ideal verkörpert, welches Israel als Volk sein sollte, aber nie gewesen war (2. Mos. 19, 6; 3. Mos. 19, 2; Dan. 7, 18), sahen sie nun „den Heiligen des Höchsten“ (Mrk. 1, 24; auch Joh. 6, 68.69 nach der besseren Lesart), und den erwählten, geliebten, barmherzigen Gottesknecht, der, göttlichen Geistes voll, auch den glimmenden Docht noch zu heiligem Feuer anfachen und selbst den Heiden zu einem Lichte werden sollte (Jes. 42, 1-7; Mtth. 12, 17-20; vgl. Luk. 4, 16-21).
Von dieser Anerkennung Jesu, diesem Vertrauen zu ihm, war es nur noch ein Schritt bis zu der Erkenntnis, daß in ihm auch „der Christus“, der „Messias“, der ersehnte König des wahren Gottesreiches auf Erden ihnen geschenkt war: Mrk. 8, 29.30. Freilich nur denen konnte er es sein, die seine innere Heiligkeit erkannt hatten und für ein anderes Reich sich erziehen ließen, als es die Masse des Volkes und seine bisherigen Führer erwarteten. Wegen dieser falschen Erwartungen vom Messias mußte Jesus vorerst seinen Jüngern verbieten, ihn mit diesem Namen zu nennen. Der Name bezeichnet ja ursprünglich „den Gesalbten“, nämlich den mit heiligem Öl zum Könige Israels gesalbten (s. 1. Sam. 10, 1; 16, 13 die Salbung Sauls und Davids durch Samuel). [28] Er wird dann übertragen auf den Jes. 9, 5-6; 11, 1-10; jer. 23, 5-6; Sach. 9, 9-10 verheißenen König der Endzeit, den mit göttlichem Gesite, Weisheit und Wunderkraft ausgerüsteten, frommen, gerechten, großen Friedensfürsten (vgl. ApG. 10, 36-38). Mit diesem Königsbilde vereinigt sich nun das Bild des barmherzigen Gottesknechtes aus Jesaia 42.
Das Reich dieses Königs, „das Himmelreich“ oder (was dasselbe ist) „das Gottesreich“, wie es Jesus versteht, verkündigt und anstrebt, „kommt nicht mit äußerlichen Geberden“ (Luk. 17, 20.21) und kann seiner Natur nach nicht mit äußerer Gewalt und niht sofort und überall sich verwirklichen; seine Vollendung liegt in der Zukunft, und niemand kann Zeit und Stunde nennen, auch Jesus nicht. Aber es hat inzwischen bereits seinen Anfang genommen. Es ist da, wo der gute Same des Evangeliums aufgegangen ist und Früchte gebracht hat (Mtth. 13, 23.38), wo Gottes Geist die bösen Geister austreibt (12, 28), die Menschenherzen erneuert (Joh. 3, 3-8), wo „Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist“ bei den Menschen wohnt (Röm. 14, 17 vgl. Gal. 5 u. 6). Zum Reich dieses Christus gehören bereits diejenigen alle, die er nach Mtth. 5, 3-10 selig preist.
Hatte ferner die Prophetie des Alten Bundes verkündet, daß Gott selbst, „der Herr“ (wie die Juden aus Scheu vor dem heiligen Namen statt „Jahwe (Jehova)“ lasen) kommen werde zur Errettung seines Volkes und zum Heile der Menschheit (3. Mos. 26, 11.12; Jes. 35, 4; 60, 1-3; Zeph. 3, 14-17) und war Jesus der Retter, der Heiland, so war in ihm auch Jahwe, der Herr, gekommen (Joh. 12, 44.45; 14, 6ff; 17, 20-23; 2. Kor. 5, 19; 6, 16; Kol. 2, 9); und es konnte nicht fehlen, daß seine Erlösten ihn selbst in diesem Sinne ihren Herrn, „den Herrn“ nannten (Joh. 20, 2.13.20,28; 21, 7; ApG. 2, 36; 9, 10.11; 1. Thess. 1, 1; Phil. 2, 11; 1. Kor. 1, 31 u. a.). Dieser Name, der sonst nur das menschliche Verhältnis des Höherstehenden und Gebietenden zu dem dienenden und gehorchenden oder des Meisters oder Lehrers zu dem Schüler bezeichnet oder allgemeiner nur ein Ausdruck der Achtung und Ehrfurcht ist, auch in dieser Bedeutung in den Evangelien noch öfters gebraucht wird, erhält nun, auf Christus angewandet, die Bedeutung der Gottesoffenbarung, und wird daher von Paulus in demselben Sinn gebraucht, wie in den Johannes-Schriften „das Wort“, der Logos. „Jesus ist der Herr“ – das heißt [29] nun: er ist die wahre, die rechte, die vollkommene Gottesoffenbarung, wie „Jesus ist der Christus“ bedeutet: er ist der rechte König, der rechte Führer des Gottesreiches auf Erden. Und Paulus kann sogar sagen: „Der Herr ist der Geist“, denn der heilige Gottesgeist, der aus ihm spricht und durch ihn wirkt, macht ihn zum Ebenbilde des himmlischen Vaters und soll auch die Seinen immer mehr in dasselbe Bild verklären (2. Kor. 4, 3-6; 3, 17.18). Für die Heidenchristen aber tritt nun Jesus Christus als der wahre Herr und Heiland, als die wirkliche und persönliche, die reinste und höchste Gottesoffenbarung an die Stelle der vielen Herren und Heilande und Göttersöhne, die sie bis dahin überall: in ihren „sogenannten Göttern“, den personifizierten Naturkräften, in ihren Herren, Weisen und Zauberern und sogar in den sehr unheiligen römischen Kaisern gesucht hatten (1. Kor. 8, 4-6; Eph. 4, 5.6).
Daß die stets wankelmütige Menge ihm nicht treu bleiben würde, die Hohenpriester aber und die Schriftgelehrten, Sadduzäer und Pharisäer, deren Ehrgeiz, Herrschsucht und Hochmut er die Ziele verrückte, ihm immer feindlicher wurden, mußte er nur zu bald erkennen. Mrk. 2, 18ff. 23ff; 3, 1-6.22-30; 6, 1-6; 7, 1ff; 8, 11-13. Ähnlich wie schon die Prophetie des A. T. erkennen mußte, daß Israel als Volk, als Ganzes, der Verstockung und dem Gericht anheimfiel und nur ein edler Rest den Beruf einer Gottesgemeinde erfüllen würde (Mich. 5, 6; Jes. 10, 20-22), so heißt es auch jetzt wieder: „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“ (Mtth. 22, 14). Auf das Bekenntnis der Jünger, das in ihrem Namen der immer rasche, entschlossene Petrus, zumeist ihr Wortführer, ablegte, sprach sich Jesus nun, damit sie nicht eitlen Träumen sich hingaben, offen über das Ende aus, das er deutlich kommen sah: Verworfen werden von den Maßgebenden des Volks, Leiden und Sterben – obwohl nur als Durchgang zum Leben des Auferstandenen zu desto größerem Wirken im Geiste. Mit dem Königsbilde vereinigt sich für ihn nicht bloß das Bild des barmherzigen Gottesknechtes, sondern auch das Bild des leidenden Gottesknechtes aus Jes. 50, 4-9 und 52, 13 – 53, 12. Ihm war es gewiß geworden, daß der Christus nur durch Leiden zu seinem herrlichen Ziele gelangen, die Menschen für den Glauben an die selbstlose Liebe gewinnen konnte (vgl. Luk. 24, 25-27; Hebr. 2, 10).
[30] Daß dieser Weg der Weg Gottes sein sollte, faßten auch die Jünger noch nicht. Ihren Versuch aber, ihm zu wehren, weist Jesus als eine Versuchung des Satans zurück. Die Heftigkeit, mit der er es tut, zeigt, daß es für ihn wirklich eine Versuchung war. Mrk. 8, 31-38. Und er fügt hinzu: „Wer sein Leben behalten will, der wird’s verlieren… Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden?“ – Für Jesus aber galt es nicht bloß, seine eigene Seele, seinen eigenen Gottesfrieden zu wahren. Wenn er, um dem tödlichen Hasse auszuweichen, die Erkenntnis und Gnade, die ihm gegeben war, und den Beruf, sein Evangelium in Wort und Tat zu verkünden, verleugnete, so verloren auch die Seinen, vielmehr: verlor die Menschheit das Heil, dessen sie bedürfte, die Befreiung aus der Knechtschaft des eitlen Zieles, der Menschensatzung und der Priestergewalt, die Erlösung aus Sündennot, Todesangst und Teufelsfurcht. War er wirklich der gute Hirte und kein ungetreuer Mietling, so durfte er nicht bloß im Frieden seine Schafe weiden wollen, sondern mußte auch sein Lben für sie einsetzen, wenn die Wölfe in die Heerde brachen (Joh. 10, 12-16). Die Liebe, die er lebte und verkündete, mußte sich bewähren in der Treue bis zum Tode. Dann erst konnte die ganze Größe dieser Liebe erkannt werden und vieler Menschen Herzen überwinden. Das Weizenkorn mußte in die Erde fallen und ersterben; nur so konnte s viele Früchte bringen (Ev. Joh. 12, 24; 15, 13; 1. Joh. 3, 16; 4, 16). „Wir in Indien“, sagt Dr. Sadhu Sundar Singh, „wußten bereits, daß Gott gut ist; aber wir ahnten nicht, daß er so gut ist, daß Christus für uns sterben sollte“ … „Gott befriedigt in gewissem Grade alle Sehnsucht nach ihm, aber die volle Befriedigung wird erst in Christus gewonnen.“ Diese Predigt vom gekreuzigten König war freilich „den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit“ (1. Kor. 1, 23). Selbst seinen Aposteln mußten erst ihre (mit der Gabe des sog. Hellsehens und den Verzückungszuständen verwandten oder verbundenen, in der Überlieferung dann poetisch, volkstümlich bildhaft ausgemalten) Erlebnisse in den Erscheinungen des verklärten Heilandes bestätigen, daß Gott sich zu ihm und seinem Werke bekannte, um ihre verzweifelnde Traurigkeit über seinen schmachvollen Tod in freudigste Zuversicht zum Siege seines Geistes zu verwandeln.
Aber Jesus war sich dessen klar bewußt, daß er „sein Leben zu einem Lösegeld für viele“, zu ihrem Loskauf aus der Knechtschaft, hingeben mußte (Mrk. 10, 45). Darauf weist auch sein Wort Luk. 12, 49-50 hin, an dem man das innere Beben und Sehnen seines Herzens spürt: „Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer werfe auf die [31] die Erde; und was wollte ich lieber, denn es brennte schon! Ich muß mich aber taufen lassen mit einer Taufe; und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde!“ Die brennende Liebe, die in ihm lebte und wirkte und ihn nun auch freiwillig, obwohl mit dem natürlichen Bangen, in den Tod gehen ließ, sollte dann – das war sein innigstes Verlangen – von seinen Jüngern in gleicher flammender Begeisterung, wie ein vom Winde getriebenes Feuer, über die Erde getragen werden. (20) Wie Jesus selbst aber zuvor durch die Leidensfluten sich hindurchringen mußte, so stand auch seinen Jüngern hartes Kämpfen und Leiden bevor, ein Ringen selbst mit denen, die ihnen in ihrem natürlichen Leben die nächsten und teuersten waren: Luk. 12, 51-53. Auch sie sollten bangen, aber nicht verzagen, auch sie mußten das Todessiegel des Herrn Jesu an ihrem Leibe tragen, damit sein Leben in den Menschen mächtig wurde (2. Kor. 4, 8-12). Aber mit Freuden will ein Paulus für seine geistlichen Kinder leiden und so mit seinem irdischen Dasein erstatten, „was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für dessen Leib d. i. die Gemeinde“ (Kol. 1, 24). Und die gewonnen sind durch die große. reine Liebe, die bitten immerfort bis heute:
„Komm, o Herr, komm bald, du Treuer, gib, ach gib dich allen kund,
und entzünd dein heilges Feuer auf dem ganzen Erdenrund!
Großes hast du schon begonnen, großes willst du ferner tun;
deine Liebe kann nicht ruhn, bis die ganze Welt gewonnen,
bis ein jedes Herz besiegt, Herr, zu deinen Füßen liegt.“
Der aus dem Neid geborene Haß des Judentums, die alte Kainssünde, welche von jeher Brüder und Brüdervölker zum Mord widereinander trieb, und die eigennützige Ungerechtigkeit des Vertreters der heidnischen Weltmacht, die dem Priester- und Theologenrat ihren Arm lieh, hat auch vor dem Heiligen, der die Liebe selber war, nicht Halt gemacht. Dadurch hat die Sünde, die Selbstsucht der Welt, sich selbst gerichtet. Die Feinde Jesu haben ihre Widergöttlichkeit offenbar gemacht; Jesu Wollen und Wirken steht nun desto höher und reiner da, die selbstlose Liebe, in Treue bewährt, triumphiert nun um so herrlicher. „Die Zeit ist gekommen, daß des Menschen Sohn verklärt (verherrlicht) werde“ (Joh. 12, 23.24 vgl. 13, 31.32; 14,2; 16, 12-14). Sein Evangelium ist für die Menschheit gerettet, sein Heilandsberuf erfüllt, sein Werk auf Erden vollbracht (Joh. 19, 30). – Wie einst die anklagende Klage Gottes an Israel erging (Mich. 6, 3): „Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit [32] habe ich dich beleidigt? Das sage mir!“ – so fragt die ewige Liebe fortan die Menschen: Was hat Jesus Christus euch getan, daß ihr ihn verworfen habt? womit hat er euch beleidigt, daß ihr ihn gekreuzigt habt? Und sie müssen antworten: „Er ist um unserer Missetaten willen verwundet, und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet“. Wie Jesaia 42, so ist auch Jes. 53 an diesem unseren Gottesknechte erfüllt. Und wie Paulus bekennt: „Es sei ferne von mir rühmen, denn allein vom Kreuz unsers Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt“ (Gal. 6, 14), so bekennt noch immer die Christenheit:
„Der am Kreuz ist meine Liebe, meine Lieb‘ ist Jesus Christ!
Weg ihr argen Seelendiebe, Welt und Fleisch mit eurer List!
Eure Lieb ist nicht von Gott, eure Lieb ist gar der Tod…“
Die Sünde der Menschheit war es, die „den Heiligen Gottes“ ans Kreuz schlug. Zum Heile eben dieser Menschheit hat er freiwillig, seiner inneren Berufung treu, das Kreuz auf sich genommen. In dieser doppelten Bedeutung ist er das heilige Opfer, das die Welt in ihrer Sündhaftigkeit gefordert hat, „das Lamm Gottes, das der Welt Sünde auf sich nahm“, mitleidend mit den Menschen unter der Last ihrer Sünde sie bekämpfte und aufhob, und, indem er Liebe für Haß gab, die welt beschämend ihre Selbstsucht überwand, das „unschuldige, unbefleckte Lamm“, das mit seinem teuren Blute uns erlöst hat, indem es den „neuen Bund“ mit Gott, das Kindschaftsverhältnis der vertrauenden Liebe unter Einsetzung seines Lebens uns errungen und gesichert hat. Mtth. 20, 28; 26, 26-28; Joh. 1, 29; 3, 14-16; 1. Kor. 5, 7; 1. Petr. 1, 18.19; Gal. 2, 20. Es ist das Opfer der Heilandsliebe und -treue, und darin besteht der Wert dieses Leidens und Sterbens. (21)
Auch die Apostel Jesu haben von dem Haß und der Ungerechtigkeit der Welt Verfolgung und Tod erlitten, das Maß der Christusleiden erfüllen helfend, und sind durch ihre Treue vielen der Weg zum Gottesfrieden geworden. So können auch sie ihr Leiden und Sterben ein Opfer im Dienst [33] des Evangeliums zum Heile der durch sie gewonnenen Glaubensgenossen nennen und mit dem Tode ihres Heilandes vergleichen: Phil. 2, 17; 3, 10.11; 2. Tim. 4, 6; vgl. oben Kol. 1, 24 u. 2. Kor. 4, 8-12.
In anderem, weiterem Sinn sollen alle Christen „ihre Leiber zu einem lebendigen, heiligen, gottgefälligen Opfer begeben“, dem Weltsinn, der sich in den toten Werken des Pharisäertums oder in dem ungöttlichen Treiben der Zügellosigkeit gefällt, absterben und sich Christi Sinn schenken lassen und so ihr ganzes irdisches Leben zu einem Gottesdienste machen: Röm. 12, 1.2; 15, 16; 1. Petr. 2, 5. Ein solcher „vernünftiger Gottesdienst“ ist ein Gottesdienst, „im Geist“ (Joh. 4, 24), aus innerem Drange geboren, und ein Gottesdienst „in der Wahrheit“, wirkliche, aufrichtige Frömmigkeit, während die eingelernten äußeren Zeremonien jüdischen und griechischen Tempeldienstes auch Gleichgültige und Heuchler verrichten können. Und das Selbstopfer, das die Liebe Christi und in ihrer Kraft auch seine Sendboten für die Menschheit gebracht haben, hat ihr eine wirkliche Erlösung, ein neues Leben gegeben, während die durch die Tempelpriester dargebrachten Sühnopfer nur ein unvollkommenes Sinnbild sein konnten, zwar ein Ausdruck des Schuldbewußtseins, das die Versöhnung mit dem Gotte suchte, sein sollten, aber nicht dem Wahne dienen durften, als ob der Sünder durch das geringe Tieropfer das dem göttlichen Gerichte verfallene eigene Leben erkaufen könnte. Hebr. 10, 1-25. Noch überboten ist dieser Wahn durch den Aberglauben, der sich an die Ablaßlehre und den Ablaßhandel der römischen Kirche geknüpft hat.
Der Vermittelung der Priester, deren Amtsauftrag ihnen doch die persönliche Vertrauenswürdigkeit nicht mitgeben konnte, und ihrer symbolischen Sühnopfer bedurften also im Neuen Bunde die Bußfertigen ebenso wenig mehr, wie der Rabinnen und ihrer Gesetzesauslegungen. Jesus gab ihnen den vollen Gottesfrieden. Wie aber, wenn er nun aus der Welt schied? – Auch dann bedurften die Kranken des Arztes, die sündigen Menschen der Seelsorger. Die sollten nicht fehlen. Wie dem petrus auf sein Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, so ist auch allen Jüngern, der ganzen Christengemeinde die Vollmacht verliehen, zu binden und [34] zu lösen; die Sünden zu erlassen und zu behalten (Mtth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23; 1. Kor. 5, 1-13; 2. Kor. 2, 5-11); denn die Gemeinde der Christgläubigen darf sich auch die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinde Gottes, die Geliebten Gottes nennen, der heilige Geist Jesu Christi wohnt ja in ihr (Joh. 20, 22; Röm. 1, 7; 1. Kor. 1, 2; 2. Kor. 1, 1). Verfehlungen, die der Gemeinde zur Unehre gereichen oder die im engeren Bruderkreise nicht zu erledigen sind, werden vor die Gemeinde gebracht. Im übrigen bedarf es nicht der ganzen Gemeinde, um Gottes Gnade und Güte zu erlangen. Wo zwei oder drei versammelt sind in Jesu Namen, in seinem Geiste, da ist er in ihrer Mitte, und was sie erbitten, soll ihnen widerfahren von seinem himmlischen Vater (Mtth. 18, 19.20). Ein Christ darf zu jedem Mitchristen, der seines Vertrauens wert ist, als zu seinem Seelsorger gehen. „Hier soll einer dem andern ein Christus werden, daß er ihm helfe, wie Christus ihm geholfen hat“, sagt Luther. „Bekenne einer dem andern seine Sünden“, mahnt der Brief des Jakobus. Insbesondere sollen die erwählten Vertrauensmänner der Gemeinde, die Ältesten oder Vorsteher, den Kranken und Angefochtenen Seelsorger sein. „Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und so er hat sünden getan, werden sie ihm vergeben sein“ (Jak. 5, 13-16).
Was Israels Volk der Idee nach sein sollte, aber in Wirklichkeit nie dargestellt hatte: „ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk“ (2. Mos. 19, 6) – Gott selbst ihr König, und alle Volksmitglieder wie Priester, ihm zu dienen, zu ihm zu nahen berechtigt – das sollte nun die Gemeinde des neuen Bundes sein: 1. Petr. 2, 5.9; Offb. 1, 6. Freilich blieben auch die Christen Menschen mit menschlichen Unvollkommenheiten. Auch die christliche Kirche ist hinter dem Ideal zurückgeblieben, desto mehr, je mehr sie die gunst der weltlichen Mächte erfuhr und mit ihnen sich verquickte, und je mehr sie Namenchristen unter sich dulden mußte. Das hat die griechisch- und römisch-katholische Kirche zum Anlaß genommen, wieder einen Priesterstand einzusetzen und den Laien ihr Kindesrecht im Vaterhause zu nehmen. Sie hat aber nicht verhüten können, daß auch unter den Priestern und Bischöfen bis hinauf zu den Päpsten sehr unwürdige, ja tief unsittliche Menschen sich befunden haben, [35] die nicht einmal den Christennamen mehr verdienten, viel weniger Führer und Seelsorger sein konnten, wenn man nicht die Gnadenmittel, wie es freilich auch dort geschehen ist, zu mechanisch wirkenden Zaubermitteln herabwürdigte, und so das Christentum wieder auf die Stufe niedersten Heidentums herabdrückte. Gewiß hat es, wie in allen Religions- und sonstigen Gemeinschaften, so auch in den protestantischen Kirchen unwürdige Glieder gegeben; aber man hat für sie auch nicht das Recht eines unfehlbaren Stellvertreters Christi beansprucht.
Das N. T. weiß nichts von einem Papsttum zu Rom. Die Apostel sind die geistlichen Väter für diejenigen Gemeinden, die sie gegründet haben (Gal. 4, 19; 1. Kor. 4, 15; 9, 1.2). Ihre besondere Autorität gründet sich darauf, daß sie Augen- und Ohrenzeugen des Heilandes waren und von ihm in seinen engeren Kreis berufen. Im übrigen waren sie seine Sendboten, gleich den Evangelisten (Missionaren) beauftragt, das Evangelium auszubreiten. Bischöfe (d. h. Aufseher) und Presbyter (Älteste) hießen ehemals die Vorsteher der einzelnen Gemeinden. Nach der Apostelzeit brachte es die geschichtliche Entwickelung, der nötige engere Zusammenschluß der Gemeinden mit sich, daß die bedeutenderen Bischöfe die Führung für größere Bezirke erhielten, die der Städte für die Landbezirke, die der Hauptstädte für die Provinzen, unter diesen wieder die hervorragendsten als Patriarchen für noch weitere Kreise angesehen wurden: im Morgenlande die zu Jerusalem, Antiochien, Alexandrien, Konstatinopel, im Abendlande der zu Rom. Aber dessen ausschließlicher Vorrang vor allen ist im Osten nicht anerkannt worden. Seine Berufung auf Mtth. 16, 18-19 ist verfehlt, weil dieselbe Vollmacht auch den anderen Aposteln zugesprochen ist (s. oben). Die Apostel sind im N. T. alle gleichen Ranges, nur je nach ihrer Begabung mehr oder weniger hervortretend, wie z. B. Jakobus und Johannes neben Petrus, und sodann Paulus, s. Gal. 2, 1-16; 1. Kor. 1, 12.13; ApG. 15, 1-35; Mtth. 20, 20-28. Außerdem waren Petrus und Paulus zu rom nicht als Bischöfe, sondern als Apostel; und die Bischöfe und deren Nachfolger waren keine Apostel.
Die Reformation hat den Laien ihr Christenrecht wiedergegeben. Möchten sie es nicht abermals sich nehmen lassen! Und möchten sie es recht gebrauchen als Mitarbeiter am Christusreiche auf Erden! Denn die Rechte geben auch Pflichten, stellen Aufgaben. Noch viel mehr als bisher [36] müssen sich die Gemeinden dessen bewußt werden. Sie sollen nicht alles von den angestellten Pfarrern, Gemeindeschwestern und oberen Kirchenbeamten erwarten, sondern auch selbst tätig sein, jeder nach seinen Gaben und Kräften. – An die Stelle der Apostel sind für uns die h. Schriften des N. T. getreten. Außer ihnen brauchen wir, gleich den apostolischen Gemeinden (1. Kor. 12) mancherlei Ämter d. i. Dienste: Missionare („Evangelisten“), Seelsorger („Hirten“), Jugend-, Armen- und Krankenpfleger (Diakone und Diakonissen), Prediger und Lehrer, welche die h. Schriften und die Geschichte der Kirche gründlicher studiert haben, und Männer, welche die Gabe der Leitung, Organisation und Verwaltung haben, dazu Versammlungen der Einzelgemeinden und ihrer Vereinigung zu größeren Gruppen, sowie deren Leiter. Aber weder die einen noch die anderen sollen sich zu Herren über die Gewissen machen, wie es zu Zeiten geschehen ist und hie und da noch geschieht, wo man das Wesen des Christseins verkennt. Ausschluß aus der Christengemeinde ist nur berechtigt, wo die Gottesoffenbarung in Jesus Christus offen geleugnet und verachtet oder der Christenname durch zuchtloses Leben geschändet wird (s. Gal. 5, 19-25; 1. Kor. 5, 1-13; 6, 9-10; 2. Kor. 2, 5-11; Mtth. 18, 15-17; 7, 15-23; 1. Joh. 2, 18-23; 4, 1-3; 1. Kor. 16, 22). Im übrigen gilt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mtth. 13, 24-30).
In Summa: Die christliche Kirche d. i. die Gemeinde des Herrn, das Reich Christi, die Gottesherrschaft auf Erden ist nicht da, wo der römische Papst mit seinen Kardinälen regiert und ihre Lehrsätze angenommen, ihre Gebote befolgt, ihre lateinischen Liturgien angehört werden; auch nicht da, wo irgend eine andere Kirchenverfassung, Theologie und Liturgie herrscht; sondern da, wo Jesus Christus mit seinem heiligen Geiste regiert, wo Menschen sich zusammenfinden, die im Vertrauen zu dem Gott, der sich in Jesus Christus als die wunderstarke, alle Erdennot bekämpfende, Sünde und Tod überwindende selbstlose Liebe erwiesen hat, zum inneren Frieden kommen und neue Menschen werden, dankbare und fröhliche, geduldige und versöhnliche, hilfreiche und opferwillige Menschen. Diese Kirche ist „unsichtbar“, nur sofern ihr inneres Leben „verborgen ist mit Christo in Gott“, im Leben des Glaubens und der Liebe im „verborgenen Menschen des Herzens“; sie wird sichtbar, wird offenbar als eine „Hütte Gottes bei den Menschen“, sobald ihre innere Kraft sich auswirkt, der gute Baum gute Früchte bringt, wie ers soll und [37] nicht anders kann, wenn er wirklich ein guter Baum ist.
Wo aber solche Menschen sich zusammenfinden, da wollen sie auch miteinander ihres inneren Besitzes sich freuen, „einmütig und mit einem Munde“ Gott lobend und dankend (Röm. 15, 5.6), und immer aufs neue an der Quelle des Gotteswortes schöpfen, mit und füreinander um Stärkung und Förderung in ihrem Gnadenstande bitten und einander mit ihren Gaben dienen. Wo lebendiges Christentum ist, da ist auch Verlangen nach gemeinsamem Gottesdienst. Aus eigenem Bedürfnis also haben sich von Anfang an die Christengemeinden diesen Gottesdienst gestaltet (ApG. 2, 42.46); nicht etwa weil sie meinten, sich durch den Besuch desselben ein Verdienst bei Gott zu erwerben. – Aber neues Leben bedarf neuer, eigener Formen. Überall im Natur- und Geistesleben zeigt uns der Schöpfer aufs deutlichste, daß er kein ewiges Einerlei, sondern unendliche, immer neue Mannigfaltigkeit der Formen will. Er selber, der lebendig machende Geist, ist ja kein Handwerker, der nach Schablonen arbeitet, sondern der Künstler aller Künstler. Auch Jesus sprach schon das bedeutsame Wort: „Niemand setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; denn der neue Lappen reißt doch vom alten, und der Riß wird ärger. Und niemand fasst jungen Wein in alte Schläuche; anders zerreißt der Most die Schläuche, und der Wein kommt um und die Schläuche“ (Mrk. 2, 21.22). In wie freier Ordnung sich die gottesdienstlichen Versammlungen der apostolischen Zeit bewegten, zeigt 1. Kor. 14. Aber darauf dringt der Apostel, daß alles, wasa dargeboten wird, zur Erbauung d. i. zur Förderung der Gemeinde diene. Und aus Kap. 12 ersehen wir, wie in der Gemeindeordnung die mannigfaltigsten Geistengaben der Gemeindeglieder Raum fanden und sich zum besten aller betätigen durften. (22) Auch unsere Reformatoren haben keinen Zweifel darüber gelassen, daß Gottesdienstordnungen gleich den Kirchenverfassungen nicht göttliche Autorität und ewige Dauer zu beanspruchen haben, sondern mannigfaltig und dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend sich gestalten dürfen. „Der Christen d. i. der Kinder der Freien, Ordnungen sollen so sein, daß sie dieselben freiwillig und von Herzen halten, ändernd, so oft und wie sie wollen. Deshalb darf niemand in dieser Sache irgend eine Form als ein notwendiges Gesetz verlangen oder aufstellen, durch das er die Gewissen verstricke oder plage“, sagt Luther (23). Die von ihm noch im Anschluß an die römische Messe aufgestellten, nur das Unevangelische ausscheidenden Ordnungen hat er selbst nur für Übergangsformen erachtet, auch verschiedene Formen [38] vorgeschlagen, in denen er mehrere Stücke, z. B. das Gloria in excelsis und das Crede (Nicänum) entweder freistellt oder ausläßt oder durch andere Formen ersetzt. Eine „allein richtige“ und deshalb unantastbare Form gibt es für ihn nicht. Ähnlich erklärt Zwingli (24): Der mitlaufenden Zeremonien halber möchte er vielleicht etlichen zu viel, etlichen zu wenig getan zu haben geachtet werden. Darin aber möge jede Kirche ihre Meinung haben, denn er wolle deshalb mit niemandem zanken. Weil durch die vielen Zeremonien so viel Schade verursacht sei, habe er zu tun, was der Herr selbst vorgeschrieben, so wenig als möglich an Zeremonien und Kirchengepränge hinzugetan, nur so viel daß „die Sach nit gar dürr und rouw verhandlet und der menschlichen Blödigkeit auch etwas zugegeben wurde“, und nur solches was zur Förderung der Gemeinde des Herrn geschickt erscheine. – Ein Rest der alten Unfreihiet, nur in anderer Richtung, war es, wenn Reformierte (allerdings wegen des katholischen Mißbrauchs) keine Bilder in ihren Kirchen dulden und im Gottesdienste nur Bibelworte singen wollten, während doch schon die apostolischen Gemeinden nicht bloß Psalmen, sondern auch andere Hymnen und Lieder gesungen haben (Kol. 3, 16; Eph. 5, 19). Man betrog durch diese Engherzigkeit nur die Gemeinden um den reichen Schatz an eigenen Liedern, die der Kirche des Evangeliums geschenkt wurden, und konnte doch den Buchstabendienst nicht duchführen, denn die Übersetzung der hebräischen und griechischen Psalmen in die Volkssprache und ihre Umdichtung in Liedform war eben doch eine andere Form. Später hat man sich denn auch der besseren Einischt Luthers angeschlossen, der alle Kunst, insbesondere aber den Gesang, Gemeinde- und Chorgesang, alte und neue Lieder, in den Dienst der Kirche stellte zur Ehre Gottes. Eine bedenkliche Verwirrung und Rückfälligkeit ist es, wenn neuerdings einzelne Überlutheraner ihre Kirche meinen dadurch neu beleben zu können, daß sie noch über Luthers und Zwinglis erste Übergangsformen hinaus auf die doch anders gemeinten Formen der römischen Messe zurückgehen, auch mit Erneuerung ihres äußeren Prunks. Das kann nur zu neuen Ärgernissen und Spaltungen führen. Festhalten an den gesunden apostolischen und evangelischen Grundsätzen und ihre ehrliche Durchführung im kirchlichen Leben kann uns allein die Einmütigkeit bringen. „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Kor. 3, 17).
Nur darf nicht übersehen werden, daß ein Zusammenleben und Miteinanderwirken nicht ohne irgend eine gemeinsame Ordnung möglich ist, [39] also auch gottesdienstliche Feiern größerer Versammlungen nicht ohne vorher bestimmte Ordnungen. Deshalb ist auch nicht dagegen einzuwenden, wenn Kirchenbehörden oder Synoden liturgische Ordnungen ausarbeiten lassen und als Muster den Gemeinden empfehlen, solange sie diesen nicht als starres Gesetz aufgezwungen werden. Besser noch ist es, wenn solche Formen von den dafür begabten Männern frei geschaffen werden und durch ihren Eigenwert frei sich durchsetzen, wie es in neuerer Zeit z. B. mit den freien sog. liturgischen Feiern geschehen ist. Selbstverständlich ist auch die Forderung, daß die gottesdienstlichen Ordnungen dem Inhalte nach mit dem Wahrheitsgehalt des Evangeliums übereinstimmen und der Form nach schlichte, edle Feierlichkeit wahren, der Höhenlage ihrer Bedeutung entsprechen. „Alles geschehe wohlangemessen und geordnet“, verlangt auch Paulus 1. Kor. 14, 40. Gerne wird man dabei das Gute und Schöne, das frühere Generationen geschaffen haben, schätzen und verwerten, solange es sich als lebenskräftig und lebenweckend erweist. Aber fahren lassen soll man getrost, was zum toten Buchstaben werden will oder mit der Wahrhaftigkeit nicht mehr vereinbar ist. Sonst ist Gefahr, daß der Gottesdienst durch andachtloses oder gar heuchlerisches Ableiern entwürdigt und entleert wird.
Die apostolischen Gemeinden haben sehr schnell von der Freiheit, die ihnen das Evangelium gab, Gebrauch gemacht. Sie feierten bald nicht mehr den jüdischen Sabbat und die jüdischen Feste, sondern die Gedenktage der neuen Gottesoffenbarungen und befreiten sich von den jüdischen Speisegesetzen: Kol. 2, 16.17 vgl. ApG. 20, 7; Off. 1, 10. – Die Beschneidung, das alte Bundeszeichen Israels, fiel dahin, denn Jesu himmlischer Vater war kein Volksgott mehr: Gal. 3, 26-29; 5, 6; 6, 15; Phil. 3, 3. Den Eintritt in die neue Gottesgemeinde bezeichnete fortan die Taufe, wie sie schon Johannes der Täufer vollzogen hatte (Mrk. 1, 4) und Jesu Jünger sie fortsetzten (Joh. 3, 22.26; 4, 12; ApG 2, 41; 8, 12.38; 9, 19 u. a. ): das äußere Sinnbild der inneren Reinigung, der „Sinnesänderung“ oder Bußfertigkeit und der Vergebung der Sünden für die Bußfertigen. In ihr verwirklicht sich, was in der Bildrede Hesek. 36, 25-27 verheißen war: „Ich werde reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz verleihen und einen neuen Geist in eurer Inneres legen…“ Sie wird aber in der Christengemeinde zur Taufe „auf den Namen Jesu Christi“ (ApG. 2, 38; 10, 48; 19, 5). Denn sein Wesen, sein H. Geist ist es, der die Herzen erneuert; seine bis in [40] den Tod getreue Liebe wird denen, die sie erkennen und ihr das Herz auftun, die Bürgschaft der Gnade Gottes und schafft die neuen Menschen (Mrk. 1, 8; Eph. 5, 25-27; Tit. 3, 3-7). Darum heißt diese Taufe auch eine Taufe auf den Tod des Herrn (Röm. 6, 2-6; Kol. 2, 11-14) und zugleich eine Taufe auf den Namen Gottes des Vaters und des heiligen Geistes (Mtth. 28, 19). – Das äußere Zeichen bietet der Vorstellung und dem Glauben eine Anknüpfung, Anregung und Stütze, verstärkt den Eindruck des Wortes. Aber entscheidend für das Verhältnis zu Gott, für das Christsein, ist im Grunde nicht die begleitende sinnbildliche Handlung („Wasser tuts freilich nicht“), sondern die in Christus dargebotene göttliche Gnade und die Gesinnung, mit der sie aufgenommen wird. Heidnischer Aberglaube ist es, wenn das äußere Sinnbild und die dabei gesprochenen Worte wie eine mechanisch wirkende Zauberformel angesehen werden, die durch ihre Wunderkraft zwingend eine „Wiedergeburt“ bewirken könnten, falls sie nur genau nach der kirchlichen Vorschrift ausgeführt würden. – Mit solcher Anschauung hängt es zusammen, wenn die römisch-katholische Kirche die ungetauft gestorbenen Säuglinge als nicht zu ihr gehörig betrachtet und sie außerhalb der geweihten Erde bei den Unchristen u. Selbstmördern begraben läßt, wo sie die alleinige Verfügung über die Friedhöfe hat. Mit dem Geiste des N. T. ist das unvereinbar. Die unmündigen Christenkinder sind schon durch ihre eltern in die christliche Gemeinschaft hineingestellt und dadurch unter den Einfluß der heiligenden Gnade gestellt (vorausgesetzt natürlich, daß die Eltern selbst wirklich unter diesem Einfluß stehen), weshalb Paulus 1. Kor. 7, 14 die Kinder heilig nennt. Werden sie außerdem getauft, so ist die Taufe für sie noch die sinnbildliche feierliche Bestätigung ihrer Gotteskindschaft, ihrer Gemeinschaft mit dem heiligenden Geiste Jesu Christi. Sobald die Entwickelung der Kinder die Stufe eigenen Bewußtseins und eigener Verantwortung erreicht hat, genügt freilich das unbewußte Christsein nicht mehr, sondern muß das eigene Verständnis und das eigene Wollen hinzukommen, was dann nach erfolgtem Unterricht durch die Konfirmation zum Ausdruck kommt. Man soll aber auch die Christengemeinden nicht schelten, welche (wie z. B. noch der Kirchenlehrer [41] Tertullian, + 220) die Taufe erst mit dem bewußten Bekenntnis zu Christus verbinden wollen, wie es noch heute immer auf dem Felde der Mission geschieht bei den Erwachsenen, die dem Christentum neu gewonnen werden. Und das war ja die ursprüngliche Weise. Denn die ersten Christen sind selbstverständlich als Erwachsene getauft. Aus der apostolischen Zeit ist die Kindertaufe noch nicht nachzuweisen, wenn man sie vielleicht auch folgern darf aus den Berichten, daß christliche Männer und Frauen sich taufen ließen mit ihrem Hause, mit allen ihren Angehörigen: s. 1. Kor. 1, 16 wörtlich: „des Stephanus Haus“, u. ApG. 16, 15 u. 33.
Mit der Ausbreitung des Christentums verödeten die Opferstätten mehr und mehr. Die bekehrten Heiden verließen aber nicht bloß ihre Götzenaltäre; auch den Tempel zu Jerusalem und seine Priester brauchten sie nicht. Joh. 4, 19-24. Hebr. 10. Die unvollkommenen Schattenbilder ihrer Opfer waren wertlos, überflüssig gemacht durch die vollkommene Wirklichkeit: durch das Opfer der Liebe und Treue, wie es Jesus gebracht und wie es in seiner Kraft und Nachfolge auch seine Jünger zu bringen befähigt und willens waren. Des zum Zeichen und Gedächtnis feierten sie das heilige Abendmahl, „das Mahl des Herrn“: das Essen des gebrochenen Brotes und das Trinken des ausgegossenen Weines als Zeichen und Sinnbild ihres dankbaren und willigen Teilhabens an dem Opfer Jesu Christi: 1. Kor. 11, 23-26; Luk. 22, 14-20; Mrk. 14, 22-25; Mtth. 26, 26-29. Denn sein in den Tod gegebener Leib und sein zum Heil der Welt vergossenes Blut ist ja das heilige Opfer, das seine Hirtentreue uns brachte (vgl. Hebr. 10, 10). Darauf weist auch die Anknüpfung an das Passahmahl hin, das ein Opfermahl war (vgl. 1. Kor. 5, 7). Und diese „Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi“ (1. Kor. 10, 16), dieses Teilhaben an seinem Opfer (vgl. 10, 18) galt für seine Jünger und gilt noch für alle Christen in zwiefacher Richtung: zuerst daß sie teilhaben an dem Segen, den es den Menschen bringen sollte, an dem „neuen Testamente“ oder „neuen Bunde“ (25), den Jesus uns gebracht und für den er sein Leben einsetzte, ihn gleichsam mit seinem Blute besiegelnd (vgl. Sach. 9, 11; 2. Mos. 24, 8), an jenem neuen Bunde, in welchem Gottes freie vergebende Gnade uns aus dem Furchtverhältnis ungehorsamer Knechte zum strengen Herrn [42] in das Vertrauensverhältnis dankbarer Kinder zum gütigen Vater versetzt (vgl. Jer. 31, 31-34); und zum andern, daß sie teilhaben an der Verpflichtung, die ihnen dieser neue Bund, die erfahrene unverdiente Liebe auferlegt, sich willig zu zeigen zu gleicher Liebe und Treue. Auf das erste weist auch das Ev. Joh. hin mit den in Bildreden gekleideten Jesusworten: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten… Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt (6, 35 u. 47-51) … „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringet viel Frucht“ (15, 5). Auf das zweite: den Trieb der Dankbarkeit, Liebe um Liebe, Treue um Treue zu geben, weisen zahlreiche andere Stellen hin, z. B. Eph. 4, 32 – 5, 2: „Seid untereinander freundlich, herzlich, einander vergebend, gleichwie Gott euch vergeben hat in Christo. Seid also Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleichwie Christus uns geliebet hat und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer“ – 1. Joh. 3, 16: Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns eingesetzt hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder einsetzen“ – ferner 1. Petr. 2, 19-25; 4, 12-14; 2. Kor. 6, 1-10 u. a. Auf die Gemeindschaft bildende Kraft der im Herrenmahl uns vergegenwärtigten und zugesprochenen treuen Heilandsliebe und Gottesgnade weist Paulus 1. Kor. 10, 17 hin: „Ein Brot ists, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes teilhaftig sind“ – vgl. 12, 12-13 u. 26-27. – In dem ausgeführten Sinn haben auch Kirchenväter die Teilnahme an der Abendmahlsfeier ein Opfern genannt. Clemens von Alexandrien bekennt: „Wir opfern nicht dem Gotte, der nichts bedarf, allen alles gibt, sondern wir preisen den für uns geopferten, indem wir uns selbst opfern.“ Ähnlich auch Eusebius: „Wir opfern im h. Abendmahle, indem wir uns selbst dem Herrn hingeben, uns ihm mit Leib und Seele weihen.“ Und Augustin erklärt: „Das Andenken Christi feiernd opfern wir uns selbst… wir selbst müssen in unsern Herzen das unsichtbare Opfer sein… Die Gemeinde wird in dem Opfer, welches sie darbringt, selbst dargebracht.“ Auch Luther schreibt im Sermon von dem Neuen Testament (1520): „Wir sollen geistlich opfern. Was sollen [43] wir denn opfern? Uns selbst und alles was wir haben, mit fleißigem Gebet, wie wir sagen: Dein Wille geschehe auf der Erden als im Himmel. Hiemit wir uns dargeben sollen göttlichem Willen, daß er von und aus uns mache, was er will nach seinem göttlichen Wohlgefallen; dazu ihm Lob und Dank opfern aus ganzem Herzen für seine unaussprechliche süße Gnade und Barmherzigkeit, die er uns in diesem Sakrament zugesagt und gegeben hat.“ (26) 1. Kor. 11, 17-34 nennt Paulus der Korinther Abendmahlsfeier wegen Verletzung der Brüderlichkeit mit Recht eine unwürdige Feier, die nicht „des Herrn Abendmahl“ zu heißen verdiene, vielmehr eine Versündigung sei „am Leibe und Blute des Herrn“, an dem Opfer der heiligen Liebe. Denn deren Gedächtnis begehen sie doch mit dem Herrenmahle; durch ihr unbrüderliches Verhalten aber verleugnen sie ja die Liebe, verachten die christliche Gemeinschaft, unterscheiden nicht das Mahl des Herrn von gewöhnlichem Essen und machen so die Feier zu einem Heuchelwerk, das Gottes Gericht herausfordert.
So ist das h. Abendmahl zuerst eine Dankesfeier, eine Eucharistie wie die alte Kirche sie nannte und mit Lob- und Dankgebeten einleitete; sodann aber auch eine Erinnerung an den tiefen Ernst des Christenberufs, wie ihn das Lied: „Mir nach, spricht Christus, unser Held, mir nach, ihr Christen alle!“ uns ans Herz legt.
Anknüpfung an sinnbildliche Handlungen war den Jüngern Jesu nichts befremdliches, nicht unverständliches, vielmehr ihnen vom A. T. her bekannt. Der Prophet Hesekiel z. B. läßt sich (5, 1ff) seine Haupt- und Barthaare abschneiden und verbrennt, zershclägt und verstreut sie vo den Augen des gottlosen Volkes, um ihm eindrücklich zu machen, daß es durch Pest und Hunger und durchs Schwert seiner Feinde umkommen und der Rest zerstreut werden soll. Jeremia begleitet die Ankündigung des Strafgerichtes (19, 10.11; 27, 2ff), der Zerschlagung und Knechtschaft des Volkes, mit dem Zertrümmern eines Kruges und dem Anlegen eines Joches. In ähnlicher Weise machte Johannes der Täufer seine Bußpredigt eindrücklicher durch die Wassertaufe; und die sich ihr unterzogen, bekannten damit ihr Verlangen nach Reinigung vom Unflat der Sünden, nach Bereitschaft für das kommende Gottesreich. (27) So verband nun Jesus [44] den Hinweis auf seinen nahen Tod, der den neuen Gnadenbund besiegeln sollte, mit dem Brechen des Brotes und dem Ausgießen des Weines; und die Jünger, welche die so gedeuteten Zeichen von ihm hinnahmen und genossen, bekannten sich damit zu seinem Erlösungswerk und zu ihrer Nachfolge. – Die sinnbildliche Handlung bekräftigt das Wort und dient dem Glauben zum Anhalt; aber die Sinnbilder bleiben Sinnbilder. so wenig wie bei der Taufe das Wasser in den heiligen Geist verwandelt wird, so wenig wird beim h. Abendmahle Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt. Auch spricht Jesus nicht von Mitteilung und Genießen des „verklärten“, sonern seines für uns in den Tod gehenden Leibes und Blutes. Und das konnte von seinen Jüngern und kann ebenso von uns nicht buchstäblich, sondern nur von der Zueignung des Heilsgewinnes dieses seines Todesopfers verstanden werden, wie es oben ausgeführt ist. (28) Danach ist die Abendmahlsfeier nun nicht bloß eine Darstellung, ein „heiliges Spiel“, sondern voller Lebensernst, und nicht bloß das Gedächtnis und die anschauliche Vergegenwärtigung eines Geschehnisses der Vergangenheit, sondern lebendige, persönliche Aneignung einer mit Jesu Opfertod uns geretteten Gabe und Aufgabe, Befestigung unseres Treubundes mit dem Herrn und unserer brüderlichen Gemeinschaft mit allen den Seinen.
Die dargelegte, aus dem geschichtlichen Zusammenhang und als der nächstliegende Sinn der Schriftworte sich ergebende Bedeutung der Taufe und des Abendmahles steht mit der Grundrichtung und dem Hauptinhalte des N. T. im Einklang, wahrt die Innerlichkeit, die geistige Art des Christentums, mutet uns keine unvollziehbaren Vorstellungen zu, legt uns nichts überspanntes und lebensfremdes auf, ist für jeden Christen verständlich und verwertbar und enthält beides: das Tröstliche und das Verpflichtende des Evangeliums. Es war eine Einseitigkeit Zwinglis, daß er nur das letztere sah, nur die Verpflichtung der das Herrnmahl feierenden Gemeinde zu dankbarem Gedächtnis und Bekenntnis zugestand. Er hindert dadurch die Verständigung mit Luther, der außerdem und vor allem die Worte: „Für euch gegeben und vergossen [45] zur Vergebung der Sünden“ betont haben wollte und darin mit Recht die Zusicherung der im Glauben zu ergreifenden Gottesgnade erblickte. Aber das haben Calvin, der später die Führung der Schweizer übernahm, und der 1563 herausgegebene „Heidelberger Katechismus“, der das Einigungsband der Reformierten Deutschlands wurde, durchaus anerkannt. Auch sie betonen, daß uns im Herrnmahle ein Unterpfand der Frucht des Leidens und Sterbens des Heilandes gegeben ist. So war in dem Hauptpunkte die Einmütigkeit hergestellt. Und damit konnte man sich begnügen, mußte man sich begnügen. Wenn den dem Bestreben, weiter zu vermitteln, sich der buchstäblichen Auffassung zu nähern, Calvin und der Heidelberger Katechismus lehrten: durch den heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohne, würden wir auch mit dem gekreuzigten, jetzt verklärt im Himmel befindlichen Leibe und Blute vereinigt oder würden dessen Lebenskräfte uns mitgeteilt, indem unsere Seele sich gläubig zu dem himmlischen Herrn erhebe, während wir mit dem leiblichen Munde die irdischen Wahrzeichen, Brot und Wein, genießen: so geht auch das schon über den schlichten ursprünglichen Sinn des Herrnmahles hinaus, ist jedenfalls eine zu künstliche, für den einfachen Christenmenschen schwer faßlich Reflexion, gehört deshalb nicht in den Kinderunterricht und die Gemeindepredigt. Und um was man damals sonst noch stritt, das war erst recht nicht mehr Evangelium, sondern Theologie, nicht Treue gegen das Jesuswort, sondern ein Sichversteifen auf eine bestimmte Auslegung, eine sachlich unmögliche Auffassung, die eine wörtliche sein sollte und es doch nicht mehr war (denn statt „dieses ist mein Leib“ setzten die Lutheraner „in, mit oder unter diesem ist m. L.“). (29) Es waren, historisch betrachtet, Reste der mittelalterlichen Scholastik und antiken Mystagogie (30), mit denen die griechische und römische Kirche schon vorher das Evangelium behaftet hatten. [46] Daß man dies nicht beiseite ließ, vielmehr gerade daran die traurig berühmte rabies theologorum sich festbiß, das hat aufs neue die Christenheit verwirrt und gespalten und den Siegeszug des Evangeliums gehemmt. Wollen wir nicht endlich, endlich dies schwere Ärgernis des Unfriedens abtun, das mit Recht die Kritik und den Hohn aller Feinde unserer Kirche herausfordert? – Wollen wir nicht endlich die unchristlichen Zäune dogmatischer Spitzfindigkeiten und mystagogischer Grübeleien niederreißen, damit alle diejenigen einander die Bruderhand reichen und mit einander zum Tisch des Herrn gehen können, die in der christlichen Gesinnung einig sind? – Es ist hohe Zeit, Ernst zu machen mit der Konsequenz des Pauluswortes: „Unser Erkennen ist Stückwerk und ist wandelbar; bleibendes Wertes aber sind Vertrauen, Hoffnung, Liebe, diese drei; und die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Sonst möchte der Herr der Kirche bald auch zu uns sprechen: „Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon zu gefallen bist, bessere dich und beginne von neuem. Wenn nicht, so komme ich über dich und werde deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte“ (Offb. 2). Das Gericht, das schon ein Mal, im 17. Jahrhundert, als Folge der Uneinigkeit über uns kam, möchte sonst noch härter sich wiederholen.
Ein Lichtblick sind in unserer Zeit die mancherlei Bestrebungen, alle die verschiedenen Kirchen zu gemeinsamer Arbeit, zur Verwirklichung der christlichen Grundsätze im Leben der Gemeinden und der Völker zusammenzubringen. Mit großer Freude begrüßen wir das als ein Zeichen, daß der Geist des Herrn uns zu neuer Stufe aufwärts führen will. Nur die römische Kirche schließt sich selber prinzipiell von diesen Bestrebungen aus, weil sie ihre Dogmatik und Praxis für die allein und unfehlbar richtige, ein für alle Mal festgelegte erklärt und einfache Unterwerfung unter ihre Priesterherrschaft verlangt. Hiemit aber legt sie sich auch fest auf all das vor- und außerchristliche, das im Laufe der Jahrhunderte in sie eingedrungen ist. Dazu gehört vor allem die Lehre von der Wirkung ihrer Weihungen ex opere operato d. h. der magischen, zauberhaften Wirkung derselben, die stets eintreten soll, wenn nur jedes Wort, jede Bewegung und Gebärde aufs peinlichste nach der Vorschrift und Absciht der Kirche ausgeführt wird – ganz wie der uralte heidnische Zauberglaube an peinlicher Ausführung bestimmter Formeln und Handlungen und an bestimmten Stoffen haftet. Der von einem anderen, [47] übergeordneten Priester geweihte Priester soll, auch wenn er persönlich ein Unchrist wäre, die übernatürliche Macht besitzen, solche Weihungen an lebenden und toten Dingen zu vollziehen. Das von ihm geweihte Wasser, auf Menschen oder auch (wie man noch heute z. B. in Italien sehen kann) auf Ochsen und Esel gesprengt, soll die Kraft haben, böse Geister von ihnen auszutreiben oder fernzuhalten, während Christenkinder, die nicht mit dem Taufwasser besprengt sind, im Leben und im Tode von der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen werden. Die geweihte Oblate und der geweihte Wein sollen in den wirklichen Leib und das wirkliche Blut Christi und damit für immer in Gott verwandelt sein, den die Gemeinde kniend anzubeten hat. Solcher Macht also, die Gottes Gegenwart herbeizuzwingen, in irdische Stoffe hineinzuzwingen vermögen, dazu die Gnadenkräfte dieses Meßopfers nicht bloß auf Anwesende, sondern auch auf Abwesende und sogar auf die abgeschiedenen Seelen im Fegefeuer übertragen können – einer Macht, die preiswürdiger erscheinen müßte als die Erschaffung der Welt – rühmt sich die römische Priesterschaft. Das ist nicht bloß Rückfall in heidnischen Zauberwahn, sondern auch Blasphemie. Kann das Opfer der heiligen Liebe schlimmer entstellt, das geistige Wesen des Christentums ärger verkannt werden? – Christi Opfer ist ein für alle Mal gebracht; es bedarf nicht, wie die Ipfer des A. T., der unendlichen Wiederholung, wie Hebr. 10, 11-18; 9, 12.28 nachdrücklich betont wird. Wir sollen es uns nur in der rechten Weise aneignen. Wiederholung ist nur in dem Sinne möglich und nötig, daß seine Jünger im Dienste des Evangeliums ihr Leben einsetzen, also Selbstopfer der Treue bringen. Das Zauberwerk der katholischen Kirche dient freilich zu desto größerer Verherrlichung ihrer Priesterschaft, die sich dadurch zum eigentlichen Mittler zwischen Gott und Menschen macht; aber deshalb können wir es nur um so weniger annehmen. – die nicht wegzuleugnende Tatsache, daß trotz der behaupteten Verwandlung Brot und Wein nach Geschmack, Geruch und Aussehen durchaus Brot und Wein bleiben und zersetzbar sind, erklärten die Dogmatiker flugs für ein weiteres von Gott gewirktes Wunder. Indes gab es doch selbst unter den Scholastikern Männer wie den Engländer Wilhelm Occam (+ 1347), welche dieses dreiste Wegerklären der Wirklichkeit nicht mit ihrer Wahrhaftigkeit vereinigen konnten [48] und deshalb der später von Luther aufgenommenen Lehre zuneigten, daß Leib und Blut des Herrn wirklich, aber in und mit den natürlichen Elementen genossen würden. Aber auch bei dieser Auslegung kann man – von anderen Widersprüchen abgesehen – von der Vorstellung einer leiblichen Vereinigung mit der Gottheit, dem Erbe der heidnischen Mysterien, nicht los, und war man zu der Folgerung genötigt, daß Leib und Blut Christi allgegenwärtig seien, was doch nur von dem göttlichen Geiste gesagt werden kann. Wenn die „Concordienformel“ der Lutheraner von 1577 die Unterscheidung machte, daß der Genuß nicht fleischlich, aber doch leiblich mit dem Munde geschehe, so war das nur ein Spiel mit Worten und kam doch zuletzt auf dasselbe hinaus, was schon Chrysostomus in den rohen Ausdruck gefaßt hatte, daß der Christusleib mit den Zähnen zerbissen werde. So entweihte man das Heilige, zog es in die trivialste Sinnlichkeit herab, indem man es zu einem mysterium tremendae majestatis zu erheben meinte. Den christen der apostolischen und nachapostolischen Zeit war das Herrnmahl nicht ein solches „Geheimnis schauervoller Majestät“, sondern eine Eucharistie, eine Dankesfeier, weil eine Feier der vollbrachten Erlösung, der offenbarten höchsten und heiligsten Liebe und Treue. Die hierin ihres Lebens Grund und Kraft gefunden hatten, die hatten „den Vater gesehen“, in Jesus Christus Gottes Wesen geschaut und brauchten nicht mehr Got tzu suchen wie die Heiden in Mysterien oder Philosophien.
Mit Unrecht hat man aus 1. Kor. 8 u. 10 herauslesen wollen, daß auch Paulus, von den heidnischen Mysterien beeinflußt, angenommen habe, die Beteiligung an den heidnischen Opfermahlen bewirke auf mystisch-magische Weise eine geistleibliche Vereinigung mit den Götzen bzw. mit den hinter den Götzenbildern vermuteten Dämonen, und dementsprechend das christliche Abendmahl auf gleiche Weise eine geistleibliche Vereinigung mit Christus, mit seinem verklärten Leibe und Blute. Das ist bei der sonstigen Einstellung des Paulus, seinem Hervorheben des geistigen, persönlichen, sittlichen Wesens des Christentums von vornherein unwahrscheinlich, und widerlegt sich auch gerade aus den angeführten Kapiteln. Wenn dem Apostel die Götzen keine wirklichen, sondern nur „sogenannte Götter“ sind, „wie es ja (bei den Heiden) der Götter (der sogenannten) viele und auch der Herren viele, aber [49] für uns (die Christen) nur Einen Gott und Einen Herrn gibt“, wenn folglich auch das Götzenopferfleisch nicht etwas Göttern geopfertes, sondern nur sogenanntes Opferfleisch ist (1. Kor. 8, 4-6; 10, 19; Gal. 4, 8), und Paulus deshalb denen, die durch diese Erkenntnis in ihrem Gewissen frei geworden sind, gestattet, das etwa auf dem Markte oder bei einem privaten Gastmahle angebotene Fleisch zu essen, solange ihnen unbekannt ist, woher es stamme, wonach sie auch nicht forschen sollen (1. Kor. 10, 25-27): so kann Paulus gar nicht meinen, das Essen des Opferfleisches bringe auf magische Weise mit den Götzen bzw. Dämonen in geistleibliche Gemeinschaft; denn sonst dürften sie es doch überhaupt nicht essen, gleichviel ob sie um die Herkunft wüßten oder nicht. – Um der christlichen Liebe willen verlangt aber der Apostel von den Christen den Verzicht darauf, sobald sie auf die Herkunft aufmerksam gemacht werden und ein Mitchrist, der noch nicht die Freiheit der Erkenntnis hat, an dem Essen Anstoß nimmt oder gar durch ihr Beispiel zum Mitessen mit bösem Gewissen verführt werden könnte (10, 28-33; 8, 7-13).
Gänzlich verbietet dagegen Paulus das Teilnehmen an den eigentlichen Götzenopfermahlen, und zwar deshalb, weil es Beteiligung am Götzen- oder Dämonendienst ist (10, 14 u. 10, 20-22). Zum Vergleich zieht er 10, 18 das Opferessen der Israeliten heran und sagt von ihm, daß es in Gemeinschaft mit dem Altar brachte, genauer übersetzt: zu „Genossen“ oder „Teilhabern des Altars“, zu Tischgenossen Gottes machte, dessen Segen sie da zu erwarten hatten und dem sie ihr Leben heiligen sollten (vgl. 2. Mos. 20, 24; 19, 6; 5. Mos. 7, 6-9). So macht das Götzenopfermahl die Mitessenden zu Teilhabern am Götzenopfer und damit zu Tischgenossen der Götzen bzw. Dämonen, macht sie zu Götzen- oder Dämonendienern. Deshalb können die Christen sich daran nicht beteiligen. Denn das wäre eine Verleugnung ihres Gottes und ihres Herrn, an dessen Tisch sie sonst sitzen, an dessen heiligem Opfer sie teilhaben, wenn sie des Herrn Mahl feiern, seinen Segen erwartend und ihm sich heiligend. Dies und nichts anderes bedeutet also nach dem Zusammenhang „die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi“ (10, 16). Von mystisch-magischer, geistleiblicher Vereinigung der Israeliten mit ihrem Altar kann ja keine Rede sein, folglich die „Gemeinschaft“ von Paulus nicht in diesem Sinne verstanden sein. Im übrigen spricht, wie Jesus, so auch Paulus, wo vom h. Abendmahle die Rede ist, nirgends vom „verklärten“ Leibe und Blute, [50] wohl aber betont er, daß die Feier eine Verkündigung des Todes des Herrn sei (1. Kor. 11, 26), also ein Bekenntnis zu dem, was dieser Tod als der Tod des Herrn, des von Gott uns gesandten Heilandes, für die Mitfeiernden bedeutet.
Die Götzenopferfeste mußten um so strenger von den Christengemeinden werden, als sie oft Gelegenheit zu Zuchtlosigkeiten und Sünden boten. Als warnendes Beispiel wird 10, 1-13 das Volk Israel hingestellt, dessen Mehrzahl torzt seinen besonderen Gnadenerfahrungen wiederholt in Untreue und deshalb in schwere Strafgerichte fiel. So sollen die Christen durch ihren Gnadenstand, ihre besonderen Segnungen in Taufe und Abendmahl sich nicht in Sicherheit wiegen lasen, sondern acht geben, daß sie durch den Verkehr mit den Heiden nicht zu ähnlicher Untreue und dadurch auch in Strafgerichte kommen. Um den Vergleich weiter auszuführen, werden 10, 1-4 die Gnadenerfahrungen Israels allegorisch gewertet. Wie die Christenheit auf Jesus Christus als ihren Heiland und Mittler des Neuen Bundes getauft ist, so ist (meint Paulus) das Volk Israel bei seinem Ursprung durchs rote Meer und auf seinem Wüstenzug unter der Gnadenwolke gleichsam auf Mose getauft als seinen Erretter und Mittler des Alten Bundes. Und wie den Christen im h. Abendmahle Christus geistlicher Weise ihr Lebensbrot und Lebenswasser ist (vgl. Joh. 6, 35; 4, 10), so hat Gott die Israeliten in der Wüste nicht bloß wunderbar mit leiblicher Speise und Trank versorgt, sondern auch mit geistlicher: der Gottesgeist, der sich uns in Christus offenbart hat, der hat ihnen in anderer Weise durch Mose Gottes Willen kund getan, so daß gleichsam Christus (denn „der Herr ist der Geist“ 2. Kor. 3, 17 vgl. auch 1. Petr. 1, 11) als ein das geistliche Lebenswasser spendender Fels mit ihnen gegangen ist. Von „sakramentaler“ im Sinne von mystisch-magischer Wirkung ist auch hier keine Rede. Bekanntlich wird das Wort „Sakrament“ im N. T. überhaupt nicht von heiligen Handlungen gebraucht, auch nicht als zusammenfassender Name, weshalb der Streit der Dogmatiker um ihre Anzahl und um den Begriff des Wortes wenig Wert hat.
[51] Das mit „Gemeinschaft“ übersetzte griechische Wort wird 1. Joh. 1 von der Gemeinschaft der christen unter einander und mit Gott und Jesus Christus gebraucht. Das wird sonst, z. B. 4, 10-21 ein Bleiben in Gott und Gottes in ihnen genannt, und dies wiederum wird von denen gesagt, denen Gott von seinem Geiste gegeben hat oder die im Glauben und in der Liebe bleiben und dadurch trotz der Sünde volle Freudigkeit gewissen. Von leiblicher Vereinigung ist auch hier nichts gesagt.
Nicht anders gemeint ist der bei Paulus öfters wiederkehrende Gedanke, daß Christus in den Christen lebt oder wohnt oer daß sie Gottes Tempel sind. Nach Röm. 9, 9-17; 1. Kor. 2, 10-16; 3, 16 ist dies dasselbe wie wenn es sonst heißt: Sie haben Christi Sinn; Christi Geist, der ja göttlicher Geist ist, wohnt und wirkt in ihnen, läßt sie Gottes Wesen recht erkennen, gibt ihnen die Kraft zu neuem gottgefälligen Leben. Näher bestimmt bedeutet es: Die göttliche Liebe, die ihnen in Jesus Christus sich erwiesen hat, die hat in ihnen das starke Vertrauen und die brünstige Gegenliebe erweckt, die ihr ganzes Leben auf neue Grundlage gestellt und in neue Richtung gebracht haben, hält in ihrer Seele sein heiliges Bild – zum Trost wie zur Mahnung – stets gewärtig, ja hat sie ganz gefangen genommen, hält sie ganz in ihrer Gewalt, beherrscht, treibt, begeistert sie; s. Röm. 5, 5.8; 2. Kor. 5, 14.15; 13, 5; Gal. 2, 20; Eph. 2, 4-10; 3, 14-19. – Wieder nur eine andere Betrachtungsweise, ein anderes Bild für dieselbe Sache ist es, wenn von den Christen gesagt ist: Sie „leben in Christus“ oder „mit Christo in Gott“ oder „haben Christum angezogen“, wie Phil. 3, 8.9; Kol. 3, 3; Gal. 3, 26-29. Die Christen bedecken gleichsam ihre Mängel, ihre Blöße mit Christi Barmherzigkeit wie mit einem schützenden Mantel, hüllen sich in seine göttliche Liebe ein wie in ein neues Ehrenkleid. Vgl. Jes. 61, 10. Es handelt sich aber auch hier überall um ein geistiges, persönliches, sittliches Verhältnis.
Wenn ferner Paulus die Gemeinde des Herrn seinen Leib und ihn selbst ihr Haupt nennt, so ist das selbstverständlich nur vergleichsweise gesagt, drückt im Bilde die Führung durch das Haupt und den gegenseitigen Dienst der Glieder aus, sowie die innige Verbundenheit in dem einen Geiste, in gleicher Gesinnung (Röm. 12, 3-6; 1. Kor. 11, 3; 12, 12ff; Kol. 1, 18; 2, 19.20; Röm. 6, 5.6; Phil. 2, 1-5) und [52] durch die erfahrenen gemeinsamen Segnungen und Leiden (1. Kor. 10, 17; 12, 13.26; Kol. 1, 24; 2. Kor. 1, 5-7; 4, 10-12).
Eben das sittliche Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde: die Liebe, die fürsorglich sich hingibt, und die Demut, die gerne dient und sich führen läßt, wird Eph. 5, 22-33 als Urbild für die rechte Führung der Ehe hingestellt. Das ist der Vergleichungspunkt. Versuche, diesen Vergleich in allen Einzelzügen, insbesondere nach den Zitaten aus 1. Mos. 2, 21-24 weiter auszuführen, sind ebenso überflüssig wie verfehlt. Der Sinn von V. 28-31 ist klar: Christus, der mit der Gemeinde so eng verbunden ist wie das Haupt mit den Gliedern eines Leibes, erweist sich nicht bloß als ihr Herr, sondern auch als ihr treuer Versorger, teilt ihr sein Wesen und seine Kraft mit; aus seinem Geiste ist sie ja geboren und von ihm empfängt sie ihr Wachstum (vgl. 4, 12-24). So soll auch der Ehemann an seinem Weibe, mit dem er gleichsam ein Leib ist, sich nicht bloß als der Herr, sondern auch als der liebevolle Versorger erweisen. (31)
Ein Geheimnis, das groß sei, ist 5, 32 das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde genannt: nach Eph. 1, 9-14 und 3, 3-12 deshalb, weil in ihm ein vorher unbekanntes Ziel der göttlichen Weltregierung sich verwirklicht, ein bis dahin verborgener Ratschluß Gottes offenbar wird zum Heile nicht boß der Juden, sondern aller Völker (vgl. Röm. 16, 25.26; Kol. 1, 25-28). Das griechische Wort für Geheimnis (mysterion) ist ein der lateinischen Übersetzung der römischen Kirche hier mit sacramentum wiedergegeben und wird in ihrer Theologie – entgegen der eigenen Erklärung der Epistel – auf die Ehe bezogen, diese deshalb zu den Sakramenten gerechnet. Aber die Ehe ist zunächst ein durchaus natürliches Verhältnis, in der Schöpfungsordnung begründet und aus Neigung und Willen der Eheleute vollzogen. Ihre Rechtsgültigkeit, die sowohl für die Eheleute, wie ganz besonders für die Kinder wichtig und folgenreich ist, hängt ab [53] von der Anerkennung durch die Instanz, der die Rechtspflege obliegt, also durch den Staat, nicht die Kirche, es sei denn, daß diese vom State beauftragt ist. Ein Geheimnis liegt in der Ehe nur insofern, als alles Leben in seiner Erzeugung und seinem Wachstum uns im letzten Grunde ein Geheimnis bleibt. Die Ehrfurcht vor diesem Wunder der Schöpfung soll uns freilich mahnen, auch das geschlechtliche Leben in Ehren zu halten, mit zarter Scheu zu umgeben, es nicht in die Gemeinheit herabzuziehen. Christliche aber wird die Ehe nicht dadurch, daß sie vor einem katholischen Priester geschlossen wird, sonern nur dadurch, daß die Eheleute sie in christlicher Gesnnung führen. Dazu werden sie sich den Segen Gottes erbitten und, wenn sie anders lebendige gleider der Kirche sind, auch deren Zuspruch und Fürbitte begehren. Ein Gelübde, das Eheleute sich als vor Gottes Angesicht geben, und ein Familienleben, das als vor Gottes Augen geführt wird, ist jedenfalls eine bessere Bürgschaft der Treue als alle Leidenschaft des Blutes, die nur zu leicht verfliegt, wenn die Wirklichkeit ihre Mängel zeigt und ihre Lasten bringt. Die eheliche Treue aber ist not um der hohen Aufgaben willen, die das Familienleben zu erfüllen hat, besonders in der Kindererziehung. Ist es rechter Art, sind die Eltern den Kindern nicht bloß Ernährer und Zuchtmeister, sondern auch Vorbild, so ist es die beste Schule der Selbstverleugnung und des Gemeinschaftssinnes und somit auch die beste Vorschule für die Einfügung in das Gemeinde- und Volksleben. Gegenüber dem A. T. aber, das dem Manne noch das Recht willkürlicher Scheidung gab, das Weib seiner Laune preisgab, bedeutet die christliche Auffassung einen großen Fortschritt, indem sie von beiden Teilen Treue fordert und auch dem Weibe seine Ehre gibt. Vgl. Matth. 5, 27-32; 19, 3-9; 1. Kor. 7, 10-17; 1. Petr. 3, 1-7.
Der Verzicht auf die Ehe ist an sich nichts heiliges und verdienstliches, am wenigsten wenn man sich dadurch nur den Pflichten und Lasten der ehe entziehen will. Die dankbare Freude am Kinde, diesem Gottesgeschenk, und die opferwillige Mutterliebe und Vatergüte sind frömmer als ein Einsiedlertum, das nur sich selber lebt. Die Ehelosigkeit hat vielmehr, da der Naturtrieb bleibt, ihre besonderen Versuchungen; ihnen erliegen manche, [54] besonders solche, denen sie aufgezwungen ist (1. Kor. 7, 9; 1. Tim. 4, 1-5; 5, 11-14). Das ist auch von dem Zölibat des katholischen Priesterstandes bekannt. Nach 1. Tim. 3, 2-5 u. Tit. 1, 6 sollen deshalb zu Bischöfen (Vorstehern der Kirchengemeinden) Männer gewählt werden, die in Einehe leben und musterhafte Familienväter sind. Aus besonderen Gründen kann sich indes der Verzicht auf die Ehe empfehlen: so etwa in Verfolgungszeiten (1. Kor. 7, 26) oder einer besonderen Aufgabe wegen, wie sie z. B. Jesus hatte und Missionare haben können (Mtth. 19, 12; s. andrerseits 1. Kor. 9, 5), oder wegen besonderer Veranlagung, Abneigung gegen das Geschlechtsleben, oder wegen mangelnder Gesundheit, bei der die Erzeugung gesunder, lebenskräftiger Kinder nicht möglich ist, vollends bei ansteckender Krankheit. Im letzten Falle ist ohne Frage die Enthaltung vom Geschlechtsverkehr Pflicht, selbstverständlich niht bloß vom ehelichen, sondern auch vom außerehelichen, der ja ohnehin unchristlich ist.
Ein gesundes, kräftiges Volks- und Gemeindeleben und rechte Erziehung ist ohne die Grundlage gesunden Familienlebens nicht denkbar; Anstaltserziehung bleibt Notbehelf. Ein solches muß deshalb jedem Stand und Beruf ermöglicht sein. Alles was dies hindert: Übermäßige Ausnutzung der Arbeitskräfte, unzureichende Entlohnung, ungesunde und überfüllte Wohnungen, Boden-, Miets- und Geldwucher, der durch gemeinnützige Unternehmungen erschwert, Wirtshausleben, Trunksucht, Geschlechtskrankheiten, und alles was die Unzucht und Schamlosigkeit fördert: der sittliche Schmutz in Litteratur und Kunst, auf Theater- und Lichtspielbühnen, Bordellgelegenheit, Kupplertum – alles das muß mit größtem Nachdruck bekämpft werden, vom Staate mit seinen Mitteln, von der Kirche mit ihren Mitteln. Beide haben daran gleich hohes Interesse und gleich ernste Pflicht. Und alle Berufsklassen sollten gemeinsam für diesen Kampf sich einsetzen, statt mit einander zu hadern und einander zu erbittern. Jeder Beruf hat zwar das Recht, seine Interessen zu vertreten. Aber die Formen, in denen jetzt zumeist der Klassenkampf geführt wird, sind höchst unwürdig. Sie wären unmöglich, wenn auf beiden Seiten christliche Gesinnung oder auch nur Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Wohlwolen das Verhalten bestimmte. Armut und Verkommenheit sind gewiß oft eigene Schuld, aber durchaus nicht immer; und wo es der Fall ist, muß die christliche Barmherzigkeit doch zu retten suchen, was zu retten ist. Der Neid [55] und Haß der Minderbemittelten ist gewiß unchristlich, zuweilen wohl auch ein künstliches Erzeugnis parteifanatischer oder geschäftsmäßiger Verhetzung. Aber er wird nicht schwinden, wenn nicht zuvor der ebenso unchristliche Hochmut und Geiz der Bevorzugten schwindet. Und mehr noch als schäbiger Geiz, unersättliche Habgier, rücksichtsloser Geschäftsbetrieb und protziger Luxus erbittert eine geringschätzige, hochmütige Behandlung. Je höher einer steht oder zu stehen meint, desto größer ist seine Verantwortung, und im Bewußtsein derselben sollte er desto demütiger sein. Und je bevorzugter einer ist, desto mehr hat er Ursache, dankbar zu sein und voranzugehen in der Friedfertigkeit und Brüderlichkeit. Jak. 2, 1-9. Die Abhängigen und Dienenden müssen dagegen anerkennen, daß der Unternehmer nicht bloß für sich, sondern zugleich für alle seine Angestellten Gelegenheit zum Verdienst schafft, und daß die geistige Arbeit und die Sorge und Verantwortung der leitenden Personen auch Arbeit ist und ihres Lohnes wert (vgl. Luk. 10, 7; 1. Kor. 9, 11-14), ja oft mehr Kraft verzehrt als körperliche Arbeit. Es kann auch nicht alles gleich gemacht werden. Begabung, Geschick, Kenntnisse, Erfahrung und Fleiß sind überall verschieden; deshalb werden auch Erfolg und Entlohnung stets verschieden sein. Aber es sollte nicht sein, daß die einen schlemmen und die andern darben. Und auch die geistige Arbeit muß geschützt werden, damit nicht z. B. der Erfinder hungert, während der Ausnutzer Millionär wird. Die Gütergemeinschaft der ersten Christen zu Jerusalem hat sich nicht bewährt; das Verkaufen der Äcker, der Nahrungsquelle, und Verteilen des Erlöses führte zur Verarmung der Gemeinde, so daß Paulus für sie sammeln mußte.
Das Christentum verheißt weder ein Leben in fauler Üppigkeit des Reichtums, noch billigt es ein arbeitsscheues Bettlertum der Armut. Vielmehr soll jedermann, solange ers vermag, sein selbstverdientes Brot essen, statt andern zur Last zu fallen, und wenn ihm ein übriges zufällt, den notleidenden helfen, statt es unnütz zu vergeuden oder nutzlos aufzuhäufen. 1. Thess. 4, 11.12; 2. Thess. 3, 10-12; Eph. 4, 28. Über das A. T., das in der Arbeit eine Strafe der Sünde sah, führt das Christentum hinaus zu der höheren Auffassung, die in der Arbeit einen Segen sieht, ein Mittel, [56] Gesundheit und Kräfte zu stählen, und es für Freude erachtet, etwas gutes und nützliches zu schaffen und seinen Mitmenschen damit zu dienen, auch eigenes Leid dadurch zu überwinden.
Mit Almosen, die doch immer etwas demütigendes für den Empfänger haben, so nötig sie zur Stillung der größten Not oft sind, wird die soziale Frage nicht gelöst, auch mit Kranken-, Invaliden-, Alters- und Erwerbslosenversicherung noch nicht, so zweckmäßig sie auch sein mögen. Erst wenn jeder gesunde, kräftige Mann die Möglichkeit hat, mit ehrlicher Arbeit, sei es Hand- oder Kopfarbeit, sich und seiner Familie ein menschenwürdiges Dasein zu erringen – wozu nicht bloß das Nötige an Nahrung, Kleidung und Wohnung, sondern auch „Zeit und Kraft zur Pflege des seelischen Lebens“ gehört – erst dann wird der soziale Friede wiederkehren und werden beide, Unternehmer und Arbeiter, rechte Freude an ihrer Tätigkeit haben. Auch die Unternehmer: weil sie dann erst ein gutes Gewissen haben und zuverlässige, willige Leute finden, die aus eigenem Interesse das Unternehmen fördern.
Unterordnung ist notwendig. Ein gemeinsames Werk kann nicht gedeihen, wenn alle befehlen wollen; je größer es ist, desto weniger. Die gemeinsamen Siedelungen früherer und neuester Zeit z. B. sind meistens gescheitert an dem Eigenwillen, Unverstand und Unfleiß von Mitgliedern. Auch das Christentum hat den Unterschied zwischen Herr und Knecht, Frau und Magd, Regierenden und Gehorchenden, Führenden und Folgenden nicht aufgehoben. Tit. 2, 9.10; Kol. 3, 22 – 4, 1. Aber es hat die Herren gelehrt, sich selbst nicht höher zu achten denn als begnadigte Sünder vor Gott, andererseits auch in den Dienenden ihre Brüder und Schwestern, Kinder des einen himmlischen Vaters zu sehen und zu ehren. In überaus feinsinniger und zartfühlender Weise legt Paulus dies dem Philemon ans Herz (s. den Brief). Und indem das Evangelium den Dienenden diesen höchsten Adel, den der Gotteskindschaft gab, und sie lehrte, in der treuen Pflichterfüllung einen Gottesdienst zu sehen, hat es sie innerlich befreit von dem Gefühl der Erniedrigung durch ihre irdische Berufsstellung. Jede, auch die allerniedrigste Arbeit, hat ihren Wert als Dienst zum Gedeihen der Gesamtheit, und ist demgemäß zu ehren, um so höher, je härter sie ist. Vgl. 1. Kor. 12, 14-26.
[57] Nur muß eben auf beiden Seiten dieses christliche Bewußtsein leben. Daß es so selten geworden ist, das ist die letzte Ursache der erschreckenden Vertiefung der Kluft zwischen den Berufsklassen. So tut es doppelt not, mitzuhelfen, mitzukämpfen u. mitzubeten, daß Gottes Reich komme auf Erden.
Die Christen der ersten Jahrzehnte haben erwartet, daß die Herrschaft Gottes und seines Christus auch äußerlich bald in die Erscheinung treten werde. „Freuet euch! Der Herr ist nahe“ – so tröstet Paulus sich und seine Gemeinden in den Verfolgungsnöten (Phil. 4, 5). Mit dem hoffnungsvollen Maràn athâ d. h. unser Herr kommt (1. Kor. 16, 22 vgl. 11, 26 u. Offb. 22, 20) schloß auch die älteste uns bekannte (nachapostolische) Abendmahlsliturgie. Aber sie haben auch gewußt, daß sie Jahr und Tag nicht bestimmen konnten und daß zuvor das Evangelium allen Völkern verkündet werden müsse (Mrk. 13, 10.32), ohne freilich die Weite der Aufgabe überblicken zu können. Die es nicht erlebten, starben in der Hoffnung, daß sie daheim sein würden bei ihrem Herrn, der ihnen vorangegangen war zu seinem Gott (2. Kor. 5, 8; Phil. 1, 21.23; Joh. 14, 1-2). Und sein Gott war ja auch der ihre geworden; der neue Geist, der ihnen gegeben war, ihr neues Leben aus Gott konnte nicht vergänglich sein, war ihnen ein Unterpfand der Hoffnung (2. Kor. 5, 5; Röm 8, 14-17; Joh. 10, 27.28). Das war ein lichteres Ziel als das schattenhafte Dasein in der Unterwelt, von dem das Altertum sich erzählte und vor dem auch den frommen Israeliten noch graute. „Nicht dankt dir die Unterwelt, nicht preist dich der Tod; nicht harren, die in die Gruft hinabgestieben, auf deine Treue“ – so betete noch der König Hiskia (Jes. 38, 18; vgl. Ps. 6, 6).
Die Verfasser der Neutestamentlichen Schriften wußten auch alle noch nichts von jenem Zwischenzustande: dem „Fegefeuer“ der alexandrinischen Theologen und der römischen Kirche, jenem läuternden Straffeuer für nicht vollendete Seelen, und erst recht nichts von den päpstlichen Ablässen (32) und priesterlichen Seelenmessen, die aus ihm befreien sollen gegen allerlei außer der Beichte zu leistendende kleine Genugtuungen, wie z. B. [58] Rosenkranz und andere Gebetsformeln, viele Male wiederholt (dem Verbote Matth. 6, 7 zum Trotz), Geldopfer (s. dagegen ApG. 8, 20), Almosengeben, kirchliche Stiftungen, Fasten, Wallfahrten zu Bildern und Reliquien von Heiligen oder gar nach Rom oder Jerusalem. Kann etwa durch solche äußerliche Zeremonien und Werke gottlose und lieblose Gesinnung, die eigentliche Sünde und der andern Sünden Wurzel (Mtth. 15, 19), wieder gut gemacht werden)? Wenn aber Gott durch Jesus Christus die Sünder mit sich versöhnt, von ihrer Gewissensnot befreit hatte, sie an seine unendliche freie Gnade und Güte glauben ließ: wie konnten sie so kleinlich sein zu meinen, daß sie sein großes Heilandswerk durch ihre kleinen Werke, durch Erfüllung solcher Priestergebote ergänzen müßten? – Hatte Gott ihnen vergeben, so hatte er ganz vergeben, auch die wirkliche, persönliche Schuld, auch große Schuld (Paulus z. B. nennt als solche seine Verfolgung der Christen) und nicht etwa bloß die Erbschuld (die nach römischer Theologie durch die Taufe getilgt sein soll); hatte Gott sie zu seinen rechten, lieben Kindern angenommen, dadurch auch in ihnen die rechte Liebe erweckt, so hatten sie auch ein Anrecht auf das Vaterhaus. Ihr Gott war nicht wie ein altrömischer Richter oder ein deutscher Rechtsanwalt, sondern der himmlische Vater Jesu Christi: er verlangte nicht, daß sie zuvor alle einzelnen Sünden abbüßten, welches unmöglich war (s. Luk. 18, 9-14; 23, 43; Mtth. 18, 21ff). Gewiß wollten sie das etwa anderen angetane Unrecht nach Möglichkeit wieder gut machen und neues Unrecht meiden, ja ihre Reue über die Sünde und ihre Dankbarkeit für die unverdiente Gnade erweisen durch doppelten Eifer im Gutestun, wie Zachäus Luk. 19, 1-10. Außerdem mußten sie sich sagen, daß die natürlichen folgen der Sünde nicht ausbleiben können („alle Schuld rächt sich auf Erden“), denn sie dienen nach Gottes Ordnung zur Warnung und Erziehung der Menschheit. Aber nichts mehr, weder Tod noch Leben, weder gute noch böse Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, konnte sie scheiden von der Liebe Gottes, die ihnen in ihrem Herrn, Jesus Christus, Wirklichkeit geworden war (Röm. 8, 31-39).
Seine Verrichter und Feinde aber schließen sich selber von seiner Gemeinschaft aus und damit von der Gemeinschaft mit Gott; denn der letzte Grund ihrer Feinschaft ist doch, daß sie nicht wollen ihre böses Wesen erkennen und sich davon befreien [59] lassen (Joh. 3, 17-21; 5, 42; 1. Joh. 1, 8-10). Diejenigen, zu denen das Evangelium noch nicht gekommen war, sind deshalb nicht verdammt. Sie sind nach dem Maß ihrer Erkenntnis zu beurteilen. Denn sonst gehörten ja auch ein Abraham, ein Mose, ein Elia und alle anderen Frommen vor und außer der Christenheit zu den Verdammten, was schon durch Luk. 16, 23; 9, 30; 12, 47.48 ausgeschlossen ist.
Die erste Christenheit hat in der Drangsal der Verfolgungen das Kommen ihres Herrn in Herrlichkeit, die Vollendung seines Reiches herbeigesehnt. Aber sie hat auch gewußt, daß dieses Reich die innere Umwandlung der Menschen, neue Herzen, neuen Sinn zur Voraussetzung hatte, folglich nicht durch Ungeduld und äußere Mittel sich herbeizwingen ließ. Die Weltgeschichte hat es bestätigt: weder Kreuzzüge noch Ketzertribunale, weder politische noch soziale Revolutionen, weder monarchische noch demokratische Tyranneien haben der Menschheit die Glückseligkeit, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Güte gebracht; auf diesen Wegen hat imme rnur eine Ungerechtigkeit die andere, eine Bedrückung die andere abgelöst. Und äußeres Glück, Reichtum und Wohlleben hat, wenn die Charakterfestigkeit fehlte, sowohl im Völker- wie im Einzelleben sittlichen Niedergang und damit bald den Verfall gebracht. Auch verfeinerte Bildung und schöngeistiges Genießen schützt davor nicht und führt die Menschen nicht zum Frieden mit sich selbst und unter einander, wenn sie im Grunde ihres Wesens Egoisten und zuchtlos bleiben. Werden die Gegensätze zwischen Reich und Arm, Herrschenden und Dienenden zu schreiend, so droht ein jäher, gewaltsamer Ausgleich; Revolutionen gleichen den Fiebererscheinungen des kranken Körpers, sind ein Anzeichen ungesunder Zustände, die nicht rechtzeitig erkannt und bekämpft sind. Und der Fieberhitze folgt nicht immer die Genesung: Die blindwütenden Mächte der Zerstörung arbeiten schneller als die besonnen aufbauenden Kräfte; die Aufpeitscher der Leidenschaften finden leichter Gehör als die Stimmen der Gerechtigkeit, der Einsicht und der Mäßigung.
Aber hat nicht auch das Christentum versagt? Haben nicht christliche Herren und christliche Völker die Schuld furchtbarer Verfolgungen und Bedrückungen, Kriege und Revolutionen auf sich geladen? – Weit gefehlt! Nicht das Christentum hat versagt, sondern diejenigen, die mit Unrecht sich Christen nannten, bloße Gewohnheitschristen oder Heuchler waren oder einer Karikatur, einer Verzerrung des Christentums anhingen.
[60] Christliche Völker gibt es überhaupt noch nicht, sondern nur einige Christen in diesen Völkern. Oftmals wollten übrigens die Urheber des Unheils gar nicht Christi Jünger heißen, waren vielmehr – offen oder heimlich – seine Feinde. Auch jetzt fordern große Gruppen die Abschaffung des Christentums, weil es mit ihrer falsch verstandenen Menschenwürde, ihrer Selbstvergötterung unvereinbar sei oder weil es den Klassenhaß und -kampf und die gesellschaftliche Zügellosigkeit, den Kampf gegen die Ehe nicht erlaube, womit sie freilich dem Christentum ein gutes, sich selbst ein schlimmes Zeugnis ausstellen.
Aufwärts kann die Menschheit nur gehen, wenn sie den rechten Führern folgt, denen, die ihre Führeraufgabe richtig und rechtzeitig erkennen und selbstlos erfüllen, ihr Führen und Regieren nicht als ein Mittel zur Befriedigung persönlicher Wünsche oder einseitiger Parteiinteressen betrachten, sondern als einen Dienst an der Gesamtheit, insbesondere an denen, die sich selbst nicht führen, nicht schützen und aufrichten können. Durch die rechten Männer, die christlichen Charaktere, muß der rechte Geist auch in die Sitte, in die Gesetzgebung, in die Verwaltung, in die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft der Berufsklassen und in der Verkehr zwischen den Völkern kommen, ohne daß die äußeren Formen überall die gleichen zu sein brauchen. Erst schwache Anfänge sind hie und da vorhanden.
„Das Gesetz Christi: einer trage des andern Last“ – gilt aber uns allen, nicht bloß den Herrschenden. „Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid“, sagt der Herr, „so ihr Liebe unter einander habt“ – und: „Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Paulus faßt es zusammen in die Mahnung: „Ein jeglicher sei gesinnt wie Jesus Christus auch war.“ (33) Darum wollen wir weiter bitten mit dem tapferen und frommen Ernst Moritz Arndt:
„O Gottes Geist und Christi Geist, der uns den Weg zum Himmel weist,
der uns die dunkle Erdennacht durch seine Lichter helle macht;
du Hauch, der durch das Weltall geht als Gottes stille Majestät,
du aller Lichter reinstes Licht, erleucht uns Herz und Angesicht!
Komm, leuchte mit dem Gnadenschein hell in die weite Welt hinein!
Komm, mach uns in der Finsternis des lichten Himmelswegs gewiß!Ach hier ist alles Staub und Nacht, die Wahn und Sünde trübe macht;
ach hier ist alles Not und Tod, geht uns nicht auf dein Morgenrot;
das Morgenrot der bessern Welt, das wie ein Strahl vom Himmel fällt,
als Gottes Macht und Gottes Lust durchblitzt die kranke Menschenbrust.
O Gottes Geist und Christi Geist, der uns wie Kinder beten heißt,
der uns wie Kinder glauben heißt, o komm, o komm, du heilger Geist!“
Anmerkungen:
(1) Gebeine, Kleider, Kreuzesholz und -nägel u. dergl.
(2) der als schöpferischer Geist von der Welt verschieden, ein Wesen für sich, doch im Weltall und in den Menschen wirkt, wie die Sonne am Himmel steht und doch zugleich wirksam ist auf Erden durch ihre Strahlen
(3) die Unlogik des Satzes: „Wenn es Götter gäbe, wie ertrüge ich es, kein Gott zu sein! Also gibt es keinen Gott“ – zeigt nur zu deutlich die beginnende Geistesumnachtung des einst so überaus scharfsinnigen u. hochstrebenden Denkers. Aber sein Ziel war ein falsches. Nicht die römischen Cäsaren, sondern Jesus v. Nazaret behält den Sieg. Und das „Seinwollen wie Gott“ geißeln treffend schon die biblische Legende vom Sündenfall und das deutsche Märchen vom „Fischer un sine Fru“.
(4) So verfiel er auch nicht einer Lebens- und Gottesverneinung, wie sie z. B. das aus Überkultur und Lebensüberdruß entsprungenen buddhistischen Bettelmönchstum lehrte.
(5) So verstanden (nicht als Behauptung absoluter Gottgleichheit) steht diese Stelle nebst den ähnlichen Joh. 10, 30; Kol. 2, 9 nicht in Widerspruch mit Joh. 14, 28 („der Vater ist größer denn ich“), Mark. 10, 18; 13, 32; 1. Kor. 3, 23; 11, 3; 15, 28; 1. Tim. 2, 5 u. a.
(6) Das Wort vom Kamel und Nadelöhr V. 25 ist ein sogen. hyperbolischer d. h. übertreibender Ausdruck, wie sie öfters, auch von Jesus, gebraucht werden, um eine Wahrheit recht kräftig zu betonen; die Einschränkung folgt ja V. 27.
(7) Petrus und andere Apostel und Brüder Jesu waren verheiratet, s. Mtth. 8, 14; 1. Kor. 9, 5. Das Einsiedler- und Mönchstum entstammt den alten ägyptischen und asiatischen Volksreligionen; in Mesopotamien gab es die tanzenden Derwische, in Syrien Säulenheilige der Astarte, in den ägyptischen Serapistempeln nur durch ein Luftloch mit der Außenwelt in Verbindung stehende Zellen für Mönche und Nonnen.
(8) mit Edelsteinen geschmückte und eine goldene Weltkugel tragende
(9) Noch der Syllabus von 1864 verdammt als Irrtum die Lehre, daß die Kirche nicht die Vollmacht habe, Gewalt anzuwenden und keine unmittelbare oder mittelbare weltliche Macht habe.
(10) das griechische Wort bedeutet sowohl Vertrauen wie Treue
(11) Das schließt selbstverständlich nicht aus, daß im Unterricht zur Weckung u. Schärfung der Gewissen das christliche Prinzip auf die Hauptgebiete des sittlichen Lebens angewandt wird, wie es nach apostolischem Vorbilde z. B. In Luthers Haustafel und in seiner Erklärung der zehn Gebote geschehen ist.
(12) Das scharfe Urteil, das Paulus Gal. 1, 6-10 ausspricht, ist gegen solche gerichtet, die das Evangelium Jesu Christi in sein Gegenteil verkehren, die bekehrten Heiden unter das jüdische Gesetzesjoch beugen wollten; da handelte es sich also nicht um verstandesmäßigen Ausbau, sondern um Sein oder Nichtsein des Christentums, um seinen Beruf zur Menschheitsreligion.
(13) Die Lehre von einem wörtlichen Diktat durch den h. Geist ist jetzt wohl allgemein aufgegeben; sie wird ja schon durch Luk. 1, 1-4 und durch die Varianten in den erhalten Handschriften unmöglich gemacht. Es führt immer zu Irrtümern, wenn man von vorausgesetzten allgemeinen Begriffen ausgehend die Wirklichkeit im Einzelnen bestimmen will. So kann man nicht von dem allgemeinen Satze aus: „Die Bibel ist Gottes Wort“ bestimmen, wie sie in Einzelnen beschaffen sein muß, sondern man hat von der wirklichen Beschaffenheit der Bibel ausgehend zu erkennen, inwiefern sie Gottes Wort heißen, d. i. eine Gottesoffenbarung, eine geistige Höherführung der Menschheit zu sein beanspruchen darf. Dabei ergeben sich Stufen des Fortschritts auch innerhalb der Bibel, wie in der gesamten Religionsgeschichte.
(14) Auf den Inhalt der Sätze soll hier nicht näher eingegangen werden. Nur bemerkt sei, daß die Hauptformel: „ein einiger Gott in drei Personen“ nicht mehr brauchbar ist. Denn nach jetzigem Sprachgebrauch sind drei menschliche Personen nicht ein Mensch , sondern drei Menschen, dem entsprechend drei göttliche Personen drei Götter.
(15) Das dritte für ökumenisch gehaltene, das sog. Nicaenum, wird (mit einer Abweichung) auch in den östlichen Kirchen gebraucht, ist aber teils kürzer, teils ausführlicher als das 325 zu Nicäa beschlossene symbolum.
(16) vgl. dazu noch Mtth. 20, 23; Mrk. 10, 18; 13, 32; 14, 32-39; Luk. 22, 28; Hebr. 2, 17.18; 4, 15; 5, 7.8
(17) „Christus ist nicht darum Christus genannt, daß er zwei Naturen hat, sondern er trägt diesen herrlichen und tröstlichen Namen von dem Ampt und Werk, so er auf sich genommen hat; Christus ist der Spiegel des väterlichen Herzens Gottes“ – sagt auch Luther, der sonst jene alte Theorie bestehen läßt.
(18) Außerordentliche Begabung durch Annahme der Zeugung ohne Mannes Zutun zu erklären, ist nicht etwas eigentümlich christliches, sondern lag dem Altertum nahe: auch von Buddha, von ägyptischen Pharaonen, von Pythagoras, Plato, Apollonius v. Tyana und anderen erzählen es die alten Legenden. Dagegen hat das Volk Israel weder sich noch seinen Königen göttliche Herkunft, göttliche Zeugung im eigentlichen Sinne zugeschrieben.
(19) Friedr. Spitta hält aus anderen Gründen die drei Wundererzählungen, die 2, 11; 4, 54; 21, 14 als 1., 2. u. 3. gezählt werden, für eingeschobene Stücke.
(20) Den Beginn der Erfüllung schildert ApG. 2, wobei das Ergriffensein sich bis zu Verzückungsreden und -gesichten steigert und innere Vorgänge in äußeren Bildern sich darstellen.
(21) Die an jüdische und heidnische Anschauungen vom Opfer sich anschließende mittelalterliche Lehre von der Genugtuung, welche Gottes Gerechtigkeit und verletzte Ehre fordern mußten, ehe seine Liebe sich uns zuwenden durfte, ist unvereinbar mit dem Evangelium von der freien väterlichen Gnade Gottes. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat der Vater nicht erst den tugendhaften Sohn geopfert, ehe er dem in Reue zurückkehrenden vergab. Und Jesus selbst hat den Sündern u. Sünderinnen die Vergebung zugesprochen, ohne zuvor den Glauben an solche Genugtuung zu fordern.
(22) Mannigfaltigkeit der Ordnungen bestand auch in der alten Kirche und noch zum Teil bis ins Mittelalter hinein, bei einigen gemeinsamen Grundzügen.
(23) in der Schrift: Formula Missae et communionis pro ecclesia Wittembergensi (1523)
(24) in „Action oder Beruf des Nachtmahls“ (1525)
(25) Es ist sehr zu beachten, daß die Worte 1. Kor. 11, 25 u. Luk. 22, 20 nicht lauten: „Das ist mein Blut“ oder „mein Bundesblut“ wie bei Mrk. u. Mtth., sondern: „dieser Kelch ist das N. T. in meinem Blut“ d. h. der durch meinen Tod bekräftigte, festgemachte Bund“. Dadurch wird dem Mißverständnis vorgebeugt, als ob das Blut Christi getrunken werden sollte – ein schon an sich unvollziehbarer, aber für Israeliten besonders unmöglicher Gedanke: s. ApG. 15, 20; 1. Mos. 9, 4; 3. Mos. 3, 17; 17, 10-16. Auch Joh. 6, 63 ist der buchstäblichen Auffassung nachdrücklich gewehrt („das Fleisch ist nichts nütze“).
(26) Daneben wurden in der alten Kirche auch die von Gemeindegliedern für die Liebesmahle und die Abendmahlsfeier gespendeten Gaben eine Darbringung, ein Dankesopfer genannt.
(27) Wenn Jesus sich von Johannes taufen ließ, so bedeutete das für ihn natürlich nicht die Abkehr von einem gottlosen, lasterhaften Leben, aber doch das Gelübde, allezeit nur den Willen seines himmlischen Vaters zu erfüllen, alle Versuchung, die ihn daran hindern wollte, abzuschlagen, und so sich ganz in den Dienst des wahren Gottesreiches zu stellen, das er nahen sah.
(28) So wird auch in den ältesten uns bekannten Abendmahlsgebeten (in der „Lehre er Apostel“ aus der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts) nur gedankt für Heilsgüter, die der himmlische Vater uns durch sein Kind Jesus kundgetan: Wohnen seines heiligen Namens in unseren Herzen, Erkenntnis, Glauben, ewiges Leben; und diese werden uns gnädig gespendete geistliche Speise und Trank genannt in ausdrücklichem Gegensatz zu der leiblichen Nahrung, für die sonst die Menschen dem Schöpfer zu danken haben. Und gebeten wird Gott nur um Errettung, Sammlung und Vollendung seiner Kirche.
(29) Daß „ist“ gleich „bedeutet“ sein kann, s. z. B. Luk. 8, 11; Mtth. 13, 38.39. Darauf daß in der Fassung bei Paulus und Lukas „der neue Bund“ die mitgeteilte himmlische Gabe ist, und zwar gerade nach dem Wortlaut, wurde oben schon hingewiesen.
(30) d. h. Einführung in Geheimkulte, Mysterien. In diesen wollte man mit allerlei äußerlichen, von den „Eingeweihten“ vollzogenen symbolischen Handlungen, Weiheformeln und geheimnisvollen Zeichen religiöse Güter erzwingen, erstrebte man auch eine leibliche Vereinigung mit der Gottheit mittels Vergottung sinnlinger Dinge, meinte man das Himmlische mit den Sinnen wahrzunehmen und zu genießen. Es war eine Suggestion des Gefühls oder der Phantasie, was man da erlebte. So wollte man z. B. in der Darstellung des winterlichen Sterbens und sommerlichen Wiederauflebens der Naturgottheiten die Vereinigung mit diesen Gottheiten erleben und sich mit ihren Lebenskräften erfüllen.
(31) Die Worte in V. 30: „von seinem Fleische und von seinem Gebeine“ werden von angesehenen Herausgebern des Urtextes für späteren Zusatz gehalten. Sie erscheinen als eine allzu grobe Ausmalung des Bildes. Diese erklärt sich zwar aus dem Anschluß an das Wort Adams 1. Mos. 2, 23, ist aber, wenn sie echt ist, jedenfalls nur als solche zu werten, also nicht buchstäblich, sondern als Bild zu nehmen und nicht auf den einzelnen Ausdruck zu pressen.
(32) Ablaß ist das Erlassen zeitlicher Sündenstrafen auf Erden oder im Fegefeuer. Man erhält z. B. 100 Tage Ablaß jedesmal, wenn man andächtig betet: „Mein Jesus, Barmherzigkeit!“ oder 300 Tage Ablaß jedesmal, wenn man betet: „Süßes Herz Mariä, sei meine Rettung!“ – 100 Tage Ablaß bedeutet Erlaß so vieler zeitlicher Strafen als man abbüßen würde, wenn man ebenso viele Tage lang den alten Kirchensatzungen Buße täte. Welch äußerliches, juristisches und geschäftsmäßiges Wesen zeigt sich in diesem Abzählen und Aufrechnen!
(33) Das ist es, was uns und unserer Kirche immer und vor allem not tut: solche Gesinnung und ihr Erweis im Leben. Darauf allein – nicht auf Einförmigkeit in den Kirchenverfassungen, Gottesdienstordnungen und Lehrdefinitionen – kann und muß sich auch die Einmütigkeit der Christen gründen, um die der Apostel Phil. 2, 1-5 und 1. Kor. 1-4 u. 12-13 so ernst und herzbeweglich ringt.