Zwei wissenschaftliche Kommentare zum Johannesevangelium will ich prüfen: Sind sie offen für eine befreiungstheologische Lektüre, wie Ton Veerkamp sie vorgelegt hat? Oder muss sich Veerkamps politisch geprägte Auslegung von Hartwig Thyen und Klaus Wengst her in Frage stellen lassen? Meine Kommentar-Kommentierung ist ein Blog in drei Teilen – begonnen am 23. Februar 2022 und abgeschlossen am 23. Februar 2023.

Zum Johannes-Blog 2: „Der verborgene Messias“ (5,1 – 12,50)
Zum Johannes-Blog 3: „Der Abschied des Messias“ (13,1 – 21,25)
Inhaltsverzeichnis
Die Auslegungen von Hartwig Thyen, Ton Veerkamp und Klaus Wengst
Hinweise zum Verständnis dieser Besprechung wissenschaftlicher Kommentare – auch für Laien!
Johannes 1,1a: Im Anfang ist das Wort
Johannes 1,1bc-2: Das Wort und der Gott Israels
Johannes 1,3: Schöpfung und Geschichte – zukunftsoffen
Johannes 1,4-5: Leben, Licht und Finsternis
Johannes 1,6-8: Johannes der Zeuge
Johannes 1,9: Das vertrauenswürdige Licht
Johannes 1,10: Die (Menschen-)Welt unter der Weltordnung
Johannes 1,11: Das Eigene und die Eigenen
Johannes 1,12-13: Aus Gott geboren – nicht aus Blut, Fleisch oder Manneswillen
Johannes 1,14a: Das Wort wird Fleisch – ein bestimmter jüdischer Mensch
Johannes 1,14b: Im Fleischgewordenen hat das Wort sein Zelt
Johannes 1,14cd: Das Schauen der Ehre des Einziggezeugten Sohnes vom VATER
Johannes 1,14e: Gnade und Wahrheit oder solidarische Treue?
Johannes 1,15: Johannes als Zeuge seines „Ersten“
Johannes 1,16-17: Ersetzt die Gnade durch Jesus Christus die Tora des Mose?
Johannes 1,18: Der Einziggezeugte, Gottbestimmte, als Exeget des Gottes Israels
Zur Gliederung des Johannesevangeliums
Johannes der Zeuge, der Messias und die Schüler (Johannes 1,19-51)
Johannes 1,19-21: Dreifaches Zeugnis des Johannes, wer er nicht ist
Johannes 1,22-23: Stimme eines Rufenden
Johannes 1,24: Wer sind die Pharisäer?
Johannes 1,25-27: Der Unbekannte, der hinter dem Täufer kommt
Johannes 1,28: Wo liegt Bethanien jenseits des Jordans?
Johannes 1,29: Zweiter Tag – Gottes Lamm und die Verirrung des kosmos
Johannes 1,30-33: Taufe mit Wasser und mit Inspiration der Heiligung
Johannes 1,34: Der Sohn Gottes – einer wie Gott!
Johannes 1,35-39: Dritter Tag – die ersten beiden Schüler Jesu
Johannes 1,40-42: Andreas findet „als Ersten“ den Simon Petrus
Johannes 1,43-44: Vierter Tag – Jesus findet Philippus
Johannes 1,45-46: Philippus bezeugt Nathanael den Messias aus Nazareth
Johannes 1,47-49: Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum
Johannes 1, 50-51: Der offene Himmel über dem Menschensohn
Messianische Hochzeit und messianische Gemeinde (Johannes 2,1-12)
Johannes 2,1a: Eine Hochzeit zu Kana in Galiläa am dritten Tage
Johannes 2,1b-3: Die Mutter Jesu und Jesus mit seinen Jüngern als Hochzeitsgäste
Johannes 2,4-5: Jesu Wort zur Mutter über seine Stunde und ihr Wort zu den Diensthabenden
Johannes 2,6-7: Sechs Wasserkrüge für die jüdischen Reinigungsriten
Johannes 2,8-10: Der Festverantwortliche und der Wein, der Wasser gewesen war
Johannes 2,11: Der Anfang der Zeichen, die Ehre Jesu und das Vertrauen der Schüler
Johannes 2,12: Der Abstieg der messianischen Gemeinde nach Kapernaum
Tempelreinigung und Tempelaufrichtung in drei Tagen (Johannes 2,13-22)
Johannes 2,13: Der Aufstieg des Messias zum Passafest nach Jerusalem
Johannes 2,14-16: Jesu Aktion gegen Händler und Geldwechsler im Tempel
Johannes 2,17: Ist Jesus ein Eiferer, ein Zelot?
Johannes 2,18-21: Das Zeichen des Abbruchs und der Aufrichtung des Tempels
Johannes 2,22: Vertrauen auf die Schrift und Jesu Wort nach seiner Aufrichtung aus den Toten
Nikodemus, der Lehrer Israels (Johannes 2,23-3,21)
Johannes 2,23-25: Jesus vertraut vielen nicht, die auf ihn vertrauen
Johannes 3,1-2a: Nächtlicher Besuch des Pharisäers und Ratsherrn Nikodemus bei Jesus
Johannes 3,2b-d: Nikodemus spricht Jesus als von Gott gesandten Lehrer an
Johannes 3,3: Wer von oben her neu geboren wird, kann das Reich Gottes sehen
Johannes 3,4: Das Missverständnis des Nikodemus
Johannes 3,5: Wer aus Wasser und Geist geboren ist, kommt in das Reich Gottes
Johannes 3,6-8: Das Fleisch und die Sturmwind-Stimme des Geistes
Johannes 3,9-10: Eine (berechtigte?) Frage des Nikodemus, des Lehrers Israels
Johannes 3,11-12: Augenzeugnis von irdischen und himmlischen Dingen
Johannes 3,13: Aufstieg und Abstieg des Menschensohns zum und vom Himmel
Johannes 3,14-15: Die Erhöhung der Schlange und des Menschensohnes
Johannes 3,16: Die solidarische Liebe Gottes zur Welt im Sohn, dem Einziggezeugten
Johannes 3,17-18: Statt Weltverdammung Befreiung durch Vertrauen auf den Namen des Sohnes
Johannes 3,19-21: Das Gerichtsverfahren des Lichts gegen die bösen Werke der Finsternis
Das Zeugnis des Johannes und die Stimme des Bräutigams (Johannes 3,22-36)
Johannes 3,22-24: Jesus und Johannes taufen beide im judäischen Land
Johannes 3,25: Johannesjünger streiten mit einem Judäer über die Reinigung
Johannes 3,26-28: Johannesjünger reagieren eifersüchtig auf den Tauferfolg Jesu
Johannes 3, 29-30: Johannes als der Freund des messianischen Bräutigams
Johannes 3,31-33: Ein Zeugnis von der Erde für den, der vom Himmel kommt
Johannes 3,34: Der Gottgesandte und die Geistbegabung „nicht nach dem Maß“
Johannes 3,35-36: Das Vertrauen auf den Sohn des VATERS und der Zorn Gottes
Die Samaritanerin am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1-42)
Johannes 4,1-3: Jesu erneuter Aufbruch aus Judäa nach Galiläa
Johannes 4,4-6a: Jakobs Brunnen auf Josefs Feld bei der Stadt Sychar in Samarien
Johannes 4,6b-7a: Jesus und die Repräsentantin der Stamm-Mütter Israels
Johannes 4,7b-8: Jesu Bitte „Gib mir zu trinken!“ in Abwesenheit seiner Schüler
Johannes 4,9: Die samaritanische Frau im Konflikt mit Jesus, dem judäischen Mann
Johannes 4,10: Jesus bietet der Frau lebendiges Wasser als Gabe Gottes an
Johannes 4,11-12: Jesus in Konkurrenz zu Jakob – woher hat er lebendiges Wasser?
Johannes 4,13-14: Eine Wasserquelle, die „aufspringt zum Leben der kommenden Weltzeit“
Johannes 4,15: Die Bitte der Frau um ein Ende des Durstes und Wasserschöpfens
Johannes 4,16-18: Der Mann der Samaritanerin, der kein Mann ist, sondern ein Baˁal
Johannes 4,19: Die Frau nennt Jesus einen Propheten
Johannes 4,20: An welchem Ort soll man „sich verneigen“, proskynein?
Johannes 4,21: Die Anbetung des VATERS weder auf dem Garizim noch in Jerusalem
Johannes 4,22: „Rettung, Heil, Befreiung“, sōtēria, kommt von den Juden/Judäern
Johannes 4,23-24: Die Verneigung vor dem VATER im Geist und in der Wahrheit
Johannes 4,25: Die Erwartung des Messias, der alles verkünden wird
Johannes 4,26: Im Reden Jesu mit der Frau geschieht der NAME Gottes: „ICH BIN“
Johannes 4,27: Die Verwunderung der Schüler Jesu über sein Gespräch mit der Frau
Johannes 4,28-30: Die Samaritanerin als messianische Evangelistin ihrer Landsleute
Johannes 4,31-34: Die den Schülern unbekannte Speise Jesu, das Werk Gottes zu vollenden
Johannes 4,35-38: Jesu Rede über die Ernte zum Leben der kommenden Weltzeit
Johannes 4,39-42: Die Samaritaner erkennen Jesus als den Befreier der Welt
Das andere messianische Zeichen in Kana, Galiläa: „Dein Sohn lebt!“ (Johannes 4,43-54)
Johannes 4,43-45: Die Aufnahme Jesu, der in seiner patris, „Vaterstadt“, nichts gilt, in Galiläa
Johannes 4,48: Ohne Zeichen und Machterweise Gottes ist kein Vertrauen möglich
Johannes 4,49-53: Das durch das Leben des Sohnes bestätigte Vertrauen des Hofbeamten auf Jesu Wort
Johannes 4,54: Das zweite Zeichen, das den Messias Jesus offenbart
Johannes-Blog 2: „Der verborgene Messias“ (5,1 – 12,50)
Johannes-Blog 3: „Der Abschied des Messias“ (13,1 – 21,25)
↑ Mein Johannes-Blog
So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich lese zwei Bücher, zwei dicke Bibelkommentare – eigentlich sogar drei, denn ich vergleiche, was ich bei Hartwig Thyen und Klaus Wengst lese, mit Ton Veerkamps Auslegung – und meine Gedanken dazu schreibe ich nicht nur ins Unreine auf, um sie später zu einem ausführlichen Beitrag zusammenzufassen, sondern fortlaufend gleich hier ins Internet. Mein erster Blog – mein Johannes-Blog! Ich verstehe ihn als eine Baustelle für Gedanken, die im Werden sind, möglicherweise über Monate hin. Heute, am 23. Februar 2022, fange ich an. Speichern werde ich den Blog immer unter dem Datum der letzten Änderung – und dabei im Titel vermerken, bis zu welchem Abschnitt im Johannesevangelium ich gekommen bin.
Vielleicht lässt sich ja auch manche Leserin, mancher Leser – mehr als bei einem fertigen Beitrag – dazu anregen, einen Kommentar zu hinterlassen – mit Anregungen, Fragen, Kritik, von mir aus auch freundlicher Zustimmung.
↑ Die Auslegungen von Hartwig Thyen, Ton Veerkamp und Klaus Wengst
Nachdem ich in den letzten anderthalb Jahren eine ganze Reihe von Büchern über das Johannesevangelium von Veerkamps Auslegung her kritisch kommentiert habe, <1> wurde ich letztens auf zwei wissenschaftliche Kommentare aufmerksam, die mich wirklich neugierig machten. Mit Ton Veerkamp teilen sie zwei Grundvoraussetzungen:
- Sie legen das Johannesevangelium in seiner Endgestalt aus und führen tatsächliche oder angebliche Widersprüche im Text nicht darauf zurück, dass Johannes zwei oder drei schriftliche Quellen mehr oder weniger sorgfältig zu einem durch viele Jesus-Reden ergänzten Evangelium zusammengestückelt hätte. <2>
- Sie nehmen ernst, dass das Johannesevangelium nicht ohne den Rückbezug auf die jüdische Bibel zu verstehen ist.
Hartwig Thyen <3> reizt mich außerdem nicht nur deswegen, weil er mir von meinem Pfarrerkollegen Peter Willared wärmstens empfohlen wurde und theologisch von Karl Barth her geprägt zu sein scheint, sondern auch, weil ich seine Annahme spannend finde, dass Johannes auch die Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas gekannt hat und dass er (T4) „intertextuell mit den alttestamentlichen Texten ebenso wie mit den synoptischen Evangelien in ihren überlieferten redaktionellen Gestalten spielt“. Interessant ist das vor allem deswegen, weil er nicht etwa meint, Johannes hätte die früheren Evangelien ersetzen oder verdrängen wollen, vielmehr werden „diese Prätexte … durch den neuen Text … in Erinnerung gerufen und neu in Kraft gesetzt.“
Klaus Wengst <4> geht insofern noch zwei weitere große Schritte in Richtung einer Auslegung, wie sie Ton Veerkamp vertritt, als (W5) sein exegetisches Suchen zunächst durch die in den 70er Jahren „aufkommende sozialgeschichtliche Fragestellung“ bestimmt war und er sich später genötigt sah, „verstärkt jüdische Tradition und gerade und besonders jüdisch-rabbinische wahrzunehmen.“ Gegen das Argument (W24), die von ihm angeführten „jüdisch-rabbinischen Texte seien in ihrer Masse viel zu jung, um für das Verstehen des Johannesevangeliums eine Rolle spielen zu können“, wendet Wengst ein, dass nach dem Judäischen Krieg bereits im
Lehrhaus in Javne in Aufnahme schon älterer Traditionen der Grund gelegt [wurde] für eine kontinuierliche Entwicklung, die sich literarisch in Mischna, Talmudim und Midraschim niedergeschlagen hat. Auch ein nachweislich junger Text aus dieser Tradition zeigt, dass eine ihm entsprechende Aussage im Neuen Testament eine jüdische Sprachmöglichkeit ist.
Wenn Kritiker seine Art der Johannesauslegung (W12) als eine „Exegese aus schlechtem Gewissen“ bezeichnet haben, weil er sich mit dem Problem auseinandersetzt, dass das Evangelium von jüdischen Leserinnen und Lesern als antisemitisch empfunden werden kann, dann nimmt er diese Kritik positiv auf, indem er „die Integration des Gewissens in den Vollzug exegetischer Arbeit selbst“, also „eine wirklich ‚gewissenhafte‘ Exegese“ anstrebt. Konkret heißt das für ihn (W11):
Für jüdisches Mithören sensibel zu sein, ist keine Frage bloßer Höflichkeit. Es gehört vielmehr zur Sache selbst, weil Jesus und die neutestamentlichen Zeugen keinen neuen und anderen Gott verkündet haben, der bis dahin unbekannt und unbezeugt gewesen wäre, sondern den in Israel bezeugten und bekannten Gott.
Nachvollziehbar finde ich auch, was Wengst über die Zielsetzung eines Evangeliums schreibt, das gegen Ende des 1. Jahrhunderts verfasst wurde (W14):
Der Evangelist Johannes schreibt die Geschichte Jesu neu. Er schreibt sie so, dass die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde in den Auseinandersetzungen Jesu mit „den Juden“ und „den Pharisäern“ ihre eigenen Auseinandersetzungen mit der jüdischen Mehrheitsposition in ihrer Umgebung wiedererkennen, dass sie in der Darstellung der Schülerschaft Jesu sich selbst entdecken kann. Die Erfahrungen, die Johannes und seine Gemeinde in ihrer Gegenwart machen, wirken sich also aus auf seine Darstellung der Geschichte Jesu, färben sozusagen darauf ab. Und so schreibt er die Geschichte Jesu in solcher Weise neu, dass die Gemeinde in den Auseinandersetzungen ihrer Situation gestärkt wird.
Der letzte Satz lässt in meinen Augen aber etwas außer Acht, worauf Ton Veerkamp <5> sein besonderes Augenmerk legt. Das Johannesevangelium mag zwar auch der Ermutigung in einer Phase der Bedrängnis durch die jüdische Mehrheit dienen, aber es ist nicht nur ein aus einer Opferrolle heraus geschriebenes Trostbuch. Sehr deutlich ist es eine Kampfschrift, die sich in erster Linie gegen die Weltordnung richtet, den angeblich durch die Pax Romana wohlgeordneten kosmos, der aber erdrückend auf der Lebenswelt der Menschen (die auch kosmos genannt werden kann) und insbesondere dem Volk Israel lastet. Und die scharfen Angriffe, die im Johannesevangelium gegen die Ioudaoi oder die Pharisaioi laut werden, beziehen sich nach Veerkamp darauf, dass Johannes dem zu seiner Zeit entstehenden rabbinischen Judentum vorwirft, sich in einer Nische des Römischen Reiches als „erlaubte Religion“, religio licita, einzurichten und nicht wahrzunehmen, dass der Messias Jesus diese schlimme Weltzeit durch den freiwillig auf sich genommenen Tod am Kreuz längst überwunden hat und dass es jetzt darauf ankommt, durch „solidarische Liebe“, agapē, diesen Sieg in Form des Lebens der kommenden Weltzeit hier auf Erden tätig zu erwarten.
Indem Wengst abschließend in seiner Einleitung die Infragestellung der johanneischen Gemeinde folgendermaßen auf den Punkt bringt (W29), kommt er allerdings doch der Aussageabsicht, die Veerkamp vertritt, sehr nahe:
Wie kann derjenige der Messias sein, der am Kreuz so schmählich hingerichtet worden ist, wo doch mit dem Messias das Reich der Gerechtigkeit kommt, in dem das Unrecht der Gewalttäter nicht mehr triumphieren kann? Johannes versucht, dem nachzuspüren und es auszusagen, wie denn Gottes Gegenwart und Handeln in diesem bestimmten Schicksal Jesu gedacht werden kann.
↑ Hinweise zum Verständnis dieser Besprechung wissenschaftlicher Kommentare – auch für Laien!
[27. März 2022] An dieser Stelle schiebe ich nachträglich klärende Hinweise ein, bevor nach dem einführenden Abschnitt zum Prolog des Johannesevangeliums dessen fortlaufende Auslegung beginnt.
Als ich im Abschnitt zu Johannes 1,35-39 stundenlang im Internet nachschauen musste, was Hartwig Thyen in seinem Kommentar mit dem „Gesetz des Verisimile“ meint (siehe Anm. 128), habe ich mich gefragt: Wenn manche seiner Formulierungen schon mich als studierten Theologen überfordern, wie soll dann jemand ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse begreifen können, was ich hier über die Erkenntnisse dreier Exegeten herauszufinden versuche?
Ich hoffe trotzdem, auch für wissenschaftliche Laien so verständlich wie möglich rüberzubringen, was ich selbst verstanden habe – falls mir das nicht gelungen ist, scheuen Sie sich bitte nicht, mir in Kommentaren das mitzuteilen und nachzufragen!
Zugleich bin ich daran interessiert, auch wissenschaftlichen Standards zu genügen. Wie in Anm. 3 und Anm. 4 beschrieben, verweise ich auf die jeweils folgenden Zitate von Thyen und Wengst jeweils durch Seitenzahlen in runden Klammern (…) mit einem vorangestellten „T“ oder „W“. Da mir Ton Veerkamp erlaubt hat, seine Johannes-Auslegung auf meiner Homepage zu veröffentlichen, kann ich auf sie durch einen direkten Link verweisen (siehe Anm. 5). Auf von diesen Autoren benutzte Literatur verweise ich in Anmerkungen, wobei ich abgekürzte Literaturangaben aus dem jeweiligen Literaturverzeichnis vervollständige.
Um das Verständnis zu erleichtern, gebe ich Wörter in griechischer oder hebräischer Schrift mit einer einfachen deutschen Umschrift wieder <6> und ergänze deutsche Übersetzungsmöglichkeiten in Anführungszeichen. Fremdsprachlichen Ausdrücken in zitierten Texten füge ich jeweils eine Übersetzung oder Erläuterung in geschweiften Klammern {…} hinzu. Manchmal verlinke ich ein Fremdwort (etwa das oben erwähnte Wort „Verisimile“), das in einem Zitat vorkommt, auch mit einem Eintrag aus Wikipedia, der natürlich im Original nicht damit verbunden war.
Auf biblische Bücher verweise ich in meinem eigenen Text mit den Angaben, die in der evangelischen Lutherbibel üblich sind. In den Kommentaren werden in der Regel andere Bezeichnungen und Abkürzungen verwendet. Besonders bei den fünf Büchern Mose ist es wichtig, die alternativen Namen zu kennen:
- 1. Mose = Genesis (Gen)
- 2. Mose = Exodus (Ex)
- 3. Mose = Leviticus (Lev)
- 4. Mose = Numeri (Num)
- 5. Mose = Deuteronomium (Dt oder Dtn).
Hinzu kommen unterschiedliche Namen bei folgenden Büchern:
- Sprüche Salomos (Spr) = Proverbien (Prov)
- Prediger Salomo (Pred) = Ecclesiastes (Ecc) = Kohelet (Koh)
- Hoheslied Salomos (Hld) = Cantica (Cant)
- Hesekiel (Hes) = Ezechiel (Ez)
Nähere Angaben finden sich auf Wikipedia in dieser Liste biblischer Bücher.
Weitgehend verzichte ich auf die uns vertraute Bezeichnung Altes Testament für die jüdische Bibel, als sei sie durch das, was Jesus Christus gebracht hat, überholt. Stattdessen sage ich lieber „die Schriften“, „die jüdischen Schriften“, „die jüdische Bibel“ oder ich verwende die Abkürzung TeNaK (oft auch „Tanach“ geschrieben).
Dieses Kunstwort steht für die hebräischen Anfangsbuchstaben der thora = 5 Bücher Mose, der neviim = Vordere und Hintere Propheten (erstere entsprechen in unserem Alten Testament den vier Büchern Josua, Richter, Samuel und Könige, letztere den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dem Zwölfprophetenbuch) und der khetuvim („Schriften“, nämlich einerseits Psalmen, Sprüche, Hiob und Fünf Rollen [Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther] und andererseits Daniel, Esra, Nehemia und Chronik).
Was ist dann aber mit dem Namen Neues Testament für die Texte der Bibel, die von Jesus Christus handeln und durch die wir uns als christliche Religion von der jüdischen unterscheiden? Wir können sie die messianischen Schriften nennen, wenn wir uns bewusst machen wollen, dass ihre Autoren ursprünglich keine neue Religion begründen, sondern Jesus als den Messias Israels verkünden wollten.
Wie eng diese messianischen Schriften mit der jüdischen Bibel zusammenhängen, zeigt sich auch darin, dass in ihnen von keinem anderen Gott die Rede ist als dem Gott Israels. Dieser Gott trägt nach 2. Mose 3,14 einen ganz bestimmten NAMEN, der unzertrennlich mit der Befreiung Israels aus jeglicher Sklaverei verbunden ist und wegen seiner Unverfügbarkeit mit dem Tetragramm („Vierbuchstabenwort“) JHWH nur geschrieben, aber nicht ausgesprochen wurde. Ähnlich wie Juden auf Hebräisch das Tetragramm mit ha-schem, „der Name“, umschreiben, verwende ich im Folgenden das in Großbuchstaben geschriebene Wort NAME für den befreienden Gott Israels. In gleichem Sinn schreibe ich das Wort VATER in Großbuchstaben, wo Johannes in seinem Evangelium das griechische Wort patēr für den NAMEN als den Vater des Messias Jesus verwendet.
Wünschenswert ist, dass am Anfang eines Abschnitts, in dem die Auslegung von Bibelversen besprochen wird, auch eine Übersetzung dieser Verse steht. Das Problem dabei ist: Jeder Exeget übersetzt anders. Denn schon die Art der Übersetzung beruht auf der jeweiligen Auslegung. Es ginge aber zu weit, jedes Mal gleich alle drei Übersetzungen von Thyen, Wengst und Veerkamp zu zitieren.
Darum stelle ich – gelb hinterlegt – jedem Abschnitt die Lutherübersetzung von 2017 voran. Auf diese Weise wird sofort deutlich, wie stark die Übersetzungen der drei Exegeten an vielen Stellen von der deutschen Bibel abweichen, die evangelischen Bibelleserinnen und -lesern vertraut ist. Das trifft insbesondere auf Ton Veerkamp zu, der davon ausgeht, dass der jüdisch-messianische Jesus uns Christen erst einmal wieder fremd werden muss, um ihm wirklich begegnen zu können. Auf die Unterschiede der Übersetzungen gehe ich in der jeweiligen Auslegung ein.
Von Thyen, Wengst und Veerkamp übersetzte Bibelzitate markiere ich ebenfalls gelb, aber jeweils umrahmt von der blauen, grünen und roten Zitatfarbe dieser Autoren, um auf ihre Urheberschaft der Übersetzung hinzuweisen.
↑ Der Prolog (Johannes 1,1-18)
[25. Februar 2022] Die ersten 18 Verse des Johannesevangeliums werden üblicherweise als Prolog bezeichnet, der, so Klaus Wengst (W37), „in komprimierter Weise das Evangelium schon vorweg“ nimmt und daher auch als „Ouvertüre“ <7> bezeichnet werden kann.
Für Hartwig Thyen ist dieser Prolog (T64), ohne „seine mögliche Vorgeschichte“ betrachten zu wollen, der logisch in sich zusammenhängende „Eingangstext unseres Evangeliums“. Als zentralen Schlüsselbegriff sieht er das Wort doxa in 1,14; diese „göttliche Herrlichkeit“ erscheint aber „am fleischgewordenen logos erst in der ,Stunde‘, da Jesus am Kreuz von Golgatha ‚sein Fleisch hingibt für das Leben der Welt‘ (6,51)“. Und erst zusammen mit einem „durch den Geist-Parakleten vermittelten“ Glauben an Jesu Auferstehung (T65) kann Jesu Leiden und Sterben zum „Erkenntnisgrund seiner Herrlichkeit und damit zugleich seines ewigen ‚Seins‘“ werden, „das er noch vor der Grundlegung der Welt bei seinem Vater hatte (17,24).“
Gewaltige theologische Worte verwendet Thyen also gleich zu Beginn seiner Johannes-Auslegung. Es wird zu prüfen sein, was konkret unter sarx und doxa, „Fleisch“ und „Herrlichkeit“, sowie zōē und kosmos, „Leben“ und „Welt“, zu verstehen ist, und ob Johannes wirklich von einem ewigen Sein Jesu bei Gott vor aller Zeit sprechen will.
Wie Thyen wendet sich auch Klaus Wengst gegen alle Versuche, den Prolog durch Rekonstruktionen irgendwelcher Vorlagen besser verstehen zu können. Stattdessen gilt es (W32), „den jetzt vorliegenden Text zu nehmen, wie er ist, den Versuch zu machen, ihn in seiner gewordenen Gestalt als so gewollte Einheit zu verstehen.“ So ist ihm zwar bewusst, dass Johannes auf jüdische Spekulationen über die Weisheit zurückgreift, die in Sprüche 8, Hiob 28, Sirach 24 oder Weisheit 7-9 zu finden sind, aber (W34) er will genauer danach
fragen, warum Johannes die ihm gegebenen Möglichkeiten so nutzt, wie er es tut. Er setzt offenbar bewusst am Anfang seiner jüdischen Bibel an, beim schöpferischen Wort Gottes, das er deshalb mit Jesus identifizieren kann, weil durch ihn und vor allem an ihm wiederum ein schöpferisches Handeln Gottes geschieht. Warum aber beginnt Johannes mit dem von Gott bei der Schöpfung gesprochenen Wort, wenn er doch im Evangelium die Geschichte Jesu erzählen will?
Um diese Frage zu beantworten, vergleicht Wengst (W36) den Prolog mit den Anfängen der anderen Evangelien und stellt ihn insbesondere den Stammbäumen Jesu bei Matthäus und Lukas gegenüber. Auch Matthäus „gibt damit der Geschichte Jesu eine Tiefendimension, indem er sie in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel verankert.“ Und Lukas „lässt diesen Stammbaum über Abraham hinaus bis auf Adam und über diesen bis auf Gott selbst zurückgehen.“ Wengst meint aber nun:
In dieser Linie kann der Prolog des Johannesevangeliums nicht gesehen werden – als werde hier nun dieser Anfang bei Gott noch stärker betont und breiter ausgeführt. Johannes stellt nicht, wie es ein Stammbaum tut, eine entwicklungsgeschichtliche Abfolge dar; er zeichnet keine kontinuierliche Linie nach.
Das tut aber doch auch Matthäus in seinem Stammbaum Jesu nicht! Indem der Evangelist dort die Namen von fünf Frauen mit angezweifeltem Ruf in eine lange Abstammungsliste ehrenwerter Stammväter Israels einreiht (vgl. dazu meine Predigt Männer und Frauen im Stammbaum Jesu), weist auch er keine stammesgeschichtliche Kontinuität nach, die bruchlos zum Messias führt; vielmehr ist es (übrigens wie schon bei Sara, die dem Abraham, wie in 1. Mose 21,2-3 drei Mal betont wird, den von Gott verheißenen Sohn Isaak gebärt) allein Gott, durch dessen Willen dem Josef sein Sohn Jesus von Maria geboren wird. Und wenn Lukas seinen Stammbaum Jesu bis auf Gott zurückführt, will er nicht dessen biologische Abstammung von Gott beweisen, sondern er setzt neben die Erzählfigur der Jungfrauengeburt noch einen zweiten Hinweis darauf, dass Jesus in seinem ganzen Willen und Wesen vom Gott Israels her bestimmt ist.
Wir werden schauen müssen, ob Johannes wirklich etwas anderes als Matthäus und Lukas meint, wenn er, wie Wengst sagt, „vom anfänglichen Sein des Wortes bei Gott“ spricht und damit den Anfangsgrund und schlechthinnigen Ursprung bezeichnen will, „auf den die folgende Erzählung bezogen ist, in dem sie gründet.“ Und wie bei Thyen wird in der Einzelauslegung der Verse des Prologs zu fragen sein, ob es überhaupt angemessen ist, den Begriff des Seins auf die Beziehung des Wortes oder Jesu zu Gott anzuwenden.
Worin soll nun die besondere Funktion des Prologs bestehen? Wengst sieht in ihm ein „Vor-Wort in dem prägnanten Sinn, dass er eine ‚Leseanweisung‘ <8> für die folgende Erzählung gibt“, und er fügt hinzu:
Die Leserschaft erhält hier ein Vorverständnis für ihre weitere Lektüre, einen klaren Durchblick für das, um was es im Folgenden geht.
Im Widerspruch zu der Erwartung, den Prolog auf diese Weise leicht und unmittelbar verstehen zu können, steht aber – worauf Wengst selber (W32) aufmerksam macht <9> – was „Holtzmann vor über hundert Jahren über die Auslegung des Prologs im Ganzen gesagt hat: „Ueberhaupt zeigt jeder Blick in die Commentare, dass die Exegese des Prologs sich von jeher der Methode des Rathens bediente.“
Zu weit geht in meinen Augen jedenfalls eine Schlussfolgerung, die Hartwig Thyen <10> aus einem überlegenen Vorwissen der Leser des Prologs zieht (zitiert von Wengst, W37, Anm. 8):
„Derart ausgezeichnet, teilt der Leser von Anfang an das Wissen Jesu um sein ,Woher‘ und ,Wohin‘ und gewinnt damit eine eigentümliche Überlegenheit über alle Akteure der Erzählung, die Jesu Worte und Taten ständig mißverstehen.“
In meinem Beitrag Ironische Glaubensgewissheit im Johannesevangelium? habe ich eine solche Sicht auf das Johannesevangelium in Frage gestellt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein so großartiger Autor wie Johannes sich an seine Leserschaft quasi anbiedert, indem er ihnen ein billiges Überlegenheitsgefühl über die Akteure seines Evangeliums vermittelt. Vielmehr denke ich, dass Johannes auch von seinen Leserinnen und Lesern eine Menge an Verstehensarbeit erwartet. Er gibt ihnen und erst recht uns als spät geborenen Heidenchristinnen und -christen kein Rezept an die Hand, das uns den Sinn des Evangeliums fast wie von selbst erschließt. Wenn überhaupt irgendwo eine „Leseanweisung“ für das Johannesevangelium zu finden ist, dann besteht sie in dem wiederholten Hinweis darauf, dass die Bedeutung Jesu nur von der jüdischen Bibel her begriffen werden kann, die wir das Alte Testament nennen und die genauer als TeNaK zu bezeichnen ist. Das heißt, wie ich bereits im genannten Beitrag schrieb:
Wir Christen dürfen nicht behaupten, als Leserinnen und Leser des Johannesevangeliums besser über Jesus und seine Ziele Bescheid zu wissen als die Samaritanerin oder Pilatus oder die unwissenden Juden des Evangeliums. Vielmehr sollten wir uns in ihrer Reihe hinten anstellen, um die jüdische Bibel in ihrer befreienden Kraft wirklich ernstzunehmen und erst dann von diesen jüdischen Schriften her Schritt für Schritt auch das Johannesevangelium ganz neu zu begreifen.
Von einer solchen Haltung her wird auch die seltsam anmutende Empfehlung verständlich, die Ton Veerkamp <11> seiner Auslegung des Prologs voranschickt:
Eine Vorrede schreibt man, wenn das Werk vollendet ist. Verstehen kann man sie erst, wenn man das Werk gelesen hat. Sie ist daher ein zusammenfassendes Nachwort, das man dem Text voranstellt, um den Zweck des Textes von vornherein klarzustellen. Die Vorrede wiederholt. Bei der Lektüre empfiehlt es sich, mit der Auslegung ab 1,19 anzufangen, um dann die Vorrede zu studieren.
Gleichwohl steht natürlich auch Veerkamps Beschäftigung mit dem Prolog nicht am Ende seiner Auslegung. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wir nicht die Illusion haben sollten, mit diesen 18 Versen allzu schnell fertig zu sein.
[27. Februar 2022] Das bezieht sich zunächst auch ganz konkret auf den Zeitaufwand für diese wenigen Verse. Er wird größer sein als für die meisten anderen Kapitel und Verse des Evangeliums, denn in ihnen tauchen viele umstrittene Begriffe auf und viele später ausgeführte Aussagen, die hier nur kurz angedeutet werden.
↑ Johannes 1,1a: Im Anfang ist das Wort
1,1a Im Anfang war das Wort.
In welchem Anfang „war“ – oder „ist“, wie Ton Veerkamp übersetzt – welches Wort?
Die Worte en archē, „im Anfang“, rufen den Anfang der jüdischen Bibel auf, wo ab 1. Mose 1,1 – so Wengst – (W38) die Schöpfung als „ein dem Sprechen Gottes entsprechendes Geschehen erzählt wird.“
Auch Thyen führt das Wort logos, „Wort“, (T66) auf das zehnfache „und Gott sprach“ im 1. Kapitel der Bibel zurück, was er in Johannes 1,18 bestätigt sieht, wo Jesus wörtlich als der Exeget Gottes bezeichnet „und damit der Raum für die Geschichte Jesu als sein Sagen eröffnet wird“.
Damit ist auch von vornherein klar: Mit diesem Wort ist in irgendeiner Weise Jesus gemeint. In welcher Weise er mit diesem Wort gleichzusetzen ist, das wird Johannes im Prolog nach und nach entfalten und später im Evangelium ausführlich erzählen.
Sowohl Wengst als auch Thyen verzichten darauf, meines Erachtens mit Recht, das Wort logos außerdem (W40) mit „der griechisch-philosophischen Tradition über ‚den Logos‘“ in Verbindung zu bringen oder davon auszugehen (T66), dass „der Prolog … an eine wie auch immer geartete ‚Logoschristologie‘ anknüpfte, die ihm schon vorausläge“.
Gleichwohl legt Hartwig Thyen großen Wert darauf (T65),
daß die erste Prologzeile mit ihrem ēn {war} deutlich noch hinter den Anfang der schöpferischen Werke Gottes von Gen 1 zurückgreift.
Ehe die Welt durch Gottes Sprechen wurde (egeneto), war (ēn) bereits der (ungeschaffene) logos.
Erst etwas später erklärt Thyen unter Berufung auf Frank Kermode <12> genauer, worin er den Unterschied dieser im Prolog mehrfach verwendeten Worte „war“ bzw. „wurde“ erblickt (T73):
ēn bezeichnet das Sein im Unterschied zum Werden und Geschehen (egeneto). Alles Werden und Geschehen hat einen Anfang und ein Ende, das Sein dagegen ist anfangs- und endlos. ēn prädiziert den transzendenten Schöpfer, egeneto aber die Welt der geschaffenen Dinge. „Gott im Alten Testament und sein Sohn im Neuen haben über das Verbum sein spezifische Rechte; wenn sie sagen Ich bin machen sie ihre göttliche Autorität geltend“ (John as Poet 7). Und wie dieses ,Ich bin‘ immer zugleich ein ,Ich war‘ und ein ,Ich werde sein‘ einschließt, so läßt sich auch das ēn des Prologs nicht auf irgendeinen kalenderzeitlichen Abschnitt reduzieren, sei das in die Zeit vor dem Sündenfall oder sei es in die Zeit des historischen Jesus.
Hier scheint mir Thyen doch bereits dem jüdischen Evangelisten Johannes, der auf den Messias Jesus vertraut, christlich-dogmatische Vorstellungen zuzuschreiben, die auf griechisch-philosophischen Vorgaben beruhen. Genauer gesagt: Er vermischt Denkvoraussetzungen über das Sein und das Werden, die uns aus der linear denkenden Gesichtsphilosophie der Antike bis heute vertraut sind, mit biblischen Vorstellungen über die Autorität Gottes, die von Missverständnissen geprägt sind.
Richtig daran ist, dass das „war“ des Prologs nicht auf eine bestimmte Zeit bezogen werden kann. Aber es meint auch nicht einfach ein überzeitliches, ewiges, jenseitiges Sein im Sinne einer unbeweglichen Unveränderbarkeit, und schon gar nicht eine abstrakte „göttliche Autorität“ im Sinne einer absoluten Allmacht, die über unbeschränkte und willkürliche Herrschaftsgewalt verfügt. Denn Thyen erinnert ja zu Recht an das egō eimi, „Ich bin“, von 2. Mose 3,14, mit dem der Gott Israels seinen NAMEN offenbart. Im Hebräischen steht da die Formulierung ˀehjeh ˀascher ˀehjeh, die man wörtlich mit „ich geschehe, als der ich geschehe“ übersetzen müsste. Und es ist der Auftrag Gottes an Mose, sein Volk Israel aus der Versklavung in Ägypten in die Freiheit zu führen, der den NAMEN dieses Gottes eindeutig im Sinne seines befreienden und Recht schaffenden Willens für das von ihm erwählte Volk bestimmt und festlegt. In dieser Weise bindet der biblisch offenbarte Gott seine von außen unbeschränkte Macht an seine Treue zu Israel; jede Rede von seiner Allmacht darf diese Selbstbeschränkung Gottes aus Liebe zu seinem Volk (5. Mose 7,7-8) nicht aus den Augen verlieren.
Dass schon die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta (abgekürzt LXX), den Gottesnamen in 2. Mose 3,14 mit egō eimi ho ōn, „ich bin der Seiende“, wiederzugeben versuchte, war nicht mehr als eine Notlösung; tatsächlich kommt die Umschreibung der Selbstbezeichnung Gottes in der Lutherbibel mit „ich werde sein, der ich sein werde,“ dem ursprünglich Gemeinten näher.
Ton Veerkamp <13> macht auf das grundsätzliche Problem aufmerksam, das dadurch entsteht, dass auch der jüdische Schriftsteller Johannes, der griechisch schreibt, aber hebräisch denkt, ein griechisches Wort wie einai, „sein“, benutzen muss, um damit ein hebräisches Wort wie haja wiederzugeben:
Das Problem steckt in der Gepflogenheit, das Verb sein als die einzig gangbare Übersetzung für das hebräische haja zu nehmen. In den europäischen Sprachen ist sein fast immer eine Kopula {Bindeverb}. Es verbindet das Subjekt mit dem Prädikat nach der logischen Grundformel S = P, Subjekt ist dem Prädikat gleich.
Eine Kopula kennen die semitischen Sprachen nicht. … Bei Identitätsaussagen verwenden diese Sprachen nicht die Kopula, sondern die schlichte Juxtaposition {Nebeneinanderstellung}.
Haja bedeutet „geschehen, wirken als, existieren als, werden“. Wir können in unserem Text haja nicht mit geschehen übersetzen, weil Johannes dafür ein eigenes Verb hat: ginesthai.
Veerkamp versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass er die Vergangenheitsform ēn nicht mit „war“, sondern „ist“ übersetzt:
Im Anfang ist das Wort.
Das Präsens in den ersten Zeilen des Evangeliums übernimmt in unserer Übersetzung die Funktion des „Schockierens“. Würden wir das traditionelle Imperfektum nehmen, „im Anfang war das Wort“, würde eine historische Reihenfolge suggeriert: „Im Anfang war das Wort, und dann kommt weiteres.“ Das Wort wirkt aber immer als Anfang, als Prinzip, bei allem, was geschieht.
Eigentlich müsste die Veerkampsche Übersetzung „Im Anfang ist das Wort“ auch Thyen gefallen, denn auch er versteht ja die Vergangenheitsform nicht als historische Aussage über eine ferne Daseinsform des Menschen Jesus vor aller Zeit; vielmehr will Johannes in seinen Augen ausdrücken (T73), dass „Gott und sein Logos Herren der Zeit und von zeitlichen Kategorien nicht begrenzt sind“. Von daher kommt er zu der Schlussfolgerung (T74):
Ja, wenn überhaupt erst das Sprechen Jesu Christi und Jesus Christus als dieses Sprechen (ekeinos exēgēsato {jener hat ausgelegt}) die Möglichkeit erschlossen hat, das Unsagbare zu sagen (1,18), dann muß der gesamte Prolog von seinem ersten Vers an als Preisgedicht auf den Fleischgewordenen und nicht etwa als die Erzählung der Vorgeschichte dieser Fleischwerdung gelesen werden. <14>
Damit verlasse ich die Bemerkungen zu dem Wort ēn, „war“, und gehe näher auf einen Satz Thyens über das Wort logos ein (T66), das der
Sache nach nur Prädikat und „Platzhalter“ (Barth) sein kann für den jüdischen Mann Jesus, den erst V. 17 mit seinem Namen und mit seinem messianischen Beruf als den Christus identifizieren wird. Er allein ist das logische und wahre Subjekt des Prologs wie des gesamten Evangeliums. Wie phōs, zōē, alētheia etc. ist, wie schon Origenes gesehen hat, auch logos nichts als sein Prädikat.
Auch hier lauert aber, genau wie bei Thyens Ausführungen über das Sein und die Autorität Gottes, ein Missverständnis. So richtig es ist, in dem logos, „Wort“, von dem Johannes spricht, „den jüdischen Mann Jesus“ zu sehen, so falsch kann es sein, diesen logos und weitere Begriffe wie phōs, „Licht“, zōē, „Leben“, alētheia, „Wahrheit, Treue“, auf Jesus in der Form eines „Prädikats“ zu beziehen, nämlich so, als ob wir schon wüssten, was mit „Wort, Licht, Leben, Wahrheit“ gemeint ist, und das Wesen Jesus dadurch näher zu bestimmen wäre.
Eine solche Vorgehensweise kann leicht dazu führen (und hat schon im griechisch-philosophisch geprägten Heidenchristentum ab dem 2. Jahrhundert dazu geführt), dass man meinte, von diesen Prädikaten her nicht nur Jesus, sondern auch Gott, seinen Vater, neu definieren zu müssen (etwa als den vergebenden im Gegensatz zu einem rächenden oder strafenden Gott).
Auf eine solche Gefahr macht auch Wengst aufmerksam, wenn er sich (W64, Anm. 56) gegen die eben zitierte Behauptung Thyens wendet,
Jesus „allein“ sei „das logische und wahre Subjekt des Prologs wie des gesamten Evangeliums“. Gewiss steht Jesus im Zentrum, aber eben als der, in dem Gott zu Wort und Wirkung kommt, wie ihn die jüdische Bibel in der in ihr erzählten Geschichte bezeugt. Er ist das „wahre Subjekt“, und zwar vom ersten Satz des Evangeliums an.
Johannes versteht Jesus sicher noch strikt jüdisch: Jesus ist Subjekt tatsächlich nur insofern, als er sich ganz und gar als von ihm Gesandter dem Gott Israels unterworfen, subiectus, weiß. Damit ist wiederum gerade keine sklavische Unterwerfung unter einen Willkürherrscher gemeint, sondern eine unbedingte Verpflichtung gegenüber dem befreienden Willen des NAMENS, wie eben beschrieben.
Daraus folgt: Was Jesus in den Augen des Johannes bedeutet, ist nicht von anderswo definierten Prädikaten her zu bestimmen, sondern umgekehrt verkörpert jetzt dieser jüdische Mann Jesus den befreienden NAMEN des Gottes Israels (als der von ihm Gesandte und Gesalbte, christos, Messias), und alle auf Jesus bezogenen Bestimmungen, „Wort, Licht, Leben, Treue“ usw. müssen von den jüdischen Schriften her verstanden werden.
Es wird sich zeigen, dass diese unterschiedliche Blickrichtung einen großen Unterschied macht: Liest man die jüdische Bibel nur noch auf Christus hin bzw. legt man sie von einem christlich verstandenen Jesus her aus, dann wird sie bald als das Alte Testament in den Hintergrund des Neuen Testaments gedrängt, und der Gott der Juden wird zu einem überholten Stammesgott herabgewürdigt, während sich der wahre allmächtige Gott erst durch Jesus als der Gott der Gnade und Liebe offenbaren konnte. Stattdessen kommt es darauf an, die Bedeutung Jesu als des Messias ganz und gar von der jüdischen Bibel her zu begreifen; davon gehen jedenfalls nach Ton Veerkamp noch alle messianischen Schriften, die wir das Neue Testament nennen, aus – und ganz besonders Johannes. <15>
Noch einmal zurück ganz an den Anfang, en archē, „im Anfang“. Wengst und Veerkamp ziehen aus dem Rückbezug dieser Worte auf den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 auch inhaltliche Schlussfolgerungen. Wengst fragt sich schon angesichts der Identifikation Jesu mit dem Schöpferwort Gottes (W39), warum Johannes „im Blick auf Jesus, eine geschichtliche Person“, von einer „Schöpfungsmittlerschaft“ redet, und beantwortet diese Frage folgendermaßen:
Es ist zu vermuten, dass hinter bestimmten Formulierungen bestimmte Erfahrungen von Menschen stehen, die diese Formulierungen machen und aufnehmen. Im Prolog ist die Erfahrung, die zur Bildung der Aussage von der Schöpfungsmittlerschaft des mit Jesus identifizierten Wortes führte, ausdrücklich ausgesprochen und also greifbar. Die in V. 14 sprechenden „Wir“ sind vorher in V. 12f. beschrieben worden als diejenigen, die das mit Jesus identifizierte Wort aufnehmen und an seinen Namen glauben. Sie sind damit als solche gekennzeichnet, die sich darauf einlassen, dass in Jesus Gott zu Wort kommt, und sich also auf dieses Wort verlassen. Dadurch erhalten sie, heißt es, „Macht, Kinder Gottes zu werden“. Als diese Kinder sind sie „von Gott erzeugt worden“. Auch hier ist von einem „Werden“ die Rede, von Schöpfung. Dahinter steht die Erfahrung des Entstehens von Gemeinde durch die auf Jesus als den Gesalbten bezogene Verkündigung, die als ihre Voraussetzung den Glauben an das schöpferische Handeln Gottes in der Auferweckung Jesu von den Toten hat. Von daher wird Gemeinde als endzeitliche Neuschöpfung verstanden.
Bei Paulus wird ein „Grenzen überschreitendes Zusammenkommen von Juden und Griechen, Freien und Versklavten, Männern und Frauen zu geschwisterlicher Gemeinschaft“ (1. Korinther 12,13; Galater 3,28) tatsächlich als „neue Schöpfung“ bejubelt (2. Korinther 5,17).
Wenn es stimmt, dass auch Johannes das Werden einer auf den Messias Jesus vertrauenden Gemeinde, die auch von Gott gezeugten Kindern besteht (1,12-13) als eine solche neue Schöpfung betrachtet, dann ist zu fragen, in welcher Weise er das tut. Konzentriert sich Johannes auf die Zeugungen (tholɘdoth) der Kinder Israels inmitten der Völker, die im 1. und 4. Buch Mose beschrieben und hier fortgesetzt werden? Oder nimmt Wengst auch für Johannes bereits eine aus Juden und Griechen zusammengesetzte Gemeinde an?
Ton Veerkamp <16> betont die Bedeutung von „Schöpfung“ für Johannes in noch grundsätzlicherer und umfassenderer Weise. Indem Jesus am Sabbat Heilungen vollzieht, macht er offenbar, dass die Schöpfung als Ganze noch nicht vollendet ist:
Johannes hat es deutlicher, provozierender als die anderen Evangelisten gesagt. „Mein VATER verrichtet Werke bis jetzt, so verrichte auch ich Werke“ (5,17), lässt er den Messias Jesus sagen. Ein gelähmter Mensch, ein gelähmtes Israel ist Zeichen der Nicht-Vollendung. Schöpfung ist nicht, Schöpfung wird. Schöpfung bedeutet kein massives Sein, wie „Welt“ oder „Natur“, sondern eine Wirklichkeitsstruktur, eine Struktur des Werdens, niemals des Seins. Dass alles einen Anfang und auch ein Ende hat, ist eine Platitüde. Schöpfung bedeutet, dass nichts in sich selbst begründet ist, dass nichts Wirkliches, also kein Einzelnes in der Wirklichkeit sich zum Absoluten, sprich zum theos, erklären kann.
Veerkamp wird sogar noch konkreter. Er verweist darauf, dass der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1,1 – 2,4 nicht einfach als weisheitlicher Lobpreis einer fertigen Schöpfung zu begreifen ist, sondern als „formalisierte Zusammenfassung der Schöpfungstheologie jenes Deuterojesajas“, die in den Kapiteln 40-55 des Buches Jesaja in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. entwickelt wurde:
Dieser anonyme Prophet, als Deuterojesaja bekannt, wollte verhindern, dass die nach Babel verschleppten Menschen aus Juda unter dem immensen Anpassungsdruck ihre Identität und somit ihre Zukunft verlieren. Ihr Gott, also das, was ihre unbedingte Loyalität in Anspruch nimmt, kann daher keine regionale, gar lokale Instanz sein. In einer Zeit, wo die Großmächte – das neubabylonische, das ägyptische und das persische Reich – die Geschicke aller Völker im für jenen Propheten überschaubaren Weltkreis bestimmen, kann das Volk Judas im Exil nur dann eine eigene Zukunft haben, wenn das, was sein gesellschaftliches Wesen ausmacht, eine Instanz über allen politischen Instanzen ist, allen, ohne Ausnahmen in Zeit und Raum.
Daraus zieht Veerkamp den Schluss, dass der „Sinn der Schöpfungstheologie“ in der jüdischen Bibel „politischer, nicht kosmologischer Natur“ ist, was sich am eindrucksvollsten darin zeigt, dass der zweite Jesaja nicht einmal davor zurückschreckt, „den shooting star der politischen Neuordnung im ganzen Orient, den Perserkönig Kyros (Cyrus), zum Hauptfunktionär („Gesalbten“, maschiach, Messias) des Gottes Judas/Israels“ zu machen (Jesaja 45,1ff.). So unglaublich es klingt: Zugunsten des kleinsten, unbedeutendsten Volkes auf Erden setzt der Gott Israels die stärkste Weltmacht in Bewegung, um seine Rückkehr aus der Verbannung nach Babel zu ermöglichen. Im Grunde inszeniert dieser Gott sogar die Schöpfung der gesamten Erde unter dem Himmel mit nur einem einzigen Ziel: seinem Volk Israel inmitten der Völker einen Lebensraum zu bereiten.
Es mag verwegen erscheinen, bereits allein aus den Worten en archē, „im Anfang“, diesen Bezug auf die politische Schöpfungstheologie des Deuterojesaja zu erschließen. Es muss sich später erweisen, ob Veerkamps Argumentation stichhaltig ist. Von keinem Exegeten wird allerdings bestritten, wie sehr sich Johannes insgesamt gerade auf die Kapitel des zweiten Jesaja im Jesajabuch bezieht.
↑ Johannes 1,1bc-2: Das Wort und der Gott Israels
1,1bc Und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
1,2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
[28. Februar 2022] Der Rest des 1. Verses im 1. Johanneskapitel wird von Thyen, Wengst und Veerkamp unterschiedlich übersetzt. Zwei Mal steht hier das Wort theos, „Gott“, einmal mit und einmal ohne den bestimmten Artikel. Im 2. Vers wird die Formulierung mit dem bestimmten Artikel wiederholt. Wengst (W30) versucht die unbestimmte Form in 1,1c durch die Übersetzung „gottgleich“ auszudrücken:
1,1b und das Wort war bei Gott
1,1c und gottgleich war das Wort.
1,2 Das war am Anfang bei Gott.
Dazu erläutert er näher (W42):
Das anfängliche Wort hat seinen Platz „bei Gott“. Es wird so nah wie irgend möglich an Gott herangerückt, aber nicht mit ihm identifiziert. Es bleibt eine Differenz; sie wird gewahrt: „Und gottgleich war das Wort.“ Die Übersetzung „gottgleich“ versucht dem Rechnung zu tragen, dass im griechischen Text an dieser Stelle das Wort „Gott“ – im Unterschied zu den beiden anderen Vorkommen – ohne Artikel steht.
Dazu beruft sich Wengst auch darauf (W43), dass der jüdische Philosoph Philo das Wort Gottes oder rabbinische Quellen Jakob als den Stammvater Israels „gottgleich“ nennen können.
Thyen dagegen legt in 1,1c großen Wert auf die Übersetzung von theos mit „Gott“ (T63):
1,1b und der Logos war bei Gott /
1,1c und Gott war der Logos. /
1,2 Derselbe war im Anfang bei Gott. /
Genau damit will Johannes ihm zufolge (T66) deutlich machen,
daß der logos mit Gott weder identifiziert noch von ihm je getrennt werden darf. Gott und sein logos gehören anfänglich und auf immer zusammen.
Tut man dagegen so (T67), als stünde da nicht das Hauptwort theos, sondern das Eigenschaftswort theios, „göttlich“, versucht man sozusagen, „Jesus zum subordinierten Untergott“ zu machen. Johannes aber weiß sich „des teuren und verpflichtenden Erbes von Israels Monotheismus“ gerade dadurch bewusst, „daß er die unauflösbare Einheit des Sohnes mit dem Vater proklamiert (10,30)“.
Der Widerspruch der beiden Sätze in Vers 1b und 1c darf nach Thyen ebeso wenig aufgehoben werden wie später „in der familiaren Metaphorik der Relation von Vater und Sohn … die ebenso unaufhebbare Spannung zwischen der Subordination des Sohnes unter den Vater und seiner Identität mit ihm“. Würde man entweder Jesus nur mit Gott gleichsetzen oder ihn nur Gott unterordnen, dann wäre das „ein Angriff auf Gottes absolute Transzendenz“, denn man
machte den Einzigen (Dt 6,4) zum Exemplar einer Gattung und den Mann Jesus so tatsächlich zu einem „über die Erde schreitenden Gott“ (Käsemann). <17>
Richtig daran ist sicherlich, dass weder der biblische Gott noch Jesus in eine Reihe mit anderen antiken Göttern wie Baˁal, Zeus oder Dionysos gestellt werden dürfen. Dennoch muss gefragt werden, ob nicht auch Thyens Rede von „Israels Monotheismus“ oder sein Pochen auf „Gottes absolute Transzendenz“ in der Gefahr steht, das Wesen Gottes sehr abstrakt und allgemein-menschlich als ein überweltliches göttlichen Wesen zu entwerfen, das mit dem Gott Israels, wie er sich konkret in den Schriften offenbart, nicht mehr viel zu tun hat. Aber genau dieser Gott ist doch „der Gott“, auf den das Wort, der logos, nach Johannes 1,1c und 1,2 ausgerichtet ist.
Ton Veerkamp <18> betont, dass wir „in der Schrift keinen abstrakten, idealistischen Monotheismus“ haben. Es gab in der biblischen Vorstellungswelt durchaus „viele Götter“ in einem ähnlichen Sinne, wie Martin Luther <19> einmal gesagt hat: „Worauf du nu … Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“ Das erläutert Veerkamp folgendermaßen näher:
In der Schrift ist „Gott“ die Instanz, der man unbedingt Folge zu leisten hat, das Grundprinzip (archē) einer jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung. Sie fungiert als Konvergenzpunkt aller gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Im Rahmen der biblischen Logik ist die Frage, ob denn überhaupt ein Gott existiert, eine absurde Frage. Einzig erlaubt ist die Frage: „Wer bzw. was ist der Gott, wer bzw. was funktioniert in einer gegebenen Gesellschaft als Gott?“ Vor diese Frage stellte der Prophet Elia das ganze Volk Israel auf dem Berg Karmel (1 Könige 18,21). Nach dieser Logik kann es keine gottlose Gesellschaft geben, weil keine Gesellschaft auf eine Grundordnung verzichten kann. Sie würde dann auseinanderfallen.
Wenn es richtig ist, dass der TeNaK, die jüdische Bibel, auf diese Weise unterscheidet zwischen dem Gott Israels, der „in der altjudäischen Gesellschaft die Funktion hat, ‚aus dem Sklavenhaus herauszuführen‘ (Exodus 20,2)“, und den Göttern anderer Völker, deren Funktion es ist, Unterdrückung und Ausbeutung zu legitimieren, dann meint das Wort „Gott“ mit dem bestimmten Artikel in Johannes 1,1b und 1,2
in unendlicher Verdichtung die spezifische, detailliert bestimmte Gesellschaftsordnung, die sich Israel in seiner Tora gegeben hat, eine Ordnung von befreiten Sklaven, von Autonomie und Egalität.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, gilt natürlich auch für dieses jüdische Gottesverständnis, dass Gott keinesfalls ein Exemplar einer Gattung von Göttern ist. Alles, was außer dem NAMEN Gott genannt wird, sind ja menschengemachte Götzen (Jesaja 44,6-19). Und wenn Thyen mit der Transzendenz dieses Gottes seine Unverfügbarkeit gegenüber menschlichen Beschwörungskünsten und der Vereinnahmung durch menschliche Interessengruppen meint, dann ist auch gegen diese Charakterisierung nichts einzuwenden. Schließlich ist Thyen auch Recht zu geben, wenn er sagt (T67):
Es ist, wie zu den entsprechenden Stellen zu zeigen sein wird, Gottes egō eimi {ICH BIN}, das aus dem Munde Jesu erklingt, und nicht ein göttliches.
Es wird aber zu fragen sein, in welcher Weise genau er das jeweils interpretieren wird. Ich würde es so ausdrücken, dass Jesus ganz und gar den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert.
Seltsam ist übrigens, dass die meisten Exegeten, auch Thyen und Wengst, die Worte pros ton theon sowohl in Vers 1 als auch in Vers 2 mit „bei Gott“ übersetzen, obwohl das Wort pros nicht einfach ein Mit- oder Nebeneinander, sondern eine Ausrichtung auf etwas hin ausdrückt. <20> Veerkamp versucht das auf folgende Weise ins Deutsche zu übertragen:
1,1b Das Wort ist auf GOTT gerichtet, …
1,2 Dieses ist im Anfang auf GOTT hin.
Dabei deutet er mit der Großschreibung des Wortes GOTT an, dass Johannes eben den Gott meint, der sich dem Volk Israel mit seinem befreienden NAMEN offenbart hat; Jesus als das Wort Gottes ist „also nicht auf Gott oder das Göttliche überhaupt hin, sondern auf einen bestimmten Gott, den Gott Israels, gerichtet.“
Den dazwischen liegenden Satz 1,1c übersetzt Veerkamp ähnlich wie Wengst:
1,1c gottbestimmt ist das Wort.
Keinesfalls handelt es sich hier ihm zufolge
um einen griechischen Urteilssatz nach dem Muster S = P {Subjekt = Prädikat}. Das Wort ist nicht mit irgendeinem Prädikat identisch, sondern es geschieht gottbestimmt. Der Artikel fehlt hier, deswegen nicht Gott, sondern gottbestimmt oder, wenn man will, göttlich. Natürlich ist das keine allgemeine Feststellung, das Wort hat keine allgemeine, göttliche Struktur, sondern eine spezifische: Das Wort vollzieht sich im Rahmen dessen, was in Israel der Gott heißt, und es wirkt wie (der) Gott.
Dieses „wie Gott“ wird im Evangelium sachlich durch den Ausdruck „Sohn des Gottes“ (hyios tou theou) wiedergegeben.
Die so verstandene Beziehung des Messias Jesus zum Gott Israels kann man „orientalisch“ nennen im Gegensatz zu der „abendländischen Logik“, <21> auf Grund derer eine schon bald heidenchristlich dominierte Kirche die biblischen Texte beider Testamente bis heute zu lesen sich angewöhnt hat. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass auch Thyen durch seine Übersetzung des artikellosen theos mit „Gott“ schon eine spätere Zweinaturenlehre über Jesus, der zugleich ganz Gott und ganz Mensch ist, in diesen Vers hineinliest.
↑ Johannes 1,3: Schöpfung und Geschichte – zukunftsoffen
1,3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
[1. März 2022] Ähnlich wie Luther übersetzt auf Klaus Wengst den 3. Vers des Johannesevangeliums (W30):
1,3 Alles ward durch es
und ohne es ward auch nicht eins, was geworden.
Damit ist (W44) ausdrücklich von der „Schaffung alles Seienden durch das Wort“ die Rede, und es „verbietet sich für Johannes von vornherein ein doketischer oder gar ein gnostischer Schöpfungsbegriff“, also die Vorstellung, dass die „Gemeinde als neue Schöpfung … eine vom Irdischen völlig getrennte Projektion des Himmlischen“ oder dass die geschaffene Welt durch und durch böse sei. Wie schon in seiner Auslegung von en archē in Johannes 1,1 konzentriert sich Wengst in seiner Betrachtung der Beteiligung des Wortes und damit Jesu an der Schöpfung auf „die Gemeinde als restituierte Schöpfung… Sie stellt schon dar, was die Welt durch Jesus sein kann.“
In diesem Zusammenhang geht Wengst auch auf „eine Analogie in der jüdischen Tradition“ ein, „wenn dort Israel als ‚neue Schöpfung‘ begriffen wird.“ Indem in rabbinischen Quellen das Wort „machen“ in 1. Mose 12,2 auf das „Schöpferhandeln Gottes“ in 1. Mose 1,7 bezogen wird, „gilt Israels ‚Genese‘ als neue Schöpfungstat Gottes“. Und weil in 4. Mose 29,2 „für ‚den ersten Tag des siebten Monats‘ im Rahmen der Opfervorschriften nicht zum ‚Darbringen‘, sondern zum ‚Machen‘ aufgefordert wird, kann die an diesem Tag erfolgende „Sündenvergebung“ zugleich als „Neuschöpfung Israels“ verstanden werden.
Wengst lässt aber offen, ob und in welcher Weise die johanneische Gemeinde sich als genau dieses neugeschaffene Israel versteht oder in einer Analogie zu Israel an die Stelle des bisherigen Gottesvolkes treten soll.
Hartwig Thyen konzentriert sich (T68f.) in seiner Auslegung von Johannes 1,3 zunächst darauf, zu erweisen, dass die letzten beiden Wörter ho gegonen, „die geworden sind“, nicht zum folgenden Vers 4 gezogen werden dürfen, sondern zu Recht den Abschluss von Vers 3 bilden (wovon auch Wengst und Veerkamp ausgehen). Seine Übersetzung ist ähnlich wie die von Wengst (T63):
1,3 Alles ist durch ihn geworden, /
und ohne ihn wurde auch nicht ein einziges der Dinge, /
die geworden sind. /
Inhaltlich argumentiert Thyen (T70) gegen die Vorstellung, dass es in diesem Vers „primär um Gottes Handeln in der Geschichte und nicht um sein anfängliches Schöpferwirken“ gehe, weil sich „das Verbum ginesthai ja von Haus aus nicht auf die Schöpfung im Sinne von ‚gemacht werden‘“ beziehe, sondern „im Blick auf geschichtliche Ereignisse: ‚geschehen, sich ereignen, passieren‘“ heiße. Dabei wehrt er sich (T71) vor allem gegen ein damit einhergehendes Verständnis des göttlichen logos im Sinne der „eher heidnischen Gefilde irgendwelcher ‚Zwecke‘ oder ‚Pläne‘ Gottes“ und beharrt unter Berufung auf Maurice Blanchot <22> darauf, „das biblisch bezeugte Sprechen Gottes und sein gesprochenes Wort“ ernstzunehmen:
„Was wir dem jüdischen Monotheismus verdanken, ist nicht die Offenbarung vom einzigen Gott. Es ist die Erschließung der (gesprochenen) Sprache als Ort, wo die Menschen sich in Bezug halten zu dem, was jeden Bezug ausschließt: das absolut Ferne, das absolut Fremde. Gott spricht, und der Mensch spricht zu ihm. Das ist das große Faktum Israels… Zu jemandem sprechen bedeutet, daß akzeptiert wird, daß der Angesprochene nicht in ein System von Sach- oder Seinsinformationen eingeführt wird. Es bedeutet vielmehr, ihn als unbekannt anzuerkennen und als Fremden aufzunehmen, ohne ihn zu nötigen, seine Andersartigkeit aufzugeben…“
Wie dem auch sei, Thyen meint jedenfalls, dass in Johannes 1,3 „der Bezug auf die Schöpfung … wohl kaum ernsthaft zu bestreiten“ ist. Interessant ist dabei nun, dass ihm zufolge dabei die Schöpfung nicht nur
im Sinne des abgeschlossenen Sechs-Tage-Werkes von Gen 1 im Blick ist, sondern wie Joh 5,17 … zugleich die creatio continua {fortwährende Schöpfung} als Erhaltung alles dessen, was ist. Oder anders gesagt, daß bei Johannes wie bei Deuterojesaja, auf den er sich überaus häufig bezieht, das Reden von der Schöpfung vermittelt ist durch die eschatologische Heilsökonomie.
Thyen bringt Vers 3 also mit genau denselben Bibelstellen in Verbindung, die Veerkamp bereits zu Vers 1 angeführt hatte, um die Schöpfungstheologie des Johannes näher zu bestimmen.
Während Veerkamp allerdings die Werke von Johannes 5,17 im Sinne der Vervollkommnung einer noch nicht fertigen Schöpfung begreift (im Sinne der Heilung lähmender Unrechts- und Gewaltstrukturen), spricht Thyen von der „Erhaltung“ der Schöpfung, die man sich wohl als abgeschlossen vorstellen muss. Mit seinem Hinweis auf „die eschatologische Heilsökonomie“ bei Deuterojesaja könnte Thyen etwas Ähnliches wie Veerkamp meinen, wenn er das eschaton, die „Endzeit“, als den Tag der Entscheidung verstehen würde, an dem die kommende Weltzeit des Friedens auf der Erde unter dem Himmel anbricht und die Schöpfung vollkommen sein wird.
Den zweiten Jesaja im Auge zu behalten, lohnt sich nach Thyen auch deshalb (T72), weil es Heinrich Lausberg <23> gelungen ist, das Schriftwort Jesaja 55,10-11 „als den für die Christologie sowohl des Prologs als auch des corpus evangelii {Haupttext des Evangeliums} verbindlichen und diese beiden Teile zugleich fest miteinander verbindenden ‚Bezugstext‘ zu erweisen“:
„,Wort Gottes“ (,mein Wort“) der Stelle Js 55,10-11 bezieht sich auf die ,redende Verkündigung‘ Gottes durch den Propheten: diese Rede Gottes ist fruchtbar wie der Regen. Hierbei erfährt das ,Wort Gottes‘ eine gewisse poetische Personifizierung. – Der Evangelist benutzt diese Personifizierung, um den persönlichen Jesus mit ihm in eins zu setzen und die Ereignisse (und Reden) des Lebens Jesu in dieser Interpretationssicht darzustellen. Der Schriftsteller will, daß die das ganze Evangelium durchziehende interpretatorische Anspielung auf Js 55 immer wieder als solche verstanden wird“.
Es mag nun erstaunen, dass Ton Veerkamp, <24> der doch Johannes 1,1 mit der Schöpfungstheologie von 1. Mose 1 und Deuterojesaja in Verbindung gebracht hat, den Vers 1,3 nicht auf die Weltschöpfung durch das Wort Gottes bezieht. Seine Übersetzung sieht so aus:
1,3a Alles geschieht durch es,
1,3b ohne es geschieht nichts,
1,3c was geschehen ist.
Das passt aber genau zur Vorstellung von der nicht abgeschlossenen Schöpfung, die Veerkamp in Johannes 5,17 bestätigt findet. Hier kann man ebenso gut von der nicht abgeschlossenen Geschichte sprechen.
In 1,3c ist nämlich von dem die Rede, „was Geschichte war, ho gegonen.“ Diese Perfektform „was geschehen ist“, bedeutet – semitisch und nicht griechisch verstanden – „alles, was in der Vergangenheit begonnen und in der Vergangenheit abgeschlossen wurde“. In diese Geschichte kommt nun das Wort hinein (Johannes 1,3ab):
Erst durch das Wort wird die vollendete und abgeschlossene Vergangenheit aufgebrochen und zukunftsfähig gemacht. … Die Verbalform egeneto zeigt die Fortdauer alles dessen, was in der Vergangenheit begann. Ohne es (das Wort) ist alles, was in der Vergangenheit geschah und in der Vergangenheit) abgeschlossen wurde, endgültig vorbei. Die Geschichte – das Kürzel für alles, was in der Vergangenheit begann und abgeschlossen wurde – hätte dann keinen Atem, erst recht keinen langen Atem. Ohne das Wort geschieht nichts mehr, was Geschichte war, ho gegonen. Das Wort ouden, „nichts“, oder, wie andere Handschriften wollen, oude hen, „nicht ein Ding“, bezieht sich auf ho gegonen, „das, was geschehen ist“. Unser Perfekt gibt das Semitische am Perfekt gegonen nur ungenügend wieder; man müsste eigentlich unschön umschreiben, etwa: „Das, was in seinem Werden abgeschlossen ist.“ Nicht ein Ding ist in seinem Werden abgeschlossen, das ist die Aussage. Durch das Wort bleibt alle Geschichte offen, lebendig, wie wir in der nächsten Zeile hören werden. Nichts ist vorbei und nichts ist fertig.
So gesehen spielt es kaum eine Rolle, ob im Vers 3 auf die Schöpfung der Welt oder die fortlaufende Geschichte Bezug genommen wird, denn nach Veerkamp versteht Johannes beide als zukunftsoffen.
↑ Johannes 1,4-5: Leben, Licht und Finsternis
1,4 In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
1,5 Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen.
[3. März 2022] Die Verse 4-5 sieht Thyen in einem engen Zusammenhang, während Wengst (W35) zwischen ihnen einen deutlichen Einschnitt wahrnimmt, der sich daran zeigt,
dass die Verben in V. 1-4 in Zeitformen der Vergangenheit gehalten sind, während in V. 5a ein Präsens erscheint. Die ersten vier Verse beschreiben das anfängliche Sein des Wortes bei Gott und sein schöpferisches Wirken. Dass demgegenüber mit der Aussage von V. 5 ein großer Sprung vorausgesetzt ist, wird auch daran deutlich, dass für das nun als Licht prädizierte Wort Johannes der Täufer als Zeuge angeführt wird. Es ist also jetzt konkret das geschichtliche Auftreten und Wirken Jesu im Blick, ohne dass sein Name hier schon genannt wird.
Damit schließt (W46) Vers 4 den „Vorspann“ ab, „der die Tiefendimension dieses Geschehens aufzeigt“ (W30):
1,4 In ihm war Leben
und das Leben war das Licht der Menschen.
Inhaltlich beschreibt Klaus Wengst die Beziehung der hier erstmals erwähnten Worte zōē, „Leben“, und phōs, „Licht“, folgendermaßen (W45):
Das Neue ist, dass jetzt nicht mehr vom Geschaffenen im Ganzen gesprochen wird, sondern die Menschenwelt im Besonderen in den Blick kommt. Und da geht es nicht um Leben überhaupt, sondern um rechtes Leben, um erhelltes Leben. Daher ist es nicht die bloße physische Lebendigkeit, die „das Licht der Menschen“ genannt wird. Wie sollte sie es auch sein können, da sie Menschen nicht daran hindert, sich auch in finsterster Weise zu begegnen und einander das Lebenslicht auszulöschen?
Wer das Evangelium nicht zum ersten Mal liest, wird schon hier an die späteren Ich-bin-Worte Jesu denken, in denen „Leben“ und „Licht“ eine zentrale Rolle spielen; in der „Nachfolge Jesu“ erhält „der Lebensweg Orientierung“ und bleibendes Leben „auch angesichts des Todes“. Diese „Aussage von der Orientierung gebenden Lebensvermittlung des Wortes“ erinnert zugleich auch „an die Tora“ (W45f.):
Man sollte hier keine vorschnellen Abgrenzungen konstruieren. Die Struktur ist jedenfalls dieselbe: Sowohl das Wort, das in der Tora besteht, als auch das, mit dem Jesus identifiziert wird, gibt Orientierung für einen Weg, auf dem Leben erfahren und verheißen wird. In welchem möglichen Verhältnis beides zueinander steht, wird zuerst bei der Auslegung von 1,17 zu fragen sein.
Zusammenfassend sagt Wengst sodann von Johannes 1,1-4 (W46):
Johannes stellt in den ersten vier Versen seines Evangeliums Jesus in die Dimension des Wortes, mit dem Gott selbst sich vernehmbar macht, mit dem er schon in der Schöpfung gesprochen hat. Indem er so vom Wort redet, es von Anfang an „bei Gott“ weiß und dieses Wort sozusagen „Platzhalter“ sein lässt für Jesus, hat er damit einen Bezugsrahmen abgesteckt, innerhalb dessen das im Evangelium erzählte Handeln und Geschick Jesu als Selbstmitteilung Gottes begriffen werden kann und soll.
Damit muss man Wengst wohl so verstehen, dass die Verse 1 bis 4 zunächst vom Wort im Sinne des Schöpferwortes und der Tora des Gottes Israels reden und dass erst Vers 5, den Wengst folgendermaßen übersetzt (W30), konkret von Jesus handelt:
1,5 Und das Licht scheint in der Finsternis,
aber die Finsternis hat es nicht gefasst.
Damit handelt er sich aber ein Problem ein, das er folgendermaßen beschreibt (T46f.):
Johannes springt also vom schöpferischen Wirken des Wortes „am Anfang“ sofort hinüber zum Wort, wie es in Jesus wirkt. Sein Interesse dabei dürfte die Zuordnung von urzeitlichem und endzeitlichem Handeln Gottes sein: Er kommt in Jesus nicht anders zu Wort, als der er am Anfang schöpferisch gesprochen hat. Aus dieser Nebeneinanderstellung von Schöpfung und Neuschöpfung, die um der Prägnanz der Zuordnung willen alles, was dazwischen liegt, überspringt, darf nun nicht umgekehrt geschlossen werden, Johannes habe an der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel kein Interesse. Selbstverständlich denkt er nicht an einen Schöpfer, der von Israels Gott unterschieden wäre. Das wird im Evangelium oft genug deutlich. Auch das von Gott bei der Schöpfung gesprochene Wort kennt er ja nur aus seiner jüdischen Bibel.
Aber entsteht die Wahrnehmung eines solchen Überspringens der Geschichte Israels nicht erst dadurch, dass Wengst die ersten vier Verse wegen ihrer Vergangenheitsformen im Sinne einer fernen Vergangenheit der geschichtlichen Gegenwart Jesu gegenübergestellt hat? Nimmt man dagegen ernst, dass Johannes die Rede vom „Anfang“ als immer gegenwärtigen und zukünftigen Grund des schöpferisch-befreienden Wirkens Gottes versteht, auf den hin Jesus als Gottes Wort von Anfang an ausgerichtet ist, muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob Johannes die Befreiungsgeschichte Israels vergessen könnte.
Weiter schreibt Wengst erstaunlicherweise zwar (W47), dass in dem „Menschen Jesus … kein anderes Licht aufscheint als das, von dem er im Schöpfungszusammenhang gesprochen hatte“, aber die „Finsternis“, von der hier „ganz unvermittelt“ die Rede ist, begreift er nicht ebenfalls vom biblischen Schöpfungsbericht her. In seinen Augen macht Johannes „nicht den mindesten Versuch, die Finsternis von irgendwoher abzuleiten oder ihr Vorhandensein zu erklären“. <25> Aber er muss sie doch gar nicht „von irgendwoher“ erklären, da er das, was er mit Finsternis meint, sehr genau aus den Schriften kennt.
Diesen Zusammenhang benennt Hartwig Thyen (T72) deutlich, indem er schon in Vers 4b, dem zufolge das „Leben des logos … die Menschen ins Licht“ versetzt, eine nicht zufällige Entsprechung zum „ersten Wort des Schöpfers (Gen 1,3) und seinem ersten Tagewerk, ‚und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis‘“, erblickt:
Allein diese Scheidung macht die Finsternis als solche überhaupt erst wahrnehmbar. „Es gibt sie“ – wie unser folgender Vers impliziert – nur als Aufstand gegen das Licht. Darum ist das dem logos innewohnende Leben ausnahmslos für alle Menschen das Licht, ganz unabhängig davon, wie sich einer dazu verhält: Mag er es begrüßen als Licht auf seinem Wege, oder mag er es hassen und fliehen, damit seine bösen Werke nicht ans Licht kommen (s. u. zu 3,19-21).
Auch nach Ton Veerkamp <26> ist das Leben, das en autō, „in“ oder „mit ihm“, dem Wort, ist, „das Licht für die Menschen“, womit zugleich gesagt ist, dass Johannes dieses Licht nicht „als kosmisches Prinzip“ betrachtet:
Sobald es um nähere Bestimmungen von Wort, Geschichte, Leben, Licht geht, taucht die menschliche Wirklichkeit auf. Diese menschliche Wirklichkeit ist konkrete Geschichte. Bevor diese Geschichte zur Sprache kommt, muss der Widerspruch zum Licht benannt werden. Der Widerspruch lautet Leben/Licht gegen Nichts/Finsternis.
Und auch Veerkamp begreift diese Finsternis, dieses Nichts, wie Thyen von der „Schöpfungserzählung“ in 1. Mose 1,1-4a her:
Bevor wir dort das Wort Licht überhaupt hören, bevor überhaupt ein Wort gesprochen wird, hören wir in der Schöpfungserzählung das Wort Finsternis. Bevor aus dem Himmel und der Erde Schöpfung wird, muss die Finsternis in ihre Schranken gewiesen werden, genauso wie das Chaosmeer.
Konkreter als Thyen wird Veerkamp insofern, als er nicht nur von der Finsternis spricht, die in 1. Mose 1,4-5 „sozusagen entmythologisiert“ wird: „Sie ist kein kosmisches Prinzip, sie ist schlicht Nacht, mehr nicht, weniger auch nicht.“ Ihm zufolge kennt Johannes
auch eine von Menschen verursachte Finsternis. Wir hören Jeremia 4,23-26:
Ich sah das Land, da, irr und wirr,
den Himmel: Keins seiner Leuchten!
Ich sah die Berge, da, erschüttert,
alle Hügel, sie wälzen sich um.
Ich sah, da, keine Menschheit mehr,
alle Vögel des Himmels verflogen.
Ich sah, da, Weinberg ist Wüste,
Städte zerstört,
vor dem Antlitz des NAMENS,
vor dem Antlitz der schnaubenden glühenden Wut seiner Nase.Hier wird der Zustand eines von Krieg verheerten Landes beschrieben mit dem Zustand einer Erde vor jedem schöpferischen Wort: Irr und wirr, kein Licht, keine Menschheit, keine Vögel, alles verwüstet, und zwar wegen der törichten Politik der Eliten Jerusalems, ihrer Verweigerung, das Reformwerk des guten Königs Josia zu bewahren und die Machtverhältnisse in der Region zu beachten. Das Ergebnis dieser Politik ist das Nichts und die Finsternis. Der Prophet kann das nur als Resultat der zornigen Reaktion des Gottes Israels verstehen. Wenn die Ordnung der Tora, die ja für Israel „Gott“ ist, durch die Politik seiner Eliten zerstört wird, reagiert diese Ordnung mit dem Zorn ihres Zerstörtseins. Es geht nicht um einen mythischen Urzustand, es geht um das, was die Menschen um Johannes damals und was wir heute täglich sehen: Finsternis, Chaos, Zerstörung des Lebens.
Was Veerkamp mit den Worten „irr und wirr“ wiedergibt, ist genau das Doppelwort thohu wabohu, das nur hier in Jeremia 4,23 und in 1. Mose 1,2 vorkommt, von ihm so übersetzt:
Die Erde ist wirr und irr geworden:
Finsternis über der Fläche des unendlichen Meeres.
Gottessturm brütete über der Fläche des unendlichen Meeres.
Damit bestätigt er nochmals, dass das erste Kapitel der Bibel nicht einfach als weisheitlicher Lobpreis einer fertigen, wohlgeordneten Schöpfung zu betrachten ist. Vielmehr muss eine solche Ordnung, die als sehr gut gepriesen werden kann, den bedrohlichen Todesmächten, die sich vor allem in der Weltpolitik erheben, immer wieder neu abgerungen werden:
Die Propheten haben das, was vielleicht ursprünglich ein kosmologischer Ursprungsmythos war, zu einer politischen Lehre des von Menschen verursachten Chaos und ihrer finsteren Zustände gemacht.
Zurück zu Johannes: Er ruft in Veerkamps Augen deswegen die skotia, „Finsternis“, und das thohu wabohu von 1. Mose 1,2 und Jeremia 4,23 als Gegenspieler des Lichts ins Gedächtnis, um die Botschaft vom Messias Jesus als „Leben“ und „Licht“ in die Situation seiner eigenen Zeit am Ende des 1. Jahrhunderts zu stellen:
Was Jeremia beschreibt, ist genau der Zustand des Volkes von Judäa nach dem Jahr 70. Die Stadt ist verwüstet, die Bevölkerung massakriert, das Land unbewohnbar. Was not tut, ist ein vollkommener Neuanfang. Von der Katastrophe des Jahres 70 führt kein Weg mehr zurück, nichts wird mehr sein, was je war. Wegen des aktuellen Zustandes muss jemand, der wie Johannes das Jahr 70 als das Ende deutet, mit den Worten im Anfang beginnen. Das Werk des Messias ist eine neue Erde unter einem neuen Himmel, Leben und Licht. Die Finsternis hat nicht gewonnen: Das Verb, das hier auftaucht, katalambanein, „überwältigen“, hat in der griechischen Version der Schrift immer eine gewalttätige Konnotation. Gegen das Nichts und die Finsternis, die seit dem katastrophalen Ausgang des judäischen Krieges 66-70 herrschten, holt Johannes „Licht“ und „Leben“ hervor: die Finsternis hat Licht und Leben nicht überwältigt.
Auch nach Thyen (T75) hat das Wort katalambanein in Johannes 1,5 „den Sinn eines feindlichen Überwältigens“ oder Auslöschens, wobei in dessen Verneinung nicht „Pessimismus, sondern Siegesgewißheit“ über die Finsternis laut wird:
Denn geradezu per definitionem ist die skotia {Finsternis} Aufstand gegen das Licht. Ihr ganzes Vermögen und Wesen erschöpft sich in solcher Feindschaft. Weil es sie überhaupt nur als diesen Aufstand gibt, vermag sie das Licht weder zu begreifen, noch zu erkennen, geschweige denn jemals anzuerkennen. Darum kann das Lexem skotia auch nicht als Synonym der gerade zuvor genannten anthrōpoi {Menschen} (V. 4) oder des kosmos (V. 10) begriffen werden. Denn anders als die feindliche skotia sind die Welt und die Menschen darin unwiderruflich Gegenstände der Liebe Gottes (vgl. 3,16 u. ö.).
Das wiederum sieht Klaus Wengst völlig anders. Indem er (W47) sich dagegen verwahrt, dass Johannes Spekulationen über die Finsternis anstellt, behauptet er genau das, was Thyen abstreitet:
Er spekuliert nicht, er stellt einen Tatbestand fest. Und mit der „Finsternis“ meint er nichts anderes als die zuvor erwähnte Welt, die er mit dem Wort „alles“ umschrieben hatte, und die Menschen in ihr, die durch das Wort erschaffen worden sind. Im Licht des Auftretens Jesu erkennt er, dass die Welt, so wie sie ist, dass die Geschichte der Menschen, so wie sie verläuft, nicht in Ordnung sind. Damit tritt von hier aus in aller Deutlichkeit hervor, dass die Aussagen von V. 3f. keine schöpfungstheologische Rechtfertigung der faktischen geschichtlichen Wirklichkeit bedeuten. Das Auftreten Jesu lässt die Welt in keinem guten Licht erscheinen. … Mit Jesus ist mitten in der Welt eine gegenüber dem faktischen Geschichtsverlauf andere, sie in Erinnerung an die Schöpfung ändernde Wirklichkeit aufgeleuchtet, die in seiner Nachfolge Raum gewinnt (vgl. 8,12). Die Welt soll und kann anders sein; sie ist es in der Nachfolge Jesu.
Mit diesen Äußerungen kommt Wengst zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Veerkamp über eine Schöpfung, die durch das geschichtliche Handeln von Menschen in Unordnung geraten ist. Aber er bezieht die „Aussage vom Scheinen des Lichtes in der Finsternis“ auf andere „biblische Zusammenhänge“ als Veerkamp, nämlich zum einen auf die in Micha 7,8 und Jesaja 9,1 angesprochene „Hoffnung auf (messianische) Rettung aus einer als finster erfahrenen Wirklichkeit“ und zum anderen „auf das rechte sozialethische Verhalten, das ausstrahlende Kraft hat und bedrückten Menschen das Leben hell macht“, wie es in Jesaja 58,10 und Psalm 112,4 ausgedrückt wird.
Fraglich ist allerdings, ob er die „Finsternis“ zu Recht mit der Lebenswelt der Menschen gleichsetzt, zumal das Wort kosmos, „Welt“, noch gar nicht vorkam. Ganz so einfach, wie Thyen (T75) die Identifikation der „Welt“ mit der „Finsternis“ unter Hinweis auf 3,16 abweist, ist es aber auch nicht; es wird sich zeigen, dass Johannes vom kosmos in sehr unterschiedlicher, ja, widersprüchlicher Weise reden wird.
Da Wengst die Finsternis mit der Welt gleichsetzt, versteht Wengst (W48) auch das Wort katalambanein anders als Thyen und Veerkamp. Er wählt die deutsche Übersetzung „fassen“, weil sie mehrdeutig genug ist, um „die Bedeutungen von ‚umfassen‘ und ‚erfahren‘, von ‚greifen‘, ‚ergreifen‘ und ‚begreifen‘“ zum Ausdruck zu bringen, und sieht das Wort in teilweiser Parallele zu dem Wort paralambanein in 1,10, mit dem dort gesagt wird, dass das Licht von den Seinen nicht angenommen wird:
Die Welt kann die Wirklichkeit Gottes in einem doppelten Sinn nicht „fassen“ – es sei denn, dass Gott sich fassbar macht, womit er sich aber zugleich wieder in solcher Fassbarkeit verbirgt.
Einen ähnlichen Weg haben offenbar auch die Revisoren der Lutherbibel ab 1984 beschritten, indem sie katalambanein mit „ergreifen“ statt mit „begreifen“ übersetzen. Auch darin bleibt der Doppelsinn eines verstehenden Annehmens sowie eines feindseligen Überwältigens angedeutet.
Welche dieser Sichtweisen angemessen ist, wird erst zu klären sein, wenn deutlicher wird, was Johannes ganz konkret unter kosmos, „Welt“, versteht, und zwar insbesondere, ob und inwieweit er diese tatsächlich mit der „Finsternis“, skotia, gleichsetzt.
↑ Johannes 1,6-8: Johannes der Zeuge
1,6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt,
der hieß Johannes.
1,7 Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge,
auf dass alle durch ihn glaubten.
1,8 Er war nicht das Licht,
sondern er sollte zeugen von dem Licht.
Die Verse Johannes 1,6-8 betrachtet Klaus Wengst (W50) als einen „Exkurs über die Funktion Johannes des Täufers“. Damit will (W49) der Evangelist „offenbar einen konkurrierenden Anspruch“ von Täufergemeinden abwehren, „die Johannes weiterhin für die endzeitliche Gestalt hielten“. Obwohl der Täufer aber ausdrücklich nicht „das Licht“ ist, gehört er doch nicht zur „Finsternis“, sondern ist „gesandt von Gott“:
Obwohl also die Konkurrenzsituation zwischen der an Jesus glaubenden Gemeinde und der Täufergemeinde nach dem Johannesevangelium schärfer ist als nach den anderen Evangelien, ist hier die positive Funktion des Täufers im Blick auf Jesus wesentlich gewichtiger als dort. Bei den Synoptikern ist er Vorläufer und Wegbereiter; im Johannesevangelium ist er Zeuge. Derjenige, auf den sich der Glaube einer konkurrierenden Gruppe bezieht, wird hier zum Zeugen des eigenen Glaubens.
Indem Wengst (W30) seine Übersetzung in Vers 6 mit „Da war ein Mensch“ beginnen lässt, , schenkt er dem Umstand keine Beachtung, dass der Evangelist hier nicht das zuvor sechs Mal auf das Subjekt „Wort“ und „Leben“ bezogene Wort ēn verwendet, sondern das Wort egeneto, womit er den Täufer, wie Thyen annimmt (T78), im „Gegenüber von Sein und Werden“ der „Werden-Seite“ zuordnet. Das wird ihm zufolge zusätzlich dadurch unterstrichen, „daß dem theos ēn des Bezeugten ein egeneto anthrōpos seines Zeugen korrespondiert“, das heißt, wie von Jesus gesagt wird, dass er „Gott“ ist, wird Johannes ausdrücklich als „Mensch“ benannt.
Den in Vers 6 von Thyen nur kurz erwähnten und „kaum zufälligen Anklängen an die Sprache der Bibel” misst Ton Veerkamp <27> erheblich größeren Wert bei. Er sieht eine deutliche Parallele zwischen Johannes 1,6 und Richter 13,2:
Es geschah: ein Mann (Mensch), Gesandter von Gott,
sein Name: Johannes.Es geschah: ein Mann aus Zora, aus einer danitischen Großfamilie,
sein Name Manoach.
Nicht nur ihre semitische Sprache verbindet beide Stellen, sondern auch ihr Inhalt:
Beide, Manoach und Johannes, ermöglichen eine Befreiungsgeschichte, sind aber nicht die Befreier. Mit dem Wort wa-jehi, (kai) egeneto, „es geschah“, wird eine nichtige Geschichte von Unterdrückung und Aussichtslosigkeit beendet. Jetzt wird aus Vergangenheit wirkliche Geschichte. Dieser Ausdruck kommt viele hunderte Male in der Schrift vor; es geht immer um das, was geschah, nie um das, was war.
Der Held der Erzählung Richter 13-16 ist nicht Manoach, sondern Simson, aber ohne Manoach wäre die Erzählung über den Befreier Simson nicht möglich gewesen. Auch die Erzählung vom Messias Jesus wäre ohne Johannes nicht möglich gewesen. Es geschieht ein Mensch, und diese Geschichte ist „gottbestimmt“; dieser Mensch ist ganz bestimmt von dem, was in Israel „Gott“ ist, er ist „göttlich“. Der Name des von Gott her gesandten Menschen ist Johannes, ein priesterlicher Name; bei Lukas entstammt er einer Priesterfamilie. Bei Johannes ist er aber nicht Johannes, der Täufer, sondern Johannes, der Zeuge.
Indem Veerkamp zu Vers 7 weiter ausführt, dass Johannes als „Zeuge in einem Verfahren um die Vertrauenswürdigkeit des Messias“ auftritt, trifft sich seine Argumentation mit der Aussage von Thyen (T76f.), dass Johannes „zum Zeugen gemacht und in den großen Prozeß zwischen Gott und der Welt verwickelt“ wird. Dieser vom Täufer eröffnete „Rechtsstreit Gottes mit dem kosmos“ hat sein Maß „an der durch Mose gegebenen Tora“, wie es insbesondere in den Kriterien für einen Propheten wie Mose in 5. Mose 18,18-20 dargelegt ist:
Immer wieder breitet der Evangelist vor seinen Lesern die Argumente beider Streitparteien aus, um sie selbst urteilsfähig zu machen und sie so von Recht und Wahrheit der Sache Jesu zu überzeugen.
Das Wort pisteuein in Vers 7 übersetzt Veerkamp nicht wie Wengst und Thyen mit „glauben“, sondern mit „vertrauen“:
1,7 Dieser kam für das Zeugnis, das Licht zu bezeugen,
damit alle vertrauen durch ihn.Wir erklären das Verb pisteuein. Es ist die griechische Form der kausativen Verbalform der Wurzel ˀaman, „treu, fest sein“; kausativ also, he-ˀemin, „(einen Menschen) vertrauenswürdig sein lassen“, also „vertrauen“. <28> Glauben ist eine mehr oder weniger begründete Meinung haben, Vertrauen setzt eine Praxis in Gang. Johannes überträgt Substantive bzw. Adjektive der hebräischen Wurzel ˀaman mit griechischen Wörtern vom Stamm alēth-. Wir haben den Vorschlag Martin Bubers übernommen, alle Wörter dieser hebräischen Wurzel mit deutschen Wörtern vom Stamm trau- oder treu- zu übersetzen. Das Licht ist vertrauenswürdig, es kann Vertrauen erwecken. Die der Treue des Lichtes entsprechende Handlung der Menschen ist pisteuein, „vertrauen“.
↑ Johannes 1,9: Das vertrauenswürdige Licht
1,9 Das war das wahre Licht,
das alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen.
[6. März 2022] Mehrere Probleme stellen sich im Vers Johannes 1,9. Sie beginnen mit der Frage nach dem Subjekt des ersten Wortes ēn in Vers 9. In Vers 8 war klargestellt worden, dass Johannes der Täufer nicht „das Licht“ war. Kann es sein, dass es nun von diesem Licht einfach heißt (wie z. B. in der Lutherübersetzung), dass es das „wahre Licht“ war? Hartwig Thyen meint (T81), dass sich das betont am Anfang stehende ēn auf den logos, das Wort, beziehen muss, von dem in den Versen 1-4 die Rede war und der in Vers 5 mit dem Licht gleichgesetzt wurde. Denn „dem Menschen, der nicht das Licht war“, also dem Täufer, kann „nur eine personale Größe als das wahre Licht entsprechen“.
Überzeugender noch ist seine Beobachtung, dass es im folgenden Vers 10 heißt, dass die Welt „ihn“, auton, nicht erkannte. Dieses auton ist männlich, nicht sächlich, wie es sein müsste, wenn es sich auf das sächliche Wort phōs, „Licht“, beziehen würde. Und ein Wechsel des Subjekts ist zwischen Vers 8 und 9 inhaltlich angemessener als zwischen den Versen 9 und 10. Einen großen Bedeutungsunterschied verursacht dieses Problem aber nicht, da ohnehin das Wort mit dem Licht gleichgesetzt wird.
Klaus Wengst (W50) sagt zwar auch, „dass das jetzt nicht ausdrücklich genannte Subjekt ‚das Wort‘ sein muss“, wobei nun „an das geschichtliche Wirken Jesu gedacht“ ist, aber er geht trotzdem erst „ab V. 10 zum maskulinen Personalpronomen ‚er‘ über“ (W30):
1,9 Es war das wahre Licht …
1,10 ln der Welt war er …
Gerade weil aber im Deutschen das Wort „Wort“ sächlich und nicht männlich ist, erscheint bei ihm dieser Wechsel grammatikalisch unangemessen. Thyen vermeidet dieses Problem (T63), indem er von Vers 1 an das Wort logos unübersetzt in der Form „der Logos“ stehen lässt.
Wie Wengst bleibt auch Thyen dabei, das Wort ēn mit „war“ zu übersetzen, wobei ihm zufolge (T81) in diesem Wort „wie im Eingang des Prologs … wiederum ein ist ebenso wie ein wird sein eingeschlossen“ ist, während Ton Veerkamp <29> es auch hier für angemessener hält, das Missverständnis, es handle sich hier um ein vergangenes Geschehen, dadurch zu vermeiden, dass er ēn präsentisch mit „ist“ wiedergibt.
Ein weiteres Problem ist die Bedeutung des Wortes alēthinos. Wengst und Thyen übersetzen mit „wahr“, wobei Thyen (T81) darauf hinweist, dass Johannes dieses Wort in der Regel streng von dem verwandten Wort alēthēs unterscheidet:
to phōs to alēthinon ist nicht das wahre im Unterschied zu den falschen, sondern das vollkommene und authentische Licht im Gegensatz zu den unvollkommenen, vorläufigen und schattenhaften Lichtern.
Ich gebe zu, dass ich mit diesem Unterschied an dieser Stelle nichts anfangen kann. Welche Art von unvollkommenen Lichtern soll Jesus hier überstrahlen, und in welchem Sinne wird Thyen das andere Wort alēthēs als „wahr“ im Sinne von „richtig“ und im Gegensatz von „falsch“ auf Jesus beziehen – als wahrhaft göttlich im Unterschied zu falschen Göttern oder Gottessöhnen? Vielleicht wird Thyen das später verdeutlichen, wenn eine weitere der 9 Stellen mit alēthinos oder eine der 14 Stellen mit alēthēs vorkommt.
Wengst wiederum versteht (W50) Jesus „als das wahre Licht“ zunächst im Zusammenhang der
Konkurrenzsituation zur Täufergemeinde: Jesus wird als das wahre Licht hervorgehoben, weil es einen konkurrierenden Anspruch gibt, der in einem anderen das Licht erkennt. In „wahr“ ist aber noch ein anderer Aspekt enthalten, nämlich der des Wirklichen und Wesentlichen. Daher ist zu fragen, welche Wahrheit, welche Wirklichkeit denn im Lichte des Auftretens Jesu erkannt werden kann. Womit „erleuchtet“ er das Leben der Menschen? Hier kann nun zum Zuge kommen, dass der Evangelist im voranstehenden Exkurs Johannes als Zeugen für das Licht angeführt hatte; und das erinnert diejenigen, die das Evangelium nicht zum ersten Mal lesen, vor allem an sein Zeugnis über Jesus als „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“ (1,29.36). Das also leuchtet in Jesus als Wahrheit und Wirklichkeit auf, dass Gott hier als barmherzig und vergebend gegenüber der Welt, gegenüber allen Menschen begegnet, die deshalb auch im Lichte Jesu, in seiner Nachfolge, einen Weg gehen können, der Leben verheißt (8,12).
Grundsätzlich ist aber zu fragen, ob es hier überhaupt um etwas geht, was wir normalerweise als wahr oder unwahr bezeichnen. Ton Veerkamp, <30> der ebenso wie Wengst nicht auf einen Unterschied zwischen alēthinos und alēthes eingeht, macht darauf aufmerksam, dass der Jude Johannes das Wort alētheia, von dem beide Adjektive abgeleitet sind, nicht einfach im Sinne des griechisch-philosophischen Wahrheitsbegriffs versteht, also im Sinne einer objektiven Erkenntnis oder gemäß der Logik von richtig oder falsch. Bereits bei seiner Auslegung von Vers 7 hatte er darauf hingewiesen, dass Johannes „Substantive bzw. Adjektive der hebräischen Wurzel ˀaman mit griechischen Wörtern vom Stamm alēth-“ überträgt:
Alētheia ist nicht „Wahrheit“, sondern „Treue“ (ˀemuna, ˀemeth), alēthēs nicht „wahr“, sondern „getreu, vertrauenswürdig“. Phōs alēthinos aus 1,9 ist nicht das „wahre Licht“, sondern jenes Licht, auf das man sich beim Gehen durch das Leben (jüdisch halakha) verlassen kann, also „vertrauenswürdiges Licht“.
Diese Vertrauenswürdigkeit des Lichtes, das Jesus darstellt, ist natürlich auf die Treue des Gottes Israels bezogen, auf den Jesus als das Wort ausgerichtet ist und von dem er herkommt.
Eine dritte Frage entscheiden sowohl Thyen als auch Wengst und Veerkamp anders als die Lutherübersetzung, die das Ende von Vers 9, erchomenon eis tēn kosmon, „kommend in die Welt“ auf die Menschen bezieht. Nach Thyen (T81) wäre „die Näherbestimmung des Menschen als eines solchen, der in die Welt kommt… überflüssig und banal.“ Sinnvoller ist es (T82), das Kommen in die Welt auf Jesus als „das wahre Licht“ zu beziehen, „das bei seinem Kommen in die Welt jeden Menschen erleuchtet“.
Richtig spannend wird es nun mit dem Wort kosmos, das hier zum ersten Mal im Johannesevangelium auftaucht. Dürfen wir es einfach mit „Welt“ übersetzen und annehmen, dass wir schon genau wüssten, was damit gemeint ist? Die ausführliche Klärung verschiebe ich auf die Auseinandersetzung mit dem folgenden Vers 10, da kosmos dort gleich drei weitere Male vorkommt. Mit dieser Klärung mag zugleich auch klarer werden, was Johannes mit dem Wort phōtizein, „erleuchten“, meint.
↑ Johannes 1,10: Die (Menschen-)Welt unter der Weltordnung
1,10a Es war in der Welt,
1,10b und die Welt ist durch dasselbe gemacht;
1,10c und die Welt erkannte es nicht.
Was genau meint Johannes also mit dem Wort kosmos? Hartwig Thyen bezieht dieses Wort (T83) „unzweideutig“ auf die „Menschenwelt“ (die in geschweiften Klammern von mir hinzugefügten Übersetzungen gehen auf Thyen selbst (T63) zurück):
Hieß es in V. 3 panta di‘ autou egeneto {alles ist durch ihn geworden}, so ist, nachdem V. 9 den Blick von diesem neutralen und allumfassenden panta auf alle Menschen gerichtet hatte, an dessen Stelle jetzt das Lexem kosmos getreten, das hier, wie das Prädikat ouk egnō {hat nicht erkannt} unzweideutig anzeigt, der spezifischen Bezeichnung der Menschenwelt dient. Die erschreckende Pointe dieses wiederum dreigliedrigen Verses liegt in seinem verneinten dritten Satz: kai ho kosmos auton ouk egnō {doch die Welt hat ihn nicht erkannt}. Obgleich der logos im kosmos „war“ und unter den Menschen lebte, die ihm ihr Dasein verdanken samt allem, was sie dazu brauchen (kai ho kosmos di‘ autou egeneto {und die Welt ist durch ihn geworden}), haben sie ihm dennoch undankbar die Anerkennung versagt.
Dasselbe Verständnis von kosmos setzt auch Klaus Wengst voraus (W51), indem er schreibt,
dass das Wort, das Jesus ist, sich in der Welt nicht als in irgendeiner Fremde aufhält, sondern in der von Gott durch sein Wort geschaffenen Welt, dass der in Jesus präsente Gott derselbe ist, der am Anfang sein schöpferisches Wort sprach. Wiederum ist deutlich, dass kein doketischer Schöpfungsbegriff vorliegt. Dennoch muss Johannes feststellen, dass „die Welt ihn nicht erkannte“. „Erkennen“ dürfte im Sinn von „anerkennen“ verstanden sein. Die Welt erkennt nicht an, dass in Jesus als dem „wahren Licht“ Gott als barmherziger und vergebender präsent ist, was ja zugleich die Wahrheit über sie selbst enthält, dass ihre Taten böse sind und sie deshalb die Finsternis mehr liebt als das Licht (3,19; vgl. 7,7).
Letzten Endes läuft das, was Thyen und Wengst hier voraussetzen, darauf hinaus, dass die gesamte Menschenwelt bis auf wenige Ausnahmen „undankbar“ bzw. „böse“ ist und dass diese wenigen Ausnahmen nur dadurch vor ihrem Verderben gerettet werden können, dass sie an den Namen Jesu glauben (siehe Johannes 1,12).
Eine völlig andere Sicht der Dinge tut sich auf, wenn ernstgenommen wird, dass der Begriff kosmos auch in einem ganz anderen Sinn verstanden werden kann. Ton Veerkamp <31> fragt nämlich danach, inwiefern der von Gott sehr gut geschaffene Lebensraum der Menschen „finster“ sein kann, und er gibt eine Antwort, die sich auf den hellenistischen Begriff des kosmos bezieht:
Das Licht leuchtet in die Weltordnung (kosmos) hinein. Nicht die Welt als Lebensraum für die Menschen ist finster, sondern die Art und Weise, in der die Menschen den Lebensraum geordnet, organisiert, haben; das griechische Verb kosman bedeutet „in (schöne) Ordnung bringen“ (vgl. Kosmetik). Wir haben hier keine Pseudometaphysik der Urgegensätze Licht/Finster, Himmel/Erde bzw. Welt, Geist/Fleisch bzw. Materie usw. Hier wird keine Kosmologie, erst recht keine „gnostische“, sondern Politologie verhandelt.
Kosmos ist durch und durch griechisch. Wie der Himmel ein geordnetes, berechenbares Gesamt von Himmelskörpern ist, so ist die Welt eine politisch geordnete Welt, wie eine klassische Polis, eine Weltordnung. Das Hebräische hat ˁolam, „Epoche“, keine räumliche, sondern eine zeitliche Vorstellung. Die Erde (ˀerez) besteht für Israel aus vielen „Erden“/Ländern (ˀarazoth), in denen viele Völker nach ihren eigenen Satzungen oder Ordnungen, unter ihren eigenen „Göttern“ leben, Geschlecht für Geschlecht in Weltzeit (dor wa-dor le-ˁolam). Das ist eine völlig andere Art von Weltsicht.
Seit der Eroberung des Orients durch Alexander leben die Menschen in einer Ordnung, die durch die Urbanität des Hellenismus bestimmt ist, eben in einem Kosmos. Durch die Römer wird diese Ordnung buchstäblich zur Weltordnung. Und genau das ist das politische Problem. Die Weltordnung zerstört alle traditionellen Ordnungen der Menschen. Für sie ist Ordnung wirklich Unordnung, alles gerät aus den Fugen. Den Messianismus kann man nur verstehen vor dem Hintergrund traditionalistischer Revolten im ganzen Orient gegen die hellenistische Modernisierung traditioneller gesellschaftlicher Strukturen. Erfolg hatten sie zeitweise in Judäa durch die makkabäische Revolution um 170 v.u.Z.
Hat Johannes von Anfang an bei dem Wort kosmos eine Menschenwelt vor Augen, die durch die hellenistisch-römische Weltherrschaft, die sich selbst Weltordnung nennt, in Unordnung gebracht worden ist, dann ergeben sich daraus zwei Folgen für sein Evangelium. Erstens spielt der Begriff eine ähnliche Rolle als verdeckter Code für das Imperium Romanum wie in der Offenbarung des Johannes der Name Babel für Rom. Zweitens wird erklärbar, warum Johannes oft so widersprüchlich vom kosmos redet. Von Gott geliebt ist er als der sehr gut geschaffene Lebensraum für die Menschen, insbesondere für Israel inmitten der Völker – finster und dem Gericht Gottes ausgesetzt ist er als die dem befreienden NAMEN entgegenstehende weltweit versklavende Gewaltherrschaft Roms, ein neues Ägypten oder Babylon. Und indem Johannes die Befreiungserzählungen des Exodus und der Rückkehr aus der babylonischen Verbannung aufruft, proklamiert er den Messias Jesus als den Befreier der (Menschen-)Welt von der auf ihr lastenden Weltordnung (Johannes 4,42).
Versteht man das Wort kosmos auf diese Weise politisch, liegt es auch nahe, das Wort phōtizein, „erleuchten“, im vorigen Vers 9 nicht auf eine geheimnisvoll den gesamten Kosmos erfüllende Finsternis zu beziehen, sondern, so Veerkamp, „die Erleuchtung der Menschen“ durch das Licht des Messias Jesus „durchaus im Sinne der Aufklärung“ zu begreifen. „Sie sollen sehen, wie die Weltordnung wirklich ist, und sich entsprechend verhalten. … Der Messias ‚klärt‘ die Menschen ‚auf‘.“
Hier sollten wir nicht vorschnell urteilen, dass Veerkamp anachronistisch neuzeitliche Begriffe auf die Antike anwendet. Immerhin ist die jüdische Bibel, aus der Johannes schöpft, voll von prophetischer Kritik an der Politik sowohl der Großmächte als auch der Könige und Priester Israels und Judas, und das apokalyptische Buch Daniel verstand sich als eine Schrift, die den verbergenden Schleier vor der bestialischen Herrschaft der Weltmächte wegreißt, die bis zur Ankunft des Menschensohns, eines Herrschers mit menschlichem Angesicht, regieren (Daniel 7). Auf genau dieses Buch und die Gestalt des Menschensohns wird Johannes immer wieder Bezug nehmen.
Wie geht Ton Veerkamp nun aber mit dem mittleren Satz über den kosmos in Vers 10b um, kai ho kosmos di‘ autou egeneto, den Thyen so übersetzt (T63): „und die Welt {der Kosmos} ist durch ihn {den Logos} geworden“, und den auch Wengst (W30) mit „und die Welt ward durch ihn“ auf die Schöpfung bezieht? Dazu äußert Veerkamp in seiner Johannesauslegung von 2006/2007 erhebliche Schwierigkeiten:
Wir können ihn nicht von einer orthodox-trinitarischen Orthodoxie her erklären, der VATER habe die Weltordnung durch den SOHN erschaffen, sie sei demnach durch ihn geworden. Die Weltordnung ist aber kein Schöpfungswerk, sondern Menschenwerk. Der Lebensraum der Menschen ist hier die Erde; sie ist geschaffen. Aus der Erde machen die Menschen Welt, Weltordnung. Wenn also übersetzt wird, die Weltordnung sei durch es [Licht, Wort] geworden, verbreitet man Unsinn. Denn man müsste dann fragen, wie der Satz weiter zu denken ist. Geworden zu dem, was sie ist? Oder geworden zu dem, was sie sein soll?
Hier bin ich mit Veerkamp nicht ganz einverstanden, nämlich mit dem von mir fett hervorgehobenen Satz. Denn damit widerspricht er der von ihm selbst vertretenen Einsicht, dass Johannes den kosmos eben nicht durchgehend negativ betrachtet. Vor allem nach 3,16-17 gilt ihm die solidarische Liebe Gottes; er soll nicht gerichtet, sondern befreit werden (3,16-17).
Das heißt: Johannes kann meines Erachtens durchaus voraussetzen, dass die Lebenswelt der Menschen durch Gottes „Wort“, logos, hebräisch davar, in dem Sinne „geworden“ ist oder in Gang gesetzt wird, als ihre sehr gute Schöpfung (1. Mose 1,31) von Anfang an fortwährend der Finsternis und dem thohu wabohu abgerungen werden muss (1. Mose 1,2). Und es ist genau dieses schöpferisch-befreiende Wort des Gottes Israels, das sich Johannes zufolge im Messias Jesus verkörpert.
Natürlich setzt Johannes noch keine trinitarische Christologie voraus, aber im Hintergrund von Johannes 1,10b kann durchaus die Vorstellung stehen, dass die göttliche „Weisheit“, sophia, nach Sprüche 8,30 bei der Schöpfung vor Gott spielte und nach dem Buch der Weisheit Salomos 9,9 bei Gott war, als er den kosmos erschuf. Dass Johannes trotzdem darauf verzichtet, Jesus ausdrücklich mit der sophia zu identifizieren, führe ich darauf zurück, dass seine Zeit am Ende des 1. Jahrhunderts nach dem verheerenden Judäischen Krieg eben keinen Anlass für einen Lobpreis des weisheitlich geordneten kosmos bot. Stattdessen wird Johannes auf die Zeichen und Wunder der Exodusgeschichte zurückgreifen, um die Befreiung der Menschenwelt von der gegengöttlichen Weltordnung durch Jesus als Verkörperung des Wortes Gottes oder, anders gesagt, seiner befreienden logoi, hebräisch devarim, „Tatworte, Worttaten“, zu beschreiben.
Die von Veerkamp aufgeworfene Frage, wozu der kosmos als die Menschenwelt durch das Wort geworden ist, ist also tatsächlich so zu beantworten, dass sie zu dem wird, „was sie sein soll“, indem sie Widerstand gegen das leistet, „was sie ist“. Veerkamps sich daran anschließende Erläuterungen widersprechen daher keineswegs meiner Einschätzung, dass sich Vers 10b doch auf die Schöpfung beziehen kann:
Durch das Wort wird die herrschende Weltordnung (ho kosmos houtos, jüdisch ˁolam ha-se) konfrontiert mit ihrer absoluten Alternative, der kommenden Weltzeit (ho aiōn ho mellōn, ˁolam ha-baˀ). Keine herrschende Weltordnung kann ihre eigene radikale Alternative denken; sie müsste dann ihren Untergang denken. Das Wort ist etwas, das von außen, als Fremdes, auf sie zukommt und Dinge in Gang setzt, die sie vollkommen in Frage stellen werden. Wirklich deutlich wird das erst im Gespräch zwischen dem Messias und dem Vertreter Roms, Pilatus. Diese Weltordnung und das Wort schließen sich absolut aus. Die Geschichte, die durch das Wort in Gang gesetzt wird, steht der Geschichte Roms – der konkreten Weltordnung – diametral gegenüber.
In Vers 10 kommt dieser Gegensatz aber erst im dritten Teil, 10c, zum Ausdruck, wo Johannes davon spricht, dass der kosmos „ihn“, auton, nämlich das Wort des Gottes Israels, „nicht erkannte“, ouk egnō, wobei es <32> nicht „um Unwissenheit“, sondern „um Verweigerung“ geht, also eine feindselige Nichtanerkennung. Auch nach Thyen (T83) geht es in diesem Zusammenhang „nicht einfach um einen intellektuellen Defekt“, sondern um das „Versagen der Anerkennung des fremden Anderen“, wobei diese Formulierung in ihrer Struktur dem eben angeführten Gegensatz der politischen Theologie Veerkamps entspricht.
In der Neubearbeitung seiner Übersetzung des Johannesevangeliums <33> geht übrigens dann auch Veerkamp davon aus, dass in Johannes 1,10 beide kosmos-Begriffe nebeneinander verwendet werden:
Hier bedeutet es sowohl Lebensraum als auch jene Ordnung, die die Ordnung der einzelnen Völker und eben vor allem die Ordnungen Israels bedroht. Das Schlechte an der Welt ist bei Johannes nicht die Welt an sich, sie ist das Objekt der Solidarität Gottes, 3,15. Schlecht ist die Ordnung, unter der sie leiden muss. Daher gibt es keine „gnostische“, vielmehr eine „politische“ Kosmologie bei Johannes, der wir durch die alternierende Übersetzung „Welt“ und „Weltordnung“ Rechnung zu tragen versuchen.
Für Vers 10 schlägt er demgemäß folgende Übersetzung vor, wobei er für den ersten Teil darauf verweist, dass es „nicht um ein allgemein-abstraktes Sein, sondern um ein konkretes, tatkräftiges, effektives Geschehen, Wirken“ geht:
1,10a In der Welt wirkt es,
1,10b die Welt geschieht durch es,
1,10c aber die Weltordnung erkennt es nicht an.
↑ Johannes 1,11: Das Eigene und die Eigenen
1,11 Er kam in sein Eigentum;
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Zu Johannes 1,11 zitiere ich zunächst Ton Veerkamp: <34>
Das Wort kam in das Eigene. Die Kommentare behandeln das Eigene in der Regel als ein Synonym für Welt. Aber es ist nicht die Welt, erst recht nicht die Weltordnung. Es geht um das, was das Eigene des Messias unter den Bedingungen der Weltordnung ist: das judäische Volk. Die Eigenen sind die, die im Evangelium Ioudaioi genannt werden, die Judäer, „Juden“ in den gängigen Übersetzungen. Dieses Volk nimmt seinen eigenen Messias nicht an. Das ist der Konflikt, der das ganze Evangelium bestimmt, der Kampf um Anerkennung des Messias durch das eigene Volk.
Das sieht Hartwig Thyen (T83) entgegen „einem relativ breiten Konsensus“ der Exegeten genauso, weil „nirgendwo im Prolog … einfach dasselbe mit anderen Worten noch einmal gesagt“ wird. Die gegenüber dem Vers 10 „neue Information“ in Vers 11 besteht (T84) in den Worten „ta idia und hoi idioi“, „das Eigene“ und „die Eigenen“, die er „auf das jüdische Land und Volk“ bezieht. Außerdem ist „ein fleischgewordener basileus tou Israēl {König von Israel} (1,49) ohne eine konkrete Heimat im verheißenen Land seiner Väter“ nicht denkbar. Und schon Luther <35> hatte „mit sicherem Gespür für das Gewicht des doppelten idios“ erklärt (T85):
„Er nennet die Juden seyn eygen volck. Darumb, daß sie auß aller welt erwellet waren zu seynem volck, und yhn vorsprochen war zu Abraham, Isaak, Jakob und Dauid. Denn uns heyden ist nichts vorsprochen, frembd und von Christo. Darumb sind wir nit seyn eygen genennet“.
Interessant ist noch ein weiteres von Thyen angeführtes Argument, dass der „Konzentrationsbewegung vom kosmos hin zu den ‚Seinen‘ … auch die Abfolge von Ur- und Vätergeschichte der Genesis“ entspricht. Das heißt: Johannes konzentriert ganz bewusst sein besonderes Augenmerk auf das Volk Israel inmitten der Völker.
Klaus Wengst dagegen (W51) gibt „zwei Verstehensmöglichkeiten“ für die Verse 10 und 11 an. Zum einen kann man sie „inhaltlich parallel“ verstehen, insofern Jesus in die Welt als „das ihm sozusagen von Haus aus Eigene“ kommt, aber „wie ein Fremder behandelt“ wird, „weil die Welt sich ihrem Schöpfer entfremdet hat, der in ihm präsent ist“:
Zum anderen kann aber das Verhältnis auch als das zweier konzentrischer Kreise gelesen werden. Nach der ganzen Welt käme dann ein engerer Kreis ins Blickfeld. Damit kann nur Israel gemeint sein, sodass „das Seine“ und „die Seinen“ das eigene Land und die Landsleute Jesu bezeichneten. In solcher Weise wird schon in Ex 19,5 Israel als Eigentum Gottes vor allen Völkern bezeichnet, dem doch, wie gleich anschließend festgestellt wird, die ganze Erde gehört. Liest man so, formuliert Johannes die Ablehnung, die Jesus in Israel erfährt.
In diesem Zusammenhang übt Wengst indirekt Kritik an Johannes, indem er ihm Paulus gegenüberstellt, der „mit der jüdischen Ignorierung Jesu etwas Positives“ anfängt (W51f.),
indem er feststellt, dass erst dadurch die Botschaft zu den Völkern gelangt ist (Röm 11,11f.15.25.31). Die daraus entstandene Kirche aus den Völkern hat, mächtig geworden, oft genug Jüdinnen und Juden zur Stellungnahme gegenüber Jesus gezwungen, weil sie es auch ihnen gegenüber für die einzig relevante Frage hielt, ob Jesus der Messias sei oder nicht. Ich muss wahrnehmen, dass schon ab dem 2. Jh. Jüdinnen und Juden darauf mit „Nein“ antworten mussten, wollten sie ihre jüdische Identität bewahren. Ich muss wahrnehmen, dass ihr Nein zu Jesus ganz und gar kein Nein zum einen Gott bedeutet, der doch der Gott Israels ist und bleibt. Und ich sehe, dass Paulus nicht das Evangelium zum entscheidenden Kriterium der Wahrnehmung Israels durch Menschen aus den Völkern macht, die an Jesus als Messias glauben, sondern Israels in Geltung bleibende Erwählung durch Gott (Röm 11,28f.).
Wenngleich ich dankbar bin für Wengsts Sensibilität diesem Thema gegenüber und auch für sein Eintreten gegen jeden Bekehrungsdruck gegenüber Juden, frage ich mich, ob der Vergleich mit Paulus für das Verständnis der Haltung des Johannes im Konflikt mit seinen Mitjuden überhaupt etwas austrägt. In meinen Augen leidet Johannes unter der Ablehnung Jesu durch das zu seiner Zeit entstehende rabbinische Judentum, bleibt zugleich aber vor allem anderen an der Sammlung Israels um den Messias Jesus interessiert. Wengst scheint schon für Johannes eine viel stärkere Öffnung zu den Völkern anzunehmen, mit der Gefahr, die sich dem Messias verschließenden Juden völlig aufzugeben.
↑ Johannes 1,12-13: Aus Gott geboren – nicht aus Blut, Fleisch oder Manneswillen
1,12 Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden:
denen, die an seinen Namen glauben,
1,13 die nicht aus menschlichem Geblüt
noch aus dem Willen des Fleisches
noch aus dem Willen eines Mannes,
sondern aus Gott geboren sind.
[7. März 2022] Diese Verse werden von Thyen, Wengst und Veerkamp auf drei sehr verschiedene Weisen ausgelegt.
Hartwig Thyen konzentriert sich ganz im Sinne der kirchlichen Dogmatik von Karl Barth auf den Erweis (T86), dass es Gott ist, der durch seinen Logos den eigentlich Verlorenen sowohl aus „dem kosmos“ als auch von „den idioi“, den Eigenen, die Vollmacht, exousia, gibt, Kinder Gottes zu werden (T87), indem sie den Logos aufnehmen und an seinen Namen glauben. Dabei wehrt er sich gegen die Vorstellung „zweier seit Ewigkeit entweder zum Heil oder zum Verderben vorherbestimmter Menschenklassen“. Vielmehr ist „der Glaube … die freie und spontane Antwort auf das Wort…, das als schöpferisches freilich solche Freiheit allererst stiftet und zu ihr ermächtigt“.
Interessant ist, wie Thyen (T86) mit der „Antithese zu den beiden vorangegangenen Versen“ seine Auffassung begründet, dass nun „der Prolog … über die im Evangelium erzählte Geschichte Jesu hinaus“ geht und ein über das Volk Israel hinausgehendes Interesse auch von Heiden an Jesus ausdrückt (T86f.):
Denn erst seit „das Weizenkorn seiner göttlichen Bestimmung gemäß in die Erde gefallen und gestorben ist“, gehören zu denen, „die ihn aufnahmen“, als seine „vielfältige Frucht“ auch solche, die, im kosmos zerstreut, zuvor Fremde und nicht seine idioi waren. Zusammen mit den Glaubenden aus dem Gottesvolk sind sie, die „Nicht-Sein-Volk“ waren, sein erwähltes Eigentum und „Gottes Kinder“ geworden“.
Warum aber sollte der Prolog mehr ausdrücken wollen als das erzählte Evangelium? In einem anderen Zusammenhang ging Thyen kurz zuvor (T86) ausdrücklich davon aus, dass sich eventuelle „anfänglichen Vermutungen oder Hypothesen“ zum Prolog durch „weitere Lektüre entweder bestätigen oder aber als unhaltbar erweisen müssen“. In diesem Sinne wird auch zu prüfen sein, wie weit das Interesse schon des Johannes sich tatsächlich über das Volk Israel hinaus auch auf Menschen aus den Völkern richtet.
Für Klaus Wengst (W52) kommt in den Versen 12 und 13 „zum ersten Mal die Gemeinde in den Blick“, und auch ihm zufolge betont hier Johannes, dass diese
nicht aus dem eigenen Entschluss ihrer Mitglieder entstanden ist und auf deren Willen beruht, sondern dass es sie nur als Wunder, als Werk Gottes, als seine Neuschöpfung gibt. Aktiv und Passiv, Handeln Gottes und Handeln der Menschen sind unauflöslich miteinander verbunden. Sie nehmen auf und glauben bzw. vertrauen; sie werden erzeugt, werden zu Kindern Gottes. Die Passivität, dass der Mensch zu seiner eigenen Geburt nichts beiträgt, und die Aktivität, das Aufnehmen, wo Nicht-Annahme das zu Erwartende und Übliche ist, liegen beim Entstehen von Gemeinde ineinander.
Anders als Thyen versteht Wengst (W53) diese Gotteskindschaft von den jüdischen Schriften her:
„Die ihn aufnahmen“, „die an ihn Glaubenden“ bezeichnet Johannes als „Kinder Gottes“. Damit nimmt er auf, was in der jüdischen Bibel von Israel gilt. So heißt es etwa Dtn 14,1: „Kinder seid ihr des Ewigen, eures Gottes.“ Für Rabbi Akiva ist diese Stelle Beleg dafür, dass die Israeliten von Gott Geliebte sind, wobei sich Gottes besondere Liebe darin erweist, dass er ihnen diese Kindschaft auch kundgetan hat (mAv 3,14).
Dass Ton Veerkamp <36> mit einer solchen Sichtweise nicht einverstanden ist, wundert mich etwas; er übersetzt tekna theou mit „Gottgeborene“ und gesteht zwar zu, dass wir aus der Schrift zwar „Ausdrücke wie bene ha-ˀelohim, ‚Gottessöhne‘, ˀisch-ha-ˀelohim, ‚Gottesmann‘,“ kennen, „aber jilde ha-ˀelohim, ‚Kinder Gottes‘, kommen in der Schrift nicht vor. Gott hat keine Kinder.“ Dass der Gott Israels natürlich keine Kinder im selben Sinne hat wie in der griechisch-römischen Götterwelt, versteht sich von selbst. Aber auch wenn der Ausdruck „Kinder Gottes“ nicht wörtlich in der jüdischen Bibel vorkommt, entspricht das, was mit den „Söhnen Gottes“ etwa in 5. Mose (Deuteronomium) 14,1 gemeint ist – und was Wengst in gerechter Sprache mit „Kinder Gottes“ wiedergibt –, auch meines Erachtens durchaus dem Sinn dessen, was Johannes ausdrücken will.
Weiter geht Wengst – ebenfalls anders als Thyen – näher auf die Frage ein (W52), welcher Name es ist, an den diejenigen glauben, die Jesus als das Wort akzeptieren. Er „taucht hier recht unvermittelt auf, da ja bisher noch gar kein Name genannt worden ist“; der Name Jesus erscheint erst in Vers 17. Folgendermaßen erklärt Wengst, was es bedeutet, an diesen Namen zu glauben:
Glauben an seinen Namen heißt, an ihn zu glauben; denn der Name steht für die Person. Die Akzeptanz dessen, dass in Jesus Gott zu Wort kommt, kann nur so erfolgen, dass diesem Wort gefolgt, dass auf den hier präsenten Gott vertraut wird. Nichts anderes meint die Wendung vom „Glauben an seinen Namen“.
Konkreter als Wengst wird Ton Veerkamp <37>, wenn er zum Vertrauen „im NAMEN des Messias“ näher erläutert:
Der Name war in jener Kultur mehr als eine Kennzeichnung eines Individuums, anders als bei uns. Bei uns kann man beliebig seinen Namen wechseln. Aber Name in einer altorientalischen Kultur ist das unverwechselbare, unaufgebbare Eigene der Person, es ist die ureigene Lebensaufgabe einer Person. Tut sie nicht das, was ihr Name sie zu tun heißt, bleibt es für immer ungetan und ungeschehen. Der NAME des Messias ist die Befreiung der Welt von der Ordnung, die auf ihr lastet, Johannes 4,42. Vertrauen im NAMEN (oder auf den NAMEN hin) bedeutet, dass man vertraut, dass der NAME hält, was er verspricht.
Wengst zufolge (W52) wird vom „Glauben an den Namen“ auch in „einer rabbinischen Tradition“ gesprochen, dort aber (W53) ist „vom Glauben an den Namen Gottes“ die Rede. Dennoch kann man, so meint er, beides aufeinander beziehen:
Einmal kann neben dem Glauben an Gott schon biblisch vom Glauben an Mose gesprochen werden (Ex 14,31; vgl. 19,9). Das Vertrauen auf Mose richtet sich darauf, dass er nicht irgendetwas, sondern Gottes Worte vermittelt, dass also in dem, was er dem Volk sagt, Gott selbst zu Wort kommt. Nicht anders verhält es sich – und das ist der zweite Punkt -, wenn im Johannesevangelium vom Glauben an Jesus die Rede ist. Besonders zugespitzt ist das in 12,44 ausgesprochen, wenn es in der den ersten Teil des Evangeliums abschließenden Jesusrede heißt: „Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich geschickt hat.“
Das ist nur zum Teil richtig, denn Johannes versteht – im Unterschied zum Vertrauen auf Mose – das Vertrauen auf den Namen des Messias Jesus doch sehr anders, nämlich im Sinne sogar einer Verkörperung des befreienden NAMENS des Gottes Israels (vgl. schon meine Auslegung von Johannes 1,1a, insbesondere Anm. 13). Leider gehen weder Wengst noch Thyen auf diese Beziehung des Namens Jesu zum heiligen Gottesnamen des jüdischen TeNaK inhaltlich ein.
Ebenso verzichten sie voll und ganz darauf, von den jüdischen Schriften her den auf die „Gotteskindschaft“ bezogenen Satz des Johannes zu deuten: „Die nicht aus Blut noch aus Fleischeswillen noch aus Manneswillen, sondern von Gott erzeugt worden sind.“ Wengst begnügt sich dazu mit der knappen Feststellung:
Was ist damit über die Glaubenden gesagt? Natürlich sind sie – wie andere Menschen auch – „aus Blut und aus Fleisches- und aus Manneswillen“, also auf dem üblichen Weg zur Welt gekommen. Sie sind ja leibhaftige Menschen und keine Scheinwesen. Aber Glaubende sind sie nicht aus natürlichen Voraussetzungen. Dass es überhaupt welche gibt, die im Wirken und Geschick Jesu die Präsenz des Gottes Israels erkennen und anerkennen, das kann der Evangelist nur als Wunder verstehen, als Tat Gottes selbst.
Wie eben beim Thema des Namens wird auch an dieser Stelle Ton Veerkamp <38> sehr viel konkreter. Was bedeutet das, was Johannes mit ek theou gennēthēsan umschreibt, dass sie „gottgemäß gezeugt wurden“? Veerkamp verdeutlicht mit drei negativen Bestimmungen, worauf es dabei nicht ankommt:
1. „Nicht aus Blut“, ouk ex haimatōn. Zu diesem Wort haimata im Plural, „den es in der deutschen Sprache nicht gibt“, verweist Veerkamp auf 73 Stellen in der Schrift, wo das hebräische Wort damim, ebenfalls „Blut“ im Plural, „vor allem im Zusammenhang mit Opferritualen“ vorkommt, und insbesondere auf 2. Mose 4,24-26, wo es um das Blut der Beschneidung geht. Von daher folgert er:
Nicht die Beschneidung, Merkmal der Unterscheidung Israels von den anderen Völkern, entscheidet darüber, wer zum „Eigenen des Messias“ gehört. Nicht aus Blut heißt daher: nicht aus der Beschneidung und für sie gezeugt werden. Hier gibt es keinen Meinungsunterschied zwischen Johannes und Paulus.
Dieses Argument hätte Thyen durchaus für seine oben angeführte Annahme ins Feld führen können, dass Johannes hier nicht ausschließlich an Glaubende aus Israel denkt.
2. „Nicht aus dem Willen des Fleisches“, oude ek thelēmatos sarkos. Zum ersten Mal taucht hier im Johannesevangelium das Wort sarx, „Fleisch“, auf, womit in den jüdischen Schriften „keine negative Vorstellung“ verbunden ist. „Es bedeutet die verwundbare, vergängliche menschliche Existenz“, aber natürlich „keine Ablehnung der menschlichen Existenz“ wie in der weltflüchtigen Gnosis.
An dieser Stelle macht Veerkamp schon auf den in seinen Augen entscheidenden Gegensatz zwischen sarx, also „fleischlicher Existenz“, und einem anderen johanneischen Schlüsselbegriff aufmerksam, der zōē aiōnios (wörtlich „äonisches Leben“):
Der Gegensatz ist der zwischen „vergänglich“ und „bleibend“. „Nicht aus dem Willen des Fleisches“ heißt: nicht aus einer Existenz gezeugt werden, die an diese Weltzeit, an den ˁolam ha-se, und somit an die herrschende Weltordnung gebunden bleibt. Johannes will keine menschliche (fleischliche) Existenz, die an der Vergänglichkeit ihrer historischen Bedingungen gebunden bleibt, sondern eine messianisch inspirierte (nicht: geistige!) Existenz, die die kommende Weltzeit verkörpert. Der Gegensatz zu einem vergänglichen, verwundbaren, körperlichen Leben ist bei Johannes nicht das ewige, geistige Leben im Jenseits, sondern ein Leben der kommenden Weltzeit, zōē aiōnios, im Diesseits. Das Adjektiv aiōnios bedeutet „den kommenden aiōn, den ˁolam ha-baˀ (Buber: Weltzeit), die kommende Epoche betreffend“. Der Ausdruck stammt von Daniel. Wir kommen darauf zurück, wenn wir die Stelle 5,29 besprechen. Diese Epoche wird bleibend sein, eine Epoche, in der das menschliche Leben nicht länger durch unmenschliche Verhältnisse bedroht ist. Wir übersetzen daher zōē aiōnios konsequent mit „Leben der kommenden Weltzeit“ und nicht mit „ewiges Leben“.
3. „Nicht aus dem Willen des Mannes“, oude ek thelēmatos andros. Dabei ist nach Ton Veerkamp „an Abraham zu denken“, dessen Sohn „das Thema von Genesis 15-22“ ist:
An keiner Stelle ist davon die Rede, dass Abraham diesen Sohn, den einzig Geborenen, mit Sara gezeugt hatte. Es ist nur von Sara und ihrem Sohn die Rede. Wir hören nirgends den klassischen Satz: „Der und der [Abraham] erkannte sie und sie [Sara], wurde schwanger und gebar einen Sohn…“ Der Sohn, den beide wollten, um den sie Gott angefleht hatten, wird geboren, nicht aus dem Willen eines Mannes! Zwar hören wir: „Dies sind die Zeugungen Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak“, Genesis 25,19. Aber die Zeugung durch Abraham ist ein Element aus dem Kapitel: „Zeugungen Isaaks“. Ganz im Gegensatz zu all den Patriarchen aus dem Buch Genesis, Zeugungen (tholedoth), tholedoth ˀAdam (Genesis 5,1) tholedoth Noach … bis tholedoth Jaˁaqov (Genesis 37,2) fehlt ausgerechnet das Kapitel tholedot ˀavraham…
Das Kind wurde Abraham geboren, passiv; Sara hat geboren, aktiv. …
Das heißt, Veerkamp zufolge ist bereits hier von dem Einziggeborenen, monogenēs, die Rede, den Johannes im folgenden Vers 14 zum ersten Mal erwähnen wird:
Der Einzige, der monogenēs, ist der neue Isaak, der einzige gottgemäß Gezeugte. Wer dem vertraut, wird selber zum gottgemäß Gezeugten. Er sieht wirklich Licht, ist aufgeklärt, bleibt am Leben in einer Ordnung des Todes.
So kann eine Auslegung von Johannes 1,13 aussehen, die streng vom jüdischen TeNaK her denkt und nicht vorschnell spätere christliche Dogmatik in das Evangelium hineinliest. Es wäre zu begrüßen, wenn die akademische Bibelwissenschaft solche exegetischen Ansätze nicht weiterhin komplett ignorieren, sondern wenigstens in Erwägung ziehen würde.
↑ Johannes 1,14a: Das Wort wird Fleisch – ein bestimmter jüdischer Mensch
1,14a Und das Wort ward Fleisch.
[10. März 2022] In Vers 14 wechselt der Stil des Prologs (W54) von der „Beschreibung in der dritten Person“ zu einem „Wir“, in dem, wie Klaus Wengst es formuliert, „die bekennende Gemeinde“ das Wort ergreift. Das wird allerdings erst in Vers 14bc deutlich. Wie im Vers 1 das Wort in seiner Ausrichtung auf den Gott Israels beschrieben wurde, so bekennen sich in Vers 14a diejenigen, die zuvor als Kinder Gottes bezeichnet wurden, zu Gottes Wort, das „Fleisch“ wurde:
Gottes schöpferisches Sprechen nimmt konkrete Gestalt an, verdinglicht sich geradezu, wird weltlich und gegenständlich. Es steht hier dasselbe Wort „Fleisch“, das gerade gebraucht wurde, wo sich die Geburt aus Fleicheswillen und die Erzeugung von Gott gegenüberstanden. In der biblischen Tradition bezeichnet „Fleisch“ als anthropologischer Ausdruck den Menschen in seiner Hinfälligkeit und Vergänglichkeit (vgl. Jes 40,6f.) – im Unterschied zu Gott, der gerade nicht Fleisch ist (vgl Jer 17,5.7). Von dem Wort, das „am Anfang bei Gott war“, das einen solchen Anfang hat, vor dem es keinen weiteren Anfang gibt, das der Anfang schlechthin ist, heißt es jetzt, dass es Fleisch wurde und also hinfällig-vergängliche Materie, dass es einen Anfang in der Zeit hat und damit auch ein Ende in ihr.
Vehement wehrt sich Wengst jedoch gegen „die christlich beliebt gewordene Redeweise von der Menschwerdung Gottes“. Davon ist bei Johannes nicht die Rede (54f.):
Nach Johannes ist Gott nicht Mensch geworden. Er spricht genauer davon, dass das Wort Fleisch geworden ist. Noch zugespitzter wäre zu sagen: Das Wort des Gottes Israels ist „jüdisches Fleisch“ geworden. <39> Dementsprechend hatte er Gott und das Wort nicht einfach miteinander identifiziert sondern einen differenzierten Zusammenhang aufgewiesen. Gott geht nicht in seinem Wort auf, wenn er sich auch in ihm entäußert und äußert, in ihm präsent ist. „Das Wort ward Fleisch“ – Gott teilt sich wirklich in der Konkretheit des Menschen Jesus von Nazaret mit, aber es bleibt indirekte Mitteilung, vermittelt durch Auftreten und Schicksal dieses Menschen. Es geht Johannes nicht um die Vergöttlichung Jesu – und schon gar nicht um die Vergottung der an ihn Glaubenden.
Wenn also (55) Udo Schnelle <40> sagt: „Jesus ist Mensch geworden und zugleich Gott geblieben!“, oder Michael Theobald <41> zu der Aussage neigt, dass „der fleischgewordene Logos sein göttliches Wesen“ bewahrt, dann „steuert“ Wengst zufolge „mehr oder weniger bewusst die im griechischen Denkhorizont ausgebildete kirchliche Dogmatik die Auslegung des Textes.“ Dazu ist aber zu bedenken (55f.), dass
die philosophischen Begriffe „Sein“ und „Wesen“ … nicht nur bei Johannes nicht vorkommen, sondern in der gesamten Bibel nicht. … Die Bibel – und mit ihr Johannes – erzählt vom Mitsein und Mitgehen Gottes mit seinem Volk Israel und – im Neuen Testament – mit dem einen Juden Jesus und mit und durch beide auch mit den Völkern.
Ganz anders geht Hartwig Thyen an Johannes 1,14 heran (T89), indem er nämlich genau das tut, was Wengst kritisiert, nämlich in seiner Auslegung wieder auf das griechisch-philosophische Denkmuster von Sein und Werden zurückzugreifen. Das wird am deutlichsten, wenn er in Vers 14 „den beiden vorangehenden V. 12 u. 13 gegenüber“ eine in seinen Augen paradoxe „Umkehrung“ feststellt:
Die der Sphäre des genesthai {Werden} zugehörigen und ihrer Genese aus Fleisch und Blut verhafteten sterblichen Menschen werden paradoxerweise, was der logos als der monogenēs {Einziggeborene} vom Vater von Ewigkeit her immer schon war, nämlich „Kinder Gottes“ (V. 12f; vgl. 1Joh 3,1). Er dagegen, der ,Gott war‘ (V. 1c), begibt sich seiner „Heimat“ im Sein (ēn) und tritt ein in die Welt des Werdens: kai ho logos sarx egeneto {Und der Logos wurde Fleisch} (V. 14a)…
Damit ist verbunden, dass dieser Logos, „der wie der Vater, das Leben ‚in sich selbst hat‘ (5,26), … sich auf den Weg des Todes“ begibt (T89f.):
Das darf freilich nicht so verstanden werden, als hätte er mit der Fleischwerdung sein theos einai {Gottsein} preisgegeben und seine göttliche doxa {Herrlichkeit} abgelegt. lm Gegenteil! Gerade in seinem irdischen Weg, der in der Hingabe seines Fleisches für das Leben der Welt gipfelt und darin Gottes Liebe zu seiner Schöpfung vollendet, erscheint seine göttliche doxa, so daß seine tiefste „Erniedrigung“ sich denen als „Erhöhung“ und „Verherrlichung“ zeigt, die sie als den Weg seiner Liebe begreifen.
Indem Thyen intensiv (T92) über die „‚Vereinigung von Gottheit und Menschheit‘ in der Person Jesu Christi“ spekuliert, lassen seine Formulierungen deutlich erkennen, wie er von der griechisch-philosophisch geprägten kirchlichen Dogmatik her argumentiert. Interessant finde ich, dass er das offenbar selbst als problematisch empfindet, denn er wendet sich ausdrücklich gegen „die Zwei-Naturen-Lehre“, die schon nach Schleiermacher <42> „ die Spuren eines unbewußten Einflusses heidnischer Vorstellung an sich trage“, und fragt sich mit Johannes Fischer, <43>
„ob nicht innerhalb der Christologie die Unterscheidung von Gottheit und Menschheit Jesu statt als Unterscheidung einer zweifachen Substantialität bzw. zweier Kategorien von Eigenschaften als Unterscheidung zweier Erkenntnisweisen gefaßt werden muß. Der Sohn Gottes hat keine andere Gestalt als die Gestalt jenes Menschen, den uns die Evangelien vor Augen stellen. Als Mensch begegnet uns Jesus als ein Teil der Welt, dadurch, daß unsere Erkenntnis ihn im Zusammenhang dieser Welt lokalisiert. Als Gott aber begegnet er im Wort der Schrift, dadurch, daß die Erkenntnis des Glaubens, dieses Wort in die Phänomene abbildend, uns mitsamt unserer Welt im Zusammenhang seiner Geschichte lokalisiert. Der Gedanke einer zweifachen Substantialität ist demgegenüber Ausdruck jener supranaturalistischen Auffassung, welche die Wirklichkeit Gottes als eine besondere Sphäre innerhalb des in die theoretische Erkenntnis fallenden Bereichs aufsucht und damit die Welt verdoppelt.“
In seinem Interesse, Jesus in seiner Göttlichkeit vom „Wort der Schrift“ her auszulegen, ist Thyen der Auffassung von Wengst nahe, indem er allerdings von „Jesus als ein Teil der Welt“ spricht, bleibt offen, inwieweit er ihn als den konkreten Juden, der er ist, wahrnehmen wird.
Obwohl Thyen nicht von einer Zwei-Naturen-Lehre sprechen will, ist die Art, wie er sich mit der Spannung zwischen sarx, „Fleisch“, und doxa, „Herrlichkeit“, beschäftigt, doch sehr der dogmatischen Formel verpflichtet, die erst mehr als dreieinhalb Jahrhunderte nach Johannes im Jahr 451 auf dem Konzil in Chalcedon die Einheit von Jesu Gottheit und Menschheit zu beschreiben suchte:
„Ein und derselbe ist Christus, der einziggeborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vereinigt.“
Ganz in diesem Sinne geht es Thyen zufolge (T92) bei der
„Vereinigung von Gottheit und Menschheit“ in der Person Jesu Christi nicht einfach um die mythische Metamorphose des logos…, aus der dann eine wie auch immer geartete Synthese von sarx und doxa resultierte. sarx und doxa bleiben vielmehr in einer unaufhebbaren Spannung zueinander bestehen.
In diesem Zusammenhang geht Thyen (90) auf die Kontroverse zwischen Bultmann und Käsemann um die Auslegung von Johannes 1,14 ein, innerhalb derer er Rudolf Bultmann <44> darin zustimmt, dass „der Logos“ in „purer Menschlichkeit … der Offenbarer“ ist und nicht „etwas Strahlendes, Mysteriöses oder Faszinierendes … als Heros oder theios anthrōpos {göttlicher Mensch}, als Wundertäter oder Mystagoge“.
Ernst Käsemann <45> dagegen hatte behauptet, wie bereits gesagt, dass es im Johannesevangelium eigentlich um die „Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit durch einen Jesus“ gehe, „dessen ‚Fleisch‘ nur das Inkognito eines ‚über die Erde schreitenden Gottes‘ ist“:
„In welchem Sinne ist derjenige Fleisch, der über die Wasser und durch verschlossene Türen geht, seinen Häschern ungreifbar ist, am Brunnen von Samaria, müde einen Trunk verlangend, gleichwohl nicht zu trinken braucht und eine andere Speise hat als die, für welche seine Jünger sorgen? Von den Menschen wird er nicht getäuscht, weil er auch ohne ihre Worte ihr unzuverlässiges Innere(s) kennt. Er disputiert mit ihnen aus der unendlichen Distanz des Himmlischen heraus, hat weder das Zeugnis des Mose noch das des Täufers für sich nötig, distanziert sich von den Juden, als wären sie nicht sein Volk, und von seiner Mutter als der, welcher ihr Herr ist. Er läßt Lazarus ungerührt vier Tage lang im Grabe liegen, damit das Wunder der Auferweckung größer wird, und geht freiwillig und als Sieger in den eigenen Tod. Wie paßt das alles zu einer realistischen Auffassung der Fleischwerdung?“
Diese Fragen sind ernstzunehmen und werden an der jeweiligen Stelle auch ernsthaft beantwortet – und, wie ich hoffe – widerlegt werden. Hartwig Thyen hält Käsemann schon hier entgegen (91), dass jedenfalls keineswegs
Jesu leibhaftige Existenz in der Umgebung des Evangeliums als bloßer Schein angesehen worden wäre. Dafür fehlt aber auch das entfernteste Indiz. Im Gegenteil! Gerade Jesu bloßes Menschsein, seine unbedeutende Herkunft aus Nazaret, ist ja der Grund dafür, daß seine jüdischen Gegner ihn wegen seines göttlichen Anspruchs der Blasphemie zeihen und verwerfen.
Im Gegensatz zu Wengst geht Thyen also durchaus davon aus, dass Jesus bereits für Johannes in paradoxer Weise genau in seiner vollkommenen Menschlichkeit auch vollkommen Gott ist. Ich zitiere einige weitere Zeilen aus Thyens Kommentar (T92f.), die mir spannend erscheinen, auch wenn ich sie nicht ganz verstehe:
Dieser nach keiner ihrer beiden Seiten hin aufhebbaren paradoxen Spannung entspricht der Evangelist durch seine narrative Textualisierung der Geschichte Jesu als des fleischgewordenen logos. Durch seinen Einsatz von Ironie und Metapher, von doppeldeutigen Wörtern und ambivalentem sprachlichem Ausdruck, durch die Beschreibung der absoluten Negativität des Todes Jesu als der selbsteigenen Tat seiner Liebe und Vollendung seiner Herrlichkeit macht er das Evangelium zur schriftgewordenen Erinnerung des Parakleten an den gerade in seinem permanenten Abschied bleibenden Gottessohn Jesus Christus… So findet die Fleischwerdung des logos ihre sachgemäße Entsprechung in der narrativen Gestalt dieses Evangeliums als eines literarischen Werkes. Sie nicht ernst zu nehmen und ihre Zeichen als bloße Hinweise auf ein jenseits des Textes Bezeichnetes und Transzendentes zu nehmen, wäre der alte Doketismus in neuer Gestalt. Als literarisches Werk ist das Evangelium dem unendlichen Prozeß seiner Interpretationen und dem Streit um sie ausgeliefert. Fundamentalisten jeder Art – einerlei, ob sie naiv zu wissen glauben, was der Text „eigentlich meint“, oder ob sie wähnen, seinen objektiven Sinn als die Intention seines Autors auf dem Weg historisch-kritischer Analyse methodisch eruieren zu können -, befinden sich allesamt auf Holzwegen. „In die ganze Wahrheit“ vermag allein der im Evangelium selbst verheißene Geist-Paraklet zu führen (16,13), sofern er für dessen Rezeption ebenso bestimmend wird, wie er es bereits für seine Produktion gewesen ist.
Je mehr ich darüber nachdenke, um so mehr verknotet sich mein Hirn. Macht Thyen hier die Fleischwerdung des Wortes praktisch zu dessen Buchwerdung?
Nachvollziehen kann ich seine Warnung, man könne ohne Weiteres wissen, was der Text „eigentlich meint“, und seine Mahnung, bei der Erkenntnis Gottes vor allem auf den Heiligen Geist oder Gottes Inspiration zu bauen – oder wie man Gottes Einfluss auf diejenigen, die auf ihn vertrauen, auch nennen mag.
Wenn ich allerdings seinen Blick auf sprachliche Mittel wie Ironie oder Ambivalenz und abstrakte Formulierungen über Jesu Tod und Herrlichkeit, Abschied und Bleiben betrachte, frage ich mich, ob er dem gerecht wird, was Johannes tatsächlich damit meinte, dass das Wort „Fleisch“ geworden ist.
Wie Wengst geht auch Ton Veerkamp <46> davon aus, dass Johannes den Satz von der Fleischwerdung des Wortes eben nicht als „Grieche“, sondern als „ein Kind Israels“ geschrieben hat. Er versteht aber, dass es für „griechisch Denkende“, zu denen wohl auch Thyen zu rechnen ist, „nahezu unmöglich“ ist, „das Vergängliche (Fleisch) und das Unvergängliche (Wort) zusammen zu denken.“ Die „großen Theologen“ der Jahrhunderte nach Johannes unternehmen diesen Versuch aber dennoch und „wagen“ schließlich
einen nach griechischer Denkart unmöglichen Satz. Das, was die beiden Pole der Gleichung vereint, gilt „unvermischt, unverwandelt, ungeteilt, ungeschieden“, wie die dogmatische Formel von Chalcedon es will. Mit diesen vier Adjektiven, die alle ein Alpha privativum (a-, deutsch un-) haben, gibt die eine Hand, was die andere wegnimmt. Mit solchen Formeln versuchte man, den – oft blutigen! – Auseinandersetzungen um die Orthodoxie den Stachel zu ziehen. Von diesen spekulativen Klimmzügen der Kirchenpolitik und ihrer mühselig ausgehandelten Orthodoxie des 5. Jh. war Johannes Lichtjahre weit entfernt.
Das Unglück der Johannesexegese besteht bis heute darin, dass man Johannes von den Konzilen in Nicäa und Chalcedon her zu lesen gewohnt ist, statt umgekehrt die Dogmatik der Überprüfung durch Johannes, durch die Schrift überhaupt, zu unterziehen.
Nicht unerwähnt lassen will ich, dass Veerkamp dennoch die Arbeit der griechisch denkenden Theologen durchaus wertschätzt. Sie hatten ja keine anderen Denkmöglichkeiten und mussten versuchen, das aus den jüdischen und messianischen Schriften Übernommene in ihrer Sprache auszudrücken:
Zur Ehrenrettung der klassischen Dogmatik muss freilich gesagt werden, dass die Theologen des 4. und 5. Jh. ihre Arbeit gut gemacht haben. Ihr Kompromiss hatte bis in die Neuzeit gehalten, und wir können von ihrer Genauigkeit und ihrer Leidenschaft unendlich viel lernen. Wir dürfen ihre Sätze aber nicht zu ewiger Wahrheit machen.
Was nun konkret Johannes 1,14a angeht, so geht Veerkamp über den Satz von Wengst noch einen Schritt hinaus (W54): „Das Wort des Gottes Israels ist ‚jüdisches Fleisch‘ geworden.“ Ihm zufolge wurde das Wort nicht
zum jüdischen Menschen überhaupt, sondern zu einem ganz bestimmten Juden, der in den konkreten politischen Auseinandersetzungen seines Volkes eine ganz bestimmte Stellung eingenommen hatte, eine Stellung, die ihn in einen tödlichen Gegensatz zu den Eliten seines Volkes und zu Rom als Besatzungsmacht brachte. Gerade bei Johannes ist der Messias als dieser konkrete Mensch leidenschaftlich Partei in diesen Auseinandersetzungen.
Ton Veerkamp weist außerdem darauf hin, dass sich Johannes „mit diesem Satz“, der er übrigens mit „Das Wort geschieht als Fleisch“ übersetzt, „gegen eine Tendenz in den messianischen Gemeinden der Griechen“ wehrt, also dort, wo man in der Nachfolge eines (wohl sogar falsch verstandenen) Paulus (2. Korinther 5,16) Jesus nicht mehr „nach dem Fleisch“ kennen wollte:
Die Geringschätzung des Fleisches führt dazu, einen Satz wie: „… Sohn, geworden aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, aufgerichtet als Sohn Gottes nach der Inspiration der Heiligung …“ (Römer 1,4) de facto zu streichen. Die Herkunft aus dem „Samen Davids“, seine Verwurzelung im Volk Israel, spielte eine immer geringere Rolle. Eine Generation später ist das Bewusstsein dafür, dass der Messias ein Kind Israels war, so weit verschwunden, dass Marcion um 150 den christlichen Gemeinden die Abschaffung der Schrift nahelegen konnte.
Um so wichtiger ist es, sich nach mehr als 19 Jahrhunderten wieder eben daran zu erinnern, dass Jesus nur von der Heiligen Schrift Israels her zu begreifen ist.
↑ Johannes 1,14b: Im Fleischgewordenen hat das Wort sein Zelt
1,14b … und wohnte unter uns.
Das Wort eskēnōsen, das Luther und auch Thyen (T63) und Wengst (T31) mit „wohnte“ übersetzen, gibt Veerkamp <47> mit „hat sein Zelt“ wieder. Einig sind sich alle drei darin (T93), dass durch das Verb skēnōmai, „zelten“, „die biblische Tradition vom ‚Zelt der Begegnung‘ (ˀohel moˁed) und vom ‚Wohnen Gottes inmitten seines Volkes‘ (… 1Kön 6,13… in Erinnerung“ gerufen wird: „Als Intertextualitäts-Signal stiftet das Verbum skēnoun zu wechselseitiger Lektüre von Prolog und Sinai-Erzählung an.“
Nach Thyen wird dadurch inhaltlich bestätigt, dass Vers 14 mit seinen Eingangsworten kai ho logos, „und das Wort“, (T94) durch eine „Fernanknüpfung“ <48> auf die Schöpfungsthematik von Vers 1 Bezug nimmt:
Denn, deutlich markiert durch zahlreiche Struktur-Analogien sowie durch die sinnfällige Wiederaufnahme des Schemas: ,sechs Tage – siebter Tag‘ (vgl. Ex 24,15-18), besteht bereits zwischen den Ereignissen am Sinai und der Schöpfungs-Erzählung von Gen 1,1-2,4 eine analoge „Fernanknüpfung“. Dadurch gelangt schon in der biblischen Tradition die Schöpfung erst in der Bundeszusage Gottes an sein Volk und in der Errichtung des Zeltheiligtums an ihr Ziel. Das hat Janowski <49> klar aufgewiesen und dahingehend präzisiert, daß es beim Sinaigeschehen zwar „nicht um die ,sehr gute‘ Schöpfungswelt von Gen 1,1-2,4a (gehe), sondern um eine Welt, die samt ihren Geschöpfen aus der Katastrophe der Flut gerettet ist …, und mit der JHWH in dem aus Ägypten befreiten Israel einen Neuanfang setzt: ,Ich will inmitten der Israeliten wohnen‘ Ex 29,45a“.
Da nach Ton Veerkamp (siehe zu Johannes 1,1a) aber bereits im 2. Vers der Bibel die Schöpfung (zumindest auch) im Rahmen einer befreiungspolitischen Theologie des Kampfes gegen eine Finsternis und ein thohu wabohu zu begreifen ist, die von menschlichen Machthabern verursacht wurden, bestätigt sich hier auch, dass Johannes keinen weisheitlichen Lobpreis einer vollkommenen Schöpfung im Sinn hat, sondern die Überwindung eines thohu wabohu, in das die sehr gute Schöpfung erneut zurückgestoßen wurde.
Auch Klaus Wengst zufolge (W56) nimmt Johannes in 1,14b „biblisch-jüdische Sprachmöglichkeiten wahr“, indem er auf das „Zeltheiligtum“ der Wüstenwanderung anspielt:
Die Formulierung vom „Wohnen unter uns“, die Konzeption von der Gegenwart Gottes in einem geschichtlichen Ereignis, die enge, fast an Identifizierung reichende Beziehung zwischen Gott und seinem Wort und die doch dabei gewahrte Differenz – das alles setzt die jüdische Vorstellung von der sch‘chináh voraus, dem Einwohnen Gottes, seiner Gegenwart bei seinem Volk und in der Welt.
Von dieser Vorstellung der Schechina her fällt nach Wengst nochmals „auch Licht auf das Verständnis der besonderen Formulierung von der Fleischwerdung des Wortes“ (W57):
Aus Liebe zu Israel steigt Gott vom Himmel herab und wohnt im Zelt der Begegnung inmitten seines Volkes, ja, drängt seine Herrlichkeit, die Himmel und Erde erfüllt, auf dem engen Platz zwischen den Keruben auf dem Deckel der Bundeslade zusammen, um von dort zu Israel zu reden.
Aber nicht nur „im Zelt der Begegnung, das für den Tempel archetypisch ist“, erfolgt „das Einwohnen Gottes“. Rabbi Akiva <50> sagt zum Beispiel: „Zu jedem Ort, zu dem die Israeliten in die Verbannung gingen, ging Gott in seiner Gegenwart (sch‘chináh) mit ihnen in die Verbannung.“
Daraus folgt für Wengst (W58): „Auch wenn es terminologisch nicht begegnet, so gibt es doch ‚Fleischwerdung des Wortes‘ in Israel von Abraham an“, denn
Gott und sein Volk Israel gehören untrennbar zusammen. Deshalb kann formuliert werden: „Jeder, der Israel hasst, ist so, als wenn er den hasst, der da sprach, und es ward die Welt“; „jeder, der Israel hilft, ist so, als wenn er dem hilft, der da sprach, und es ward die Welt“. <51> Hier kann eine Seite nicht ohne die andere gedacht werden.
Solche Texte (W58, Anm. 43) widerlegen die Behauptung von Jörg Frey, <52> „die Inkarnationsaussage von Joh 1,14 sei auch im Judentum – wie im Griechentum – ‚unvorstellbar‘“. Auch Michael Wyschogrod <53> „sagt, dass das Judentum mit der Vorstellung vom Eintreten Gottes in die Welt der Menschen ‚inkarnatorisch‘ sei und dass das Christentum ‚diese Tendenz konkretisiert‘ habe“:
Gott ist „durch ein Volk in die Welt hineingegangen, das er sich als seine Wohnstätte gewählt hat. So kam es zu einer sichtbaren Gegenwart Gottes im Universum, zuerst in der Person Abrahams und später in seinen Nachkommen, dem Volk Israel“.
Aus diesen Erkenntnissen zieht Wengst eine wesentliche Schlussfolgerung für die Auslegung von Johannes 1,14:
Was die hebräische Bibel und die jüdische Tradition von ganz Israel aussagen, wird von Johannes in einer ungeheuren Konzentration auf den einen Juden Jesus bezogen. Für uns Menschen aus den Völkern, die wir durch diesen einen Juden Zugang zum Gott Israels gefunden haben, käme es darauf an, diese Beziehung zwischen Gott und Jesus nicht exklusiv und antithetisch gegenüber der zwischen Gott und seinem Volk Israel zu verstehen, sondern die Analogie zu erkennen und also die leiblichen Geschwister Jesu als Zeugen Gottes wahrzunehmen.
Dem ist weitgehend zuzustimmen – bis auf den Punkt, dass es Johannes noch bei weitem nicht so sehr wie Paulus, Lukas oder Matthäus darauf ankam, „uns Menschen aus den Völkern … Zugang zum Gott Israels“ zu verschaffen. Nach Ton Veerkamp wird sich erweisen, dass zunächst einmal ganz Israel einschließlich der verlorenen Stämme Nordisraels (Samarien) und der Juden aus der Diaspora als eigentlicher Adressat des Johannes ernstgenommen werden muss. Dass Wengst dies anders sieht, zeigt sein Hinweis auf jüdische Weise, die trotz „der engen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk … von der ganzen Welt als dem Ort der Gegenwart Gottes … sprechen, und seine „Beobachtung…, dass die ‚Wir‘, unter denen das fleischgewordene Wort wohnte, Repräsentanten der Welt sind.“ Das hatte er zuvor (W56) folgendermaßen begründet:
Die hier in der 1. Person Plural Sprechenden sind zwar gewiss die vorher genannten Glaubenden, aber indem das „unter uns“ in Entsprechung zu „Fleisch“ steht, das den Menschen in seiner Vergänglichkeit und Hinfälligkeit bezeichnet, sind sie zugleich Repräsentanten aller Menschen. Und so gilt ja auch in 3,16 die Sendung Jesu als Erweis der Liebe Gottes zur Welt.
Die Frage ist aber, wovon bereits zu Johannes 1,10 die Rede war, ob kosmos wirklich alle Menschen der Welt meint oder ob Johannes dieses Wort nicht vielmehr als politischen Kampfbegriff für die römische Weltordnung verwendet, die in seinen Augen alles andere als eine gute Ordnung ist, sondern eine weltweite Sklaverei, die wie in einem neuen Ägypten auf der Menschenwelt lastet.
Ganz in diesem Sinne bezieht sich Johannes 1,14b nach Ton Veerkamp <54> darauf, dass der befreiende NAME unter den Bedingungen der römischen Weltordnung die Gestalt des Messias Jesus annimmt, um diese zu überwinden:
„Es hat sein Zelt bei uns“, heißt es dann vom Wort. Die Übersetzung „es hat unter uns gewohnt“ ist mehr als fade. Das Zelt ist das „Zelt der Begegnung“ aus der Wüste, wo der NAME wohnte: „Die Wolke hüllte das Zelt (ˀohel) der Begegnung ein, die Wucht/Ehre des NAMENS erfüllte die Wohnung (mischkan)“, Exodus 40,34. Die zwei hebräischen Wörter gibt die Septuaginta mit skēnē, Zelt, wieder. Das Zelt war der Ort des Daseins dessen, der mit den vier unaussprechlichen Zeichen JHWH angedeutet wird und bei uns mit dem Wort NAME wiedergegeben wird. Das Zelt ist der Ort der Gesetzgebung, der Ort, wo die Ordnung der Gesellschaft von befreiten Sklaven festgelegt wird. Auf Exodus 40,34-38 folgt das Buch Leviticus: „Er rief Mose zu, der NAME sprach mit ihm vom Zelt der Begegnung aus.“ In diesem Buch wird das Koordinatenfeld von Autonomie und Egalität ausgefüllt. Das Zelt der Begegnung ist zugleich mobil: „Als die Wolke sich hob von der Wohnung, zog Israel aus auf allen ihren Zügen“, 40,36. Aus diesem mobilen Ort wurde später der stabile Ort des Heiligtums in Jerusalem. Johannes sagt, nach der Zerstörung des Heiligtums durch die Römer habe das Zelt der Begegnung die Gestalt des fleischgewordenen Wortes, des Messias Jesus, angenommen.
↑ Johannes 1,14cd: Das Schauen der Ehre des Einziggezeugten Sohnes vom VATER
1,14c Und wir sahen seine Herrlichkeit,
1,14d eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater…
[13. März 2022] Der Sinn von Vers 14cd erschließt sich nach Klaus Wengst folgerichtig (W58f.) aus dem Wohnen des fleischgewordenen Wortes unter uns:
Diejenigen, die die Formulierung von der Fleischwerdung des Wortes wagen und von seinem Wohnen „unter uns“ sprechen, bekennen weiter: „Und wir schauten seine Herrlichkeit.“ Betrachtet man die auf Jesus bezogenen Stellen mit dóxa im Johannesevangelium, lassen sie sich dann einheitlich verstehen, wenn man voraussetzt, dass es um die Herrlichkeit Gottes geht, um Gottes „Glanz“, der in dem Geschehen aufleuchtet, in dem er präsent ist. Es geht um das „Gewicht“ – so die Grundbedeutung des entsprechenden hebräischen Wortes kavód -, das Gott hat und das dem Gewichtigkeit gibt, worin er gegenwärtig ist.
Aber was soll konkret mit dieser „Herrlichkeit“ gemeint sein? Nachdem Ton Veerkamp <55> in einer Anmerkung zu seiner Übersetzung von 2015 wie Wengst darauf hingewiesen hat, dass doxa das hebräische Wort kavod wiedergibt und wortwörtlich „Wucht“ (von kaved, „schwer sein“) bedeutet, fährt er kurz und bündig fort:
Nach Buber <56> übersetzen wir mit „Ehre“ und nicht mit „Herrlichkeit“. Das Wort ist nicht zu „ver-herr-lichen“, sondern ihm gebührt Ehre auf Grund dessen, was es für Israel tut.
Veerkamp weist also auf eine Problematik hin, die sowohl dem hebräischen Wort kavod mit seiner Betonung der gewaltigen Wucht von Gottes Durchsetzungskraft anhaftet als auch dem deutschen Wort „Herr-lichkeit“ bzw. „Ver-herr-lichung“ mit seiner Herausstellung der Übermacht eines „Herren“. Denn die „herr-liche“ Macht und Durchsetzungskraft des Gottes Israels ist ja gerade darauf gerichtet, sein Volk Israel aus jeglicher Sklaverei zu befreien und in Recht und Frieden leben zu lassen. Darin besteht die „Ehre“ dessen, der sich als der befreiende NAME offenbart hat (siehe die Bemerkungen zum NAMEN in meinen Hinweisen zum Verständnis dieser Besprechung wissenschaftlicher Kommentare). Natürlich kann auch das Wort „Ehre“ missverstanden werden, daher wird Veerkamp <57> in seiner Auslegung zu 12,28 darauf hinweisen, von woher die Ehre des NAMENS zu begreifen ist:
Die Ehre Gottes ist das lebende Israel. … Jesus betet hier: „VATER, gib deinem Namen die Ehre!“ Hier ist an Psalm 115 zu denken:
Nicht uns, DU, nicht uns, nein, Deinem Namen gib die Ehre,
deiner Solidarität wegen, deiner Treue wegen.
Warum sollen die Völker sprechen:
„Wo ist denn ihr Gott?“
Unser Gott ist im Himmel,
Alles, was seinem Gefallen entspricht, das tut Er … (Verse 1-3)
Dass mit „Herrlichkeit“ nicht einfach eine offensichtliche Herrschergewalt Jesu nach normal-menschlichen Maßstäben gemeint ist, ist auch Wengst klar. Allerdings stellt er einem solchen Missverständnis nicht das befreiende Wirken des NAMENS gegenüber, sondern den Leidensweg Jesu ans Kreuz (W59):
Beim Schauen der Herrlichkeit des fleischgewordenen Wortes ist der ganze Weg Jesu im Blick, wie er im Evangelium beschrieben wird – ein Weg, der in der äußersten Niedrigkeit am Kreuz endet. Aber weil gerade dieser Weg als Weg des Mitseins Gottes beschrieben wird, muss von „Herrlichkeit“ gesprochen werden.
Veerkamp verbindet beide Gesichtspunkte – es ist ja Jesu freiwillig übernommener Gang in die Ermordung durch die römische Weltordnung, der eben diese Weltordnung überwinden und die Ehre des NAMENS wiederherstellen wird, indem Israels Leben in der kommenden Weltzeit des Friedens anbrechen kann.
Wengst argumentiert in eine ähnliche Richtung, denn zur Fortführung der „Aussage vom Wohnen des fleischgewordenen Wortes ‚unter uns‘ … mit der vom Schauen seiner Herrlichkeit“ sieht er eine Analogie
in dem engen Zusammenhang, in dem die Gegenwart Gottes (schkhináh) und seine Herrlichkeit (kavód) in rabbinischen Texten stehen. So wird der Schluss von Ez 43,2, dass „die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit“, damit erklärt: „Das ist das Angesicht der Gegenwart Gottes (sch‘chináh).“ <58> Nach einer anderen Tradition verheißt Gott für die Zukunft: „In der kommenden Welt, wenn ich meine Gegenwart (sch‘chináh) nach Zion zurückkehren lasse, bin ich in meiner Herrlichkeit offenbar über ganz Israel und sie sehen mich und leben für immer.“ <59> Die Rückkehr der Gottesgegenwart zum Zion und ihre bleibende Anwesenheit dort lassen Gottes Herrlichkeit offenbar sein. In ihr wird er selbst gesehen und das verbürgt Leben, das nicht mehr in Frage gestellt werden kann.
Genau so versteht nach Veerkamp auch der Evangelist Johannes die Zukunftsperspektive der Herrlichkeit oder Ehre Gottes als das zukünftige Leben Israels in der kommenden Weltzeit des Friedens auf Erden, allerdings mit dem Unterschied, dass dieses Leben nach der Zerstörung des Tempels sich nicht auf dem Jerusalemer Zionsberg, sondern in der messianischen Gemeinde, dem Leib des Messias, sammeln wird.
Grundsätzlich sind die folgenden Sätze bei Wengst offen für eine solche Auslegung:
Wenn sich im Johannesevangelium solche Aussagen in Verbindung mit Jesus finden, ist Jesus verstanden als Ort endzeitlicher Gegenwart Gottes. Und wo Gott in seiner Gegenwart da ist, gibt es mitten in der Not Erfahrungen von Rettung, von Trost, von Leben.
Es kann aber auch sein, dass Wengst zufolge schon Johannes über die Analogie zur jüdischen Erwartung einer diesseitigen kommenden Weltzeit insofern hinausgeht, dass er ein jenseitiges ewiges Leben erwartet und für das diesseitige Leben zwar „Erfahrungen von Rettung, von Trost, von Leben“ im Blick hat, aber nicht eine politische Perspektive der Befreiung aus der weltweiten Sklaverei der römischen Weltordnung.
Mit Vers 14d wird jedenfalls die doxa Jesu ganz klar auf den Gott Israels bezogen:
Jesu Herrlichkeit – das ist nicht seine, des Menschen aus Nazaret, Herrlichkeit, etwa sein imponierendes Auftreten und machtvolles Reden. Mit dieser Herrlichkeit, die alle sehen konnten, war es am Kreuz vorbei, was ebenfalls alle sehen konnten. Jesu Herrlichkeit – das ist allein Gottes Herrlichkeit, die sich dem Glauben gerade und besonders am Kreuz zeigt, wo alle menschliche Herrlichkeit zu Ende ist.
Indem „die geschaute Herrlichkeit … näher bestimmt [wird] als ‚Herrlichkeit gleichsam des Einzigen vom Vater‘“, wird von Jesus – „metaphorisch“ und nicht als „Wesensaussage“ – ähnlich geredet wie „in der rabbinischen Tradition von Israel als Kindern Gottes“. Und (W60) was dort „von Israel als Kindern Gottes im Ganzen gilt, wird im Johannesevangelium von Jesus als dem einzigen Sohn gesagt.
Zum Stichwort des „einzigen Sohnes“, monogenēs, verweist Wengst an dieser Stelle auf spätere Erörterungen:
Joh 10,34-36 wird zeigen, dass die Betonung der Einzigkeit nicht im Sinne der Exklusivität verstanden werden muss. Die hier ausgesagte Einzigkeit lässt sich begreifen als Konzentration und gleichzeitige Ausweitung: Der Vater liebt den Sohn (vgl. 15,9) und in der Sendung des Sohnes die Welt (vgl. 3,16; 1. Joh 4,9; 3,2).
Obwohl er zugleich anmerkt (W60, Anm. 47), dass mit der „Bezeichnung monogenés („Einziger“) … auch die Erzählung von der Bindung Isaaks (Gen 22) eingespielt sein“ kann (und zwar als des „‚Einzige[n]‘…, an dem die Verheißung hängt“) und dazu auf Johannes 3,16 verweist, wird er auch dort nicht näher auf diese israelbezogene Verknüpfung eingehen, sondern die hier vertretene Auffassung weiter entfalten, dass durch Jesus auch die gesamte Welt Zugang zum Messias Israels erhält, womit er die Menschen aller Völker meint.
Ton Veerkamp <60> nimmt die Verbindung zu 1. Mose 22 ernster und interpretiert das Wort monogenēs im Sinne einer bewussten Konzentration des Johannes auf einen Messias Jesus, der zuerst und zentral für Israel da ist:
Johannes überträgt den theologischen Gebrauch von „einzig“ (jachid) in der Erzählung von Isaak als „einziger Sohn“ und somit als die einzige Zukunft Abrahams auf den Messias Jesus. Er ist der neue Isaak, er eröffnet die Zukunft des neuen Israels.
Auch Hartwig Thyen weiß zwar (T97), dass das Wort monogenēs in einer Beziehung zu Isaak steht, denn er zitiert Heinrich Lausberg, <61> der die Wendung hōs monogenous para patros, „der als Einziger vom Vater geboren ist“, als vorbereitende „Entsprechung des isaak-typologisch deutlicheren“ Verses 1,29 betrachtet, wo das Gotteslamm, das die Sünde der Welt trägt, erwähnt wird. Dennoch beruft er sich zur Wortbedeutung nur auf Gerard Pendrick, <62> der monogenēs „unter Berücksichtigung des gesamten auf CD-ROM gespeicherten Thesaurus Linguae Graecae“ als eine „thēlygenēs, homogenēs, heterogenēs etc.“ entsprechende Wortbildung erwiesen hat, die „darum ‚einzig in seinem genos, einzigartig‘ bedeutet, wie es die Altlateiner denn auch stets korrekt mit unicus wiedergegeben haben“. Dabei bleiben natürlich schriftgemäße Bezüge, auf die Veerkamp hinweist, auf der Strecke.
Das Stichwort der doxa, „Herrlichkeit“, hatte Thyen bereits im Gegenüber zum Begriff der sarx, des „Fleisches“, ausführlich behandelt (siehe zu Johannes 14a). Zum Schauen dieser Herrlichkeit (T96) durch Menschen, die hier erstmals in der Wir-Form von sich reden, weist er die Auffassung von Theologen wie Michael Theobald <63> ab, Johannes beziehe sich hier auf „Augenzeugen des historischen Jesus“, die seine folgende Erzählung in ihren Fakten beglaubigen könnten, da „das ‚Sehen der doxa‘ aber ja auf alle Fälle ein Sehen mit den Augen des Glaubens … ist“:
Wie schon längst vorzeitig Jesaja die doxa des auferstandenen Gekreuzigten gesehen und von ihm geredet hat (12,41), und wie bereits Abraham seinen Tag gesehen und darüber gejubelt hat (8,56), so sollen und werden auch alle zukünftigen Glaubenden Zeugen seiner verheißenen Gegenwart sein, die durchaus auch sinnlich erfahren wird.
Für den Vergleich mit der Position von Ton Veerkamp ist interessant, dass Thyen diese Ausführungen über eine Augenzeugenschaft „mit den Augen des Glaubens“ durch einen Seitenblick auf den 1. Johannesbrief unterstreicht (T96f.):
Als ein absichtsvolles Spiel mit unserem Prolog … erweist sich das Proömium {Vorwort} des 1Joh (1,1-4). Denn hier will nicht ein Anonymus durch die Fiktion seiner Augenzeugenschaft des historischen Jesus seinem Schreiben dessen Autorität verleihen… Vielmehr zeigen die auffallend neutrische Formulierung und der Perfekt-Aspekt der Verben, ho akēkoamen, ho heōrakamen tois ophthalmois {was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen}, deutlich, daß von etwas gegenwärtig vor Augen und Ohren Befindlichem die Rede ist.
Ton Veerkamp <64> ist in seiner Auslegung der ersten vier Verse des 1. Johannesbriefs zwar darin mit Thyen einig, dass es nicht um historische Augenzeugenschaft, sondern um etwas geht, das vergegenwärtigt wird. Aber die Frage, welcher „Anfang“ dort vergegenwärtigt wird, beantwortet Veerkamp anders als Thyen:
Der Anfang, den der Text meint, ist nicht der Jesus Christus des Christentums, sondern jener Anfang, von dem her Israel lebt. Dieser Anfang ist die Rede und die Tat, die Israel gehört und gesehen und erschaut und ertastet hat, und von diesem Hören und Sehen und Erschauen und Ertasten Israels her „handelt die Menschheit und lebt durch sie“ (Lev 18,5).
Ich gehe darauf ausführlich ein, weil christliche Theologen oft dazu neigen, das Glauben gegen das Sehen auszuspielen. Nach Veerkamp war Johannes aber noch kein Christ, sondern ein Jude, der sein Vertrauen auf Jesus vom den jüdischen Schriften her verstanden hat. Und im TeNaK kann man Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch sehen:
Daß man „Reden“ (debarim) hören kann, ist nicht verwunderlich; in der Sprache der Schrift, die Grundsprache des Judäers „Johannes“, kann man „Reden“ auch sehen. Die „Rede“ die man hören kann, ist die „Rede“ der Befreiung, Dtn 4,32f:
Ob etwas geschah wie diese große Rede,
oder etwas gehört wurde, wie diese: da,
ob wohl ein Volk eine Stimme „Gottes“ hörte,
redend mitten aus dem Feuer,
wie du es hörtest und bliebst am Leben …Im gleichen Text hören wir (4,9):
Jedoch hüte deine Seele, hüte sehr,
daß du vergessen würdest
die Reden, die deine Augen sahen.
Ja, in der Schrift kann man sogar das Wort „mit den Händen ertasten“ (was Thyen bezeichnenderweise in seiner Zitierung von 1. Johannes weggelassen hat):
Das Wort „ertasten“ erklärt sich aus Psalm 115. Von den Götzen heißt es:
Einen Mund haben sie: sie reden nicht,
Augen haben sie: sie sehen nicht,
Ohren haben sie: sie hören nicht,
eine Nase haben sie: sie riechen nicht,
ihre Hände: sie ertasten nicht.Wer blind ist, wie der alte Jizchak {Isaak}, muß sich behelfen mit dem „Tasten seiner Hände“. Nicht einmal das können blinde Götter. Wir aber hören und sehen, haben eine Vision, können uns das Leben ertasten in der Finsternis: denn „die Finsternis tastet man“ (Ex 10,21). Uns ist nicht einmal die Finsternis Verhängnis. Dieses Ertasten ist keine nette Umschreibung für „erahnen“: es ist leiblich, „unsere Hände“. … Die Reden sind wirklich sichtbar und die Vision ist mit den Händen zu greifen: wahrhaftiges, irdisches, „weltliches“ Leben.
So muss nach Veerkamp <65> auch in Johannes 1,14 das Schauen der Ehre „als die eines Einziggezeugten beim VATER“ verstanden werden, nämlich sehr konkret diesseitig als das erfüllte Leben Israels in der Weltzeit, die durch den Messias Jesus anbrechen soll.
Ausdrücklich weist Veerkamp darauf hin, dass in diesem Vers „zum ersten Mal das Wort VATER“ erscheint, das bei Johannes „der Platzhalter für den NAMEN“ ist, „nachdem wir zunächst das Wort Wucht/Ehre gehört haben“ (siehe meine Anm. 13). Nirgends im Johannesevangelium darf vergessen werden, dass der Vater Jesu der Gott Israels ist, dessen NAME seit 2. Mose 3,14 für die Befreiung Israels aus jeder Form von Unterdrückung und Ausbeutung steht.
↑ Johannes 1,14e: Gnade und Wahrheit oder solidarische Treue?
1,14e … voller Gnade und Wahrheit.
[14. März 2022] Vor der Besprechung der letzten vier Wörter von Johannes 1,14 – plērēs charitos kai alētheias – erinnere ich daran (T94), dass Hartwig Thyen das Wort skēnoun, „zelten“, als „Intertextualitäts-Signal“ ansah, durch das zwei Texte, „Prolog und Sinai-Erzählung“, in einen engen Zusammenhang gestellt werden (T93f.):
Hier wie da sind die zentralen Themen das „Wohnen Gottes mitten unter seinem Volk“, das „Erstrahlen seiner Offenbarungs-Herrlichkeit“ auf dem von Mose errichteten „Zelt der Begegnung“ dort, wie auf dem Angesicht des monogenēs para patros {der als Einziger vom Vater geboren ist} hier.
Allerdings weigert sich Thyen (T94), „den hier so deutlich durchschimmernden alten Text umstandslos zum lnterpretationsschlüssel des neuen zu machen, wie das häufig geschieht und sich besonders an der Übersetzung der Wendung plērēs charitos kai alētheias zeigt.“ Bereits Rudolf Bultmann <66> habe die Möglichkeit widerlegt, diese griechischen Worte als unmittelbare Übernahme „des hebräischen Textes von Ex 34,6: rav-chesed wɘˀemeth“ zu betrachten und (T95) „als die ‚subjektive Liebe und Treue Gottes‘ zu verstehen“, da die LXX diese Wendung „regelmäßig mit eleos kai alētheia“ und eben nicht mit charis kai alētheia wiedergibt, während sie charis in der Regel für das hebräische Wort chen verwendet. Unter Berufung auf Ignace de la Potterie <67> behauptet Thyen:
Die Wiederaufnahme der Wortverbindung von charis kai alētheia als Gegenüber der durch Mose vermittelten Gabe (edothē) der Tora in V. 17 zeigt deutlich, daß „Gnade und Wahrheit“ in beiden Versen als Hendiadyoin zu begreifen ist, das die objektive Gabe und nicht etwa die subjektive Gesinnung Gottes beschreibt. charis kai alētheia sind also so zu verstehen, daß alētheia durch charis als eschatologisches Gnadengeschenk definiert wird.
Sicher ist davon auszugehen, dass hier ein „Hendiadyoin“ vorliegt, also nach Wikipedia „eine Stilfigur, die einen komplexen Begriff mittels zweier nicht bedeutungsgleicher Ausdrücke beschreibt, die in der Regel durch die Konjunktion ‚und‘ verbunden werden.“ Aber es wird gar nicht so eindeutig zu erweisen sein, dass die in Vers 17 wiederaufgenommene „Wortverbindung von charis kai alētheia“ tatsächlich als „Gabe“ der von Mose gegebenen Tora gegenübersteht, denn dort wird sie wortwörtlich nicht von Jesus gegeben, sondern sie wird oder geschieht, egeneto, durch ihn.
Warum sich Thyen so vehement gegen einen Rückbezug von 14e auf 2. Mose 34,6 wendet, wird deutlich, wenn er schreibt (T98):
Schwerlich soll hier gesagt werden, die von den ‚Wir‘ wahrgenommene doxa des Fleischgewordenen als des vom Vater gesandten einzigen Sohnes sei „voller Gnade und Wahrheit“ gewesen.
Dagegen spricht nämlich in seinen Augen, dass der Nominativ des Adjektivs plērēs nicht auf das im Akkusativ stehende Wort doxan in 14c, sondern auf den logos in 14a bezogen sein muss, wodurch das Schauen der Herrlichkeit (14bc) in einer Parenthese, also Klammer, zwischen dem fleischgewordenen Wort (14a) und seiner Gnadengabe (14e) steht. Wichtiger noch ist ihm folgender Gesichtspunkt:
Trotz der gewiß absichtsvoll hergestellten Intertextualität zwischen Joh 1,14-18 und der biblischen Sinai-Erzählung darf die doxa, von der in der eben erörterten Parenthese die Rede war, jedoch nicht einfach aus dem Vortext als der blendende Lichtglanz der göttlichen Epiphanie gedeutet werden.
Seine Begründung dafür läuft darauf hinaus, dass die doxa des logos aber eben keine offensichtliche Herrlichkeit ausstrahlt, sondern darin besteht (T98f.),
daß er – obwohl selbst unerschöpfliche Quelle des Lebenswassers, das allen Durst auf ewig stillt (4,14) – am Ende, von physischem Durst gequält (19,28-30), sein Fleisch hingibt für das Leben der Welt (6,51) und darin die Liebe Gottes zum kosmos vollendet (3,16). … Daß die spezifische doxa Jesu als des geliebten Sohnes nichts anderes ist als seine mit derjenigen des Vaters koinzidierende Liebe, und daß der wahre Protagonist des vierten Evangeliums – wie im übrigen auch schon in dessen drei älteren Vorgängern – von Anfang an der auferstandene Gekreuzigte ist, muß der folgende Kommentar eingehend begründen.
Mit dieser Argumentation sieht sich Thyen ausdrücklich (T99) in einer Frontlinie gegen das bereits erwähnte von Ernst Käsemann gezeichnete „Bild der ‚Herrlichkeit Christi‘ nach Johannes“, das neben der Gottheit Jesu keinen Platz für seine Menschlichkeit lässt.
Ich finde es aber seltsam, dass Thyen im Zuge der Abwehr der Käsemannschen Gegenposition sich auch gegen die Sinai-Tradition teilweise meint abgrenzen zu müssen, als ob „der transzendente Lichtglanz der Sinai-Offenbarung“, wenn er mit Jesus in Verbindung gebracht würde, seinen von Käsemann angenommenen Status als eines über die Erde wandelnden Gottes bestätigen würde. Mir scheint, dass Thyen damit das Wesen der Herrlichkeit oder Ehre des Gottes Israels missversteht.
In seinen Augen ist die doxa doppelt bestimmt, „nämlich einerseits durch die lntertextualität zwischen Prolog und Sinai-Erzählung und andererseits durch ihre Identifikation mit der sich in der Sendung und im Weg Jesu vollendenden Liebe Gottes“. Meines Erachtens kommt diese zweite Bestimmung aber nicht erst in Jesus zur ersten hinzu, denn bereits in der Befreiung aus Ägypten und in der Verpflichtung auf die Disziplin der Freiheit am Sinai war die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel am Werk, und genau von dieser Liebe Gottes zu Israel her muss die Sendung und der Weg Jesu verstanden werden.
Auch die „Gnadengabe der Wahrheit“ sieht Thyen zwar einerseits „durch das Verhältnis zum Vortext“, also 2. Mose 34, bestimmt, aber andererseits ist sie
nichts anderes … als der fleischgewordene logos in der menschlichen Person Jesu Christi (vgl. egō eimi … hē alētheia {ich bin … die Wahrheit}: 14,6). Wie der transzendente Lichtglanz der Sinai-Offenbarung so ist jetzt auch die Fülle der göttlichen Wahrheit Fleisch und damit immanent und konkret geworden.
Hier zeigt sich deutlich, dass Thyen das christliche Vorurteil teilt, das Wengst überwunden hat, dass nämlich erst in der Person Jesu zum ersten Mal eine Fleischwerdung des göttlichen Wortes stattgefunden hat. Auch eine zweite christliche Gepflogenheit scheint er fortzusetzen, nämlich Gott als den Vater Jesu Christi von Jesus her neu zu begreifen, statt wie Johannes Jesus als den Messias ganz vom Gott Israels her zu verstehen, wie er sich in den jüdischen Schriften offenbart. Das zeigt sich deutlich, indem er betont,
daß es in jedem Falle verfehlt wäre und das Evangelium um das Singular-Eigene seines Sagens brächte, wollte man seine Lexeme alētheia, alēthēs, alēthinos ktl. irgendeinem – sei es alttestamentlich-jüdischem, sei es griechisch-hellenistischem – „Begriff“ von Wahrheit unterwerfen. Denn als abstrakte Nivellierungen konkreter Erfahrungen, sind alle „Begriffe“ Zugriffe, Angriffe und Eingriffe auf und in die Andersheit des Anderen, Versuche seiner Unterwerfung im Sinne von Nietzsches <68> ironischer Notiz, daß es stets „etwas Beleidigendes (habe), verstanden zu werden. Verstanden zu werden? Ihr wißt doch, was das heißt? – Comprendre c‘est égaler {Verstehen ist Gleichmachen}“.
Indem sich Thyen hier auf Nietzsches ironische Kritik am Verstehenwollen beruft, hätte er allerdings eigentlich im selben Moment seine Arbeit am Johanneskommentar einstellen müssen, denn was ist seine eigene Bemühung anderes als diejenige auch aller anderer Exegeten einschließlich Wengst und Veerkamp, nämlich einem Verstehen dessen, was im Johannesevangelium gesagt wird, näherzukommen? Recht hat er natürlich darin, dass geprüft werden muss, inwiefern der johanneische Wahrheitsbegriff griechisch-philosophischen oder hebräisch-jüdischen Vorbildern entspricht und in welcher Weise er ggf. darüber hinausgeht. Und Recht ist auch Nietzsche darin zu geben, dass der Anspruch totalen Verstehens als übergriffige Inbesitznahme des angeblich Verstandenen angesehen muss.
Aber schauen wir einmal, auf welchen Wahrheitsbegriff Thyen in den folgenden Ausführungen zum Sinn der Formulierung „voller Gnade und Wahrheit“ zurückgreift, wobei er davon ausgeht, dass „- wie V. 17 ausführen wird – die Gnadengabe der Wahrheit (erst) durch Jesus Christus geworden (egeneto) und in die Welt gekommen ist“ (T99f.):
Weil das Sagen des Fleischgewordenen durch seine Worte, seine Zeichen und seinen Weg diejenigen, die ihn „aufgenommen“ und seine Stimme gehört haben, als Gottes Kinder und die Welt als Gottes Schöpfung ans Licht und damit in ihre Wahrheit gebracht hat und bringt, können sie ihn mit dem Prolog als den Schöpfungsmittler preisen. Und wenn der scheidende Jesus dann im Evangelium das Kommen des Geistes der Wahrheit verheißt, und daß der die Jünger „in alle Wahrheit führen und auch das Künftige offenbaren werde“ (… 16,13), dann heißt das doch, daß die Jünger unter seinem Geleit auch alles künftige Geschehen in Natur und Geschichte im Lichte des in Christus Fleisch gewordenen logos und damit in seiner wirklichen Wahrheit und wahren Wirklichkeit wahrnehmen sollen. Bei dem anangelein der erchomena {Ankündigen der kommenden Dinge} geht es schwerlich um das Enthüllen apokalyptischer Geheimnisse, sondern um die Erschließung auch des unvorhersehbaren künftigen Weltgeschehens als Gottes Schöpferhandeln in Gericht und Gnade. Und wenn die Fülle der Wahrheit nicht in mythischen Epiphanien, sondern einzig am Fleischgewordenen zu Gesicht kommt, so sollte uns das daran erinnern, daß <69> „die Kapuzinerpredigt gegen die Eitelkeit der lmmanenz … insgeheim auch die Transzendenz (liquidiert), die einzig von den Erfahrungen der Immanenz gespeist wird“.
Wie versteht Thyen Wahrheit hier konkret? Dass diejenigen, die auf Jesus vertrauen, sich selbst als Kinder Gottes und die Welt als Gottes Schöpfung erfahren, sieht er als „ihre Wahrheit“ und die Wahrheit, in die der Geist die Jünger hineinführen wird, als „Erschließung auch des unvorhersehbaren künftigen Weltgeschehens als Gottes Schöpferhandeln in Gericht und Gnade“. Was in diesem abstrakten Blick auf eine Wahrheit für alle glaubenden Menschen und das allgemeine Weltgeschehen fehlt, ist jeglicher Bezug auf Israel und jeder konkrete Blick auf die kommende Weltzeit der Überwindung von Unfreiheit und Unrecht. Der hier vorliegende Wahrheitsbegriff verträgt sich daher voll und ganz mit der griechischen Philosophie, aber von „alttestamentlich-jüdischem“ Denken im Blick auf das, was im TeNaK mit ˀemeth, der Treue Gottes, gemeint ist und was die LXX mit alētheia überträgt, ist hier nicht einmal eine Spur zu finden. So weit sollte es ein christlicher Exeget nun wahrlich nicht treiben, um die Unterwerfung unter einen jüdischen „Begriff“ zu vermeiden.
Interessant ist der Kontext, in dem das Adorno-Zitat zu finden ist, mit dem Thyen am Schluss seiner Ausführungen wohl zeigen will, dass „Wahrheit nicht in mythischen Epiphanien“, also beweiskräftigen übernatürlichen Erscheinungen, zu haben ist, sondern nur im Blick auf den fleischgewordenen Menschen Jesus. Adornos Auffassung, dass denjenigen, die wie der Prediger Salomo (z. B. 1,2) betonen, alles sei eitel, was wir auf Erden erreichen können, auch jede konkrete Vorstellung von einem erfüllten Leben in einem transzendenten, ewigen Leben abhanden kommt, gipfelt in dem schlichten Satz: <70> „Nur wenn, was ist, sich ändern läßt, ist das, was ist, nicht alles.“ Wenn die Aussageabsicht des Johannes nach Thyen darauf hinausläuft, würde er in diesem Punkt mit der Johannesauslegung Ton Veerkamps übereinstimmen.
Im Gegensatz zu Thyen sieht Klaus Wengst (W60) die „die Wendung pléres cháritos kai aletheías“ als exakte Entsprechung der „hebräischen Wendung rav chésed ve-emét“, die er mit „Voll von Gnade und Treue“ übersetzt. Sie „ist eine mögliche genaue Übersetzung dieses Schlusses von Ex 34,6 und Ps 86,15“. Damit löst er das Problem, dass plērēs im Nominativ steht und „im unmittelbar vorangehenden Kontext kein im Nominativ stehendes Bezugswort“ hat, anders als Thyen (der es ja auf den logos bezogen hat) und auch anders als andere Exegeten, wie etwa Adolf Deissmann, <71> die in der griechischen „Vulgärsprache“ Belege für ein nicht-dekliniertes plērēs finden, das aber wie „eine Feldanemone zwischen Marmorblöcken“ eigentlich nicht in den in gehobener Sprache formulierten Prolog passt (W62):
Man muss also nicht das Vorliegen von Vulgärsprache annehmen, wenn man die Wendung „Voll von Gnade und Treue“ als genaue Entsprechung zu rav chésed ve-emét erkennt und sie als einen der Beinamen Gottes versteht. Dann ist auch ihr Bezug auf Gott klar, hier als „Vater“ bezeichnet. Und es ist weiter deutlich, dass auf diesem Hintergrund alétheia besser mit „Treue“ als mit „Wahrheit“ wiedergegeben wird. Von Gottes reicher Gnade und Treue ist die Rede, die sich in der Fleischwerdung des Wortes, im Auftreten Jesu von Nazaret, erweist. Hier sagt sich Gott gnädig zu und erweist darin seine Treue. Wenn also Johannes so an die Tradition anknüpft, an die Bibel und ihre Auslegung, ist es auch von hier aus völlig klar, dass nach ihm Jesus nicht einen bisher unbekannten Gott „offenbart“. Er will vielmehr herausstellen, dass in Jesus kein anderer als der in Israel schon als gnädig und treu bekannte Gott zum Zuge kommt.
Indem Wengst den Kontext von 2. Mose 34 in den Blick nimmt, betont er den Gesichtspunkt, den ich bei Thyen vermisst hatte (W61):
Danach ist es gerade der die Tafeln – und mit ihnen der die Tora gebende und damit den Bund schließende – Gott, der sich als barmherzig, als „voll von Gnade und Treue“ vorstellt. Gegenüber christlichen Denkgewohnheiten, für die Gesetz und Gnade antithetisch sind, manifestiert sich hier Gottes Gnade und Barmherzigkeit gerade in der Gabe der Tora.
Dass nach rabbinischen Quellen die Wendung „Voll von Gnade und Treue“ nicht nur „als Beiname Gottes“ gelten kann, sondern „Gnade und Treue“ auch als „Wohltaten“ und als „Tora“ gedeutet werden können, spricht übrigens gegen Thyens strikte Entscheidung, dass damit nur eine Gabe und nicht eine Eigenschaft Gottes bezeichnet sein kann.
Ton Veerkamp <72> geht in der Wiedergabe des von Thyen mit „Gnadengabe der Wahrheit“ umschriebenen Hendiadyoin charis kai alētheia noch einen Schritt weiter als Wengst, indem er auch die Übersetzung mit „Gnade“ in Frage stellt und die Doppelformulierung im Deutschen folgendermaßen auflöst:
… erfüllt von solidarischer Treue.
Die Ehre wird abschließend mit den Wörtern charis/chessed und alētheia/ˀemeth wiedergegeben. Chessed übersetzt Buber mit Huld und begründet das mit der Zuneigung des Herrn zu seinem Vasallen. Uns scheint Huld zu sehr von feudalen Herrschaftsvorstellungen geprägt, wie überhaupt Buber einen Hang zum neugotischen Deutsch von Leuten wie Richard Wagner hatte. Gnade ist herrschaftlich geprägt, der NAME könnte durch diese Vokabel als der Gott der Antike, als Herr, erscheinen. Das mag mit dem Bild übereinstimmen, das sich die Menschen damals vom absoluten Gegenüber ihrer Gesellschaftsordnung machten, die für sie „Wort Gottes“ war. Die Funktion „Gott“ hat in der Regel die Funktion der „Herrschaft“, aber das, was in der Schrift „Gott“ genannt wird, hat die Funktion der Freiheit. Freiheit aber herrscht nicht, ist nicht von oben herab gnädig. Das Wort charis kommt bei Johannes nur in der Vorrede zum Evangelium vor, zweimal zusammen mit alētheia, einmal allein. Da im Evangelium das Wort agapē sowohl eine Haltung Gottes zu den Menschen als auch die Haltung der Menschen untereinander angibt, ist hier ebenfalls an chessed zu denken. Offenbar hat der Verfasser der Vorrede Anlass gesehen, für die Haltung Gottes zu den Menschen das Wort charis zu nehmen. In der LXX steht es gewöhnlich für chen, Gunst („Gnade“). Es ist dort die Haltung des Höhergestellten den Untertanen gegenüber. Andererseits finden wir in der Schrift niemals den Ausdruck chen we-ˀemeth, sondern immer chessed we-ˀemeth. An diese Verbindung muss der Verfasser der Vorrede gedacht haben. Chen, Gunst, Gnade, kommt in der Zeit der Katastrophen für das judäische Volk nur als ˀemeth, Treue, in Frage und ist dann Solidarität.
↑ Johannes 1,15: Johannes als Zeuge seines „Ersten“
1,15 Johannes zeugt von ihm und ruft:
Dieser war es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist;
denn er war eher als ich.
[15. März 2022] Ein weiteres Mal (W62) tritt „Johannes der Täufer … ins Blickfeld“, der bereits „im ersten Teil des Prologs, in der Beschreibung,“ eingeführt wurde. Nach Wengst wird er dadurch im „zweiten Teil, im Bekenntnis,“ (W63) gemeinsam mit den Glaubenden zum Sprecher, der den Rest des Prologs bis Vers 18 vorträgt. Allerdings hält er es auch für möglich, „die Aussage des Johannes als Parenthese“, also Einschub, zu verstehen. Von Letzterem geht Thyen ganz klar aus, denn (T100) der Evangelist Johannes <73> „liebt … die Figur der ‚Parenthese‘… . Auf diese Weise nehmen die bekennenden ,Wir‘, zu denen ja auch der ,implizite Leser‘ gehört, den historischen Zeugen in ihre Mitte; sie scharen sich um ihn.“
Dass der zur Zeit der Abfassung des Evangeliums schon lange Verstorbene im Präsens von Jesus Zeugnis gibt, erklärt Thyen im Anschluss an Lausberg <74> als die Stilfigur der Rede eines Toten, „die von den antiken Rhetorikern eidōlopoiia“ genannt wird. Auch nach Wengst (W62) wird der Täufer „vom Evangelisten bis in seine eigene Gegenwart hinein als Zeuge für Jesus beansprucht. Er behält diese Funktion. Was er ‚laut herausrief‘, klingt bis in die Gegenwart nach.“ Das sieht er auch dadurch unterstrichen (W62, Anm. 52), „dass das zweite Verb im Perfekt steht, das im Griechischen die anhaltende Wirkung einer in der Vergangenheit liegenden Handlung anzeigt.“
Merkwürdig ist nach Wengst aber nicht nur der Rückblick des Johannes „auf die Wirksamkeit Jesu im Ganzen“, da der Täufer (W63) „schon vor Jesus von der historischen Bühne abgetreten war“, sondern
auch der zweite Teil der Einführung des eigentlichen Täuferwortes…: ‚Von dem ich sagte.‘ Johannes hat bisher im Evangelium noch gar nicht gesprochen; das geschieht hier erstmals. Und doch weist er auf etwas hin, das er schon gesagt hat.
Damit taucht im Johannesvangelium zum ersten Mal (T101) „ein intertextuelles Spiel unseres Autors mit synoptischen Texten“ auf, wie Thyen es nennt, wobei er voraussetzt, dass er und seine implizierten Leser alle drei synoptischen Evangelien kannten, während Wengst eine allgemeinere Kenntnis synoptischer Tradition annimmt (W63):
Der Evangelist setzt Lesende und Hörende voraus, die schon wissen, worauf hier hingewiesen wird. Seine Gemeinde kennt das Täuferwort aus ihrer Tradition, wie es dann ja auch in V. 27 zitiert wird, das Wort von dem nach ihm Kommenden, dessen Schuhriemen aufzubinden, der Täufer nicht wert ist.
Inhaltlich wird allerdings Wengst zufolge das in den Synoptikern enthaltene Täuferwort, wo Jesus „als ‚der Stärkere‘ gilt (Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16)“, insofern „charakteristisch abgewandelt“, als sich hier bei Johannes „nur Kategorien der Zeit“ finden: „Der nach mir kommt, wurde mir voraus, denn er war eher als ich.“ Dem „Argument der Täufergemeinde“, dass der Täufer „vor Jesus da war“ und „Jesus getauft hatte“, setzt der Evangelist den „Superlativ prótos“ entgegen:
Obwohl in der Zeit nach Johannes aufgetreten, ist Jesus ihm voraus, weil in ihm das Wort vom Anfang zur Sprache kommt, in dem Gott die Fülle seiner Gnade und Treue zuspricht, die ihm schon immer zu eigen war. Insofern also das schöpferische Sprechen Gottes am Anfang in der Geschichte Jesu neuschöpferisch Ereignis wurde, war Jesus Johannes „voraus“, „ist“ Jesus, „bevor Abraham war“ (8,58).
Auf diese Weise vermeidet es Wengst, in meinen Augen vollkommen zu Recht, von einer ausdrücklichen Präexistenz Jesu zu sprechen. Genau diese sieht wiederum Thyen (T103) durch Johannes des Täufer in betonter Weise bezeugt. Während er sich nicht spekulativ „mit dem historischen Täufer und seiner vermeintlich mit einer johanneischen Gemeinde konkurrierenden Anhängerschaft“ befassen will, ist für ihn (T102) als „der eigens dazu ‚von Gott gesandte Mann‘ (1,6) … Johannes Zeuge des Fleischgewordenen und bezeugt mit dem gesamten Prolog und ihm voraus die Präexistenz Jesu.“ Es wird weiter zu prüfen sein, worauf das für ihn konkret hinausläuft.
Sowohl Wengst als auch Thyen übersetzen die griechische Wendung prōtos mou wie auch alle anderen gängigen Übersetzungen mit „eher als ich“. Ton Veerkamp <75> macht darauf aufmerksam, dass prōtos als Ordinalzahl eigentlich „der Erste“ heißt und auf das hebräische Wort reschith, „Anfang“ anspielt: „Man soll deswegen übersetzen: ‚Mein Erster ist er‘; man könnte auch übersetzen: ‚Mein Anfang ist er!‘“
Die Formulierung „Mein Erster“ kann auch nach Veerkamp gegen jene Teile der Anhängerschaft des Täufers gerichtet sein, für die dieser auch nach dem Auftreten Jesu „der ‚Erste‘, prōtos, blieb“:
Den Mitgliedern der Gruppe der Täuferschüler wird gesagt, der Messias Jesus sei Hintergrund und Zukunft des Täufers. Das ist eine systematische Frage. Mit der modernen Diskussion, ob Jesus historisch der Täuferbewegung entstamme, hat sie nichts zu tun. Nach Ansicht der Vorrede hängt die ganze politische Tätigkeit der Bewegung um Johannes in der Luft, wenn sie sich nicht als eine Bewegung auf den Messias Jesus hin begreift. Dass das Johannesevangelium wiederholt – sehr deutlich im Passus 3,25-30 – auf diese Problematik zurückkommt, zeigt, dass es Widerstände gegen diese Einsicht gab.
Die Formulierung „Mein Anfang ist er!“ kommt auf der anderen Seite der oben angeführten Erläuterung von Wengst (W63) über das „Wort vom Anfang“ nahe, das „in der Geschichte Jesu neuschöpferisch Ereignis“ wird und dessen Proklamation die Lebensaufgabe Johannes des Zeugen ist.
↑ Johannes 1,16-17: Ersetzt die Gnade durch Jesus Christus die Tora des Mose?
1,16 Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
1,17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben;
die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
[16. März 2022] Bei den nun folgenden Versen 16 und 17 wird es kompliziert. Thyen und Wengst stellen nämlich ihre jeweilige Übersetzung des Ausdrucks charin anti charitos gegeneinander, begründen sie aber mit ziemlich denselben Argumenten und scheinen beide auf etwas Ähnliches hinaus zu wollen. Mein Eindruck ist, dass das Problem in diesem Fall auf der nicht immer eindeutig bestimmbaren Bedeutung deutscher Präpositionen beruht.
Fangen wir an mit Hartwig Thyen. Er übersetzt (T63):
1,16 Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, /
Gnade anstelle von Gnade. /
1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, /
und die Gnadengabe der Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. /
Dabei (T103) bezieht er das den Vers 16 einleitende Wort hoti, „denn“, über Vers 15 hinweg, den er ja als Einschub beurteilt, zurück auf Vers 14, in dem das Wort plērōma, „Fülle“, an plērēs, „voll“, anknüpft und aus dem auch das Subjekt hēmeis, „wir“, übernommen wurde (T103f.):
Die in V. 14 redenden und durch V. 15 nun um Jesu ersten und gottgesandten Zeugen Johannes gescharten „Wir“ bekennen, daß der Fleischgewordene „voller Gnade und Wahrheit“ ist, weil sie aus seiner Fülle alle anstelle der alten neue Gnade empfangen haben. Dabei ist – wie V. 17 begründet (hoti) – die vorige Gnadengabe das durch die Vermittlung des Mose von Gott gegebene (edothē) „Gesetz“, die neue Gnadengabe aber die durch Jesus Christus fleischgewordene (egeneto wie in V. 14…) Wahrheit. Das Prädikat elabomen zeigt an, daß charis als sein Objekt hier nur Gottes Gabe bezeichnen kann…
Gegen die weitverbreitete und auch von Wengst vertretene Übersetzung von charin anti charitos mit „Gnade über Gnade“ wendet Thyen (T103) unter Berufung auf Ruth Edwards <76> ein, dass sich „sich die klassische Bedeutung von anti (gegen) nur in den Komposita von Verben erhalten hat, während die Präposition immer und ausschließlich im Sinn von anstelle gebraucht wird“.
Aber enthält die deutsche Präposition „über“ tatsächlich unzweideutig die Bedeutung einer Entgegensetzung? Klaus Wengst argumentiert genau umgekehrt gegen die Verwendung der Präposition „anstelle“ (W64, Anm. 57), wobei er sich auf folgendes Zitat von Dorit Felsch <77> bezieht:
„Die Gläubigen haben aus Jesu Fülle Gnade anstelle von Gnade empfangen, nämlich die des Werdens von ,Gnade und Wahrheit‘ anstelle der (ebenfalls gnädigen!) Gabe der ,Tora‘“. Aber die Gabe der Tora ist für sie doch nicht durch die andere Gnade ersetzt worden. Johannes beruft sich auf sie, besonders nachdrücklich in 10,34f. Daher gewinnt antí hier die auch belegte Bedeutung „für“ und ist der Sache nach gemeint: „Gnade über Gnade“.
Dementsprechend lautet die Übersetzung von Wengst (W31):
1,16 Denn aus seiner Fülle nahmen wir alle,
ja: Gnade über Gnade.
1,17 Denn die Tora wurde durch Mose gegeben,
die Gnade und Treue kam durch Jesus, den Gesalbten.
Daraus ergibt sich die seltsame Pointe, dass sowohl Thyen als auch Wengst ihre jeweilige Übersetzung einem antijüdischem Vorurteil entgegensetzen. Bei Thyen liest sich das so (T104):
Übersetzt man – wie hier vorgeschlagen – charin anti charitos mit „Gnadengabe anstelle von Gnadengabe“, so erscheint bei Johannes das „Gesetz“ gut jüdisch als göttliche Gnadengabe. Das aber steht im Gegensatz zu der seit den Tagen Augustins die westliche Theologie beherrschenden Antithese von Gesetz und Gnade: ou gar este hypo nomon alla hypo charin {ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade} (Röm 6,14). Und daher rührt das genannte „dogmatische Vorurteil“, das zahlreiche Exegeten nach dem philologischen Strohhalm von „Gnade über Gnade“ greifen und sie ausgerechnet in Joh 1,17 die vertraute paulinische Antithese wiederfinden läßt.
Wengst wiederum wendet sich (W64, Anm. 58) ausführlich dagegen, dass die „beiden Aussagen“ in Vers 17 „antithetisch interpretiert“ werden. Dabei zitiert er als „modernes Beispiel“ den Exegeten Hans Weder, <78>
der von Joh 1,17 „als Schlüssel zur Sache des Evangeliums“ ausgeht. Obwohl er bemerkt, dass der Evangelist „ohne jedes philologisch faßbare Signal einer Antithese“ formuliert, interpretiert er antithetisch: „Auf der einen Seite steht das Gesetz, das Mose dem Volk Israel gab. Das Gesetz ist von Mose unterscheidbar; er gibt es. Die Gnade und die Wahrheit sind demgegenüber nicht vom Christus unterscheidbar: sie sind durch ihn entstanden. Sie sind nicht etwa seine Gabe, sondern er selbst stellt Gnade und Wahrheit dar“. Das wird im Folgenden weiter ausgeführt und mündet schließlich in der Konstatierung eines „qualitativen Sprungs vom Gesetz zur Christologie“. Dass Weder in einem Kontext, in dem er die „Rezeption“ betont, das Wort „geben“ negativ konnotieren muss, zeigt die Seltsamkeit seines Unterfangens.
Wengst selbst stellt fest, dass gerade im Blick auf das Geben in Vers 17 beide „Vershälften ganz parallel formuliert“ sind (W64f.):
Am Beginn steht das jeweilige Subjekt: die Tora sowie Gnade und Treue. Es folgt die Angabe des jeweiligen Mittlers: Mose und Jesus. Den Schluss bildet das jeweilige Prädikat in einer grammatisch passiven Form, die auf Gott als logisches Subjekt weist. Er ist der Geber der Tora durch die Vermittlung des Mose. Und er ist es auch, der durch Jesus in seiner Gnade und Treue gekommen ist. Gott ist freundlich Gebender durch Mose und durch Jesus. Das Bekenntnis von V. 16, überreich Gnade empfangen zu haben, wird also doppelt begründet: zunächst durch die Gabe der durch Mose vermittelten Tora und dann durch die Präsenz des gnädigen und treuen Gottes in Jesus, dem Gesalbten.
Im Blick auf die Tora fügt Wengst noch hinzu (Anm. 59), dass nach einer rabbinischen Quelle <79>
Gott mit der Gabe der Tora auch sich selbst gibt: „Du hast einen Kauf, bei dem der, der verkauft, mit seiner Ware verkauft wird. Der Heilige, gesegnet er, hat zu Israel gesagt: Ich habe euch meine Tora verkauft. Ich bin gleichsam mit ihr verkauft worden.“
Damit wird deutlich, dass die Tora zwar von Mose unterscheidbar ist, aber von Gott nur in einer Weise, die der Unterscheidung des Messias von Gott entspricht.
Interessant finde ich übrigens, dass Thyen ja sogar im Blick auf Jesus seit seiner Auslegung von Vers 14e darauf besteht, dass charis kai alētheia als seine Fülle in Form einer gnädigen Gabe der Wahrheit zu begreifen ist und nicht als die Fülle der solidarischen Treue Gottes, die durch den Messias Jesus als Gabe und wirkendes Geschehen zugleich zum Ausdruck kommt.
Damit ist auch – jenseits der unterschiedlichen Wiedergabe der Präposition anti – der entscheidende Unterschied in der Auslegung von Johannes 1,16-17 zwischen Thyen und Wengst benannt. Wengst zufolge (W64) wird mit dem „Wort ‚Fülle‘“ in Vers 16
an die am Ende von V. 14 genannte Bezeichnung Gottes angeknüpft: „Voll von Gnade und Treue“. Gott, der diesen Beinamen zu Recht hat, teilt sich genau als so Benannter mit, indem er in Jesus auf den Plan tritt. Das Wort „Fülle“ zeigt an, dass davon, worauf es sich bezieht, genug und mehr als genug, in überreichem Maße vorhanden ist: „Gnade“, Gottes Gunst, seine überströmende Freundlichkeit. Den Aspekt unerschöpflicher Fülle unterstreicht auch die Verdoppelung des Wortes „Gnade“.
Dazu merkt Wengst an (Anm. 57): Diese „Verdoppelung könnte auch beeinflusst sein von dem ersten Begriffspaar in Ex 34,6: ‚gnädig und barmherzig‘.“
Thyen dagegen versteht (T105) die Worte „seine Fülle“,
plērōma autou, „durch den Kontext doch unzweideutig als die „Fülle“ des Fleischgewordenen, des in V. 17 Mose gegenüberstehenden Mannes Jesus Christus… Das aber müßte – genau genommen – ja heißen, daß auch die Gnadengabe der Tora vom Sinai der Fülle Jesu Christi entstammt. Nun, daß das tatsächlich die Meinung unseres impliziten Autors zu sein scheint, der seinen Protagonisten ja u. a. sagen läßt: „Wer mich sieht, der sieht den Vater“ (14,9), „Ich und der Vater sind eines“ (10,30) und prin Abraam genesthai egō eimi {Ehe Abraham wurde, bin ich} (8,58), das wird nicht nur die Exegese der genannten Passagen des corpus narrativum {der Erzählung} zu zeigen haben, sondern das dürfte schon bei der nun folgenden Auslegung von V. 18 … zum Vorschein kommen.
Damit läuft Thyen Gefahr, wie bereits in der Auslegung zu Johannes 1,14e gesagt, Gott als den Vater Jesu Christi ganz neu von Jesus her auszulegen, während Wengst ausdrücklich daran festhält, Jesus als den Messias, christos, den „Gesalbten“, ganz vom Gott Israels her zu begreifen.
[17. März 2022] Ton Veerkamp teilt diese Herangehensweise von Wengst, nimmt zugleich aber den Konflikt der johanneischen Gruppe mit dem rabbinischen Judentum sehr ernst, der sich in seinem Augen in den Versen 16 und 17 widerspiegelt. Wie schon in Vers 14 begreift er charis als die unverbrüchliche Solidarität Gottes mit seinem Volk Israel, die durch das Wort „Gnade“ einen falschen Zungenschlag von oben herab erhalten würde; anti übersetzt er mit „für“ im Sinne von „statt“, und das hoti am Anfang von Vers 17 liest er als zwei Wörter, ho ti, die er mit „was“ (statt „denn“) wiedergibt: <80>
1,16 Aus seiner Fülle nehmen wir alle,
ja, Solidarität für Solidarität.
1,17 Was als die Tora durch Mose gegeben wurde,
das geschah als die Solidarität und die Treue
durch Jesus Messias.
Damit geht Veerkamp <81> durchaus davon aus, dass die „Solidarität mit Israel … ersetzt [wird] (anti), und zwar durch eine neue Gestalt der Solidarität.“ Während für das rabbinische Judentum Mose allein „ihr Lehrer ist, Mosche rabbenu“, wie die Pharisäer in Johannes 9,28 erklären: „Wir sind die Schüler des Mose“, geschieht heute die bleibende solidarische Treue „des Gottes Israels durch den Messias Jesus“.
Ist damit aber die Tora des Mose überholt? Sie beschreibt doch
die Ordnungen, in denen das Volk Israel leben will. Diese Ordnungen sind heilsam, sie ermöglichen ein menschliches Leben in Israel.
Diese Gesellschaftsordnung von Autonomie und Egalität ist/war die Solidarität Gottes. Ist sagt das rabbinische Judentum. War, sagt Johannes. Denn die Umstände – und wahrlich die weltweiten, globalen Umstände – haben sich so geändert, dass die Gesellschaftsordnung der Tora politisch nirgendwo mehr durchführbar ist. Die Tora ist jetzt das mandatum novum {das neue Gebot}, die Solidarität, die agapē der Schüler des Messias untereinander.
Nach Veerkamp redet Johannes zwar „sehr distanziert von der Tora (‚eure Tora‘ 8,17; 10,34; ‚ihre Tora‘ 15,25). Gleichzeitig aber bleibt die Tora (oder die Schrift) für Johannes davar, logos, Rede, die erfüllt werden muss. Erfüllen bedeutet für Johannes nicht erledigen (vgl. 19,24.28).“ Dass er „nicht von einer neuen Tora (nomos kainos)“ redet, „sondern von einem neuen Gebot (entolē kainē)“, deutet darauf hin, dass man die solidarische Treue des Messias nicht gegen die Tora ausspielen kann.
Ganz ähnlich hat Veerkamp zufolge auch Paulus <82> daran festgehalten, dass Gott in seiner Treue mit Israel solidarisch bleibt, auch „wenn die Tora unter den tatsächlichen Umständen keine konkrete Lebensmöglichkeit mehr“ und die Tora „durch die qualitativ neuen Verhältnisse sozusagen ‚ausgesetzt‘ (oder einstweilen ‚geledigt‘) ist.“
Einen interessanten Seitenblick wirft Veerkamp zu diesen Fragen auf den 1. Johannesbrief, in dem die Frage gestellt wird:
Ist das „Neue“ die ersatzlose Streichung des „Alten“, Jesus die ersatzlose Streichung des Mose? Der Ausdruck: Solidarität für Solidarität legt diese Schlussfolgerung nahe, erst recht der Satz: „Was nun als die Tora durch Mose gegeben wurde, das geschieht als solidarische Treue durch Jesus Messias.“ 1 Johannes 2,7f. lautet:
Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot,
sondern ein Gebot von alters her, das ihr von Anfang an hattet.
Das Gebot von alters her ist das Wort, das ihr gehört habt.
Wiederum schreibe ich ein neues Gebot.
Was vertrauenswürdig ist bei ihm, ist es auch bei euch:
dass die Finsternis vorbeigeht
und das wirkliche Licht bereits scheint.Der Verfasser des ersten Johannesbriefes sieht keinen Ersatz des „Gebots von alters her“ (Mose) durch das neue Gebot. „Das Gebot von alters her“ (entolē palaia) ist das gehörte Wort. Er vermeidet das Wort anti („statt, für“) der Vorrede. In der messianischen Gruppe um Johannes ist das Verhältnis zum rabbinischen Judentum noch lange im Fluss geblieben. Neu ist für ihn die neue Situation, die durch den Messias bereits in der alten Ordnung der Finsternis leuchtet. Kein Ersatz der Tora durch das mandatum novum. Die Diskussion in der Gruppe um Johannes ging offenbar auch um die Frage, ob man das „Alte“ überhaupt noch braucht. Überall suchten die messianischen Gemeinden ihr Verhältnis zum rabbinischen Judentum zu klären. Johannes 1,16f. reflektiert diese Debatte.
Auf diese Weise stellt Ton Veerkamp die Frage nach der Geltung der Tora gemäß Johannes 1,17 in den Rahmen einer nachvollziehbaren Konfliktlage, innerhalb der sich die johanneische Gruppe am Ende des 1. Jahrhunderts befand.
↑ Johannes 1,18: Der Einziggezeugte, Gottbestimmte, als Exeget des Gottes Israels
1,18 Niemand hat Gott je gesehen;
der Eingeborene, der Gott ist
und in des Vaters Schoß ist,
der hat es verkündigt.
[18. März 2022] Zu Johannes 1,18 begründet Hartwig Thyen (T105) zunächst ausführlich, warum er die Textüberlieferung monogenēs theos, die er (T63) mit „Der einziggeborene Gott“ übersetzt, gegenüber anderen Varianten wie „eingeborener Sohn“ für ursprünglich hält, nämlich unter anderem (T106) „schon allein aufgrund des Gewichtes ihrer Textzeugen“, aber auch, weil „gewiß nicht zufällig das kai theos ēn ho logos {und Gott war der Logos} aus V. 1 … wieder aufgenommen“ wird.
Formal bestimmt Thyen Vers 18 „als das ‚Epiphonem‘ des Prologs“, das Heinrich Lausberg <83> als „eine ein Textstück formal ebenso „markant“ abschließende wie dessen inhaltliche ,Bedeutsamkeit‘ ins ,Allgemeine‘ weitende ,Sentenz‘“ definiert. Dieser kunstvoll gestaltete gedankliche Anhang enthält mit dem letzten Wort exēgēsato, wörtlich: „der hat ausgelegt“, ein Verb, das in der Regel nicht auf ein personales Objekt wie theon, „Gott“, bezogen wird. Aber weil es „in größtmöglicher Entfernung“ von dem ganz am Anfang stehenden Wort „Gott“ steht, erhält es die außergewöhnliche Lizenz, in abgekürzter Form sinngemäß etwas zu sagen, was ausführlicher in Johannes 8,38 oder 6,46 steht: Jener hat (gesehen und was er gesehen hat) ausgelegt.
Thyen folgt außerdem Lausbergs Annahme, dass Johannes 1,18 bewusst mit dem Vers Sirach 43,31 spielt, indem er „die Antwort auf die beiden rhetorischen Fragen“ gibt:
Wer hat ihn gesehen, dass er von ihm erzählen könnte?
Wer kann ihn so hoch preisen, wie er ist?
Wenn Johannes aber so präzise auf eine ganz bestimmte „kunstvoll formulierte Sentenz innerhalb eines literarischen Werkes“ anspielt, muss er auch bei seinen Lesern die Kenntnis dieses Werkes voraussetzen. Daraus zieht Thyen wiederum den Schluss (T107), dass auch „das Kapitel 24“ des Sirachbuches „nicht als eine lediglich Joh 1,1-18 verwandte Tradition über die sophia {Weisheit}, sondern als literarischer ‚Bezugstext‘ des Prologs begriffen sein will.“
Inhaltlich ergeben sich für Thyen (wieder unter Berufung auf Lausberg) daraus zwei Aussagen, nämlich erstens,
daß durch Joh 1,18 „eine die Unmöglichkeit feststellende rhetorische Frage … durch einen Bericht über die Realisierung des sprichwörtlich Unmöglichen beantwortet wird“,
und zweitens,
daß der „poetisch an ein personifiziertes Abstraktum {die Weisheit} gerichtete Imperativ“: en Iakōb kataskēnōson {in Jakob sollst du wohnen} (Sir 24,8), durch die Wendung: kai eskēnōsen en hemin {und wohnte unter uns} (Joh 1,14) „als von einer konkreten historischen Person bereits vollzogen hingestellt wird“.
Der ersteren Aussage, dass Jesus Gott sehen konnte, wird Thyen zufolge durch die Wendung ho ōn eis ton kolpon tou patros, „der im Schoß des Vaters ist“, eigentlich nichts Wesentliches hinzugefügt: Dieses „Sein des monogenēs an der Brust oder im Schoße des Vaters … befähigt [ihn], den Menschen Gott zu offenbaren“.
Klaus Wengst geht ganz anders an Johannes 1,18 heran. Zunächst einmal (W66) nimmt er ernst, dass der „einleitende Satz, dass ‚noch niemals jemand Gott sah‘, … eine Feststellung [ist], die in biblischer Tradition allgemein Gültigkeit hat.“ Zwar wurde Mose „ein Sehen Gottes ‚von hinten‘ ermöglicht“, und in 5. Mose 34,10
heißt es im Rückblick auf Mose sogar: „Und nicht mehr stand in Israel ein Prophet wie Mose auf, den der Ewige erkannte von Angesicht zu Angesicht.“ Aber das hebt die Gültigkeit der Aussage nicht auf, dass Gott nicht gesehen wird. Auf diesem Hintergrund tritt vielmehr die Besonderheit der Beziehung des Mose zu Gott umso stärker hervor. Nicht anders verhält es sich in Joh 1,18, wo auf demselben Hintergrund dieses allgemein anerkannten Satzes nun die Besonderheit der Gottesbeziehung Jesu herausgestellt wird.
Dies tut Johannes nach Wengst auf drei verschiedene Weisen. Indem Johannes „aus V. 14 die Bezeichnung ‚Einziger‘ wiederholt“, kennzeichnet er „die Beziehung von Gott und Jesus als die von Vater und Sohn“, aber dieser Sohn ist er, indem er Israel als den einzigen Sohn Gottes verkörpert (W67): „Wieder ist also auf Jesus konzentriert, was von Israel im Ganzen gilt.“ <84>
Sodann nimmt er aus V. 1 die Bezeichnung „gottgleich“ auf. Was dort vom „Wort“ galt, wird nun von Jesus gesagt. Aber diese Aussage kann nur deshalb von ihm gemacht werden, weil sie in V. 1 vom „Wort“ gemacht wurde und weil in V. 14 von der Fleischwerdung des Wortes gesprochen ist. Auch hier geht es nicht um Mythisierung, nicht um Vergöttlichung eines Menschen, sondern darum, dass in diesem Menschen wirklich Gott zu Wort kommt.
Und schließlich sieht Wengst die „Ortsbestimmung Jesu ‚am Busen‘ oder ‚im Schoß des Vaters‘“ in ihrer Zielrichtung treffend durch Johannes Calvin <85> auf den Punkt gebracht, „damit wir wissen, im Evangelium haben wir gleichsam das Herz Gottes offen vor uns.“ Aus all dem ergibt sich für Wengst folgendes Fazit seiner Auslegung des Johannes-Prologs (W67f.):
Von dem so dreifach in seiner Besonderheit Charakterisierten heißt es nun am Schluss des Prologs: „der hat ausgelegt“. Durch die geradezu intime Beziehung zu Gott ist Jesus als dessen Ausleger legitimiert. „Das Wort“, am Anfang und in der Mitte des Prologs genannt, wird nun an dessen Ende verbalisiert: „Der hat ausgelegt.“ In der anschließend im Evangelium erzählten Geschichte kommt Gott zu Wort. Jesus, wie er dort dargestellt wird, ist Auslegung Gottes – des Gottes Israels; und nicht ist er „Offenbarer“ eines bislang unbekannten Gottes oder bringt er „Kunde“ von einem bisher mehr oder weniger verborgen gebliebenen Gott. Dass er den in Israel bekannten Gott auslegt, ist schon durch den ersten Satz des Prologs mit seiner Anspielung auf Gen 1,1 deutlich.
Damit lehnt Wengst – anders als das bei Thyen der Fall zu sein scheint – auch die Vorstellung ab, die Auslegung Gottes durch den Messias mit einem physischen Sehen Gottes zu verbinden (W68, Anm. 67):
Dass Jesus „auf eine einzigartige Weise Kunde von Gott, den doch kein Mensch sehen kann“, bringe, weil „in der Person des fleischgewordenen Logos […] diesem unsichtbaren Gott auch visuell begegnet werden“ könne, <86> trifft schlicht nicht zu. In der jüdischen Bibel wie im Neuen Testament kann Gott nicht anders wahrgenommen werden als durch Lesen und Hören einer erzählten Geschichte.
Für Ton Veerkamp <87> fasst der erste Teil von Vers 18, den er mit „Niemand hat je GOTT gesehen, niemals“, übersetzt, „das Grundanliegen der Schrift zusammen.“ Selbst Mose wird nicht erlaubt, „das Gesicht Gottes“ zu sehen: „Nur ‚von hinten‘ kann Mose sehen, nämlich das, was hinterher geschehen ist: das, was geschah, zeigt sich als wirkliche Befreiung“, nämlich der NAME, der sich nach 2. Mose 34,6 als „Gottheit barmherzig, Gunst erweisend, langmütig, reich an solidarischer Treue (rav chessed we-ˀemeth)“ offenbart.
Diese schriftgemäße Vorstellung vom Sehen Gottes versucht Veerkamp mit Hilfe moderner Parallelen in ihrer politischen Bedeutsamkeit zu begreifen:
Übersetzen wir „Gott sehen“ in die politische Prosa des 21. Jh. Wenn „Gott“ der tiefste Konvergenzpunkt aller gesellschaftlichen Loyalitäten ist, die dichteste Zusammenballung dessen, was es an Ordnung in einer Gesellschaftsordnung gibt, dann bedeutet „Gott sehen“: die Hand auf die Gesellschaftsordnung der befreiten Sklaven selbst legen, die eigenen Vorstellungen über die Gesellschaftsordnung selber stülpen. Wenn das der König, der Staat, tut, meldet er einen absoluten Anspruch an, macht die Menschen zu Sklaven: „Götze mir ins Angesicht“, Exodus 20,3. „Niemand hat je Gott gesehen“ ist keine empirische Feststellung, sondern eine Feststellung, dass das Gegenteil nichts als eine Lüge wäre. Der Satz bedeutet: Gotteserfahrung ist etwas zutiefst Illegitimes. Wer diese Gottunmittelbarkeit politisch umsetzt, erhebt den Anspruch, die innerste Ordnung der Gesellschaft persönlich und absolut zu verkörpern. Das haben Kommunisten „Personenkult“ genannt, und das ist eine korrekte Beschreibung dessen, was unter Stalin mit der kommunistischen Partei und mit den Menschen der Sowjetunion geschehen ist.
Auch der Messias hat „Gott“ nicht gesehen. Niemand hat gesehen. Der Messias hat das, was hier mit der Vokabel „Gott“ ausgesagt werden soll, nicht gesehen, sondern „erklärt“, exēgēsato. Der Messias ist kein Visionär, er ist Exeget, er erklärt die Schriften: Schriften, die, nach seiner Meinung, die Schüler nie verstanden hatten. Und er lebt das, was die Schriften von Israel wollen, vor. Wir schreiben für exēgēsato nun „ausgeführt“, weil die „Erklärung“ durch den Messias sein Lebenswandel (halakha) ist, ein Lebenswandel, der ihn in einen letztendlich unversöhnlichen Gegensatz zu den Eliten seines Volkes und der römischen Besatzungsmacht führte.
Wieder einmal mag man meinen, Veerkamp würde hier anachronistisch gegenwärtige Problemlagen in die Antike zurückprojizieren. Und wieder gebe ich zu bedenken, dass jedenfalls die jüdischen Schriften vor allem in der Tora und in den Propheten nicht ohne ihre Zielrichtung auf politische Befreiung ausgelegt werden dürfen – und auf genau diese Schriften bezieht sich Johannes. Ihr Exeget ist der Messias, sie legt er aus in seinem gesamten Wirken und in seinem bewussten Gang in die Ermordnung durch die römische Weltordnung mit dem Ziel ihrer Überwindung, um das Leben der kommenden Weltzeit des Friedens für Israel inmitten der Völker anbrechen zu lassen.
Könnte es nicht auch anachronistisch sein, Johannes von apolitisch verstandener Weisheit, jenseitsorientierten Erlösungsvorstellungen oder gar einer weltflüchtigen Gnosis her zu begreifen? Solche Interpretationsmöglichkeiten werden bereits ab dem 2. Jahrhundert bis heute auf das Johannesevangelium angewendet, aber es ist die Frage, ob nicht Johannes selbst noch viel jüdischer in einem befreiungstheologischen, politischen Sinne gedacht hat.
Exegetisch könnte man gegen Veerkamp einwenden, dass Johannes in 6,46; 8,38; 14,9 später doch davon spricht, dass Jesus den VATER gesehen habe. Im einzelnen wird darauf an den entsprechenden Stellen einzugehen sein. Von Johannes 1,18 her spricht viel dafür, dieses Sehen Gottes von vornherein im Sinne des gesamten Wirkens einschließlich des Abschieds des Messias Jesus zu begreifen, durch das er den befreienden NAMEN des Gottes Israels von den jüdischen Schriften her auslegt.
Wie begreift Ton Veerkamp das „Subjekt des zweiten Teiles des Schlusssatzes“, monogenēs theos? Er übersetzt ähnlich wie Wengst mit „Einziggeborener, Göttlicher“ oder „Einziggezeugter, Gottgemäßer“, und vermeidet die unmittelbare Identifizierung Jesu mit Gott. Aber auch er wendet sich gegen die Ersetzung der
Vokabel Gott durch die Vokabel Sohn. Letzteres passt sehr gut zur Orthodoxie des 4. und 5. Jh. Der Gedanke lautet dann: „Niemand hat je Gott gesehen, der einziggezeugte Sohn, der am Busen des VATERS (orthodox: der mit Gott wesensgleiche, homoousios, Sohn) hat …“ Man benutzte eine Orthodoxie, die zwei bis drei Jahrhunderte nach der Abfassung unseres Textes versucht, das Problem, das der Text uns aufgibt, zu lösen. Das ist kein wissenschaftlich zu verantwortendes Verfahren.
Hier sei angemerkt, dass auch Thyen das Bestreben für berechtigt ansieht (T108), „das Johannesevangelium nicht wie nahezu alle modernen Kommentatoren im Licht von Chalcedon, sondern vielmehr allenfalls dahin unterwegs zu lesen“. Dennoch hält er im Gegensatz zu Wengst und Veerkamp daran fest (T109), dass der Johannes-Prolog vom Sein Jesu bei Gott vor der Schöpfung der Welt redet, also von der so genannten Präexistenz Jesu, der sich
als der auferweckte Gekreuzigte den Seinen dadurch als „Schöpfungsmittler“ erwiesen hat, daß er ihnen den ängstenden kosmos als Gottes Schöpfung erfahrbar gemacht und ihnen die Vollmacht gegeben hat, darin als Teilhaber an seinem Frieden und seiner Freude „Gottes Kinder zu werden“…
Eine derart allgemein-menschlich religiös-kosmologische Sichtweise würde Ton Veerkamp von dem jüdischen Messianisten Johannes nicht erwarten. Er verweist zum Verständnis dessen, was Johannes hier mit dem „Einziggezeugten, Gottbestimmten“ meint, auf den „rätselhaften Ausdruck der am Busen des VATERS“, den er von der Schriftstelle 4. Mose (Numeri) 11 her erläutert:
Das Volk in der Wüste gedachte der schönen Tage im Sklavenhaus, wo es umsonst (chinnam) Fisch zu essen gab, dazu „Gurken, Melonen, Porree, Zwiebel, Knoblauch!“ Mose war es leid, dieses Volk zu führen. Er beklagt sich über diese Aufgabe beim Gott Israels. Es heißt dann, Numeri 11,11ff.:
Und Mose sagte zum NAMEN:
„Warum willst du deinem Knecht Böses antun?
Warum habe ich keine Gunst in deinen Augen gefunden,
dass du mir die Last dieses ganzen Volkes auflegst?
Bin ich etwa schwanger gewesen mit diesem ganzen Volk,
habe ich es etwa gezeugt,
dass du mir gesagt hättest,
hebe es an deinem Busen auf,
wie der Hüter den Säugling aufhebt …?“Das Verhältnis eines Säuglings zur Bezugsperson ist das einer völligen Abhängigkeit. So ist das Verhältnis Moses zum Volk, das er führen muss und das von ihm abhängig ist. Mose sagt zu seinem Gott: „Die sind nicht mein, sie sind dein Volk. Hebe es an deinem Busen auf!“ Tatsächlich kann dieser Einziggezeugte theos, ein einzigartig von Gott Bestimmter, genannt werden als „der am Busen“. Er ist die exemplarische Konzentration Israels, er ist „am Busen des NAMENS/VATERs“, ganz und gar von Gott bestimmt, eben theos. Der Gott des Mose erhörte die Stimme Moses, er hob diesen geschlagenen und ermordeten Messias in Vertretung für das geschlagene und verzweifelte Volk der Juden auf – wie einen Säugling an seinem Busen.
Damit beschließt Veerkamp die Auslegung des Prologs und leitet über zur Auslegung der
Erzählung über Jesus ben Joseph aus Nazareth in Galiläa, sein Vorbild Johannes, seine Nachfolger und Schüler. Wenn wir die Erzählung gehört und begriffen haben, dann erst können wir die Vorrede verstehen.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen, wie Thyen, Wengst und Veerkamp nach dem Prolog an die Erzählung des Johannesevangeliums herangehen: In den Augen von Hartwig Thyen folgt nun die Geschichte des präexistenten Logos, der in Jesus Fleisch geworden ist und gerade in der Hingabe seines Fleisches für das Leben der Welt seine göttliche Liebe und Herrlichkeit zeigt. Klaus Wengst betont vor allem, dass in Jesus das Sprechen des Gottes Israels die konkrete Gestalt eines jüdischen Menschen angenommen hat, der den in Israel bekannten Gott auslegt. Und für Ton Veerkamp ist der Messias Jesus, indem er das Volk Israel als den Einziggezeugten Sohn Gottes repräsentiert, auch die Verkörperung des befreienden NAMENS des Gottes Israels.
↑ Zur Gliederung des Johannesevangeliums
[19. März 2022] Nach der Betrachtung des Prologs füge ich Überlegungen zur Gliederung des Johannesevangeliums ein, die bei Thyen (TVIIIff.), Wengst (W7ff.) und Veerkamp <88> sehr unterschiedlich aussehen.
Einig sind sich alle drei lediglich darin, dass sie die Verse 1,1-18 als Prolog und die Verse 20,30-31 entweder als Epilog betrachten, dem noch ein angefügtes Kapitel folgt (Wengst und Veerkamp), oder als einen Epilog, der erst in 21,25 endet (Thyen).
Was zwischen Prolog und Epilog liegt, unterteilt Hartwig Thyen einerseits in zwei Bücher, „Das Buch des Zeugnisses“ und „Das Buch der doxa {Herrlichkeit} Jesu“, und andererseits in sieben Akte einer (T111) von Johannes dargebotenen „dramatischen Historie Jesu“. Dabei fällt auf, dass er insofern eine seltsam anmutende exakt symmetrische Anordnung dieser Akte voraussetzt, als jeweils die ersten und letzten drei Akte komplett zum jeweiligen Buch gehören (1,19-2,22; 2,23-4,54; 5,1-7,52 sowie 13,1-17,26; 18,1-19,40; 20,1-29), während (T509) der zentrale vierte und in Thyens Augen entscheidend wichtige Akt (8,12-12,50) durch den Einschnitt 10,40-42, der die beiden Bücher voneinander trennt, in zwei Teile zerschnitten wird. Wie er das begründet, wird zu überprüfen sein. Worauf die Aufteilung der verschiedenen Akte beruht, erschließt sich mir auch nicht auf den ersten Blick; ich bin gespannt, welche Gesichtspunkte er dafür anführen wird.
Auch Klaus Wengst teilt die Erzählung des Johannesevangelium in zwei Hauptteile auf. Der erste Teil „Das Wirken Jesu als des von Gott Gesandten findet Glaubende und Nichtglaubende“ endet mit dem Rückblick Jesu auf sein öffentliches Reden unter den Judäern (12,50), worauf mit 13,1 der zweite Teil beginnt: „Der ans Kreuz gehende Jesus gibt sich den Glaubenden als zu Gott Zurückkehrender zu verstehen und verheißt seine Gegenwart im Geist“.
Seine weitere Aufteilung der beiden Teile (W28) orientiert sich weitgehend an der Art, wie das Johannesevangelium „die Geschichte Jesu anders als die synoptischen Evangelien“ schreibt, „auch in zeitlicher und örtlicher Hinsicht“. Im ersten Teil erzählt Johannes
von einer mehr als zweijährigen Wirksamkeit Jesu mit einem relativ häufigen örtlichen Wechsel zwischen dem Ostjordanland, Galiläa und Judäa mit dem Zentrum Jerusalem, wobei auf dieser Stadt ein deutlicher Schwerpunkt liegt.
Dementsprechend beziehen sich die Überschriften, die Wengst seinen Kapiteln II bis VI gibt, auf die jeweiligen Aufenthalte Jesu in bestimmten Landesteilen: (Jerusalem/Judäa: 2,13-3,36; Samaria/Galiläa: 4,1-54; Jerusalem (2): 5,1-47; Galiläa (2): 6,1-71; Jerusalem (3): 7,1-10,42). Aus diesem Schema fällt nur das Kapitel VII heraus: „Die Auferweckung des Lazarus und ihre Folgen“: 11,1-57). Eingerahmt werden diese sechs Kapitel durch die Schilderung der ersten Woche (Kapitel I: 1,19-2,12) und des Anfangs der letzten Woche (Kapitel VIII: 12,1-50) des öffentlichen Auftretens Jesu.
Die (W29) am Anfang des zweiten Teils „in 13,1-19,42 geschilderten Ereignisse“ machen dagegen
nur einen einzigen Tag aus… Mit 20,1-23 kommt der dritte Tag nach Jesu Tod hinzu, mit 20,24-29 eine weitere Woche. Die jeweilige Zeit, über die sich die beiden Teile des Evangeliums erstrecken, ist also völlig disproportional zum jeweiligen Umfang. Daraus aber ist zu schließen, dass dem Geschehen und Verstehen des letzten Lebenstages Jesu – und das heißt vor allem seines Todes am Kreuz – ein außerordentlich großes Gewicht zukommt.
Hier nimmt Wengst eine weitere Aufteilung in drei Kapitel über die Reden Jesu beim Letzten Mahl, die Passionserzählung und den auferweckten Gekreuzigten vor.
Ton Veerkamp sieht die Erzählung des Johannesevangeliums nicht in nur zwei, sondern drei Hauptteile aufgeteilt. Den ersten Teil „Der offenbare Messias“ strukturieren zunächst die sieben Tage einer Woche entsprechend der Schöpfungswoche; ein zweites Strukturprinzip sind die beiden „Zeichen“, sēmeia, die Jesus zu Kana vollbringt und die Johannes den „Anfang“, archēn, der Zeichen (2,11), bzw. das „andere, zweite“, deuteron, Zeichen (4,54) nennt. In diesem Teil wird Jesus von Johannes dem Zeugen als der Messias proklamiert, schart sich eine messianische Gemeinde um ihn und offenbart sich Jesus in Jerusalem, Samaria und Galiläa als der Messias für ganz Israel.
Der zweite Hauptteil wird von Veerkamp <89> mit „Der verborgene Messias“ überschrieben. Er wird durch Angaben zu jüdischen Festen gegliedert und
behandelt den Konflikt zwischen der messianischen Gemeinde und ihren Gegnern, den Judäern. In diesem Konflikt wird Jesus nicht als Messias angenommen und als solcher nicht wahrgenommen; er ist als Messias verborgen. Dieser Teil umfasst fünf Kapitel unterschiedlicher Länge. Sie haben die Vorgänge während fünf verschiedener Feste der Judäer als Inhalt.
Der Beginn dieser fünf Kapitel (nicht zu verwechseln mit der uns vertrauten, aber erst viel später eingeführten Kapitelzählung) wird durch die Angaben zu einem unbestimmten Fest (5,1), zur Nähe des Pascha (6,4), zum Laubhüttenfest/Sukkot (7,2), zum Tempelweihfest/Chanukka (10,22) und zur erneuten Nähe des Pascha (11,55) markiert. Der Inhalt der so abgegrenzten ersten vier Kapitel konzentriert sich um vier weitere Zeichen, in denen Veerkamp die Werke sieht, „mit denen Jesus das Werk Gottes vollendet“, nämlich die „Heilung des Gelähmten und die Ernährung Israels … sowie das Öffnen der Augen und die Belebung Israels“. Das fünfte Kapitel zeigt (wie schon das zweite), dass Jesus als der messianische König vollständig missverstanden wird.
Das Passafest oder „Pascha“, wie Veerkamp unübersetzt aus dem Griechischen stehen lässt, wird im Johannesevangelium nie gefeiert, ist immer nur nahe, aber in solcher Nähe schon im ersten Hauptteil präsent, beim ersten Aufenthalt Jesu in Jerusalem, dann zwei Mal im zweiten Hauptteil in Galiläa und Jerusalem. Der dritte Hauptteil „Der Abschied des Messias“ ist ganz von der Nähe des Pascha bestimmt, denn eben im Sterben des Messias und seinem Aufsteigen zum VATER vollzieht sich die Befreiung, die beim Anbrechen der neuen Weltzeit in einem neuen Pascha gefeiert werden kann. Diesen dritten Teil sieht Veerkamp durch Zeitangaben markiert: „Vor dem Pascha“ (13,1-30a); „Es war Nacht“ (13,30b-18,28a); „Frühmorgens“ (18,28b-19,13); „ˁErev (Vorabend des) Pascha“ (19,14-42); „Tag eins der Schabbatwoche“ (20,1-31).
Dieser Erzählung, die mit der Zurückgezogenheit der Schüler Jesu hinter verschlossenen Türen (20,19.26) endet, wird Veerkamp zufolge mit 21,1-25 ein vierter Teil „Galiläa“ hinzugefügt, der die Öffnung der johanneischen Gruppe für die größere von Petrus geführte messianische Bewegung schildert. Ich möchte ergänzen, dass dieses Kapitel insofern organisch in die Struktur des gesamten Evangeliums eingepasst ist, als der Fischfang am See Tiberias als „dritte“, triton, Proklamation Jesu vor seinen Schülern bezeichnet wird (21,14), wodurch er in eine Reihe mit den beiden Zeichen zu Kana gestellt wird.
In meiner eigenen Strukturierung dieses Blogs, wie ich ihn nach und nach entfalte, indem ich den Auslegungen von Thyen, Wengst und Veerkamp folge, werde ich zunächst auf größere Einteilungen verzichten und überschaubare Verseinheiten so zusammenfassen, dass ich den Anliegen aller drei Autoren, aber vor allem Johannes, wie ich ihn verstehe, einigermaßen gerecht werden kann.
↑ Johannes der Zeuge, der Messias und die Schüler (Johannes 1,19-51)
[20. März 2022] Die Erzählung des Johannesevangeliums beginnt mit Johannes als dem Zeugen des Messias Jesus und der Schilderung, wie sich die ersten Schüler um Jesus scharen. Nach Hartwig Thyen (T111) endet der hier beginnende 1. Akt des johanneischen Dramas mit 2,22, nach der Hochzeit zu Kana, dem Aufenthalt in Kapernaum und der Tempelreinigung zu Jerusalem:
Durch sein auffälliges Tagesschema (tē epaurion {am Folgenden} in 1,29; 1,35; 1,43; tē hēmera tē tritē {am dritten Tag}: 2,1 und ou pollas hēmeras {nicht viele Tage} 2,12) ist er deutlich in sieben Szenen gegliedert.
Klaus Wengst zufolge (W69) reicht die durch das Zeugnis des Johannes ausgelöste „Kettenreaktion“ nur bis Johannes 2,12. „Er wird formal zusammengehalten durch ein Tagesschema, das zusammengenommen genau eine Woche ergibt.“ Dadurch, dass er „jenen Tag“, tēn hēmeran ekeinēn, den nach 1,39 Jesu erste Schüler bei ihm blieben, zusätzlich zu den von Thyen erwähnten Tagen zählt, findet bei ihm die Hochzeit zu Kana am 7. Tag statt: „Der sechste Tag wird übersprungen“ und „ist als Reisetag gedacht.“
Wenn das so wäre, müsste man sich aber den Tag, an dem die Hochzeit und das Füllen der Krüge der Reinigung mit Wasser stattfindet, als einen Sabbat vorstellen; jüdische Hochzeiten finden aber weder an einem Sabbat noch an Festtagen statt. <90>
Thyen wird wohl eher Recht mit seiner Annahme haben, dass die Hochzeit am sechsten Tage stattfand. <91> Das passt sogar zu Wengsts Parallelisierung der letzten Woche des Wirkens Jesu mit seiner ersten, denn in 12,1 ist ausdrücklich davon die Rede, dass Jesus sechs Tage vor dem Passafest nach Bethanien kam; auch diese Woche ist unvollständig, da Jesus an ˁerev pascha, am Rüsttag für das Passafest stirbt, das in diesem Jahr zugleich an einem Sabbat stattfindet (19,31).
Ton Veerkamp <92> geht wie Thyen von vier aufeinanderfolgenden Tagen bis zum Ende des 1. Johanneskapitels aus, aber auch er sieht wie Wengst den Tag der Hochzeit zu Kana als den siebten Tag, weil er vom vierten Tag aus weiterzählt: „Nach den vier Tagen kommen zwei weitere Tage und dann ein dritter Tag. Das ergibt eine volle Woche, der siebte Tag ist tatsächlich ein Festtag.“ Dabei unterläuft ihm der Fehler, dass die biblische Wendung tē hēmera tē tritē, „am dritten Tag“, den Ausgangstag mitzählt (sonst wäre auch der Auferstehungstag Jesu, vom Karfreitag aus gesehen, nicht der dritte Tag). Ansonsten gilt, wie gesagt, dass eine Hochzeit zwar ein Fest ist, aber nicht auf einem Sabbat oder sonstigen regulären Festtag gefeiert werden darf. Auch nach Veerkamp müsste also die Hochzeit auf den sechsten Tag fallen.
Zunächst aber geht es um „einen Tag und drei weitere folgende Tage“, an denen Johannes mit seiner Zeugentätigkeit für den Messias Jesus beginnt und Jesus seine ersten Schüler findet.
↑ Johannes 1,19-21: Dreifaches Zeugnis des Johannes, wer er nicht ist
1,19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes,
als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem Priester und Leviten,
dass sie ihn fragten:
Wer bist du?
1,20 Und er bekannte
und leugnete nicht,
und er bekannte:
Ich bin nicht der Christus.
1,21 Und sie fragten ihn:
Was dann? Bist du Elia?
Er sprach: Ich bin‘s nicht.
Bist du der Prophet?
Und er antwortete: Nein.
Die Erzählung des Johannesevangeliums baut von vornherein ein Spannungsfeld auf, innerhalb dessen Johannes der Täufer einer Befragung ausgesetzt ist. Veranlasst ist die Befragung durch „die Juden aus Jerusalem“, hoi Ioudaioi ex Hierosolymōn. Wer sind diese Juden?
Hartwig Thyen (T112) stellt „die Juden“, die er in Anführungszeichen setzt, zunächst ganz einfach Johannes gegenüber, der nach Peter von der Osten-Sacken <93> als „der erste Christ“ bezeichnet werden kann, denn er „bekennt und verleugnet nicht“ wie diejenigen, „die aus Angst vor dem Synagogenausschluß das Bekenntnis nicht wagen (… 12,42 u. ö)“. Hat Johannes aber tatsächlich bereits dem jüdischen Glauben eine alternative christliche Religion gegenübergestellt? Das dürfte anachronistisch sein.
Klaus Wengst (W70) übersetzt hoi Ioudaioi als „die führenden Juden“, wozu er anmerkt (Anm. 3):
Wo Johannes pauschal von „den Juden“ spricht, füge ich in der Übersetzung ein sich vom Kontext ergebendes Adjektiv hinzu, um den in unseren Ohren beim Lesen und Hören sich ansonsten unvermeidlich ergebenden antijüdischen Klang wegzunehmen.
Er sieht in ihnen (W70) die
beauftragende Behörde, die vom Zentrum her Vernehmungsbeamte entsendet, weil hinter dem Taufen des Johannes messianische Ansprüche vermutet werden…, derentwegen er vernommen werden soll.
Insofern nimmt Wengst ernst, dass es hier noch nicht um den religiösen Gegensatz zwischen Juden und Christen geht, sondern um innerjüdische Konflikte, die mit sehr konkreten politischen Problemen zu tun haben (W71):
Mit dem Kommen des Gesalbten, des königlichen Messias, sind Hoffnungen auf die Beseitigung von Not und Bedrückung, auf das Ende von Unrecht und Gewalt verbunden. Ob Jesus der Gesalbte sei, darum wird im Johannesevangelium immer wieder gestritten. Es war der wesentliche Streitpunkt in der Zeit des Evangelisten zwischen seiner Gruppe und der jüdischen Mehrheit.
Ton Veerkamp <94> wählt für hoi Ioudaioi die wörtliche Übersetzung „Judäer“, womit Johannes das entstehende „rabbinische Judentum“ meint, das aber zu seiner Zeit noch eine unter mehreren Richtungen – etwa messianischer oder zelotischer Ausprägung – darstellte. In seinen Augen war erst
nach dem letzten der drei „Jüdischen Kriege“ gegen Rom, dem von 131-135 … das rabbinische Judentum faktisch identisch mit dem Judentum überhaupt, das sich nach dem Ende der exzessiven Verfolgung durch Rom etwa 140-150 etablierte. Vor dieser Zeit gab es kein homogenes „Judentum“.
So beschreibt es Veerkamp in seiner Auslegung 2006. In einer Anmerkung zu seiner Übersetzung von 2015 zieht er zwei weitere Bedeutungen in Erwägung:
Im 1. Jh. n.Chr. konnte das Wort Ioudaios zweierlei bezeichnen: 1. einen Juden im ethnischen Sinne; 2. einen Bewohner der römischen Provinz Judaea (im Unterschied zu den Einwohnern Samarias, Galiläas usw.). Dieser zweite Sinn dominiert bei Johannes. Seine Ioudaioi sind Einwohner des römischen Judaea und damit, so die Logik des Textes, automatisch Gegner Jesu. Der Galiläer Jesus von Nazareth ist zwar Jude, aber kein Judäer, im Sinne des Johannesevangeliums also auch kein Ioudaios.
Tatsächlich kommen je nach dem Zusammenhang alle drei Bedeutungsmöglichkeiten bei Johannes in Frage.
Merkwürdigerweise tauchen die hier von den Judäern abgesandten „Priester und Leviten“ nur an dieser einen Stelle im Evangelium auf. Nach Veerkamp handelt es sich um „Angehörige der politischen Klasse Judäas“:
Die politische Führung des Bezirkes Judäa hatte Obrigkeitsfunktionen innerhalb der Grenzen der von den Römern belassenen Autonomie. Während der Periode 6-66 u.Z. waren die Priester die entscheidende politische Klasse des Gebiets. Die Leviten waren eine Schicht von Beamten unter der Führung der Priester. Die Judäer sandten also Angehörige ihrer politischen Führung zu Johannes.
Hartwig Thyen (T116) erkennt hier einen Rückverweis auf die griechische Übersetzung von Jesaja 40,1-3:
Die „Priester und Leviten“ dürften, wie Obermann <95> gezeigt hat, … darum zur Stelle sein, weil sie im Text der LXX von Jes 40,1-3 „explizit“ als diejenigen angesprochen sind, die „Jerusalem zu Herzen“ reden sollen. So ergibt sich die tiefe Ironie, daß „Priester und Leviten“, die als berufene und ausgewiesene Experten für alle Fragen levitischer Reinheit dazu ausgesandt waren, Johannes über seine Person und sein Taufen zu verhören…, nun umgekehrt als Zeugen zurückgesandt werden, Jerusalem zu Herzen zu reden, damit es Jesus, seinem kyrios, den Weg bereite.
Ob es richtig ist, das Wort kyrios auf Jesus zu beziehen, wird in der Besprechung von Vers 23 noch Thema sein. Was Jesaja 40,2 betrifft, werden allerdings dort nicht „Priester und Leviten“, sondern nur hiereis, „Priester“, erwähnt, und auch sie tauchen im hebräischen Text gar nicht auf.
Interessant ist, dass es im gesamten Buch Jesaja eine einzige Stelle gibt (66,21), wo „Priester und Leviten“ gemeinsam vorkommen, und zwar in genau derselben Formulierung wie in Johannes 1,19. Fast am Ende des Jesajabuches steht dort eine Zukunftshoffnung für Israel, in der es (66,19) um die Verkündigung der „Herrlichkeit“ des Gottes Israels „unter den Völkern“ und (66,20) um die Rückkehr aller Israeliten „aus allen Völkern … nach Jerusalem“ zum heiligen Berg Gottes geht. Und von diesen Rückkehrern aus der Zerstreuung unter die Völker heißt es dann (66,21):
Und ich will auch aus ihnen Priester und Leviten nehmen, spricht der HERR.
Da nach Johannes 11,52 die Sammlung ganz Israels einschließlich der Diaspora-Juden das Herzensanliegen des Messias Jesus ist, könnte die Erwähnung der Priester und Leviten durchaus auf diese Jesaja-Stelle anspielen, was nicht ausschließt, dass zugleich auch Jesaja 40,2 im Blick ist. Dann würde Johannes schon am Beginn seiner Erzählung anklingen lassen, worin er die Aufgabe einer wahrhaft dem Volk Israel verpflichteten Priesterschaft sieht, nämlich in der Sammlung ganz Israels. Ironischerweise erfüllt nach Johannes 11,51-52 die mit Rom kollaborierende Hohepriesterschaft durch ihre Auslieferung des Messias an Pilatus genau dadurch, ohne es zu wissen und zu wollen, diese Aufgabe.
In der Befragung durch die Priester und Leviten verneint Johannes der Täufer von sich aus, dass er der Messias ist, und auf die Nachfrage (T112),
ob er denn „Elia“ sei (der nach Mal 3,22f prin elthein hēmeran kyriou tēn megalēn kai epiphanē {ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt} wiederkommen und alle Zerstrittenen versöhnen soll) oder ob er der Dt 18,15 verheißene „Prophet wie Mose“ sei, antwortet er mit abnehmender Emphase zunächst mit ouk eimi {ich bin es nicht} und endlich mit dem einfachen ou {nein}. Dieses dreifach negative „Bekenntnis“ will, wie seine Formulierung zeigt, freilich zugleich als positives Zeugnis für den verstanden sein, der immer wieder egō eimi {ICH BIN} sagen wird, und in dem alle mit dem Messias, mit dem wiederkehrenden Elia und mit dem endzeitlichen „Propheten wie Mose“ verbundenen messianischen Verheißungen mehr als erfüllt sein sollen.
Dabei geht es Thyen zufolge dem Evangelisten Johannes nicht um „die Bestreitung des Rechts, Johannes {den Täufer} messianisch zu verehren“. Wohl aber könnte, wie William Wrede <96> erklärt (T113), das von
„Johannes bekämpfte Judentum … den Täufer gegen Jesus ausgespielt haben: … Man sagte etwa auf jüdischer Seite, Johannes sei doch ein ganz anderer Mann als Jesus gewesen; er sei viel eher ein Prophet zu nennen; die Taufe habe er gebracht, nicht Jesus, er habe ja auch Jesus selbst getauft, sei folglich der Größere, Jesus dagegen sei der Taufe bedürftig gewesen, und dergleichen“. Diese Vermutung wird bestätigt durch den Gegensatz zwischen dem Schweigen, mit dem Josephus Jesus übergeht, und seiner beredten Zeichnung Johannes des Täufers als eines frommen Märtyrers, dessen allgemeine Hochschätzung im Volk sich vor allem darin erwiesen habe, daß man in der vernichtenden Niederlage der gesamten Armee des verhaßten Antipas im Krieg gegen die Nabatäer dessen verdiente Strafe des Himmels für die Ermordung des gerechten Johannes gesehen habe. <97>
Dass Johannes den Täufer nicht wie Markus oder Matthäus „mit den Farben der Palette des biblischen Elia-Bildes“ malt, liegt daran, dass er diese Farben – wie auch diejenigen des „Propheten wie Mose“ (5. Mose 18,18) – „für sein Porträt Jesu“ braucht. Auch widerspricht Johannes
der durch Justin <98> bezeugten jüdischen Erwartung…, wonach erst der wiedergekehrte Elia einen dazu erwählten und bis dahin unerkannt unter seinem Volke lebenden Menschen, indem er ihn salbt, zum Messias macht.
↑ Johannes 1,22-23: Stimme eines Rufenden
1,22 Da sprachen sie zu ihm:
Wer bist du dann?,
dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben.
Was sagst du von dir selbst?
1,23 Er sprach: „Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste:
Ebnet den Weg des Herrn!“,
wie der Prophet Jesaja gesagt hat (Jesaja 40,3).
[21. März 2022] Die Bemerkung der Befragungskommission, sie müssten denen Antwort geben, die sie geschickt haben, führt Klaus Wengst (W72) auf eine „in der jüdischen Tradition“ geltende „selbstverständliche Lebensregel“ zurück; in 2. Mose 19,8 <99> bringt Mose sogar „die Worte des Volkes zurück zum Ewigen“, und zwar, „obwohl er es weiß und Zeuge ist“.
Ton Veerkamp <100> geht eher davon aus, dass die Judäer mit der Auskunft des Täufers, „er sei weder Mose noch Elia, weder Tora noch Propheten“, nichts anfangen können. „Aber sie brauchen eine Antwort, denn sie müssen die Aktion des Johannes politisch einordnen können.“
Die Antwort besteht aus dem berühmten Jesajazitat, auf Grund dessen in den synoptischen Evangelien der in der Wüste am Jordan auftretende Johannes zur „Stimme eines Rufers in der Wüste“ wurde, wie auch Thyen (T111) in Vers 23 übersetzt. Wengst (W72) dagegen übersetzt genauer:
„Ich? Die Stimme eines Rufenden: In der Wüste ebnet dem Ewigen den Weg!“ Das entspricht dem Text von Jes 40,3a. … Der Evangelist bietet ein anderes Verb als die Septuaginta. Da es dem im hebräischen Text gebrauchten näherkommt, spricht das für Beeinflussung durch diesen. Auch dessen Zuordnung der Angabe „in der Wüste“ zum Bahnen des Weges und nicht zum Rufenden liegt für ihn näher, da er sich das Auftreten des Johannes nicht in der Wüste vorstellt. Der will hier also nichts sonst sein als „die Stimme eines Rufenden“, die dazu auffordert, Gott den Weg zu ebnen.
Anders als Thyen, der den hier erwähnten kyrion, „Herrn“, beiläufig auf Jesus bezieht, wie oben erwähnt, meint Wengst zufolge mit
kýrios im Zitat … der Evangelist nicht Jesus, sodass er die Umschreibung des Gottesnamens der Bibel auf Jesus übertrüge. Er identifiziert nicht Gott und Jesus. Er differenziert zwischen kýrios ohne Artikel als Entsprechung zur Umschreibung des Gottesnamens mit „Adonaj“ und kýrios mit Artikel als Bezeichnung für Jesus, was dem aramäischen mará entspricht. <101> Indem der Evangelist den Johannes als „die Stimme eines Rufenden“ versteht, um dem zur Rettung kommenden Gott den Weg zu ebnen, und damit zugleich, wie das Folgende ausdrücklich macht, als Zeugen für Jesus, bringt er Gott und Jesus in engsten Zusammenhang miteinander: Im Auftreten Jesu tritt Gott selbst heilvoll und rettend auf den Plan.
Auch Veerkamp bezieht das Wort kyrion, das in der Septuaginta für den befreienden Gottesnamen steht, auf den Gott Israels:
„Ich bin Stimme eines Rufenden:
in der Wüste bahnt den Weg für den NAMEN.“… Das Jesajazitat sagt, Johannes sei wie der Prophet Jesaja; so wie dieser damals in Babel etwas ungehört Neues ankündigte, so ist Johannes der, der heute, in der Zeit der Römer, Neues ankündigt. Die Parallele ist die zwischen der Befreiung aus Babel und der Befreiung von Rom.
Da das Stichwort erēmos, „Wüste“, bei Johannes nicht den Ort seines Wirkens bezeichnet, muss es auch bei Jesaja nicht nur an den Weg der Rückkehrer aus der babylonischen Deportation durch die Wüste erinnern; vielmehr kann es jesajanische Bilder der Verwüstung Israels und insbesondere Jerusalems aufrufen (44,26; 49,8.19; 51,3; 52,9; 58,12; 61,4; 62,4; 64,9), die Johannes aus seiner eigenen Zeit nach dem Judäischen Krieg und der Zerstörung Jerusalems nur zu gut kannte.
Hartwig Thyen (T114), der „in Joh 1,19-34 ein intertextuelles Spiel mit Mk 1,2-11“ wahrnimmt, weist darauf hin, dass Johannes nicht nur absichtlich darauf verzichtet, das Jesaja-Zitat wie Markus mit dem „auf Elia weisenden“ Text Maleachi 3,1 zu verbinden. Er zieht außerdem aus den beiden Sätzen in Jesaja 40,3: „In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott!“ in kunstvoller Weise die beiden Verben hetoimasate, „bereitet“, und eutheias poieite, „macht eben, gerade“, zu dem euthynate, „ebnet“, in Johannes 1,23 zusammen. Nach Maarten Menken <102> bezeichnet hetoimazō „stets einen für das Künftige notwendigen Akt seiner ihm vorausgehenden Vorbereitung (vgl. nur Joh 14,2…)“; die Ersetzung durch euthynō dagegen lässt den Täufer nicht als einen Vorläufer Jesu erscheinen, der seinen Zeugendienst vor dem Erscheinen Jesu vollendet hätte, vielmehr tritt Johannes als Zeuge für Jesus gleichzeitig mit ihm auf.
↑ Johannes 1,24: Wer sind die Pharisäer?
1,24 Und sie waren abgesandt von den Pharisäern.
Was die Lutherbibel mit „von den Pharisäern“ übersetzt, heißt auf Griechisch: ek tōn Pharisaiōn, wörtlich „aus den Pharisäern“. In manchen Handschriften steht vor apestalmenoi ēsan, „und sie waren abgesandt“, zusätzlich der Artikel hoi; dann muss übersetzt werden: „die Gesandten gehörten zu den Pharisäern“. Thyen und Wengst entscheiden sich für die erste Lesart, Veerkamp für die zweite.
Nach Thyen veranlasst die in Vers 24 nachgetragene Bemerkung, dass die nach Vers 19 aus Jerusalem kommenden Priester und Leviten von den Pharisäern entsandt worden waren, viele Exegeten dazu (T115), „die Schere der Literarkritik zu ergreifen, um hier das Zusammenfließen zweier Quellen zu postulieren“. Nach Thyen ist ein solches Zerpflücken des Textes jedoch nicht angebracht, denn Johannes liebt es,
Dinge, die für seine Erzählung wesentlich sind, nicht schon in den Expositionen zu nennen, sondern ihnen dadurch besonderes Gewicht zu verleihen, daß er sie wie beiläufig nachträgt (vgl. 2,6; 5,9; 9,14 u.ö.).
Wesentlich ist es demzufolge für Johannes, die Pharisäer von Anfang an als „die treibende Kraft für das Verhör des Johannes“ herauszustellen. Und wie Johannes „hier die Juden ‚faktisch gleichsetzt‘ mit den Pharisäern“, kann er „in Kap. 9 auch umgekehrt die zuerst genannten Pharisäer danach mit ‚den Juden‘ identifizieren“.
Aber wer sind eigentlich diese „Pharisäer“ im Johannesevangelium? Ton Veerkamp <103> weigert sich, in seiner Übersetzung dieses Wort weiterhin zu benutzen:
Das Wort „Pharisäer“ ist durch die jahrtausendealte Propaganda eines antijüdischen Christentums gleichbedeutend mit „Heuchlern, Betrügern“ in die allgemeine Sprache eingegangen. Das Wort ist demnach unbrauchbar geworden. Deswegen schreiben wir mit dem jüdischen Übersetzer André Chouraqui Peruschim.
Peruschim, „Abgespaltene“, ist das aramäische Wort, aus dem das griechische Pharisaios abgeleitet wurde. Diese politische „Partei hatte eine ehrwürdige Tradition“:
Ihre Ursprünge liegen in der Zeit des Kampfes der judäischen Bevölkerung gegen die hellenistischen Monarchen des Nordens (Syrien-Mesopotamien), d.h. um 170 v.u.Z. Sie formierte sich als Opposition gegen die Politik der Staatsführer und späteren Könige aus dem Haus der Hasmonäer (Makkabäer), die sich immer mehr als hellenistische Monarchen zu erkennen gaben. Der Kampf der Peruschim war ein Kampf um die Tora in schriftlicher und mündlicher Überlieferung als dem Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, unter welcher Oberhoheit auch immer. Der Gegner des Jesus ben Joseph ist das sich formierende rabbinische Judentum, das zwar nicht identisch mit den Peruschim, ihnen politisch aber doch sehr verwandt war. Viele der führenden Lehrer Israels nach dem Jahr 70 kamen aus dem Milieu der Peruschim.
Für Veerkamp ist es nun „mehr als merkwürdig“, dass die von den Judäern entsandten Priester und Leviten zu den Peruschim gehören sollen. Das gleiche würde umgekehrt – wenn die von Thyen und Wengst bevorzugte Lesart zutrifft – für die Entsendung von Priestern durch die Peruschim gelten. Denn in „der Regel gehörten die Priester der Partei der Sadduzäer an.“ Diese kommt nun allerdings im Johannesevangelium an keiner Stelle vor, wahrscheinlich deswegen, weil sie nach dem Judäischen Krieg und dem Untergang Jerusalems und des jüdischen Tempels keinerlei politische Rolle mehr spielt.
Dennoch weiß Johannes um die Rolle der Priesterschaft zur Zeit Jesu als den
eigentlichen hohen Repräsentanten des judäischen Volkes. Das Verhältnis Priester/Volk wird in 11,46-54 deutlich werden. Der Grund der Feindschaft zwischen Jesus und den Priestern wird in 19,15 unmissverständlich ausgesprochen; ihre erste Loyalität gilt dem Kaiser Roms: „Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar.“
Zugleich will Johannes aber den Gegebenheiten seiner eigenen Zeit gerecht werden. Seiner auf den Messias Jesus vertrauenden Gruppe steht hauptsächlich das seit dem Judäischen Krieg entstehende rabbinische Judentum entgegen, dessen Wurzeln in der pharisäischen Bewegung liegen. Und so ist es entweder „das gesamte politische Establishment der Hauptstadt“ – von Johannes als „die Judäer“ bezeichnet -, das „eine ‚pharisäische‘ Delegation“ zum Täufer schickt, oder Johannes würde sich schon die judäische Führungsschicht zur Zeit Jesu als pharisäisch dominierte Behörde vorstellen, die Priester und Leviten zum Verhör aussendet.
↑ Johannes 1,25-27: Der Unbekannte, der hinter dem Täufer kommt
1,25 Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm:
Warum taufst du denn,
wenn du nicht der Christus bist noch Elia noch der Prophet?
1,26 Johannes antwortete ihnen und sprach:
Ich taufe mit Wasser;
aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt.
1,27 Der wird nach mir kommen,
und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse.
[22. März 2022] Erst auf eine weitere Rückfrage an den Täufer, die auf seine drei Verneinungen Bezug nimmt, wird Wengst zufolge (W72)
das Wirken des Johannes erwähnt, das ihn vor allem auszeichnete, das Taufen, und das ihm die ihn spezifisch charakterisierende Bezeichnung „der Täufer“ einbrachte. Die erhält er aber im Johannesevangelium nicht – wahrscheinlich deshalb nicht, weil hier seinem Taufen keinerlei soteriologische {rettende} Eigenbedeutung zukommt. Er sagt: „Ich, ich taufe in Wasser.“ Wenn auf die schlichte Feststellung, dass er in Wasser taufe, unmittelbar folgt, dass mitten unter ihnen stehe, den sie nicht kennen, wird der Eindruck erweckt, den der folgende Abschnitt bestätigt, dass sein Taufen einzig dazu dient, diesen noch Unbekannten bekannt zu machen.
Thyen erklärt die erst hier erfolgende Erwähnung, dass Johannes getauft habe (T117), erneut „aus dem spannungsvollen Spiel mit den synoptischen Prätexten.“
Nach Ton Veerkamp <104> setzt die Delegation aus Jerusalem ihre Befragung fort, weil „einem, der sich von ‚Gesetz und Propheten‘ unterscheidet, … nicht über den Weg zu trauen“ ist. „Was solle die ganze Täuferei, wenn er, Johannes, weder Mose noch Elia sei?“
Er taufe mit Wasser, sagt er, „mitten unter euch“ stehe einer, der nach ihm komme. Der Ausdruck mitten unter euch weist auf Deuteronomium 18,15: „Ein Prophet aus der Mitte der Brüder“. Wenn irgendeiner der „Prophet“ sei, den man jetzt in Israel sehnlich erwartet, dann ist es der, der „nach ihm kommt“. Opisō mou erchomenos, der nach mir Kommende, übersetzen wir. Der mir Hinterhergehende könnten wir auch schreiben, denn hinterhergehen ist in der Schrift einem folgen. <105> Beides stimmt. Jesus war im Gefolge Johannes des Täufers, und gleichzeitig ist er der, der nach ihm kommt und das Verhältnis umdreht. Der Evangelist kennt diesen „historischen“ Fakt aus dem Leben Jesu. Er kehrt dieses historische Verhältnis theologisch – das heißt politisch – um: Er, Jesus, sei für ihn, Johannes, der Erste, der Vorangehende.
Die Leute aus Jerusalem kennen ihn nicht, niemand kennt ihn, auch Johannes nicht (1,31). Deswegen verstehen sie den Sinn des Zitats nicht. Johannes weiß nur, dass er mit Wasser taufen muss. Und er weiß, dass der, der kommen muss, nicht jemand von außen sein wird, sondern einer „aus der Mitte der Brüder“; die Befreiung, so wird Jesus später der Frau am Jakobsbrunnen sagen, komme von den Judäern her, 4,22. Näheres wird uns erst in 1,29ff. gesagt.
Zur anschließenden Unterordnung des Täufers unter den nach ihm Kommenden schreibt Wengst (W73), dass er „sich im Verhältnis zu ihm für geringer als einen Sklaven gegenüber seinem Herrn“ erklärt, und verweist auf eine rabbinische Quelle <106> zur „Besitzergreifung von Sklaven“: Der Sklave zieht seinem Erwerber „seine Sandale an und er löst ihm seine Sandale“. Andererseits (Anm. 15) <107>
ist sich Gott nicht zu schade, an Israel Sklavendienst zu verrichten: „Bei Fleisch und Blut zieht der Sklave seinem Herrn die Sandalen an. Aber der Heilige, gesegnet er, handelt nicht so (Ez 16,10): ,Und ich habe dir Sandalen aus Tachasch-Leder angezogen‘.“
Auf einen anderen möglichen Bezugspunkt des Lösens der Schuhbänder in den jüdischen Schriften weist Veerkamp hin:
So viel ist aber klar: Johannes hält sich nicht für würdig, dem nach ihm Kommenden die Schuhbänder zu lösen. Wir wissen aus der Rolle Ruth, dass das Lösen eines Schuhs ein Zeichen ist. Ein Geschäft wird in Israel rechtskräftig, indem der eine der daran Beteiligten seinen Schuh löst und ihn dem anderen gibt (Ruth 4,7f.). Hier ist mehr im Spiel als nur ein Ausdruck für totale Unterwerfung. Niemand in Israel kann den Messias dazu zwingen, rechtskräftig in und für Israel zu handeln, man kann ihm nicht die Schuhe lösen, nicht einmal die Bänder der Schuhe. Was schon „mitten unter euch“ im Gange ist, ist auf alle Fälle etwas, das alle Vorstellungen von Politik und Widerstand in Judäa auf den Kopf stellen wird.
↑ Johannes 1,28: Wo liegt Bethanien jenseits des Jordans?
1,28 Dies geschah in Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.
Zur Ortsangabe für die Ereignisse am Tag der Befragung des Johannes stellt Wengst (W73) geographische Überlegungen an, die darauf hinauslaufen, dass kein Bethanien am Unterlauf des Jordans gemeint sein kann, wo traditionell der „Taufort des Johannes“ lokalisiert wird. Denn nach Johannes 10,40
geht Jesus dahin zurück, bevor er nach dem Tod des Lazarus zu dem Dorf Betanien bei Jerusalem (11,1.18) aufbricht. Verlegt man die mit „Betanien“ angegebene Taufstelle des Johannes in den Süden, ist einmal der Weg von dort nach Kana (2,1) zu weit, um an einem Reisetag bewältigt werden zu können. Und zum anderen ist der Weg von dort nach Betanien bei Jerusalem zu kurz, um einsichtig zu machen, dass Lazarus schon vier Tage im Grabe liegt (11,17). Diese Schwierigkeiten lösen sich, wenn „Betanien“ im Norden liegt und mit der Landschaft Batanäa östlich des Sees Gennesaret identifiziert wird.
Die Versuche verschiedener Handschriften, das Problem dadurch zu lösen, dass an Stelle von Bēthania als Taufort Bēthabara oder Bētharaba angegeben wird, weist Thyen (T118) mit dem Argument zurück, dass der Evangelist
von diesem transjordanischen Bethanien unmittelbar danach (Joh 11,1.18) ein anderes nur fünfzehn Stadien von Jerusalem entferntes Bethanien als das „Dorf des Lazarus und seiner Schwestern Maria und Martha“ derart „sorgfältig“ unterscheidet…
Die entscheidende Bedeutung der Erwähnung von Bethanien an dieser Stelle liegt für Thyen darin, „daß unsere Szene (1,19-28) dadurch zusammen mit der Passage 10,40-42 um den gesamten ersten Evangelienteil (1,19-10,42) eine Inclusio bildet.“ Hier beginnt das Zeugnis des Johannes, dort wird in 10,41 auf seine gesamte Zeugenschaft zurückgeblickt und „dem treuen martys {Zeugen} zugleich ein Denkmal als Märtyrer gesetzt.“ Damit wird auch deutlich, warum Thyen den ersten Hauptteil des Johannesevangelium als „Buch des Zeugnisses“ mit Johannes 10,42 enden lässt.
Auch Ton Veerkamp <108> hält nichts von geographischen Spekulationen um Bethanien. Er nutzt allerdings die Rückkehr Jesu an den Taufort des Johannes (10,40) nicht zur Abgrenzung eines ersten von einem zweiten Buch im Gesamtzusammenhang des Evangeliums, sondern konzentriert sich darauf, dass der Name des Ortes, wo das entscheidende Zeichen der Auferweckung des Lazarus geschehen wird, bereits hier laut wird. Zwar mögen die Orte jenseits des Jordans und in der Nähe von Jerusalem weit voneinander entfernt sein, aber
Bethanien ist kein geographischer, sondern ein theologischer Ort. Was in Bethanien geschehen wird, übersteigt die Vorstellungskraft jedes Menschen in Israel, wie aus der Erzählung vom Zurückrufen des toten Lazarus ins Leben (Johannes 11) hervorgeht. Es ist also nicht nötig, sich über die genaue Lage Bethaniens bzw. um die genaue Buchstabierung des Namens den Kopf zu zerbrechen. Schon die Leute, die die alten Handschriften angefertigt haben, haben sich diese vergebliche Mühe gemacht. Man muss daher fragen, welche Rolle der Ort in der ganzen Erzählung spielt, und nicht, wo genau er auf der Karte liegt. Nein: Bethanien ist der Ort des Zeugnisses, weil es der Ort des entscheidenden Zeichens sein wird.
↑ Johannes 1,29: Zweiter Tag – Gottes Lamm und die Verirrung des kosmos
1,29 Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt,
und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm,
das der Welt Sünde trägt!
[23. März 2022] Interessant ist, wie unterschiedlich Thyen, Wengst und Veerkamp den ersten Teil von Vers 29 betrachten.
Wengst (W74) spricht vom erstmaligen Betreten der Szene durch Jesus, die an diesem nächsten Tag nach der Befragung „ausschließlich aus einer Rede des Johannes angesichts des ihm begegnenden Jesus besteht“, die an das „Publikum … der Leser- und Hörerschaft des Evangeliums“ gerichtet ist. Wie bei einem „Standfoto“ <109> oder einer „Großaufnahme“ <110> wird „alles Nebensächliche ausgeblendet.“
Thyen (T118) nimmt wahr, dass nicht das Auftreten Jesu betont wird, sondern in
der knappen Einführung in die Szene sagt der Erzähler dem Leser nach Art einer Teichoskopie, am folgenden Tage habe er – nämlich Johannes – Jesus auf sich zukommen sehen.
Wenn es aber tatsächlich darum geht, dass Johannes wie bei dem aus der griechischen Dramatik bekannten Kunstgriff der Teichoskopie oder Mauerschau etwas darstellen will, was auf andere Weise nicht darstellbar ist, worin genau besteht dann dieses anders nicht Dargestellbare? Ein einfacher Auftritt Jesu ist auf jeder Bühne zu bewerkstelligen. Dazu geht Thyen nicht weiter ins Detail.
Veerkamp <111> dagegen macht darauf aufmerksam, dass „es in der zweiten Szene um das Sehen des Johannes“ geht:
Er ist der erste und wohl auch der wichtigste Augenzeuge: Er sah, wie Jesus auf ihn zukommt (V.29), und am Ende „hat er bezeugt und gesehen“ (Perfekt), dass „dieser dasein wird wie Gott“. Der „hinter“ Johannes „Kommende“ ist der „auf Johannes Zukommende“. Aus der Tiefe der Schrift Israels kommt die Zukunft Israels.
Wohlgemerkt: damit geht es gerade nicht um historische Augenzeugenschaft. Tatsächlich ist das, was Johannes hier sieht, nur durch eine Mauerschau vor dem weiten Horizont des biblischen TeNaK zu erkennen. Dass dies so ist, wissen auch Thyen und Wengst, aber wie sehr der Evangelist gerade dieses „Sehen“ des auf ihn zukommenden Jesus vor dem Hintergrund der Schriften betont, entgeht ihnen.
Auf welche Schriftstellen bezieht sich nun Johannes 1,29?
Hartwig Thyen holt sehr weit aus (T119), um weite Teile des diesbezüglichen Rätselratens als abwegig zu erweisen, etwa die Unterstellung, dass „zweisprachigen ‚native Speakers‘“, wie es Johannes einer war, Fehlübersetzungen aus dem Aramäischen ins Griechische unterlaufen sind, oder (T120f.) der Versuch, den Vers von der „Welt der jüdischen Apokalyptik“ vom äthiopischen Henochbuch bis zur Offenbarung des Johannes zu erklären.
In die engere Wahl (T120) der möglichen Schriftstellen kommen für ihn 2. Mose 12, Jesaja 53,7 und 3. Mose 16, wobei er jeweils aber auch Schwierigkeiten sieht. Zwar legt „Jesu Sterben in der Stunde der Schlachtung der Passalämmer“ es nahe,
Jesus als das wahre Passalamm von Ex 12 u. ö. bezeichnet zu sehen. Doch sowenig wie das Lamm des täglichen Tamid-Opfers stirbt das Passalamm „für die Sünden der Welt“. Das wird – wenn auch mit der Einschränkung auf die da redenden Wir: kai kyrios paredōken auton tais hamartiais hēmōn {aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn, Jesaja 53,6} – im Alten Testament einzig von dem Gottesknecht gesagt, von dem es zugleich heißt: hōs probaton epi sphagēn ēchthē kai hōs amnos enantion tou keirontos {wie ein Lamm, das vor seinen Schlachter geführt wird, und wie ein Schaf im Angesicht seines Scherers} (Jes 53,7: LXX), habe er seinen Mund nicht aufgetan. Doch anders als Jesus in unserer Szene wird er mit dem Lamm nur verglichen, nicht aber identifiziert.
Noch schwerer ist nach Thyen der in 3. Mose 16 erwähnte „zuvor mit den Sünden Israels beladene und alsdann in die Wüste vertriebene Sündenbock im Ritual des Versöhnungstages“ mit Johannes 1,29 in Übereinstimmung zu bringen. Er ist kein amnos, „Schaf“, sondern ein chimaros, „Ziegenbock“. Er ist „ausdrücklich nicht für JHWH, sondern für Asasel (einen Unheil bringenden Wüstendämon?) bestimmt“. Er gibt nicht freiwillig sein Leben hin, sondern als Gegenstand eines Rituals. Schließlich
schafft hier gar nicht der Asasel-Bock die von der Sünde befreiende Sühne, sondern die bewirken das vergossene Blut eines geschlachteten Jungstieres (moschos) und das Blut des (im Unterschied zum Asasel-Bock) durch das Los für JHWH bestimmten chimaros (Lev 16,16ff).
Daraus zieht Thyen aber nicht den Schluss (T121), die letzteren „Ableitungsversuche“ zu verwerfen; er will sie aber nicht „als Alternativen betrachten, die Entscheidungen fordern“, denn so „haben weder der Verfasser unseres Evangeliums noch seine jüdischen Zeitgenossen ihre Bibel gelesen. Sie pflegten vielmehr eine konkordante Art der Lektüre“, das heißt, wie Geza Vermes <112> sagt, sie „legten in dem üblichen Verfahren eines Midraschs eine Schriftstelle im Lichte einer anderen aus“.
Bei diesem üblichen Verfahren darf nach Thyen aber eine weitere „Passage der Schrift“, nämlich die Erzählung von der ˁaqɘdath jitzchaq „Bindung Isaaks“ (1. Mose 22, 1-19) nicht außer Acht gelassen werden (T122). Spätestens seit „den Martyrien jüdischer Frommer während der Religionsverfolgung unter Antiochus IV. Epiphanes und der makkabäischen Erhebung“ spielt die „Akeda Isaaks“, obwohl er „nicht wirklich sterben mußte“, Vermes zufolge
„eine einzigartige Rolle in der gesamten Heilsökonomie Israels… Die Verdienste seines Opfers wurden vom auserwählten Volk in der Vergangenheit erfahren, in der Gegenwart in Anspruch genommen und für das Ende der Zeit erhofft“.
Insofern kann das Passalamm von 2. Mose 12 entgegen dem zuvor von Thyen Gesagten nun doch im Zusammenhang mit einem Sühneopfer gesehen werden:
Weil längst vor der Errichtung des Tempels und der Institution seines Opferkultes an eben dieser Stelle Isaak sich selbst als Gott wohlgefälliges Opfer dargebracht hat, müssen alle danach im Tempel geopferten Lämmer dazu dienen, Gott an Isaaks Opfer und seine damit verbundene Verheißung zu erinnern. Das gilt auch von den in der Nacht des Exodus aus Ägypten anstelle der Erstgeborenen Israels geschlachteten Passalämmer.
Da bereits in 1,14 (siehe oben zu Johannes 1,14cd) auf Isaak angespielt worden ist, bleibt nach Thyen
zu erwägen, ob man – zumal nach der „isaak-typologischen Formulierung“ monogenēs para patros (Lausberg) schon im Prolog (1,14; vgl. 3,16) – in dem Johannes-Wort: ide ho amnos tou theou ho airōn tēn hamartian tou kosmou {Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt}, wegen seiner unüberhörbaren Definition des „Lammes“ durch den bestimmten Artikel nicht eine unmittelbare Anknüpfung an Abrahams Wort aus Gen 22,8 sehen darf: ho theos opsetai heautō probaton eis holokarpōsin {Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer}.
Klaus Wengst geht davon aus (W74), dass der Evangelist die „biblische Wendung vom ‚Tragen der Sünde‘“ aus der „der hebräischen Bibel“ übernimmt, da sie „in der Septuaginta nur zweimal mit dem von Johannes gebrauchten Verb (1. Sam 15,25; 25,28)“ begegnet. Auch ihm zufolge wird damit auf 3. Mose 16,21f. angespielt; und eben so starke Rückbezüge sieht er (W75) zu Jesaja 53 und zur Tradition des Passalamms:
In Jes 53,12 heißt es von dem in diesem Kapitel beschriebenen Knecht Gottes, der leidet und getötet wird, dass er „die Sünde Vieler getragen hat“; und in V. 7 wurde er mit einem Lamm und Schaf verglichen. Dass in Joh 1,29 nicht von einem die Sünden tragenden Bock gesprochen wird, sondern von einem Lamm, ist aber vor allem dadurch bedingt, dass Jesus im Johannesevangelium als endzeitliches Pessachlamm verstanden wird. … Als endzeitliches Pessachlamm trägt Jesus „die Sünde der Welt“, vermittelt er allen Gottes barmherzige Zuwendung.
Unter Rückgriff auf rabbinische Traditionen (Anm. 22) widerlegt Wengst „die oft gemachte Behauptung, ‚eine Sühnefunktion‘ des Pessachblutes sei ‚nicht belegt‘.“
Dass (W75) „der Evangelist in 19,14 die Verurteilung und anschließende Hinrichtung Jesu auf die Zeit der Schlachtung der Pessachlämmer legt und … in 19,33.36 den Bezug auf das Pessachlamm ausdrücklich herstellt“, darf also „nicht beziehungslos zu der Aussage von 1,29 gedacht werden“:
Die niederschmetternde Erfahrung, dass hier ein Unschuldiger in einem Prozessverfahren zum Tode verurteilt und elend hingerichtet wurde, verwandelt sich mit Hilfe dieser biblischen Kategorien in die Aussagen: Er ist der Sündenbock; er ist der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführte Gottesknecht; er ist das endzeitliche Pessachlamm. Damit wird dieses schlimme Geschehen mit Gott zusammengedacht. Dann muss dieses unschuldige Leiden und Sterben anderen zugutekommen. Dann kann prinzipiell niemand davon ausgeschlossen sein.
Mit dem letzteren Satz lässt Wengst durchblicken, dass er das Wort kosmos auch hier auf die gesamte Menschenwelt bezieht, und er verbindet damit eine Warnung:
Das darf aber nicht in das falsche Schema „neutestamentlicher Universalismus gegen alttestamentlich-jüdischen Partikularismus“ gepresst werden. Gerade auch bei der Aussage von der Sühnung kennt die rabbinische Tradition einen Bezug auf die Welt, wenn es von „den Stieren, die verbrannt werden, und den Böcken, die verbrannt werden“, heißt: „zur Sühnung für die Welt“. <113>
Thyen verzichtet in diesem Zusammenhang ganz darauf, das Wort kosmos näher zu erläutern, wie er auch keinerlei Überlegungen darüber anstellt, was denn hier eigentlich genau mit dem Wort hamartia gemeint sein könnte, das er und Wengst ganz traditionell mit „Sünde“ übersetzen. Wengst erwähnt dazu immerhin (W74) im Zusammenhang mit 3. Mose 16,21f. dass nach einer rabbinischen Quelle <114>
der in die Wüste geschickte Bock mit Ausnahme der kultischen Vergehen „die übrigen in der Tora genannten Übertretungen […] sühnt“: „die leichten und die schweren, die absichtlichen und die versehentlichen, bewusst und unbewusst, Gebot und Verbot, mit Ausrottung und Todesstrafe belegt.“
Für Ton Veerkamps <115> Auslegung ist gerade das Verständnis von kosmos und hamartia entscheidend. Bereits „bei der Besprechung von 1,9“ hatte er angedeutet: „Kosmos, ‚Welt‘, ist sowohl Lebensraum der Menschen als auch die gesellschaftliche Ordnung, mit der dieser Raum ausgestattet, ‚geschmückt‘ ist“.
Wie der weltweite Lebensraum der Menschen durch fehlgeleitete Menschen in eine Weltordnung des Todes verwandelt wurde, stellt Veerkamp zufolge „ungefähr am Anfang unserer Zeitrechnung in Alexandrien … ein jüdischer Toragelehrter mit einer gediegenen Ausbildung in griechischer Philosophie“ im apokryphen Buch „Weisheit Salomons“ dar. „Für ihn ist das Wort kosmos deckungsgleich mit dem, was er ktisis nennt; dieses Wort bedeutet für ihn Schöpfung.“
Zu dieser Schöpfung gehört nach Weisheit 1,13-16 (Lutherübersetzung 2017) noch nicht der Tod, der auf das Wirken von asebeis, „Frevlern, widergöttlichen Unrechttätern“, zurückgeführt wird:
Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat kein Gefallen am Untergang der Lebenden; sondern er hat alles geschaffen, dass es Bestand haben sollte; und was in der Welt geschaffen wird, ist heilsam; es ist kein tödliches Gift darin, und das Reich des Todes herrscht nicht auf Erden. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich; aber die Frevler haben den Tod herbeigerufen mit Worten und mit Werken. Denn sie hielten ihn für ihren Freund und sehnten sich nach ihm; sie schlossen mit ihm einen Bund, weil sie es wert sind, ihm anzugehören.
Die widergöttliche Ordnung, die auf solche Frevler zurückgeht, ist nach Weisheit 2,10-11 von Unterdrückung und vom Recht des Stärkeren geprägt:
Lasst uns den Gerechten unterdrücken, der in Armut lebt; lasst uns keine Witwe verschonen; wir wollen uns nicht scheuen vor dem grauen Haar des Greises. Unsere Stärke sei das Gesetz der Gerechtigkeit; denn es zeigt sich, dass Schwäche nichts ausrichtet.
Am Ende des Kapitels 2 wird das, was diese Frevler tun, mit dem diabolos (gängigerweise, aber nicht unbedingt korrekt, in unseren Bibeln, auch bei Luther, mit „Teufel“ übersetzt) als dem Gegenspieler oder „Widersacher“ des Gottes Israels in Verbindung gebracht (2,23-25): <116>
Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Abbild seines eignen Wesens gemacht. Aber durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen, und es müssen ihn erfahren, die ihm angehören.
Veerkamp gibt den mittleren Teil dieser Sätze anders wieder: „Durch den Neid des Widersachers kam der Tod in die Welt“, was mit den Worten umschrieben werden kann: „erhielt die Welt eine Todesordnung“. Mit den Worten hamartēmata nomou, „Verfehlungen der Tora“, bei Luther mit „gegen das Gesetz sündigen“ wiedergegeben, deutet der Vers Weisheit 2,12 an, dass die in diesem Kapitel beschriebene Todesordnung der befreienden und Recht schaffenden Tora Gottes diametral entgegengesetzt ist.
Im Rahmen dieses Verständnisses von einer sehr guten Schöpfung, ktisis, die durch die Verfehlung der befreienden Wegweisung Gottes in eine tödliche Weltordnung verwandelt wurde, ist nach Veerkamp der Vers Johannes 1,29 zu begreifen:
Das Wort hamartia, chataˀ, bedeutet Verfehlung eines Ziels. Die Menschheit wurde nicht „sündig“ geschaffen. Sie verfehlte ihr Ziel und verläuft sich seitdem. Erbsünde ist das nicht, die Menschheit kann auf ihren Weg zurückfinden, wie das Volk Israel der Menschheit vormacht. Die Erbsündetheorie der christlichen Orthodoxie verdeckt die Sicht auf das, was Johannes sagen will. Freilich kann die Menschheit unter den gegebenen Umständen, unter der herrschenden Ordnung der Welt, nur in die falsche Richtung gehen. Die Weltordnung (kosmos) selbst ist die Verirrung. Was also Johannes auf sich zukommen sieht, ist die Aufhebung dieser Weltordnung. Die Menschen können sie von sich aus nicht aufheben. Die Übersetzung: „Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt“, ist nicht falsch; aber sie ist abgegriffen, zumal sie mit dem Wort „Sünde“ die Assoziation eines persönlichen moralischen Defizits weckt. „Verirrung/Sünde“ ist keine anthropologische Kategorie, sie ist keine Eigenschaft einer (gefallenen, sündigen) menschlichen Natur. Das Wort, das wir hier hören, ist eine „kosmologische“, also politische und daher keine ethische Kategorie. Die Weltordnung als solche zerstört nach Johannes und den anderen Messianisten alles Zusammenleben der Menschen und bewirkt alle Perversitäten, allen Verrat, alles Unrecht, das einzelne Menschen aneinander begehen, begehen müssen. Die Zukunft ist nun, dass dies nicht mehr sein wird. Das sieht Johannes.
Die „Sünde“ des einzelnen Menschen ist bei Johannes [dem Evangelisten] immer nur Symptom einer perversen Ordnung, unter der dieser Mensch leben muss; für diese persönliche Verirrung hat er zwar selber die Verantwortung zu übernehmen und kann sie nicht auf eine anonyme Ordnung abschieben. Überwinden kann er sie letztlich nur dann, wenn die Ordnung, deren Ausfluss die persönliche „Sünde“ ist, abgeschafft wird. Kosmos, Weltordnung, Rom, ist für Johannes geradezu eine Obsession. Nirgendwo sonst kommt das Wort so oft vor wie bei ihm. Diese Sicht des Römischen Reiches muss man nicht teilen, aber sie ist die Sicht des Johannes.
Im Übrigen bezieht auch Veerkamp den Vers 1,29 zurück auf Jesaja 53,7.12 und 3. Mose 16,21f. Indem beide Stellen „in diesem Agnus Dei miteinander verbunden“ werden“, geht es „um einen definitiven jom kippur“, einen weltweiten Versöhnungstag:
Weil und indem Jesus auf ihn zukommt, kann Johannes sagen: „Siehe, das Mutterschaf (rachel, amnos) von Gott her, das die Verirrung der Weltordnung aufhebt.“ …
Der Messias ist das Mutterschaf von Jesaja 53 und als Bock von Leviticus 16 trägt er die Verirrungen der Weltordnung weg, hebt sie auf: das bedeutet jenes hebräische naßaˀ, das fast immer durch das griechische airein übersetzt wird. <117> Der Messias trägt nicht nur passiv die Verirrungen, sondern er hebt aktiv die Verirrungen einer ganzen Weltordnung auf. Johannes ändert die Dimensionen; es geht nicht um die „Verirrungen der Söhne Israels“, sondern um die „Verirrungen der Weltordnung, kosmos“.
Auf diese Weise bezieht Veerkamp nicht einfach einen individualethischen Begriff von Sünde auf eine über Israel hinaus erlösungsbedürftige Menschenwelt, für die Jesus den Sühnetod stirbt, sondern er nimmt ernst, dass in den jüdischen Schriften bis in die nicht in den TeNaK aufgenommene Schrift der Weisheit und die messianischen Schriften (die wir das Neue Testament nennen) hinein mit hamartia zuallererst eine Abirrung von der gesellschaftlichen Grundordnung der Tora bezeichnet wird.
↑ Johannes 1,30-33: Taufe mit Wasser und mit Inspiration der Heiligung
1,30 Dieser ist‘s, von dem ich gesagt habe:
Nach mir kommt ein Mann,
der vor mir gewesen ist,
denn er war eher als ich.
1,31 Und ich kannte ihn nicht.
Aber damit er offenbar werde für Israel,
darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser.
1,32 Und Johannes bezeugte es und sprach:
Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel
und blieb auf ihm.
1,33 Und ich kannte ihn nicht.
Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser,
der sprach zu mir:
Auf welchen du siehst den Geist herabfahren
und auf ihm bleiben,
der ist‘s, der mit dem Heiligen Geist tauft.
[24. März 2022] Der Vers 30 ist eine nicht ganz wörtliche Wiederholung von Vers 15, wobei Hartwig Thyen (T123) „allein in dem prologtypischen ēn {war} des ersteren gegenüber dem narrativ bedingten estin {ist} des zweiten“ einen den Sinn betreffenden Unterschied erkennt. Mit anderen Worten:
Im Prolog ist Johannes der in dessen feste Buchstaben geronnene und darin bleibende und so stets gegenwärtige Zeuge …, in 1,30 dagegen verweist das houtos estin {dieser ist es} auf den, der gerade jetzt zu ihm kommt.
Weiter erwägt Thyen (T124), ob das hier verwendete Wort anēr, „Mann“, statt anthrōpos, „Mensch“, das in 1,6 für Johannes gestanden hatte, vielleicht den Unterschied zwischen Johannes als einem Menschen „und Jesus als dem fleischgewordenen Wort Gottes markieren“ soll. Die Formulierung emprosthen mou gegonen wird in Thyens Augen von Bauer <118> „treffend mit ‚ist mir zuvorgekommen‘ übersetzt“, was „mit dem präexistenten Sein Jesu, ‚weil er eher war als ich‘,“ begründet wird.
Klaus Wengst zufolge deutet der Evangelist (W76) mit der wiederholten Aussage, „dass der Kommende, insofern ‚das Wort‘ in ihm ‚Fleisch wurde‘, ‚eher war‘,“ an, „dass sich Gott von diesem Tod betreffen lässt, hier selbst begegnet.“ Er versteht dieses „‚eher als‘ Johannes“, wie gesagt, nicht im Sinne einer Präexistenz Jesu, sondern so, (Anm. 25), dass „Gott in ihm so wirkmächtig spricht, wie er am Beginn der Schöpfung gesprochen hat.“
Ton Veerkamp <119> macht nochmals deutlich, dass es „weder hier noch in 1,15 darum“ geht, „wer zeitlich eher war, sondern wer das Prinzip, wer der Erste ist.“
„Mein Erster ist er“, sagt Johannes [der Täufer]. Natürlich kann man übersetzen: „Er war eher als ich.“ Den Mitgliedern der Gruppe, die sich von Johannes herleitet, wird gesagt: Der Messias ist Hintergrund und Zukunft des Täufers und nicht umgekehrt, er ist für Johannes das Prinzip seines Lebens. … Die „Geschichte“ des Messias kommt vor Johannes eigener „Geschichte“, sie bestimmt seine Geschichte ganz gar, er will nichts anderes als Rufender jenes Messias sein, der „einen Weg in der Wüste bahnen“ wird.
Was das konkret bedeutet, hat möglicherweise sehr direkt mit dem zwei Mal wortwörtlich wiederholten Satz des Täufers (Vers 31 und 33) kagō ouk ēdein auton, „und ich kannte ihn nicht“, zu tun. Der, den nicht einmal er kannte, muss von ihm bekannt gemacht werden:
Sein ganzes Leben diente nur der „Veröffentlichung“ des Messias; was er tut, dient nur dazu, dass Jesus für Israel zu einem öffentlichen Phänomen (phanerōthē) wird. „Offenbaren“ übersetzt man meistens. Hier klingt das Programm des Messias an: Seine bündige Zusammenfassung ist eben „Israel offenbar werden“.
Während Thyen (T124) nur kurz erwähnt, dass es Israel ist, dem die offenbarende Tätigkeit des Täufers gilt, wie auch „Jesus primär zu den ‚Seinen‘, nämlich zu Israel, gekommen ist (1,11)“, geht Wengst (W76) ausführlich auf diesen Punkt ein:
Adressat des Jesus offenbar machenden Handelns ist „Israel“. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, ist jemand, der einen sehr konkreten und nicht beliebigen Ort in dieser Welt hat: Er ist Jude in Israel.
An allen vier Stellen im Johannesevangelium, wo der „Begriff ‚Israel‘ begegnet“, wird von Israel
positiv geredet, nicht in einem übertragenen Sinn und nicht eingeschränkt auf Jesusanhänger. Das steht im Kontrast zur überwiegend negativen Darstellung „der Juden“. Letzteres streicht ersteres nicht aus. Es ist vielmehr zu betonen, dass Johannes trotz der bedrängenden Erfahrungen, die die weithin negative Redeweise von „den Juden“ bedingen, an einem positiven Gebrauch des Begriffs „Israel“ festhält – und damit die Juden meint. <120> Er ist ein jüdischer Autor, der eine primäre Bedeutung Jesu für Israel formuliert.
In Frage stelle ich allerdings, was Wengst sofort hinzufügt:
Erst von seinem heilvollen Tod her kommen andere in den Blick. So heißt es in 11,51f. hinsichtlich des Ausspruchs des Hohenpriesters vom Sterben Jesu für das Volk weiter: „und nicht nur für das Volk, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenbrächte“.
Es wird an der entsprechenden Stelle zu klären sein, ob wirklich schon der Evangelist Johannes mit den zerstreuten Kindern Gottes eine generelle Heidenmission in den Blick nimmt oder nicht in erster Linie die Juden aus der Diaspora meint, um zunächst einmal ganz Israel in der messianischen Gemeinde zu sammeln.
Trotzdem ist Wengst in seinen Schlussfolgerungen für eine „Völkerkirche“, die sich bereits seit dem 2. Jahrhundert als legitime Adressatin des Johannesevangeliums sieht, voll und ganz zuzustimmen:
Eine zur Völkerkirche gewordene Kirche, die endlich die Einsicht in die bleibende Erwählung Israels wiedergewonnen hat und die Treue Gottes zu seinem Volk Israel und die Treue dieses Volkes zu seinem Gott respektvoll wahrnimmt, wird das nicht als Argument für Judenmission aufnehmen können, aber entschieden das Judesein Jesu und seinen Ort in Israel festhalten. Für uns Menschen aus den Völkern, die wir durch Jesus zum Gott Israels gekommen sind, ergibt sich als Konsequenz aus seinem Judesein, seine leiblichen Geschwister als Zeugen Gottes wahrzunehmen.
Zurück zu Johannes dem Täufer. Zum zweiten Mal nach Vers 26 sagt er in Vers 31, dass er en hydati, „in Wasser“, tauft. Und „als einzigen Zweck des Taufens“ gibt er an, „den bisher noch Unbekannten bekannt zu machen.“ In den beiden Versen 32-33 folgt
die johanneische Fassung der Taufgeschichte Jesu – die hier gar keine Taufgeschichte ist. Vielmehr wird erzählerisch ausgeführt, was Johannes bereits als Zweck seines Taufens in Wasser bezeichnete. Dass er Jesus getauft hat, wird nicht einmal erwähnt. Der Evangelist setzt die Tradition von der Taufe Jesu voraus und lässt Johannes aus ihr bestimmte Elemente in seiner Rede aufnehmen.
Inhaltlich beschränkt sich Wengst bei der Deutung der Vision vom Herabsteigen des Geistes in Gestalt einer Taube auf die folgenden Sätze:
Dass die Geisteskraft in Gestalt einer Taube auf Jesus herabsteigt, ist hier bloßes Erkennungszeichen für Johannes, wen er als den Kommenden zu bezeugen habe. Von ihm sagt er jetzt, dass er „mit heiliger Geisteskraft tauft“. Johannes ist nichts als Zeuge für den, der die endzeitliche Gabe der Geisteskraft vermittelt.
Für Thyen ist klar (T124), dass die Verse 32-33 auf dem Taufbericht der synoptischen Evangelien aufbauen und dass „die Taufe Jesu durch Johannes im vierten Evangelium nicht unterschlagen, sondern nur anders akzentuiert“ wird:
Nur als er Jesus mit Wasser taufte, kann Johannes nach V. 33 gesehen und seitdem ständig vor Augen haben (tetheamai), wie der Geist, einer Taube gleich, vom Himmel herabschwebte und auf Jesus blieb.
Es ist vor allem dieses besonders betonte „Bleiben des Geistes auf Jesus“, in Vers 32 und 33 zwei Mal durch das Wort menein, „bleiben“, ausgedrückt, was bei Johannes gegenüber den synoptischen Texten zur Taufe Jesu eine „neue Information“ darstellt und womit er „gewiß nicht zufällig an das anapausetai ep‘ auton pneuma tou theou von Jes 11,2 {auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN} (vgl. 42,1)“ erinnert.
Und indem der Täufer in Vers 33 zum dritten Mal sein Taufen „mit Wasser“ erwähnt und diesem erst jetzt denjenigen gegenüberstellt, „der kraft des bleibend auf ihm ruhenden göttlichen Geistes mit dem heiligen Geist taufen wird“, wird wieder etwas vom „intertextuellen Spiel“ des Johannes (T125) mit dem Markusevangelium sichtbar, denn jetzt wird auch der zweite Teil des Wortes Markus 1,8 aufgenommen, das er der Befragungskommission aus Jerusalem vorenthalten hat.
Damit sind Wengst und Thyen mit ihrer Auslegung der Verse 32-33 fertig. Was mit dem Herabschweben des Geistes, einer Taube gleich, vom Himmel herab gemeint sein könnte, darauf bleiben beide eine genauere, konkrete Antwort schuldig.
Ton Veerkamp <121> allerdings fängt jetzt erst richtig mit seiner Auslegung an. Er interessiert sich dafür, worauf sich die uns allzu vertrauten und doch schwer fassbaren Worte „Geist“, „Himmel“, „Taube“, „heilig“ in der Vision Johannes des Täufers beziehen:
Nachdem die plötzliche Konfrontation mit Jesus sein ganzes früheres Wissen erschüttert hat – „ich hatte kein Wissen von ihm“ -, stellt Johannes seine Vision vor. Das Verb, das hier verwendet wird, hat mit Zuschauen (tetheamai, theasthai vgl. „Theater“) zu tun: Zuschauen, was geschehen wird, eine Vision haben.
Zunächst geht Veerkamp intensiv auf die Worte pneuma, „Geist“, und ouranos, „Himmel“, ein:
„Die Inspiration steigt ab wie eine Taube vom Himmel.“ Wir vermeiden das Wort „Geist“, weil wir dann viel zu verdinglicht denken. Diese Inspiration wird sowohl griechisch wie hebräisch umschrieben mit einem Wort {pneuma}, das mit „blasen, wehen, Wind“ zu tun hat. Es setzt die Menschen in Bewegung, es macht sie „bewegt, inspiriert“. Die Inspiration kommt vom Himmel. Der Himmel ist Nicht-Erde: „Der Himmel ist Himmel für IHN, den NAMEN, die Erde gab er den Menschenkindern“, Psalm 115,16. Der NAME ist nach Exodus 20,2 „der Hinausführende aus dem Haus des Sklaventums“, moschiaˁ jißraˀel, der Befreier Israels (Jesaja 43,3 usw.) Dieser Befreier steht der Erde und ihren Bewohnern absolut gegenüber, wie der Himmel der Erde. Aus diesem Bereich kommt die Inspiration, der Himmel „inspiriert“ Israel, und der Himmel ist für Israel der Befreier und nicht das Transzendente, das Numinose.
Hier wird ein Gottesbild deutlich, das manche Leserin, manchen Leser beunruhigen mag. Will Veerkamp tatsächlich aus Gott einen reinen Funktionsbegriff machen, hat der Gott Israel lediglich die Funktion, für gesellschaftliche Befreiung und Recht zu sorgen? Tatsächlich konzentriert sich in seinen Augen alles, was im TeNaK über Gott ausgesagt wird, auf genau dieses Ziel.
Meine Haltung in dieser Frage ist insofern ein wenig anders, als ich Veerkamps Unbehagen gegenüber dem Transzendenten nicht teile. Ich halte es für undenkbar, dass sich die auf Gott vertrauenden Israeliten den befreienden NAMEN nicht doch als transzendente, unsichtbare und persönlich ansprechbare Macht vorgestellt haben, mit der man reden, zu der man beten kann. Trotzdem fasziniert mich die Möglichkeit, die Veerkamp hier ins Auge fasst, dass man vielleicht auch als religiös völlig unmusikalischer Mensch <122> den Gott Israels als ein „Gegenüber denken kann, ohne eine metaphysische Transzendenz bemühen zu müssen“. Es mag also durchaus sein, dass man sowohl als religiös musikalischer wie auch unmusikalischer Mensch sich davon beeindrucken lassen kann, wie konsequent der biblische Gott seine Ehre mit dem Leben Israels in Freiheit, Recht und Frieden verbindet.
Wie auch immer man also zu der Möglichkeit eines persönlichen, religiösen Gottesverhältnisses steht: Der biblische Gott macht sich durchgehend bekannt durch seinen befreienden NAMEN! Das unterscheidet ihn von jeglichem obersten Willkürgott, den menschliche Machthaber zur Legitimation und Aufrechterhaltung ihrer unterdrückenden und ausbeutenden Herrschaft benutzen: <123>
Freiheit ist das, was das Herrschende radikal aufhebt, sich nirgendwo aus ihm ableiten lässt. Es ist das Nihil {Nichts} der real existierenden Ordnung, ihres Prinzips (archōn tou kosmou {wörtlich: Fürst der Welt}): Mit dem Messias hat es nichts (zu tun), wie wir in Johannes 14,30 hören werden. Der befreiende NAME kommt als Inspiration auf Jesus, und das heißt: alles was Jesus sagen und tun wird, „atmet“ (spirat) Befreiung. Der Messias Jesus (SOHN) ist die Inspiration (GEIST) durch den Befreier, den NAMEN (bei Johannes VATER). Von da aus kann man die bis zur Unkenntlichkeit abgegriffene Formel Vater, Sohn, Heiliger Geist denken: das schaut Johannes [der Täufer].
Damit ist Veerkamps Auslegung von Johannes 1,32-33 noch nicht am Ende, denn die Vision des Täufers wird „nicht nur mit dem Bild eines Windes, sondern auch mit dem Bild der Taube wiedergegeben. Beide kennen wir aus der Fluterzählung sehr gut“. In 1. Mose 8,1 ist davon die Rede, dass Gott „Noahs und aller Lebewesen, allen Viehzeugs, das mit ihm im Kasten war“, gedenkt. Dann lässt er „einen Windbraus (ruach, pneuma) über die Erde fahren, die Gewässer duckten sich.“ Im Anschluss daran sendet Noah drei Mal „die Taube von sich weg, damit sie sehe, ob das Wasser auf der Fläche des Erdbodens weniger geworden war“:
Die Taube in der Vision ist das Zeichen für die Bewohnbarkeit der Erde. Diese Vorstellung war in messianischen Kreisen offenbar verbreitet. Markus verwendet sie in seinem Prolog (1,10), Matthäus und Lukas übernahmen sie. Wenn die Inspiration die Gestalt einer Taube hat, dann ist sie vom Himmel her die Gewähr dafür, dass die Zeiten der Zerstörung der Erde einem Ende entgegen gehen und die Zeiten der Erde als Wohnort für Menschen anfangen. Man muss bei der Auslegung von Johannes 1,29ff. diesen Teil der Flutgeschichte laut vorlesen, um den Zusammenhang herauszuhören. Diese Vision ist allen Evangelien gemeinsam. Die Vision ist ein Midrasch von Genesis 8. Jeder Midrasch ist eine Anwendung eines Schriftfragments auf die neue Lage, in der die Menschen leben. Was kommt, ist ein neues Leben für die Menschen, auf einer erneuerten Erde.
Schließlich bleibt noch das Wort hagios, „heilig“, auszulegen. Was Thyen traditionell (T118) mit „dem Heiligen Geist“ und Wengst (W74) mit „heiliger Geisteskraft“ übersetzt, gibt Veerkamp mit „Inspiration der Heiligung“ wieder:
Der Messias Jesus wird „mit Inspiration der Heiligung“ (und mit Feuer, fügen einige Handschriften hinzu) taufen. Auch das verstehen wir nur, wenn wir die Schrift Israels befragen. Es heißt: „Ihr sollt heilig werden, denn heilig bin ich, der NAME, euer Gott“, Leviticus 19,2. Im dritten Teil des dritten Buches der Tora, wajiqraˀ (Leviticus), der in Kapitel 18 beginnt, wird der Gott Israels einmal „der Heilige“ (qadosch) genannt und siebenmal aktiv-kausativ: „Der heilig macht“ (meqadisch). In Leviticus 20,7f. hören wir:
Heiligt euch und werdet zu Heiligen,
denn ICH BIN ES, der NAME, euer Gott.
Ihr sollt meine Gesetze wahren, sie tun,
ICH BIN ES, der NAME, der euch heilig macht.Dieses aktive „Heiligen“ ist das, was mit „Inspiration der Heiligung“ gemeint ist. Für Israel war es die Befähigung, die Tora leben zu können. Die Frage ist, ob Johannes die gleiche Tora meint. Keine Frage ist, ob Johannes den gleichen Gott und die gleiche Inspiration meint, die die Propheten Israels antrieb. Für ihn ist maßgeblich, was in der Vokabel Gott an gesellschaftlicher Vision steckt. Der Inhalt der Vision des Johannes ist die bleibende Inspiration vom Himmel, also vom NAMEN, her. Sie ist für immer mit Jesus verbunden.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wie sparsam Johannes das Wort hagios verwendet. Außer in 1,33 taucht es nur vier Mal im Evangelium auf, allerdings jeweils an entscheidenden Stellen:
- im Bekenntnis des Petrus zu Jesus als dem hagios tou theou, dem „Heiligen Gottes“ (6,69),
- für den paraklētos, to pneuma to hagion, also den „Parakleten, den heiligen Geist“ (14,26),
- in der Gebetsanrede Gottes durch Jesus als „heiliger Vater“, pater hagie,
- und bei der Belebung der Schüler durch den Empfang des pneuma hagion von Jesus, der zum VATER aufsteigt (20,22).
Hinzu kommt vier Mal das Wort hagiazein, „heiligen“, mit dem Jesus einerseits von seiner eigenen Heiligung durch den VATER und durch sich selbst spricht (10,36 und 17,19) und andererseits von der Heiligung derer, die auf ihn vertrauen (17,17 und nochmals 17,19). Diese Heiligung, die in engem Zusammenhang mit der Treue, alētheia, dieses VATERS gesehen wird, wird nur von der Tora über die Heiligung im 3. Buch Mose her verstanden werden können, auf die Veerkamp hier hinweist.
↑ Johannes 1,34: Der Sohn Gottes – einer wie Gott!
1,34 Und ich habe es gesehen und bezeugt:
Dieser ist Gottes Sohn.
[25. März 2022] Was (W76) in der synoptischen Tauftradition „von ‚einer Stimme aus dem Himmel‘ gesprochen wird“, das hat dem Evangelisten Johannes zufolge der Täufer gesehen und bezeugt: „Der ist der Sohn Gottes.“ In dieser Bezeichnung, die in 20,31 „parallel neben der Bezeichnung Jesu als des ‚Gesalbten‘“ steht, „um die im Evangelium heftig gestritten wird“, sieht Wengst (W77)
keine seinsmäßige Wesensbestimmung Jesu, sondern eine Funktionsbezeichnung im Rahmen der königlichen Messiaserwartung. Er ist endzeitlicher Beauftragter Gottes.
Mit dieser Einschätzung, zu der sich Wengst (Anm. 28) u. a. auf Psalm 2,7 beruft und auf die sich seine Beschäftigung mit dem Gottessohntitel an dieser Stelle beschränkt, wendet er sich ausdrücklich gegen Thyens Behauptung (T126), „der bloße Titel ho christos {der Gesalbte}“ erscheine dem Evangelisten
inadäquat und präzisierungsbedürftig […]. Es muß hinzugefügt werden, daß dieser Messias in einem ganz bestimmten und schlechthin analogielosen Sinne der Sohn Gottes ist.
Die Frage, was Thyen mit dieser völligen Unvergleichbarkeit von Jesu Gottessohnschaft meint, ist allerdings nicht leicht zu beantworten, zumal ihr Sinn, wie er selbst sagt, sich erst „im Laufe unserer Lektüre zeigen und … erst im Licht des Ostermorgens vollends deutlich werden“ wird. Einige Überlegungen dazu stellt Thyen aber bereits an dieser Stelle an. Sie sind deswegen besonders interessant, weil auch er nicht in der Weise missverstanden werden will, als würde er Jesus ein göttliches Wesen oder Sein zusprechen (das ist das, was er in den folgenden Zitaten mit „Ontologie“, einer Lehre des „Seins“, griechisch ōn, meint).
Thyen geht davon aus, dass in Äußerungen des johanneischen Jesus über sich und seinen himmlischen Vater „fraglos die Sprache des Mythos laut“ wird. Diese Sprache ist jedoch (T126f.)
die Sprache eines durch die Transzendenzerfahrung der monotheistischen Offenbarungsreligion gebrochenen Mythos. Denn Israels Glaube an den einen Gott hat zwischen den Bereichen des Göttlichen und des Weltlichen und Menschlichen eine unüberwindbare Barriere errichtet und damit das traumhafte Stadium einer mythischen Einheit von Göttern und Menschen ein für alle Mal gesprengt und so allen Formen einer Onto-Theologie den Boden entzogen… Man könnte auch sagen, die jüdisch-christliche Transzendenzerfahrung habe den fiktiven Charakter aller Mythen ans Licht gebracht. Darauf beruht ja auch der wiederholte Blasphemie-Vorwurf der Juden gegen Jesus in unserem Evangelium.
Gegen diesen jüdischen Vorwurf darf man Thyen zufolge (T127) nicht einfach erklären,
die Juden mißverstünden Jesus insofern, als sie ihm unterstellten, er wolle sich zu etwas erst machen, was er doch von Ewigkeit her schon ist, nämlich theos {Gott} (1,1). Denn es darf nicht im Unklaren bleiben, daß die Kopula „ist“ in dem Satz „Jesus ist Gott“ nicht auf die Ontologie zurückgeführt werden darf. Sie gehört vielmehr dem Sagen der Transzendenzerfahrung des Glaubens an und darf sich keinesfalls „in jenes Abenteuer mit hineinreißen (lassen), welches von Aristoteles bis Heidegger die Theologie durchlaufen hat; die Theologie, die Identitäts- und Seinsdenken geblieben ist und die tödlich wurde für Gott und den Menschen der Bibel oder für das, was man so genannt hat. …
Doch noch nach seinem Zerbrechen durch die monotheistische Offenbarung ist der als fiktional durchschaute und zum symbolischen Modus von Texten gewordene Mythos keineswegs stumm und überflüssig geworden. Vielmehr bleibt er … ein unersetzliches poetisches Sprachspiel. In dem, was er ausspricht, zeigt sich die unaussprechliche Antwort auf die Sinndefizite der Welt und des Lebens.
Wenn ich Thyen richtig verstehe (T128), dann versucht er, von der johanneischen Verwendung des Wortes sēmeion, „Zeichen“, her das Johannesevangelium symbolisch zu begreifen: <124>
Jesus vollbringt nicht nur solche zeigenden sēmeia, sondern er ist das sēmeion Gottes in Person und Werk: „Wer mich sieht, der sieht den Vater“ (14,9). Auch die Prädikation dieses Mannes aus Nazaret, „dessen Vater und Mutter wir doch kennen“ (6,42), als hyios tou theou {Sohn Gottes} hat den Modus eines sēmeion.
Vielleicht tue ich Thyen Unrecht, aber mir kommt es so vor, als wolle er die Quadratur des Kreises vollbringen, indem er versucht,
das unaufgebbare Sachanliegen des Symbols von Chalcedon bewahren, ohne dessen dyophysitischer Ontologisierung {seinsmäßige Substanzbestimmung} zweier Naturen Christi zustimmen zu müssen. Denn asynchytōs und atreptōs, sowie adiairetōs und achōristōs {unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar} fallen sie im Symbol zusammen, die beiden Aspekte Jesu Christi, nämlich das Sichtbare und Sagbare dieses Menschen und in, mit und unter diesem zugleich das Unsichtbare und Unsagbare, für das er das sēmeion ist, das allein der Glaube wahrnimmt.
Noch problematischer erscheint mir teilweise Thyens Abgrenzung von Gottessohnvorstellungen, die Johannes ihm zufolge keinesfalls gemeint haben kann. Er schreibt, dass Jesus weder einer von „den gefeierten heroischen Göttersöhnen der Antike“ ist noch wird er „wie die Pharaonen Ägyptens oder die Könige Israels“ als Gottes Sohn bezeichnet.
Aber kann es im Sinne des Johannes sein, die Pharaonen Ägyptens und die Könige Israels ohne Weiteres nebeneinanderzustellen? Zwar weiß die jüdische Bibel, dass kaum ein König Israels tat, „was dem HERRN wohlgefiel“, also was das in den Augen des NAMENS Gerade war (vgl. zum Beispiel 2. Könige 2,22), aber trotzdem ist der König Israels vom NAMEN dazu bestimmt (Psalm 2,7), als der von ihm gezeugte Sohn für die Durchsetzung seiner befreienden Wegweisung einzustehen, was besonders in Psalm 72 deutlich wird. Es sollte also nicht vorschnell darauf verzichtet werden, Jesu Gottessohnschaft auch vom biblischen Blick auf den König Israels her, wie er nach Gottes Willen handeln sollte, zu begreifen.
Thyen legt dagegen großen Wert darauf, Jesus „als den Einzigen vom Vater (monogenēs para patros) und als den Präexistenten“ zu betrachten und eben nicht (T126) „aus dem ewigen Sohn einen in der Zeit Gezeugten“ zu machen. Ich denke ja (wie auch Wengst und Veerkamp), dass er damit doch bereits christliche Theologie mit griechisch-philosophischen Denkvoraussetzungen in Johannes hineinliest, zumal man Jesus nur insofern „den Einzigen vom Vater“ nennen kann, als er den Einzigen Sohn der jüdischen Schriften, nämlich Isaak (und mit ihm das Volk Israel als erstgeborenen Sohn Gottes, 2. Mose 4,22) repräsentiert.
Thyen sind solche Zusammenhänge nicht grundsätzlich fremd (T128), denn er weiß ja vom Bezug des monogenēs, des „Einzigen“, auf Isaak, wie im letzten Satz dieses Abschnitts deutlich wird:
Dürfen wir das eine symbolische Inversion der Tradition von Isaaks Bindung nennen, weil hier nicht ein Mensch seine grenzenlose Liebe zu Gott dadurch erweist, daß er ihm sein Liebstes opfert, sondern weil hier umgekehrt das absolut Unglaubliche geschieht, daß Gott seine Liebe zur Welt – zu einer nur auf das Ihre bedachten und in Feindschaft gegen ihn lebenden Welt – durch die Hingabe seines Liebsten erweist (vgl. 3,16)?
Machen wir uns klar, was Thyen hier tut:
Er nimmt nicht etwa ernst, dass Jesus diesen Isaak verkörpert und mit ihm das im Judäischen Krieg zu Tausenden gekreuzigte Volk Israel. Dann könnte er weiter ebenso klar sehen, dass Jesus eben als dieser zweite Isaak nun auch derjenige ist, der den NAMEN des Gottes Israels verkörpert und insofern sein Sohn genannt werden darf. Im ermordeten Israel, repräsentiert durch seinen Messias, gibt sich Gott selber hin, um seinem Volk im Leben der kommenden Weltzeit Befreiung, Recht und Frieden zu schaffen.
Stattdessen meint Thyen offenbar, dass der Gott Israels in Jesus eine Kehrtwendung anderer Art vollzieht. Er fordert nicht mehr ein übermenschliches Opfer von einem Menschen, wie er es von Abraham gefordert hat, vielmehr gibt er selber seinen einzigen Sohn in Feindesliebe gegenüber der ihn ablehnenden Welt hin. Das klingt nach der alten Sichtweise einer Überlegenheit des christlich liebenden Vatergottes gegenüber einem jüdischen Gesetzesgott, der unerbittlich die Einhaltung des 1. Gebotes fordert. Doch auch wenn solche Anklänge nicht in Thyens Absicht liegen, bleibt jedenfalls Israel als Adressat der bleibenden Treue Gottes bei ihm außer Acht.
Zu dieser Problematik schreibt Ton Veerkamp: <125>
Wer die traditionelle Übersetzung: „Dieser ist der Sohn Gottes“ liest, denkt die ganze christliche Dogmatik von Nicäa über Chalcedon nach Konstantinopel mit, die Orte, wo das Dogma über Jesus Christus ausformuliert wurde.
Veerkamp selber wählt an dieser Stelle daher eine provokative Übersetzung der Worte des Johannes: „Und ich habe gesehen und habe bezeugt: Der ist es, Einer wie Gott!“ Dazu erläutert er, was im semitischen Sprachraum mit dem Wort „Sohn“ gemeint ist:
Das Wort „Sohn“, das hebräische ben, bedeutet „leiblicher Sohn“. Er ist als Sohn derjenige, der dem Namen seines Vaters Beständigkeit gibt, er setzt die Lebensaufgabe des Vaters fort. Als Sohn handelt er wie der Vater. Semitische Namen geben diese Beziehung als Substanz des Namens wieder: Simon ist bar Iōna oder ben Jochanan, der von den Briten eingesetzte König des Wüstenöllands Arabien hieß Ibn Saud, Sohn Sauds, der Saude, einer der Familie Saud. Die arabische Halbinsel ist daher Familienbesitz, Saudi-Arabien. Jesus wurde in den synoptischen Evangelien „Sohn Davids“ genannt, also einer aus der Familie David, also einer, der die Lebensaufgabe Davids und seiner Nachkommen fortsetzen muss. Johannes sieht Jesus kurz und bündig als einen „wie (der) Gott (Israels)“, also der, der das tut, nur das und nichts anderes als das, was der Gott Israels für Israel tut. Mit „Wesensgleichheit“ zwischen Gott und Jesus hat das hier nichts zu tun.
Damit stimmen Wengst und Veerkamp am deutlichsten darin überein, die Gottessohnschaft Jesu im Johannesevangelium von der jüdischen Bibel her zu begreifen. Auch Thyen will zwar von einer „Wesensgleichheit“ Jesu mit Gott nichts wissen, tendiert aber doch dazu, schon bei Johannes ein Verständnis Jesu als des Sohnes Gottes im Sinne der späteren christlichen Dogmatik vorauszusetzen.
↑ Johannes 1,35-39: Dritter Tag – die ersten beiden Schüler Jesu
1,35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals da
und zwei seiner Jünger;
1,36 und als er Jesus vorübergehen sah,
sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm!
1,37 Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.
1,38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen
und sprach zu ihnen: Was sucht ihr?
Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –,
wo wirst du bleiben?
1,39 Er sprach zu ihnen: Kommt und seht!
Sie kamen und sahen‘s und blieben diesen Tag bei ihm.
Es war aber um die zehnte Stunde.
[26. März 2022] Zu den beiden Jüngern oder Schülern, mathētai, des Johannes, die in Vers 35 unvermittelt erwähnt werden, merkt Thyen an (T129), dass erneut ein Vorwissen der Leser darüber vorausgesetzt wird, „daß es ‚Jünger‘ des Johannes gibt“. Die halbe Wiederholung des Wortes vom Lamm Gottes soll ihm zufolge „vielleicht auch die Johannes-Jünger als Ohrenzeugen von 1,29-34 vorstellen.“ Wengst (W77) betont, dass die Wiederholung „die Bedeutsamkeit dieses Wortes, das Gewicht, das es im Evangelium hat“, unterstreichen soll.
Weder Thyen noch Wengst gehen näher auf das Wort peripatein in Vers 36 ein, mit dem dargestellt wird, bei welcher Tätigkeit Johannes Jesus an diesem Tag erblickt. Wengst übersetzt: „wie er da herging“, Thyen: als er ihn „vorübergehen“ sah. Veerkamp <126> macht darauf aufmerksam, dass dieses Wort in seiner inhaltlichen Füllung ernstgenommen werden muss, um den Text von vornherein angemessen zu verstehen:
Peripatein bedeutet nicht einfach „gehen, wandeln“, sondern einen ganz bestimmten „Lebenswandel, Lebensgang“. Halakha, „Gang“, ist bei den Juden ein Lebensgang nach den Weisungen der Tora und der mündlichen Überlieferungen. Es ist dieser Gang Jesu, der Menschen auf ihn aufmerksam machte. Johannes sieht Jesus nicht spazieren, sondern eben jenen Gang von Jesaja 53 gehen. Deswegen „den Gang gehen“.
Von daher leuchtet auch unmittelbar ein, warum die Bezeichnung „Mutterschaf von Gott her“ wiederholt wird:
Genau das ist der Lebensgang Jesu, er muss leben, wie die Bilder aus Jesaja 55 und Leviticus 16 andeuten. Johannes braucht nicht weiter zu reden, die Schüler wissen Bescheid. Wenn sie das Wort hören, folgen sie Jesus.
In Vers 38 gibt es noch ein Wort, auf das Wengst gar nicht eingeht und das Thyen (T129) nur ganz knapp als „Geste der Zuwendung“ Jesu bezeichnet: strephein, „sich umwenden“. Veerkamp deutet dieses Wort vom hebräischen Wort schuv, „umkehren“ her und nimmt wahr, dass erstaunlicherweise zwar die Schüler des Johannes, als sie hören, wie er redet, Jesus folgen, aber von ihrer Umkehr oder Bekehrung zu Jesus ist nicht die Rede:
Sie bekehren sich nicht zu Jesus, indem sie die Gruppe des Johannes verlassen und sich der Gruppe Jesu anschließen. Vielmehr bekehrt sich Jesus zu den Schülern. Das Wort strephein, schuv, hier hat immer mit jenem „Umkehren“ zu tun, das Gottes beständige Zuwendung zu Israel beschreibt. „Gott“ ist der, dem die Menschen in Israel nachgehen müssen; „Gott“ ist das, was unter allen Loyalitäten von Menschen seinen Konvergenzpunkt findet. Nachgehen oder Folgen „Gottes“ ist Wissen, um was es in der Gesellschaft letztendlich gehen muss. Die Bekehrung Gottes ist die Voraussetzung der Bekehrung der Menschen und nicht umgekehrt.
Eine solche Bekehrung Gottes zu seinem Volk war Veerkamp zufolge notwendig geworden, als die unter Esra und Nehemia unter persischer Oberherrschaft gegründete und von Priestern geführte Torarepublik unter den Bedingungen des hellenistischen Siegeszuges durch Alexander den Großen und seine Nachfolgereiche in die Versuchung geriet, sich Gott nach dem Muster olympischer Willkürgötter vorzustellen, der mit Völkern wie Israel oder Menschen wie Hiob aus seiner Allmacht heraus umspringen darf, wie er eben will. Was Veerkamp darüber in seinem Buch „Autonomie und Egalität“ <127> herausgefunden hatte, das fasst er hier kurz folgendermaßen zusammen:
Das ist die Lektion des Buches Hiob, „Gott“ bekehrt sich von seiner dämonischen, hellenistischen Verfremdung (Hiob 1-2) zu sich selbst als Befreier Israels (Hiob 42,7ff.), anders gesagt: „Gott“ steht „wieder“ (schuv!) für eine Ordnung, die die Menschen Israels unter den Bedingungen von Autonomie und Egalität leben lässt, statt sie einer tyrannischen Ordnung zu unterwerfen. Jesus, der „wie Gott“, kehrt sich um zu ihnen und schaut zu, wie sie folgen (wieder das Wort, das für unser „Theater“ Pate stand).
Ein weiteres Wort, nämlich das erste, das Jesus überhaupt im Johannesevangelium spricht, übergeht Wengst (W78) ebenfalls sehr knapp, indem er Jesu Frage an die beiden Johannesjünger: „Was sucht ihr?“ mit „Wonach verlangt ihr?“ umschreibt und sich dann ausschließlich der Gegenfrage der beiden zuwendet, „wo er seine Bleibe habe“.
Auch Thyen (T129) geht zwar darauf ein, dass in dieser „vordergründigen Frage nach Jesu Wohnort doch gewiß schon die Suche nach einer unvergänglichen Bleibe“ mitschwingt, aber warum Jesus überhaupt ti zēteite?, „was sucht ihr?“, gefragt hat, findet er offenbar nicht erwägenswert.
Anders Ton Veerkamp. Er denkt, dass die beiden Johannesjünger in Jesu Augen „ganz Israel“ repräsentieren, und kommt von daher dem Sinn dieser so pointiert von Jesus gestellten Frage auf die Spur:
Was Israel suchen muss, ist immer das, was in Israel „Gott“ heißt, und zwar „mit ganzem Herzen und mit der ganzen Seele“ (Deuteronomium 4,29; 6,5 usw.). Ganz Israel war auf der Suche nach dem „Gott“, der der verzweifelten Lage des Volkes ein Ende bereiten sollte, nach dem Messias. Ganz Israel wartete nach Johannes darauf, dass sich endlich etwas wirklich ändert, und zwar definitiv. „Was sucht ihr?“ Er weiß, was sie suchen, sie wissen, was sie suchen.
Insgesamt 34mal kommt das Verb „suchen“ im Johannesevangelium vor. „Suchen ist ein Lebensziel, es bedeutet so etwas wie streben.“ Während Jesu Lebensziel der „Wille Gottes“ ist, wird „den Judäern vorgeworden, genau ihn nicht zu suchen“; stattdessen suchen sie Jesus, um ihn „festzunehmen bzw. zu töten“, das sieht der Evangelist offenbar als das „Lebensziel des rabbinischen Judentums“ an, wozu Veerkamp anmerkt, dass wir in dieser Hinsicht „seine Sicht nicht teilen“ müssen.
Auf die Frage Jesu an die Schüler, was sie suchen, bekommt er „keine direkte Antwort, berichtet wird nur, was/wen sie finden.“ Das entsprechende Wort heuriskein, „finden“, taucht aber erst etwas später auf, dazu mehr in der Besprechung von Johannes 1,41.
Hier zeigt zunächst das Wort rabbi, das vom Evangelisten sogleich mit didaskalos übersetzt wird, dass sie in Jesus einen „Lehrer“ sehen, den sie (W78) fragen: pou meneis?, „wo ist deine Bleibe?“ Dazu erläutert Wengst:
Die Schüler eines Rabbi gehen nicht nur zu ihm in den Unterricht, sie wohnen, „bleiben“ bei ihm, leben mit ihm zusammen und dienen ihm, um umfassend – und also auch von seinem Leben – zu lernen.
Thyen (T130) geht zwar ausführlicher auf die Anrede rabbi ein, zieht daraus aber keine Schlüsse zur Art der Lehre Jesu, sondern nur darauf, dass „wir uns hier wohl kurz vor oder auf der Schwelle zur Entstehung des Rabbinats als eines rituell und rechtlich geordneten Amtes befinden“. Die Übersetzung des Wortes rabbi ins Griechische
hat sicher nicht den vordergründigen Zweck, griechischen Lesern ein fremdes Lexem zu übersetzen. Vielmehr dient in nahezu allen literarischen Erzählungen die Einführung von Lexemen in der Muttersprache der handelnden Personen dem Gesetz des Verisimile. <128> Zudem wird in unserem Fall der kurzen und schnell verklungenen Anrede rabbi durch ihr methermēneuein {Übersetzen} zusätzliches Gewicht verliehen und klargestellt, daß es sich hier nicht um eine bloße Höflichkeitsfloskel, sondern um die respektvolle Anrede von hörbereiten Schülern handelt.
Inhaltlich läuft alles, was hier geschildert wird, nach Thyen auf eine „Nachfolge Jesu“ hinaus, die er nicht mit rabbinischen Analogien vergleicht, sondern auf die Johannes bereits als einer christlich ausgeprägten Vorstellung zurückgreift:
Die gedrängte Folge der Lexeme lalein, akouein und akolouthein {reden, hören und folgen in Vers 37} weist auf einen nahezu technischen und den Lesern vertrauten Gebrauch. Das lalein {Reden} des Johannes als des gottgesandten Zeugen ist Ruf in die Nachfolge Jesu, den seine Jünger „hören“ und „befolgen“.
Wengst dagegen sieht die „Schule Jesu“, die, wie das weitere Evangelium zeigt, „in die Gemeinschaft der Gemeinde“ führt, durchaus in einer Analogie zum rabbinischen Unterricht:
Bei Jesus „bleibt“, wer in seiner Lehre bleibt, wer sich an das hält, was er gelehrt und gelebt hat. Wer so bei Jesus bleibt, hat eine „Bleibe“ bei Gott. Das wird Kap. 14 zeigen. Dort sagt der von seinen Schülern Abschied nehmende Jesus, dass im Haus seines Vaters viele „Bleiben“ seien und er gehe, ihnen einen Platz zu bereiten (14,2). In 14,23f. aber ist die Richtung umgekehrt, wenn Jesus sagt, dass er und der Vater kommen werden, um „Bleibe“ zu nehmen bei denen, die ihn lieben und seine Worte halten. In der Nachfolge also „bleiben“ die Mitglieder der Gemeinde bei Jesus (12,26). Er selbst hat seine „Bleibe“ bei Gott, wie in der vorigen Szene das Herabsteigen der Geisteskraft und deren „Bleiben“ auf ihm anzeigte. Das macht die Nachfolge verheißungsvoll. Dass sie sich tatsächlich als solche erweist, kann nicht im Voraus andemonstriert werden. Deshalb erfolgt die Einladung: „Kommt und seht!“ Lasst euch darauf ein und ihr werdet schon eure Erfahrungen machen.
Zum Wort menein, „bleiben“, steuert Veerkamp noch weitere Überlegungen bei, die sich auf den semitischen Hintergrund dieses Wortes beziehen:
Die zwei Schüler des Johannes wollen wissen, wo Jesus bleibt“. Das Verb, das auf dem ersten Blick einfach „bleiben“ heißt, hat, wie so oft bei unverfänglichen Wörtern, einen doppelten Boden. Eine Kopula „bleiben“ (wie „bleibe du gesund“) gibt es in semitischen Sprachen nicht. Die griechischen Übersetzer geben oft Wurzeln wie „aufrecht sein“ oder „stehen“ mit diesem „bleiben“ wieder. Die Schüler wollen nicht die Adresse Jesu wissen, sondern sie möchten wissen, wo sein Standort ist, wo er diesen ganzen trostlosen Zustand Israels „aushält“. Später wird das Verb eine Grundtugend der Schüler beschreiben; sie sollen nicht „in Christus bleiben“ (was sich ein normaler Mensch sowieso nicht vorstellen kann), sondern „mit dem Messias standhalten“. Also fragen sie: „Wo hältst du es aus?“ „Kommt und seht“, ist die Antwort. Die zwei halten es zunächst während dieses Tages mit Jesus aus.
Die Bemerkung hōra ēn hōs dekatē, „es war um die zehnte Stunde“, soll nach Thyen (T130) wieder „dem Verisimile“ dienen, also der erzählerischen Plausibilität, und „zugleich deren symbolischen Modus“ signalisieren. Dabei will sich Thyen aber auf keine mögliche Deutung festlegen: „Auf jeden Fall gilt da Ricoeurs Maxime, daß das Symbol zu denken gibt.“
Auch Klaus Wengst (W79) sieht die Zeitangabe in Vers 39 als ein Signal „für eine tiefere Sinndimension“. Bei ihrer Erschließung sollte aber
nicht allgemein von der Zahl Zehn, sondern von „der zehnten Stunde“ ausgegangen werden. In der jüdischen Überlieferung spielt „die zehnte Stunde“, soweit ich sehe, nur in einer einzigen Tradition eine Rolle. In ihr wird die durch andere Elemente weitergeführte biblische Erzählung von der Erschaffung des ersten Menschen bis zu seiner Vertreibung aus dem Garten Eden in einen einzigen Tag zusammengefasst und in einem Schema von zwölf Stunden geboten: „In der zehnten (Stunde) gebot er (= Gott) ihm (= dem ersten Menschen)“. <129> Ein solcher Bezug ergäbe einen möglichen Sinn für Joh 1,39, zumal das Gebieten, das Lehren eines Gebotes bzw. von Geboten einerseits und das Halten der Gebote und Worte Jesu andererseits in der im Evangelium beschriebenen Relation zwischen Jesus und seinen Schülern eine wichtige Rolle spielen. Wie Gott dem ersten Menschen gebot, so gebietet Jesus als sein endzeitlicher Beauftragter, als messianischer Lehrer seinen Schülern – und über sie der Gemeinde.
Tatsächlich passt diese Deutung der zehnten Stunde als der Zeit des Lehrens der Gebote durch Gott sehr gut zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus seine Tätigkeit als Lehrer seiner Schüler aufnimmt.
Ton Veerkamp verweist zum Stichwort hōra, „Stunde“, das insgesamt 26mal im Johannesevangelium vorkommt, darauf, dass es siebenmal die „Stunde Jesu“ bezeichnet, also jenen „festgelegten Zeitpunkt, an dem Jesus geehrt‘ werden soll“, indem er am Kreuz stirbt. Und es sind vier „ganz bestimmte Stunden“, die „mit einem Zahlwort hervorgehoben“ werden:
Die sechste Stunde war die Stunde, wo Jesus sich beim Jakobsbrunnen in Samaria hinsetzte (4,6); hier ruft der Messias die Leute von Samaria zur Einheit Israels zurück. Die siebte Stunde war die Stunde, in der der Sohn des königlichen Beamten geheilt wurde (4,52). Die sechste Stunde wird ein zweites Mal erwähnt; sie ist bei Johannes nicht der Augenblick, wo das ganze Land in Finsternis gehüllt wird {wie in Markus 15,33; Matthäus 27,45; Lukas 23,44}, sondern der Augenblick, in dem Pilatus den gefolterten Jesus herausführte mit den Worten: „Da, euer König!“ (19,14) Die zehnte Stunde war die Stunde des „Kommt und seht“. Kommen ist eine Einladung, sehen eine Aufforderung. Hier geht die Einladung an die, die nicht durch ihre Vorurteile geblendet sind.
↑ Johannes 1,40-42: Andreas findet „als Ersten“ den Simon Petrus
1,40 Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten
und Jesus nachgefolgt waren,
war Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
1,41 Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm:
Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte.
1,42 Und er führte ihn zu Jesus.
Als Jesus ihn sah, sprach er:
Du bist Simon, der Sohn des Johannes;
du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt: Fels.
[27. März 2022] Die Lutherübersetzung ist in Vers 40 sehr ungenau. Im Original beginnt der Text nämlich mit ēn Andreas, „es war Andreas“, und betont damit die Rolle dieses Schülers , der, so Wengst (W80), in den synoptischen Evangelien
außer in der Berufungserzählung (Mt 4,18-22; Mk 1,16-18) nur in Aufzählungen vorkommt. Hier in Kap. 1 ist er Simon nicht nur zeitlich vorgeordnet, sondern wirkt ihm gegenüber als Zeuge Jesu und führt ihn zu Jesus. Diese Beobachtung hat ihre Entsprechung an weiteren Stellen des Evangeliums, an denen andere namentlich genannte Schüler auftreten. Der Evangelist umstellt sozusagen die prominente Figur des Simon Petrus mit einer Mehrzahl anderer Schüler. Diese Art der Darstellung dürfte dadurch veranlasst sein, dass er ein geschwisterschaftliches und kein hierarchisches Modell von Gemeinde vertritt.
Auch die Art, wie Johannes in Vers 42 die Umbenennung Simons aus dem Matthäusevangelium (16,17-18) übernimmt, kann nach Wengst (W80f.) nicht
anders gedeutet werden, als dass der Evangelist eine antihierarchische Tendenz verfolgt. Simon wird in der Darstellung dieses Abschnitts – in jedem Sinn – hineingeholt in die Gemeinschaft der Schüler Jesu.
Denn während Simon nach Matthäus auf Grund seines Messiasbekenntnisses den Namen Petrus erhält und zum Leiter der Gemeinde bestimmt wird, hat nach Johannes (W80) „schon Andreas dem Simon gegenüber Jesus als Messias bekannt“; es bleibt „bei der bloßen Benennung und es fehlt jeder Hinweis auf eine ekklesiologische {gemeindebezogene} Bedeutung.“
Das kann man aber auch anders sehen, gerade wenn man voraussetzt, dass Johannes die Matthäusversion der Umbenennung des Simon Petrus kennt. Er erzählt nämlich in Vers 41, dass Andreas prōton seinen eigenen Bruder Simon Petrus findet, und dieses Wort prōton, das Luther mit „zuerst“ und Wengst mit „zunächst“ wiedergibt, kann wörtlich auch mit „als Ersten“ übersetzt werden. Veerkamp <130> zieht daraus den Schluss, dass es hier zwar durchaus um eine Kritik an Petrus geht, seine Führungsrolle wird aber gerade dadurch eher noch gestärkt. Petrus bleibt „das Fundament des messianischen Israels“ nämlich nicht auf Grund zweifelhafter persönlicher Verdienste, sondern allein auf Grund seiner Berufung durch den Messias:
Andreas „findet“ seinen Bruder, als den „Ersten“, nämlich als den, den der Messias zum Hirten Israels berufen wird (21,15ff.). Simon geht beim Wort „Messias“ nicht von sich aus auf Jesus zu, sondern er wird zu Jesus gebracht. Simon, Sohn des Johannes, erhielt einen neuen NAMEN, das heißt: Er muss das Fundament des messianischen Israels sein. Bevor er das kann, muss er restlos demontiert werden, als Nachfolger, der in einem entscheidenden Augenblick „leugnet“. Johannes der Täufer „leugnet nicht“, sondern „bekennt“ (1,20), Simon bekennt nicht, sondern leugnet, dreimal (18,25ff.). Johannes verknüpft durch die Wahl seiner Worte die entscheidenden Szenen seiner Erzählung miteinander.
Das Wort heuriskein, „finden“, in Vers 41 verdient weitere Aufmerksamkeit. Wengst meint dieses Wort im Sinne von „zufällig antreffen“ deuten zu können (W80):
Andreas „findet“ seinen Bruder Simon, wie später Jesus den Philippus findet und der den Natanael. Hier „findet“ sich gleichsam alles wie von selbst – zufällige Begegnungen, aus denen eine Gruppe von Schülern resultiert, in der die Gemeinde sich wiedererkennen kann.
Dabei nimmt Wengst nicht ernst genug, dass im selben Satz das Wort „finden“ ein zweites Mal vorkommt. Hier wird nämlich, so Veerkamp, die erste Frage Jesu aus Vers 38: „Was sucht ihr?“ endlich beantwortet:
Andreas sagt: „Wir (!) haben den Messias gefunden.“ Mit diesem „wir“ ist die Gruppe um Johannes gemeint, deren Aufgabe darin besteht, die Außenwelt von diesem Befund zu unterrichten.
Das heißt, es geht bei diesem Finden um alles andere als einen Zufall, sondern um ein sehr bewusstes Aufeinanderzugehen. Veerkamp erläutert ausführlich die „wichtige Rolle“, die nicht nur das Verb zētein, „suchen“, sondern auch das Verb heuriskein, „finden“, im Johannesevangelium spielt:
Es geht um eine bewusste Aktion. Das Verb kann auch antreffen bedeuten, aber hier wird nur gefunden, was gesucht wird. Sechsmal ist Jesus Subjekt, viermal das Objekt von finden. Jesus findet Menschen, die er sich zum Schüler machen will (Philippus), den er geheilt hat und vor weiterer Verirrung bewahren will (den Gelähmten von 5,1ff.), den aus der Synagoge ausgeschlossenen Blindgeborenen, den toten Freund, der schon vier Tage im Grab war; er findet zwecks Erfüllung der Schrift den Esel des Propheten Sacharja, er findet zwecks Reinigung Israels die Händler im Heiligtum. Viermal sucht die Menge der Judäer Jesus, um ihn zur Rede zu stellen, sogar, um ihn zu töten. (Das Finden gelingt aber nicht, wie allein in 7,34-36 dreimal hervorgehoben wird.) Pilatus findet dreimal keinen Grund für einen Prozess gegen Jesus. Zweimal bestätigen Schüler, dass sie den Messias gefunden haben, dreimal finden Schüler andere Schüler. Die Fischer werden Fische und die Schafe Weide finden. In all diesen Fällen geht es immer um ein Resultat eines bewussten Suchens.
Worauf weder Wengst noch Veerkamp eingehen, darauf richtet Thyen sein Hauptaugenmerk, nämlich auf die Frage, warum nur einer der beiden ersten Schüler Jesu mit Namen genannt wird (T132). Wer könnte aber der anonyme Schüler sein?
Fraglos bildet der fehlende oder „unterdrückte“ Name eines der beiden Erstberufenen in unserem Text eine absichtsvolle „Leerstelle“, die zu ihrer Ausfüllung aufruft…
Außer diesem Leerstellen-Signal, das nach seiner Auffüllung durch die Wahrnehmung anschließbarer Textsegmente ruft, ist zudem gar nicht einzusehen, warum das … intertextuelle Spiel mit Mk 1,7ff nach Joh 1,34 plötzlich abbrechen sollte. Denn daß am Anfang aller Jüngerschaft Jesu die Berufung zweier Brüderpaare stand, nämlich die von Petrus und Andreas, sowie die der Zebedäussöhne Jakobus und Johannes (Mk 1,16ff par.) – und danach nach Ausweis der Apostelliste von Mk 3,16-19/Mt 10,2-4 wohl die des Philippus – weiß der Leser aus den Prätexten (und dieses Wissen ist im übrigen auch Joh 21,2 vorausgesetzt, wenn das Brüderpaar da einfach als hoi to Zebedaiou {die des Zebedäus} bezeichnet wird).
Daraus ist Thyen zufolge zwar „keinesfalls unmittelbar zu entnehmen…, daß nach Andreas auch der ‚Andere‘ seinen Bruder zu Jesus geführt haben müsse.“ Aber (T131) die nach „dem gewichtigen Codex Sinaiticus“ bezeugte „Lesart prōtos“ im Nominativ statt prōton im Akkusativ könnte die Auslegung stützen, dass „unter den beiden einstigen Johannes-Jüngern Andreas der erste war, der einen anderen, nämlich seinen Bruder Petrus, zu Jesus brachte“ (meine Hervorhebung). Es bleibt (T133) „ein den Lesern aufgegebenes Rätsel“, wer der andere unbenannte Jünger ist und was ihn möglicherweise „mit der Figur des ‚Jüngers, den Jesus liebte‘ verbindet“. Aber es ist wohl kein Zufall, dass schon frühe Handschriften das Evangelium mit euangelion kata Iōannen, „Evangelium nach Johannes“, über- oder unterschrieben haben, also seinen Autor mit Johannes, Sohn des Zebedäus und Bruder des Jakobus, in Verbindung gebracht haben. Man könnte also (T133f.)
gerade die „Nichtnennung“ der Zebedaiden im Corpus unseres Evangeliums und ihr Erscheinen erst in Joh 21,2 als ein Element der absichtvoll durchgeführten Strategie begreifen, den Jünger, ho martyrōn peri toutōn kai ho grapsas tauta {der das bezeugt und aufgeschrieben hat} (21,24) und seine Zeugenschaft als einer, der ap‘ archēs {von Anfang an} mit Jesus war (15,27) bleibend mit dem Rätsel seiner Anonymität zu verbinden.
Thyen sieht aber nicht (T133) wie Ferdinand Hahn <131> im „‚namenlosen Jünger‘, der auch hier, wie später am Grab Jesu, vor Petrus zu Jesus gekommen ist, … die Abbildung eines realen und als mutmaßlicher Traditionsträger einer ‚johanneischen Gemeinde‘ verehrten Mannes“, sondern „den von seinem Autor geschaffenen, rein fiktionalen Erzähler-Schreiber unseres Evangeliums“. Das heißt, der reale Autor des Johannesevangeliums tritt in vollständiger Demut hinter diesen von ihm vorausgesetzten anonym und rätselhaft bleibenden Erzähler aus der Zeit Jesu zurück.
Dass Jesus (W80) den Simon bereits mit Namen anredet, „bevor einer der beiden Brüder etwas sagt“, deutet Wengst von der späteren Selbstbeschreibung Jesu als des guten Hirten her:
Er kennt ihn schon, ehe er mit ihm bekannt gemacht worden ist. Hier ist in Erzählung umgesetzt, was Jesus von sich als dem guten Hirten in 10,3 sagen wird: „Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus.“
Auch für Thyen (T136) werden in Jesu „spontanem Erkennen Simons (V. 42) … bereits Farben aus dem Bild vom ‚guten Hirten‘ sichtbar, ‚der seine Schafe kennt und sie mit Namen ruft‘ (10,3.14.27)“. Deutlicher als Wengst drückt er aus, dass Jesus damit „an der Omniszienz des ‚Vaters‘“, seiner Allwissenheit, teilhat, und er will „ihren Ursprung ‚in den Schriften suchen, die von ihm reden‘ (Joh 5,39)“, etwa im Vergleich von Stellen wie 1. Könige 8,39 und Jesaja 45,4.8 mit Johannes 2,24f. Dazu erst bei der Auslegung dieser Stelle mehr.
In der Benennung Simons mit dem aramäischen Namen Kēphas sieht Thyen übrigens nicht einen Beleg für die Aufnahme einer älteren Tradition durch Johannes, sondern eine bewusste Archaisierung, also die Aufnahme eines zu seiner Zeit bereits ungebräuchlichen Begriffs (T137):
Wie er im Bekenntnis des Andreas, das wohl auch für Petrus gelten darf, die griechische Transskription Messias des hebräischen maschiach verwendete, um sie dann mit „gesalbt“ bzw. „der Gesalbte“ (christos) zu übersetzen, so benutzt er nun anstelle von Petros die griechische Transskription Kepha des aramäischen kejphaˀ und übersetzt sie mit „Fels“ (petros). Diese Archaisierung der Namen dient nicht nur dem narrativen Gesetz des Verisimile {siehe Anm. 128}, sondern in einer Zeit, in der „Petrus“ längst zum Eigennamen geworden ist und einige Christenkinder womöglich schon diesen Namen des verehrten Märtyrers tragen, wird so das Außergewöhnliche der Belehnung des Simon mit dem metaphorischen Namen „der Fels“ in Erinnerung gerufen.
Eine ähnliche Argumentation erklärt Thyen zufolge auch, warum Simon hier als Sohn des Johannes und nicht des Jona wie in Matthäus 16,17 angeredet wird. Der Name „Jona(s)“ ist nämlich nach Joachim Jeremias <132> in neutestamentlicher Zeit „als selbständiger Name nicht nachweisbar“, sondern nur als abweichende Lesart in der Septuaginta zum Namen „Iōan(n)es“; daraus „möchte man schließen, dass jonaˀ Mt 16,17 Abkürzung von jochanan ist“. Auch hier sieht Thyen demzufolge den Evangelisten „um die archaischere Gestalt der biblischen Sprache bemüht.“
↑ Johannes 1,43-44: Vierter Tag – Jesus findet Philippus
1,43 Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen
und findet Philippus
und spricht zu ihm: Folge mir nach!
1,44 Philippus aber war aus Betsaida,
der Stadt des Andreas und des Petrus.
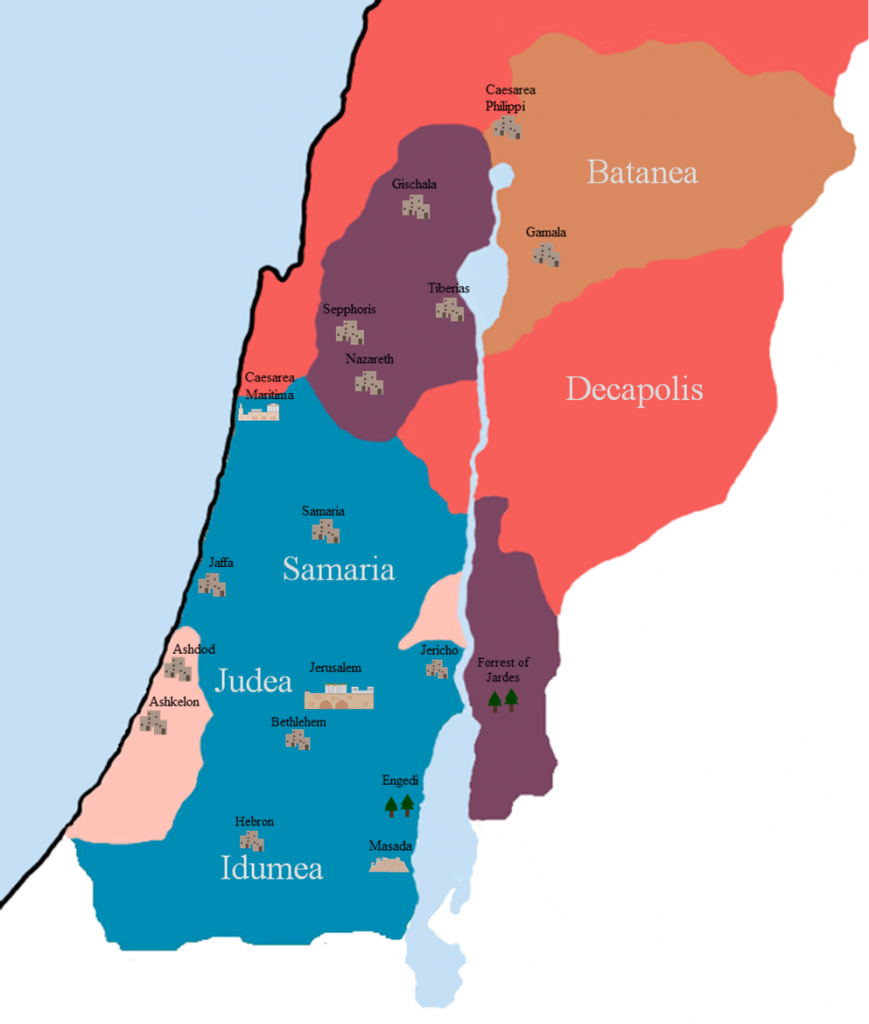
[28. März 2022] Was am folgenden Tag geschieht, wird, wie Wengst sagt (W81), „mit dem beabsichtigten Aufbruch von Batanäa nach Galiläa“ eingeleitet. Darin sieht er eine „bloße Vorbemerkung“ zum Ort der Hochzeit zu Kana. Etwas mehr sagt er zur Stadt Betsaida, aus der sowohl Philippus als auch Andreas und Petrus stammen. Sie liegt nach Josephus <133> „am See Gennesaret…, ‚in der unteren Gaulanitis‘,“ also „am Nordufer des Sees…, in unmittelbarer Nähe des Jordaneinflusses“:
Auf die Lage am See weist auch sein Name: „Fischerhausen“. Dass der Evangelist diese Lokaltradition hier aufnimmt und dass er die Erzählung in seinem Evangelium in Batanäa und Gaulanitis beginnen lässt, spricht für die These, dass es diese Gebiete sind, in denen seine erste Leser- und Hörerschaft lebte.
Thyen wundert sich (T140f,), warum mit Betsaida „als die gemeinsame Heimatstadt“ der bis dahin mit Namen genannten Jünger ein Ort genannt wird, der „gar nicht in Galiläa, sondern jenseits des Jordan in der Gaulanitis liegt“. Allerdings wird er in Johannes 12,21 dennoch „als galiläisch“ bezeichnet, und bereits in Jesaja 8,23 werden Gebiete „jenseits des Jordans“ als „das Galiläa der Heiden“ bezeichnet. Auch Thyen beschäftigt sich nicht näher mit der Frage, warum Johannes den Wunsch Jesu erwähnen mag, nach Galiläa aufzubrechen.
Für Veerkamp <134> ist die Bemerkung aus politischen Gründen wichtig, dass Jesus „in den Galil gehen“ wollte:
Der Galil (Galiläa) ist für die messianischen Schriften das, was für die Tora die Wüste ist. Dort fing alles an, dort finden sich die Schüler nach der Ermordung des Messias wieder. <135> Galiläa ist für Johannes politische Peripherie {Randgebiet}, das Zentrum ist Jerusalem.
Schon in den jüdischen Schriften spielt diese „Landschaft ‚Galil‘“, die immer am Rande gelegen hatte, „kaum eine Rolle“:
Galiläa wurde erst spät, unter dem König Judas Aristobul (104-103 v.u.Z.), mit Judäa vereinigt, seine Bevölkerung wurde teils durch Immigration aus Judäa, teils durch Zwangsbekehrung <136> judäisch und stand in einer angespannten Beziehung zum Zentrum Jerusalem. … Das Land wurde um die Mitte des 1. Jh. v.u.Z. durch bürgerkriegsähnliche Zustände zerrissen und „befriedet“ durch Leute wie Herodes (um 44 v.u.Z.). Es wurde durch die Lakaien Roms, die den Königstitel führten (etwa Herodes Antipas), mehr ausgeplündert als verwaltet und hatte in Jerusalem einen schlechten Ruf. Es war ein rebellisches Land, und im großen Krieg gegen Rom (66-73 u.Z.) hatten hier die Rebellen anfänglich ihre größten Erfolge. Die Evangelien zeichnen den Messianismus als eine Bewegung, die in der Peripherie Galiläa seinen Ursprung hatte.
Ist es Zufall, dass sowohl Wengst als auch Thyen die Erwähnung des randständigen Galiläa, für das sich Jesus besonders interessiert, als unwesentliche Randbemerkung so gut wie außer Acht lassen?
Veerkamp geht übrigens davon aus, dass Jesus seine Reise durchaus schon angetreten hat, als er auf „dem Weg nach Galiläa“ den Philippus findet. Es ist meinerseits nicht mehr als eine Vermutung, dass Johannes vielleicht deswegen die in der Nähe des Jordan liegende Stadt Betsaida als dessen Heimatstadt erwähnt, weil sie – gerade noch dem „Galiläa der Völker“ jenseits des Jordans zugehörig – den Übergang vom ostjordanischen Betanien, dem Taufort des Johannes, zum westjordanischen Kana markiert, wo die beiden entscheidenden Zeichen Jesu geschehen werden.
Überhaupt scheint Philippus im Johannesevangelium mehrfach eine Schlüsselstellung einzunehmen, die mit der Verbindung unterschiedlicher Teile der Schülerschaft Jesu zu tun hat. Wir werden im nächsten Abschnitt sehen, wie er, „der im ‚Galil der Völker‘ den Menschen aus den Völkern nahestand“ und „für das Israel der Diaspora steht“, die Aufgabe hat, einen zu finden und über sein Finden des Messias zu unterrichten, „der für das Israel des Landes steht“. Später (12,21) ist er es, der „Leuten aus der Diaspora (Griechen) den Zugang zum Messias“ vermittelt:
dort wird Philippus mit Herr angesprochen, einem Titel, der im Evangelium nur Jesus selbst vorbehalten bleibt. Die ersten beiden Schüler folgen von sich aus dem Jesus, Simon erhält einen neuen NAMEN, nur Philippus wird aufgefordert, ihm zu folgen.
Wengst (W81) beurteilt das, was Johannes hier von Philippus erzählt, anscheinend als reichlich mager:
Wie vorher Andreas seinen Bruder Simon fand, so findet Jesus selbst nun Philippus. Nicht mehr wird von dieser Begegnung erzählt, als dass er ihn auffordert, ihm zu folgen. Das erinnert an die synoptischen Berufungsgeschichten. Aber während dort erzählt wird, dass diejenigen, die Jesus ruft, einer beruflichen Beschäftigung nachgehen, in der sie der Ruf Jesu trifft, woraufhin sie alles stehen und liegen lassen und ihm folgen, steht davon hier nichts. Nur die Begegnung und die Aufforderung Jesu, ihm zu folgen, werden erwähnt. Dass Philippus ihr Folge leistet, ist in der weiteren Erzählung vorausgesetzt.
Während (W82) in den synoptischen Evangelien sich jeder Jünger Jesu „letztlich von ihm selbst berufen“ weiß, stellt das Johannesevangelium
die unterschiedlichen Ausgangspunkte heraus. Nur einer wird von Jesus direkt aufgefordert, ihm zu folgen. Ansonsten begegnet das Zeugnis in einem Außenstehenden oder in schon Gewonnenen – und indem dieser jenen und jener einen weiteren „findet“, findet sich Gemeinde.
Thyen (T139) erkennt in der knappen Erzählung vom Finden des Philippus durch Jesus wiederum ein bewusstes Spiel mit den synoptischen Evangelien. Vehement wehrt er sich gegen die Auffassung, möglicherweise hätte ein unachtsamer Bearbeiter des Textes „die typisch johanneische Berufungsweise, wonach stets ein Zeuge einen anderen zu Jesus führe, durch eine spezifisch ‚synoptische Szene‘ unterbrochen.“ Vielmehr wollte Johannes „in unserem Kapitel die Jüngerberufung exemplarisch darstellen“ und konnte „dabei doch den typischen Ruf Jesu akolouthei moi {folge mir nach} unmöglich übergehen.“
↑ Johannes 1,45-46: Philippus bezeugt Nathanael den Messias aus Nazareth
1,45 Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm:
Wir haben den gefunden,
von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben,
Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth.
1,46 Und Nathanael sprach zu ihm:
Was kann aus Nazareth Gutes kommen!
Philippus spricht zu ihm:
Komm und sieh!
[29. März 2022] Dass Philippus aus Betsaida gemäß 1,45 Nathanael findet, der nach 21,2 in Kana zu Hause ist, bestärkt meine Vermutung, Jesus mit seiner wachsenden Schar von Schülern werde bereits hier auf seinem Weg von Bethanien (Batanäa?) nach Kana dargestellt, wo er 2,2 zufolge zu einer Hochzeitsfeier erwartet wird.
Thyen denkt wohl auch zu Recht (T140), dass die beiden Erwähnungen von Nathanael in Kapitel 1 und 21 „der Erinnerung unserer Szene und der beiden ihr folgenden Kana-Zeichen (2,1-11 u. 4,46-54) und damit der Verknüpfung des Endes mit dem Anfang“ dienen. Das unterstützt außerdem meine Annahme zur Gliederung des Evangeliums, dass der Fischfang am See Tiberias (21,14) tatsächlich als drittes, triton, entscheidendes Zeichen der öffentlichen Wirksamkeit des Messias gemeint ist.
Ähnlich, wie einer der beiden ersten Jünger Jesu im Johannesevangelium anonym bleibt, gibt auch der Name dieses fünften Schülers Rätsel auf. Nach 21,2 muss er „zu den nach Joh 6,66ff treu gebliebenen ‚Zwölf‘ gehören“; manche haben ihn mit dem in der synoptischen „Apostelliste von Mk 3,16-19“ auf Philippus unmittelbar folgenden „Bar-Tholomäus“ gleichsetzen wollen, da dort nur sein Vatername, „Sohn des Tholomäus“, angegeben ist. Mit Recht meint allerdings Thyen:
Doch wichtiger als das wohl für immer unlösbare Rätsel seiner Identität ist das unmittelbare Sprechen seines theophoren {göttliche Bedeutung tragenden} Namens Nathanael: „Gott hat gegeben“. Denn darin erscheint er nahezu als Inkarnation der Worte Jesu: pan ho didōsin moi ho patēr pros eme ēxei {Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir} und oudeis dynatai elthein pros me ean mē ho patēr ho pempsas me helkysē auton {Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat} (6,37.44).
Diesen Aspekt betont auch Wengst (T82, Anm. 39), während er den Zusammenhang mit Kapitel 21, das er als „Nachtragskapitel“ einschätzt, außer Acht lässt:
Das singuläre und doch relativ ausführliche Vorkommen am Schluss der Schülergeschichten lässt fragen, ob nicht im Namen dieses Schülers („Gott hat gegeben“) prägnant zum Ausdruck gebracht wird, was die entscheidende Dimension aller dieser Geschichten ist: In den zufälligen Begegnungen, in denen sich alles „findet“, ist es letztlich Gott, der „gibt“ (vgl. 6,37).
Wie beim Finden des Simon Petrus durch Andreas spielt das Wort heuriskein, „finden“, eine Doppelrolle, aber mit einer seltsamen Pointe, die Veerkamp <137> andeutet:
„Wir haben gefunden“, sagt er, wie Andreas, obwohl er nicht gefunden hat, sondern gefunden wurde.
Mit dem „wir haben gefunden“ stellt sich Philippus in die Reihe aller Schüler, die bisher Jesus als den Messias gefunden haben, und bestätigt zugleich, dass dem Finden Jesu das Gefundenwerden durch ihn vorausgehen muss, wie bereits die Umwendung (strapheis) Jesu zu den ersten Schülern (1,38) auf die Umkehr Gottes zu seinem Volk angespielt hatte.
Das Zeugnis (W82), das „jetzt Philippus gegenüber Natanael“ über Jesus ablegt, unterscheidet sich von dem entsprechenden Zeugnis des „Andreas gegenüber Simon“ dadurch, dass er nicht ausdrücklich vom „Messias“ redet, sondern eine Umschreibung gibt, die zugleich die Messianität Jesu belegen soll: „Von dem Mose in der Tora geschrieben hat, auch die Propheten.“
„Mose“ und „die Propheten“ bezeichnen zusammenfassend „die Schrift“. Ihre unterschiedlichen Hoffnungsvorstellungen schießen in der Person Jesu zusammen, sind in ihm konzentriert. Wer daher auf ihn seine Hoffnung setzt, hofft auf den in der Schrift sein Verheißungswort sprechenden Gott. Dass dieser Gott als der geglaubt wird, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, ist Unterpfand dafür, dass die Verheißungen gelten und die darauf bezogene Hoffnung nicht vergeblich ist. Unter der Voraussetzung dieses Glaubens haben die neutestamentlichen Autoren die Schrift gelesen und so von ihr her Wirken und Schicksal Jesu gedeutet.
Dass allein der Rückbezug auf die Schrift jedoch noch nicht „ein ‚Beweis‘ für die Messianität Jesu“ sein kann, zeigt der „Fortgang des Textes“, den Ton Veerkamp wie folgt skizziert:
Dieser von Tora und Propheten angekündigte Messias ist ein konkreter Mensch mit amtlich bekannten NAMEN und Herkunft: Jesus ben Joseph aus Nazareth, Galiläa. Nathanael fragt: „Aus Nazareth? Was kann daraus Gutes werden?“ Diese Frage wird fast immer als rhetorische Frage aufgefasst, aus Nazareth könne nichts Gutes kommen. Vielmehr gibt die Frage die Verwunderung wieder, dass der, den ganz Israel sucht und erwartet, aus einem Ort kommen soll, der in der Befreiungsgeschichte Israels nicht vorkommt; von Nazareth ist in der Schrift (Mose und den Propheten) nirgendwo die Rede. Matthäus und Lukas lassen den Messias in Bethlehem, der Stadt Davids, zur Welt kommen. Johannes aber deutet die Herkunft aus Nazareth als eine vollkommen neue Initiative Gottes. Nazareth ist für ihn auch ein Bruch mit der Vergangenheit. Der Satz erhellt sich von 7,52 her, wo die Peruschim zu ihrem Genossen Nikodemus sagen: „Bist du nicht aus Galiläa? Forsche und siehe: aus Galiläa steht kein Prophet auf.“ Der Einwand Nathanaels ist, dass sich die Messianität Jesu aus der Schrift nicht nachweisen lässt, offenbar ein verbreiteter Einwand.
Philippus jedoch lässt sich (T141) „von solcher Skepsis nicht … infizieren und zu einer Debatte über Nazaret verleiten (vgl. 7,40ff)“. Vielmehr antwortet er, so Veerkamp, „wie Jesus auf die Frage der ersten beiden Schüler geantwortet hat: ‚Komm und sieh!‘“ Offenbar wird im Johannesevangelium sehr ernstgenommen, dass die befreienden Erfahrungen, von denen in der Tora und in den Propheten die Rede ist, zumindest zeichenhaft konkret erlebt und gesehen werden müssen. Von diesem Sehen wird sogleich mit Gespräch Jesu mit Nathanael die Rede sein.
Am Rande weist Klaus Wengst darauf hin (W83, Anm. 41), dass Johannes Calvin <138> diese Stelle zum Anlass für folgenden Kommentar nahm: „Wie wenig Glauben Philippus hatte, wird hier deutlich; er vermag von Christus nicht vier Worte auszusagen, ohne zwei schwere Irrtümer mit auszusprechen“, nämlich dass Josef Jesu Vater sei und dass Jesus aus Nazareth stammte. Diese Haltung hat natürlich damit zu tun, dass es in der Christenheit bis in unsere Tage hinein üblich war, die Jungfrauengeburt Jesu und den Ort seiner Geburt in Bethlehem als in allen Evangelien vorausgesetzt anzunehmen. Aber für Johannes „ist Josef ganz selbstverständlich der Vater Jesu. Und doch ist gerade dieser Josefssohn für ihn ‚der Sohn Gottes‘, ‚der Sohn des Vaters‘. Ebenso selbstverständlich ist für ihn die Herkunft Jesu aus Nazaret.“ Im selben Zusammenhang meint Hartwig Thyen gegen Rudolf Schnackenburg, <139> dass der Evangelist den Philippus wohl kaum
nur „die im Volk übliche Vatersbezeichnung“ Jesu nachplappern läßt. Es könnte ja auch sein, daß er seinen „Philippus“ absichtsvoll das in keinerlei „Zwei-Naturen-Lehre“ auseinanderlegbare Paradox des ho logos sarx egeneto {das Wort ward Fleisch} auf diese Weise hat formulieren lassen, weil sich für ihn Josephs- und Gottes-Sohnschaft Jesu keineswegs ausschließen müssen.
↑ Johannes 1,47-49: Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum
1,47 Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm:
Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist.
1,48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich?
Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Bevor Philippus dich rief,
als du unter dem Feigenbaum warst,
habe ich dich gesehen.
1,49 Nathanael antwortete ihm:
Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel!
[30. März 2022] „Komm und sieh!“, hatte Philippus zu Nathanael gesagt, und wieder vollzieht sich dieses Sehen, indem ausdrücklich nur vom Sehen Jesu die Rede ist: Er sieht Nathanael auf sich zukommen, er hat ihn unter dem Feigenbaum gesehen.
Indem Jesus Nathanael auf sich zukommen sieht, sagt er über ihn, wie Veerkamp <140> etwas genauer übersetzt: „Sieh, einer der getreu (Adverb!) Israelit (Adjektiv) ist, in ihm ist keine Tücke.“ Um zu erklären, was „ein tückischer Mensch in Israel“ ist, zitiert Veerkamp Psalm 35,19-20, auf den Jesus in 15,25 anspielen wird:
Sie mögen sich nicht freuen über mich, meine Feinde, Lügner,
die mich hassen ohne Grund, augenzwinkernd.
Sie reden mir keinen Frieden zu, den Ruhigen des Landes,
reden und planen Tücke.… Der Tückische ist der absolute Gegensatz zu dem, der in Israel „Bewährter“ (zadiq) genannt wird.
Wengst (W83) versteht im gleichen Sinn das, was „den echten Israeliten ausmacht“, von Psalm 32,2b her: „In ihm ist kein Trug; er ist das Gegenteil von einem Ränkeschmied“, und dies ist Nathanael bereits, „bevor er zu Jesus in Beziehung tritt“. Zwei Punkte hebt Wengst besonders hervor: Johannes deutet „durch den Gang des Textes in keiner Weise an“, dass „‚die wahren Israeliten‘ auf die an Jesus Glaubenden“ zu beschränken seien. Und Jesu Anerkennung des Nathanael „bringt wieder – wie schon die Begegnung mit Simon – zum Ausdruck, dass er die Seinen kennt.“
Im folgenden Vers 48 taucht nach Wengst „zum ersten Mal im Johannesevangelium“ das „Motiv vom wunderbaren Wissen Jesu“ auf, denn auf „die Frage Natanaels, woher er ihn kenne, antwortet Jesus, ihn schon unter dem Feigenbaum gesehen zu haben, bevor Philippus ihn rief.“ Er will dieses Motiv
in seiner Funktion an dieser Stelle wohl am besten mit Blank so verstehen, dass die Begegnung mit Jesus „den Menschen betroffen (macht), indem sie diesem auch zugleich die Wahrheit über sich selbst enthüllt“. <141> Das wird hier nicht psychologisch einsichtig dargestellt, sondern konstatiert. Es genügt, wenn die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde entsprechende Erfahrungen macht.
Solche Spekulationen über angebliche „parapsychologische Fähigkeiten“ Jesu veranlassen Veerkamp zu einer heftigen Kritik an der „Ahnungslosigkeit der Exegeten“:
Die Phantasie geht dann mit vielen Auslegenden durch, Jesus habe gesehen, was ein normaler Mensch nicht sehen konnte, irgend etwas, was Nathanael heimlich unter jenem Feigenbaum trieb, eine kleine Demonstration „übernatürlichen Wissens“; <142> ein gewisser Blank meint, die Begegnung mit Jesus mache den Menschen betroffen, indem sie diesem auch die Wahrheit über sich selbst enthülle.
Auch ich finde es seltsam, dass ein auf den jüdischen Hintergrund des Johannesevangeliums bedachter Exeget wie Wengst die Möglichkeit völlig außer Acht lässt, den Feigenbaum in seiner symbolischen Bedeutsamkeit zu betrachten. Dazu schreibt Veerkamp:
Jesus antwortet nicht direkt auf die Frage, er verkündigt vielmehr seine Vision: „Friede für Israel“. Im Goldenen Zeitalter Israels, als König Salomo noch ein tadelloser Mann war, hieß es, 1 Könige 5,4f.:
Friede war mit ihm (Salomo) von allen Seiten ringsum.
Und Juda und Israel siedelten in Sicherheit,
jedermann unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum,
von Dan bis nach Beerscheba,
alle Tage Salomos.Diese Vision hatte auch der Verfasser des ersten Buches der Makkabäer; während der Regierung des Fürsten Simon Makkabäus saß „jedermann unter dem Weinstock und unter seinem Feigenbaum“ (14,12). Diese Vision war in der makkabäischen Zeit lebendig. Jesus nennt Nathanael „einen Israeliten ohne Tücke“. Was das heißt, erklärt Jesus mit seiner Sicht, dass Nathanael „unter dem Feigenbaum war“. Ein Israelit ohne Tücke ist ein Israelit, der nur eins will: Friede für Israel. Dasein unter dem Feigenbaum ist die Friedensvision des Messias und die Herzensangelegenheit Nathanaels.
Diese Ausführungen verbindet Veerkamp (Anm. 99) mit der Erwägung, ob in der positiven Erwähnung des Feigenbaums möglicherweise auch eine „Zurechtweisung an die Adresse des Markus bzw. Matthäus“ zu sehen ist, „die Jesus den Feigenbaum verfluchen lassen“ (so in Markus 11,12-14 und der Parallele Matthäus 21,18-19). „Lukas hat diesen Passus wohl mit Absicht weggelassen.“ Zum Bild des Feigenbaums verweist Veerkamp weiter auf Micha 4,4 und Sacharja 3,10.
Auch Hartwig Thyen denkt (T141), dass Jesus nach der „Logik unserer Erzählung … Nathanael gerade an seinem einai hypo tēn sykēn {Sein unter dem Feigenbaum} als einen ‚wahrhaften lsraeliten, an dem kein Trug ist‘ erkannt haben“ muss und dass „die symbolischen Obertöne dieses, ‚Sitzens unter dem Feigenbaum‘ nicht überhört werden“ dürfen, nicht allerdings im Sinne von Spekulationen wie von Bultmann: <143>
„Wenn ein Zusammenhang zwischen jener Charakteristik und dem Verhalten des Nath. unter dem Feigenbaum bestehen soll …, so genügt vielleicht der Hinweis darauf, daß Rabbinen gerne den Platz unter einem Baume als Ort ihres Studiums und ihrer Lehre wählten. Nath. würde sich dann dadurch als echten Israeliten ausweisen, daß er in der Schrift forschte (5,39), und als ohne dolos {Trug} dadurch, daß er – im Unterschied von den Juden, die zwar die Schrift erforschen, ihr aber nicht glauben (5,39.46f!) – zu Jesus kommt.“
Thyen selbst greift auf die auch von Veerkamp erwähnten Schriftstellen bei Micha und Sacharja zurück, indem er betont, dass Nathanaels
„Sitzen unter dem Feigenbaum“ Züge eschatologischen Glücks auf[weist]. Das Sitzen Israels unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum ist nämlich seit den Tagen Michas und Sacharjas geläufige Metapher eschatologischen Friedens: „dann werden sie nicht mehr lernen Krieg zu führen (kai ouketi mē mathōsin polemein). Ein jeder wird vielmehr ausruhen unter seinem Weinstock und ein jeder unter seinem Feigenbaum (anapausetai … hekastos hypokatō sykēs autou), und keiner wird da sein, der ihn aufschreckt, denn versprochen hat es der Mund des Herrn, des Pantokrator“ (Mi 4,3f, LXX); und: en tē hēmera ekeinē, legei kyrios pantokratōr, synkalesete hekastos ton plēsion autou hypokatō ampelou kai hypokatō sykes {An jenem Tage, spricht der HERR, der Allherrscher, wird jeder seinen Nächsten einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum} (Sach 3,10, LXX).
Unter Berufung auf Johann Anselm Steiger <144> [ebd. 56 ff.] versteht daher Thyen „Jesu ‚Sehen‘ Nathanaels unter dem Feigenbaum als eine eschatologische Vision“, allerdings in einer eingeschränkten Weise (143f.):
Sie zeigt Nathanael als „Platzhalter für das durch Micha und Sacharja verheißene eschatologische Glück ganz Israels. Denn Nathanael ist es, der zwar noch nicht unter Weinstock und Feigenbaum sitzt, aber bereits unter dem Feigenbaum … Das AT spricht vom Sitzen unter dem Feigenbaum nie, ohne ,und unter dem Weinstock‘ hinzuzufügen. Ein Israelit (und noch nicht ganz Israel) sitzt unter dem Feigenbaum (und noch nicht unter Feigenbaum und Weinstock)…“ [56].
Nun ist allerdings Vorsicht geboten, wenn Christen auf Eschatologie zu sprechen kommen, also auf die Lehre von den letzten Dingen. Handelt es sich dabei um das Ende dieser Welt mitsamt Weltgericht, das für jeden einzelnen mit seinem individuellen Tod zusammenfällt, wie man es sich im Christentum gewöhnlich vorstellt? Dann wäre das Sitzen unter dem Feigenbaum und Weinstock gleichzusetzen mit einer Vision des ewigen Lebens im Himmel, und es ginge hier um die Frage, ob Israel ganz oder vielleicht auch nur zum Teil dieses Leben im Jenseits erlangen könne.
Veerkamp versteht diese Eschatologie anders, nämlich so diesseitig, wie sie auch bei den Propheten Israels gemeint ist, und von daher bezieht sich ihm zufolge die Reaktion des Nathanael folgerichtig auf die konkrete Friedensverheißung für Israel, die mit Königen wie Salomo oder Simon Makkabäus verbunden war:
Nathanael begreift sofort, was Jesus ihm sagt. Jesus, der Lehrer, sei „wie Gott“ und „König über Israel“, wie Salomo ben David und Simon, der Bruder des Judas Makkabäus. Das ist kein formelhaftes Bekenntnis, sondern eine inhaltliche Aussage über Jesus.
Da Wengst die Symbolik des Feigenbaums vollständig ignoriert, kann er wiederum das Bekenntnis des Nathanael nur sehr formelhaft erläutern (W83f.):
Der von Jesus schon gesehene Natanael, bevor er selbst kommt und sieht, wird angesichts dieser Gewissheit, von Jesus schon erkannt und „ersehen“ zu sein, seinerseits zum Bekenntnis geführt: „Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels!“ Wie die beiden Johannesschüler (V. 38) redet er ihn zunächst als „Rabbi“ an und bekennt ihn dann – wie Johannes (V. 34) – als „Sohn Gottes“ und – analog zu den Bekenntnissen in V. 41 und 45 – als „König Israels“. Das Nebeneinander von „Sohn Gottes“ und „König Israels“ kennzeichnet Jesus als Gottes messianischen Beauftragten.
Auch wendet sich Wengst (Anm. 43) in diesem Zusammenhang ausdrücklich gegen die Annahme von Thyen („unter Berufung auf einen Aufsatz von A. Steiger“), dass Johannes hier auf Zephanja 3,15 anspiele „und damit ein Gottesprädikat auf Jesus übertrage“. Was Thyen damit ausdrücken will, lohnt aber eine genauere Betrachtung. Dabei gebe ich die von Thyen zitierten griechischen Bibelstellen nach der Lutherbibel wieder und hebe die Stellen, auf die es ihm besonders ankommt, hervor. Thyen geht davon aus (T142), dass sich Nathanael mit seinem Bekenntnis zu Jesus als dem König Israels
durch das Zitat von Zeph 3,15 (LXX) als ein in „Gesetz und Propheten“ Erfahrener erweist. Daß hier nicht nur ein zufälliger Anklang an Zeph 3 oder ein willkürlich aus seinem Zusammenhang gerissener Bibelvers vorliegt, hat A. Steiger durch seine sorgfältige Analyse des Kontextes von Zeph 3,15 eindrucksvoll erwiesen. Zeph 3,8 eröffnet eine Gottesrede über den Tag, ,da JHWH als Zeuge auftreten, über die Völker und Israel seinen Zorn ergießen, und allem Frevel ein Ende bereiten wird. Aber er wird sich einen Rest bewahren:
Zephanja 3,12-13: Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk; die werden auf des HERRN Namen trauen. Und diese Übriggebliebenen in Israel werden nichts Böses tun noch Lüge reden, und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht.
Und diesem Heiligen Rest, in dessen Mund keine glōssa dolia {betrügerische Zunge} mehr ist, verheißt JHWH dann:
Zephanja 3,15: Denn der HERR hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der HERR, der König Israels, ist bei dir {wörtlich: in deiner Mitte}, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst.
Diese Stelle ist nach Steiger [55] neben Jesaja 44,6 die einzige Stelle der jüdischen Bibel, wo der Gott Israels als melek jißraˀel, „König Israels“, bezeichnet wird:
„Nathanael läßt Jesus also, nachdem dieser ihn Zeph 3,13 folgend einen Israeliten, an dem kein Trug ist, genannt hat, das eschatologische Gottesprädikat ,König Israels‘ nach Zeph 3,15 zukommen. In Jesus tritt JHWH selbst auf. So bringt Joh 1,49 schon das zum Ausdruck, was dann in 10,30 wiederkehren wird: ,Ich und der Vater sind eines‘. Mit dem in die Welt gekommenen Logos werden der Sohn Gottes und JHWH als ,eines‘ in der Mitte Israels epiphan {offenbar}: ,Der König Israels, der Herr, in deiner Mitte‘ (en mesō sou, Zeph 3,15).“
Wengst sieht eine solche Argumentation offenbar als eine unmittelbare Gleichsetzung Jesu mit dem Gott Israels, die ein Jude wie Johannes, auch wenn er auf Jesus als den Messias vertraut, nicht gemeint haben konnte. Die Frage ist letzten Endes, wie der Satz „In Jesus tritt JHWH selbst auf“ konkret zu verstehen ist. Eine Gleichsetzung in der Weise, dass Jesus selbst ein auf Erden wandelnder Gott wäre, lehnt zumindest auch Thyen ja ausdrücklich ab; Jesus ist und bleibt in den Augen des Johannes ein Mensch aus Fleisch und Blut, Sohn des Josef aus Nazareth. Wenn Thyen meinen sollte, dass sich in Jesus das befreiende Wirken Gottes, das in den Schriften mit seinem NAMEN bezeichnet wird, so vollkommen verkörpert, wie es sich niemals in einem König wie Salomo oder einem Fürsten wie Simon Makkabäus verkörpern konnte, dann könnte ich ihm zustimmen.
Es ist, als werde die alte Prophetenrede hier mit verteilten Rollen neu aufgeführt. Der, der unerkannt bereits mitten unter Israel steht (mesos hymōn hestēken hon hymeis ouk oidate: 1,26), erkennt in Nathanael den truglosen Repräsentanten des bewahrten Restes Israels und der wiederum erkennt in Jesus den zum endzeitlichen Weiden seines Volkes gekommenen basileus tou Israēl {König von Israel}.
Wieder bleiben bei Thyen zwei Fragen offen: Erstens, wie dieses „endzeitliche Weiden seines Volkes“ konkret gemeint ist, im Sinne einer jenseitigen Rettung oder eines diesseitigen Friedens. Und zweitens, welches Volk Johannes hier im Sinn hat. Weitere Gedanken, die Thyen anfügt, geben in dieser Hinsicht zu denken (T143):
Zudem erweckt Jesu Wort über Nathanael vom ,Israeliten ohne Trug‘ Assoziationen an Jakob, der sich durch Trug seines Vaters Erstgeburtssegen erschlich und in der Stunde seines nächtlichen Ringens mit dem Engel Gottes den Ehrennamen Israel erhielt. Denn da V. 51 am Ende noch ausdrücklich aus der Erzählung von Jakobs Traum in Bethel zitieren wird, liegt diese Jakobs-Erinnerung ja gleichsam über unserer Szene „in der Luft“ [Steiger 53]: „Nathanael ist derjenige, der den von JHWH vor seinem Tag übriggelassenen Rest Israels vertritt und die Hoffnung aufbewahrt sein läßt, daß JHWH dereinst sein ganzes Volk retten wird: ,Deswegen werde ich euch namhaft machen und zum Lobpreis unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euch, spricht der Herr‘ (Zeph 3,20). Nathanael ist der erwählte Vertreter Israels, der übereinstimmend mit Zeph 3,13 insofern keinen dolos {Trug} hat, als er keine glōssa dolia {betrügerische Zunge} hat. Er steht im JohEv als Mahnmal für uns Christen und will uns dessen eingedenk werden lassen, daß das endzeitliche Handeln Gottes doch erst dann zur Erfüllung gekommen sein kann, wenn die Rettung Israels in die Rettung ganz Israels nach Zeph 3,20 gemündet sein wird“.
Hier bestätigt Thyen (wieder unter Berufung auf Steiger [vgl. 72f.]), dass Jesus im Johannesevangelium trotz seiner Ablehnung als des Königs von Israel durch die Mehrheit der Juden am Ziel der Sammlung ganz Israels festhält. Als „Mahnmahl für uns Christen“ würde Nathanel aber wohl erst dann ernst genommen, wenn wir Menschen aus den Völkern uns als Adressaten des Johannesevangeliums sehr bescheiden hinter den Menschen aus dem eigenen Volk Jesu anstellen würden.
↑ Johannes 1,50-51: Der offene Himmel über dem Menschensohn
1,50 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Du glaubst, weil ich dir gesagt habe,
dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum.
Du wirst noch Größeres sehen als das.
1,51 Und er spricht zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Ihr werdet den Himmel offen sehen
und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren
über dem Menschensohn.
[31. März 2022] Wie ist Jesu Antwort auf das Bekenntnis des Nathanael zu verstehen, das Veerkamp <145> so übersetzt: „Weil ich gesagt habe, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, hast du Vertrauen“? Thyen sieht (T144) „darin keine durch Jesus vorgetragene Kritik des Evangelisten an dem vermeintlich bloß vordergründigen Wunderglauben des Nathanael“, den viele Exegeten auf eine von Johannes mutmaßlich übernommene „Semeiaquelle“ <146> zurückführen. Vielmehr zeigt Nathanael „einen Glauben, der die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, die verheißenen größeren und dem Unglauben verschlossenen Dinge überhaupt wahrnehmen zu können.“ Diese Formulierung lässt natürlich sehr viele Interpretationsmöglichkeiten offen.
Auch Wengst äußert sich (W84) zurückhaltend gegenüber der Annahme einer „Semeiaquelle“, derzufolge etwa nach Jürgen Becker <147> „die gerade gemachte Erfahrung mit dem wunderbaren Wissen Jesu nur ‚eine kleine Kostprobe‘ war, der noch große Wunder folgen“ würden. Er selbst will das Größere, das Jesus hier ankündigt, vom Glaubensbekenntnis der Schüler Jesu in 16,29-32 her verstehen:
Jesus fragt zurück: „Jetzt schon glaubt ihr?“ und kündigt ihnen an, dass sie sich zerstreuen und ihn allein lassen werden. Was sie als ihren Glauben aussagen, ist gewiss nicht falsch, aber es ist sozusagen ein vorzeitiger Glaube, der noch nicht das Kreuz Jesu im Blick hat und sich angesichts dieses Kreuzes erst noch bewähren muss.
Ebenso hat auch der sich im „Bekenntnis Natanaels … aussprechende Glaube … seine Bewährung noch vor sich.“ Das ist sicher nicht falsch, aber will Jesus hier wirklich genau darauf hinaus? Ton Veerkamp sieht ein konkreteres Anliegen Jesu:
Jesus ahnt das Missverständnis, Nathanael denke, mit ihm, Jesus, kämen die großen alten Tage Israels wieder. … Nathanael vertraut darauf, dass er „unter dem Feigenbaum“ sein wird, dass er Frieden erleben wird, und Frieden ist mehr als die Abwesenheit offenen Krieges, Frieden ist Sicherheit, und die ist unter Königen wie Salomo oder Simon nicht wirklich zu haben. Das plastische Bild für das Leben in Sicherheit ist Sitzen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Aber diese Sehnsucht ist nicht genug. Es gibt ein Problem der Weltordnung, das durch diesen Frieden nicht gelöst wird. Zwischen der Vision der Belebung und Vereinigung Israels Ezechiel 37 und den Blueprint für den Wiederaufbau Israels Ezechiel 40-48 steht der Text über Gog aus Magog. Dieser kommt „gegen ein Land von Bauern, auszuplündern Leute, die in Sicherheit siedeln. Alle siedeln sie ohne Mauern, weder Riegel noch Türen haben sie“ (Ezechiel 38,11). Solange es Gog aus Magog gibt, solange gibt es keine wahre Sicherheit. Was ist größer als Frieden für Israel? Eine Weltordnung des Friedens.
Das heißt: Gerade weil der johanneische Jesus nach Veerkamp die ganz diesseitig orientierte Friedenshoffnung der Propheten für Israel positiv aufnimmt, kann er diese nicht in ihrer naiven Form gutheißen, wie sie etwa von den Zeloten propagiert wurde. Ein mit militärischen Mitteln ausgefochtener Sieg über die Unterdrücker wie bei den Makkabäern brächte keine Lösung, da schon damals die Unterdrückung auch unter den neuen Herrschern weiterging. Zudem wusste der Evangelist Johannes aus eigener leidvoller Erfahrung um die verheerenden Folgen des zelotischen Kampfes gegen die Römer im Judäischen Krieg. Über eine Friedenshoffnung hinaus, die sich isoliert auf Israel bezieht, träumt Johannes also tatsächlich von einer Weltordnung des Friedens, die der Messias Jesus gegen die unterdrückende Weltordnung Roms ins Werk setzen wird. Auf welche Weise dies geschehen kann, das deutet Jesus im folgenden Vers an:
Johannes bringt dann ein komplexes Zitat aus der Schrift, das sich auf drei Stellen bezieht, Ezechiel 1,1, Genesis 28,12 und Daniel 7,12. Eingeleitet wird dieses Konglomerat mit dem Satz: „Ihr werdet sehen den Himmel, geöffnet.“ Der Ausdruck kommt nur im Buch Ezechiel vor, in 1,1:
Geöffnet wurden die Himmel
ich sah, Sicht auf Gott: …Was „Sicht auf Gott“ (marˀoth ˀelohim) bedeutet, werden wir noch erfahren.
Was genau Jesu Schüler zu sehen bekommen sollen, wird zunächst durch „die Vision Jakobs“ angedeutet. Dabei verweist Veerkamp nicht nur auf das Bild der Himmelsleiter mit den auf ihr auf- und absteigenden Gottesboten in 1. Mose 28,12, sondern auf den NAMEN, der sich über Jakob aufstellte und zu ihm sagte (1. Mose 28,13):
„ICH BIN ES, der NAME,
der Gott Abrahams, deines Vaters,
der Gott Isaaks.
Das Land, das ich ihm zuschwor,
dir werde ich es geben, und deinem Samen…“Was sie zu sehen bekommen, hat mit Israel zu tun, mit der Landverheißung. Heute gehört das Land anderen, durch den Messias wird es Israel gehören.
Schließlich „kommt das dritte Element“ hinzu, der so genannte Menschensohn. Veerkamp lässt ihn in der Regel unübersetzt in seinem aramäischen Wortlaut „bar enosch“ stehen und fügt zur Klärung das Wort „MENSCH“ in Großbuchstaben hinzu. Diese Vision ist nur vom Buch Daniel her zu verstehen:
Daniel schaute, wie im Himmel Throne aufgestellt werden für einen „Fortgeschrittenen an Tagen“, unzählige Wesen standen vor ihm. Dann heißt es, 7,10-14:
Das Gericht setzt sich, Bücher werden geöffnet.
Eine Vision geschah mir danach,
wegen der Stimme großspuriger Redensarten,
die das Horn (der Großkönig Syriens) redete,
eine Vision geschah mir,
das Tier (das Königtum Syriens) wurde getötet,
sein Leichnam vernichtet und der Feuerglut übergeben.
Die Regierung der übrigen Tiere (Königreiche) wurde befristet,
Lebensdauer wurde ihnen gegeben für eine befristete Zeit.
Ich schaute, eine Nachtvision:
Da kam mit den Wolken des Himmels ein bar enosch, ein MENSCH,
zum Fortgeschrittenen an Tagen ging er,
er wurde vorgeleitet bis in seine Nähe.
Ihm wurde die Regierungsmacht übergeben, die Würde, das Königtum,
alle Völker, Gemeinschaften und Sprachgruppen erwiesen ihm die Ehre.
Seine Regierung wird eine Regierung in Weltzeit sein, unbefristet,
sein Königtum wird nicht zerstört.Diese Vision hat die Wucht des Volkswillens, sich nicht auf Dauer der Macht der Raubtiere, die bis dahin über Israel herrschten, zu ergeben (Daniel 7,1ff.). „Das Gericht setzt sich, Bücher werden geöffnet.“ Was jetzt kommt, ist nichts Tierisches mehr, jetzt kommt einer „wie ein Mensch“. Der Ausdruck „Sohn eines Menschen“ oder „Menschensohn“ bedeutet schlicht: „ein MENSCH“. Wir schreiben das Wort groß, um einen ganz bestimmten Menschen mit einem ganz bestimmten Auftrag zu bezeichnen. Die Macht tierischer Königreiche ist eine befristete, die Macht des Humanen ist eine unbefristete Macht. Mit den Wolken des Himmels kommt etwas, was noch nie war: die Macht des Humanen, verkörpert durch das Volk der Heiligen des Höchsten, durch Israel (Daniel 7,27). Und dieses Humane ist zugleich Maß des Rechts und Vollstrecker des Rechts.
Wir hatten ja schon gesehen, dass in Veerkamps Augen Jesus schon als der monogenēs para patros, als der „Einziggezeugte beim VATER“ (1,14), zunächst einmal Isaak und damit Gottes erstgeborenen Sohn, nämlich Israel (2. Mose 4,22), verkörpert. Hier macht Johannes deutlich, in welcher Weise Jesus das tut:
Die Verkörperung dieses Israels, dieses bar enosch, dieses MENSCHEN, ist für Johannes der Messias Jesus ben Joseph aus Nazareth. Immer wenn wir bei Johannes den Ausdruck bar enosch, „Menschensohn“, hören – wir schreiben „MENSCH“ -, müssen wir diese Vision mithören.
Klaus Wengst setzt in seiner Auslegung von Vers 51 andere Akzente. Wichtig ist ihm vor allem (W85), dass Johannes eine bestimmte „Leseweise des hebräischen Textes von Gen 28,12“ aufnimmt,
der an seinem Schluss nicht eindeutig ist. Er kann so gelesen werden, dass Engel Gottes hinauf- und herabsteigen „auf ihr“, nämlich der Leiter. Es ist aber auch möglich, den Text so zu verstehen, dass Engel hinaufsteigen und herabsteigen „auf ihn“, nämlich Jakob.
In rabbinischen Texten kann diese zweite Auslegung damit verbunden werden, dass die herabsteigenden Engel das Gesicht Jakobs sehen und sagen:
„Das ist das Gesicht gleich dem Gesicht des Wesens (nämlich dem Ez 1,10 genannten Menschengesicht), das am Thron der Herrlichkeit ist“. <148> Dass diese Tradition im Hintergrund von Joh 1,51 stehen muss, zeigt sich daran, dass nicht vom Hinauf- und Herabsteigen der Engel auf der Leiter gesprochen wird, sondern vom Herabsteigen der Engel auf Jesus. Dass er hier als „der Menschensohn“ bezeichnet wird, dürfte ebenfalls durch diese Tradition veranlasst sein, nämlich durch die Rezeption von Ez 1,10.
Ich halte diesen Bezug auf Hesekiel 1,10 jedoch für äußerst unwahrscheinlich, da es nach Hesekiel 1,5 um vier menschenähnliche Wesen geht, die vier verschiedene Gesichter tragen: das Gesicht eines Menschen, Löwen, Stiers und Adlers; außerdem steht für „Mensch“ dort einfach ˀadam und anthrōpos, und nicht ben ˀadam oder bar ˀenosch, „Menschensohn“, wie in Daniel 7. Selbst wenn Johannes auf diese Stelle anspielen sollte, welche Absicht würde er damit verfolgen wollen, außer vielleicht, um die Bezugnahme auf den Menschensohn von Daniel 7,13-14 zu verstärken?
Diese Linie verfolgt Wengst aber gar nicht weiter. Ihm kommt es erstens darauf an, dass Johannes durch seinen Bezug auf den Jakobstext nicht
als „den wahren Jakob“ begreife und so diesen Text von Jakob wegziehe. Das von Jakob Gesagte ist Text seiner Bibel. Dass die gilt und in Geltung bleibt, ist Voraussetzung der Interpretation.
Zweitens ist nach Wengst
zu bedenken, dass Jakob zugleich auch für das Volk Israel steht. Wieder dürfte es also so sein: Was von Jakob als Urbild Israels und damit von ganz Israel gilt, ist hier auf Jesus als den einen aus Israel konzentriert. Mit der Anspielung auf Gen 28 gibt der Evangelist Jesus als „das Haus Gottes“ (vgl. 2,19-22) zu verstehen, als Ort der Gegenwart Gottes.
Dazu zitiert Wengst (Anm. 49) Christian Dietzfelbinger: <149> „Die Engel von 1. Mose 28,12 dienen hier also dazu, um Jesus als die Stelle verständlich zu machen, an der die himmlische Welt in das Irdische einbricht“.
In der Identifikation Jesu mit Israel über die Gestalt des Jakob berührt sich Wengst mit Veerkamps Anliegen; auch der Gedanke, dass Beth-El als das Haus Gottes auf Jesus als den neuen Tempel Gottes zu beziehen sei, kann zutreffen. Zur Frage des Einbruchs der himmlischen Welt in das Irdische muss aber noch genauer nachgefragt werden, was damit konkret gemeint sein soll.
Nochmals betont Wengst einen dritten Punkt, der ihm am Herzen liegt, nämlich dass im „Fortgang des Evangeliums … nun keineswegs erzählt“ wird (W85f.),
dass Natanael und die übrigen Schüler tatsächlich Engel hinaufsteigen und auf Jesus herabsteigen sehen. Es werden Begebenheiten erzählt, die sie und die Leser- und Hörerschaft gewiss machen sollen, dass Gott wirklich in Jesus gegenwärtig ist. Was sie aber schließlich „sehen“ werden, ist dies, dass Jesus ans Kreuz geht. Von hier aus bekommt für diejenigen, die das Evangelium nicht zum ersten Mal lesen, die Bezeichnung „Menschensohn“ Bedeutung. Sie begegnet im Evangelium häufig im Zusammenhang der Rede von der Erhöhung und Verherrlichung Jesu, die auf seine Kreuzigung bezogen ist (z. B. 3,14; 8,28): Darauf wird es ankommen, gerade den gekreuzigten Jesus als Ort der Herrlichkeit Gottes zu erkennen.“
Offen bleibt dabei jedoch, inwiefern der Gekreuzigte als „Ort der Herrlichkeit Gottes“ zu erkennen ist, ja, worin überhaupt diese Herrlichkeit besteht. Nach Veerkamp ist die Herrlichkeit oder Ehre Gottes engstens mit dem Leben Israels im Frieden der kommenden Weltzeit verbunden; auf den Anbruch dieser Weltzeit und nicht etwa nur auf ein ewiges Leben im Himmel soll die Ermordung des Menschensohns durch die römische Weltordnung hinauslaufen, die gerade dadurch überwunden wird, dass Jesus den Tod freiwillig auf sich nimmt, aus der Treue und liebevollen Solidarität (alētheia und agapē) des NAMENS heraus.
Hartwig Thyen betont bei der Auslegung von Vers 51 noch einmal andere Aspekte. Wie wichtig Johannes das in diesem Vers von Jesus Gesagte nimmt, zeigt ihm zufolge (T145) das „hier zum ersten Mal“ und „nur bei ihm, und da gleich 25-fach vorkommende doppelte und nicht-responsorische amēn amēn“:
Sein „Amen, ich sage euch“ ist wohl ein Zeichen jener exousia {Vollmacht}, die seine Zeitgenossen in Erstaunen versetzte (Mk 1,22f par.) und dessen „implizite Christologie“ später ihre österliche Explikation fordern sollte. Der jedem Hörer solcher Amen-Worte auffallende Witz besteht dann darin, daß hier einer das vertraute responsorische Amen atl. Texte und zumal der jüdischen Liturgie zur solennen {feierlichen} Eröffnung seiner Rede gemacht hat.
Weiter (T144) sieht Thyen in Vers 51 „ein intertextuelles Spiel mit Mt 26,64 und seinem Kontext“, wofür rein formal spricht, dass einige Handschriften die dortige „Zeitbestimmung ap‘ arti“, „von nun an“, auch hier einfügen. Dort antwortet Jesus auf die Frage des Hohenpriesters, ob er „der Christus, der Sohn Gottes“ ist:
26,64 Du sagst es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.
Dort wie hier werden mit der Selbstbezeichnung Jesu als dem Menschensohn, die hier zum ersten Mal im Johannesevangelium auftaucht, „die vorausgegangenen messianischen Bekenntnisse präzisiert und vertieft“; dort wie hier folgt auf die Anrede des Hohenpriesters (T145) bzw. Nathanaels durch Jesus im Singular „gänzlich unvermittelt“ eine Anrede im Plural, was „als absichtsvolle und abschließende Anrede aller seit V. 35 zu Jesus gekommenen Jünger, des durch Nathanael repräsentierten Restes Israels, sowie des Modell-Lesers in unserem Text verstanden sein“ will. Auch Wengst meint, ohne auf die synoptische Parallele einzugehen (W83), dass über Nathanael „gleichsam wieder die Leser- und Hörerschaft des Evangeliums Adressat des Sprechens Jesu“ ist.
Auffällig ist für Thyen auch (T146), dass die Zusammenschau
des „Menschensohnes“ mit den „Engeln Gottes“, die in den synoptischen Evangelien stets im Zusammenhang mit der verheißenen Parusie {Wiederkunft} Jesu zum Weltgericht erscheint (Mt 16,27 // Mk 8,38 // Lk 9,26; Mt 25,31; vgl. 2Thess 1,7), hier im Gegensatz dazu gerade den irdischen Weg Jesu mit seinen Jüngern eröffnet. Und diese Versetzung der Engel, die den Menschensohn bei seinem Erscheinen zum Gericht umgeben, aus dem Eschaton {dem Letzten} in die archē {den Anfang} des Weges Jesu mit seinen Jüngern ist gewiß kein Zufall.
Zur Begründung wird Thyen in seiner weiteren Auslegung
zeigen, daß und wie das gesamte Johannesevangelium gerade den Weg des irdischen Jesus als das definitive und befreiende Gericht Gottes über den archōn tou kosmou toutou {Fürst dieser Welt} (12,31; 14,30; 16,11) darstellt. Was Jesus Mt 26,64 mit dem Zitat von Dan 7,13 seinen Feinden als zukünftig- und öffentlich-sichtbares Geschehen verkündet, das verheißt er Joh 1,51 denen, die an ihn glauben: Sie, die er 15,14 seine Freunde und österlich endlich seine Brüder (20,17) nennen wird, sollen an seiner irdischen Gegenwart seine Herrlichkeit sehen und erfahren.
Ich erwarte mit Spannung, wie Thyen dieses „befreiende Gericht Gottes“ konkret verstehen wird und, insbesondere, wer in seinen Augen der Fürst dieser Welt ist.
Nun aber zur Vision Jesu selbst, wie Thyen sie auslegt. Weil das Wort aneōgota, „geöffnet“, das sich auf den Himmel bezieht, im Perfekt steht, geht er davon aus, dass seit der Vision des Johannes von dem Geist, der „wie eine Taube vom Himmel herabfuhr und auf ihm blieb“ (1,32), „der Himmel offen“ geblieben ist – in meinen Augen eine ziemlich seltsame Schlussfolgerung, da es sich in beiden Fällen um eine Vision und nicht um einen am Himmel wahrnehmbaren Zustand handelt.
Im Blick auf die (T147) rabbinische Debatte über die Auslegung von 2. Mose 28,12, „ob die Engel nun auf Jakob oder auf der Leiter hinauf- und herabgestiegen seien“, will Thyen nicht Jesus an die Stelle von Jakob setzen und die Engel als die himmlischen Mächte ansehen, die „die Verbindung zwischen der himmlischen Erscheinung, der Herrlichkeit, doxa, Christi und seinem Erscheinen im Fleisch herstellen“, <150> denn erstens kann man „nirgendwo in unserem Evangelium auch nur den Schatten eines derartigen platonischen Idealismus“ entdecken, und da zweitens Nathanael „den treuen Rest Jakob/Israels“ repräsentiert, kann jetzt nicht „Jesus in dessen Rolle“ schlüpfen. Darum wird man, so Thyen,
mit der LXX, die das epi {über, auf} ja auf die Leiter bezieht, den „Sohn des Menschen“ als die Jakobs-Leiter in den fortan stets offenen Himmel begreifen müssen. Das entspricht auch dem Wort des scheidenden Jesus: egō eimi hē hodos kai hē alētheia kai hē zōē; oudeis erchetai pros ton patera ei mē di‘ emou {Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denndurch mich} (14,6).
Das heißt (T148), „Jesus als der Menschensohn“ ist Thyen zufolge „hier leibhaftig an die Stelle der von Jakob einst nur erträumten Himmelsleiter getreten“. Dabei folgt er inhaltlich Delbert Burkett, <151> den er ausführlich folgendermaßen zitiert:
„Dies ist die einzige Interpretation, die sowohl der Grammatik der Aussage Jesu gerecht wird als auch die Parallele zwischen Jakob und den Jüngern aufrechterhält. Wie Jakob werden sich die Jünger in Bethel, dem Haus oder Haushalt Gottes, d. h. der Gemeinschaft des Volkes Gottes, wiederfinden. Wie Jakob werden die Jünger eine Verbindung zwischen dem Haus Gottes auf Erden und Jahwe im Himmel sehen. Anders als Jakob werden sie nicht eine Leiter sehen, sondern den Menschensohn, ‚der auf der Erde steht und dessen Haupt bis zum Himmel reicht‘, als Verbindung zwischen Gott und dem Haus Gottes. Wie Jakob werden sie sehen, wie engelhafte Diener durch diese Verbindung von Gottes Haus zu Gott aufwärts und von Gott zu seinem Haus abwärts gehen“.
Bei dieser von Thyen geteilten Auffassung muss aber gefragt werden, ob eine solche Vorstellung von einem dauerhaft geöffneten Himmel im jüdischen Denkhorizont des Evangelisten Johannes überhaupt möglich ist. Christlich verstanden macht diese Vorstellung keine Probleme, wenn man sie darauf bezieht, dass die Menschen, die an Jesus glauben, vereinfacht ausgedrückt, in den Himmel kommen können. Aber in der jüdischen Bibel ist ein solches „in den Himmel kommen“ eine absolute Ausnahme von der Regel, die von Elia (2. Könige 2,11) und vielleicht noch von Henoch (1. Mose 5,24) ausgesagt wird. Stattdessen muss davon ausgegangen werden, dass Johannes als Jude ganz andere Vorstellungen vom geöffneten Himmel im Hinterkopf hat. Dazu schreibt Ton Veerkamp:
Das „Größere“, das Nathanael und seine Mitschüler sehen werden, ist dreierlei.
Sie werden „Sicht auf Gott“ bekommen, also „die Himmel geöffnet“. Der Himmel, das zweite Schöpfungswerk Gottes, ist das Gewölbe (raqiaˁ), das das Oberirdische vom Irdischen abschirmt. Es ist also gut, dass der Himmel geschlossen bleibt. Wird er geöffnet, geschieht das Unheil der Flut, „die Schleusen des Himmels wurden geöffnet“, Genesis 7,11.
Wenn weiter die Himmel geöffnet werden, dann wird zweitens Israel eine irdische Zukunft erschlossen: das Land.
Drittens aber werden die Himmel geöffnet, damit Recht geschieht für die Erde und ihre Bewohner, Jesaja 24,18. Die Schüler werden sehen, dass endlich Recht geschehen wird, Gottesrecht. Es kommt „vom geöffneten Himmel“, Ezechiel 1,1, mit dem „MENSCHEN“, Daniel 7, für Israel, Genesis 28,10ff. Es werden die Schriften erfüllt werden.
In der Schrift ist der Himmel nach Psalm 115,16 nur Gott vorbehalten, und vom Himmel her erhalten Menschen auf der Erde unter dem Himmel Gottes die Möglichkeit, menschenwürdig zu leben. Das zieht sich bis in die letzten Seiten auch der messianischen Schriften durch, wo in der Offenbarung des Johannes (21,2.10) das himmlische Jerusalem auf die Erde herabkommt und nicht etwa die Menschen in den Himmel.
Im Vorgriff (T148) auf die „Auslegung der folgenden Menschensohn-Worte in ihren jeweiligen Kontexten“ sieht Thyen übrigens die Selbstbezeichnung Jesu „als ‚der Sohn des Menschen‘ geradezu als die Übersetzung oder Umsetzung der hymnischen Prologaussage“ von seiner Fleischwerdung in die Erzählung des Evangeliums:
[S]o klingt … in dem definierten ho hyios tou anthrōpou {der Sohn des Menschen} als der Synthese aus dem vergleichenden „wie ein Mensch“ und dem generischen {die Gattung betreffenden} ben ˀadam {Sohn Adams} der Bibel stets mit, daß hier der irdische Mann aus Nazaret von sich als einem Menschen unter Menschen spricht…
Das heißt für Thyen weiter (T149), dass „das Prädikat ‚der Sohn des Menschen‘ … ganz buchstäblich Gottes durch seinen fleischgewordenen logos vermittelte Beziehung zu den Menschen“ bezeichnet, während „Jesu Relation zu Gott … durch sein ungleich häufigeres Reden vom ‚Vater, der ihn gesandt hat‘ und von sich als dem ‚Sohn‘ und durch seine Benennung als der ‚Sohn Gottes‘ angemessen zur Sprache gebracht“ wird.
Vor dem Hintergrund all dieser Ausführungen Thyens bleibt in der Schwebe, ob und wie die „johanneischen Menschensohn-Worte“ in seinen Augen auch direkt von Daniel 7,13 her beeinflusst sind. An einer Stelle deutet er an (T148), dass dieser Bezug „wohl durch die synoptischen Evangelien“ vermittelt wurde, an einer anderen formuliert er (T149) einen Satz, der an die Veerkampsche Auslegung erinnert:
Denn erst wenn der ,Menschenähnliche‘ aus Daniels Vision in dem wirklichen Menschen Jesus Fleisch und Blut gewonnen hat, gewinnt auch der absichtsvolle Kontrast zwischen dem gerechten ,Menschenähnlichen‘ und den zuvor erschienenen vier unmenschlichen Bestien aus Daniels Vision irdische Realität.
Jedenfalls richtet Vers 51 (T149f.)
den Blick auf Jesu Menschsein, an dem seine Jünger das Nathanael verheißene ‚Größere‘ wahrnehmen sollen.
In Thyens abschließendem Satz (T150) zu dieser Szene könnte man auch eine Kritik an der Auffassung von Wengst erblicken, der ja, wie oben mehrfach erwähnt, das von Jesus angekündigte „Größere“ vor allem in der Bewährung der Jünger angesichts des Kreuzes Jesu sieht:
Darum sollte man die Erfüllung der mit V. 51 gegebenen Verheißung nicht so ungeduldig in der isolierten Kreuzigung Jesu sehen, sondern mit den nachfolgenden Jüngern wahrnehmen, wie sie sich, angefangen mit dem Kana-Wunder (2,11!), Schritt für Schritt entfaltet. Auch Jesu Kreuzigung kann als „Erhöhung“ des Menschensohnes und als Vorschein der göttlichen doxa nur verstanden werden, wenn sie als das notwendige Ziel der Liebe Jesu zu seinen Freunden begriffen ist (vgl. Joh 15,13).
Damit sind wir am Ende des ersten Johannes-Kapitels angelangt, Veerkamp zufolge auch am Ende der Einleitung zur Erzählung des Johannes, in der die Sammlung der Schüler Jesu beispielhaft dargestellt wird:
Jetzt muss aus den „gefundenen“ Schülern messianische Gemeinde werden.
↑ Messianische Hochzeit und messianische Gemeinde (Johannes 2,1-12)
[1. April 2022] Vor die Auslegung der Erzählung von der Hochzeit zu Kana stellen Thyen und Wengst klärende Vorbemerkungen. Hartwig Thyen betont (T151) den Verzicht „auf jeglichen analytischen Versuch, hinter ihr eine vermeintliche Quelle entdecken zu wollen“ <152> und dabei etwa „auf den Weingott Dionysos“ zurückzugreifen:
Denn wer in einem jüdischen Kontext Juden und der Synagoge assoziierte Gottesfürchtige durch die Mühe der Komposition eines Evangeliums davon überzeugen will, daß „Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes“ (20,30f), der wird ihn dazu doch gewiß nicht als den Konkurrenten eines heidnischen Götzen auftreten lassen.
Auch Klaus Wengst wehrt sich (W87) gegen Versuche, den Stoff der Erzählung „religionsgeschichtlich“ auf die heidnische „Dionysos-Legende“ zurückzuführen, insbesondere (Anm. 53) gegen die Annahme von Peter Wick, <153> „daß das ganze Evangelium sich implizit oder explizit mit dem Dionysoskult auseinandersetzt“. Ich selbst habe mich in meinem Beitrag Jesu Fleisch kauen – wie beim Gott Dionysos? intensiv mit ähnlichen Vorstellungen der Exegetin Esther Kobel <154> auseinandergesetzt.
Ton Veerkamp <155> streift solche Auslegungsversuche nur kurz, indem er sie einem angemessenen Verständnis von den jüdischen Schriften her gegenüberstellt:
Jedenfalls führt Jesaja tiefer in das Geschehen ein als das Dionysosfest auf Andros, wo drei Tage lang aus den Tempelquellen Wein statt Wasser gesprudelt haben soll. Das leuchtete Rudolf Bultmann ein; <156> unser Licht stammt aus einer anderen Quelle!
Alle drei Exegeten, auf die ich mich beziehe, sind sich weiterhin darin einig, dass eine antijüdische Auslegung der Erzählung nicht in Frage kommt, indem man in ihr (W88, Anm. 54) etwa <157> das „Motiv der Ablösung und Überbietung der jüdischen Religion durch den christlichen Glauben“ finden will.
↑ Johannes 2,1a: Eine Hochzeit zu Kana in Galiläa am dritten Tage
2,1a Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa.
[2. April 2022] Zur Zeitbestimmung tē hēmera tē tritē, „am dritten Tag“, schließt Wengst (W89) entgegen der Ansicht von Pinchas Lapide <158> aus, dass Johannes damit den dritten Wochentag nach jüdischer Zählung meint, der „unserem ‚Dienstag‘“ entspricht und „ein in Israel und im Judentum beliebter Hochzeitstag“ ist. Denn in der Mischna werden andere Wochentage als Tage der Heirat genannt, und erst später, also keinesfalls zur Zeit des Johannes, kam es zu dem von Lapide genannten Brauch.
Es bleibt also dabei, dass der dritte Tag die bisher beschriebenen vier (Thyen, Veerkamp) bzw. fünf Tage (Wengst) zu einer ganzen Woche von sechs (Thyen) bzw. sieben Tagen (Wengst, Veerkamp) vervollständigt.
Zugleich verweisen sowohl Wengst als auch Veerkamp <159> auf den von Paulus und den Synoptikern her vertrauten dritten Tag als den Auferstehungstag Jesu:
Der dritte Tag ist eine ständige Figur in den anderen Evangelien; er bezeichnet den Tag der Auferstehung. Für Paulus war dieser dritte Tag bereits eine traditionelle Vorstellung, 1 Korinther 15,4. Johannes weiß, davon können wir mit Sicherheit ausgehen, was Messianisten mit dem dritten Tag verbinden.
Ähnlich schreibt Wengst (W89):
Für die Leser- und Hörerschaft kann es aber bei der Wendung „am dritten Tag nicht ausbleiben, dass sie dabei auch noch eine andere Assoziation hat und an den Auferstehungstag Jesu denken muss. So wird also gleich zu Beginn dieser Erzählung auch die österliche Dimension aufgerissen.
Auch diese Assoziation kann allerdings nicht die Auffassung der beiden stützen, den dritten Tag als den siebten Tag einer vollen Woche zu begreifen, denn der Auferstehungstag wird bei Johannes mehrfach (20,1.19) als mia tōn sabbatōn, „Tag eins der Sabbatwoche“, beschrieben.
In meinen Augen macht die hier nochmals von Thyen begründete Auffassung mehr Sinn (T152):
Als der dritte ist dieser Tag wohl wie üblich unter Einschluß des Tages der Begegnung Jesu und Nathanaels gezählt und darum der sechste Tag der unser Evangelium eröffnenden Woche. Diesen sechs Tagen der ersten Woche mit der Offenbarung der doxa {Herrlichkeit} Jesu am sechsten Tag (2,11) entsprechen die sechs Tage der letzten Woche Jesu: Sie wird „sechs Tage vor dem Passa“ (pro hex hēmerōn tou pascha: 12,1) mit Jesu „Salbung im judäischen Bethanien“ und seinem Einzug in Jerusalem eröffnet und kulminiert in der Erscheinung der Herrlichkeit des Gekreuzigten und seinem Begräbnis am sechsten Tage (12,1-19,42…).
Dennoch mag ein Spiel mit der synoptischen Vorstellung vom dritten Tag vorliegen, auf das Thyen hier seltsamerweise nicht ausdrücklich eingeht, <160> indem Johannes diese Formulierung bewusst hier und nicht im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu verwendet, um den Tag der Kreuzigung als den eigentlichen Tag der Erhöhung und Verherrlichung Jesu hervorzuheben.
Die Ortsbestimmung en Kana tēs Galilaias, „in Kana, Galiläa“, wird sowohl von Wengst als auch von Thyen (T153) „als ein realer Ort auf der Landkarte Palästinas“ verstanden. Außerdem mag nach Thyen „der Ortsname Kana symbolische Obertöne ins Spiel“ bringen, „zumal er durch das hier erstmals auftauchende tēs Galilaias näher bestimmt wird“:
Denn wie unten zu 4,43ff u. ö. zu zeigen sein wird, sind Galiläa (Kana) und Judäa (Jerusalem) in unserem Evangelium oppositionelle geographische Symbole: Während Galiläa als der Ort des Glaubens die Heimat derer ist, die Jesus nachfolgten, ist Judäa/Jerusalem – obgleich die idia patris {eigenes Vaterland bzw. Vaterstadt} des in sein ,Eigentum ‘ gekommenen logos – Ort seiner Ablehnung und der Feindschaft gegen ihn…
Veerkamp beschreibt diesen Gegensatz zwischen Galiläa und Judäa, zwischen Kana und Jerusalem, nicht als religiösen Gegensatz zwischen Glauben und Unglauben, sondern in politischen Kategorien:
Das Kana aus Josua 19,28 ist ein nördlicher Grenzort des Stammgebietes Ascher. Ascher liegt an der nördlichen Peripherie {Rand}, Kana ist in dieser Peripherie wiederum Peripherie. Der dritte Tag von Johannes 2,1, der Tag der messianischen Hochzeit, findet in der Peripherie der Peripherie statt. Wie Nazareth hat auch Kana keine Befreiungsvergangenheit; mit den großen Ereignissen im Leben Israels hatte es nicht zu tun. Es ist also ein Ort am Rande, wo „nichts los“ war. Die anderen Evangelisten kennen Kana nicht. Kana ist ein theologischer, kein geographischer Ort, so wie der Stern von Bethlehem bei Matthäus kein astronomisches, sondern ein theologisches Objekt ist. Kana ist der Ort für den „Anfang der Zeichen“ und der Ort für das andere (zweite) Zeichen, 4,46. Hier zeigt das politische Programm des Johannes erste Konturen: die Bestimmung Israels, die messianische Hochzeit, geschieht in der Peripherie, und zwar an einem Ort, an den noch niemand gedacht hatte. Das Zentrum (Jerusalem, das politische Establishment Judäas) wird die Perspektive aus der Peripherie zurückweisen.
Obwohl Thyen einer solchen politischen Deutung nicht zustimmen würde und die Formulierung „messianische Hochzeit“ vermeidet, sieht auch er (worauf Wengst gar nicht eingeht) den symbolischen Zusammenhang des Wortes gamos, „Hochzeit“, mit den Schriften der Bibel (T153):
Seit den Tagen Hoseas haben die Metaphern der Ehe und ehelichen Liebe immer wieder dazu gedient, JHWHs Verhältnis zu seinem Volk als die frühe und innige Liebe eines Bräutigams zu seiner erwählten Braut zu beschreiben. Besonders die Rabbinen wissen davon zu sagen, daß mit der Tora als dem Ehevertrag am Sinai das große Hochzeitsfest gefeiert wurde. <161> Trotz des permanenten ehebrecherischen Verhaltens seiner geliebten Braut (vgl. Ez 16 u. Hos 2) baut Gott in seiner ungebrochenen Liebe jedoch auf ihre Umkehr zur Gerechtigkeit und setzt ihrer Untreue seine Verheißung entgegen: „Denn wie der Jüngling eine Jungfrau freit, so wird dein Erbauer dich freien; wie der Bräutigam seine Wonne hat an der Braut, so wird dein Gott seine Wonne haben an dir!“ (Jes 62,5; vgl. Jes 54,4ff; Hos 2,20f; Ez 16,6ff). So ist die Hochzeitsmetapher zum Bild der eschatologischen Erlösung Israels und der Völker geworden (vgl. Mk 2,19; Joh 3,29; Mt 22,1ff; 25,10ff u. ö.).
Während Thyen jedoch das „Bild der eschatologischen Erlösung Israels“ hier sogleich auf die „Völker“ ausweitet und wohl auch in dem bereits zuvor angedeuteten Sinn von Eschatologie als den letzten, jenseitigen Dingen versteht, geht es Johannes nach Veerkamp im prophetischen Sinn der jüdischen Schriften sehr klar um das Vertrauen auf Jesus, „der ‚Größeres‘ ankündigte: die Dinge in der Sicht Gottes zu sehen und zu begreifen, dass es in dieser Hochzeit um Israel geht“:
Hochzeit ist im Sprachraum des Johannes nicht irgendeine orientalische Hochzeit, wo die Familie des Jesus eingeladen war. Seine Sprache wird normiert durch die Sprache der Schrift. Es kann nicht die Rede davon sein, dass Jesus irgendeiner Hochzeitsgesellschaft aus irgendeiner Verlegenheit hilft und sich als Wundermann erweist. Das Urbild der Hochzeit ist die Hochzeit zwischen Israel und seinem Gott. Hier ist an Jesaja 62,4f. zu denken:
Man wird über dich nicht länger sagen: „Verlassen!“
Über dein Land wird man nicht länger sagen: „Verödetes!“
Dich (Israel) ruft man: „Mein-Gefallen-an-ihr“,
und dein Land: „Verheiratet“.
Denn Gefallen an dir hat der NAME gefunden,
und verheiratet wird dein Land.
Wie ein Junge ein Mädchen heiratet,
so heiratet dich der, der dich erbaut.
Und wie der Bräutigam sich ergötzt an seiner Braut,
so ergötzt sich dein Gott an dir.“
Mehr noch als auf prophetische Stellen bezieht Thyen die Hochzeit zu Kana (T154) auf die „Geburt Israels als des Gottesvolkes“ am Sinai, worauf auch (T153) „die hebräische Wurzel qanah (gründen, erwerben)“ anspielen könnte. Für einen solchen Zusammenhang spricht ihm zufolge auch, dass „unsere ‚Hochzeit in Kana‘ ebenso wie die Vermählung Gottes mit seinem Volk am Sinai nach Tagen der Reinigung am ‚dritten Tage‘“ geschieht (2. Mose 19,10-11):
Und der HERR sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag; denn am dritten Tage wird der HERR vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai.
Dazu passt auch, dass „entsprechend dem Auftrag der ‚Mutter Jesu‘ an die Festdiener: ho ti an legē hymin poiēsate {Was er euch sagt, das tut} (V. 5) … einst am Sinai das ganze Volk dreifach [antwortete]: panta hosa eipen ho theos, poiēsomen kai akousometha {Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun} (Ex 19,8; 24.3.7).
↑ Johannes 2,1b-3: Die Mutter Jesu und Jesus mit seinen Jüngern als Hochzeitsgäste
2,1b Und die Mutter Jesu war da.
2,2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.
2,3 Und als der Wein ausging,
spricht die Mutter Jesu zu ihm:
Sie haben keinen Wein mehr.
Die Anwesenheit der Mutter Jesu bei der Hochzeit handelt Wengst (W89f.) ausgesprochen knapp ab:
In der gleich erzählten Geschichte übernimmt sie eine Rolle; deshalb wird sie hier eingeführt. Eine ungleich größere Rolle wird Jesus spielen, vor allem für seine Schüler.
Thyen dagegen (T154f.) will auch die Rolle der Mutter nicht zu gering einschätzen. Während Jesus und seine Jünger ausdrücklich als eingeladene Hochzeitsgäste bezeichnet werden, „heißt es von seiner Mutter einfach: ēn ekei. Sie war dort. Sie gehört zu jener jüdischen Hochzeitsgesellschaft und -feier“, was bestätigt wird
durch die selbstverständliche Autorität, mit der sie den Saaldienern die Weisung erteilt: „Alles, was er euch aufträgt, das tut!“ Und wenn wir diese Wendung im Lichte unseres „Sinai screen“ <162> als ein Spiel mit dem dreifachen: „Alles, was der Herr geboten hat, das wollen wir tun!“ des Volkes Israel sehen dürfen, dann wird deutlich, daß die Mutter Jesu dem Leser hier vorgestellt wird wie zuvor Nathanael, nämlich als eine wahrhafte und toratreue Israelitin, in deren Mund kein Trug ist.
Da (T155) „die Mutter Jesu“ weder hier noch bei ihrem zweiten Auftauchen am Kreuz Jesu (19,25-27) „mit ihrem Eigennamen Maria genannt“ wird, „der den Lesern doch gewiß geläufig war“, geht Thyen davon aus, dass diese „offenbar absichtsvolle Anonymität“ sicher „mit jenem rätselhaften ‚Jünger, den Jesus liebte‘,“ zu tun hat, der ebenfalls anonym bleibt und „neben dem sie dann am Ende auch erscheint.“
Aus all dem kann man nach Thyen jedoch nicht den Schluss ziehen, dass die Mutter Jesu
ein Symbol der Kirche oder womöglich gar nur die Repräsentantin eines hinter dem wahren Glauben des durch den geliebten Jünger repräsentierten Heidenchristentums zurückgebliebenen Judenchristentums wäre, wie Bultmann vermutet. <163>
Vielmehr repräsentiert „Jesu Mutter die toratreue Synagoge“: <164>
Der geliebte Jünger aber, der seinem Herrn als einziger bis nach Golgatha nachgefolgt ist und ihm die Treue gehalten hat, vertritt in der Szene mit der Mutter Jesu nolens volens {wohl oder übel} die Kirche. In der Person seines geliebten Jüngers verweist der sterbende Jesus seine Kirche an die Synagoge als ihre Mutter und macht sie für alle Zeit für sie verantwortlich…
Im Großen und Ganzen stimmt diese Auslegung; tatsächlich steht die Mutter für ein Israel, das bereit ist, den Willen des Messias zu tun. Auch ist Thyens Anliegen zu loben, die Verantwortung der christlichen Kirche für ihre Mutterreligion hervorzuheben, aus der sie hervorgegangen ist. Aber zu bezweifeln ist, ob bereits Johannes die christliche Kirche als eine der jüdischen Synagoge gegenüberstehende neue Religion gesehen hat. Ihm geht es noch darum, ganz Israel (einschließlich Samarias, der Diaspora-Juden und vielleicht einiger Gottesfürchtiger aus den Völkern) in der Gemeinde des Messias zu sammeln. Um diese Sammlung geht es, wenn der geliebte Schüler die Mutter des Messias (19,27) eis ta idia, „in das Eigene“, nehmen soll.
Genau in dieser Richtung beurteilt Veerkamp die Mutter Jesu, wie Johannes sie in die Geschichte einführt:
Sie spielt eine Rolle, die keiner der anderen Evangelisten ihr zuerkannte. Bei Lukas ist sie die handelnde Person in der Zeugungs- und Geburtsgeschichte des Messias. Eine besondere Rolle erwächst ihr daraus nicht, ganz im Gegenteil: die Synoptiker weisen jeden Anspruch auf eine herausgehobene Funktion in der messianischen Gemeinde schroff zurück: „Wer ist schon meine Mutter, wer sind meine Brüder“, fragt der Messias. „Wer den Willen meines VATERS in den Himmeln tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter“, Matthäus 12,50, vgl. Lukas 8,21 und Markus 3,23.
Bei Johannes spielt die Mutter gerade beim „Anfang der Zeichen“ eine entscheidende Rolle. Die Mutter Jesu gehört an erster Stelle zur Hochzeitsgesellschaft, Jesus und seine Schüler wurden danach herbeigerufen. Gerade sie stellt einen gravierenden Mangel fest, der das Hochzeitsfest unmöglich macht: „Wein haben sie nicht.“ „Wein“ steht am Anfang des Satzes, er ist die Hauptsache. Gerade diese Hauptsache fehlt. Die Mutter Jesu steht also zwischen dem Messias mit seinen Schülern und der Hochzeitsgesellschaft. Sie vermittelt zwischen Israel und dem Messias.
Später wird Veerkamp <165> auf die Frage eingehen, inwiefern guter Wein die Hauptsache beim messianischen Hochzeitsfest ist; im Hintergrund sieht er das Weinberggleichnis aus Jesaja 5,1ff., dem zufolge der Gott Israels „von seinem Weinstock Israel … guten Wein“ erhoffte, aber bitter enttäuscht wurde (Jesaja 5,2.7 nach Luther 2017):
Er … wartete darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. … Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
Worin aber könnten dieser Rechtsbruch und diese Schlechtigkeit bestehen, auf die Johannes das Weinberggleichnis in seiner Zeit bzw. der Zeit Jesu bezieht? Unter der Römischen Herrschaft ist es dem Volk Gottes ja gar nicht mehr möglich, nach der Tora in Freiheit und Gerechtigkeit zu leben. Der judäischen Führung wirft Johannes jedenfalls vor, mit der Weltordnung der Unterdrückung und Ausbeutung gemeinsame Sache zu machen, was eindeutig aus 19,15 hervorgeht, wo die Hohenpriester erklären: „Wir haben keinen König außer dem Kaiser.“
Um diesen Mangel an gutem Wein geht es in Johannes 2,3, ihn bringt die Mutter des Messias zur Sprache.
Thyen legt diesen Vers folgendermaßen aus (T155):
Mit dem meisterhaft knappen Syntagma {Wortverbindung} kai hysterēsantos oinou {wörtlich: mangelnden Weines oder zur Neige gegangenen Weines wegen} legt unser Erzähler den Grund für alles Folgende, nämlich sowohl für den dramatischen Wortwechsel der Mutter mit ihrem Sohn (V. 3f) als auch für das dann dennoch erfolgende Weinwunder, durch das Jesus den Umschlag des Mangels in unausschöpfliche Fülle vollbringt (V. 5-10). Hinter den scheinbar nur feststellenden Worten der Mutter: oinon ouk echousin {Wein haben sie nicht} verbirgt sich sowohl ihre Bitte an den Sohn, diesen Mangel doch zu beseitigen, als auch ihr Vertrauen in seine Kraft dazu.
Wengst dagegen (W90) beschreibt hier lediglich „eine prekäre Lage“ für den Hausherrn, dem es „als Pflicht obliegt, ‚seine Kinder und Hausangehörigen zu erfreuen. Womit erfreut er sie? Mit Wein! Denn es ist gesagt (Ps 104,15): Und Wein erfreut des Menschen Herz.“ <166>
↑ Johannes 2,4-5: Jesu Wort zur Mutter über seine Stunde und ihr Wort zu den Diensthabenden
2,4 Jesus spricht zu ihr:
Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?
Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
2,5 Seine Mutter spricht zu den Dienern:
Was er euch sagt, das tut.
[3. April 2022] Nach der Lutherübersetzung reagiert Jesus auf die Mangelanzeige seiner Mutter sehr schroff. Hat er, wie Thyen meint, obwohl er doch (T155) „wirklicher Sohn dieser besorgten irdischen Mutter“ ist, das Recht dazu, weil er sich „als der von seinem himmlischen Vater Gesandte nicht umstandslos in die Geschäfte der Irdischen verwickeln“ lassen muss? Oder kommt in dieser „Distanzierung des ‚Fremden vom Himmel‘ <167> von seiner irdischen Mutter“ nun doch eine ähnlich kritische Haltung gegenüber der Familie Jesu zum Ausdruck wie in Markus 3,31-35?
Die Anrede gynai, „Frau“, findet Thyen befremdlich; die Frage ti emoi kai soi?, wörtlich „was mir und dir?“ nennt er (T155f.) zwei Mal eine „rhetorische Frage“. In seinen Augen (T156) erinnert sie an „jenen Aufschrei der Dämonen…, die mit dem Auftreten Jesu ihre letzte Stunde gekommen sehen“ (Markus 1,24):
Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes!
Zugleich aber mag nach
dem emphatischen Bekenntnis des Johannes, daß er nicht Elia sei (s. o. zu 1,21), … das Weinwunder von Kana aber zugleich auch an Elias Mehl- und Ölwunder von Zarepta erinnern und das ti emoi kai soi? … daran, daß die Witwe und Mutter des toten Knaben den Propheten fragte: ti emoi kai soi, anthrōpe theou? {Was hab ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? (1 Könige. 17,18)} (s.u. zu 4,46-54).
Wengst zufolge (W90) ist Jesu Antwort zwar „nicht ganz so abweisend“, es geht jedenfalls „nicht um die Aufkündigung oder Bestreitung von Gemeinschaft.“ Die Wendung „was mir und dir?“, zu der er (Anm. 61) auf Richter 11,12; 2. Samuel 16,10; 2. Könige 3,13 verweist,
fragt abwehrend, wieso sich aus der beiderseitigen Beziehung das Verhalten des Partners ergibt. Die Anrede entspricht einem „Madame“. So redet etwa <168> ein Armer die Frau Hillels an. Gegenüber der Mutter zeigt diese Anrede jedoch, wie auch die Frage im Ganzen, eine ungewöhnliche Distanz.
Nach Ton Veerkamp <169> ist die „Die Anrede ‚Frau!‘ (gynai) … weder respektlos noch abweisend.“ Auf jeden Fall ist es eine ganz normale Anrede für eine Frau, sowohl im Johannesevangelium etwa für die Frau am Jakobsbrunnen (4,21) und für Maria Magdalena (20,13.15) oder bei Matthäus und Lukas für eine Frau, die von Jesus Hilfe erhält (Matthäus 15,28; Lukas 13,12). Im 4. Buch der Makkabäer 16,14 finden wir im Lobpreis der Mutter, deren sieben Söhne als Märtyrer starben, die parallele Anrede für sie als mētēr, presbyti und gynai, „Mutter, Älteste und Frau“. Ich habe nicht überprüft, ob nach der Bibel festzustellen ist, was als angemessene Anrede für die eigene Mutter angesehen wurde.
Veerkamp übersetzt den Ausdruck ti emoi kai soi nicht als rhetorische, sondern als echte Frage: „Was ist zwischen mir und dir, Frau?“ Und die Distanz, die in dieser Frage und evtl. auch in der Anrede zum Ausdruck kommt, ist auf eine inhaltliche Frage zurückzuführen, die er auf Augenhöhe mit seiner Mutter klarstellt:
Der Ausdruck ist aus der Schrift bekannt; er bedeutet, dass ein gemeinsames Anliegen zwischen zwei Personen in Frage gestellt wird. Seine Stunde, „die Stunde, um aus dieser Weltordnung heraus zum VATER überzugehen“ (13,1), sei noch nicht gekommen. Noch ist der Augenblick nicht da, wo dem Mangel an Wein abgeholfen wird, wo Israel wieder zu Israel wird, indem die Kluft zwischen Israel (die Mutter) und der messianischen Gemeinde (Jesus und seine Schüler) zugeschüttet werden wird. Offenbar hat der Wein etwas mit der „Stunde“ zu tun. Das Ansinnen der Frau ist wie eine dringende Bitte in dieser Feststellung verborgen. Es ist eine Bitte wie die der Schüler, Apostelgeschichte 1,6: „Ob du in dieser Zeit das Königreich für Israel wiederherstellen wirst?“ Dort wurden die Schüler zurückgewiesen (Apostelgeschichte 1,6), wie hier die Mutter zurückgewiesen wird. „Noch nicht“, sagt Jesus hier, und er wird es später Maria aus Magdala sagen, weil sie Jesus wie einen Lebenden zu berühren sucht: „Noch bin ich nicht zum VATER hinaufgestiegen“ (20,17).
Dass Johannes der Familie Jesu ein eher zelotisches Verständnis der Befreiung Israels von der römischen Unterdrückung unterstellt, wird in Johannes 7,3-10 für die Brüder Jesu deutlich zum Ausdruck kommen. In der Frage der Mutter nach dem messianischen Wein bleibt offen, auf welche Weise der Messias sein Reich herbeiführen soll. Ähnlich wie der getreue Israelit Nathanael sich nach dem Frieden für Israel sehnt und von Jesus auf das Größere aufmerksam gemacht werden muss, dass dieser Friede nur auf dem Wege der Herstellung des Weltfriedens durch die Erhöhung des Menschensohns herbeigeführt werden kann, wird nun der Mutter des Messias als getreuer Israelitin die Auskunft gegeben, dass die Stunde dieser Erhöhung noch nicht gekommen ist.
Andere Exegeten meinen, wie Wengst sagt (W90), dass Jesu „Feststellung ‚Noch ist meine Stunde nicht gekommen‘ … lediglich die ‚Selbstbestimmung‘ des Wundertäters zum Ausdruck“ bringen soll. <170> Nach Wengst selbst ist hier „eindeutig die Stunde der Passion und des Todes Jesu“ im Blick, wie bereits „die einleitende Zeitbestimmung einen Hinweis auf Ostern gibt“.
Thyen denkt (T156), dass der Satz von der Stunde Jesu „fraglos absichtsvoll doppeldeutig“ formuliert ist. Aber wenn er sich „vordergründig … auf die ‚Stunde‘ der Wandlung des Wassers in Wein beziehen“ soll, ist zu bedenken, dass diese Stunde ja insofern gar nicht auf sich warten lässt, als Jesus unmittelbar nach der Anweisung seiner Mutter an die Diener, zu tun, was er sagt, zur Tat schreitet. Daher ist Thyens Vergleich mit der „Verzögerung seines Eingreifens“, als „der geliebte Freund Lazarus … sterbenskrank darnieder“ liegt, nicht so ganz passend.
Richtig sieht Thyen, dass „eine tiefe und sehr enge Beziehung“ zwischen dem grundlegenden Zeichen bei der Hochzeit zu Kana und Jesu Tod am Kreuz bestehen muss: „Mit der Fülle des guten Weines gibt Jesus darum nicht irgendetwas, sondern sich selbst.“ Anders als Veerkamp verbindet Thyen diesen Ausblick auf die kommende Stunde Jesu jedoch nicht mit der Frage, wie Jesu Tod den Anbruch der kommenden Weltzeit des Friedens herbeiführen könnte, sondern mit religiösen Spekulationen über eine „paradoxe Durchdringung der Zeiten“ von Gail O‘Day <171> oder (T157) Friedrich-Wilhelm Marquardt; <172> Letzteren zitiert er ausführlich folgendermaßen:
„Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verhalten sich unter der Herrschaft der Todes-Endgültigkeit abgeschottet gegeneinander. Aber Ostern reißt das Tor zwischen den Gezeiten auf. Statt Erinnerung und Hoffnung erschließt sich dem erweckten Jesus ein Sein in seinen Gezeiten: seine Gleichzeitigkeit gestern, heute und in allen Äonen, in denen er nun zugleich ho autos {Derselbe} sein kann. Der Zwang des Asynchronen {Ungleichzeitigen} wurde gebrochen, als Gott Jesus dem Tode entriß. Der, von dem es hieß: ,Und er verschied‘, lebt. Das ist die Kraft und das Geheimnis von Jesu ho autos {Derselbe}, seiner Identität, u.E. sein christologisches Geheimnis schlechthin: Jesus ist der Mensch, dem Gott alle Zeiten sperrangelweit geöffnet hat“.
Diese Worte und Bilder klingen schön, und man kann sie sicher gut verwenden, um aus ihnen tröstliche Gedanken für Traueransprachen zu destillieren. Aber geben sie wieder, was Johannes sagen will? Zweifel daran weckt besonders, dass die von Marquardt hier wiedergegebene Übersetzung von Johannes 19,30: „Und er verschied“ schlicht falsch ist, da sie die Worte paredōken to pneuma, „er übergab den Geist“, verkürzend auf das Sterben Jesu bezieht, fast im Sinne eines saloppen „den Geist aufgeben“. Darauf wird bei der Auslegung von 19,30 genauer einzugehen sein.
Als Reaktion auf das Wort Jesu an seine Mutter erteilt diese tois diakonois, „den Dienern“, wie Luther übersetzt, die Anweisung: „Was er euch sagt, das tut!“ Damit zeigt sie, so Wengst (W90), dass sie „sich nicht entmutigen“ lässt, und zugleich versetzt sie Jesus „in die Rolle des Hausherrn“, was „über die Erzählung hinausweist“.
Wengst übersieht dabei allerdings, worauf Thyen bereits in der Auslegung zu Johannes 2,1b aufmerksam gemacht hatte, dass die Mutter Jesu selbst in der Autorität der Hausherrin spricht. Dort hatte Thyen (T157) auch schon „die Weisung der Mutter Jesu an die diakonoi, alles zu tun, was Jesus ihnen auftrage“, vor dem Hintergrund „des ‚Sinai screen‘ (Olsson)“ als Ausdruck ihrer Identifikation mit einem Israel interpretiert, das bereit ist, der Tora JHWHs zu folgen.
Ähnlich sieht Veerkamp das Auftreten der Mutter Jesu:
Die Mutter Jesu, die sich das zentrale Problem des Hochzeitsfestes zu eigen gemacht hat, wendet sich an die Diensthabenden. Ihre Handlung interpretiert die Frage: „Was ist zwischen mir und dir?“ nicht als eine rhetorische, sondern als eine wirkliche Frage. Was habe ich, der Messias, mit diesem Israel zu tun? Sie beantwortet diese implizite Frage mit einer Aktion; sie sagt zu den Diensthabenden, sie sollen tun, was Jesus ihnen sagen wird. Mit einem solchen Israel hat er allerdings etwas zu tun.
Es gibt noch ein Problem, das durch die uns vertraute Übersetzung kaum ins Auge fällt, nämlich die besondere Bedeutung des Wortes diakonos:
Das Wort diakonos bedeutet nicht einfach Bediensteter, Knecht, Sklave. Das normale Wort für Knecht usw. ist doulos. Der diakonos aber ist der, der am Hof eines Königs einen gehobenen Dienst versah, wie jene sieben Diensthabenden, „die vor dem Antlitz König Ahasveros ihren Dienst versahen“ (Esther 1,10, vgl. 6,3). Martha versah ihren Dienst im Haus ihres Bruders Lazarus vor dem Antlitz Jesu, der Lazarus aus dem Tod herausgerufen hatte (12,1f.); auch das war nicht der Dienst eines Sklaven (das passende Wort wäre hier douloun und nicht diakonein). Die Dienende par excellence ist Martha, die Schwester des Lazarus (12,2). Der Dienende (diakonos) ist der, der dasein wird, wo der Messias dasein wird, die Dienenden sind die, die dem Messias folgen, 12,26. Die Mutter Jesu redet also wie zu den Hofbeamten eines Königs.
Auch Thyen erwähnt (157) die Stelle 12,26 als einziges weiteres Vorkommen des Wortes diakonos im Johannesevangelium (wobei er den durch das Verb diakonein ausgedrückten Dienst der Martha in 12,2 übergeht). Da dort vom „Gekommensein der Stunde Jesu“ die Rede ist, auf die Jesus in 2,4 verwiesen hat, könnte Johannes an Stelle der geläufigeren Worte doulos oder pais für „Diener“ das dort verwendete Wort diakonos auch hier gewählt haben, um den Zusammenhang zu betonen.
↑ Johannes 2,6-7: Sechs Wasserkrüge für die jüdischen Reinigungsriten
2,6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge
für die Reinigung nach jüdischer Sitte,
und in jeden gingen zwei oder drei Maße.
2,7 Jesus spricht zu ihnen:
Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!
Und sie füllten sie bis obenan.
Der Eindruck, dass Jesus sich mit seiner Anweisung an die Diensthabenden Zeit lässt, mag dadurch entstehen (W90), dass „zunächst die dafür nötigen Requisiten genannt“ werden. In der Erwähnung der Steingefäße (W91) für Wasser, das „rituellen Waschungen“ dient, kann Wengst zufolge „unverständige christliche Überheblichkeit … nur ‚äusseres Ceremoniell‘ und Gesetzlichkeit“ sehen. <173> Dabei wird übersehen,
wie sie daran erinnern und zugleich Ausdruck dessen sind, dass Leben vor dem Angesicht Gottes geschieht und deshalb seiner Heiligkeit entsprechen muss. „Heilig sollt ihr sein; denn heilig bin ich, der Ewige, euer Gott“ (Lev 19,2). Was für die Priester beim Tempeldienst galt, rein vor Gott zu treten, wofür sie sich bestimmten Riten unterzogen, das übertrugen Pharisäer in den Alltag, da es doch keinen Ort und keine Zeit gibt, wo der Mensch nicht vor dem heiligen Gott steht und seinen Weg im Tagesablauf vor ihm zu verantworten hat. „Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk“ (Ex 19,6).
Nach Thyen (T157) kann man vielleicht
auch die Sechszahl der Krüge kata tōn katharismon tōn Ioudaiōn {für die Reinigungsriten der Juden} mit den damals am Sinai, wie hier seit der ersten martyria {Zeugnis} des Johannes der Offenbarung der doxa {Herrlichkeit} vorausgegangenen Tagen der Reinigung in Verbindung bringen…
Veerkamp <174> hat eine andere Vermutung bezüglich der „sechs Wassergefäße“:
Möglich ist folgende Erklärung. Zwölf ist die Zahl für „ganz Israel“. Diese Deutung wird unterstützt durch die Erzählung 1. Könige 18, wo Elia zwölfmal – dreimal vier – Gefäße mit Wasser füllen lässt (18,34), nachdem er zwölf Steine – „nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs“ – hat aufrichten lassen (18,31). Hier ist aber das „halbe“ Israel. Die andere Hälfte ist noch gar nicht da. (Vgl. 10,16: „Andere Schafe habe ich, die sind nicht von diesem Hof“.) Das toratreue Israel im Lande (die sechs Gefäße, gefüllt mit Wasser) muss zum messianischen Israel werden (zu sechs Gefäßen, gefüllt mit Wein). Freilich bleibt die Frage: warum sechs?
Es mag sein, dass Johannes, der Rätsel liebte, wie bereits am Umgang mit einem der ersten Schüler Jesu zu sehen war, dessen Name nicht genannt wurde, auch diese Frage bewusst in der Schwebe lassen wollte. Veerkamp wird später in Erwägung ziehen, dass mit der zweiten Hälfte Israels die samaritischen Stämme des alten Nordisrael gemeint sein könnten, die Jesus in Johannes 4 ja bewusst aufsucht und für ihn aufgeschlossener sind als die Judäer.
Auf Grund der Maßangabe ana metrētas dyo ē treis, „je zwei bis drei Metretes“, ergibt sich nach Wengst (W91) das „Fassungsvermögen eines jeden der sechs Steinkrüge“ von etwa zwei bis drei mal
39 Litern, so dass die Gesamtmenge Flüssigkeit, die die Steinkrüge aufnehmen können, mindestens 468 und höchstens 702 Liter beträgt. Diese Krüge mit Wasser zu füllen, gebietet nun Jesus den Bedienenden. Das setzt nicht voraus, dass sie völlig leer waren. Dann hätten sie ihre gerade genannte Funktion nicht erfüllen können. Aber nach Ausführung des Befehls sind sie voll „bis oben hin“.
Aus der durch nichts belegten Annahme (W91, Anm. 68): „Die Krüge von Kana sind leer“, schließt Wengst zufolge der Exeget Michael Theobald <175>
auf ihre Funktionslosigkeit und damit das Ende des jüdischen Reinigungskults. Das generalisiert er noch in bestimmter Aufnahme von 1,17: „Das Gesetz überhaupt ist soteriologisch ,entleert‘, ,Gnade und Wahrheit‘ sind in Christus Wirklichkeit geworden“.
Aber schon ein genauer Blick auf die Erzählung zeigt den Irrtum Theobalds. Wasser ist ja im Überfluss vorhanden, sonst könnten die Krüge nicht gefüllt werden. Das ist nach Veerkamp auch symbolisch so zu sehen:
Wein haben sie nicht, was sie haben, ist Wasser. Wasser ist lebensnotwendig, Wasser ist die Tora, es dient dazu, die zentralen Reinigungsvorschriften der Tora auszuführen.
Von einer Aufhebung dieser Vorschriften ist nirgends im Johannesevangelium die Rede. Man muss aber zugleich sagen, dass Johannes auch keinen besonderen Wert auf Rituale legt, denn der in 3,25 erwähnte Streit über die Reinigung interessiert ihn inhaltlich überhaupt nicht und in 15,3 sieht Jesus die Reinheit seiner Schüler allein durch das Wort bewirkt, das er zu ihnen gesagt hat. (Ähnliches ist zu den Ritualen der Taufe und des Abendmahls zu sagen, aber dazu ausführlich später.)
Das heißt: die Tora als von Gott gegebene befreiende und Leben schaffende Wegweisung bleibt im Johannesevangelium unangetastet. Aber unter den Bedingungen einer erneuten Sklaverei wie damals in Ägypten, die aber unter der Pax Romana ihre Herrschaft weltweit ausgedehnt hat, ist es nicht mehr möglich, das Volk Israel in ein gelobtes Land zu führen, in dem es getrennt von den Völkern gemäß der Tora der Freiheit und des Rechts leben kann. Stattdessen ist eine neue, weltweit wirksame Befreiung aus der Versklavung durch die römische Weltordnung erforderlich, die in den Augen des Johannes nur der Messias Jesus bewerkstelligen kann.
Es geht also nicht um die Überwindung angeblich jüdischer Gesetzlichkeit durch christliche Gnade, sondern um die Frage, wie die Verheißungen der auf Freiheit, Recht und Frieden gerichteten Tora unter den Bedingungen eines weltweiten Regimes von Unfreiheit, Unrecht und Unfrieden in Erfüllung gehen können. Diesem Ziel gelten die Zeichen und Werke, die der Messias Jesus vollbringen wird bis hin zur Hingabe seines eigenen Lebens am Kreuz der Römer; diesem Ziel wird sein neues Gebot der agapē, der solidarischen Liebe, dienen; und dieses Ziel wird hier durch die Überfülle des Weins symbolisiert, in den die ca. sechs Hektoliter Wasser verwandelt werden.
↑ Johannes 2,8-10: Der Festverantwortliche und der Wein, der Wasser gewesen war
2,8 Und er spricht zu ihnen:
Schöpft nun und bringt‘s dem Speisemeister!
Und sie brachten‘s ihm.
2,9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war,
und nicht wusste, woher er kam –
die Diener aber wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten –,
ruft der Speisemeister den Bräutigam
2,10 und spricht zu ihm:
Jedermann gibt zuerst den guten Wein
und, wenn sie trunken sind, den geringeren;
du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.
[4. April 2022] Im zweiten Auftrag Jesu an die Diensthabenden wird zunächst, wie Thyen bemerkt (T158) das Wort antlein, „schöpfen“, in ungewöhnlicher Weise verwendet, denn normalerweise bezeichnet es „den Vorgang des Schöpfens oder Abfüllens von Wasser aus einer Quelle“. Darin kommen seines Erachtens wohl „symbolische Obertöne zum Erklingen“. Es könnte, wie Hoskyns <176> meint, auf „Christus als dem ‚Quell lebendigen Wasser‘“ oder nach Lausberg <177> auf Jesaja 12,3 anspielen:
Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils.
Ungewöhnlich ist auch das Wort architriklinos, das „in der gesamten Bibel nur hier“ vorkommt und das Thyen und Wengst wie Luther mit „Speisemeister“ übersetzen. Wer verbirgt sich hinter dieser Gestalt? Nach Thyen ist man, um den Sinn des Wortes zu erfassen,
allein auf die jeweiligen Kontexte und auf die üblichen Wortbildungsregeln angewiesen. triklinon (lat. triclinium) ist ursprünglich die Bezeichnung eines Liegesofas für drei Personen. Das Wort bezeichnet aber alsbald auch ein Speisezimmer oder einen Festsaal und endlich sogar das gesamte Fest einschließlich der feiernden Personen. … Das vor- oder nachgestellte arch- (arches) bringt … stets die Dominanz und Herrschaftsfunktion des so Ausgezeichneten zur Sprache. Beispiele im NT sind archiereus, architelōnes oder archisynagōgos {Hoherpriester, Oberzöllner, Synagogenvorsteher}. In unserer Erzählung ist der sogleich durch den Artikel definierte architriklinos darum sicher beides: archōn tōn diakonōn {Vorgesetzter der Diensthabenden} und Verantwortlicher für den ordentlichen Verlauf des Festes…
Auch Wengst zufolge (W91) ist der architriklinos „der dafür Verantwortliche, dass im Festsaal (triklinon) die Speisen und Getränke zur rechten Zeit gut zubereitet und aufgetragen werden.“ Anknüpfend (W92) an Erinnerungen an sein eigenes Heimatdorf ist es für ihn nachvollziehbar, dass man bei einer Bauernhochzeit auf dem Lande jemandem, dem man zutraute, „die feinere Lebensart“ zu kennen, die Verantwortung für das Fest übertrug und dass (Anm. 71) „Helferinnen und Helfer aus der Nachbarschaft“ angeworben wurden. Damit ist aber weder das Wort diakonos, das auf einen gehobenen Dienst hinweist, noch die herausragende Stellung des architriklinos erklärt. Erst später geht Wengst am Rande (W92) auf eine symbolische Bedeutung des Wortes triklinos ein, indem er auf Rabbi Jaˁakov <178> verweist, der „den Festsaal zur kommenden Welt in Beziehung“ setzt (Anm. 74):
Er sagt: „Diese Welt gleicht dem Vorzimmer in Hinsicht auf die kommende Welt. Bereite dich im Vorzimmer vor, damit du in den Festsaal eintreten darfst“.
Veerkamp <179> hält Wengst vor, dass er trotz des Hinweises auf diese rabbinische Stelle den architriklinos „als eine Nebenfigur“ behandelt:
Das Wort erklärt den Ort der Hochzeit, das Haus des Bräutigams. Die Figur muss also mehr bedeuten als eine Nebenfigur. Der architriklinos ist auf alle Fälle der Vertraute des Bräutigams, wie sich zeigen wird. Der Bräutigam kann, wenn wir die Hochzeit nach Jesaja 62,4f. deuten, keinen anderen repräsentieren als den Gott Israels.
Veerkamp zieht sich aus der Affäre, indem er das Wort „Architriklinos“ unübersetzt stehen lässt. Die Übersetzung „Speisemeister“ greift jedenfalls zu kurz; der moderne wedding planner kommt in seiner Funktion dem architriklinos möglicherweise nahe. Ich würde das Wort „Festverantwortlicher“ wählen, eine ebenso unübliche Wortbildung wie architriklinos mit großer Bedeutungsbreite.
Während Johannes nach Thyen (T158) das Unwissen des architriklinos über die Herkunft des Weines erwähnt, um „diesen berufenen Vorkoster in seinem Unverständnis und seiner Ahnungslosigkeit zugleich als völlig unverdächtigen Zeugen dessen erscheinen“ zu lassen, „was da geschehen ist“, sieht Veerkamp in dieser Bemerkung einen weiteren Hinweis auf die Identität des architriklinos:
Der architriklinos weiß nichts, die Wissenden sind die Diensthabenden, die diakonoi. Die Diensthabenden haben keinen direkten Zutritt zum Bräutigam. Die diakonoi wissen, der architriklinos ist der, der nicht weiß, was die diakonoi wissen; von dort muss das Rätsel, vor das uns diese Gestalt stellt, gelöst werden. Bislang hatten wir nur die zweimalige Versicherung des Täufers: „Auch ich hatte kein Wissen von ihm“ (1,31.33, kai egō ouk ēdein auton). Vom architriklinos wird gesagt: „Er wusste nicht.“ So wie der Täufer nicht wusste, dass Jesus ben Joseph aus Nazareth der Messias war, so wusste der architriklinos nicht, woher der Wein, das effektive Zeichen der messianischen Zeit, stammt. Wer ist der Vertraute oder „Freund des Bräutigams“? Warten wir bis 3,29!
Dieser Festverantwortliche bekommt (T159) mit der „längsten aller direkten Reden“ bei der Hochzeit zu Kana das letzte Wort, indem er auf eine „Praxis unseriöser Kneipenwirte“ anspielt, „die sich ihren minderen Wein von den trunkenen Gästen am Ende ebenso teuer bezahlen lassen, wie zuvor den guten“, und damit verwundert den Bräutigam konfrontiert, der es umgekehrt gemacht hat. Damit lässt er Thyen zufolge
auf der Symbolebene hinter dem Bräutigam den fremden Gast Jesus sichtbar werden, der diese unausschöpfliche Masse köstlichen Weines für seine eschatologische Stunde der Hochzeitsfeier „bewahrt“ hat.
Wenn sich Thyen außerdem fragt, „ob sich von der so verbreiteten Hochzeitfreude am Ende nicht auch der treue Zeuge Jesu, Johannes, angesteckt zeigt, wenn er gleich im nächsten Akt unseres Dramas“ (Johannes 3,28-30) von dem reden wird, der als „Freund des Bräutigams … voller Freude über die Stimme des Bräutigams“ ist, frage ich mich wiederum, ob er nicht auf einen ähnlichen Schluss wie Veerkamp kommen könnte, da sich ja eben Johannes der Täufer mit diesem Freund und Vertrauten des Bräutigams identifizieren wird.
Zu den Worten sy tetērēkas ton kalon oinon heōs arti, „du hast den guten Wein bewahrt – bis jetzt“, die der Festverantwortliche an den Bräutigam richtet, schreibt Veerkamp:
Das Wort „bewahren“ bedeutet im Johannesevangelium sonst immer „das Bewahren der Gebote“. Noch zweimal hören wir den Ausdruck „bis jetzt“. In 5,17: „Mein VATER wirkt bis jetzt und auch ich wirke.“ Die andere ist 16,24: „Bis jetzt habt ihr um nichts mit meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet nehmen, damit eure Freude erfüllt sei“, ganz am Ende der sogenannten „Abschiedsreden“. Diese Stellen erklären unsere Stelle hier. Jesus hat gewirkt „bis jetzt“; bis jetzt spielte bei der Sehnsucht (beten) der Schüler der Name Jesu keine Rolle. In dem Moment, wo sie ihre Sehnsucht nach der kommenden Weltzeit mit dem Namen Jesus verbinden, werden sie das, worum sie beten, annehmen, und ihre Freude wird sich erfüllen. Jetzt wird Israel zu jenem „guten Wein“; bis jetzt war es alles andere als guter Wein…
Unter Bezug auf das Weinberggleichnis Jesaja 5,1ff und das „gleiche Bild“ in Jeremia 2,21 fährt Veerkamp fort:
Das Zeichen Jesu verwandelt „zuletzt“ die bitteren Worte der Propheten in das, was der Geliebte von seinem Weinstock Israel immer erhoffte: guten Wein. Die Hoffnung Gottes geht „zuletzt“ in Erfüllung. Der architriklinos hilft dem Bräutigam aus einer großen Verlegenheit, ohne auch nur zu ahnen, wo der Wein herkommt, was hier überhaupt geschieht.
Thyen erwägt zum Bewahren des guten Weines (wieder in Anlehnung an Lausberg) „eine Anspielung auf die Vorschrift über das Passalamm“, das „jedes Familienoberhaupt“ nach 2. Mose 12,6 „bis zum vierzehnten Nisan aufbewahren“ muss, „um es dann zu schlachten“ (T159f.):
„Der architriclinus hat … ungewollt eine christologische ,Prophetie‘ ausgesprochen, wie es deren ja auch aus dem Munde des Hohen-Priesters J 11,50 und des Pilatus J 19,19-22 gibt. … Der kalos oinos {gute Wein} wurde also von der sy {du} genannten Person ,aufbewahrt‘ … heōs arti {bis jetzt}, wobei arti einerseits die Ex 12,6 tessareskaidekatēs tou mēnos toutou {den Vierzehnten dieses Monats, im Griechischen eine weibliche Form} – an deren Abend das bis dahin aufbewahrte Pascha-Lamm geschlachtet wird – bezeichnet und andererseits der ,Stunde Jesu‘‘ … entspricht. Damit ist der kalos oinos {gute Wein}… dem zu schlachtenden Pascha-Lamm liturgiezeitlich parallelisiert: Jesus selbst ist das (J 1,29; 19,34) Pascha-Lamm. Der architriclinus hat – ohne es zu wissen – mit J 2,10d sy {du} Jesus angesprochen, der den Wein ja ,besorgt‘ hat“ [119f.].
Nirgends habe ich eine Überlegung dazu gefunden, wie sich die beiden Worte nyn und arti im Johannesevangelium zueinander verhalten, die ja beide auf die Bedeutung „nun, jetzt“ hinauslaufen und beide im Zusammenhang mit der Verwandlung des Weines vorkommen, das Wort nyn zu Beginn in Vers 8, das Wort arti am Schluss. Auf das erstere geht nur Thyen ein (T157), indem er sich fragt, zu welchem Zeitpunkt wohl „die wunderbare Verwandlung des Wassers in Wein“ geschehen sein mag, entweder (T158) bereits
als die diakonoi die Gefäße füllten, oder aber – und das ist wohl wahrscheinlicher – daß sie in eben dem Augenblick geschieht, da Jesus den diakonoi gebietet: antlēsate nyn kai pherete tō architriklinō {Schöpft nun daraus und bringt das dem Speisemeister!}. Denn das hier gebrauchte nyn {jetzt, nun} dient gewiß nicht nur als logische Partikel zur Verstärkung der Weisung: antlēsate {schöpft}, sondern hat, wie immer bei Joh und zumal in der für ihn typischen Verbindung mit der hōra {Stunde} Jesu, streng temporalen Sinn. Es ist mit Lausberg [189] auch hier auf die in V. 4 genannte „Stunde Jesu“ zu beziehen; vgl. zu diesem Gebrauch des nyn die oben bereits genannte Wendung: erchetai hōra kai nyn estin {es kommt die Stunde und ist schon jetzt} (4,23 u. 5,25 u.s. 12,27; 13,31; 16,5.22; 17,5.13).
Wengst (W93) geht wie Veerkamp nur auf das Wort arti ein, und zwar in folgender Weise:
Dieses árti, mit dem die Erzählung endet, wird im Evangelium noch öfter begegnen. Jetzt ist der gute Wein da und Jesus hat ihn gebracht; jetzt ist die messianische Zeit angebrochen. Wird die Geschichte so gelesen, hat auch die Erwähnung der Hochzeit schon messianischen Klang, da die Heilszeit mit einer Hochzeitsfeier verglichen werden kann (vgl. Mk 2,19a). Entsprechend ließ schon die einleitende Zeitbestimmung „am dritten Tag“ die österliche Dimension aufscheinen; sie verknüpft so Jesu messianisches Wirken mit dem Zeugnis von Gottes auferweckendem Handeln an ihm.
Hier sieht Wengst, der die Hochzeit zu Kana nicht mit den prophetischen Bildern von der Hochzeit des Gottes Israels mit seinem Volk in Verbindung gebracht hatte, nun doch die „in jüdischen und frühchristlichen Texten“ erwähnte „unvorstellbare Überfülle von Wein“ als „Kennzeichen der messianischen Zeit bzw. der kommenden Welt“. Wichtig ist ihm aber auch folgender Gesichtspunkt (W92):
Geschichten dieser Art werden nicht von Menschen erzählt, deren Weinkeller reichlich und gut sortiert ist, sondern von solchen, die wenigstens bei großen Festen einmal Wein im Überfluss haben möchten. Allen verklemmten Moralisten und unfrohen Asketen zum Trotz nimmt diese Geschichte das Verlangen nach Lebensfreude positiv auf, die im Weingenuss zum Ausdruck kommt, und verheißt ihm Erfüllung.
Auch Thyen ist (T160) angesichts des „ja – ähnlich wie die Menge des Weines – unausschöpflichen symbolischen Modus der Erzählung von der Kana-Hochzeit“ offen für andere Auslegungsmöglichkeiten, etwa einer engen „Beziehung zwischen dem kostbaren Wein von Kana und dem vergossenen Blut Jesu von Golgatha (19,34f)“ oder einem „symbolischen Hinweis auf die Weingabe des Herrenmahls“. Jedenfalls ist, „solange solche Interpretationen einander nicht wechselseitig ausschließen, … gegen sie trotz ihrer Vielfalt auch nichts einzuwenden.“
Warum aber ist, wie Thyen sich fragt, bei der Hochzeit zu Kana (T159) „von einer Braut – für uns doch Hauptperson einer Hochzeit – mit keiner Silbe die Rede“? Warum taucht „auch der Bräutigam (nymphios) … nur zuallerletzt als stummer Zuhörer der ‚Weisheit‘ seines architriklinos und als derjenige auf, der ‚den guten Wein bis zu dieser Stunde bewahrt hat‘“?
Veerkamp sagt dazu nur, dass von „der Braut in 3,29f. die Rede sein“ wird. Und den Bräutigam hatte er ja bereits mit dem „Gott Israels“ in Verbindung gebracht. Auch darüber werden wir bei der Auslegung von 3,29 noch nachzudenken haben.
Es hat jedoch sicher seinen guten Grund, weshalb Johannes die genaue Identität sowohl der Braut als auch des Bräutigams in der Schwebe lässt. Gerade wenn andere Exegeten <180> es nicht einmal für abwegig halten, „dass Jesus und seine Mutter der wahre Bräutigam und die wahre Braut bei der Hochzeit sind“, tut die Zurückhaltung des Johannes gut, indem er zwar auf die messianische Hochzeit des Gottes Israels mit seinem Volk anspielt, aber keinen Anlass geben will, den Messias Jesus und seine Mutter mit den Akteuren einer heiligen Hochzeit heidnischer Mysterienkulte zu verwechseln.
↑ Johannes 2,11: Der Anfang der Zeichen, die Ehre Jesu und das Vertrauen der Schüler
2,11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat.
Es geschah zu Kana in Galiläa,
und er offenbarte seine Herrlichkeit.
Und seine Jünger glaubten an ihn.
[5. April 2022] Das tat Jesus „als Anfang der Zeichen“, archēn tōn sēmeiōn, so beginnt der abschließende Vers zur Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana in wörtlicher Übersetzung. Es geht also nicht um eine simple Aufzählung von Wundern Jesu, die vielleicht sogar zufällig bei der Übernahme der Geschichte aus einer angeblichen Semeia-Quelle im Evangelium stehengeblieben wäre.
Ton Veerkamp <181> setzt das Wort archē in Beziehung zum Beginn des Johannesevangeliums wie der Bibel überhaupt und versteht es im Sinne eines leitenden Prinzips für das gesamte befreiende Handeln des Messias Jesus:
Hier geht es um das prinzipielle Zeichen. Nicht das erste Zeichen aus einer Reihe vieler weiterer, sondern den Anfang der Zeichen. Das Evangelium fängt mit den Worten an: „Im Anfang“, so wie die Schrift überhaupt angefangen hat. Hier hören wir das gleiche Wort. Das Zeichen der Zeichen, das, worum es eigentlich geht und gehen muss, zeigt: Israel wird endlich zu Israel. Darum geht es bei allem, was Jesus sagen und tun wird. Denn das wird seine Ehre sein. Die Ehre Jesu ist die Heimführung Israels.
Mit dem Stichwort „Ehre“ greift Veerkamp dabei das Wort doxa auf, das sich vom hebräischen Wort kavod her auf die Ehre des Gottes Israels bezieht und das üblicherweise mit dem missverständlichen Wort „Herrlichkeit“ übersetzt wird (siehe meine Ausführungen zu Johannes 1,14cd).
Aber was genau meint Johannes mit dem Wort sēmeion, „Zeichen“, das hier zum ersten Mal auftaucht? Klaus Wengst beginnt mit einer sehr allgemeinen Definition (W92):
Johannes nennt das, was Jesus tut, ein „Zeichen“. Ein Zeichen ist nicht die Sache selbst, sondern weist über sich hinaus auf sie hin. In ihm blitzt aber auch schon etwas von der gemeinten Sache auf.
Weiterhin verwahrt sich Wengst dagegen (W93), dass der „Glaube der Schüler … als nur eingeschränkt oder gar negativ qualifiziert verstanden“ wird,
weil er sich ‚nur‘ auf ein Wunder bezöge. Dieses Wunder hat sich als mehrdimensionales Zeichen erwiesen, das in einer einzelnen Geschichte doch zugleich das ganze Evangelium repräsentiert. In ihr wie in ihm offenbart Jesus seine „Herrlichkeit“, die letztlich auf Gott selbst verweist (vgl. zu 1,14).
Die Worte „Zeichen“ und „glauben“ stellt Wengst sodann in „einen biblischen Zusammenhang“, der zum Beispiel in 4. Mose 14,11 zu finden ist:
Dort fragt Gott Mose auf die ängstlich-mürrische Weigerung des Volkes hin, den Weg ins Verheißene Land fortzusetzen, nachdem der Bericht der Kundschafter Gefahren erkennen ließ: „Wie lange glauben sie mir nicht bei all den Zeichen, die ich in seiner (des Volkes) Mitte getan habe?“
Das ist schon alles, was Wengst über das Stichwort „Zeichen“ sagt. Das Stichwort „glauben“ erläutert er noch etwas näher, und zwar in folgendem Sinn (W94):
aufgrund bisher gemachter heilvoller Erfahrungen, von denen im Volke Gottes erzählt wird, im Vertrauen auf Gott einen gebotenen und verheißenen Weg selbständig weiterzugehen, der keineswegs ohne Risiken ist.
Dazu setzt Wengst (Anm. 77) einer früher gängigen christlichen Meinung, der jüdische Glaube sei im Gegensatz zum christlichen ein äußerlich auf Wunder ausgerichteter Glaube, folgende Argumentation entgegen:
Glauben kann sich auf Zeichen beziehen, muss es aber nicht. Primär ist der Bezug auf das sich zusagende Wort Gottes. So heißt es <182> im Blick auf die am Schilfmeer geretteten Israeliten, die dort ein Lied singen: „Rabbi Nechemja sagt: ,Die Israeliten waren allein aufgrund ihres Glaubens berechtigt, ein Lied am Meer zu singen; denn es ist gesagt (Ex 4,31): Da glaubte das Volk und es steht geschrieben (Ex 14,31): Da glaubten sie dem Ewigen.‘ Rabbi Jizchak sagte: ,Sie sahen alle jene Zeichen, die für sie gemacht worden waren – und sollten nicht zum Glauben gekommen sein?‘ Aber Rabbi Schim‘on bar Abba sagte: ,Aufgrund des Glaubens, mit dem Abraham dem Heiligen, gesegnet er, glaubte; denn es ist gesagt (Gen 15,6): Da glaubte er dem Ewigen. Von daher waren die Israeliten berechtigt, ein Lied am Meer zu singen.“
Auf jeden Fall ist der Glaube der Schüler Wengst zufolge (W94) „immer ‚vorläufig‘. Im Blick auf die Schüler Jesu wird es die Frage sein, ob sie auf dem Weg bleiben und weitergehen, auf den sie sich mit Jesus eingelassen haben.“ Da die „Stunde“ Jesu erwähnt wird, ist schon hier das Kreuz Jesu im Blick:
Leidvolle Wirklichkeit wird nicht illusionär übersprungen. Gegen sie werden hoffend Wunder erzählt und mitten in ihr gibt es doch auch schon wunderbare Erfahrungen von Sattwerden und Rettung, Gemeinschaft und Freude mit Brot und Wein, genug und im Überfluss. „Glauben“ ist nicht statisch zu verstehen, sondern es ist das vertrauensvolle Gehen eines Weges, das „Zeichen“ braucht als Wegweiser und Stärkung. Von diesem biblischen Glaubensverständnis her werden die alternativen Zuordnungen von Glaube und Gnade einerseits und Gebot und Tun andererseits hinfällig.
Dieses dynamische Verständnis von „glauben“ könnte nach Wengst (Anm. 78) auch dazu geführt haben, dass Johannes sehr oft „das Verb pisteúein (‚glauben‘, ‚vertrauen‘)“ verwendet, „aber kein einziges Mal das Nomen pístis (‚Glaube‘, ‚Vertrauen‘)“.
Veerkamp spitzt das Vertrauen der Schüler Jesu inhaltlich politisch zu. Es geht darum, dass sie die befreiende Macht des Messias erfahren, die den Anbruch der kommenden Weltzeit des Friedens für Israel inmitten der Völker herbeiführen kann:
Die Schüler vertrauen Jesus. Es ist hier das erste Mal – von der Vorrede abgesehen –, dass wir dieses Wort „vertrauen“ hören. Um dieses Vertrauen wird es gehen. Dass Jesus der Messias wird, wird ihnen klar (ephanerōsen, offenbar!), als dem Mangel Israels abgeholfen wurde. Sie vertrauen, nicht weil ein Zauberer mit einem Zaubertrick 600 Liter Wasser zu ebensovielen Litern Wein umzauberte, sondern weil ihnen klar wird, was Jesus tun muss und tun wird. Die Unmenge Weins steht für die Fülle der messianischen Zeit.
Im Zusammenhang mit dem Stichwort sēmeion, „Zeichen“, stellt Veerkamp in einem ersten „Scholion“, <183> also einer erklärenden Randbemerkung, Überlegungen zu seiner Art einer allegorischen Auslegung an. In seinen Augen ist historisch-kritische Auslegung notwendig, insofern sie versucht, den Text „in sein eigenes historisches (politisches, soziales, ideologisches) Milieu zurückzuversetzen“ und ihn nicht „zum exotischen Objekt“ werden zu lassen. Dennoch hat die „Allegorese … etwas gesehen, was in der historisch-kritischen Auslegung unter den Tisch fällt“:
Sie allein erklärt den vorliegenden Text nicht. Wenn man aber den Text auslegen will, muss man auch seine Struktur kennen. Die Struktur einer Erzählung ist zunächst das Geflecht der Rollen, die die Figuren in ihr spielen. Sie und ihre Handlungen sind Zeichen. Die Zeichen verweisen auf das, was sie bezeichnen, auf das, worauf sie hinaus sind, was sie aber für sich nicht sind. Sie be-zeichnen etwas, was sie für uns oder an sich sind; gerade dieses etwas ist es, was uns am Text interessiert. Sonst würden wir ihn nicht lesen, auslegen, über ihn predigen, ihn zum Gegenstand des Unterrichts machen. Das Zeichen setzt das Be-zeichnete als das Andere (allon) voraus, sonst wäre es kein Zeichen, sēmeion. Gerade wegen der überragenden Rolle des Wortes sēmeion im Johannesevangelium – siebzehnmal hören wir es – kommt man ohne Allegorese in der Auslegung des Johannesevangeliums nicht weit.
Veerkamp weiß jedoch um die Gefahr, dass bei „der Allegorese der Phantasie keine Grenzen gesetzt“ sind. Um Willkür zu vermeiden, greift er auf die Unterscheidung zwischen synchroner (≈ zeitgleicher) und diachroner (≈ durch die Zeit verlaufender) Auslegung zurück: erstere bezieht sich auf die Strukturen innerhalb eines Textes, letztere auf die Entwicklung eines Textes. Dabei vertritt die historische Kritik „das Element der Diachronie, das die Differenz zwischen unserer Zeit und der Zeit der Erzählung berücksichtigt“. Die Allegorese hingegen spielt in biblischen Texten immer auf das Andere an, das mit dem Gott Israels, wie er im TeNaK offenbar wird, zu tun hat. Insofern ist sie für ihn
kein willkürliches Verfahren, sondern wesentliches Moment der strukturalen (synchronen) Analyse des Textes als Ganzes. Wir meinen mit Allegorese die Respektierung des Ganzen, das dem Fragment vorangeht und es transzendiert. Dieses Ganze ist das Andere, und die Figuren der Einzelerzählungen verweisen über ihre spezielle Rolle im Einzelfragment hinaus auf ihre Rolle im Ganzen. Dieses Ganze hat sein ureigenes System von Zeichen und Bildern, Gestalten und Visionen, seine Sprache im umfassenden Sinne des Wortes. Deswegen spielen die Figuren in Kana nicht irgendeine Rolle auf irgendeiner Bauernhochzeit in irgendeinem Dorf, wo den Leuten der Wein – es hätte auch Bier, Hammelbraten usw. sein können – ausgegangen war, sondern auf einer messianischen Hochzeit. Wenn wir dieses Andere nicht gelten lassen, auf das das Zeichen „Wasser wird Wein“ hinweist, wird die ganze Szene völlig beliebig und Jesus zu einem Tausendsassa, der alles kann, etwa 600 Liter Wasser in Wein verwandeln. Wenn die Erzählung nicht jenes Andere bedeutet, bedeutet sie eben nichts.
Zu einem solchen Vorgehen passt (T161) die eine eingehende Untersuchung des Wortes sēmeion sehr gut, die Hartwig Thyen beisteuert, wobei er besonders dessen „reiche biblische Vorgeschichte“ betrachtet. Die Septuaginta bietet „über 120 Vorkommen von sēmeion“, meistens „als Wiedergabe des hebräischen ˀoth“; es „spielt zumal in der Exodus-Erzählung und in Erinnerungen an sie … eine besonders prominente Rolle“, zum Beispiel im 5. Buch Mose und in Psalm 105,5.27. Genau hier findet er erstaunliche Ähnlichkeiten „zu seiner Verwendung in unserem Evangelium“.
Als nämlich Mose „am ,brennenden Dornbusch‘ … nach Ägypten gesandt“ wird, „das versklavte Volk Israel in die Freiheit zu führen“, da sagt Gott ihm zu (2. Mose 3,12):
Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge.
Mose reagiert skeptisch auf ein solches Zeichen, das erst in der Zukunft erfüllt wird: „Was aber, wenn sie mir nicht glauben“? (2. Mose 4,1):
Solchen Widerstand zu überwinden, wird Mose nun von Gott unterwiesen, autorisiert und mit dem wundertätigen Stab ausgerüstet zum Tun von sēmeia. Diese ,Zeichen‘ soll er in Ägypten vor den lsraeliten tun… (Ex 4,5). Und sollten sie auf das ,erste Zeichen‘ hin noch nicht glauben, so soll Mose das zweite tun… (Ex 4,8f; wie Joh 2,11 u. 4,54 werden nur diese ersten beiden ägyptischen sēmeia ,gezählt‘)… Aber auch alle folgenden Zeichen, die Mose tut, und zumal die über den von Gott verstockten Pharao und sein Volk verhängten ,ägyptischen Plagen‘ sind sēmeia kai tērata {Zeichen und Wunder} (Ex 4,21f; vgl. Joh 4,48).
Das heißt, (T163) die „Offenbarung der doxa {Herrlichkeit} Jesu“ ist nicht nur, wie es Thyen in seiner Auslegung von Johannes 1,14 getan hatte, von der Sinai-Erzählung, sondern auch von „den eben genannten Exodustexten“ her auszulegen, in denen wir „doch alle Motive aus unserem Vers 2,11 beieinander“ haben:
Hier wie da ist vom poiein sēmeia {Zeichen tun} und vom Glauben an Mose bzw. an Jesus als die von Gott Gesandten die Rede (vgl. das pothen {woher} in 2,9). Sachlich dürfte der Offenbarung der doxa Jesu die Aussage entsprechen: episteusen ho laos kei echarē, hoti epeskepsato ho theos tous hyios Israēl, kai hoti eiden autōn tēn thlipsin {Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der HERR sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an} (Ex 4,31).
Besonders interessant ist nun, dass es sowohl in 2. Mose 4,8 als auch im Johannesevangelium zwei besonders hervorgehobene Zeichen gibt. Johannes verknüpft das Zeichen zu „Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte“ (4,46), sehr eng mit dem deuteron sēmeion, „zweiten Zeichen“ (4,54), das ebenfalls in Kana geschehen wird, nämlich der Heilung des Sohnes des königlichen Dienstmanns. Dort werden zudem die sēmeia kai terata, „Zeichen und Wunder“ (4,48), erwähnt, die aus der Exodus-Erzählung vertraut sind. Überdeutlich ist nach Thyen:
Wie in der Begegnung Moses mit seinem Volk im Sklavenhaus Ägyptens die Israeliten ihm auf seine Zeichen hin seine göttliche Sendung glaubten, so führen auch in den beiden Kana-Erzählungen Jesu Zeichen dazu, daß hier „seine Jünger“ und da „der königliche Beamte mit seinem ganzen Haus“ (4,53) an ihn glaubten.
Hinzu kommt die erwähnte Zählung von nur zweien einer ganzen Reihe von Zeichen:
Und wenn auch nicht als archē tōn sēmeiōn und als deuteron sēmeion {Anfang der Zeichen und zweites Zeichen} (Joh 4,54), sondern als prōton und eschaton sēmeion {erstes und anderes, letztes Zeichen} (Ex 4,8) bezeichnet, fehlt in der Exoduserzählung selbst die vielerörterte Zählung der ersten beiden sēmeia – und nur dieser! – nicht.
Was ist aber von dieser seltsam asymmetrischen Zählung der beiden einzigen gezählten sēmeia in 2. Mose 4,8 bzw. Johannes 2,11 und 4,54 zu halten? Normal wäre die Zählung prōton sēmeion, deuteron sēmeion, „erstes Zeichen, zweites Zeichen“. Ich nehme an, dass Johannes sich in bewusster Gegenläufigkeit auf die Vorlage der Exodus-Erzählung bezieht, um deutlich zu machen, dass es auch dem Messias Jesus um die Befreiung Israels geht – aber mit großen Unterschieden. Ein völlig neuer Anfang muss gesetzt werden, da es unter den Bedingungen weltweiter Sklaverei nicht mehr möglich ist, ein Volk durch den Auszug in ein anderes Land zu befreien. Der Messias muss Befreiung in ganz anderen Maßstäben bewerkstelligen, nämlich durch die Überwindung der römischen Weltordnung selbst.
Aufschlussreich (T162) ist für mich auch Thyens Argumentation im Zusammenhang mit dem Umstand, dass auf Grund von 5. Mose (Deuteronomium) 13,2-6 „das Charisma sēmeia tun zu können, in Israel zu einem gewichtigen Kriterium und Ausweis der göttlichen Sendung eines Propheten <184> und zumal zum Signum {Markenzeichen} des Deut 18,15ff verheißenen künftigen ‚Propheten wie Mose‘“ wurde. Nach Wolfgang Bittner [551] vermeiden die synoptischen Evangelisten das Wort „sēmeion zur Bezeichnung der Wundertaten Jesu“ deswegen so strikt, weil „sie nicht minder konsequent auch jede mögliche Deutung Jesu als ,eines‘ oder gar als ,des eschatologischen Propheten‘ ablehnen“. Das sei auch der Grund, warum
Jesus alle an ihn herangetragenen Forderungen von ,Zeichen‘ abweise. Damit trete er nämlich in Wahrheit dem diese Forderungen motivierenden Ansinnen entgegen, er solle sich durch ,Zeichen und Wunder‘ als der eschatologische „Prophet wie Mose“ erweisen und sein Volk doch endlich vom verhaßten Joch der Römer befreien. Zumal für Markus – des Zeitzeugen des großen jüdischen Aufstandes gegen Rom und der Katastrophe der Tempelzerstörung des Jahres 70 -, dem die oft schrillen messianischen Töne unter den Aufständischen kaum entgangen sein dürften (vgl. Mk 13), hat diese Erklärung fraglos einige Plausibilität.
Nirgends hat Thyen bisher so deutlich seine Einschätzung der politischen Lage zur Zeit der Abfassung der Evangelien zum Ausdruck gebracht: Markus verfasste sein Evangelium angesichts der Katastrophe des Judäischen Krieges und der Tempelzerstörung und musste auch auf den Messianismus der Zeloten reagieren. Daraus erklärt sich für Thyen, warum Markus zur Beschreibung der Messianität Jesu darauf verzichtete, auf „die jüdische Erwartung ,eines Propheten wie Mose‘“ zurückzugreifen, nämlich um „dessen derart politische Instrumentalisierung“ zu vermeiden.
Tatsächlich ist das bis zu einem gewissen Grad richtig. Falsch wird die Einschätzung des Markus dann, wenn man annimmt, dass letzten Endes der gesamte römisch-politische Hintergrund des Evangeliums angesichts der religiösen Bedeutung Jesu unwichtig sei. Markus war sicherlich gegen die abenteuerlich militante Politik des zelotischen Aufruhrs gegen Rom, die mit zum katastrophalen Ausgang des Judäischen Krieges beigetragen hatte. Aber dennoch schrieb er seine „Frohe Botschaft am Abgrund“ über einen Jesus, der in seinen Augen gerade als der „gescheiterte Messias“ die einzige Hoffnung zur Bewältigung des durch Rom verursachten Traumas war. <185>
Bleiben wir noch ein wenig bei Thyens Formulierung über die „politische Instrumentalisierung“, auf die Bittner in seinen Augen den Propheten wie Mose reduziert. In seinen Augen stimmt das schon für den Evangelisten Lukas nicht, der „in erkennbar intertextuellem Spiel mit der Exoduserzählung in der Apostelgeschichte oft und durchaus positiv von den sēmeia kai terata Gottes oder der Apostel sprechen kann“ und „in den Reden der Kapitel 3 und 7 unter ausdrücklicher Berufung auf Deut 18,15 Jesus als den da verheißenen Propheten bezeichnen kann“ (Apostelgeschichte 3,22f u. 7,37). <186> Auch für Lukas setzt Thyen dabei offenbar eine apolitische Auslegung einfach voraus. Dazu, dass man das Zeugnis für den Messias (Apostelgeschichte 1,8) „in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an den Rand der Erde“ auch anders interpretieren kann, verweise ich auf die Auslegungen von Gerhard Jankowski. <187>
Die Auslegung des Johannesevangeliums durch Veerkamp würde Thyen wohl auch als „politische Instrumentalisierung“ ablehnen. Ist es nicht aber umgekehrt eine unzulässige Entpolitisierung, wenn man sich weigert, die offensichtlichen Bezugnahmen des Johannesevangeliums auf die befreienden „Zeichen und Wunder“ des Exodus im Zusammenhang mit der auch von ihm erstrebten Befreiung von der Versklavung unter die römische Weltordnung zu sehen?
↑ Johannes 2,12: Der Abstieg der messianischen Gemeinde nach Kapernaum
2,12 Danach zog er hinab nach Kapernaum,
er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger,
und sie blieben nur wenige Tage dort.
[6. April 2022] Während Klaus Wengst den Vers Johannes 1,12 (W94} lediglich für eine überleitende „Zwischenbemerkung“ hält, „die einen Ortswechsel notiert“, hat er für Ton Veerkamp <188> eine größere Bedeutung:
Die messianische Hochzeit in Kana, Galiläa, ist das Gründungsfest der messianischen Gemeinde. Mit ihr geht er nach Kapernaum. Hier, am Anfang der Zeichen, sind alle, die die ursprüngliche messianische Gemeinde repräsentieren, noch zusammen: die Gemeinde, zu der die Mutter Jesu gehört, die Gemeinde der Brüder Jesu in Jerusalem und die Gemeinden der Schüler im Land und in der Region.
Das heißt, Veerkamp sieht in der Erwähnung der verschiedenen Begleiter Jesu nicht einfach eine unbedeutende Nebensache, sondern einen Hinweis auf die Vielfalt der ursprünglichen messianischen Nachfolgerschaft Jesu.
Indem Wengst bemerkt (W94), dass hier Jesu „Geschwister“ erwähnt werden, „die bisher nicht eingeführt waren und die sich am Anfang von Kap. 7 mit Jesus auseinandersetzen werden“, unterstellt er genderpolitisch korrekt, aber wohl nicht der Aussageabsicht des Johannes entsprechend, dass mit adelphoi auch Schwestern Jesu mitgemeint sein könnten. Das ist grammatikalisch möglich, da es im Griechischen neben adelphoi, „Brüder“, und adelphai, „Schwestern“, keinen gesonderten Begriff für Geschwister gibt. Jedoch zeigt gerade die Art, wie Johannes Maria Magdalena als Zeugin des zum VATER aufsteigenden Jesus zu den Brüdern Jesu sendet, ohne dass sie oder eine andere Frau später als in der Mitte der Schüler anwesend erwähnt wird, dass Johannes bei allem Respekt und aller Wertschätzung, die er gegenüber Frauen zum Ausdruck bringt, die üblichen Regeln einer männerdominierten Gesellschaft nicht außer Kraft setzt. <189>
Hartwig Thyen (T164) behandelt wie Veerkamp
diesen knappen Vers als eine Szene eigenen Rechts. Denn die vorausgegangene Hochzeits-Episode hatte ja mit V. 11 ebenso ihren förmlichen Abschluß gefunden, wie die dann folgende Szene im Jerusalemer Tempel deutlich durch V. 13 eröffnet wird. Bei aller Anerkennung der Brückenfunktion von V. 12 sprechen für seine relative Selbständigkeit auch der Abschluß des bislang leitenden Tages-Schemas durch die Wendung ou pollas hēmeras, der Ortswechsel von Kana nach Kapharnaum {Kapernaum} und endlich die Neueinführung „der Brüder Jesu“ in die Erzählung.
Für Kapernaum setzt Johannes Thyen zufolge „offenbar voraus, daß seine Leser über die enge Beziehung Jesu zu diesem Ort am See Genezaret im Bilde sind“, der in Matthäus 4,13ff. als sein Wohnort genannt wird. Auch die „Brüder Jesu“, die hier erstmalig erwähnt werden und dann erst wieder in 7,2ff. auftauchen, wo sie (7,5) „nicht an Jesus glauben“, führt Johannes „als bekannte Größe“ ein. Damit wird in Thyens Augen bestätigt, dass er „durch den befremdlichen Dialog Jesu ‚mit seiner Mutter‘ (2,2f)“ möglicherweise auf die Kritik an der Familie Jesu in Markus 3,31-35 (und Parallelen) anspielen wollte. Allerdings muss man im Blick auf die Mutter Jesu fairerweise sagen, dass sie sich bei Johannes als Nachfolgerin des Messias voll und ganz bewährt, indem sie den Diensthabenden sagt, dass sie auf den Messias hören sollen. In welcher Weise die Brüder Kritik verdienen, wird am Beginn des Kapitels 7 zu erörtern sein.
Zur „Wendung ou pollas hēmeras {nicht viele Tage}“ zitiert Thyen Birger Olssons Annahme, auch sie könne mit dem Hintergrund der Sinai-Erzählung zu tun haben: <190>
„Sie würde dann für den siebten und achten Tag stehen, Ex 24. Die Abweichungen im Material, das Johannes zur Verfügung stand, waren so groß, dass er die Ereignisse nur mit dem vagen ou pollas hēmeras {nicht viele Tage} verbinden konnte. Mehrere der Themen in Ex 24 und Joh 2,12-22 passen zusammen: das Opfer zur Sühne der Sünden des Volkes, das Blut des Bundes, der Tod Jesu, die Schekinah Gottes, der achte Tag als Tag der Auferstehung usw.“
Diese Erklärung ist aber alles andere als befriedigend, da ich nicht einmal vage Übereinstimmungen der Formulierung „nicht viele Tage“ mit 2. Mose 24 finden kann. Für diese Wendung bringt Veerkamp eine viel einleuchtendere Parallele aus dem 5. Buch Mose, deren Begründung er allerdings erst im Zuge seiner Auslegung der Heilung des Gelähmten in Kapitel 5 im einzelnen nachliefern wird:
„Sie blieben dort nicht viele Tage“, heißt es abschließend. Von Israel hieß es: „Ihr saßt fest in Kadesch-Barnea, viele Tage, die Tage, die ihr fest saßt“ (Deuteronomium 1,46), und: „Wir umkreisten das Gebirge Seïr viele Tage“ (Deuteronomium 2,1). Schließlich heißt es: „Und die Tage, die wir gingen von Kadesch-Barnea bis zum Bach Sered (die Grenze zu den Feldern Moabs), waren achtunddreißig Jahre“ (Deuteronomium 2,14). „Nicht viele Tage“ bedeutet: der Aufenthalt in Kapernaum soll nicht wie der Aufenthalt in Kadesch-Barnea werden: die achtunddreißig Jahre Israels sind vorbei. Um das zu verstehen, müssen wir bis 5,1ff. warten. Die Schwierigkeit bei Johannes ist, dass er immer Rätsel aufgibt, die man erst nach der Lektüre des ganzen Textes lösen kann.
Keiner der drei Exegeten geht darauf ein, dass Johannes den Weg Jesu nach Kapernaum mit dem Verb katabainein, „hinabsteigen“, ausdrücklich als Abstieg beschreibt. Dazu fand ich bei Andreas Bedenbender <191> den Hinweis, dass Jesus im Johannesevangelium nach Kapernaum immer hinabsteigt, und es wäre falsch, diese Angabe einfach als geographische Richtigkeit zu interpretieren. Im Zusammenhang einer Untersuchung zu den Fluchworten über Kapernaum in Matthäus 11,23 und Lukas 10,15 weist er nach, dass „Kapernaum“ dort einen von mehreren Decknamen für die römische Hauptstadt Rom darstellt, und ihm zufolge [433] vertritt in gewisser Weise
auch das johanneische Kapernaum Rom. Schließlich ist das römische Kaisertum bei Johannes nicht anders als bei den Synoptikern eine Instanz, die in Opposition zum Gott Israels steht, insofern sie in die Sphäre des Satans gehört. <192>
Weiter schreibt Bedenbender [432-433]:
Mit Kapernaum verbindet sich im Joh-Ev regelmäßig die Vorstellung des Abstiegs (katabainein, „hinabsteigen“, in 2,12; 4,47.49.51; 6,16f.). Es gibt keinen zweiten Ort, von dem so etwas gilt. Kapernaum fungiert damit als Gegenpol zu Jerusalem und dem Tempel, wohin der Weg typischerweise hinaufführt (anabainein). <193> Das innerweltliche Visavis von Kapernaum und Jerusalem ist allerdings eingebettet in das große Gegenüber von kosmos und „Vater“. Wiederum bilden katabainein und anabainein das zentrale Begriffspaar – beschreiben sie doch gemeinsam die Bewegung Jesu erst vom „Vater“ hinunter in den kosmos und dann aus dem kosmos wieder hinauf zum „Vater“.
Kapernaum, der Tiefpunkt in der Welt des Joh-Ev, erscheint bei solcher Betrachtung als das wahre Ziel der katabasis {des Abstiegs} Jesu. Folgerichtig ist es eben in Kapernaum, wo Jesus seiner Zuhörerschaft regelrecht einhämmert: Er ist das Brot, das vom Himmel hinabstieg (6,33-58: siebenmal katabainein). Und genauso folgerichtig situiert der Evangelist hier auch die denkbar anstößigste Konkretisierung des Gedankens, das Wort sei Fleisch geworden, die er als Schibbolet auf dem Weg der Nachfolge wird: Es gilt, die Fleischwerdung des Logos ohne jeden Vorbehalt zu schlucken – das Fleisch Jesu muß „gekaut“, sein Blut muß „getrunken“ werden. Wem das zuviel des Guten sein sollte, der hat, so Johannes, bei Jesus nichts verloren.
Dieser Zusammenhang wirft auch Licht auf das Hinabsteigen vom Ort der beiden anfänglichen messianischen Zeichen in Kana nach Kapernaum (2,12; 4,47.49.51) [432]:
Anfangs, in 2,12, manifestiert sich in Kapernaum die Einheit der messianischen Gemeinde. Die Mutter Jesu, seine Brüder und seine Schüler handeln alle genauso wie er selber, sie „bleiben“ (menein) mit ihm an einem Ort, d.h., sie halten bei ihm aus. Das ist freilich nur ein Zwischenspiel („nicht viele Tage“), welches innerhalb des Joh-Ev ohne Parallele dasteht. <194> Und in 6,66 verortet Johannes die gegenläufige Vorstellung vom Zerfall der Gemeinde ebenfalls in Kapernaum. Nimmt man beides, die Bewährung und das Versagen, zusammen, dann ist Kapernaum offenbar der Ort, an dem die Gemeinde in die krisis gerät: In Kapernaum entscheidet sich, was aus ihr wird, ob sie besteht oder vergeht.
Damit hat sich gezeigt, wie viel bei Johannes in einem so kurzen Vers, der scheinbar nur eine Überleitung darstellt, inhaltlich stecken kann.
↑ Tempelreinigung und Tempelaufrichtung in drei Tagen (Johannes 2,13-22)
[7. April 2022] Mit der Erzählung von der Tempelreinigung beginnt für Klaus Wengst (W94) ein zweiter Teil des Johannesevangeliums, der „durch die Lokalisierung in Jerusalem und Judäa zusammengehalten“ wird und drei Abschnitte enthält: „die Aktion Jesu im Tempel (2,13-22), das Gespräch mit Nikodemus über die Geburt aus Geisteskraft (2,23-3,21) und das letzte Zeugnis des Johannes (3,22-36).“ Ich frage mich aber, ob eine derart formale an geographischen Gegegebenheiten orientierte Gliederung den Absichten des Evangelisten gerecht wird.
Für Ton Veerkamp <195> ist es kein Zufall, dass auf das Zeichen der „Unmenge Weins“, das der architriklinos bestätigt hat und das „für die Fülle der messianischen Zeit“ steht, nun die Aktion Jesu „im traqlin, im triklinos des Gottes Israels…, dem Heiligtum in Jerusalem“, folgt.
Ich füge hinzu, dass es möglicherweise auch kein Zufall ist, dass dem Abstieg der messianischen Gemeinde nach Kapernaum (2,12), dessen Name, wie eben gesagt, für die dem Gott Israels entgegenstehende Weltordnung Roms stehen mag, unmittelbar der Aufstieg nach Jerusalem, der Stadt Gottes, folgt (2,13). Was er dort „findet“, heuren (2,14), sind jedoch römische Zustände: das Haus Gottes ist zu einer „Krämerstätte“, oikos emporiou (2,16), einem Handelshaus, geworden.
Für Hartwig Thyen (T165) gehört die
dramatische Szene der Tempelreinigung Joh zur Eröffnung des Wirkens Jesu unter den Juden als „den Seinen“ (1,11): Zu „ihrem“ Passa-Fest zieht Jesus mit seinen Jüngern hinauf nach Jerusalem in seine idia patris {eigene Vaterstadt}; (s. u. zu 4,44) und begibt sich zum Tempel. Doch weil er dieses „Haus seines Vaters“ (oikos tou patros mou 2,16) von Opfertier-Händlern und Geldwechslern in Besitz genommen und so zu einem oikos emporiou {Kaufhaus} heruntergekommen „findet“, macht er sich an seine „Reinigung“.
Seine Entscheidung, die Tempelreinigungs-Erzählung als siebte Szene den ersten Akt der Dramaturgie des Johannesevangeliums beschließen zu lassen, begründet Thyen hauptsächlich damit (T167), dass er nach einem Vorschlag von Anthony Harvey <196> das ganze Evangelium „tatsächlich als eine Art Prozeßprotokoll“ über „das Gerichtsgeschehen zwischen Jesus und den Juden“ lesen will, „in dem die Ankläger zu Angeklagten werden und der Angeklagte als der verborgene Weltenrichter erscheint“. Das heißt, nicht erst in „der traditionellen Passionsgeschichte“ wie in den synoptischen Evangelien wird Jesus durch den Hohenpriester und den Hohen Rat verurteilt (am Schluss des Johannesevangeliums steht nur noch der „Prozeß Jesu vor Pilatus“ im Zentrum); stattdessen wird der Prozess führender Juden gegen Jesus bereits im ersten Akt des Johannesevangeliums „durch die Szene der Tempelreinigung eröffnet“.
Wie das Verhältnis dieser Ioudaioi, „Judäer“ oder „Juden“, zu den Römern und zu Jesus zu beurteilen ist, wird weiterhin am Text konkret zu klären sein. Zur Bedeutung des Wortes Ioudaios sagt Thyen ausdrücklich, dass es „durch seinen jeweiligen Kontext definiert“ wird und es „ihm nicht etwa von Haus aus irgendeine ‚eigentliche Bedeutung‘“ anhaftet:
Darum muß über seinen Sinn und seine möglichen Referenzobjekte von Fall zu Fall entschieden werden. Zugleich gilt es dabei zu bedenken, daß die Ioudaioi unseres Evangeliums ebenso wie dessen jüdischer Protagonist und seine jüdischen Jünger zunächst fiktionale Figuren einer poetischen Textwelt sind. Darum dürfen die Urteile des erzählten Protagonisten und seines Erzählers über diese erzählten Juden und ihr erzähltes Verhalten nicht unvermittelt zu Aussagen über alle wirklichen Juden von Fleisch und Blut oder gar über das „Wesen“ des jüdischen Volkes generalisiert werden. Gleichwohl darf natürlich die hier angemahnte notwendige Unterscheidung zwischen der Denotation des Plurals hoi Ioudaioi auf der Textebene und seinen Konnotationen in der sozialen Enzyklopädie seiner Zeit nicht zur Trennung beider Fragestellungen und dazu führen, die Frage nach der Relation dieser erzählten „Juden“ zu realen Juden, sei es in der erzählten Zeit Jesu oder sei es in der Zeit und Welt unserer Erzählung gar nicht mehr zu stellen. <197>
Thyen sieht jedenfalls (T180) auch im „Auftreten der Ioudaioi, zunächst zum ,Verhör‘ des treuen und ,wahrhaftigen‘ (10,41) Zeugen Johannes und hier als derjenigen, die von Jesus fordern, daß er sein Tun im Tempel durch ein ,Zeichen‘ legitimiere“, eine deutliche Verknüpfung vom „Anfang dieses ersten Aktes mit seinem Ende“. Dasselbe gilt für die Erwähnung „des ‚nahen Passafestes‘“ in Johannes 2,13, die den Anfang des ersten Aktes mit dem Wort des Zeugen Johannes vom Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, aufruft.
Zur Frage (T166), woher Johannes die „Tempelreinigungs-Episode“ übernommen hat, stellt Thyen die Frage, ob Johannes „auch hier dergestalt mit den Texten seiner Vorgänger spielt, daß er die bei ihnen verstreuten Glieder zu einem geschlossenen Corpus zusammenfügt, oder ob er hier womöglich einer grundsätzlich anderen Überlieferung und/oder Quelle folgt“. Er selbst meint (T167) ironisch über alle Quellenspekulationen im letzteren Sinn: Sie „liegen und leiden im gleichen Spital“, indem sie letzten Endes das Problem nicht lösen können, warum Johannes die Tempelreinigung „an ihren jetzigen Ort versetzt“ hat „und was diese Versetzung für die Interpretation der Szene selbst und des gesamten Evangeliums bedeutet“. <198>
Indem ich der nachfolgenden Einzelauslegung vorgreife, zitiere ich Thyens zusammenfassende Einschätzung des johanneischen Spiels mit den Synoptikern (T180):
Durch eine dreifache Modifikation seiner synoptischen ,Prätexte‘ macht Joh seine Tempelreinigungs-Szene zur Eröffnung des in Kreuzigung und Auferstehung gipfelnden Prozesses gegen Jesus: Dazu versetzt er nämlich (1) die in seinen Vortexten fest mit der Passion Jesu verbundene Erzählung von der Tempelreinigung an diesen Anfang der Auseinandersetzung seines Protagonisten mit ,den Juden‘. Zugleich verschmilzt er (2) diese Erzählung mit dem Tempelwort aus der synoptischen Verhandlung des Synhedriums gegen Jesus zur unlösbaren Einheit. Und endlich modifiziert er dabei (3) das ,Tempelwort‘ derart, daß es ebenso zur Weissagung seines gewaltsamen Todes und seiner sieghaften Auferstehung binnen dreier Tage, wie zur verborgenen Kennzeichnung der Ioudaioi als der Vollstrecker seiner Tötung wird.
Dazu muss ich jedoch anmerken, dass Thyen hier insofern unsauber argumentiert, als erstens nicht alle Juden, sondern nur die führenden Priester samt den von ihr angestachelten Helfershelfern die Kreuzigung Jesu fordern werden, und zweitens die eigentliche Vollstreckung des Todesurteils durch Pilatus und seine Soldaten erfolgen wird.
Einen weiteren möglichen Grund (T167), warum Johannes „die Tempelreinigung samt dem Tempelwort absichtsvoll an ihren jetzigen Ort gerückt habe“, benennt Thyen zustimmend unter Berufung auf Ekkehard Stegemann, <199> nämlich „um sie so weit wie irgend möglich vom Prozeß Jesu zu trennen und damit auch jeden Schimmer eines politisch-revolutionären Verständnisses der Messianität Jesu auszuschließen“. Damit macht Thyens erneut – ohne weitere Begründung – seine Ablehnung einer politischen Auslegung des Johannesevangeliums deutlich. Richtig daran ist, dass Johannes den Messias Jesus keineswegs in eine Reihe mit zelotischen Anführern des Judäischen Krieges wie Johannes von Gischala oder Simon bar Giora stellen wollte.
Es wäre aber verfehlt, dem johanneischen Jesus ein rein religiöses, apolitisches Streben nach einem jenseitigen Himmelreich zu unterstellen. Dem widerspricht schon sein konkretes Auftreten im Tempel zu Jerusalem, mit dem wir uns jetzt im einzelnen beschäftigen wollen.
↑ Johannes 2,13: Der Aufstieg des Messias zum Passafest nach Jerusalem
2,13 Und das Passafest der Juden war nahe,
und Jesus zog hinauf nach Jerusalem.
[8. April 2022] Zu den drei im Johannesevangelium erwähnten Passafesten (2,13.23; 6,4; 11,55) meint Thyen (T169), dass „im Zentrum jedes dieser drei Passafeste das heilvolle Sterben und Auferstehen Jesu steht“ und es daher „eher um die variationenreiche Bearbeitung des einen synoptischen Passamahles Jesu“ geht als um die Ausweitung der Zeitspanne des öffentlichen Wirkens Jesu.
Im Zusammenhang mit dem Passafest ist nach Thyen auch das „Hinaufsteigen“, anabainein, Jesu nach Jerusalem zu verstehen, denn dieses Wort war „schon nahezu zum terminus technicus für den Pilgerweg auf den Gottesberg Zion geworden“. In den Augen Thyens besucht Jesus als „frommer und toratreuer Jude … den Tempel zu den großen Pilgerfesten seines Volkes.“ Eine (T170) grundsätzliche „Distanz Jesu zu Tempel und Tempelkult sowie zur Tora und zum jüdischen Festkalender“ ist also aus dem Johannesevangelium ganz und gar nicht herauszulesen. Nur wenn man „das spätere und feindliche Verhältnis der von der Synagoge getrennten vornehmlich heidenchristlichen Kirche zum Judentum und zu dessen im Jahre 70 mit der Tempelzerstörung untergegangenem Opferkult“ als bereits zur Zeit des Johannes gegeben voraussetzt, kann „der fromme und toratreue Jude Jesus, der mit seinem Volk so leidenschaftlich um das gemeinsame und für beide Seiten natürlich absolut verbindliche heilige Erbe streitet, fast zu einem antijudaistischen Christen“ gemacht werden.
Auch Wengst (W96, Anm. 79) wendet sich gegen die Haltung etwa eines Exegeten wie Michael Theobald, <200> der auf die Frage [228f.], „ob ‚der Erzähler Jesus als frommen Juden darstellen‘ wolle“, mit „Gewiss nicht!“ antwortet. Vielmehr, so Theobald, [231] „habe Jesus ‚mit seiner umfassenden wie endgültigen Austreibungs-Aktion selbst das Ende des Opfer- und Sühnekultes herbeigeführt‘“ [237]:
„Fortan tritt er in einem Tempel auf, der in seiner Wesensmitte von ihm selbst gleichsam ent-kernt wurde. Für seine eigenen Auftritte dient er nur noch als Kulisse einer ansonsten leeren Bühne“… Wenn das die Intention der fiktiven Darstellung des Johannes war, wieso lässt er Jesus dann nicht die Priester hinausjagen, wieso lässt er ihn nur das Geschäftliche aus dem Tempelbereich verweisen und ihn positiv mit biblischen Zitaten vom „Haus meines Vaters“ reden? … Mir scheint, dass sich in dieser Auslegung … immer noch die durch Jahrhunderte geübte Substitution {Ersetzung} Israels durch die Kirche auswirkt.
Veerkamp <201> weist darauf hin, dass pascha „das aramäische Wort für das hebräische pessach, das große Fest der Befreiung aus dem Sklavenhaus“, ist. Wie wichtig dem Evangelisten Johannes gerade dieses Fest ist, zeigt seine wiederholte Erwähnung. Allerdings ist das Passafest im Johannesevangelium immer nur „nahe“, seine wirkliche Feier wird nirgends beschrieben, auch in den Versen 2,13ff. nicht:
Jesus steigt auf nach Jerusalem. Denn das Pascha muss am Ort, den sich der NAME erwählt hat, gefeiert werden. … Jesus macht dort eine Entdeckung, die ihm jede Befreiungsfeier unmöglich macht: er findet (!) im Heiligtum die, die es zu einer Krämerstätte machen.
Insofern verweist bereits die Nähe des Passafestes, von der im Vers 13 die Rede ist, darauf hin, welche neue Befreiungstat des Messias notwendig ist, damit es neu mit Sinn erfüllt wieder gefeiert werden kann:
Wenn der Messias, „das Mutterschaf von Gott her, das die Verirrung der Weltordnung aufhebt“ (1,29), am Vorbereitungstag des Paschafestes getötet ist, wird das, was das erste Pascha wollte, zur Realität – zur endgültigen Befreiung von jedem Pharao.
↑ Johannes 2,14-16: Jesu Aktion gegen Händler und Geldwechsler im Tempel
2,14 Und er fand im Tempel die Händler,
die Rinder, Schafe und Tauben verkauften,
und die Wechsler, die da saßen.
2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken
und trieb sie alle zum Tempel hinaus
samt den Schafen und Rindern
und schüttete den Wechslern das Geld aus
und stieß die Tische um
2,16 und sprach zu denen, die die Tauben verkauften:
Tragt das weg
und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!
[9. April 2022] Die von Johannes beschriebene Aktion Jesu im Tempel kann Wengst zufolge (W96) „aus einer ganzen Reihe von Gründen“ nicht wirklich so geschehen sein. Zunächst einmal könnte kaum „ein einzelner, selbst wenn er eine Peitsche hat, eine nicht gering gedachte Anzahl von Viehhändlern, Taubenverkäufern und Geldwechslern aus dem großen Areal des Vorhofs der Völker oder auch nur der königlichen Säulenhalle hinaustreiben“, ohne dass diese sich erfolgreich „zur Wehr setzen“ oder „das levitische Tempelpersonal“ unverzüglich eingreift. Zum andern aber lässt es sich aus jüdischen Quellen weder bestätigen, dass „Viehhändler“ oder (W97) „Taubenhändler ihre Ware im Tempelbezirk verkauften“, dass dort also „munteres Jahrmarktstreiben“ herrschte, noch, dass „Geldwechsler, die für die Einziehung der Tempelsteuer zuständig waren, ihre Tische im Tempelbezirk hatten“. Schließlich belegt eine Bemerkung des Josephus, <202> dass an „den Wallfahrtsfesten … auch die römische Besatzungsmacht im Tempelbezirk militärische Präsenz“ zeigte und bei einer „Aktion im Tempelvorhof von solchem Ausmaß, wie sie von Jesus in den Evangelien erzählt wird“, sofort eingegriffen hätte.
Warum stellt dann aber Johannes die Geschichte von der Tempelreinigung so dar, „wie sie historisch unvorstellbar ist“? Antijüdische Exegese hat behauptet (W98, Anm. 86), dass der johanneische Jesus die jüdische Geschäftemacherei im Tempel als „das letzte, tiefste Motiv der ganzen gottesdienstlichen Arbeitsamkeit“ der Juden angegriffen hätte. <203> Dagegen verweist Wengst (W98) auf die jüdische Erwartung, dass der Tempel nur „im Zustand kultischer Reinheit“ sowie mit unschuldigen Händen und reinem Herzen (Psalm 24,3-5) aufgesucht werden darf. Auch im äußeren Erscheinungsbild schlägt sich nach rabbinischen Quellen <204> die „besondere Ehrfurcht“ nieder, die für das Betreten des Tempelberges erforderlich ist:
„Nicht darf man den Tempelberg betreten mit seinem Stock, mit seinem Schuh, mit seinem Geldgürtel und mit Staub auf seinen Füßen. Auch zum Abkürzungsweg darf man ihn nicht machen. Und spucken darf man umso weniger.“
Hinzu kamen Vorschriften, sein „Geld nicht offen zu tragen“, worin „sich jedenfalls das Bestreben“ zeigt, „das Geschäftliche nicht in den Vordergrund treten zu lassen.“ Daraus zieht Wengst den Schluss (W98f.):
So wie Johannes die Aktion Jesu im Tempel darstellt, stimmt er in der Tendenz völlig überein mit den jüdischen Zeugnissen, die ein der Heiligkeit des Ortes entsprechendes Verhalten im Bereich des Tempels verlangen. Jesus „erscheint als ein ernster Eiferer, der den Respekt, ja, den Beifall eines jeden jüdischen Frommen verdient“. <205> Wenn er die Viehhändler samt ihrem Vieh hinausjagt, die Tische der Wechsler umstürzt und Taubenverkäufer auffordert, ihre Ware hinauszuschaffen, ist das alles andere als eine radikale Infragestellung des Tempelkultes. Es ist keine grundsätzliche Tempelopposition, sondern nicht mehr und nicht weniger als die Hinausverweisung des Geschäftlichen aus dem heiligen Ort.
Bestätigt wird diese Sicht der Dinge durch „die Zitatanspielung am Schluss des Wortes Jesu, die zugleich die Funktion einer Begründung für seine Aktion haben dürfte: ‚Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus!‘“ Damit wird auf Sacharja 14,21 angespielt, wo „für die künftige Heilszeit verheißen“ wird, dass es keine Händler mehr im Haus Gottes geben wird:
Was hier verheißen wird, stellt Jesus jetzt schon her. So ist diese Darstellung zugleich ein Hinweis darauf, dass mit ihm die erwartete Heilszeit bereits angebrochen ist.
Leider ist diese Auslegung nicht wirklich überzeugend. Wengst ist so sehr bemüht, interreligiös korrekt Johannes vom Vorwurf antijüdischer Kritik zu entlasten, dass seine Argumentation jegliche Plausibilität verliert. Warum sollte Jesus für die Ehrfurcht gegenüber dem Tempel mit einer Aktion eintreten, die den Tempelfrieden in massiver Weise stört, wenn solche Geschäfte, wie Johannes sie erwähnt, im Tempel gar nicht wirklich abgewickelt wurden? Natürlich kann man bezweifeln, dass Johannes historisch Recht hat, aber er geht doch offenbar davon aus, dass der Tempel tatsächlich als Kaufhaus missbraucht wurde. Ist er damit ein Judenfeind?
Auch Thyen bezweifelt (T171), dass „die Anwesenheit von Viehhändlern, Taubenverkäufern und Geldwechslern im Tempel wirklich so selbstverständlich und unentbehrlich war“, wie es „zahlreiche Ausleger“ annehmen, um von diesem Argument her „Jesu Tempelreinigung“ als „einen fundamentalen Angriff auf den Tempelkult und zumal auf seine blutigen Tieropfer“ zu begreifen, „die sie nicht als von Gott gebotene und gewährte Sühnemittel, sondern als menschliche Kompensationsleistungen begreifen.“ Er kann sich aber vorstellen, dass der „Groß- und Kleinvieh-Markt“ und der „Taubenverkauf im Tempelbezirk“ möglicherweise eine „erst im Jahre 30 durch den Hohenpriester Kaiaphas eingeführte Neuerung“ war, wie Viktor Epstein <206> annimmt, und diese Neuerung könnte „vielen, die um die Reinheit des Tempels besorgt waren, höchst anstößig gewesen sein“ (T172):
Angesichts der vielen Wachen an den Tempeltoren und der Anwesenheit des übrigen Aufsichtspersonals sowie der nahen Präsenz der Römer auf der Burg Antonia, die einen guten Einblick in das Geschehen hinter den Tempelmauern bot, ist Jesu Tempelreinigung, auch wenn es sich dabei nur um eine Art prophetischer Zeichenhandlung an einem pars pro toto {wobei ein Teil für das Ganze steht} gehandelt haben sollte, jedenfalls nur vorstellbar, wenn Epsteins genannte Hypothese zutreffen und der Verkauf von Opfertieren im Tempelbezirk tatsächlich eine umstrittene Neuerung gewesen sein sollte. Hätte Jesus nämlich mit seiner Aktion in einen längst eingeschliffenen und in den Augen aller für die ordentliche Funktion des Tempelkults notwendigen Brauch eingegriffen, so wäre er wohl umgehend verhaftet und vor Gericht gestellt worden. War seine Tempelreinigung dagegen aber ein Angriff auf eine neue Maßnahme, die sowohl vom Sanhedrin als auch von den Frommen im Volk mißbilligt wurde, so könnte das die Unsicherheit der Verantwortlichen und ihr Nicht-Eingreifen vielleicht erklären…
Damit öffnet Thyen den Blick für eine andere Sichtweise als bei Wengst: Es geht dem johanneischen Jesus nicht um christliche Kritik am jüdischen Opferwesen als solchem, sondern er wendet sich als Jude, nämlich als der Messias des Gottes Israels, gegen andere Juden, die aus dem Haus seines VATERS, also des befreienden NAMENS, praktisch einen heidnischen Marktplatz, emporion, machen. Eine solche Sichtweise erläutert Veerkamp <207> genauer:
Das Heiligtum war ein Markt für den überregionalen Austausch von Waren nach den Prinzipien einer Geldökonomie. Diese Funktion hatte es schon in der vorhellenistischen Zeit, aber im Hellenismus entwickelte sich das Heiligtum schnell zum Markt für Güter und Dienstleistungen und hatte außerdem die Funktion eines Finanzinstitutes (2 Makkabäer 3,10f.).
Diese Stelle aus dem 2. Makkabäerbuch belegt sehr gut, was Veerkamp unter Berufung auf Martin Hengel <208> in dem pointiert zugespitzten Satz ausdrückt:
Die Judäer lebten in einer der Kultur nach vom Hellenismus zutiefst geprägten Stadt.
So gesehen übten messianisch geprägte Juden wie Johannes, die vom Messias die Überwindung der hellenistisch-römischen Weltordnung erwarteten, Kritik am Jerusalemer Tempelbetrieb nicht wegen der von der Tora geforderten Tempelfrömmigkeit, sondern gerade umgekehrt, weil aus dem Ort (5. Mose 12,5), wo der Gott Israels „seinen NAMEN wohnen lässt“, ein heidnischer Marktplatz geworden ist:
Auf solchen Märkten gab es seit der hellenistischen Antike bis in die frühmoderne Zeit Geldwechsler. Für die Existenz solcher Märkte im Bereich des Hauses Gottes gibt es außerhalb der Evangelien keine historischen Belege. Die Stadt selber freilich kannte solche Märkte. Händler kauften und verkauften, und da jeder kleine Potentat in der Region (etwa Herodes Antipas) zumindest ein eingeschränktes Münzrecht hatte, war eine Reihe von Währungen in Umlauf. Auch wenn die Geldwechsler nur für das Einziehen der Hebe für das Heiligtum (meistens „Tempelsteuer“ genannt) zuständig waren, sieht Johannes sie als Krämer, wie jene, die mit Opfertieren handelten.
In diesem Zusammenhang ist – wie für Wengst und Thyen – auch für Veerkamp „der letzte Satz des Buches Sacharja“ (14,21) die Bibelstelle, die durch Jesus Begründung für die Tempelreinigung, „macht nicht das Haus meines VATERS zum Handelshaus“, in Erinnerung gerufen wird:
„Es wird kein Krämer sein im Haus des NAMENS der Heerscharen an diesem Tag.“ Ein Zustand, nach dem sich das fromme Israel sehnt. Der Kaufmannsstand galt in Israel und überhaupt in der Vormoderne als etwas Abartiges, berufsmäßige Händler werden „Kanaaniter“ genannt. Zumindest am Schabbat duldete Nehemia keine Krämer in der Stadt (Nehemia 13,15-22). Jerusalem war in den Augen der Evangelisten eine hellenistische Stadt, eine „Krämerstadt“ (emporion), wie die Propheten die phönizische Handelsmetropole Tyrus nannten, ihre Handelspartner wurden folgerichtig emporioi, „Krämer“, genannt (Jesaja 23,17; Ezechiel 27,15). Das muss ein Ende haben. Jesus macht damit ein Ende.
Interessant finde ich, dass die Septuaginta in Jesaja 23,17 das Wort emporion, „Marktplatz“, für hebräische Worte verwendet, die mit „Hurenlohn“ und „Hurerei“ zu tun haben. Schon in Vers 15 des hebräischen Jesaja-Textes werden die folgenden Verse 16-18 als „Hurenlied“ angekündigt, und in Vers 17 heißt es von jhwh, dem befreienden NAMEN, dass er die Stadt Tyrus nach 70 Jahren wieder zum alten Reichtum kommen lässt: wɘschawah lɘˀethɘnannah wɘsanɘthah, „er lässt zurückkehren ihren Hurenlohn und lässt sie huren“, und zwar mit allen Königreichen auf Erden. Die Septuaginta übersetzt diese hebräischen Worte über die Stadt Tyrus weitaus weniger anstößig folgendermaßen: palin apokatastathēsetei eis to archaion kai estai emporion, „wieder bringt er sie zurück in ihren alten Zustand und sie wird ein Marktplatz sein“, und zwar wiederum für alle Königreiche der Erde.
Um diese eigenartige Ausdrucksweise zu verstehen, muss man wissen, dass das Bild der Hurerei in der hebräischen Bibel den Abfall Israels zu fremden (unterdrückenden und Ausbeutung legitimierenden) Göttern bezeichnete. Dass Jesaja die Handelsgewinne der Stadt Tyrus als Hurenlohn und ihren Handel als Hurerei bezeichnet, lässt erkennen, dass der Prophet auch den internationalen Handel hellenistischer Prägung mit Götzendienst gleichsetzt. Im folgenden Vers 18 sieht Jesaja dann eine erstaunliche Wende voraus, dass nämlich dieser Handels- bzw. Hurenlohn (wohl ausnahmsweise) nicht den Reichtum der Reichen auf Kosten der Armen vergrößern wird, sondern er wird „denen zufallen, die vor dem HERRN wohnen, dass sie essen und satt werden und wohlbekleidet seien.“
Ich kann mir vorstellen, dass Johannes mit dem Wort emporion auch auf diese Stelle anspielt, <209> um erstens das Handelstreiben im Tempel als von Grund auf gegen den Gott Israels gerichtet, sprich als „Hurerei“, zu brandmarken, und um zweitens anzudeuten, dass sogar solcher Hurenlohn durch das Eingreifen des befreienden NAMENS einmal der Ernährung und Versorgung Israels dienen kann.
Indem Thyen darauf hinweist (T174), dass in Sacharja 14,21 das hebräische Wort „kanaˁani keinesfalls den ,Kanaanäer‘ als Inbegriff des Fremden und Nicht-Israeliten bezeichnen kann, sondern wie Zeph 1,11 übertragen gebraucht und mit ‚Krämer‘ zu übersetzen ist“, geht auch er davon aus, dass das Wort emporion in einem zumindest indirekten Zusammenhang mit der phönizischen Stadt Tyrus zu betrachten ist. Denn Johannes benutzt ja emporion im gleichen Sinn wie das Wort Chananaios, „Kanaanäer“, in dem „ein notorisches Charakteristikum der Phönizier als eines ausgesprochenen Händlervolkes zu einer Quasi-Berufsbezeichnung geworden“ ist.
Seltsam argumentiert Thyen (T175) zur Frage, warum Johannes sich auf Sacharja 14,21 bezieht und nicht „die synoptische Tempelreinigungs-Szene mit ihrem aus Jes 56,7 und Jer 7,11 kombinierten Zitat: ho oikos mou oikos proseuchēs klēthēsetai, hymeis de auton poieite spēlaion lēstōn {„Mein Haus soll ein Bethaus heißen“; ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus} (Mt 21,13)“ aufgreift. Zustimmend gibt er die Auffassung von Francis Moloney <210> wieder, dass Jesus, indem er „den oikos kyriou pantokratoros {das Haus des Herrn, des Allherrschers} des Sacharja-Textes als oikos tou patros mou {das Haus meines Vaters} bezeichnet, … unüberhörbar sein Recht und seinen Anspruch auf den Tempel“ anmeldet (175f.):
„Im synoptischen Bericht über dieses Ereignis lassen alle Evangelisten Jesus Jesaja 56,7 zitieren und behaupten, der Tempel sei ‚mein Haus‘ … Eine solche Behauptung würde nicht zur johanneischen Darstellung von Jesus passen. Während Israel durch seinen Tempel in Beziehung zu Gott steht, stellt Jesus diese Beziehung nun in Frage, indem er behauptet, dass sogar ihr Tempel in besonderer Weise zu ihm gehört, da er das Haus seines Vaters ist“…
Für mich ist erstens nicht nachvollziehbar, worin der diesbezügliche Unterschied der beiden Stellen Sacharja 14,21 und Jesaja 56,7 liegen soll. Es geht um denselben Gott Israels, der bei Sacharja als jhwh zɘbaˀoth, der „HERR Zebaoth, der umscharte NAME“, und bei Jesaja einfach als jhwh, „der NAME“, beschrieben wird, und der Tempel Jerusalems wird als sein Haus bezeichnet. Da im Johannesevangelium der NAME gemeint ist, wo Jesus von seinem VATER redet, hätte er also genau so gut im Blick auf den Jesaja-Text den Tempel das Haus seines VATERS nennen können.
Zweitens aber bedeutet der Anspruch, den Jesus auf den Tempel anmeldet, in keinster Weise, dass dieser Anspruch nunmehr dem Volk Israel weggenommen wird. Er erhebt diesen Anspruch ja, indem er selbst den monogenēs para patros, den erstgeborenen Sohn Gottes, nämlich Isaak=Israel verkörpert, und nur als solcher ist er zugleich auch die Verkörperung des NAMENS des Gottes Israels. Nicht um Israel den Tempel und den damit verbundenen Kult wegzunehmen, nennt Jesus den Tempel das Haus seines VATERS, sondern um darauf hinzuweisen, dass dieser Tempel längst dem eigenen Volk weggenommen wurde, denn er dient nicht mehr der Sammlung des Volkes und der Reinigung von seinem Fehlverhalten, sondern der Abwicklung profitabler Geschäfte im Rahmen der herrschenden Weltordnung.
Richtig ist sicher, wie Thyen unter Berufung auf Dieter Lührmann <211> meint, dass Johannes es vermeiden will, in
seiner Erzählung von dem guten Juden Jesus … den Tempel unhistorisch eine ‚Räuberhöhle‘ zu nennen. Denn in der synoptischen Version scheint sich doch der „tatsächliche Zustand des Tempels“ und seine Bezeichnung als spēlaion lēstōn {Höhle der Räuber, Aufständischen, Terroristen} „weniger auf das Treiben der Händler als auf die Schlußphase des Jüdischen Krieges in der Gegenwart des Mk, in der der Tempel in der Hand der Aufständischen war“, zu beziehen.
Ich erkenne darin auch eine differenzierte Beurteilung verschiedener jüdischer Gruppierungen durch den Evangelisten Johannes: Während er in Johannes 10,1.8 durchaus auch auf die Aufständischen des Judäischen Krieges kritisch eingehen wird, wendet er sich in Johannes 2,14-16 gegen die judäische Führung, die den eigenen Tempel in ein hellenistisches Handelshaus verwandelt hat.
↑ Johannes 2,17: Ist Jesus ein Eiferer, ein Zelot?
2,17 Seine Jünger aber dachten daran,
dass geschrieben steht (Psalm 69,10):
„Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.“
[10. April 2022] Während Jesus selbst auf Sacharja 14,21 angespielt hatte, denken seine Schüler bei der Aktion Jesu im Tempel an Psalm 69,10:
der Eifer um dein Haus hat mich gefressen,
und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.
Der zweite Teil des Zitats kann bereits, obwohl er bei Johannes nicht ausdrücklich erwähnt wird, auf das folgende Streitgespräch Jesu mit seinen jüdischen Gegnern anspielen, der erste Teil wird bei Johannes in eine Zukunftsform umgewandelt.
Klaus Wengst zufolge (W99)
wird auch hier eine starke Bindung Jesu an den Tempel zum Ausdruck gebracht. Sein Eifer um Gott manifestiert sich im Eifer um den von ihm erwählten und so geheiligten Ort. Die futurische Fassung scheint eher dadurch motiviert zu sein, dass hier zugleich auch ein Ausblick auf die Passion erfolgt – wie ja auch Ps 69, in dem der unschuldig verfolgte Gerechte seine Hoffnung auf Gott setzt, im Ganzen Passionsklang hat.
Auch nach Hartwig Thyen (T176) dient die Zukunftsform dazu, „Jesu gesamten weiteren Weg unter den Schatten des Kreuzes“ zu rücken, „auch wenn seine mit ihm ziehenden Jünger das einstweilen nur ahnen können“:
Anders als der durch die Prologlektüre vorbereitete und mit den synoptischen Evangelien vertraute ideale Leser, der bereits den Ausgang der Geschichte Jesu kennt und weiß, „daß die Finsternis das Licht nicht verschlingen wird“ (1,5), kann ihr ,Erinnern der Schrift‘ die Jünger als handelnde Figuren der Erzählung natürlich nur ahnen oder fürchten lassen, daß Jesu Aktion im Tempel und sein unerhörter Anspruch auf ihn als „Haus meines Vaters“ ihn in einen Konflikt auf Tod und Leben verwickeln könnte…
Obwohl Thyen also selber einräumt, dass der Tod Jesu ja nicht wirklich in dem Sinne verstanden werden darf, dass das Licht von der Finsternis verschlungen wird, wendet er sich gegen C. Kingley Barretts <212> Auslegung:
„Die meisten Kommentatoren sehen in kataphagetai eine Anspielung auf den Tod Jesu; sein Eifer für Gott wird (menschlich gesprochen) sein Fall sein. Es scheint jedoch keinen vernünftigen Grund zu geben, warum nicht sowohl der Psalmist als auch Joh von dem verzehrenden Eifer gesprochen haben könnten“.
Gerade wegen der „Vorliebe unseres Evangelisten für doppeldeutige Ausdrücke“, von der Thyen ausgeht, dürfen beide Sichtweisen nicht ausgeschlossen werden. Das hatte Thyen selbst (T174) zuvor übrigens auch nicht getan, als er in einem anderen Zusammenhang Jesus als denjenigen bezeichnet hatte, „den der Eifer um die Heiligkeit des Hauses ‚seines Vaters‘ buchstäblich und mit Haut und Haaren ‚verzehren wird‘.“
Ton Veerkamp <213> wiederum betont nur die Seite der Medaille, die bei Thyen weniger Aufmerksamkeit genießt:
die Schüler erinnern sich daran, dass Jesus ein Zelot war: „Der Eifer (zēlos) um dein Haus frisst mich“, sagt der Psalm, und wir denken an Elia, der bekannte: „Geeifert, habe ich, geeifert (zēlōn ezēlōka) für den NAMEN, den Gott der Ordnungen“, 1 Könige 19,10. Jesus war nach Johannes ein Zelot, aber ein richtiger, kein Rambo vom Schlage der Leute, die während des zelotischen Regimes in Jerusalem (68-70) jenes blutige Chaos anrichteten, das in die unvorstellbare Katastrophe des Jahres 70 führte. Was hier geschieht, ist eine Art von Chanukka, die Reinigung des Hauses Gottes. Hier wird das negative Moment der Chanukka, die Säuberung, erwähnt, in 10,22ff. das positive.
Chanukka ist das jüdische Fest, das an die Reinigung des Tempels zu Jerusalem vom hellenistischen Staatskult erinnert, den Antiochos IV. als der Großkönig der Region Syrien-Mesopotamien ca. 200 Jahre vor der Zeit Jesu dort eingeführt hatte. Das heißt, Veerkamp zufolge stellen tatsächlich
alle Evangelisten Jesus ganz in die Tradition der makkabäischen Revolution. Dass sie diesen Jesus den militärischen Zelotismus ablehnen lassen (Johannes 10,8ff.; 18,11; Matthäus 26,52), hat mit einem dogmatischen Pazifismus nichts, mit einer realistischen Einschätzung des militärischen Kräfteverhältnisses alles zu tun.
Zur Begründung dafür, dass man auf Jesus keinen absoluten Verzicht auf jede Gewaltausübung zurückführen kann, führt Veerkamp das Argument an:
Auffällig ist die Gewalt, die Jesus hier anwendet; einer wie Gandhi war er bei Johannes nicht. Auf Unvoreingenommene macht das keinen guten Eindruck; sie können sich dem Eindruck nicht entziehen, dass hier ein fundamentalistischer Eiferer am Werke ist.
Thyen allerdings (T174) sieht zwar auch gegenüber dem synoptischen Bericht eine Verschärfung der Aktion Jesu, und zwar sowohl durch seinen Einsatz der „Peitsche“ als auch durch das „Verschütten der Wechselmünzen“, aber (T173) Johannes achtet ihm zufolge doch sorgfältig darauf, den Eindruck zu vermeiden, „Jesus könne gegen subjektiv unschuldige Menschen seine Peitsche erhoben haben“, indem er ihren Einsatz in Vers 15 ausdrücklich nur auf die Schafe und Rinder und nicht auf die vorher und nachher erwähnten Händler und Geldwechsler bezieht.
↑ Johannes 2,18-21: Das Zeichen des Abbruchs und der Aufrichtung des Tempels
2,18 Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm:
Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?
2,19 Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Brecht diesen Tempel ab
und in drei Tagen will ich ihn aufrichten.
2,20 Da sprachen die Juden:
Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden,
und du willst ihn in drei Tagen aufrichten?
2,21 Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.
[11. April 2022] Auf die Aktion Jesu im Tempel antworten die Ioudaioi, „Judäer, Juden“, sofort, indem sie von Jesus ein sēmeion, „Zeichen“, fordern. Damit wollen sie, so Wengst (W100), „einen messianischen Erweis“ dafür, dass „die Heilszeit“ schon angebrochen ist, worauf in seinen Augen „die Anspielung auf Sach 14,21“ hingedeutet hat. Tatsächlich verweist Jesus aber nur seine „Leser- und Hörerschaft in aller wünschenswerten Klarheit“ in verschlüsselter Form „auf das messianische Zeichen, das Wunder schlechthin“, nämlich seinen Tod und seine Auferstehung. Ihnen gilt die Erläuterung des Erzählers, dass Jesus peri tou naou tou sōmatos autou, „von dem Tempel seines Leibes“, redet: dieser kann nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n. Chr. als „Ort der besonderen Gegenwart Gottes“ verstanden werden. Seine Gegner, die ihn befragen, können ihn dagegen nur missverstehen, als ob er wirklich die Tempelgebäude abreißen und wiedererrichten wolle. Bezieht man die Bauzeit des Tempels von 46 Jahren (Anm. 102) auf die von König Herodes „im Jahre 19 v. Chr.“ begonnene „gründliche Renovierung des Zweiten Tempels“, ergibt sich für den Zeitpunkt der Aktion Jesu das Jahr 27 n. Chr., was historisch vorstellbar ist, aber nicht zwingend erschlossen werden kann.
Thyen fügt diesen Angaben von Wengst hinzu (T177), dass „Jesu Tempelreinigung“, ohne dass sie „ausdrücklich als sēmeion bezeichnet wäre, … offenbar doch als solches verstanden werden“ wollte. Das schließt er aus dem Rückverweis auf die Zeichen, die Jesus getan hatte, in Vers 23, und auch aus Johannes 6,30, wo ebenfalls ein Zeichen gefordert wird, obwohl Jesus bereits die Speisung der 5000 vollbracht hatte. Während die Schüler Jesu „des Zeichencharakters der Tempelreinigung innewerden, indem sie sich der Schrift erinnern (V. 17), erweisen sich die Ioudaioi diesem ,Zeichen‘ gegenüber gerade dadurch als Blinde, daß sie zu seiner Legitimation wiederum ein sēmeion fordern.“
Weiter betont Thyen (T178), dass Jesus diese Zeichenforderung nicht etwa abweist, vielmehr kündigt er „das von ihm geforderte Zeichen in Gestalt des Abbruchs und der Wiedererrichtung des Tempels binnen dreier Tage an“, womit er „ganz buchstäblich das Sterben und Auferstehen Jesu als sein definitives sēmeion“ ankündigt.
Schließlich erklärt Thyen auch „das Tempelwort Jesu und diese Reaktion der zeichenfordernden Juden als ein Spiel mit den synoptischen Texten“ (T178f.):
Brachten die Prozeßzeugen bei Markus gegen Jesus die falsche Anschuldigung vor (epseudomartyroun), er habe gesagt: egō katalyō ton naon touton ton cheiropoiēton kai dia triōn hēmerōn allon acheiropoiēton oikodomēsō {Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist} (14,58), so muß pseudomartyrein {falsches Zeugnis ablegen} ja nicht heißen, daß das ganze Zeugnis frei erfunden wäre, und wohl auch nicht, daß Jesus in Wahrheit nur gesagt habe, er könne (dynamai) den Tempel abbrechen und binnen dreier Tage neu errichten (Mt 26,61). Es ist aber gleichwohl ein „falsches Zeugnis“, und was daran falsch ist, läßt Johannes seine Leser hier am Ort des ursprünglichen Gesprochenseins des Tempelwortes wissen. Nicht er werde den Tempel zerstören, hat Jesus gesagt, sondern die Ioudaioi. Und der „andere, nicht mit Händen gemachte“, Tempel, den er binnen dreier Tage dafür errichten/erwecken (egeirein) wird, ist der „Tempel seines Leibes“ (V 21).
Zusätzlich sieht Thyen (T179) „diese Identifikation des Tempels mit dem Leib Jesu“ durch „Jesu Antwort auf die Zeichenforderung bei Mt 12,39f. inspiriert“, die sich auf den dreitägigen Aufenthalt des Propheten Jona im Bauch des Wals bezieht.
In Vers 19 wird Jesu Imperativ lysate ton naon touton, „zerstört diesen Tempel!“ insofern „absichtsvoll doppeldeutig“ zu einer unfreiwilligen Weissagung, als die hier angesprochenen führenden Juden
durch ihr Drängen auf seine Kreuzigung … nicht nur den ,Tempel seines Leibes‘ zerstören, sondern am Ende wird auch der noch gar nicht vollendete Prachtbau des herodianischen Tempels zuerst zur „Räuberhöhle“, nämlich zur Kommando-Zentrale der Aufständischen, und endlich zur rauchenden Trümmerstätte werden.
Veerkamp <214> gesteht den hier anwesenden Repräsentanten der judäischen Führung zu, dass sie „allen Anlass“ hatten, Jesus „nach seiner Legitimation zu fragen“, und dass der Evangelist Johannes sich dessen auch bewusst sein musste:
Immerhin hatte das militärische Abenteuer der Zeloten das Volk in eine entsetzliche Katastrophe geführt. Sie haben das barbarische Eingreifen Roms und die Zerstörung der Stadt und des Heiligtums veranlasst. Nicht nur Romanhänger wie Flavius Josephus, sondern auch andere Angehörige des Volkes waren dieser Ansicht.
Und so fragen sie, „mit welcher Legitimation Jesus mit seiner Aktion eine Politik des Kompromisses mit Rom gefährden könnte.“ Seine Antwort darauf muss ihnen jedoch als „eine unerhörte Provokation“ erscheinen:
Was wir hier erleben, ist typisch für das literarische Verfahren des Johannes. Er lässt Jesus etwas sagen, was seine Gegner notwendig missverstehen müssen. Entweder ist das Evangelium vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben, und dann treibt Johannes ein böses Spiel mit den Befürchtungen der Judäer. Oder es ist nach der Zerstörung geschrieben. Dann ist die Antwort erst recht inakzeptabel. Jesus gibt sich nicht die geringste Mühe, den Standpunkt der Gegner ernst zu nehmen. Nicht einmal die Schüler haben ihn verstanden; erst nach seinem Tod begriffen sie, dass er nicht vom Heiligtum, dem Haus Gottes, gesprochen hatte, sondern „über den Tempel seines Körpers“. Vor seinem Tod gingen sie, wie alle anderen auch, selbstverständlich davon aus, Jesus rede vom Heiligtum und von nichts sonst.
Veerkamp erklärt nun die Provokation, indem er darauf hinweist, wie Johannes hier vom Haus Gottes redet. Hätten die Judäer genauer zugehört, dann hätten sie den Sinn von Jesu Rede verstehen können:
Johannes redet vom Haus Gottes immer als vom Heiligtum (hieron). Nur hier redet er vom Tempel (naos). Johannes bewegt sich in einem Vorstellungsraum, der unter vielen Messianisten verbreitet war. So wird der Hohepriester beim Verhör vor dem Sanhedrin Jesus verstehen; dieser habe gesagt: „Ich werde diesen mit Menschenhänden gemachten Tempel (naos) herunterreißen und nach drei Tagen einen anderen, nicht mit Menschenhänden gemachten aufbauen“ (Markus 14,58; Matthäus 27,61). Es handelt sich hier nicht um eine billige Polemik gegen „jüdische Tempelfrömmigkeit“; der Ort in Jerusalem, an dem Jesus lehrte und das Volk politisch aufklärte, war auch für die Messianisten ein Ort der Heiligkeit des Gottes Israels, eben „Heiligtum“. Es handelt sich vielmehr um den Widerstand gegen einen Prozess, der das judäische Heiligtum (hieron) zu einem gojischen {heidnischen} Tempel (naon) macht. Der Tempel wird mit dem gleichen Adjektiv cheiropoiēton, „von Menschenhänden gemacht“, bezeichnet (Apostelgeschichte 7,48), das in der Schrift von Götzenbildern gebraucht wird (maˁaße jede ˀadam, Psalm 115,4). In der messianischen Zeit wird der Tempel wieder zum Heiligtum werden; das macht die Leidenschaft (zēlos) des Messias aus. Johannes lässt Jesus den Judäern in Jerusalem, also der judäischen Obrigkeit, vorwerfen, dass sie aus dem Haus des Gottes Israels eine hellenistische Religionsanstalt mit ihren ganzen Auswüchsen der Geschäftemacherei machen und sich dieses Etikettenschwindels gar nicht bewusst sind.
Obwohl ich diese Ausführungen Veerkamps inhaltlich voll und ganz teile, kann mich seine sprachliche Unterscheidung der Vokabeln hieron und naos nicht überzeugen. Der rein negativen Bedeutung von naos widerspricht schon seine Verwendung für den Tempel des Leibes Jesu und bereits in der jüdischen Bibel werden die Wörter hieron und naos gleichbedeutend für den jüdischen Tempel gebraucht. Als im 3. Buch der Makkabäer 1,10 erzählt wird, dass der ägyptisch-hellenistische König Ptolemäus IV. in Jerusalem „die gute Ordnung des Heiligtums bewundert und den Wunsch in Erwägung zieht, den Tempel zu betreten“, thaumasas de kai tēn tou hierou eutaxian enethymēthē bouleusasthai eis ton naon eiselthein, kommen sogar beide Wörter parallel und bedeutungsgleich in einem Vers vor.
Allerdings halte ich es für möglich, dass Johannes durch das Spiel mit unterschiedlichen Wörtern gleichen Sinnes seiner Hörer- und Leserschaft zu denken geben will, ob sich ihre Bedeutung wirklich von selbst versteht oder nicht vielmehr zur Erschließung neuer Erkenntnis offen bleiben muss.
Thyen hatte bereits in einem anderen Zusammenhang (T170), als es darum ging, ob „to hieron ebenso wie ho naos … den gesamten Tempelbezirk einschließlich des eigentlichen Heiligtums bezeichnet“ oder nicht, darauf hingewiesen, dass „das Wechselspiel mit semantisch identischen Synonyma geradezu ein Stilmerkmal“ des Johannesevangeliums ist (T170f.):
So ersetzt Johannes etwa das seltene Lexem kermatistēs {Münzwechsler} – wohl von kermatizō abgeleitet und sonst nur in einem Papyrus der Universität Gießen belegt – im folgenden Vers 15 durch das synoptische kollybistēs {Geldwechsler} und vermeidet so das harte Zusammenstoßen von kermatistēs mit kerma {Geld, Münze}. Als derart stilistische Variationen, und keinesfalls als Lizenzen für literarkritische Operationen, wird man auch den Wechsel von ploion und ploiarion {Boot und Bötchen} in 6,17ff oder den von agapan und philein {lieben und befreundet sein} in 21,15ff zu begreifen haben. Das muß auch für den Wechsel zwischen hieron am Anfang und naos am Ende unserer Szene gelten. Denn ohne diese semantische Synonymität der beiden Lexeme verlöre das Mißverständnis der nach einem legitimierenden Zeichen für Jesu Tempelreinigung fragenden Juden in der Tat seinen Witz…
Gerade was die beiden Wörter agapan und philein angeht, wird über die entsprechenden Unterschiede noch an Ort und Stelle zu reden sein. Auf jeden Fall sollte nicht zu früh einfach davon ausgegangen werden, dass Johannes die stilistische Variation nur aus formalen Gründen liebt. Sogar wenn die Bedeutung gleich sein sollte, will Johannes sie doch als inhaltlich außerordentlich bedeutsam hervorheben.
↑ Johannes 2,22: Vertrauen auf die Schrift und Jesu Wort nach seiner Aufrichtung aus den Toten
2,22 Als er nun auferstanden war von den Toten,
dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte,
und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.
Zum zweiten Mal in dieser Szene im Tempel heißt es von den Schülern Jesu, dass sie sich erinnern. Dieses Mal tun sie dies aber nicht hier in der Szene selbst, sondern der Erzähler blickt voraus auf die Zeit, nachdem Jesus tatsächlich aus dem Tode „aufgerichtet“ worden war; das heißt, Johannes verwendet dasselbe Wort egeirein für die Aufrichtung des Tempels und die Auferweckung Jesu. Die Erinnerung bezieht sich nun auf Jesu Wort über den Tempel seines Leibes, zugleich aber auch auf die Schrift.
Nach Klaus Wengst (W101) will Johannes seiner
Leser- und Hörerschaft … deutlich machen, dass Jesus nur angemessen wahrgenommen werden kann unter der Perspektive seines Todes am Kreuz und des Zeugnisses, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat. Das ist das messianische Zeichen, das Jesus in V. 19 anbietet: sein Tod und seine Auferweckung. Dass sich Gottes Gegenwart am gekreuzigten Jesus als lebendig machend erweist, legitimiert ihn als Messias.
Dass Johannes vom Glauben der Schüler an die Schrift und an das Wort Jesu spricht, bezieht Wengst nicht nur auf „die vorher in V. 17 zitierte bestimmte Schriftstelle“ und Jesu „Aussage von V. 19“, sondern (W101f.)
die ganze Schrift und für alle Worte, die Jesus im Evangelium sagt und die über ihn gesagt werden. Jesus ist da im Wort, das nun in der Zeit seiner leibhaftigen Abwesenheit die Gegenwart Gottes verspricht. Mit dem, was er gesagt, getan und erlitten hat, ist er da in den Worten des Evangeliums, im in ihnen schon ausgelegten Wort, das je und je wieder ausgelegt werden will. Aber neben und vor dem Wort Jesu steht „die Schrift“, die jüdische Bibel, die Bibel Jesu und des Evangelisten. Das Wort Jesu steht nicht isoliert für sich; es gründet in dieser Schrift.
Neben dieses Vertrauen der messianischen Gemeinde auf Jesus und die Schrift stellt Wengst (W102) das „Hören auf die Schrift, die Orientierung des Lebens an ihr, besonders an ihrem ersten Teil, der Tora“, das „dem nicht an Jesus als Messias glaubenden Judentum das Überleben nach der Katastrophe des Jahres 70 mit der Zerstörung des Tempels ermöglichte und es der Gegenwart Gottes vergewisserte.“ Ihm liegt sehr daran, zu betonen, dass die Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk „weder mit Jesu Tod und Auferweckung noch mit der Tempelzerstörung ihr Ende gefunden“ hat:
Wir dürfen daher Jesu „Leib als Tempel“ nicht als Ablösung des dann später zerstörten Tempels verstehen, sondern können wahrnehmen, dass noch und wieder Jüdinnen und Juden an der Westmauer des Tempelberges in Jerusalem beten und Gottesdienst feiern und dass Israel es gelernt hat, auch ohne den Tempel in der Gegenwart Gottes zu leben.
Diesen Erwägungen aus interreligiösem Geist stimme ich zwar voll und ganz zu. Für Johannes muss man allerdings sagen, dass er ein rabbinisches Judentum, das an der Tora festhält, ohne zugleich auf den Messias Jesus zu vertrauen, ablehnt. Natürlich wäre erst recht eine Enterbung des Judentums durch eine heidenchristlich dominierte Kirche für ihn keineswegs akzeptabel gewesen, hoffte er doch darauf, dass sich ganz Israel einschließlich Samaria und der Diaspora-Juden im Tempel des Leibes Christi, also der messianischen Gemeinde, als dem neuen Heiligtum Gottes versammelt. Gerade insofern wird Wengst allerdings auch der Einschätzung des Tempels im Johannesevangelium nicht vollständig gerecht. Ton Veerkamp <215> schreibt dazu:
Nicht die Zerstörung des Tempels, sondern die Aufrichtung des Messias aus den Toten ist das Zeichen. Für Johannes hat die Zerstörung der Stadt und des Heiligtums nach der Auferstehung des Messias keine wirkliche Bedeutung mehr. Bei ihm weint kein Messias über die Stadt (Matthäus 23,37ff.; Lukas 13,34-35; 19:41-44). Der Tempel wird zerstört, der Messias getötet, aber das Heiligtum konnte dagegen nicht zerstört werden, weil es nicht von Menschenhänden gemacht wurde, sondern der Ort war, den sich der NAME selber erwählt, freilich für einen ganz neuen Dienst, die Verneigung (Anbetung) gemäß „Inspiration und Treue“, wie wir bei der Auslegung von 4,20-24 unter 5.4 sehen werden. Und der Messias konnte durch den Tod beim Aufstieg zum VATER nicht aufgehalten werden.
Nach Veerkamp bedenkt Johannes aber in der Erzählung von der Tempelreinigung und dem Tempelwort Jesu nicht nur die jüdische Führung zur Zeit Jesu und das entstehende rabbinische Judentum zur Zeit des Evangelisten mit scharfer Kritik, sondern auch sein Blick auf die hier nur als unbeteiligte Beobachter anwesenden Schüler Jesu enthält kritische Untertöne:
Die Schüler als (nicht) handelnde Figuren der Erzählung stehen hier für die messianischen Gemeinden nach der Zerstörung. Auch sie haben die Antwort auf die Frage nach einem Zeichen nicht durchschaut. Das komme daher, meint Johannes, dass die Schüler – die messianischen Gemeinden nach dem Jahr 70 – weder der Schrift, noch dem Wort Jesu vertraut bzw. es verstanden haben. Vor der leeren Grabhöhle, der unbewohnten Trümmerstätte Jerusalems, steht die Gemeinde noch immer verständnislos, 20,11. Johannes geht mit der Depressivität seiner und der anderen messianischen Gemeinden hart ins Gericht. Er will, dass Israel seine Schrift wirklich versteht; sein hermeneutisches Prinzip ist der Messias, der sterben musste, damit er aufstehen konnte. Auch für Lukas war der Messias der Lehrer der Schrift, 24,32. Ein gutes Lehrhaus findet statt, wenn den Menschen „das Herz bei der Eröffnung der Schriften brennt“. Hier brennt gar nichts, hier gibt es nur Unverständnis.
Nach Hartwig Thyen (T180) ist mit Johannes 2,22 „die erste Tempelszene unseres Evangeliums und mit ihr dessen ,erster Akt‘ abgeschlossen.“ Die noch folgenden drei Verse des 2. Johanneskapitels zählt er schon als Überleitung zum Beginn des zweiten Aktes.
Auch Wengst sieht hier einen Einschnitt, allerdings endet ihm zufolge hier bereits der 1. Abschnitt des mit der Tempelreinigung begonnenen zweiten Teils des Johannesevangeliums über (W94) Jesu „Erste Wirksamkeit in Jerusalem und Judäa“.
Für Veerkamp <216> schließlich endet hier das erste „Lehrstück“, das der „Messias als Lehrer Israels“ vollbringt, bevor er in ein Lehrgespräch mit Nikodemus als dem „Lehrer Israels“ eintritt.
↑ Nikodemus, der Lehrer Israels (Johannes 2,23-3,21)
[16. April 2022] Den nun folgenden Abschnitt des Johannesevangeliums lassen sowohl Thyen als auch Wengst und Veerkamp bereits vor dem 3. Kapitel beginnen, da sie die letzten drei Verse des 2. Kapitels als Hinleitung zum Gespräch Jesu mit Nikodemus begreifen. Auch über sein Ende in Johannes 3,21 sind sie sich einig (W104):
Formal ist der gesamte Abschnitt 2,23-3,21 durch die Situationsangabe in V. 23 – das Pessachfest in Jerusalem – zusammengehalten. In 3,22 erfolgt ein Zeit- und Ortswechsel.
Nur Wengst schlägt im Vorhinein eine Gliederung dieses Abschnitts vor:
Diese so formal bestimmte Einheit lässt sich in folgender Weise gliedern: a) Überleitung (2,23-25); b) die These von der Geistgeburt und ihre Erläuterung (3,1-8); c) die Frage nach der Möglichkeit der Geistgeburt und ihre Beantwortung (3,9-21).
Außerdem weist Wengst daruf hin (W103), dass „das Gespräch mit Nikodemus“ zwar im „Mittelpunkt dieses Stückes“ steht, ab Vers 13
aber gerät der Gesprächspartner Jesu völlig aus dem Blick. Ohne dass davon Notiz genommen würde, verschwindet er. Hinzu kommt, dass Jesus von sich nicht mehr in der ersten Person spricht, sondern in der dritten Person vom Menschensohn und Gottessohn. Schließlich ist spätestens in V. 13 die in V. 1f. angegebene Situation weit überschritten, insofern hier auf das gesamte Wirken Jesu zurückgeschaut wird.
Auf Grund dieser Beobachtungen haben viele Exegeten (wieder einmal) gemeint, der Text sei aus verschiedenen Quellen in letztendlich schludriger Weise zusammengeleimt worden. Unsere drei Johannesausleger verwahren sich gegen solche Unterstellungen. Das „Verschwinden des Nikodemus“ aus dem Text sieht etwa Wengst als „bewusst eingesetztes Mittel“ der Textgestaltung des Johannes (W103f.):
Auf der Gesamtebene des Evangeliums ist Nikodemus Kontrastfigur zur samaritischen Frau im nächsten Kapitel. In ihren Reaktionen auf Jesus zeigen sich zunächst Entsprechungen. Aber während Nikodemus in abwehrender Fragehaltung verharrt, wird die Frau zur Zeugin Jesu. So gerät er aus dem Blick, während sie bis zum Schluss der Szene im Spiel bleibt.
Was Jesus in den Versen 3,13-21 ausführt, kann man also als eine „erste längere Ausführung im Munde Jesu“ sehen, die sich über den Kopf des aus dem Blick geratenen Nikodemus hinweg direkt an „die Leser- und Hörerschaft“ des Johannes richtet.
↑ Johannes 2,23-25: Jesus vertraut vielen nicht, die auf ihn vertrauen
2,23 Als er aber in Jerusalem war beim Passafest,
glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat.
2,24 Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an; denn er kannte sie alle
2,25 und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen;
denn er wusste, was im Menschen war.
[17. April 2022] Warum erwähnt Johannes, dass Jesus in Jerusalem während des Passafestes „viele Zeichen tat“? Ton Veerkamp <217> sieht darin einen gewissen „Widerspruch“, da er doch nach dem grundlegenden Zeichen der messianischen Hochzeit zu Kana „erst nach seinem Aufenthalt in Jerusalem und nach seiner Rückreise vom Jordan durch Samaria nach Galiläa sein ‚zweites Zeichen‘ (4,54) tat.“ Allerdings hatte Thyen schon im Zusammenhang mit der der Auslegung von Johannes 2,11 darauf hingewiesen, dass die Zählung der beiden Zeichen sich auf 2. Mose 4,8f. zurückbezieht und es wie in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten auch im Johannesevangelium neben den beiden gezählten Zeichen noch viele andere Zeichen gibt.
Speziell zu Johannes 2,23 bemerkt Hartwig Thyen (T182):
Daß hier als pars pro toto {Teil, der für das Ganze steht} der sēmeia ha epoiei {Zeichen, die er tat} Jesu Tempelreinigung stehen muß, wurde oben bereits gesagt. Darüberhinaus steckt in dem auffälligen Plural sēmeia möglicherweise noch das intertextuelle Spiel mit der Episode von der Verfluchung und dem Verdorren des unfruchtbaren Feigenbaumes mit Jesu Wort vom Berge versetzenden Glauben (Mk 11,12-14 u. 20-24).
Mir erscheint das durchaus nachvollziehbar, obwohl Klaus Wengst einwendet (W105, Anm. 109):
Konkret erzählt und als Zeichen benannt hat er nur das Weinwunder in Kana, das aber die Jerusalemer nicht gesehen haben. Die Aktion Jesu im Tempel versteht er nicht als Zeichen, da er in V. 18 auf sie bezogen nach einem Zeichen fragen lässt.
Dieses Argument zieht aber nicht, da auch in Johannes 6,30 von Menschen, die bereits das Zeichen der Speisung der Fünftausend erlebt haben, ein neues Zeichen gefordert wird. Wengst mag aber dennoch auch mit seiner Einschätzung Recht haben, dass Johannes „sich Jesus als ständig wirkend vorstellt (vgl. 5,17) – mit viel mehr Zeichen, als im Evangelium berichtet (vgl. 20,30).“
Zur Bedeutung des Wortes pisteuein hatte ich bereits am Ende der Auslegung von Johannes 1,6-8 auf Veerkamps Übersetzung mit „vertrauen“ hingewiesen. Zu Johannes 3,23.24 schreibt nun auch Wengst (W105, Anm. 108):
Ebenso gut möglich wie die geläufige Übersetzung von pisteúein mit „glauben“ – wahrscheinlich sogar treffender – ist die mit „vertrauen“. Das in V. 23f. im griechischen Text vorliegende Wortspiel mit pisteúein lässt sich jedenfalls im Deutschen nur bei der Übersetzung mit „vertrauen“ nachvollziehen.
Veerkamp begründet noch einmal nachdrücklich seine Vorliebe für „vertrauen“:
Wir vermeiden das Verb „glauben“, weil der Glaube etwas Statisches hat. Es ruft eine religiöse Weltanschauung auf. Das griechische Wort pisteuein und sein hebräisches Äquivalent heˀemin sind keine religiösen Kategorien. Gemeint ist eine Haltung der Zuversicht, dass es eine radikale Wendung in der Lage des Volkes geben wird und die komme dadurch zustande, dass man sich in seinem Lebenswandel (Halakha) auf den Messias hinbewegt.
Mit diesem Unterschied der Übersetzung scheint also eine klare inhaltliche Unterscheidung einherzugehen, denn Wengst und erst recht Thyen verstehen das Wort pisteuein eindeutig im religiösen Sinn als einen Glauben an Jesus. Wengst dürfte übrigens auch das Vertrauen auf Jesus in diesem Sinne begreifen.
Ich frage mich im Unterschied zu Veerkamp, ob die beiden Bedeutungen einander unbedingt ausschließen müssen. Recht gebe ich Veerkamp in seiner Einschätzung, dass man pisteuein vom hebräischen heˀemin und von den diesseitigen Hoffnungen der Propheten Israels her in seiner politischen Dimension ernstnehmen muss; Wengst und Thyen halte ich vor, diesen Aspekt weitgehend zu ignorieren. Zugleich ist aber in meinen Augen das Vertrauen Israels auf seinen Gott, der den befreienden NAMEN trägt, nicht ohne die religiöse Dimension der Beziehung von Menschen zu dem Gott denkbar, der im Gegensatz zu ihnen im Himmel wohnt (Psalm 115,16).
Wie ist nun (W105) die überraschende „Distanz“ Jesu „zu den hier erwähnten Glaubenden“ zu erklären, die „in einem Wortspiel zum Ausdruck gebracht“ wird, „dass sich Jesus seinerseits ihnen nicht anvertraut“? Viele Exegeten behaupten, dass Jesus das Vertrauen der Vielen auf ihn deswegen für fragwürdig hält (T183), weil sie nur einen „bloß vordergründigen, allein auf ,Zeichen‘ gegründeten Glauben“ aufweisen können. Thyen weist diese Annahme mit folgender Begründung zurück (T182):
Denn allein dazu, den Glauben ,vieler‘ zu erwecken und zu unterhalten, hat Jesus, wie einst Mose in Ägypten, seine sēmeia in göttlicher Sendung ja getan; und dazu, daß sie dem auch in aller Zukunft noch dienen sollen, hat unser Erzähler sie in seinem ,Buch‘ eigens ,(auf)geschrieben“ (20,30f). … Nirgendwo bietet unser Evangelium auch nur den leisesten Anhalt, geschweige denn die Lizenz dazu, Jesu Worte gegen seine sēmeia {Zeichen} oder gegen seine erga {Werke} auszuspielen. Im Gegenteil! Gerade das Resümee von 20,30f zeigt, daß der gesamte Weg des fleischgewordenen logos – also seine Worte, sein Verhalten und seine Taten – mit dem einen Stichwort sēmeia benannt und in ihm zusammengefaßt werden kann.
Zurückhaltender äußert sich Wengst zum Glauben auf Grund von Zeichen (W104):
Die „Vielen“ hier tun dasselbe wie „die Kinder Gottes“ nach 1,12: Sie „glauben an seinen Namen“. Dass sie es aufgrund von Zeichen tun, muss ihr Verhalten nicht als negativ qualifizieren. Denn in 2,11 wurde dieselbe Aussage von den Schülern Jesu im Blick auf das erste Zeichen in Kana gemacht. Am Ende des darauf folgenden Abschnitts, unmittelbar vor dem jetzigen, kam die österliche Zeit in den Blick. Darauf bezogen wurde die Glaubensaussage für die Schüler Jesu wiederholt (2,22). Durch diese Anordnung erscheint der Glaube aufgrund der Zeichen als einer, der noch vor seiner Bewährung angesichts des gekreuzigten Jesus steht, auf den alle Zeichen hinweisen.
Einig sind sich Wengst und Thyen am Ende aber doch in der Beurteilung der Vielen, von denen hier die Rede ist. Wengst nämlich fährt fort (104f.):
Nikodemus wird als Repräsentant einer Gruppe deutlich werden, die zur Zeit des Evangelisten eine Rolle spielt: heimliche Sympathisanten, die kein offenes Bekenntnis wagen und sich bedeckt halten, die die mögliche Konsequenz scheuen, aufgrund ihres Glaubens mit dem gekreuzigten Jesus in irgendeiner Weise konform gemacht zu werden. So hat Johannes zwar eine bestimmte Gruppe im Auge. Weil aber deren Versagen auch die Gefährdung des nachösterlichen Glaubens bleibt, kann er ganz allgemein vom Menschen reden. Den Glauben „hat“ man nicht ein für alle Mal, sondern er wird bewahrt, indem er sich bewährt. In je konkreter – und besonders in bedrängender – Situation erweist es sich schon, worauf ich wirklich mein Vertrauen setze.
Ganz ähnlich ist Thyen zufolge (T182)
das Manko der ,vielen‘ und der Grund des ihnen von Jesus verweigerten Vertrauens… allein ihre Lichtscheu, ihre Furcht davor, ihren (durchaus richtigen) Glauben auch öffentlich zu bekennen (3,19-21).
Ton Veerkamp sieht die Verse 2,23-25 im Licht anderer Zusammenhänge als „ein vorweggenommenes Resümee“, das er mit 12,37 vergleicht, wo nach der Verkündigungstätigkeit Jesu abschließend vom Nicht-Vertrauen der Judäer die Rede ist:
Jesus geht auf Distanz zu denen, die auf Grund der Zeichen in Jerusalem „auf seinen Namen vertrauten“. … Jesus schätzt die Bewegung der Judäer auf seinen Namen hin nicht als eine wirkliche Bewegung ein. Von ihnen ist 8,31ff. die Rede, wo es zu einem folgenschweren Konflikt kommt.
Den Hinweis auf 8,31 finde ich deswegen interessant, weil auch dort in zwei aufeinanderfolgenden Versen (8,30.31) zunächst davon die Rede ist, dass viele auf Jesus vertrauen, dann aber von Juden, die auf ihn vertraut hatten, aber dies (nach allem, was danach von ihnen erzählt wird) offenbar nicht mehr tun. Dort scheint es um diejenigen zu gehen, die ihr Vertrauen auf Jesus durch eine „harte“ oder „böse“ Rede Jesu (sklēros, 6,60) verloren hatten und als Abtrünnige nun Jesus um so heftiger aus der Sicht der toratreuen Judäer angreifen.
Interessant finde ich auch Wengsts Hinweis (W105), dass unsere kleine Szene als eine „negative Entsprechung zu der Szene mit Natanael“ gesehen werden kann, den Jesus von vornherein als ‚echten Israeliten‘ kannte (1,47), während er hier ‚wusste, was im Menschen war‘ – offenbar nichts Gutes. Von sich aus scheint er jedenfalls nicht die Gewähr für Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Treue zu bieten.“
Ich denke, es könnte sich hier um Leute handeln, die zwar Nathanaels Hoffnung auf Frieden für Israel (unter dem Feigenbaum, vgl. die Auslegung zu Johannes 1,47-49) teilen, aber nicht offen sind für das Größere, das Jesus gegenüber Nathanael ausdrückte, nämlich für alles, was mit der Vision des offenen Himmels über dem Menschensohn zu tun hat (Johannes 1,50-51). Das wird bestätigt durch diejenigen, die nach der Speisung der Fünftausend Jesus zu einem König zelotischer Prägung machen wollen (6,15), und durch die Brüder Jesu, die ihn zur öffentlichen Aktion beim Laubhüttenfest auffordern und denen in diesem Zusammenhang ihr Nicht-Vertrauen bescheinigt wird (7,3-5). Es gibt also auch ein politisch zu verstehendes Vertrauen auf Jesus, das auf einen gewaltsamen Aufstand gegen die jüdische Führung und die römischen Besatzer ausgerichtet ist, das Johannes aber rundweg als terroristisches Abenteuer mit verheerenden Folgen ablehnt. Dass Jesu Weg der Überwindung der herrschenden Weltordnung im bewussten Erleiden der Hinrichtung am römischen Kreuz bestehen soll, wird der Punkt sein, der das Vertrauen vieler der jetzt auf seinen Namen Vertrauenden in Unverständnis und Ablehnung bis hin zum Hass umschlagen lässt.
Heute, am Ostersonntag 2022, frage ich mich, wie vielen von uns Jesus wohl vertrauen würde, die wir uns heute Christen nennen und mehr oder weniger fest an ihn glauben, ja, vielleicht sogar mit ganzem Herzen auf ihn vertrauen. Könnte er beispielsweise einen Glauben an ihn akzeptieren, der mit der Vorstellung verbunden wäre, dass alle Juden, die nicht an ihn glauben, auf ewig verdammt sind?
Die Frage, woher Jesus weiß, ti ēn en tō anthrōpō, „was im Menschen war“, wird von unseren drei Exegeten unterschiedlich beantwortet. Thyen schreibt (T183):
Jesus weiß das aufgrund seiner Einheit mit dem Vater (10,30) und seiner darin gründenden Erkenntnis der Herzen, die auf keinerlei Belehrung über das Innere des Menschen angewiesen ist. Mit ihm weiß das freilich einstweilen allein sein allwissender Erzähler, der es in dem nun folgenden Gespräch mit Nikodemus auch den Jüngern und mit ihnen dem Leser ein Stück weit enthüllen wird. Daß Jesus ,weiß, was im Menschen ist‘, gilt freilich nicht nur den in V. 23 genannten ,vielen Jerusalemern‘, sondern auch seinen eigenen Jüngern gegenüber. Er weiß zuvor, daß „viele seiner Jünger ihn verlassen und fortan nicht mehr mit ihm wandeln werden“ (6,66). Obgleich er die Zwölf erwählt hat, ,weiß er‘, daß einer von ihnen der ,Teufel‘ ist, der ihn ausliefern wird (6,70). Daß mit seiner ,Stunde‘ auch für sie die ,Stunde‘ kommen wird: hina skorpisthēte hekastos eis ta idia kame monon aphēte {dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst (Jn. 16:32 L17)} (16,32), weiß er im Voraus…
So weit wie Thyen treibt Wengst die Identifikation Jesu mit Gott nicht, aber auch er (W105) sieht Jesu Wissen, was im Menschen ist, als eine ihm von Gott ermöglichte besondere Fähigkeit:
In der rabbinischen Tradition wird unter den „sieben Dingen, die vor dem Menschen verborgen sind“, angeführt: „Kein Mensch weiß, was im Herzen seines Mitmenschen ist“, begründet mit Jer 17,10: „Ich, der Ewige, erforsche das Herz.“ <218> Wird Jesus als Kenner dessen, was im Menschen ist, gezeichnet, erscheint er damit als Beauftragter und Bevollmächtigter Gottes.
Veerkamp dagegen vertritt eine total entgegengesetzte Position:
Jesus wusste, was er an diesen Leuten hatte. Auch hier geht es nicht um ein übernatürliches psychologisches Wissen, sondern um eine politische Einschätzung. Er brauchte kein Zeugnis über die Menschen, er erkennt, was mit ihnen politisch los ist.
So richtig Veerkamp meines Erachtens mit seiner politischen Interpretation der Anliegen des Johannesevangeliums auf den Spuren der jüdischen Propheten liegt, liest er manchmal doch zu sehr eine moderne nicht-religiöse Sichtweise in die jüdischen und messianischen Schriften hinein. Ich denke, dass Johannes durchaus davon überzeugt war, dass der Messias Jesus, als der jüdische Mensch aus Fleisch und Blut, der er war, zugleich voll und ganz vom befreienden NAMEN inspiriert war und aus diesem Geist heraus erkennen konnte, was die Menschen, denen er begegnete, in ihrem Willen wirklich antreibt.
Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass der übernatürliche Aspekt dieses Wissens, mit dem Johannes vermutlich kein Problem hatte, jedenfalls nicht der entscheidend wichtige ist. Entscheidend ist, so meine ich, die oben erörterte Frage, welche Art des Vertrauens, das wir zu Jesus aufbringen, ihn dazu veranlassen würde, auch auf uns sein Vertrauen zu setzen. Indem ich diesen Satz formuliere, wird mir bewusst, wie stark er von vielem abzuweichen scheint, was ich seit Jahrzehnten zu glauben gewohnt bin. Hängt denn Jesu Vertrauen zu uns von unserem Vertrauen zu ihm ab? Ist es denn nicht wahr, dass unser Vertrauen auf Jesus ein unverdientes Gottesgeschenk ist und bleibt? Ich lasse diese Frage vorläufig offen; um ihre Klärung geht es Johannes an dieser Stelle nicht. Er legt den Finger auf die Wunde, dass es Glauben an Jesus geben kann, der auf falschen Erwartungen beruht oder nicht durchgehalten, sich nicht bewähren wird.
↑ Johannes 3,1-2a: Nächtlicher Besuch des Pharisäers und Ratsherrn Nikodemus bei Jesus
3,1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern
mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden.
3,2a Der kam zu Jesus bei Nacht…
[18. April 2022] Die biblischen Kapiteleinteilungen stammen ja nicht von den Autoren selbst; dass man mit dem Vers Johannes 3,1 ein neues Kapitel beginnen ließ, hängt sicher damit zusammen, dass Jesus mit dem hier neu eingeführten Charakter ein langes Gespräch führen wird.
Zum Namen Nikodemus verweist Wengst darauf (W105), dass er „griechisch“ ist und „- wie viele andere griechische Namen – auch von Juden im Land Israel übernommen“ wurde. Thyen fügt hinzu (T183), dass er „in der rabbinischen Überlieferung“ auch mehrfach in der hebräischen Version „naqdimon“ vorkommt:
Nichts spricht jedoch dafür, Jesu nächtlichen Besucher mit irgendeinem der bekannten, hier oder da genannten Juden namens ,Nikodemus‘ zu identifizieren. Er dürfte ebenso fiktional sein wie die gesamte Szene… Möglicherweise spielt der Autor aber, ähnlich wie im Fall Nathanaels oder des Ortsnamens Kana, zugleich mit der einen ,Sieger‘ ankündigenden Etymologie {Wortherkunft} des Namens ,Nikodemus‘ {von nikē, „Sieg“, und dēmos, „Volk“}.
Wie bereits ausgeführt, war es aber wohl nicht die Absicht des Johannes, ein neues Kapitel erst mit 3,1 einsetzen zu lassen. Vielmehr nennt er Nikodemus beispielhaft als einen der Menschen, von denen bereits in den Versen 2,24-25 die Rede war. Dazu schreibt Wengst (W104):
Indem Nikodemus in seinem ersten Redebeitrag anerkennend auf die Zeichen hinweist, die Jesus tut (3,2), wird er als einer von den Vielen erkennbar, die nach V. 23 aufgrund dieser Zeichen „ihr Vertrauen auf seinen Namen setzten“ bzw. „an seinen Namen glaubten“.
Auf ein weiteres Argument dafür (T183), dass „unsere neue Szene … nicht erst mit 3,1 eröffnet wird“, macht Thyen aufmerksam: In 3,2a wird nämlich Jesus als Protagonist der folgenden Erzählung gar nicht ausdrücklich neu mit Namen genannt, „sondern in Weiterführung des Vorausgegangenen nur pronominal durch auton {ihm} bezeichnet“. In der Lutherbibel wird das nicht deutlich, weil sie das houtos ēlthen pros auton, „der kam zu ihm“, einfach mit „der kam zu Jesus“ übersetzt – andernfalls würde sich jemand, der das dritte Kapitel von Anfang an lesen wollte, möglicherweise fragen, von wem da überhaupt die Rede ist.
Zusätzlich wird der Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen nach Thyen dadurch bestätigt, dass Nikodemus „ausdrücklich als ein anthrōpos und nicht als tis anthrōpos oder als tis Pharisaios (vgl. 4,46; 5,5; 11,1) eingeführt wird“. Bei einem völligen Neueinsatz einer Erzählung wäre das griechische tis, „ein gewisser“ (Mensch oder Pharisäer) angebracht gewesen, das bloße anthrōpos, „Mensch“, ohne Artikel greift das unmittelbar zuvor erwähnte Wort „Mensch“ auf und „zeigt, daß jetzt an ihm Jesu Kenntnis der Menschenherzen exemplarisch vorgeführt werden soll.“
Es gibt aber auch Theologen, die die mehrfache Erwähnung des Wortes anthrōpos, „Mensch“, in den Versen 2,25 und 3,1 anders interpretieren (T184), etwa der von Thyen zitierte John Suggit: <219>
„Aber obwohl Nikodemus ein Jude ist, wird er auch als Typus der gesamten Menschheit dargestellt: Der doppelte Verweis auf ho ánthrōpos {der Mensch} in 2,25 ist eine bewusste Vorbereitung auf den Bericht über Nikodemus, einen besonderen Vertreter der Menschheit. Dies wird durch die Verwendung des ohne Artikel gebrauchten ánthrōpos in 3,1 und möglicherweise sogar durch die Verwendung des Namens Nikodemus, der sowohl bei Juden als auch bei Griechen vorkommt, deutlich gemacht.“
Dieser Argumentation stellt Thyen entgegen, dass es in 2,25 nicht um den Menschen im Sinne der Menschheit im Gegensatz zu einer Beschränkung auf Israel geht; vielmehr ist „ho anthrōpos {der Mensch} in 2,25 durch den Gegensatz zum göttlichen Wesen Jesu definiert“. Ob man über Jesus eine solche Wesensaussage machen kann, bleibe dahingestellt, richtig sieht Thyen, dass es um eine von Gott inspirierte Kenntnis der Menschenherzen geht, und die beim Passafest in Jerusalem auf Jesus vertrauenden Menschen waren sicher Juden und keine Repräsentanten der Menschheit im Sinne der Völkerwelt.
Vor allem aber kann man Nikodemus schon deshalb nicht als „exemplarischen Repräsentanten der Menschheit“ betrachten, weil er „nicht nur als Pharisäer“ bezeichnet wird, „sondern darüber hinaus auch noch als archōn tōn Ioudaiōn {Oberster der Juden}, und das heißt wohl als Mitglied des Sanhedrin…, „der neben dem Hohenpriester höchsten jüdischen Autorität“. So wird er doppelt als Jude definiert, und zwar, wie Johannes 7,51 erkennen lässt, durchaus positiv in seiner „Toratreue“:
Nikodemus will darum zunächst als der exemplarische Vertreter der vielen Juden Jerusalems begriffen sein, die aufgrund der Zeichen Jesu an seinen Namen glaubten. Und zugleich verspricht sein Auftreten dem Leser die Lösung des Rätsels, warum Jesus hier denen, die doch an seinen Namen glaubten, seinerseits dennoch mißtraut. Wenn man in Nikodemus darüberhinaus schon den exemplarischen Repräsentanten der Menschheit sehen will, dann darf man gerade von seinem Judesein nicht abstrahieren. Denn das ,Heil‘, in dem die Menschheit erst zu sich selbst finden soll, ,kommt von den Juden‘ (… 4,22…).
Auch nach Klaus Wengst (W105) wird Nikodemus „als pharisäischer Schriftgelehrter im Synhedrium vorgestellt, dem höchsten Gremium jüdischer Selbstverwaltung unterhalb der römischen Besatzungsmacht“, und außerdem „als bedeutender Lehrer bezeichnet“. Später wird sich Nikodemus im Zusammenhang mit dem Versuch der Hohenpriester und Pharisäer, Jesus zu ergreifen, für „ein gesetzlich einwandfreies und faires Verfahren“ einsetzen (7,45-52) und nach 19,38-42 (W106)
sorgt er zusammen mit Josef von Arimatäa für eine aufwändige Bestattung des hingerichteten Jesus… Josef wird ausdrücklich „ein heimlicher Schüler Jesu“ genannt (19,38) – eine Kennzeichnung, die wohl auch auf den hier mit ihm gemeinsam handelnden Nikodemus zutrifft.
Thyen hält es auch nicht für abwegig (T184), dass „Nikodemus auf dem Weg sein könnte, aus einem ,aus Furcht vor den Juden‘ apokryphen Jünger zum rechten Nachfolger Jesu zu werden“. Gegen Marinus de Jonge, <220> der meint, dass die Argumentation des Nikodemus in Johannes 7,51 „innerhalb der Grenzen der pharisäischen Diskussion von Gesetzesfragen verbleibe“, sieht er Nikodemus durchaus als „Ausnahme unter den Ratsherren und den Pharisäern“, denn „gerade der Glaube an die grammata Moses {die Schriften des Mose}, und das heißt die wahre Treue zur Tora, ist die Bedingung der Möglichkeit, an die rhēmata Jesu {Worte Jesu} zu glauben… (5,46f).“
Wengst hingegen (W106) hält es für „unwahrscheinlich“, dass
die Stellen 7,50f. und 19,39 „sein stufenweises Voranschreiten im Glauben an Jesus andeuten (sollen)“ <221> oder dass, wie „sein Kommen zu Jesus seinen Ernst bezeugt, so sein späteres Verhalten […] seine Treue“, <222> ist unwahrscheinlich. Denn nirgends wird ein offenes Bekenntnis zu Jesus von ihm berichtet. Johannes beurteilt jedenfalls Leute wie Nikodemus und Josef von Arimatäa durchaus negativ. In 19,38 wird die Heimlichkeit der Schülerschaft Josefs mit seiner „Furcht vor den Juden“ begründet. Das erinnert an 12,42, dass auch „viele von den Ratsherren“ an Jesus glaubten, aber aus Furcht davor, von der synagogalen Gemeinschaft ferngehalten zu werden, kein offenes Bekenntnis wagten. Zu diesen „Ratsherren“ gehört auch Nikodemus. Über sie fällt Johannes in 12,43 ein wenig schmeichelhaftes Urteil: „Sie liebten die Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes.“
Zu bedenken ist allerdings, dass nach diesem Kriterium auch sämtliche Schüler Jesu dem gleichen Urteil unterworfen sein müssten, denn auch von ihnen heißt es (20,19), dass sie aus „Furcht vor den Juden“ am Abend des Ostertages hinter verschlossenen Türen sitzen.
Interessant finde ich das Charakterbild, das Wengst von Nikodemus zeichnet, indem er sich (Anm. 115) „ganz und gar die Perspektive des Evangelisten“, wie er sie sieht, „zu eigen gemacht“ hat (W106):
Will man nach diesem Überblick Nikodemus zusammenfassend charakterisieren, so wird man sagen müssen, dass er der Typ eines mit „weltlicher“ und „geistlicher“ Macht ausgestatteten Mannes ist, der sich gern mit einem gewissen liberalen Nimbus umgibt. Er ist aufgeschlossen und interessiert, grundsätzlich bereit, jedem Anerkennung zu zollen, der sie seiner Meinung nach verdient (3,2). Er ist gegen voreilige, aus reinem Machtwillen heraus gefällte Urteile und verlangt gründliche, dem Gesetz genügende Prüfung des Falles (7,51). Er ist hilfreich bis zu verschwenderischer Großzügigkeit, wenn es zu spät ist (19,39). Im Entscheidungsfall passt er sich opportunistisch an und geht in die innere Emigration (12,42). Er hat zutiefst keine Ahnung, um was es geht, und erhebt stattdessen noch einen Einwand und stellt noch eine Frage (3,4.9), die ihn daran hindern, in klarer Weise Stellung zu beziehen und eindeutig Partei zu ergreifen.
Ich bin nicht sicher, ob Wengst hier wirklich genau die Perspektive des Johannes wiedergibt, sicher redet er heutigem bürgerlichen Liberalismus ins Gewissen. Zu 19,39 kündigt Wengst an (Anm. 115), „für die Wertung des Verhaltens dieser Person auch eine andere Perspektive“ wahrzunehmen.
Allerdings ist Johannes nach Wengst (W106) gar nicht an Nikodemus „als an einer möglichen historischen Person interessiert“. Vielmehr ist er für ihn „Repräsentant einer bestimmten Gruppe, die im Umkreis seiner Gemeinde eine Rolle spielt“ (W107):
Bei ihr handelt es sich gewiss um jüdische Personen. Aber sie sind nicht identisch mit „den Juden“, die alsbald als Gegner Jesu schlechthin auftreten werden. Denn Nikodemus kommt zu Jesus und ist ihm gegenüber ganz und gar nicht feindlich eingestellt. Wen er repräsentiert, ergibt sich aus 12,42: Es sind heimliche Sympathisanten aus der Oberschicht, die sich nicht offen bekennen, weil sie distanzierende Maßnahmen der Synagogengemeinde befürchten. Sie wollen ihren sozialen Status nicht aufs Spiel setzen. Deshalb verhalten sie sich so, wie Nikodemus dargestellt wird. Daher heißt es von ihm auch, dass er nachts zu Jesus kommt. Er geht nicht am Tage zu ihm, weil nicht bekannt werden soll, dass er hier Kontakte knüpft, die ihn in der öffentlichen Meinung diskreditieren könnten.
Als Gründe dafür nennt Wengst (W106), dass Nikodemus als einer der Vielen des Abschnitts 2,23-25 eingeführt wird, dass er in 3,2 „in der ersten Person Plural“ redet und in „den grundsätzlichen Ausführungen von 3,7b und 3,11f. … in der zweiten Person Plural angeredet“ wird, „obwohl in den jeweiligen Einleitungsformulierungen der Singular steht. Hier gilt er in aller Deutlichkeit als Repräsentant einer Mehrzahl.“ Und schließlich:
Trotz der singularischen Einführung („Ich sage dir“) ist 3,11 im Plural formuliert: „Was wir wissen, reden wir und bezeugen, was wir gesehen haben; und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an.“ Hier spricht die Gruppe des Evangelisten, die einer von Nikodemus repräsentierten Gruppierung gegenübersteht.
Darin (T185), dass „Nikodemus Jesus in der Nacht besucht“, sieht auch Thyen übrigens nicht nur „die Gelegenheit zu ununterbrochenem und eingehendem Gespräch“ mit einem möglicherweise an der Nachfolge Jesu interessierten Schüler. Vielmehr ist „absichtsvoll ambivalent“ von der Nacht die Rede, deren
Schatten zugleich denjenigen zu verbergen vermag, der sich – aus welchen Gründen auch immer – scheut, Jesus in der Helle des Tages zu begegnen. … Denn die V. 19-21, die unsere Szene beschließen, das spätere öffentliche Eintreten des Nikodemus für Jesus (7,50f), und sein Erscheinen neben dem ausdrücklich als mathētēs tou Iēsou kekrymmenos dia ton phobon tōn Ioudaiōn {heimlicher Schüler Jesu aus Furcht vor den Juden} bezeichneten Joseph von Arimathaia mit der unübersehbaren Erinnerung daran, daß auch Nikodemus bei seiner ersten Begegnung mit Jesus noch im Schutz der Nacht als ein mathētēs kekrymmenos {heimlischer Schüler} zu Jesus gekommen war (19,38ff) sowie die symbolischen Obertöne beim Gebrauch des Lexems nyx {Nacht} in 11,10 und 13,30 legen es doch nahe, in Nikodemus nicht nur den Repräsentanten der V. 23 genannten polloi {vielen}, sondern ihn – jedenfalls bei dieser ersten Begegnung – zugleich mit dem Manko der Scheu des öffentlichen Bekenntnisses behaftet und darin des Rätsels Lösung zu sehen, warum Jesus den ,vielen‘ mißtraut.
Während für Wengst und Thyen anzunehmen ist, dass sie die von Nikodemus repräsentierte Gruppe als am religiösen Bekenntnis zu Jesus interessierte heimliche Jünger betrachten, sieht Veerkamp <223> das Gespräch Jesu mit Nikodemus als Indiz für inoffizielle Kontakte zwischen der johanneischen Gemeinde und bestimmten Kreisen des rabbinischen Judentums seiner Zeit:
Beispiel: Nikodemus. Er war Mitglied der Partei der Peruschim und der politischen Führung Judäas, archōn. Er war, wie wir hören werden, „der Lehrer Israels“ (ho didaskalos tou Israēl, 3,10). Es gibt Hinweise im Johannesevangelium darauf, dass es zwischen der messianischen Gemeinde um Johannes und einflussreichen Vertretern der Synagoge bzw. des rabbinischen Judentums Kontakte unterhalb der offiziellen Ebene gab; das Gespräch mit Nikodemus ist ein Hinweis auf solche Kontakte. Es hat in rabbinischen Kreisen Bemühungen einer Minderheit gegeben, die die Konflikte nicht auf die Spitze treiben und Abspaltungen von der Synagoge verhindern wollte. Sie musste offenbar vorsichtig, „in der Nacht“, agieren.
Auch Veerkamp sieht eine Zwiespältigkeit in der „Rolle des Nikodemus“, aber er beurteilt sie nicht mit religiösen oder moralischen Kriterien wie Thyen und Wengst, sondern politisch:
Einerseits ist er ein Beispiel jener Judäer, die dem Messias Jesus vertrauen, aber seine politische Einschätzung Rom gegenüber nicht teilen. Andererseits ist er ein Rabbi, einer der Rabbis des 1. Jh. Es gab, soviel wissen wir, eine messianistische Fraktion im rabbinischen Judentum. Rabbi Aqiba ist ein berühmtes Beispiel. Freilich sah Aqiba nicht in Jesus von Nazareth, sondern in Bar Kochba den Messias. <224> Jedenfalls haben wir es bei Nikodemus mit einem Vertreter eines rabbinischen Messianismus zu tun.
↑ Johannes 3,2b-d: Nikodemus spricht Jesus als von Gott gesandten Lehrer an
3,2b … und sprach zu ihm:
3,2c Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen;
3,2d denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.
[19. April 2022] Wie bereits (T185) einige seiner ersten Schüler Jesus angeredet hatten (1,38.49), so verwendet Thyen zufolge nun auch Nikodemus die „ehrende Anrede ,Rabbi‘, vom Erzähler sogleich mit didaskale übersetzt“. Wengst (W107) bezeichnet diese Anrede, „so wie es Schüler gegenüber ihrem Lehrer tun“, als „erstaunlich“, denn Nikodemus wird doch selbst „in V. 10 als ein bedeutender Lehrer hingestellt“. Aber könnte er nicht auch einfach ein respektvolles Gespräch auf Augenhöhe mit einem Kollegen einleiten wollen?
Indem Nikodemus Jesus außerdem als „von Gott gekommenen Lehrer“ anerkennt, spricht er nach Wengst
für das Evangelium wiederholt Lesende und Hörende mehr aus, als er selbst zu sagen meint. Denn von Gott gekommen zu sein, wird im Evangelium immer wieder von Jesus ausgesagt, und zwar nur von ihm. Damit nimmt Johannes die Dimension auf, in die er Jesus schon im Prolog gestellt hat. Würde Nikodemus seine Aussage in dieser Weise verstehen, müsste er sich im Folgenden anders verhalten, als er es tut. Dieses andere Verhalten, nämlich zu verstehen und anzunehmen, was der von Gott gekommene Lehrer sagt, erwartet Johannes von seiner Leser- und Hörerschaft, die sich damit zugleich von Nikodemus distanzieren soll.
Nach Thyen (T185) tritt Nikodemus Jesus mit einem „förmlichen und keineswegs auch nur irgendwo defizitären Bekenntnis“ gegenüber; „als Sprecher der ,Vielen‘ aus 2,23“ repräsentiert er „solche (Leser), die es wie er nur in der Anonymität der Nacht wagen, zu Jesus zu kommen“, und der Text will diese „zum Aufbruch ins Licht … ermutigen.“
Darüber hinaus will Thyen hinter dem von Nikodemus verwendeten „Wir“ nicht „noch irgendeine konkrete und organisierte ,Gruppe‘ von Judenchristen in der Lebenswelt des Autors“ annehmen. Damit wendet er sich gegen Spekulationen verschiedener Exegeten, die davon ausgehen, dass sich im Gespräch mit Nikodemus innerkirchliche Konflikte der frühen Christenheit widerspiegeln, die sich um die Bedeutung der Taufe oder des Geistes in der Institution Kirche drehen (T187):
Derartigen Spekulationen gegenüber halten wir daran fest, daß der Jude Nikodemus, ein Pharisäer und wohl Mitglied des Sanhedrin, hier als ein Sprecher jener „Vielen“ Jerusalems erscheint, die aufgrund der Zeichen Jesu „an seinen Namen glaubten“. Warum Jesus ihnen gleichwohl nicht vertraut, bleibt bis zum nächtlichen Erscheinen des Nikodemus rätselhaft. Denn inhaltlich scheint es an ihrem ,Glauben an seinen Namen‘ so wenig auszusetzen zu geben, wie an seinem solennen Bekenntnis. Daß ihr und sein Glaube als „bloßer Zeichenglaube“ defizitär und darum der Grund für Jesu Mißtrauen wäre, wird zwar fast überall behauptet, trifft aber schwerlich zu. … [W]ie Nikodemus aufgrund der ,Zeichen‘ bekennt, daß Jesus ein ,von Gott gekommener Lehrer‘ und daß ,Gott mit ihm‘ sei, so erklärt Jesus selbst: egō gar ek thoeu exēlthon kai hēkō, oude gar ap‘ emautou elēlytha, all‘ ekeinos me apesteilen {ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm; denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt} (8,42) und: ho pempsas me met‘ emou estin (8,29) oder: ho patēr met‘ emou estin {der mich gesandt hat, ist mit mir} (16,32…). Auch wenn seinem Bekenntnis die spezifischen messianischen Prädikate christos {Christus, Messias} und hyios tou theou {Sohn Gottes} fehlen, wird der Sache nach wohl von niemandem eine höhere Christologie als die gefordert, die sich in dem Bekenntnis des Nikodemus ausspricht.
Das Misstrauen Jesu gegenüber Nikodemus gründet daher Thyen zufolge wohl allein in der Zwiespältigkeit, dass er einerseits zu Jesus als dem Brot des Lebens kommt (6,35), aber andererseits nicht wie einer, der die Wahrheit tut und zum Licht kommt (3,21), „sondern im Schatten der Finsternis erscheint.“
Veerkamp <225> beschreibt die Aussage des Nikodemus mit einem einzigen nüchternen Satz:
Nikodemus würdigt Jesus und sein Auftreten („Zeichen“) und stellt fest, dass Gott mit ihm ist. Nikodemus schließt das aus den Zeichen. Mit dieser Feststellung will er eine Basis für das Gespräch finden.
↑ Johannes 3,3: Wer von oben her neu geboren wird, kann das Reich Gottes sehen
3,3 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Bei der Interpretation von Johannes 3,3 ignoriert Wengst (W107) die ausdrückliche Bezeichnung der Reaktion Jesu als Antwort und behauptet:
Auf die bloße Anrede des Nikodemus hin fängt Jesus an zu sprechen. Er redet ungefragt und bestimmt damit auch das Thema.
Dieses Thema besteht Wengst zufolge aus der Frage, wer das „Reich Gottes“ sehen kann. Dieser „in den synoptischen Evangelien häufig begegnende Begriff“ kommt „bei Johannes nur an dieser Stelle und ihrer variierenden Wiederholung in V. 5“ vor, wozu Wengst meint, dass er ihn „eher beiläufig aus der Tradition übernommen haben“ wird. Speziell (W108) vom „Sehen des Gottesreiches“ ist „auch in den synoptischen Evangelien nur an einer Stelle“ die Rede (Anm. 117):
Lk 9,27; vgl. Mt 16,28; Mk 9,1. Der Vergleich zeigt, dass die lukanische und johanneische Formulierung vom „Sehen des Reiches Gottes“ ungewöhnlich ist. Sie findet sich m. W. auch nirgends in der jüdischen Tradition, auch nicht in der Fassung vom „Sehen der kommenden Welt“. Der unmittelbare Zusammenhang des synoptischen Spruchs („den Tod nicht schmecken“) macht deutlich, dass „sehen“ hier im Sinne von „erleben“ verstanden ist. Das hat seine Entsprechung in der biblischen Wendung vom Sehen (= Erleben) des Guten (Jer 29,32; Ps 4,7; 27,13; 34,13; Hi 7,7; Pred 2,1; 3,13).
Aus diesen Parallelen in den Schriften und bei den Synoptikern zieht Wengst den Schluss (W108), dass das „Sehen des Gottesreiches“ sachlich dem „Hineinkommen in das Gottesreich“ (V. 5) entspricht, das wiederum (Anm. 118) „in den synoptischen Evangelien öfter vor[kommt] und … ihre Parallele in der rabbinischen Redeweise vom ‚Kommen in die kommende Welt‘“ hat (W108):
Bei diesem „Sehen“ geht es um Teilhabe und Teilnahme und nicht darum, sich auf der Zuschauertribüne beim großen Weltspektakel niederzulassen. Der johanneischen Formulierung stehen Mt 18,3 und Mk 10,15 am nächsten. Dort liegt ein bildlicher Vergleich vor. Man muss wie die Kinder werden, um am Gottesreich teilzuhaben. Die Besonderheit der johanneischen Fassung besteht vor allem darin, dass es sich nicht um einen bildlichen Vergleich handelt. Statt vom Werden wie die Kinder ist ohne Vergleichspartikel von einem Geborenwerden die Rede. Es geht also nicht nur um ein Werden wie die Kinder, sondern radikaler um das Werden eines neuen Menschen, der durch seine Geburt eine neue Herkunft erhält. Damit ist die Intention des synoptischen Wortes verstärkt zum Ausdruck gebracht. Denn seine Herkunft kann sich der Mensch nicht selbst geben. Er erhält sie und hat sie, ob sie ihm gefällt oder nicht.
Das doppelsinnige Wort anōthen mit den beiden Bedeutungen „von oben“ und „von Neuem“ beschreibt, wie „es ein solches Geborenwerden als Einlassbedingung in das Reich Gottes geben“ kann:
Eine Geburt „von oben“, die Gabe einer anderen Herkunft, kann nur eine neue Geburt sein, da es um irdisch schon geborene Menschen geht. Und umgekehrt kann deren neue Geburt nur die Gabe einer nicht irdischen Herkunft sein, also „von oben“ geschehen.
Damit bekommt nach Wengst, wer „von oben her neu geboren wird“, <226> eine neue Herkunft, „wie sie Jesus, der ‚von oben‘ ist (8,23), von vornherein schon hat.“ Was genau das bedeutet, das soll sich „aus dem weiteren Text ergeben, der sie nach dem anschließenden Einwand des Nikodemus erläutert.“
Schon jetzt aber verwahrt sich Wengst gegen die antijüdische Auslegung von Vers 3 durch Adolf Schlatter: <227>
„Zum religiösen Verhalten des Pharisäers war diese Beschreibung des göttlichen Wirkens der vollendete Gegensatz, da sich dieser seinen Anteil an Gott durch sein eigenes Wirken mit dem erwirbt, was er durch die Natur und das Gesetz besitzt. Mit dem Satz, daß das Leben als ein neues Werk Gottes empfangen werde, war die Gottessohnschaft verkündet und das Gesetz überschritten“.
Zwar gibt es auch Wengst zufolge
rabbinische Aussagen, die in der Betonung menschlicher Verantwortlichkeit die Notwendigkeit des Tuns hervorheben. Aber es gibt sie ebenso und mit Recht im Neuen Testament. Das antijüdische Klischee besteht in dieser künstlichen Zuordnung von Gnade zum Neuen Testament und von Leistung zum Judentum.
Zur Bestätigung (W108f.), dass „im Zusammenhang des Kommens in die kommende Welt auch in der rabbinischen Tradition in geradezu provozierender Weise von Gottes Gnade geredet werden kann“, zitiert Wengst eine Deutung von Psalm 60,9f. im Babylonischen Talmud, <228> wo
Landschaften, die Gott gehören, auf Menschen gedeutet werden, die sich gottfeindlich verhalten haben. Der Text fährt fort, indem er die sich daraus ergebende Konsequenz bedenkt, dass dann David gemeinsam mit Feinden an der kommenden Welt teilhat: „Da sagten die Dienstengel vor dem Heiligen, gesegnet er: ,Herr der Welt, wenn David kommen wird, der den Philister umbrachte und deine Kinder Gat erben ließ, was machst du mit ihm? Er sprach zu ihnen: ,Mir obliegt es, sie miteinander zu Freunden zu machen.‘“
Anders als Wengst fragt sich Thyen (T187), warum Jesus trotz „der nachdrücklichen Wendung … apekrithē (ho) Iēsous kai eipen autō {Jesus antwortete und sprach zu ihm}“ (T188),
mit keinem Wort auf das christologische Bekenntnis des Nikodemus eingeht, zumal das zentrale Thema beider Szenen des dritten Kapitels mit der Rede von der himmlischen Herkunft des Menschensohns und von seinem endlichen Aufstieg dahin, woher er gekommen ist, doch gerade ein eminent christologisches ist.
Das heißt, Thyen will sich nicht einfach wie Wengst damit abfinden, dass Jesus ungefragt und souverän von Soteriologie {Lehre vom künftigen Heil} statt von Christologie {Lehre vom Christus oder Messias} redet, indem er das Thema des Reiches Gottes anschneidet, um damit „völlig an seinem Gegenüber vorbeizureden und eine Frage zu beantworten, die Nikodemus ihm überhaupt nicht gestellt hatte“.
In seinen Augen darf das Sehen des Reiches Gottes in Vers 3 und das Hineinkommen in dieses Reich in Vers 5 gar nicht als gleichbedeutend verstanden werden, sonst wäre es unverständlich,
warum der Erzähler fast unmittelbar nach V. 3 zur Eröffnung von Vers 5 nochmals das solenne {feierliche} doppelte Amen Jesu gebraucht, wenn es hier nur das Vorausgegangene interpretieren und nicht, wie sonst stets, Neues ins Spiel bringen soll.
In Wirklichkeit redet aber Jesus in Vers 3 gar nicht an Nikodemus vorbei, sondern dieser Vers enthält „die christologische Antwort Jesu auf das christologische Bekenntnis des Nikodemus“. Diese These vertritt Thyen unter Bezug auf G. C. Nicholson, <229> den er folgendermaßen zitiert:
„Wie können wir 3,3 als eine christologische Aussage verstehen? Zunächst einmal können wir sagen, dass die Behauptung, Jesus sei anōthen {von oben} geboren, dasselbe ist wie die Behauptung, er komme anōthen {von oben} (3,31) – d. h. sein Ursprung ist ,oben‘ pros ton theon {bei Gott} (1,1f). Interessant ist, dass an der anderen Stelle im Evangelium, wo gennaō {geboren werden} von Jesus verwendet wird (18,37), gennaō und erchomai {kommen} nebeneinander stehen, wenn von Jesus die Rede ist. Dass Jesus Zeugnis ablegt als Folge seines „Sehens“ der Dinge, die oben sind, ist ebenfalls nicht untypisch für das vierte Evangelium. In 8,38 wird das gleiche Verb (horaō) verwendet, um das „Sehen“ und „Reden“ Jesu einerseits und das der Juden andererseits zu kontrastieren. Es ist genau dieser Gegensatz, der in Kapitel 3 gemacht wird. Derjenige, der katō {von unten} oder ek tēs sarkos {aus dem Fleisch} geboren ist, ist sarx {Fleisch} und spricht entsprechend. Da Jesus aber von anō {oben} ist, d. h. da er anō {oben} geboren wurde, kann er von dem sprechen, was er bei seinem Vater gesehen hat (8,38; vgl. 3,32; 5,19; 6,46)“.
Hinzu kommt nach Thyen, dass in
der letzten Antwort Jesu an Nikodemus {3,11} das anfängliche idein {sehen} von V. 3 wiederaufgenommen wird. Und zudem stehen in der von Nicholson zitierten Stelle 18,37 nicht nur gegennēmai und elēlytha {geboren und gekommen} in synonymen Parallelismus, sondern im unmittelbaren Kontext dieses Verses begegnet das bei Joh rare, nämlich neben 3,3 u. 5 nur hier vorkommende Lexem basileia {Königtum, Reich} gleich dreifach (18,36; hier nicht wie 3,3.5 als basileia tou theou {Reich Gottes}, sondern als hē basileia tē emē {mein Reich}).
Wenn diese Auslegung „richtig oder, der Eigenart symbolischer Texte entsprechend, zumindest plausibel“ ist, dann geht es in Johannes 3,3 noch nicht um das Hineingehen derer in das Reich Gottes, die auf Jesus vertrauen, sondern um Jesus selbst, der nach 3,31 der einzigartige „von oben Kommende über allen ist“ (T189):
So gesehen, redet Jesus in V. 3 nicht an Nikodemus vorbei, sondern präzisiert dessen Bekenntnis zu sich als dem ,von Gott gekommenen Lehrer‘ durch sein exklusives gennēthēnai anōthen {von oben geboren werden}, was Thyen nochmals durch ein Zitat von Nicholson <230> erläutert:
„Wenn dieser Ansatz richtig ist, dann spricht Jesus an dieser Stelle des Dialogs nicht über die Notwendigkeit dieser Geburt anōthen {von oben} – das kommt später. Im Gegenteil, er gibt hier die richtige Einschätzung seiner selbst als derjenige, der von oben kommt. Jesus ist der ,von Gott kommende Lehrer‘ nur in dem Sinne, dass er von Gott gesandt ist und die Worte Gottes spricht (3,34), oder, wie es in 3,31-32 heißt, insofern er von oben kommt, spricht er von dem, was er gesehen und gehört hat“.
So bestechend diese Auslegung Nicholsons auch erscheinen mag, frage ich mich doch, warum Thyen hier nicht, wie es sonst seine Gewohnheit ist, die synoptische Parallele Lukas 9,27 in den Blick nimmt, die Wengst in diesem Zusammenhang erwähnt. Sie belegt, dass jedenfalls Lukas die Fähigkeit, das Gottesreich zu sehen, nicht auf Jesus beschränkt. Erst recht aber wird sogleich die Reaktion des Nikodemus die gesamte Argumentation von Nicholson und Thyen zum Einsturz bringen, denn er begreift Jesu Antwort ganz und gar nicht als eine nähere Erläuterung zu Jesu eigenem Von-Gott-Kommen, sondern bezieht sie auf Menschen allgemein.
Es wird also wohl doch so sein, dass das „Sehen des Reiches Gottes“ ziemlich gleichbedeutend ist mit dem „Hineinkommen in das Reich Gottes“. So sieht das auch Veerkamp, <231> wenn er schreibt, dass Johannes hier für das, wofür er sonst „den Ausdruck ‚Leben der kommenden Weltzeit‘ (zōē aiōnios)“ verwendet, ein Wort aufgreift, „das die Sehnsucht Israels zur Sprache bringt“:
Offenbar geht Jesus davon aus, dass jedes Kind Israels „das Königtum Gottes sehen“ will. Der Ausdruck ist merkwürdig. Johannes stand der Rede vom „Königtum Gottes“, die in den anderen Evangelien häufig vorkommt, skeptisch gegenüber; darum vermeidet er sie ansonsten vollständig. Was genau er dabei als bedenklich ansah, werden wir erst im Verhör Jesu durch Pilatus wirklich begreifen.
Auch Veerkamp sieht also einen Zusammenhang zwischen der Erwähnung des Reiches Gottes hier und des Reiches Jesu im Gespräch mit Pilatus, aber ohne deswegen den Vers 3,3 so zu interpretieren wie Nicholson und Thyen. Vielmehr versteht Veerkamp die basileia tou theou, „das Königtum Gottes“, als eine diesseitige politische Alternative:
„Das Königtum sehen“ heißt: erleben können, dass das Königtum Gottes den Durchbruch in dieser Welt und gegen diese Weltordnung schafft. „Wer nicht von oben her erneut gezeugt wird“, wird das nicht erleben.
Insofern sieht auch Veerkamp in Johannes 3,3 durchaus eine Antwort Jesu auf die vertrauensvolle Anrede des Nikodemus, aber in anderer Weise als Thyen:
Jesus beginnt mit einem Satz, der seine Skepsis gegenüber denen, die ihm der Zeichen wegen glauben, bestätigt, Nikodemus gehöre zu denen. Weniger dieses Vertrauen als vielmehr die Tatsache, dass ein Mensch „von oben her gezeugt werden“ muss, ist die Voraussetzung, um „das Königtum Gottes sehen“ zu können.
Wie später deutlich werden wird, kann das Königtum Gottes nicht erreicht werden, indem man Jesus durch einen messianisch-zelotischen Aufstand als König auf den Thron in Jerusalem setzt (vgl. Johannes 6,15). Eine völlig neue, vom Gott Israels und seinem Messias inspirierte Perspektive ist erforderlich, um einsehen und darauf vertrauen zu können, dass ausgerechnet die Erhöhung des Menschensohns an das römische Kreuz zur Überwindung der römischen Weltordnung führen wird.
Auffällig ist bei Veerkamp, dass er es vorzieht, das Wort gennan mit „gezeugt werden“ statt mit „geboren werden“ wiederzugeben. Grundsätzlich kann es beides bedeuten. In seiner ersten Übersetzung des Johannesevangeliums aus dem Jahr 2005 <232> hatte er dazu erläutert, wie dieses Wort auf den hebräischen Sprachgebrauch in der jüdischen Bibel zurückgeht:
Gennan (holid) ist „zeugen“, das Passiv gennesthai (huledeth) „gezeugt werden“ (vgl. Matthäus 1,2-16!) Die Hiphilform bedeutet „machen, dass jemand leben wird.“ Das ist ein einmaliges Ereignis. Es bedeutet, dass der einmalige Name eines Menschen durch die Hinzufügung des Namens des Zeugenden in das Ganze der Volksgeschichte eingeordnet wird: Er ist Sohn/Tochter des Zeugenden, Jesus ben Joseph. Die neue Zeit des Messias bedeutet zugleich einen Neuanfang der Geschichte. „Zeugen“ ist daher besser als „geboren werden“.
Wie radikal der Unterschied der neuen Zeit des Messias von Johannes eingeschätzt wird, wird sich in Johannes 20,1.19 zeigen, wenn der Tag, an dem Jesus seinen Aufstieg zum VATER beginnt, als der „Tag eins der Sabbatwoche“ bezeichnet wird, das heißt in Analogie zu 1. Mose 1,5 als der „Tag eins“ einer völlig neuen Schöpfung.
↑ Johannes 3,4: Das Missverständnis des Nikodemus
3,4 Nikodemus spricht zu ihm:
Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?
Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?
[20. April 2022] Die (T189) „Antwort des Nikodemus“ auf Jesu Äußerung ist Hartwig Thyen zufolge das „zweite der für unser Evangelium so charakteristischen Mißverständnisse“:
Es zeigt zum einen, daß Nikodemus die u. E. absichtsvolle Ambivalenz des Lexems anōthen im Sinne von „wieder“ oder „erneut“ als platte Eindeutigkeit verstanden und zum anderen weder den symbolischen Modus der Rede Jesu noch ihre christologische Pointe begriffen hat.
Das sieht Thyen zufolge Rudolf Bultmann <233> völlig anders, indem er die johanneische Zweideutigkeit nicht auf die Ambivalenz von Wortbedeutungen zurückführen will:
„anōthen kann sowohl ,von oben‘ heißen wie ,von neuem“ … Es heißt 3,31; 19,11.23 ,von oben‘, kann aber 3,3.7 nur ,von neuem‘ bedeuten. … Auch ist die Bedeutung ,von oben‘ nicht neben dem ,von neuem‘ mitzudenken. Die Zweideutigkeit johanneischer Begriffe und Aussagen, die zu Mißverständnissen führen, liegt nicht darin, daß eine Vokabel zwei Wortbedeutungen hat, so daß das Mißverständnis eine falsche Bedeutung ergriffe; sondern darin, daß es Begriffe und Aussagen gibt, die in einem vorläufigen Sinne auf irdische Sachverhalte, in ihrem eigentlichen Sinne aber auf göttliche Sachverhalte gehen. Das Mißverständnis erkennt die Bedeutung der Wörter richtig, wähnt aber, daß sie sich in der Bezeichnung irdischer Sachverhalte erschöpfe; es urteilt kat‘ opsin {nach dem Augenschein} (7,24), kata sarka {nach dem Fleisch} (8,15).“
Thyen dagegen wendet sich mit Recht dagegen (T190), die „absichtsvolle Spannung zwischen diesem ,von oben‘ und dem ,von neuem‘“ zu beseitigen, da gerade in ihr „ein gewichtiger Hinweis darauf“ zu sehen ist, „daß die neue Geburt nur eine solche ,von oben‘ sein kann, daß es hier also um ‚göttliche Sachverhalte‘ geht.
Inhaltlich will Klaus Wengst den Einwand des Nikodemus (W109) „nicht als unsinnig, als völliges Missverständnis abtun.“ Er zieht Jesu Äußerung „ins Absurde“, aber
nicht, um selbst etwas Absurdes zu sagen, sondern um die Absurdität der Aussage Jesu zu erweisen, um diese Aussage gegenüber den bestehenden harten Realitäten als Illusion bloßzustellen. Er ist Realist, insofern er mit der Unabänderlichkeit des faktischen Weltlaufs im Grundsätzlichen rechnet, mit den „Gegebenheiten“ – innerhalb deren er eine Position einnimmt, die er auf keinen Fall gefährdet sehen möchte (vgl. 12,42).
Wengst denkt also, dass Nikodemus Jesus
durchaus verstanden hat, aber im Entscheidenden nicht verstehen will. Er hat begriffen, dass Jesu Aussage einen in seiner Radikalität nicht mehr zu überbietenden Neuanfang meint. Aber er schiebt solchen Neuanfang ins Illusionäre. So schön es wäre, noch einmal völlig neu anfangen zu dürfen ohne die Last der bisherigen Lebensgeschichte, die man sich aufgebürdet hat und die einem aufgebürdet worden ist, so gehört das für Nikodemus offenbar doch in den Bereich religiöser Träumerei. Ein Greis kann keinen neuen Anfang nehmen; ein Greis hat eine lange Lebensgeschichte hinter sich, die ihn unausweichlich geprägt und geformt hat, von der er schlechterdings nicht mehr loskommen kann. Eine neue Geburt gibt es für ihn nicht.
Damit missachtet Nikodemus die „Wirklichkeit Gottes, wie sie in Jesus – irdisch und das Irdische verändernd – auf den Plan getreten ist“, obwohl er „von den durch Gott gewirkten Zeichen gesprochen“ hatte, „die Jesus tut“, und will nun doch auf Jesus
offenbar nicht sein Vertrauen setzen. Darin allein besteht sein Unverständnis. Demgegenüber betet schon Ps 50,12, dass Gott ein reines Herz erschaffe und die Geistkraft neu mache, sodass die Person in ihrem Zentrum neu und in ihrer Ausrichtung beständig werde.
Wengst bleibt also dabei, Nikodemus mit moralischen Kategorien zu bewerten. Dieser hätte von der jüdischen Tradition her begreifen können, was eine geistliche Neugeburt von oben ist, will sich aber nicht zu Jesus bekennen, um seine Oberschichtprivilegien nicht zu verlieren.
Ton Veerkamp <234> beschränkt sich zu diesem Vers auf den lapidaren Kommentar:
Diese Bedingung erscheint Nikodemus absurd, er fasst das Wort anōthen als ein zweites Mal auf; diese Bedeutung hat das Wort auch.
↑ Johannes 3,5: Wer aus Wasser und Geist geboren ist, kommt in das Reich Gottes
3,5 Jesus antwortete:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist,
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
[21. April 2022] In Vers 5 wiederholt Jesus die Formulierung aus Vers 3 ean mē tis gennēthē anōthen, „wenn einer nicht von oben her neu geboren wird“ fast wörtlich, nur ersetzt er das doppeldeutige Wort anōthen, „von oben her neu“, durch ex hydatos kai pneumatos, „aus Wasser und Geist“. Schon allein die exakte Parallele des ean mē tis, „wenn jemand nicht“, spricht in meinen Augen gegen die vorhin dargelegte Annahme Thyens, in Vers 3 sei Jesu Herkunft von oben gemeint und erst in Vers 5 die Aufnahme anderer Menschen ins Reich Gottes.
Aber bevor wir zur Interpretation des Geborenwerdens „aus Wasser und Geist“ kommen, die bei Thyen, Wengst und Veerkamp sehr unterschiedlich ausfällt, müssen wir noch einmal darauf eingehen (T190), dass „zu Eingang dieser ersten Offenbarungsrede Jesu unseres Evangeliums – und nur hier – das Stichwort der in den synoptischen Evangelien so prominenten Rede von der basileia tou theou {Reich Gottes} gleich zweifach erscheint“. Das ist Hartwig Thyen zufolge „schwerlich bloßer Zufall.“ Er sieht darin vielmehr ein absichtsvolles Spiel mit synoptischen Texten, vor allem mit der von Markus seinem Evangelium programmatisch vorangestellten Zusammenfassung der Botschaft Jesu in dem Satz (Markus 1,15 – nach Luther 2017):
Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.
Tut Buße und glaubt an das Evangelium!
Zwar spricht Johannes nicht wörtlich von metanoia, „Buße, Umkehr“, aber unter anderem „in Jesu Rede von der Notwendigkeit einer neuen Geburt (‚von oben‘)“ ist dieses Thema bei ihm doch vorhanden (in Klammern: widerspricht Thyen damit nicht seiner eigenen Annahme, diese Neugeburt beziehe sich allein auf Jesus?). Vom Glauben, bei Johannes auf Jesus bezogen, ist sogar wortwörtlich die Rede. Aber warum fehlt die Formulierung „hē basileia tou theou {das Reich Gottes} im ganzen folgenden Evangelium“? Thyen zieht daraus geradezu den Schluss,
daß unser drittes Kapitel u. a. die Funktion hat, die Rede von der basileia tou theou {Reich Gottes} in diejenige von der himmlischen Herkunft und endlichen „Erhöhung“ Jesu als des ,Menschensohnes‘ zu transformieren.
An dieser Stelle ist ein Vergleich mit der Sichtweise Ton Veerkamps <235> angebracht. Auch er nimmt diese Transformation der überlieferten Gottesreichsvorstellung wahr und ernst, deutet sie aber anders:
„Königtum Gottes“ heißt „Leben der kommenden Weltzeit“. Johannes ändert die allgemeine jüdische Terminologie; er benennt die gleiche Sache anders. Er muss sie anders benennen, weil die Umstände andere sind.
Im Klartext: Johannes spricht nicht deswegen von der himmlischen Herkunft und der Erhöhung des Menschensohns, um Jesus so eng wie möglich mit Gott zu identifizieren, was Theologen oft als eine hohe Christologie bezeichnen. Die Erhöhung des Menschensohns in Form der Hinrichtung am römischen Kreuz bietet in den Augen des Johannes vielmehr die paradoxe Möglichkeit der Überwindung der römischen Weltordnung und der Herbeiführung des Lebens der kommenden Weltzeit, das Johannes zōē aiōnios, „ewiges, äonisches Leben“ nennt (womit er aber kein jenseitiges Leben nach dem Tode meint). Ein Königtum Gottes, wie es etwa die Makkabäer dem hellenistischen Machtbereich durchaus für zwei Jahrhunderte abzuringen vermochten (ohne dass dieses allerdings tatsächlich den Kriterien eines Königreiches gemäß der Tora entsprochen hätte), kann nach Johannes dagegen auf keinen Fall die Befreiung Israels und die kommende Weltzeit anbrechen lassen. Das ist der Hintergrund, weshalb Johannes nach Veerkamp kaum vom (König-)Reich Gottes und fast ausschließlich vom ewigen Leben im Sinne des Anbruchs der kommenden Weltzeit spricht.
Zurück zu Thyen (T190). Er vergleicht an dieser Stelle nun auch Johannes 3,3.5 mit Matthäus 18,3, „dem synoptischen Vers, der diesen Sätzen in der Tat am nächsten verwandt ist“, wie es Wengst bereits bei der Auslegung von Johannes 3,3 getan hatte, wobei Thyen allerdings die von Wengst angeführte noch engere Parallele Lukas 9,27 außer Acht lässt. Unter Bezug (T191) auf M. Morgen <236> versteht er Johannes 3,1-21 als eine neue Art und Weise der Lektüre nicht einzelner Worte,
sondern literarischer Zusammenhänge der überlieferten synoptischen Evangelien. Trotz der geringen Dichte wörtlicher Übereinstimmungen erkennt Morgen in Joh 3,1-21 doch deutliche Indizien dafür, daß die Szene als ein intertextuelles Spiel mit den synoptischen Erzählungen vom ,reichen Jüngling‘ (Mk 10,17-22 / Mt 19,16-22 / Lk 18,18-23) und vom ,Zinsgroschen“ (Mk 12,13-17 / Mt 22,15-22 / Luk 20,20-26) in ihren jeweiligen Kontexten gelesen sein will.
Zur Begründung verweist Thyen unter anderem darauf,
- dass wie Nikodemus so „der ,Reiche‘ bei Lukas ein archōn {Oberer}“ ist,
- dass Jesus „Nikodemus gegenüber die Initiative ergreift und darauf zusteuert, daß und wie einer ‚nicht verloren geht, sondern das ewige Leben gewinnt‘ (3,16)“, während „bei Lukas der archōn den Dialog mit der Frage: ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō? {was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?} (Lk 18,18; vgl. 10,25)“ eröffnet,
- dass das sechsmal in Johannes 3,2.3.4.5.9 vorkommende Wort dynamai, „können, vermögen“, auch im Kontext der Erzählung vom reichen Mann in Lukas 18,26 erscheint,
- dass der Voraussage „des Leidens und der Auferstehung des Menschensohnes (Mk 10,33f)… deren johanneische Transformation“ in Johannes 13f. entspricht.
Sollte Thyen damit Recht haben, dass Johannes in der Gestalt des Nikodemus tatsächlich die synoptische Geschichte vom reichen Mann aufgreift, der nicht bereit ist, zugunsten des Reiches Gottes seinen Besitz aufzugeben, dann wäre das ein Argument für die kritische Betrachtung des Nikodemus durch Wengst als eines Mannes der Oberschicht, der nicht auf seine Privilegien verzichten will.
Nun aber zum Geborenwerden „aus Wasser und Geist“. Thyen wendet sich erstens (T192) gegen den Vorschlag von Hans Hinrich Wendt, <237> das Wort „Wasser“ einfach zu streichen, weil es in einigen Handschriften fehlt und im weiteren Gesprächsgang keine Rolle mehr spielt. Zweitens will er „dem archōn tōn Ioudaiōn {Oberen der Juden}“ aber auch nicht zumuten, wie es andere Exegeten tun,
in dem gennēthēnai ex hydatos kai pneumatos {Geborenwerden aus Wasser und Geist} eine Anspielung an die christliche Taufe, womöglich gar in deren durch das pneuma begründeter Unterschiedenheit von der Johannestaufe als bloßer Wassertaufe zu erkennen.
Als Nikodemus das Neugeborenwerden von oben „einseitig auf den natürlichen Geburtsvorgang bezogen und von daher zu Recht bezweifelt“ hatte, „daß dergleichen wiederholbar sei“, hatte er „das gennēthēnai {Geborenwerden} sachgemäß als das ,Hervorgehen aus dem Mutterleib‘ beschrieben.“ Daraus zieht Thyen nicht nur den Schluss, dass diese „ausdrückliche Beziehung auf die Mutter als die Gebärende“ es nahelegt, „das Passiv gennēthēnai in unserem Kapitel durchgehend als Geboren- und nicht etwa als Gezeugtwerden zu begreifen“ (wie es Veerkamp tut), sondern er meint sogar, dass Jesus „dieses ,Geborenwerden aus dem Mutterleib‘ … mit seinem Wort vom gennēthēnai ex hydatos {Geborenwerden aus Wasser} durchaus positiv“ aufnimmt. Zustimmend zitiert er Margaret Pamment <238> (T192f.):
„Kommentatoren waren geneigt, die Formulierung ,aus Wasser‘ zu verwerfen, weil Wasser in der Verdeutlichung der Erlösung im folgenden Vers nicht erwähnt wird: ,Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, was vom Geist geboren wird, ist Geist.‘ Wenn wir aber das Wasser als Hinweis auf das Brechen des Wassers bei der natürlichen Geburt interpretieren {wenn die Fruchtblase platzt}, findet dieser Hinweis auf die körperliche Geburt eine Parallele in V. 6. … Der Ausdruck vom Brechen des Wassers bei der natürlichen Geburt ergibt einen Sinn für den doppelten Ausdruck ‚aus Wasser und Geist‘ als Beschreibung von Geburt und Wiedergeburt. Wie immer im vierten Evangelium wird die Erfahrung natürlicher Existenz im Sinne einer Schöpfungslehre gedeutet: Der Schöpfergott erschafft und erhält seine Schöpfung, und die natürliche Geburt weist über sich hinaus auf das Leben, das von Gott kommt“.
Dass ich die johanneische „Schöpfungslehre“ von Veerkamp her ganz anders deuten würde, nämlich nicht statisch als Erhaltung einer wohlgeordneten Schöpfung, sondern dynamisch ausgerichtet auf das Ziel der Befreiung der Welt von der unterdrückenden Weltordnung, die auf ihr lastet, sei hier nur nebenbei angemerkt.
Thyen hingegen widerspricht nochmals (T192) der Auffassung, dass „die beiden durch kai {und} verbundenen Glieder hydōr und pneuma {Wasser und Geist} … als Referenzen einerseits auf die Johannestaufe und andererseits auf die christliche Taufe verstanden werden dürfen“, denn der folgende Vers 6 spricht „von einem doppelten gennēthēnai {Geborenwerden} als von zwei parallelen aber klar unterschiedenen Realitäten…, nämlich einerseits vom gennēthēnai ek tēs sarkos {Geborenwerden aus dem Fleisch} und andererseits vom gennēthēnai ex tou pneumatos {Geborenwerden aus dem Geist}.“ Damit sieht er als eindeutig erwiesen an, dass die Geburt aus Wasser als die natürliche, fleischliche Geburt aus dem Mutterleib zu verstehen ist.
Ganz so klar ist das allerdings nicht. Immerhin kam das Wort hydōr, „Wasser“, im Johannesevangelium zuvor bereits sechs Mal vor, und zwar je drei Mal im Zusammenhang mit der Taufe des Johannes (1,26.31.33) und mit dem Wasser aus den Krügen für die jüdische Reinigungszeremonie, das Jesus in Wein verwandelte (2,7.9). Es ist also nicht abwegig, dass das Wasser hier doch etwas mit der Reinigungstaufe des Johannes zu tun hat. In diesem Sinne klärt Jesus jedenfalls in Veerkamps Augen das Missverständnis des Nikodemus bezüglich des Neugeborenwerdens von oben auf:
Nur die messianischen Gruppen, die von Johannes, dem Täufer, (Wasser) und von Jesus (Inspiration) herkommen, werden „in das Königreich Gottes eingehen“. Das bedeutet „von oben“. …
„Aus Wasser und Inspiration gezeugt werden“ ist die Bedingung für das „Eingehen in das Königtum Gottes“. Wasser steht für die Aktion Johannes des „Täufers“, und die Inspiration steht für den Messias Jesus, der „mit der Inspiration der Heiligung“ tauft, 1,29-34. Sowohl die messianische Bewegung, die von Johannes ausging, als auch die, die durch Jesus vertieft und intensiviert wurde, sind die Bedingungen für das Eingehen in das Königtum; letzteres kann nur der, der sich von diesen zwei Menschen orientieren und inspirieren lässt.
Auch Klaus Wengst weist darauf hin (W111),
dass die Zusammenstellung von Wasser und Geisteskraft in Verbindung mit einem erneuernden Handeln Gottes schon biblisch vorgegeben ist und in der jüdischen Tradition aufgenommen wird. Diese Beachtung lässt Gemeinsamkeiten wahrnehmen, die durch die Auseinandersetzungen, in denen Johannes steht, verdeckt sind. In Ez 36,24-28 wird dem exilierten Israel eine Zeit nach dem Exil verheißen, in der Gott reines Wasser über sie sprengen wird, um sie zu reinigen. Er wird ihnen ein neues Herz und neue Geisteskraft geben, seine Geisteskraft, dass sie das von ihm Gebotene tun.
Indem Wengst auf diese Stelle im Propheten Ezechiel (= Hesekiel) allerdings nur am Rande eingeht, um auf christlich-jüdische Gemeinsamkeiten im religiösen Denken hinzuweisen, missachtet er die Möglichkeit, die Aussage des Johannes selbst als eine zutiefst jüdisch geprägte Aufnahme der prophetischen Gedanken zu begreifen (Hesekiel 36,24-28):
Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet; von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.
Könnte man nicht in der johanneischen Gegenüberstellung von der Wassertaufe des Johannes und der Geisttaufe Jesu sowie in der Zusammenstellung von Wasser und Geist in Johannes 3,5, wobei das Wasser in den folgenden Versen im Gegensatz zum Geist nicht wieder aufgenommen wird, ein Spiel mit genau dieser Hesekiel-Stelle sehen? Auch hier spielt das Wasser nur eingangs eine reinigende Rolle; dann übernimmt der Geist die Aufgabe der Veränderung der menschlichen Herzen, und zwar nicht in einem spirituell-jenseitigen Sinn, sondern damit Gottes Volk wieder nach der Tora im gottgegebenen Lande leben kann. Dass Johannes diese Stelle aufruft, wird auch dadurch bestätigt, dass er sich ohne Zweifel, wie wir noch sehen werden, auf das folgende Kapitel Hesekiel 37 beziehen wird, in dem der Geist die Auferweckung der Totengebeine ganz Israels und Judas aus ihren Gräbern und (37,26) „einen ewigen Bund des Friedens“ mit ihnen ankündigt.
Wie gesagt, Wengst nutzt den Blick auf den Propheten Hesekiel jedoch nicht, um von ihm her die Erwähnung des Wassers in Johannes 3,5 auf die reinigende Funktion der Johannestaufe zu beziehen, er hält es – auch im Gegensatz zu Thyen – für geboten (W111), „im Blick auf den Begriff ‚Wasser‘ de[n] Bezug auf die Taufe herauszustellen – nicht zuletzt wegen des oft belegten Zusammenhangs von Taufe und Geistbegabung“.
Vor der Klärung, was Wengst damit meint, muss erläutert werden, was es in seinen Augen mit der „Geisteskraft“, wie er pneuma übersetzt, auf sich hat, denn in den Worten (W109) „aus Wasser und Geisteskraft“ liegt (W110)
das entscheidende Gewicht auf dem Begriff „Geisteskraft“. Er bezeichnet im Johannesevangelium die Wirklichkeit Gottes (4,24). Sie steht im Gegensatz zum „Fleisch“, der Wirklichkeit der Welt (1,13; 3,6; 6,63). Doch herrscht hier keine bloße Antithetik. Denn Geisteskraft ist Jesus gegeben (1,32f.) als dem Fleisch gewordenen Wort (1,14). Es geht also um die Wirklichkeit Gottes, der sich in der Fleischwerdung des Wortes, im Auftreten Jesu von Nazaret, gerade irdisch manifestiert hat. Wenn aber Gottes andere Wirklichkeit irdisch auf den Plan tritt, dann kann das nur so geschehen, dass sie irdische Wirklichkeit ändert, dass sie die absolute Geltung der „Gegebenheiten“ aufhebt und „Realisten“ wie Nikodemus ins Unrecht setzt, dass sie in der Tat Menschen einen neuen Anfang gibt, indem sie sie von der Last und Belastung ihrer bisherigen Lebensgeschichte befreit.
Diese Interpretation ist richtig und sinnvoll, aber möglicherweise, wie der Blick auf die persönliche „Lebensgeschichte“ andeutet, individuell verengt. Dabei kommt nicht ins Gesichtfeld, was möglicherweise das zentrale Anliegen des Johannes ist, nämlich die Überwindung der politischen Versklavung unter die römische Weltordnung. Gerade gesellschaftspolitische Verknöcherungen gelten ja bis heute in den Augen vieler als unveränderbar und alternativlos. Ich schließe allerdings nicht aus, dass Wengst die Macht der „Geisteskraft“ auch auf gesellschaftliche Veränderungen bezieht, wenn er schreibt:
Und so ist den Glaubenden Geisteskraft verheißen, bei denen sie nach Jesu Tod vergegenwärtigt und wirksam erhält, was in dessen Reden, Tun und Erleiden zum Zuge gekommen ist: Gottes Liebe zur Welt (3,16) im Zuspruch der Vergebung (1,29). Daher kann zugespitzt gesagt werden: „Geisteskraft“ bezeichnet die sich irdisch selbst durchsetzende Wirklichkeit Gottes. Von Gott her einen neuen Anfang zu erhalten und sich auf seine Wirklichkeit gegen die scheinbare Dominanz des Faktischen einzulassen – das meint die Geburt aus Geisteskraft.
Interessant ist nun die Art und Weise, wie Klaus Wengst das „Wasser“ neben der „Geisteskraft“ zu begreifen sucht. Er zitiert Rudolf Schnackenburg <239> mit dem Satz: „Jeder christliche Hörer oder Leser des Ev(angeliums) mußte dabei sofort an die Taufe denken“. Zwar „ist ein Verständnis ausgeschlossen, als könne das Taufen mit Wasser sozusagen Geisteskraft herbeizwingen“, aber die Erwähnung des Wassers gibt Wengst zufolge
den konkreten irdischen Ort an, an dem die Geburt aus Geisteskraft geschieht. Da die Taufe zugleich Aufnahmeritus in die Gemeinde ist, wird damit deutlich, dass die Geisteskraft nicht voneinander isolierte Individuen produziert, sondern dass die Geburt aus Geisteskraft in die Gemeinschaft der Gemeinde versetzt. Die Taufe mit Wasser ist daher gegenüber dem primären Wirken der Geisteskraft als menschlicher Gehorsamsakt zu bestimmen, der dieses Wirken als ein in die Gemeinde berufendes öffentlich und verbindlich anerkennt.
Hier scheint mir Wengst auf jeden Fall eine spätere christliche Deutung in das Johannesevangelium einzutragen. Zwar ist im Johannesevangelium auch von eine Tauftätigkeit der Schüler Jesu die Rede, aber nirgends von der Taufe als „Aufnahmeritus in die Gemeinde“, geschweige denn von der Forderung der „Taufe mit Wasser“ als „Gehorsamsakt“ gegenüber einer kirchenamtlichen Behörde. Veerkamps folgende Äußerung kann als Einwand gegen diese Einschätzung von Wengst gelesen werden:
Nikodemus muss sich nicht unbedingt dem Taufritual der messianistischen Gruppen unterwerfen. Die Gruppe um Johannes hielt von derlei offenbar nicht viel: „Jesus selber taufte nicht“, wird er später sagen, 4,2.
Ich meine, es muss ernst genommen werden, dass Johannes nirgends den Begriff der ekklēsia, „Gemeinde“, verwendet, der bei Paulus und in der Apostelgeschichte des Lukas eine entscheidende (und in Matthäus 16,18 und 18,17 eine bescheidene) Rolle spielt. Weniger als anderen messianischen Gruppierungen geht es Johannes um die Gewinnung von Menschen aus den Völkern, mehr als ihnen in erster Linie um die Sammlung ganz Israels einschließlich Samarias und der Diaspora-Juden. Auch diese Sammlung muss natürlich in einer messianischen Gemeinde stattfinden, aber man darf für Johannes sicher noch nicht voraussetzen, dass die Zugehörigkeit zu ihr an die zuvor erhaltene Taufe gebunden ist.
Genau diese Konzentration auf Israel und seine Befreiung von der Versklavung unter die herrschende Weltordnung bleibt bei Wengst völlig außen vor, wenn er zu Johannes 3,5 weiter ausführt:
Mit der Erwähnung des Wassers bringt Johannes also die Dimension der Gemeinde ins Spiel. Er stellt damit die Erwartung des kommenden Reiches Gottes in den Horizont der Gegenwart der Gemeinde. Das tut er deshalb, weil es ihm gerade in deren bedrängter Situation nicht um Vertröstung auf eine bessere Zukunft geht, sondern weil es ihm auf konkrete heilvolle Erfahrungen in der Gemeinde ankommt.
Hier erwähnt Wengst zwar „die Erwartung des kommenden Reiches Gottes“, scheint aber konkrete politische Hoffnungen auf dessen Anbruch als illusionäre „Vertröstung“ abzutun. Stattdessen konzentriert er sich auf einen Gemeindeaufbau ohne politische Ambitionen. Dem Einwand des Nikodemus, „der die Unmöglichkeit eines echten Neubeginns am Beispiel des mit seiner langen Geschichte belasteten Greises demonstrieren will“, setzt Jesus entgegen, dass in ihm eine „Geisteskraft“ wirkt, die die „Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt“, indem sie „in Jesus als Liebe zur Welt zum Zuge“ kommt. Dieses Wirken vollzieht sich Wengst zufolge (W110f.) in einer Art und Weise, wie man heutiges christliches Gemeindeleben beschreiben würde:
Sie tut es, indem sie Gemeinde beruft und erhält als einen Bereich, in dem ein Mensch wirklich von vorn anfangen darf, weil er im Miteinander anderer Menschen steht, denen derselbe Anfang gewährt ist und die deshalb ihre Vergangenheit einander nicht aufrechnen und so in der Gegenwart nicht miteinander abrechnen sondern wirklich leben können.
Einer solchen Theorie des Gemeindeaufbaus kann ich nur zustimmen, bezweifle aber, dass sie in dieser Form durch das von Jesus erwähnte „Wasser“ in Johannes 3,5 begründet werden kann.
↑ Johannes 3,6-8: Das Fleisch und die Sturmwind-Stimme des Geistes
3,6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch;
und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.
3,7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe:
Ihr müsst von Neuem geboren werden.
3,8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl;
aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.
So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
[22. April 2022] Mit der Gegenüberstellung dessen, was aus dem Fleisch bzw. aus dem Geist geboren ist, soll Klaus Wengst zufolge (W111) „die Notwendigkeit der Geburt aus dem Geist herausgestellt werden.“ Das Wort „Fleisch“ meint in der Bibel „die Wirklichkeit des Menschen unter dem Aspekt der Hinfälligkeit und Vergänglichkeit (z. B. in Jes 40,6-8)“, bei Johannes wohl außerdem die „Gebundenheit an eine belastete Lebensgeschichte“:
Was immer in diesem Bereich erzeugt wird, ist wiederum vergänglich, hinfällig, belastet, hat als Ziel den Tod. Innerhalb des Bereichs des „Fleisches“, unter seinen Bedingungen und von seinen Voraussetzungen her, gibt es keinen wirklichen Neuanfang, gibt es keine grundlegende Änderung, gibt es keine Teilhabe am Reich Gottes.
Dem Fleisch steht der Geist als „die Wirklichkeit Gottes“ gegenüber, aber „nicht dualistisch“, als ob mit dem Fleisch eine absolut böse oder unrettbar verlorene Welt gemeint wäre:
Zwar können Menschen nicht von sich aus ihre Vergänglichkeit, Hinfälligkeit und ihr Belastetsein überwinden. Aber Gott überlässt als Schöpfer seine Welt nicht sich selbst.
In diesem Zusammenhang erinnert Wengst nicht nur daran, dass sich Gott „mit Israel als seinem Volk verbunden“ hat, was „als Voraussetzung immer im Hintergrund“ steht, sondern als Analogie zur „Fleischwerdung des Wortes“ (Anm. 123) an
das großartige Bild und die mit ihm bezeichnete Sache in Ez 37, wonach Gottes Geisteskraft aus toten Knochen lebendige Menschen macht, in neuschöpferischer Tat Israel aus der Lethargie und Ausweglosigkeit des Exils herausholt.
Auch Hartwig Thyen (T193) will schon
auf Grund von 1,14 … das Verhältnis von sarx und pneuma {Fleisch und Geist}, die hier den Ursprung „natürlicher“ und „pneumatischer Geburt“ bezeichnen, nicht vorschnell dem sogenannten „johanneischen Dualismus“ zuschlagen. Denn jedenfalls handelt es sich hier ja weder um den platonisch-anthropologischen Dualismus von Leib und Seele (und/oder Geist), noch um irgendeinen gnostischen oder auch nur gnostisierenden Dualismus… Anders als etwa phōs und skotia {Licht und Finsternis} sind sarx und pneuma bei Joh einander nirgendwo als feindliche Mächte oder Sphären entgegengesetzt.
Schon deswegen (T194), weil Johannes ja Thyen zufolge, wie wir eben gesehen haben, „das Geborensein des Menschen aus dem Fleisch“ bzw. aus dem Wasser als dem Symbol der Geburt aus dem Mutterleib, als „die notwendige, wenn auch keineswegs hinreichende Voraussetzung seiner neuen Geburt aus dem Geist“ betrachtet, kann das Fleisch nicht grundsätzlich verdammt werden, zumal
Jesu Rede von der Geburt aus dem Geist den Charakter der Verheißung hat. Denn das Kommen des Geistes ist ja an das Weggehen Jesu gebunden. Damit der Geist kommen und lebendig machen kann, muß „der Menschensohn zunächst erhöht werden, so wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste“ (3,14; vgl. 7,39).
Mit dem Satz in Vers 7 (W111f.) „Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her neu geboren werden“, greift Jesus auf seine „These von V. 3“ in direkter Anrede an Nikodemus zurück, worin nach Wengst „der Wunsch des Evangelisten erkennbar“ wird, „dass die von Nikodemus repräsentierten heimlichen Sympathisanten doch den kräftigen Anstoß erhielten, sich offen zur Gemeinde zu bekennen.“ Thyen zufolge (T194) verknüpft Jesus „jetzt auch die christologische Aussage von dem Einzigen, der anōthen {von oben} geboren ist (V. 3), mit der darin eröffneten Möglichkeit und Notwendigkeit der neuen Geburt der Glaubenden aus dem Geist.“ Nach wie vor halte ich es aber für fraglich, ob diese Aussage dort wirklich nur auf Jesus bezogen war.
Nachdem in Vers 7 „das Bild der Geburt, das unsere Szene als ihr Symbolspender bisher beherrschte, zum letzten Mal erscheint“, wird nach Thyen in Vers 8 „ihr aktuelles Geschehen“ geschildert: „Sie vollzieht sich eben darin, daß und wenn einer ,die Stimme des Geistes hört‘.“ Der Symbolisierung dieses Geschehens dient nach Thyen nun das Wort pneuma „in seiner Doppeldeutigkeit, nämlich einmal als ,Wind‘ und zum anderen als ,Geist‘“. Wichtig ist ihm dabei vor allem (T195)
die hörbare Realität des Windesbrausens als Symbolträger für das nicht minder reale Erklingen der phōnē {Stimme} des Geistes. Und daß das Stichwort phōnē hier (ebenso wie in V. 29, wo der Täufer von der phōnē tou nymphiou {Stimme des Bräutigams} redet) ganz entscheidende Bedeutung für Inhalt und Struktur von Joh 3 hat, wird die folgende Auslegung zeigen.
Darauf, dass man (W112) die Bedeutung dieses Wortspiels „in einer deutschen Übersetzung nicht angemessen wiedergeben“ kann, wie Wengst sagt, macht schon der oben zitierte Text der Lutherbibel deutlich, in dem pneuma einmal mit „Wind“ und einmal mit „Geist“ übersetzt wird und im „Sausen“ des Windes unhörbar gemacht wird, dass es sich hier um die phōnē, „Stimme“, des inspirierenden Sturmwindes handelt.
Nach Wengst enthält die
Bildseite über den Wind … drei Aussagen: 1. Er weht, wo er will. 2. Man hört seine „Stimme“. 3. Man kennt weder seine Herkunft noch sein Ziel. Bei der ersten Aussage spielt Johannes mit der Doppelbedeutung von pneúma: Nicht nur der Wind weht, wo er will, sondern auch Gottes Geisteskraft. Sie ist souverän. Ihr Wirken kann von Menschen nicht festgelegt werden – auch nicht durch die Taufe.
Die beiden anderen Aussagen bezieht Wengst, indem er nur auf das „Rauschen des Windes“ eingeht und die wörtliche Bedeutung der „Stimme“ des Windes, die Thyen so überaus wichtig ist, ignoriert, folgendermaßen „auf die aus der Geisteskraft Geborenen“:
Wie man das Rauschen des Windes hören kann, also seine Existenz und Wirksamkeit wahrnimmt, ohne jedoch seine Herkunft und sein Ziel zu kennen, so können Außenstehende die wirksame Existenz der Gemeinde nicht übersehen, müssen sie registrieren. Und sie können sich dazu in unterschiedlicher Weise verhalten, in der des Bekämpfens, des heimlichen Unterstützens oder partiellen Zusammengehens. Aber die Einsicht in Ursprung und Hoffnung dieser Existenz der aus Geisteskraft Geborenen bleibt ihnen von ihren Voraussetzungen her verschlossen.
Damit wird nach Wengst auch klar, „warum Nikodemus schließlich doch nicht versteht und so spurlos aus der Szene verschwindet“, denn er „und die von ihm Repräsentierten“ werden von Johannes „in der Rolle von Zuschauern“ gezeichnet,
die als solche letztlich nicht verstehen können. Die Geburt aus Geisteskraft ist nicht eine leicht begreifliche Sache, die schnell am Wehen des Windes erklärt werden könnte. Begreiflich wird sie allenfalls für diejenigen, die die Zuschauertribüne verlassen, die sich auf diesen Ursprung einlassen und sich in diese Hoffnung hineinnehmen lassen – die selbst aus Geisteskraft Geborene werden.
Spätestens ab Vers 13 bleibt daher als Adressat der Rede Jesu nur „die eigene Gemeinde des Evangelisten“ vorstellbar, „die er über Ursprung und Ziel vergewissern will.“
In einer Hinsicht stimmt Ton Veerkamp <240> mit Thyen und Wengst überein, nämlich in der Ablehnung eines absoluten Gegensatzes zwischen sarx und pneuma, „Fleisch“ und „Geist“:
Jetzt kommt ein Satz, der von uns, die wir mit einem gnostisch-dualistischen Christentum vertraut gemacht wurden, nur missverstanden werden kann. Fleisch sei nicht Geist und umgekehrt, sie schließen sich gegenseitig aus. So würden Griechen miteinander reden. Hier reden aber Juden miteinander, und Judäer wie Nikodemus, der Rabbi, und Johannes, der Messianist, haben mit Gnosis und Dualismus nichts zu tun.
Eben diesen Gesichtspunkt, dass hier Juden miteinander reden, nimmt Veerkamp weitaus ernster als die beiden andern Exegeten. Daher versteht er den Begriff sarx, „Fleisch“, auch nicht nur als allgemein menschliche Hinfälligkeit und Vergänglichkeit mit besonderer Aufmerksamkeit auf die individuell belastete Lebensgeschichte, sondern er stellt ihn in den Kontext der Frage nach gesellschaftlicher Unterdrückung und Befreiung:
Fleisch ist die konkrete irdische Existenz, das Leben, das unter den realen Verhältnissen der Weltordnung verletzbar und korrumpierbar ist. Ein Leben „nach dem Fleisch“ ist ein angepasstes Leben, anfällig für die Korruption durch die Weltordnung. Wer „aus dem Fleisch“ gezeugt wird, kann nur „fleischlich“ leben; wer so gezeugt wird, das heißt in die Welt gesetzt, erzogen zur Anpassung an die Ordnungen der Welt nach dem Prinzip: So war es, so ist es, so wird es immer sein. Dieser Mensch hat keine andere Wahl, als zuzusehen, wie er durchkommt, bis der Tod ihn holt.
Johannes versteht also, wenn Veerkamp Recht hat, das Wort sarx als politischen Kampfbegriff. Der Messias nimmt das „Fleisch“ eines jüdischen Kämpfers gegen die römische Weltordnung an, und zwar eines solchen, der nicht auf die militärischen Mittel des römischen Feindes oder der aufständischen Zeloten zurückgreift, sondern auf die vom „Geist“, pneuma, hebräisch ruach, des Gottes Israels inspirierte agapē, „solidarische Liebe“, von der wir schon sehr bald hören werden.
Demgegenüber vertritt das rabbinische Judentum, dem sich Johannes in seiner messianischen Gemeinde gegenübersteht, andere Vorstellungen. Veerkamp sieht hier bereits die ewig andauernde „Diskussion zwischen Reform und Kompromiss einerseits und Revolution andererseits“ vorgezeichnet, die später etwa zwischen Martin Luther und Thomas Müntzer strittig sein wird und erst recht zwischen Kommunisten und der Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung. Während die Rabbinen keinen anderen Weg zur Bewahrung des Lebens nach der Tora sehen, als sich in einer Nische des Römischen Weltreichs als religio licita, „erlaubte Religion“, mit den Herrschenden zu arrangieren, interpretiert Johannes dies als einen Kompromiss mit dem diabolos, dem „Widersacher“, dem römischen „Teufel“, wie wir in Johannes 8,44 hören werden. Dabei gibt Veerkamp nicht einseitig der johanneischen Sichtweise Recht; immerhin ist es das rabbinische Judentum, das bis heute die Treue zur Tora bewahrt, während das Johannesevangelium schon bald von einem heidenchristlich dominierten Christentum grundsätzlich antijüdisch uminterpretiert wird und spätestens mit Konstantin und Theodosius auch seine gegen die Überwindung der versklavenden römischen Weltordnung gerichtete revolutionäre Stoßrichtung verliert. Veerkamp drückt das so aus:
Die rabbinische Option war freilich eine andere: Kompromiss ist nicht Anpassung, Kompromiss kann sehr viel mit Inspiration zu tun haben. Was Johannes hier sagt, ist nicht nur Unterstellung. Kompromiss kann auch – wahrscheinlich oft – zur Anpassung führen.
Weil Letzteres der Fall sein kann, beharrt Veerkamp konsequent darauf, Johannes in seiner kompromisskritischen Haltung ernstzunehmen und diese in ihren politischen Konsequenzen herauszuarbeiten, und zwar gerade weil Johannes darin schon bald so gründlich missverstanden und im Sinne eines jenseitsorientierten oder gar gnostischen Erlösungsmysteriums uminterpretiert werden wird. Die Alternative, die auch nach Wengst die göttliche Wirklichkeit des Geistes, der Inspiration, der Geisteskraft zu bewirken vermag, ist nach Veerkamp im Sinne einer konsequenten Nicht-Anpassung an die herrschenden Strukturen der ungerechten Weltordnung zu verstehen:
Wer aber eine Alternative „sieht“, das heißt, wer erkennt, dass eine Alternative notwendig und möglich ist, lebt anders. Gemeint ist ein Leben aus messianischer Inspiration, der Inspiration, die vom Messias Jesus ausgeht. Es ist also nicht verwunderlich, dass dann ein neues Leben beginnt, sozusagen: „Von oben her, erneut gezeugt sein.“ Das Wortspiel mit Inspiration (Geist) und Sturmwind (das steckt beides im Wort pneuma, auf hebräisch ruach) zeigt, dass ein Mensch, der durch diese Inspiration „gepackt“ wird, nicht anders tun kann, als sich führen zu lassen, wohin diese Inspiration ihn bringt. Wer sich auf diese Revolution einlässt, weiß weder, auf was er sich eigentlich einlässt, noch wohin das einmal führen wird.
↑ Johannes 3,9-10: Eine (berechtigte?) Frage des Nikodemus, des Lehrers Israels
3,9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm:
Wie mag das zugehen?
3,10 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht?
Was die „Stimme“ des Geistes, auf die Thyen hingewiesen hatte, zu sagen hat, bringt sie (W112) auf „die von Nikodemus gestellte Frage, wie denn die Geburt von oben, die Geburt aus Geisteskraft geschehen könne (V. 9),“ durch den Mund Jesu in einer ausführlichen Rede zum Ausdruck, die sich nach Klaus Wengst (W112f.)
in drei Abschnitte gliedern lässt. Der erste Teil (V. 10-13) stellt die Legitimität Jesu heraus, zu diesem Thema zu reden. Er ist befugter Zeuge, der sagt, was er gesehen hat. Er kann über die Geburt „von oben“ sprechen, weil er selbst „von oben“ kommt. Der zweite Teil (V. 14-17) legt den eigentlichen Grund dieser Geburt dar: Sie beruht auf der Liebe Gottes zur Welt, die er in der Sendung und Hingabe des Sohnes erwiesen hat. Der dritte Teil (V. 18-21) beschreibt die Folge der Zuwendung Gottes zur Welt, wie sie sich im Gegenüber von Glaubenden und Nichtglaubenden zeigt.
Ich lasse das hier einmal so stehen, weise aber bereits jetzt darauf hin, dass Veerkamp den Text anders gliedern und mit anderen Schwerpunkten auslegen wird.
Zur Frage des Nikodemus in Vers 9 meint Wengst (W113), dass er mit ihr seine Fragen von Vers 4 wiederholt. Nach wie vor hält er die Geistgeburt von oben für unvorstellbar, er kann
als Außenstehender auch gar nicht anders, als in zweifelnder Skepsis zu verharren. Anders könnte es nur dann sein, wenn er sich selbst auf diese Geburt als eine Wirklichkeit einließe. Daher ist es von der Sache her nicht befremdlich, dass er im Folgenden spurlos aus der Szene verschwindet und die Rede Jesu in eine Darlegung für die Gemeinde übergeht.
Zwar geht es hier Wengst zufolge nicht um „das Geheimwissen einer Gruppe“, aber auch „nicht um ein Begreifen, das auch als Zuschauer zu haben wäre, relativ unbeteiligt und aus objektiver Distanz.“ Nur wer bereit ist, sich darauf einzulassen, „dass in Jesus Gott begegnet“, hört auf, ein Außenstehender mit einem „ablehnend-skeptischen Urteil“ zu bleiben.
Auf die zweifelnde Frage des Nikodemus kommt von Jesus in Vers 10 zunächst die tadelnde Rückfrage, als „Lehrer Israels“ müsste er doch eigentlich (W113f.) „über die Geburt aus Geisteskraft orientiert sein“.
Dass im Originaltext des Johannes (W113) „vor ‚Lehrer‘ der Artikel“ steht, „so dass wörtlich zu übersetzen wäre: ‚Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht?‘“ erklären sowohl Wengst als auch Thyen (T195) damit, dass hier mit dem Artikel auf den mittlerweile bekannten Nikodemus Bezug genommen wird, der zuvor ohne Artikel als Mensch aus den Pharisäern und Oberen der Juden eingeführt worden ist. Nikodemus werde (W113) nicht etwa „als der Lehrer schlechthin, gar als einziger Lehrer vorgestellt. …. Die Formulierung hat Entsprechungen in der jüdischen Tradition.“
Zur Frage, welches Wissen konkret Jesus bei Nikodemus als dem Lehrer Israels voraussetzt, erwägt Wengst (W114) allgemeine Kenntnis theologischer Dinge und insbesondere der Schrift, aber auch konkretes Wissen über „die theologischen Kategorien … von Geistbegabung und neuer Schöpfung“, etwa unter Rückbezug auf Hesekiel 37,14.
In diesem Zusammenhang denkt Wengst ausdrücklich darüber nach, was es für uns als Christen bedeutet, dass der als jüdischer Lehrer vorgestellte Jesus an einem anderen jüdischen Lehrer Kritik übt:
Die Weise, in der Jesus seine Frage an Nikodemus richtet, zeigt, dass Johannes hier innerjüdisch formuliert. Das muss ich beachten, wenn ich als Christ aus den Völkern diesen Vers lese. Er kann deshalb nicht als Muster dafür dienen, wie ich einem Lehrer Israels begegne. Meine Erfahrung mit Lehrern Israels ist eine andere, nämlich die, dass ich von ihnen gelernt habe und ihr Zeugnis Gottes mich reicher gemacht hat. Nicht ich stelle sie in Frage, sondern sie werden mir zur Anfrage, dass mein Lob Gottes nicht in ihren Augen götzendienerisch sei.
Auch Hartwig Thyen nimmt wahr (T195), dass „die Bezeichnung des Nikodemus als didaskalos {Lehrer} das Ende des nächtlichen Gesprächs mit seinem Anfang“ verknüpft, „wo Nikodemus ja umgekehrt Jesus mit ,Rabbi‘ angeredet und als didaskalos bezeichnet hatte“. So lässt Johannes „den ganzen Dialog zwischen den didaskaloi Lehrern {} … als ein typisches ,Schulgespräch‘ erscheinen.“ In Thyens Augen hätte Jesu Rede vom Reich Gottes
diesen ,Lehrer Israels‘ erinnern müssen an die Stimmen der Propheten seines Volkes, das er als seinen ,Sohn gezeugt hat‘ (Deut 32,18; Jes 1,2; 45,10, Jer 2,27; Hos 2,1…), dem er verheißen hat, seinen endzeitlichen und erneuernden Geist auszugießen auf alles Fleisch (Joel 3,1ff; vgl. Jes 32,15; 44,3; Jer 31,3ff), und ihm neue Herzen und einen neuen Geist einzupflanzen (Ez 36,25f…).
Indem Ton Veerkamp, <241> wie wir gesehen haben, hier keine bloße Diskussion unter Theologen über bestimmte Schriftstellen wahrnimmt, sondern eine Auseinandersetzung über die Frage, ob und wie die befreiende Inspiration Gottes die Überwindung der Weltordnung herbeiführen kann, teilt er nicht einfach selbstverständlich das abfällige Urteil, das Jesus über Nikodemus fällt. Vielmehr ordnet er sowohl die Frage des Nikodemus als auch die Reaktion Jesu in den von ihm zuvor beschriebenen Konflikt zwischen dem rabbinischen Judentum und dem jüdischen Messianismus johanneischer Prägung ein:
Nikodemus wiederholt seine Frage: „Wie kann das geschehen?“ Johannes kann es nicht lassen, seinen Antirabbinismus zu ventilieren: „Du willst der (!) Lehrer (Rabbi) Israels sein, und das erkennst du nicht?“ Die Frage des Nikodemus ist berechtigt. Die Auskunft „von oben her gezeugt werden“ klingt verheißungsvoll, die berechtigte Frage ist, welche Strategie Jesus bzw. der Messianismus, der in seinem NAMEN auftritt, hat? Denn nirgends zeigt sich eine Änderung am Lauf der Weltordnung.
Genau hier stellt sich die Frage, ob es nicht viel zu kurz greift, wenn wir mit Wengst und Thyen die von Johannes proklamierte neue Geburt von oben einfach als persönliches Gottesgeschenk an uns Christen als Individuen betrachten, die wir bereit sind, an Jesus als den Sohn Gottes zu glauben. Was wäre, wenn Jesus nach Johannes tatsächlich einen viel größeren Anspruch erhoben hätte, nämlich durch die freiwillige Hingabe am römischen Kreuz die Überwindung der gesamten Weltordnung in Gang zu setzen? Ich denke, dass wir dann die Skepsis des Nikodemus hundertprozentig teilen könnten. Immerhin sieht man bis heute nicht wirklich, dass die Weltmächte der Menschenversklavung und des Menschenmords ein für allemal besiegt sind.
Insofern müssten wir uns nicht nur wie Wengst von jüdischen Lehrern über ihr Gotteszeugnis belehren lassen, sondern wir müssten uns fragen, ob wir überhaupt in der Lage sind, dem johanneischen Jesus gegen Nikodemus so ohne Weiteres Recht zu geben. Veerkamp breitet den Konflikt folgendermaßen in seiner ganzen Tragweite aus:
An diesem Punkt wird der Gegensatz klar. Dieser Messianismus {Jesu} hat keine Antwort auf die Fragen des rabbinischen Judentums bzw. derjenigen, die zwar Jesus vertraut haben (die pepisteukotes von 8,31), dennoch an den Sieg über das Römische Reich und seinen Prinzipal (16,33) nicht wirklich glauben können. Wer eine Politik des Kompromisses fordert und dafür andere zu überzeugen sucht – der Lehrer Israels! -, der führe, so Johannes, das Volk in die Irre und besorge das Geschäft Roms, des ßatan, des diabolos (8,44).
Dieser Messianismus vermag nicht zu sehen, wie das Judentum mit seiner Strategie, Freiräume für ein toragemäßes Leben auszuhandeln und so die eigene Geschichte und die Geschichte der Menschheit offenzuhalten, irgend etwas ändert. Weil das Judentum weiß, so wäre die rabbinische Antwort, dass sein Gott, der NAME, ˀadon ha-ˁolam, Herr der Weltzeit und Herr über alle Weltordnung, ist, dass die Großmächte kommen und gehen, das Wort und die Vision bleibt, wenn man durchhält. Die Strategie des rabbinischen Judentums ist die hypomonē, thiqwe, das Durchhalten, unter allen Umständen, eben das „Prinzip Hoffnung“.
Der Messianismus will nicht anders leben unter den Bedingungen der realen Weltordnung, wie die Lehrer Israels, die Rabbinen, wollen; er will eine andere Weltordnung – und zwar sofort.
In dem, was er danach schreibt, geht Veerkamp weit hinaus über die damalige Alternative zwischen rabbinischem Durchhalten unter der Weltordnung und johanneischer Hoffnung auf eine baldige Überwindung dieser Weltordnung und den Anbruch der kommenden Weltzeit. Er kommt auf den Holocaust im 20. Jahrhundert und die Herausforderungen unseres Jahrhunderts zu sprechen:
Und wenn die Weltordnung die Ausrottung Israels nicht nur beschließt, sondern in Angriff nimmt? Hier verstummen alle Fragen, weil wir wissen, was geschah und was immer noch geschehen kann. „Fruchtbar ist der Schoß noch, aus dem das kroch“, Brecht. Der Glaube an einen allmächtigen Gott, der könnte, wenn er nur wollte, ist spätestens hier abgeschmackt. Nach wie vor steht gerade nach Auschwitz die radikal andere Weltordnung auf der Tagesordnung. Nein, es ist keine Theologengelehrsamkeit, die die zwei hier verhandeln.
↑ Johannes 3,11-12: Augenzeugnis von irdischen und himmlischen Dingen
3,11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben,
und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an.
3,12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage,
wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage?
[23. April 2022] Zum dritten und letzten Mal im Gespräch mit Nikodemus beginnt Jesus in Vers 11 eine Äußerung mit seinem doppelten amēn. Er tut dies, um feierlich betont auf das Augenzeugnis der eigenen Gruppe hinzuweisen, die sich um ihn schart, und er bedauert, dass die Gruppe, für die Nikodemus steht, dieses Zeugnis nicht annimmt.
Klaus Wengst fragt sich (W114), „was eigentlich … hier ‚gesehen‘ worden“ ist, und versucht diese Frage von anderen Stellen im Evangelium her zu beantworten:
Was Jesus hier in der 1. Person Plural sagt, spricht Johannes der Täufer in 3,32 von Jesus in der 3. Person Singular aus. Woher weiß er das? Nach der Logik des Evangeliums muss das ein Schluss aus dem 1,32-34 mitgeteilten Zeugnis des Johannes sein, dass er die Geisteskraft in Gestalt einer Taube auf Jesus herabsteigen und bleiben „sah“. Nach 8,26.38 sagt Jesus selbst, dass er das redet, was er vom und beim Vater gehört und gesehen hat. Da er keine Mitteilungen über die himmlische Welt gibt, kann das nur so verstanden sein, dass in seinem Reden Gott zu Wort kommt. Nach 14,7.9 sollen die Schüler Jesu im Blick auf ihn Gott sehen und erkennen. Das sagt dort gerade der in den Tod gehende Jesus. Dieses „Sehen“ und Erkennen Gottes wird ihnen erst Ostern zuteil. Da bezeugt Mirjam aus Magdala den Schülern Jesu: „Ich habe den Herrn gesehen“ (20,18). Und die übrigen Schüler bezeugen dem Thomas: „Wir haben den Herrn gesehen“ (20,25). Sie haben den gekreuzigten Jesus so „gesehen“, dass sie ihn nun als Herrn bekennen. Das Reden der Gemeinde basiert also auf dem Osterzeugnis.
Was Jesus als Zeugnis seiner Gemeinde wiedergibt, ist nach diesem Verständnis die vorweggenommene Überzeugung, dass Gott
den gekreuzigten Jesus nicht dem Tode überlassen hat, dass der Weg Jesu, wie er im Evangelium als Weg zum Kreuz erzählt wird, nicht ins Nichts führte, sondern zu Gott, dass Gott seinerseits auf diesem ganzen Weg gegenwärtig war.
Auch nach Ton Veerkamp <242> redet hier die „messianische Gemeinde“; er ordnet ihre Erfahrung aber nicht in einen religiösen Deutungsrahmen der österlichen Überwindung des am Kreuz erlittenen Todes Jesu ein, sondern in das bereits beschriebene Gegenüber von rabbinischem Judentum und johanneischem Messianismus:
Jesus erklärt feierlich, „Amen, amen, sage ich dir, wir wissen, wovon wir reden, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, aber unser Zeugnis nehmt ihr nicht an.“ Hier redet die messianische Gemeinde selber, wir. Das Gegenüber ist das rabbinische Judentum, dessen Repräsentant Nikodemus, der didaskalos tou Israēl, der Rabbi Israels, ist. Die Gemeinde redet aus ihrem Selbstbewusstsein, d.h. aus ihrem Wissen. Sie bezeugt, was sie gesehen hat, sie ist Augenzeuge.
Inhaltlich ist hier bis jetzt noch gar nichts darüber gesagt, was die Gemeinde Jesu konkret als Augenzeugin gesehen hat. Allerdings sei angemerkt, dass auch in Veerkamps Bezugsrahmen Jesu Auferstehung eine Rolle spielen wird, aber nicht in dem Sinne, als ob erst mit ihr ganz allgemein der Tod überwunden wäre. Dass Johannes bereits als Jude von der Auferstehung der Toten überzeugt ist, wird jedenfalls aus seinem Verweis auf Daniel 12,2 in Johannes 5,21-29 hervorgehen.
Hartwig Thyen (T195) betrachtet die Verse 11-12 „[z]wischen dem Dialog mit Nikodemus, der mit Jesu ironisch-rhetorischer Frage in V. 10 im Grunde beendet ist, und dem danach mit V. 13 einsetzenden Monolog“ als „eine der für Joh typischen ‚Brückenpassagen‘.“ Er sieht (T197) „weder ,die Gemeinde‘ noch irgendeine durch den ,Evangelisten‘ repräsentierte spezielle ‚Gruppe‘ von Zeugen, sondern allein Jesus als den Sprecher des in V. 11 Gesagten“ an:
Und indem Jesus ,wir‘ sagt, schließt er damit fraglos andere in sein Zeugnis ein. Das können aber nach dem ganzen Duktus dessen, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, nur solche sein, die ,aus dem Geist‘ und ,von oben‘ wiedergeboren und so zu Jesu ,Brüdern‘ und zu Gottes ,Kindern‘ geworden sind (20,17: poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois: anabainō pros ton patera mou kai patera hymōn kai theon mou kai theon hymōn {Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott}; vgl. 1,12f). Jesus steht also bereits als wirklich vor Augen, was doch erst sein ,Erhöhtwerden von der Erde‘ und das Kommen des österlichen Geistes realisieren wird.
Dabei erschließt sich mir nicht ganz, worin sich Thyens Sichtweise des von Jesus ausgesprochenen „wir“ etwa vom Wengstschen Versuch unterscheidet, dieses „wir“ auf das Zeugnis der nachösterlichen Gemeinde Jesu zu beziehen.
Nicht einverstanden bin ich auch mit Thyens Einschätzung der Brüder Jesu, die er unter Bezug auf Johannes 20,17 und 1,12f. kurzerhand mit den Kindern Gottes identifiziert. Nach Johannes 7,3-8 spielen diese Brüder doch eine zwiespältigere Rolle, auf die jeweils an Ort und Stelle noch genauer eingegangen werden muss.
Auch zu Vers 12 beginne ich mit dem, was Klaus Wengst dazu zu sagen weiß (W115):
An seine [Jesu] Aussage, dass die Angeredeten „unser Zeugnis“ nicht akzeptieren, knüpft er an: „Wenn ich zu euch vom Irdischen sprach und ihr nicht vertraut, wie werdet ihr vertrauen, wenn ich zu euch vom Himmlischen spräche?“ Der Form nach liegt ein Schluss vom Leichten aufs Schwere vor.
Am „Ratespiel“ der Auslegung dieses Verses beteiligt sich Wengst mit folgendem „Vorschlag einer Annäherung“:
1. Die Form des Verses macht zwar deutlich, dass „das Irdische“ gegenüber „dem Himmlischen“ in irgendeiner Weise auf einer niedrigeren Stufe steht. Aber da Jesus von ihm spricht und dieses Sprechen Vertrauen finden soll, kann es nicht negativ qualifiziert sein.
2. In V. 11 stehen sowohl das Subjekt als auch die angeredete Größe im Plural. Für letztere gilt das auch in V. 12, aber das Subjekt steht jetzt im Singular. Muss daraus nicht geschlossen werden, dass das Sprechen vom Himmlischen eine spezifische Möglichkeit Jesu meint, dass es also keine Möglichkeit der Gemeinde ist?
3. Der Nebensatz in V.12b steht im Konjunktiv mit an, der Hauptsatz im Futur. Es handelt sich also bei dem Nebensatz um einen Eventualis. Das heißt: Jesus könnte vom Himmlischen reden, hat es aber bisher nicht getan und wird es auch weiterhin im Evangelium nicht tun.
Auf Grund dieser Überlegungen neigt Wengst dazu, das „‚Irdische‘, von dem Jesus spricht“, mit dem zu identifizieren,
was in V. 11 „unser Zeugnis“ genannt war. Das bezieht sich darauf, dass auf dem Weg Jesu, der sehr irdisch am Kreuz endete, doch Gott begegnet. … Wer Jesus in Bezug hierauf die Legitimation abspricht, wird ihm auch nicht Glauben schenken, wenn er über die himmlische Welt reden würde.
Wengst geht also davon aus, dass der johanneische Jesus selbst gar nicht über „die himmlische Welt“ redet, etwa in der Art von „Spekulationen“, wie sie „im jüdischen Bereich über das Schöpfungswerk (Gen 1) und ‚den Wagen‘ (Ez 1)“ angestellt wurden.
Viel ausführlicher geht Hartwig Thyen (T198-202) auf die rätselhafte Bedeutung von Johannes 3,12 ein. Obwohl auch er selbst Versuche unternehmen wird (T198), „die spezifische Identität der epigeia {irdischen Dinge} einerseits und der epourania {himmlischen Dinge} andererseits zu ergründen“, nennt er die Konzentration darauf einen „‚Holzweg‘…, dessen Verfolgung die viel vordringlichere Aufgabe der Klärung der argumentativen Funktion des Satzes in seinem unmittelbaren Kontext nur verdrängt.“ Diese Funktion innerhalb „eines Schlusses a minore ad maius {vom Kleineren aufs Größere}, oder, wie die Rabbinen sagen, ,Vom Leichten aufs Schwere‘ (Qalwachomer),“ sieht er lediglich darin, „die völlige Zwecklosigkeit“ des Redens von himmlischen Dingen – „womöglich gar zu Nikodemus“ – zu erweisen. Zur Zusammenfassung seiner diesbezüglichen Überlegungen (T199) zitiert er zustimmend Roland Bergmeier: <243>
„Der Sinn des Schlußverfahrens ist: Wenn wir schon das Irdische nicht begreifen, dann erst recht nicht das Himmlische. Über das Himmlische als solches zu belehren, gehört nicht zu diesem Topos {vorgeprägten Motiv}, wie denn auch in Joh 3,13-21.31-36 ,das, was wir gesehen haben‘ (3,11) nicht inhaltlich entfaltet wird. Sehr wohl zur Topik gehört, daß an einem irdischen Beispiel oder Gleichnis das Unvermögen zu verstehen, aufgewiesen wird. Das Wind-Gleichnis (Joh 3,8) und des Nikodemus Nicht-Verstehen (3,9f) müssen also zusammen gesehen werden“.
Nachdem Thyen literarkritische Verschiebungen im Text des Kapitels Johannes 3 ausschließt, betont er nochmals (T200),
daß V. 12 nicht etwa als die Ankündigung eines bevorstehenden Redens Jesu von den epourania {himmlischen Dingen} begriffen sein will, sondern vielmehr nur deren Möglichkeit andeutet und zugleich zum Ausdruck bringt, daß ihre Aktualisierung angesichts des Unglaubens der von Nikodemus Repräsentierten schon den epigeia {irdischen Dingen} gegenüber völlig zwecklos wäre. Damit ist die vordringliche Frage nach der argumentativen Funktion von V. 12 in seinem Kontext beantwortet. Offengeblieben ist darüber jedoch die Frage, was denn inhaltlich mit den epigeia einerseits und den epourania andererseits bezeichnet sein könnte.
Thyen schließt aus, mit den irdischen Dingen könnten „die zur Beschreibung der ,Geburt von oben‘ von Jesus gebrauchten irdischen Analogien, wie physische Geburt, Wasser und Wind,“ gemeint sein. Auch will er (T200f.) weder Jesu „Reden in Gleichnissen (paroimiais 16,25)“ und das offene Reden „ohne Gleichnisse oder en parrhēsia“ noch das (T201), „was der irdische Jesus gesagt hat“, und „das nachösterliche und vom Himmel her ergehende Zeugnis des Parakleten“ noch die „Anfangsgründe der Lehre“ und eine „Lehre für die Vollkommenen“ auf die Unterscheidung des Irdischen vom Himmlischen beziehen.
Besondere Erwähnung verdient Thyens Kritik an der Auffassung von Rudolf Bultmann, <244> der Jesu Rede von den irdischen Dingen mit der Einsicht gleichsetzt, dass der Mensch, indem er aus dem Fleisch geboren ist, verloren sei, während die Möglichkeit, wiedergeboren und erlöst zu werden, zu den himmlischen Dingen gehöre:
„Die Rede von der Wiedergeburt gehört insofern zu den epigeia {irdischen Dingen}, als sie ein Urteil des Menschen über seine Situation in der Welt enthält, eben das, daß er als von der sarx {Fleisch} Geborener sarx ist, daß er verloren ist und das erstrebte Wohin seines Weges nicht erreicht, da sein Woher ein verfehltes ist. Wie im gnostischen Mythos bezeichnet also ta epigeia {das Irdische} nichts anderes als die widersinnige Situation des Menschen, deren Erfassung das Vorverständnis bedeutet, das für das Verständnis der Offenbarung gefordert ist. Man könnte umschreiben: wer die Notwendigkeit der Wiedergeburt nicht einsieht, der versteht auch nicht, daß sie durch Jesus möglich geworden ist“.
Thyen lehnt an diesen Vorstellungen Bultmanns nicht nur ab, dass „dem Evangelisten die vermeintlich gnostische Terminologie von seiner ‚Offenbarungsreden-Quelle‘ vorgegeben“ sei, sondern erst recht eine angeblich wesensmäßig zur Existenz des Menschen gehörende Voraussetzung,
daß „zum Verständnis der Offenbarung“ ein bestimmtes „Vorverständnis“ notwendig sein soll. Eher scheint uns doch die Erkenntnis der „widersinnigen Situation des Menschen“ – oder biblisch gesagt: die Erkenntnis, daß er als Sünder vor dem heiligen Gott verloren ist – eine Folge und nicht die Voraussetzung des Verstehens der Offenbarung zu sein.
Thyens eigene Lösung des Problems, inwiefern Johannes zwischen irdischen und himmlischen Dingen unterscheidet, entwirft er unter Rückgriff auf Johannes 12,25f., wo der Evangelist
im Einklang mit der christlichen Tradition und in intertextuellem Spiel mit Mt 16,24f Jesus erklären läßt: „Wer sein Leben (psychē) liebt, der wird es verlieren, wer aber sein Leben haßt in dieser Welt, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wenn einer mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird mein Vater ihn ehren“.
Entgegen allen Versuchen, das Johannesevangelium „auf eine sogenannte ‚präsentische Eschatologie‘“ zu reduzieren, betont Thyen, dass (T201f.)
Johannes hier und andernorts zwischen dem Leben der Glaubenden „in dieser Welt“ und dem „ewigen Leben“ sehr wohl zu unterscheiden weiß. Schon Jesu erstes Wort an Nikodemus legt es nahe, in den epigeia {irdischen Dingen} das gesamte durch die neue ,Geburt von oben‘ eröffnete ,ewige Leben‘ der Glaubenden schon auf Erden zu sehen (vgl. 3,36; 5,24; 6,47.54 u.ö.) und als die epourania {himmlischen Dinge} ihr endliches ‚Eintreten in die basileia tou theou‘ {das Königtum Gottes} (3,5) und das ,Sehen der himmlischen Welt‘ (3,3) zu begreifen.
Offen bleibt hier aber, ob man die zōē aiōnios, das „ewige Leben“, im Johannesevangelium wirklich auf ein Leben im Himmel beziehen darf. Immerhin wird dieses Leben nirgends epouranios, „himmlisch“, genannt, sondern eben „äonisch“, auf die kommende Weltzeit bezogen, eine durchaus diesseitig zu begreifende Vorstellung.
Außerdem lässt Thyen letzten Endes auch offen, warum er sich überhaupt so ausführlich über den Unterschied der irdischen und himmlischen Dinge auslässt, wenn er doch mehrfach betont hatte, dass Jesus es für zwecklos hält, von himmlischen Dingen zu reden.
Und Thyens ohne weitere Begründung geäußerte Annahme (T199), „daß der Evangelist der Aussage von V. 12 mit dem in V. 13 einsetzenden Monolog Jesu unmöglich derart unvermittelt dessen Reden von den ,himmlischen Dingen‘ folgen lassen konnte“, wäre nur dann stichhaltig, wenn die folgenden Verse 13-21 tatsächlich dazu dienen sollten, Nikodemus zum Umdenken zu bewegen. Anders sieht es aus, wenn der johanneische Jesus in diesen Versen über den Kopf des Nikodemus hinweg die Leser- und Hörerschaft des Evangeliums anspricht, die bereit ist, auf ihn zu vertrauen. Dann würde der Vers 12 praktisch die Stelle markieren, an dem das Gespräch Jesu mit Nikodemus abbricht und in eine interne Schulung der messianischen Gemeinde übergeht.
Noch eine andere Möglichkeit der Unterscheidung zwischen irdischen und himmlischen Dingen in der Rede Jesu und seiner Anhänger erwägt Ton Veerkamp, nämlich ein johanneisches Spiel mit der synoptischen Rede vom Reich Gottes:
Welchen Grund hätte aber das rabbinische Judentum, das Zeugnis nicht anzunehmen? Jesus spricht über das, „was die Erde betrifft“. Der niederländische Exeget Wout van der Spek sagt über Johannes 3,3.5: „Wo die Rede ist vom Königreich Gottes, stehen irdische Dinge auf dem Spiel.“ <245> Wenn die Bemerkung van der Speks zutrifft, dass die Verkündigung über die irdischen Dinge – ta epigeia – die Verkündigung des „Königtums Gottes“ ist, dann bezieht sich Johannes auf die Verkündigung jener messianischen Gruppen, die die synoptischen Texte produziert hatten.
Wout van der Spek selbst hatte an der von Veerkamp zitierten Stelle allerdings nicht direkt auf die synoptischen Evangelien zurückgegriffen, sondern weiter zurück auf den TeNaK, die jüdische Bibel. Schon das Geborenwerden „aus Wasser und Geist“ hatte er vom TeNaK her ausgelegt (ebenda, 21):
,Wasser‘ steht seit der Kana-Erzählung für die Thora. Der Geist ist es, der die Thora in Kraft setzt und zur Prophetie macht. ,Aufs-Neue-Geboren-Werden‘ bedeutet also: in diese Bewegung einbezogen werden. …
Die Möglichkeit einer neuen Existenz wird im Faktum ‚Jesus‘ gegründet. Es geschieht und es ist in der Erzählung von Israel früher geschehen. Die Erzählung vom Tenach ist die Erzählung von Menschen, die ihr Schicksal bewältigt haben. Wie das möglich ist, ist ein großes Geheimnis; aber daß es geschehen ist und also aufs neue geschehen kann, das bezeugt die Tradition Israels. Und wenn Nikodemus nun aufs neue fragt: wie kann das geschehen?, bedeutet das: wie soll das Wirklichkeit werden? Und dann verweist ihn Jesus auch an diese Geschichte. Diese Fakten von Menschen, die machtlos waren und in ihrer Machtlosigkeit gerettet wurden, müssen vorangehen. Das sind die irdischen Dinge, von denen Vs. 12 spricht.
Diesem irdischen Reden vom Reich Gottes stellt Veerkamp nun die anders geartete Verkündigung des Johannes gegenüber:
Wenn das Königtum Gottes eine sehr irdische Angelegenheit ist, wie die Gleichnisse des Königtums Gottes zeigen (Markus 4; Matthäus 13), und die Gegner sich darauf nicht einlassen wollen, dann muss Johannes sich von diesem Typus messianischer Verkündigung verabschieden. Mit diesem Wort wir bekundet er seine Solidarität mit jenen Gruppen. Anders gesagt: „Wir haben versucht, das Kommen des Königtums Gottes anschaulich und verständlich zu machen. Unsere rabbinischen Gegner haben das nicht angenommen. Jetzt rede ich von den epourania, von dem, was den Himmel betrifft.“
Ein wenig irritiert frage ich mich bei dieser Argumentation, ob Veerkamp tatsächlich annimmt, dass die rabbinischen Gegner Jesu seine Rede von himmlischen Dingen für überzeugender halten könnten als die bisherige Rede von irdischen Dingen. Ich denke eher, dass Jesus zwar eine Rede über himmlische Dinge anschließt, aber damit vor allem andere Adressaten als Nikodemus anspricht, nämlich solche, die bereit sind, auf ihn zu vertrauen.
Was konkret mit den himmlischen Dingen gemeint sein kann, die Jesus ansprechen wird, davon finde ich bei Wout van der Spek einen Vorgeschmack (ebenda, 21f.):
Das himmlische Geheimnis kommt an zweiter Stelle, das erste ist: Vertraue dich diesen {biblischen} Fakten an und füge dich in diese Tradition {des TeNaK}. Willst du dann trotzdem immer noch über den Himmel reden, [wisse] dann, daß die Richtung immer von oben nach unten geht. Der Menschensohn steigt herab. Der Entwurf ,Gott‘ bekommt irdische Gestalt. Und insofern es einen Weg nach oben gibt, ist das der Weg durch die Emiedrigung hindurch. Johannes nennt Jesu Kreuzestod konsequent Erhöhung. Das geschieht nicht, um sein Leben zu beschönigen, was Verrat sein würde. Johannes will damit sagen: eine andere Hoheit als diese gibt es nicht. Sein Jesus hat durch Haß und Schmach an dem himmlischen Entwurf des Menschensohns festgehalten. Getreten und geschlagen bleibt seine Gestalt königlich.
↑ Johannes 3,13: Aufstieg und Abstieg des Menschensohns zum und vom Himmel
3,13 Und niemand ist gen Himmel aufgefahren
außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist,
nämlich der Menschensohn.
[24. April 2022] Zu Johannes 3,13 macht Klaus Wengst noch einmal deutlich (W115), dass dieser Vers wie die beiden vorhergehenden in seinen Augen dazu dient, die „Legitimation“ Jesu herauszustellen. Dies geschieht, indem Jesus „in der 3. Person Singular … von sich“ selber im „Perfekt“ davon redet, dass er, „der Menschensohn“, bereits in den Himmel hinaufgestiegen ist. Darunter, so meint Wengst,
kann kaum etwas anderes verstanden werden als das Ostergeschehen (20,17; vgl. 6,62). So spricht Jesus, der hier noch am Anfang seiner Wirksamkeit steht, von seinem am Ende des Evangeliums liegenden „Aufstieg“ als einem Ereignis der Vergangenheit. Der Evangelist schreibt im Rückblick auf den ganzen Weg Jesu und lässt ihn schon am Anfang sagen, was sich erst vom Ende her ergibt.
Warum nimmt Johannes (W116) die Bezeichnung Jesu als des Menschensohns, die bereits in 1,51 vorkam, an dieser Stelle erneut auf? Wengst zufolge tut er das,
weil die mit ihr gemeinte Gestalt von Haus aus der himmlischen Welt zugehört. Der Ursprung der auf sie bezogenen Tradition liegt in Dan 7. Dort heißt es in einer Vision des Endgerichts vor dem Thron Gottes in V. 13f.: „Ich schaute Schauungen der Nacht: Da! Mit Himmelswolken kam jemand wie ein Menschensohn. Bis zum Hochbetagten gelangte er und wurde zu ihm gebracht. Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist Herrschaft auf immer, die nicht vergeht, und ein Königtum, das nicht zerstört wird.“
Diese Tradition ist im 1. Henochbuch 46 aufgegriffen worden, wo er als „der von Gott beauftragte endzeitliche Richter“ erscheint, und schon in den synoptischen Evangelien auf Jesus übertragen worden. Indem Johannes sie
aufnimmt und dabei die himmlische Herkunft dieser Gestalt betont, lotet er damit wieder sozusagen die Tiefendimension Jesu aus, wie er es im Prolog mit Hilfe „des Wortes“ getan hatte. Anders gesagt: Jesus ist nicht deshalb legitimierter Zeuge, weil er ein besonders eindrucksvoller Mensch gewesen wäre, sondern nur deshalb und dann, wenn und weil in ihm Gott selbst zu Wort kommt und so sein Zeugnis „vom Himmel“ ist.
Die „betonte Verneinung am Anfang von V. 13, dass niemand in den Himmel hinaufgestiegen sei“, will Wengst nicht als Polemik gegen Traditionen begreifen, „die vom Hinaufsteigen des Mose zu Gott sprechen“, und erst recht (W117) kann er nicht „Mose die Legitimität des Zeugen des Gotteswortes absprechen wollen. Denn er braucht ihn gleich positiv in V. 14.“
Was Wengst wie auch viele andere Exegeten kurzerhand als vorweggenommene Erzählung vom Aufsteigen des an Ostern auferweckten Jesus nimmt, sieht Hartwig Thyen (T203) weitaus problematischer. Auf Grund einer Analyse des Satzbaus von Vers 13 und vor allem „des Perfekts anabebēken {ist hinaufgestiegen}“ meint er den Satz nicht anders verstehen zu können „als in dem Sinn, daß Jesus hier tatsächlich von einer anabasis {Aufstieg} spricht, die vor seiner Begegnung mit Nikodemus liegen muß“:
Dafür sprechen auch der bei Joh ebenso wie in den Synoptikern auschließlich im Munde Jesu begegnende Name ho hyios tou anthrōpou {der Sohn des Menschen} und der Umstand, daß unmittelbar danach wieder der vorösterliche Jesus mit einer johanneisch modifizierten synoptischen „Leidensweissagung“ die Notwendigkeit seiner „Erhöhung“ verkündet (V. 14ff).
Aber „wann und bei welcher Gelegenheit“ könnte „sich ein Himmelsaufstieg Jesu noch vor unserer Nikodemus-Episode denn ereignet haben“? Ich verzichte darauf (T204), die Autoren zu nennen, die Thyen zufolge abenteuerliche Spekulationen über Jesu Himmelsaufstieg entwickelt haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit seiner Taufe, seiner Berufung zum Propheten oder auch der „Reinkarnation des biblischen Märtyrers Abel in der Person Jesu“. Wie Wengst fragt auch Thyen (T205), ob in Vers 13 „aktuelle Polemik“ gegen Spekulationen über den Himmelsaufstieg Moses geäußert werde, und entscheidet sich dagegen.
Wohlwollender befasst sich Thyen mit der Hypothese von Peder Borgen. <246> Der deutet
die in V. 13 ausgesagte Ausnahme von der Regel so, daß kein menschliches Wesen je in den Himmel aufgestiegen sei, sondern einzig der göttliche Menschensohn. Dessen vorinkarnatorischen Aufstieg will er im Anschluß an Dan 7,13f als lnthronisationsakt des präexistenten Sohnes deuten, dem damit die exousia {Vollmacht} über ,alles Fleisch‘ verliehen und der Auftrag erteilt worden sei, allen, die Gott ihm ,gegeben hat, das ewige Leben zu verleihen‘ (Joh 17,2; vgl. Dan 7,14)…
Dagegen spricht aber, dass dieser präexistente Sohn gar nicht von der Erde in den Himmel aufgestiegen ist, sondern immer schon im Himmel war. Außerdem meint Thyen, dass die „danielische Vision eines ,wie ein Mensch‘ aussehenden Himmelswesens und der sogenannte ,apokalyptische Menschensohn‘ … bei Joh keine Rolle“ spielen:
Und warum sollte einer, der ,im Anfang bei Gott‘, ja der ,Gott war‘, einer, der das göttliche egō eimi {Ich bin} im Munde führt und erklärt: egō kai ho patēr hen esmen {Ich und der Vater, eins sind wir} (10,30), einer, durch den ,alle Dinge erschaffen wurden‘, warum sollte der eigens im Himmel gekrönt und mit göttlicher Vollmacht ausgestattet werden?
Von den zuletzt angeführten Gedanken her ist es nicht verwunderlich (T206), dass Thyen eher Delbert Burkett <247> zuneigt, der [35] die „Wurzeln“ für „das Motiv von Ab- und Aufstieg des Menschensohns … in der biblischen Rede vom Auf- und Absteigen Gottes“ sieht, die Johannes „auf Jesus übertragen hat“:
Wenn die biblischen Auf- und Abstiege Gottes als solche des ,Menschensohns‘ gesehen werden, werden Passagen wie Joh 12,41 (tauta eipen Ēsaïas hoti eiden tēn doxan autou, kai elalēsen peri autou {Das sagte Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete}) oder die Rede vom Jubel Abrahams darüber, daß er ,den Tag Jesu sah‘ (8,56) beredt. Dann braucht man auch die ja so deutlich auf die Sinaioffenbarung bezogene Prologpassage (1,14-18, s.o. z{ur}. St{elle}.) nicht mehr als Polemik gegen Mose zu begreifen. Denn wenn „die Schrift doch nicht aufgelöst werden darf“ (10,35), dann kann auch Joh 1,18 nicht bestreiten wollen, daß Mose und die Ältesten auf dem Sinai den ,Topos‘ gesehen haben, ou heistēkei {ekei} ho theos tou Israēl {den Ort, wo der Gott Israels stand} (Ex 24,10f LXX <248>), oder daß Mose, weil kein Mensch das Angesicht Gottes schauen und am Leben bleiben kann, die Herrlichkeit des an ihm vorübergezogenen Gottes Israels doch wenigstens von hinten hat schauen dürfen (Ex 33,18ff). Wenn Joh Jesus sagen läßt, daß Israels Schriften ,von ihm zeugen‘ (5,39) und daß Mose ,von ihm geschrieben hat‘ (peri gar emou ekeinos egrapsen: 5,46), dann müssen der topos {Ort}, den die Ältesten Israels sahen, und die doxa {Herrlichkeit}, die Mose auf dem Sinai schaute, ja wohl der auf- und absteigende ,Menschensohn‘ und seine doxa gewesen sein, die auch Jesaja sah und an der Abraham sich freute.
In diesem Zusammenhang erinnert Thyen an seine Erörterungen zu Johannes 2,13ff., denen zufolge „A.E. Harvey und Preiss aufgewiesen“ haben (vgl. Anm. 196),
daß das gesamte Johannesevangelium als das Protokoll des durch Jesus ausgetragenen Rechtsstreites Gottes mit seinem Volk gelesen sein will. Dazu ruft Joh die Heiligen Schriften Israels als die verläßlichen Zeugen für den von Gott Gesandten auf. … Darum scheint uns Burkett im Recht zu sein, wenn er auch für Joh 3,13 nach diesem Zeugnis der Schrift fragt und es in Prov 30,1-4 entdeckt.
In diesem Abschnitt aus dem Buch der Sprüche oder Proverbien sind nach Thyen „alle Motive von Joh 3,13 fest miteinander verknüpft…, nämlich sowohl der ,Mann‘ und sein ,Sohn‘ als auch deren Aufstieg in den Himmel und ihr Abstieg“, wobei der „Mann“ (als Übersetzung nicht des hebräischen Wortes ˀisch, sondern geber, griechisch anēr) im ersten Vers als der Sprecher der folgenden Verse erscheint. Nach der Lutherbibel lautet die Übersetzung dieser Verse folgendermaßen:
30,1 Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa.
Es spricht der Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott,
ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen.
30,2 Denn ich bin der Allertörichtste,
und Menschenverstand habe ich nicht.
30,3 Weisheit hab ich nicht gelernt,
und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht.
30,4 Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab?
Wer hat den Wind in seine Hände gefasst?
Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden?
Wer hat alle Enden der Welt bestimmt?
Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?
Nach Thyen lässt die „eindringliche Reihe der rhetorischen Fragen … natürlich einzig die Antwort zu: Der ,Mann‘ und ,der Sohn des Mannes‘.“ Dabei ist allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie er den nur in Vers 1 erscheinenden „Mann“ auf die Fragen von Vers 4 beziehen kann. Das erschließt sich erst aus einer (T207) von Thyen ausführlich wiedergegebenen Analyse des hebräischen Textes der „Worte Agurs“ durch Burkett [51-75], die als „eine Rätselrede … absichtsvoll doppeldeutig“ formuliert seien. So bestätige der doppelt lesbare Konsonantenbestand hgbr“ in Vers 1,
der nämlich sowohl als ,hageber‘ (der Mann) als auch als ,hagibbor‘ (der Mächtige) gelesen werden kann (und soll!), daß die Designation ,der Mann‘ eine absichtsvoll enigmatische {rätselhafte} Referenz auf Gott ist. Das bedeutet aber zugleich, daß „der Sohn des Mannes“, wie Burkett ho hyios tou anthrōpou {der Sohn des Menschen} übersetzt, ein Kryptogramm von ho hyios tou theou {der Sohn Gottes} ist.
Letzten Endes kann Burkett diesen „Mann“ aber nur dadurch mit dem in Vers 4 gemeinten Gott identifizieren, indem er sämtliche negativ getönten Aussagen in den Versen 1 bis 3, die sich auf den Mann beziehen, in ihr Gegenteil umdeutet, zum Beispiel: „Ich habe nicht nur menschlichen Verstand. / Die Weisheit habe ich nicht gelernt, / denn ich habe das Wissen der Heiligen.“ Letzten Endes halte ich schon allein deswegen, weil die Formulierung „Sohn des Menschen“ nicht einfach mit „Sohn des Mannes“ gleichzusetzen ist, diese Versuche Burketts schlicht für zu weit hergeholt.
Trotzdem kann ich seiner These etwas abgewinnen. Aber auf einem anderen, in meinen Augen viel naheliegenderen Wege. Denn die Frage mah-schɘmo, „wie ist sein Name?“, kann direkt auf den NAMEN des Gottes Israels bezogen werden. Und von daher ist es Johannes durchaus zuzutrauen, die sich unmittelbar anschließende Frage umah-schem-beno, „und wie ist der Name seines Sohnes?“, auf Jesus zu beziehen, den er ja sowohl als Sohn Gottes bezeichnet als auch mit dem Menschensohn identifiziert und in der Formulierung egō eimi, „ICH BIN“, sogar als die Verkörperung des befreienden NAMEN Gottes betrachtet.
Allerdings ist mir weiterhin unwohl dabei, so ohne Weiteres der Schlussfolgerung von Thyen zu folgen, die er folgendermaßen nochmals zusammenfasst (T208):
All das heißt aber, daß Joh 3,13 in intertextuellem Spiel mit Prov 30 von solchen Gelegenheiten spricht, wo Gott nach einem Besuch auf Erden wiederaufsteigt in den Himmel und dabei diese Besuche der lrdischen für den hyios tou anthrōpou in Anspruch nimmt.
Als Bestätigung dafür will Thyen auch Johannes 9,5 verstehen, wo Jesus sagt: „hotan en tō kosmō ō, phōs eimi tō kosmou {jedes Mal, wenn ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt}“.
Letzte Klarheit darüber, wie Thyen das versteht, vermittelt mir erst der letzte Abschnitt seiner Argumentation zu Johannes 3,13. Dort nämlich äußert er sich erneut
zu der verbreiteten These…, als alleiniger Kenner der epourania {himmlischen Dinge} und einziger Mittler der göttlichen Offenbarung polemisiere Jesus mit V. 13 gegen Himmelsaufstieg und Offenbarungsempfang anderer. Hatten wir das oben bereits in Frage gestellt, so läßt sich nun noch definitiver sagen, daß mögliche visionäre Erfahrungen anderer hier keinesfalls bestritten werden, wie Jesus in unserer Szene ja auch nicht als Künder der epourania auftritt. Joh 3 ist kein ,apokalyptischer‘ und erst recht kein ,gnostischer Text‘. Wie die Stichworte von ,neuer Geburt‘ und ,ewigem Leben‘ anzeigen, geht es hier gar nicht um Offenbarung, sondern um Erlösung. Bestritten wird nicht, daß einer eine Offenbarung vom Himmel her erfahren haben könnte, sondern daß jemals einer des ,ewigen Lebens‘ in der himmlischen Welt teilhaftig geworden wäre [vgl. Burkett 81].
Nach dem letzten Satz dieser Ausführungen nimmt Thyen erstens an, dass Jesus sich tatsächlich in seiner Identität bzw. Sohnschaft mit Gott immer wieder „in der himmlischen Welt“ aufgehalten hat, und in diesem Zusammenhang versteht er zweitens auch „ewiges Leben“ als ein jenseitiges Leben in der himmlischen Welt und nicht als von Freiheit, Recht und Frieden erfülltes Leben auf dieser Erde unter dem Himmel.
Beide Vorstellungen Thyens halte ich für fragwürdig, zur zweiten habe ich oben zur Auslegung von Johannes 1,13 bereits zitiert, was Ton Veerkamp zum „Leben der kommenden Weltzeit“ im Gegensatz zum „Willen des Fleisches“ schreibt.
Die erste widerspricht der klaren Überzeugung des Johannes, dass das Wort Gottes voll und ganz „Fleisch“ geworden ist, also als dieser reale Jude Jesus auf der Erde gelebt hat. Nur indem Jesus als genau dieser Mensch den befreienden NAMEN Gottes verkörpert, wird er in seinem Tod zum Himmel Gottes aufsteigen, aber nicht, um als Mensch dort zu wohnen, sondern um die Verirrungen der Weltordnung wegzutragen (Johannes 1,29), die Weltordnung zu überwinden und den Anbruch der kommenden Weltzeit herbeizuführen. Diesen Aufstieg hat nach Johannes 3,13 vor Jesus als dem Menschensohn niemand vollzogen, das ist mit dem verneinten Perfekt oudeis anabebēken, „niemand ist aufgestiegen“, gemeint.
Ich will also nicht ausschließen, dass Johannes an Sprüche 30,4 denken mag, indem er vom Auf- und Abstieg des Menschensohns zum Himmel spricht, aber er hat bestimmt nicht im Sinn, dass Jesus sozusagen schon lange vor seiner Geburt als Mensch den einen oder anderen Ausflug mit seinem Vater auf die Erde unternommen hat und dann wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Eher geht es ihm darum, so deutlich wie möglich zu betonen, dass Jesus in seiner Eigenschaft als der Menschensohn zugleich voll und ganz der Sohn des Gottes Israels ist, indem er dessen befreienden NAMEN verkörpert.
Interessant sind Thyens zuletzt zitierte Überlegungen auch deswegen, weil hier deutlich wird, inwiefern er dagegen ist, Johannes 3 als einen apokalyptischen Text zu deuten. Recht hat er, insofern Johannes nicht wie etwa das Buch Henoch kapitelweise Offenbarungen über die himmlische Welt zu enthüllen vorgibt. Trotzdem hat allein schon der Bezug auf den Menschensohn mit der Apokalyptik zu tun, denn entgegen der oben bereits zitierten Auffassung Thyens (T205), dass die „danielische Vision eines ,wie ein Mensch‘ aussehenden Himmelswesens und der sogenannte ,apokalyptische Menschensohn‘ … bei Joh keine Rolle“ spielen, stammt die Vorstellung vom Menschensohn nun einmal doch aus dem apokalyptischen Buch Daniel, worauf Wengst zu Recht hingewiesen hat, und Stellen wie Johannes 17,2 oder 5.27 zeigen deutlich, in welcher Weise Johannes davon ausgeht, dass Jesus als dem Menschensohn entsprechend Daniel 7,13.14 die exousia, „Macht“, über alle Menschen übertragen wird, insbesondere diejenige, über sie Gericht zu halten (Daniel 7,10).
An diesem Punkt sind wir in der Lage zu begreifen, was Ton Veerkamp <249> damit gemeint hat, dass Jesus nun im Gespräch mit seinem rabbinischen Gesprächspartner Nikodemus „von den epourania, vom dem, was den Himmel betrifft“, reden will:
Das tut er mit einem Hinweis auf Daniel 7: „Denn niemand ist in den Himmel aufgestiegen, wenn nicht der, der aus dem Himmel absteigt, der bar enosch, wie ein Mensch.“ Vom Königtum Gottes, sagt er, sei nach eurer Ansicht auf der Erde nichts zu sehen. Wir beide meinen aber, das Königtum Gottes komme vom Himmel; ich sage dir, wie das geschieht.
Jesus unterweist hier den Lehrer Israels in den Schriften Israels, mit Midraschim. Midrasch ist eine Form von Exegese, aber eine Exegese in praktischer Absicht, das Wort mit den immer wechselnden Lebensumständen zu verbinden. So nimmt die Erzählung des laut vorzulesenden Textes (den die Juden miqraˀ nennen) im Midrasch eine neue Form an.
Konkret wird, wie oft im Johannesevangelium, der folgende Midrasch (Johannes 3,13-15) mehrere Schriftstellen miteinander verknüpfen, hier sind es die Stellen Daniel 7 und 4. Mose (Numeri) 21. In Vers 13 geht es zunächst nur um Daniel 7:
Freilich verfremdet er Daniel 7,11f. Dort heißt es: „Das Gericht setzt sich, Bücher werden geöffnet.“ Anschließend wird berichtet, wie das (zehnte) Horn des Monstrums, das Bild des Tyrannen Antiochus IV, vernichtet wird. Der in den Himmel aufgestiegen ist, der also vor dem „Fortgeschrittenen an Tagen“ steht, ist jetzt der, der aus dem Himmel abgestiegen ist. Das ist das Neue bei Johannes. Der sogenannte „Menschensohn“ ist bei Johannes zu einer irdischen Gestalt, eben „Fleisch geworden“, heißt es im Prolog.
An dieser Stelle wird nun aber deutlich, warum diese Art der Rede von „himmlischen Dingen“ für Menschen wie Nikodemus noch weniger nachvollziehbar sein dürfte als Jesu Rede von „irdischen Dingen“ (sprich: der Neugeburt aus Wasser und Geist). Denn Jesus definiert das Aufsteigen in den Himmel geradezu von seinem Gegenteil her, stellt alle Vorstellungen von himmlischer Herrlichkeit auf den Kopf:
Bei Daniel ist die Erhebung des MENSCHEN die Ausstattung mit der „Regierungsmacht, der Würde und dem Königtum“. In der Vision wird nicht gesagt, wie das geschehen wird. Es wird lediglich angedeutet, dass dieser bar enosch identisch ist mit „dem Volk der Heiligen der Höchsten“, Israel. Johannes beschreibt das Wie. Prinzipiell wird die Erhebung oder der Aufstieg des bar enosch, des MENSCHEN, als Abstieg geschehen, als „Fleischwerdung“, als konkrete politische Existenz, die am Kreuz der Römer endet und enden muss. So wie die Lage jetzt ist, kann die Erhöhung des MENSCHEN, also Israels, nur durch die Niederlage hindurch gedeutet werden. Die Verfremdung von Daniel 7 ist die Aktualisierung der Vision: Aufstieg ist Abstieg, Abstieg ist Aufstieg.
↑ Johannes 3,14-15: Die Erhöhung der Schlange und des Menschensohnes
3,14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat,
so muss der Menschensohn erhöht werden,
3,15 auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
[25. April 2022] Vor der Auslegung der zusammengehörigen Verse 14 und 15 ordnet Klaus Wengst (W117) ihre Aussage in die „Begründungskette“ ein, die in der „Auffächerung des Geschehens von Ab- und Aufstieg“ des Menschensohnes in den Versen 14 bis 17 vorliegt:
Aus ihr wird ersichtlich, warum diese Auffächerung von hinten nach vorn vorgeht. Der Menschensohn wird erhöht, das Kreuz Jesu ist Tat Gottes, weil schon der ganze Weg der Niedrigkeit des Sohnes der Liebe Gottes entsprang. Dieser Weg wiederum war ein Weg der Begegnung Gottes mit der Welt, weil er in der Sendung des Sohnes in die Welt durch Gott gründet. Die Glieder dieser Kette führen also vom Kreuz Jesu zurück auf die ursprüngliche Initiative Gottes, die in dieser Auffächerung als Heilswille für die Welt beschrieben wird.
Aber fangen wir mit Vers 14 an. Indem (T210) hier die Schlange „durch den Artikel ton“ als „die“ Schlange bezeichnet wird, setzt Johannes Thyen zufolge „ein Auditorium (bzw. eine Leserschaft) voraus…, das (die) mit dieser Erzählung von Num 21,4-9 vertraut ist“. In diesem Text des 4. Buchs Mose wird Wengst zufolge (W117f.)
vom Murren des Volkes berichtet, woraufhin Gott Schlangen unter es schickt, deren Bisse tödlich wirken. Das Volk fleht Mose um Abhilfe an, der dann auf Geheiß Gottes eine kupferne Schlange an einem aufgerichteten Pfahl befestigt. Und alle, die darauf blicken, bleiben am Leben. Dieser biblische Text ist das Unbestrittene, das die hergestellte Analogie – die Erhöhung des Menschensohnes und die ihr zugeschriebene Wirkung – überzeugend machen soll.
In welcher Weise bezieht Wengst nun (W118) diese Analogie auf den mit Jesus identifizierten Menschensohn? Er gibt eine christlich-dogmatisch geprägte Antwort:
Indem Johannes den „erhöhten“ Menschensohn in diese biblische Entsprechung stellt, gibt er den gekreuzigten Jesus als Zeichen zu verstehen, das auf Gott weist. Sich an dieses Zeichen zu halten und ihm zu folgen, heißt: das Herz dem Vater im Himmel unterwerfen, heißt: Gott vertrauen, der Jesus beauftragt hat. Es geht Johannes also um die Wahrnehmung Gottes im Kreuz Jesu.
In diesem Zusammenhang bestimmt Wengst (W118) die Bedeutung des Wortes hypsoun, „erhöhen“, in doppelter Weise:
Dieses Wort bezeichnet einmal schlicht eine sichtbare Aufrichtung, wie sie bei der Kreuzigung erfolgt. Aber zum anderen enthält es doch zugleich auch schon die Dimension der Auferweckung. Johannes will mit diesem Begriff nicht die harte Wirklichkeit des Leidens Jesu übertünchen, sondern das Kreuz Jesu als Zeichen des sich in die tiefste Niedrigkeit des Todes begebenden und aus ihr rettenden Gottes kenntlich machen und so das Vertrauen auf diesen Gott des Lebens bestärken.
Hartwig Thyen beschäftigt sich (T208) sehr viel ausführlicher mit der Bedeutung des Wortes hypsoun, „erhöhen“, das hier erstmals im Johannesevangelium auftaucht, und zwar sowohl in der aktiven als auch der passiven Form „hypsōthēnai dei {„muss erhöht werden}“. Er wendet sich dagegen, es als gleichbedeutend mit dem Wort anabainein, „aufsteigen“, zu betrachten, insbesondere in einer Auseinandersetzung mit G. C. Nicholson, <250> der „den Tod Jesu am Kreuz als bloßes Durchgangsstadium auf dem Weg eines göttlichen Wesens aus dem Himmel auf die Erde und dahin zurück“ begreift:
Die dreifache Aussage über Jesu hypsōthēnai {Erhöhtwerden} – wobei die Nennung der Ioudaioi {Judäer} als Vollstrecker dieser ,Erhöhung des Menschensohns“ (8,28) gerahmt ist von der zweimaligen Aussage über deren Notwendigkeit (hypsōthēnai dei: 3,14; 12,34) – erklärt er zum bloßen Teilmoment des vermeintlich alles beherrschenden Schemas von Abstieg und Aufstieg des Menschensohns.
Damit aber macht Nicholson das „Subjekt des Evangeliums, nämlich den gekreuzigten Jesus, … zu dessen bloßem Prädikat und die Prädikationen Jesu zum Subjekt.“ Auf Deutsch: Nach Thyen ist es der gekreuzigte Jesus, von dem Johannes sagt, dass er als genau dieser Mensch mit Gott eins ist, zum Himmel auf- und von dort herabsteigt. Nicholson dreht dieses Verhältnis um, für ihn nimmt eine Art Halbgott aus dem Himmel das irdische Schicksal Jesu einschließlich seiner Kreuzigung als vorübergehende Episode auf sich. „So aber betreibt er die konsequente Mythisierung der Geschichte Jesu.“
Dass (T209) das Wort hypsoun genau drei Mal im Johannesevangelium auf Jesus bezogen wird (3,14; 8,28; 12,32.34), zwei Mal davon im Zusammenhang mit dem Wort dei, „es ist notwendig“ (3,14; 12,34), versteht Thyen dagegen als „ein intertextuelles Spiel mit der dreifachen synoptischen Leidensweissagung Jesu“, und er betont, „daß Jesus seine ‚Erhöhung‘ stets passiv erleidet, seinen Auf- und Abstieg dagegen aber aktiv selbst vollbringt.“ Gegen Nicholson stimmt er Herbert Kohler <251> zu, dass [252] das „Kreuz Jesu … nicht … als Zwischenstation seiner himmlischen Erhöhung“ zu denken ist, „vielmehr muß sich umgekehrt an ihm die konkrete Gestalt der Herrschaft des Erhöhten ausweisen“:
Und zum Vergleich der drei johanneischen „Erhöhungsaussagen“ mit den drei synoptischen „Leidens- und Auferstehungsweissagungen“ (Mk 8,31; 9,31; 10,33f) sagt Kohler [253f.]: „Ihm (sc. Johannes) genügt das Muß des Leidens allein nicht, denn diesem muß immer ein Muß der Auferstehung nachgestellt werden (Mk 8,31ab). Vielmehr nützt er ein Moment im Kreuzigungsvorgang selbst aus – die Erhebung des zu Kreuzigenden von der Erde an den Kreuzesbalken -, um das Ineinander von Leiden und Auferstehen im doppeldeutigen Erhöhtwerden zu sichern“.
Das sieht Thyen auch als einen Grund dafür an, dass – anders als im Gegensatz vom Auf- und Absteigen, anabainein und katabainein – „dem hypsoun bzw. hypsōthēnai ein entsprechendes Gegenüber“ fehlt, „wie es etwa Paulus mit dem Kontrastpaar tapeinoun {erniedrigen} und hyperhypsoun {erhöhen} bietet (Phil 2,8f). Erst in 12,33 wird Johannes ausdrücklich sagen (T210), was in 3,14 bereits angedeutet ist:
Das ,Erhöhtwerden des Menschensohns‘ wird sich in Jesu Sterben am Kreuz ereignen. Zugleich wird daran deutlich, daß hypsōthēnai {erhöht werden} bei Johannes zwar nicht die Opposition von tapeinoun {erniedrigen} bei sich hat, wie bei Paulus, daß es sie aber, wenn Joh den schändlichen Tod am Kreuz ,Erhöhung‘ nennt, sehr wohl in sich hat.
Sehr weit holt Thyen auch aus, um (T212) die „Rede vom ‚ewigen Leben‘ {zōē aiōnios}“ in den Versen 15 und 16 zu erörtern. Diese
ist biblisch vorgegeben, wenn es Dan 12,1f heißt: Beim Erscheinen des großen Fürsten Michael werden „viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, aufwachen, die einen zum ewigen Leben …, die anderen zu Schmach und Schande“. Die Rabbinen sprechen häufig vom ,Leben der zukünftigen Welt‘ (chajjej ˁolam habaˀ). Das Adjektiv aiōnios {ewig, äonisch} begegnet im Corpus Iohanneum {Johannesevangelium und Johannesbriefe} 23 mal (17 mal im Ev und 6 mal im 1Joh) und zwar ausschließlich in der Fügung zōē aiōnios {ewiges Leben}. Daß diese häufige Prägung in V. 15 u. 16 gleich zweifach erscheint, und zwar erst nach dem einzigen, ebenfalls doppelten Vorkommen der Wendung hē basileia tou theou {Reich Gottes} in den V. 3 u. 5, ist gewiß kein Zufall.
Thyen bringt also die johanneische Vorstellung vom „ewigen Leben“ in einen Zusammenhang mit der rabbinischen Erwartung des ˁolam habaˀ, der „Weltzeit, die kommen soll“. Diese wurde als zukünftiges Leben im Diesseits verstanden, auf der Erde unter dem Himmel Gottes, was Thyen allerdings nicht hervorhebt. Er fährt fort:
Wenn man nicht übersieht, daß in der Rede vom ,ewigen Leben‘ das eschatologische Moment der uns aus den synoptischen Evangelien so vertrauten Verkündigung der Nähe der Gottesherrschaft (oder des Himmelreichs, wie Mt sagt) einerseits aufgenommen und bewahrt, andererseits aber zugleich eigentümlich transformiert ist, könnte man sagen, Joh habe hier die Fügung hē basileia tou theou {Reich Gottes} durch die Verheißung der zōē aiōnios {ewiges Leben} geradezu ersetzt.
Darin ist Thyen durchaus Recht zu geben; offen bleibt aber, worin er die eigentümliche Transformation der hier behandelten eschatologischen Begriffe erblicken will. Stellt er sich eine Umwandlung diesseitiger Reich-Gottes-Erwartungen in jenseitige Vorstellungen eines ewigen Lebens im Himmel vor? Auch weiterhin verschwimmen in Thyens Ausführungen diesseitige und jenseitige Vorstellungen vom ewigen Leben:
Barrett <252> gibt darum die „Gedankenführung“ von V. 14f so wieder: „Der Menschensohn ist durch seinen Tod in den Himmel erhöht worden: deshalb erfreuen sich jene, die in ihm sind (en autō <253>), des Lebens im kommenden Äon durch Antizipation {Vorwegnahme}“.
Wieder bleibt offen, ob dieser kommende Äon rein jenseitig oder zumindest auch als diesseitige kommende Weltzeit auf der Erde zu verstehen ist, zumal Thyen unter Rückgriff auf ein Zitat von Kohler [254f.] fortfährt (T212f.):
Dabei muß man freilich der naheliegenden Versuchung widerstehen, „dieses ewige Leben kritisch abzuheben gegenüber dem bloß physischen Leben, das durch das Schlangenzeichen gewährt wird. Darin würde sich dann noch einmal das Mißverständnis des Erhöhtwerdens wiederholen. Demgegenüber gilt: so wie zuvor in V. 14 die himmlische Erhöhung im Vollzug der Kreuzigung gedacht wurde, so wird jetzt das ewige Leben im Vollzug des irdischen gedacht. Das traditionell am Ende der Tage erwartete ewige Leben tritt in das gegenwärtige Leben ein. Das ewige Leben wird als etwas gedacht, das das Leben umfaßt und nicht etwa an seine Stelle tritt“.
Ich gebe zu, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Gedanken nachzuvollziehen. Versteht Kohler die Verheißung ewigen Lebens im Sinne einer Erfüllung des diesseitigen Lebens bereits im Hier und Jetzt, dann fragt sich, was er konkret damit meint – vielleicht eine spirituelle Veränderung des einzelnen Menschen durch seinen persönlichen Glauben? Eine auf die gesellschaftliche Lebenswelt der Menschen bezogene Veränderung im Diesseits scheint jedenfalls nicht im Blick zu sein.
Dabei versteht es sich jedoch wohl von selbst, daß sich das ,ewige Leben‘ im ,irdischen Leben‘ nicht erschöpft und daß auch die Glaubenden in der von der „Angst“ beherrschten Welt (en tō kosmō thlipsin echete {in der Welt habt ihr Angst}) es nie, wie ihr Herr, „der die Welt überwunden hat“ (16,33), „in sich selbst“ (5,26), sondern stets nur allein „in ihm“ haben werden als solche, die „an íhn glauben“ und zu seinem Kreuz „aufsehen“, so wie das geängstigte Volk Israel in der Wüste einst „aufblickte“ auf die erhöhte Schlange und Leben gewann.
Mit diesen Worten scheint Thyen die auf das Hier und Jetzt bezogenen Äußerungen Kohlers wiederum durch auf das Jenseits gerichtete Hoffnungen ergänzen zu wollen. Im Ganzen verraten die von ihm verwendeten Formeln jedoch kaum etwas darüber, wie er sich das Leben „in“ Jesus und das Aufsehen zu seinem Kreuz konkret vorstellt.
Interessant ist, dass in den Argumentationen von Klaus Wengst zu diesem Thema des ewigen Lebens ganz ähnliche Denkmuster zu erkennen sind wie bei Thyen. Die Art, wie Gott aus dem Tode rettet, wird ihm zufolge (W118) in Vers 15 so beschrieben, dass „diejenigen, die sich durch dieses Zeichen <254> zum Vertrauen auf Gott bewegen lassen, … ‚ewiges Leben haben‘“. Dazu erwähnt Wengst zwar, dass im „hebräischen Sprachbereich … dieser Wendung die vom ‚Teilhaben an der kommenden Welt‘“ <255> entspricht, aber mit keinem Wort geht er darauf ein, ob auch Johannes selbst das Anbrechen einer solchen kommenden Weltzeit auf dieser Erde im Sinn haben könnte. Stattdessen diskutiert er Vorstellungen des ewigen Lebens im Sinne der Unsterblichkeit oder des Gottvertrauens angesichts der allgemein-menschlichen Todverfallenheit (W118f.):
Die griechische Formulierung „ewiges Leben“ könnte die Vorstellung wecken, dass etwas überdauert und nicht stirbt, unsterblich ist. Daran denkt Johannes nicht. Das ist am deutlichsten, wenn er in 11,25 von solchem Leben schreiben kann, „auch wenn jemand stirbt“. Es ist Leben, das sich selbst im Tod getrost der Treue Gottes überlässt. „Ewiges Leben“ qualifiziert damit schon das Leben vor dem Tod als unbedingtes Gottvertrauen. Es ist ewiges Leben, weil es ganz und gar Gott vertraut, in seiner Hand steht und nicht an unserem Tun und Erleiden hängt. So ist es Bekenntnis und Hoffnung gegen den Augenschein einer Welt des Todes, gegen unser Unvermögen und Versagen, gegen unser Sterbenmüssen.
Offenbar meint nun Wengst (W119), das Judentum von der Vorstellung entlasten zu müssen, in der Erzählung von der Erhöhung der Schlange „sei es lediglich um die Heilung von tödlichen Schlangenbissen gegangen“, während es Johannes um die „Dimension des ‚ewigen Lebens‘“ gehe. So verweist er (W118) darauf, dass schon in Weisheit 16,5-6 die Schlange als „‚Zeichen‘ (sýmbolon)“ verstanden wurde, „das auf Gott selbst als tatsächlichen Retter hinweist“, und dass (W119) schon „in rabbinischen Auslegungen“ mehr im Blick war als die Dimension des
biologischen Lebens und Sterbens. In der kann eine Giftschlange sehr wohl töten. Die andere Dimension kommt schon in der Formulierung der Frage zum Ausdruck, die auch die implizite Antwort gibt, insofern hier auf 1. Sam 2,6 angespielt wird, wo es von Gott heißt: „Der Ewige tötet und macht lebendig, führt hinab in die Totenwelt und führt herauf.“ Dieser Text spielt in Diskussionen um die Auferstehung eine Rolle. <256> Und so geht es auch in der ausdrücklichen Beantwortung dieser Frage um das Vertrauen auf Gott als den wirklichen Herrn über Leben und Tod.
Ich verstehe Wengsts Anliegen und bestreite nicht die Richtigkeit seiner Beobachtungen, wende mich aber dagegen, dass auf diese Weise ein anderes Anliegen jüdisch-messianischer Hoffnungen völlig aus dem Blick gerät, nämlich die Erwartung einer kommenden Weltzeit für ein zukünftiges Leben auf dieser Erde in Freiheit, Recht und Frieden.
Wer sich bis hierhin durch meine Wiedergabe der Vorstellungen von Thyen und Wengst zum ewigen Leben durchgekämpft hat, hat sicher gemerkt, dass ich besonderen Wert auf die von beiden ausgeklammerte Dimension des Lebens der kommenden Weltzeit auf dieser Erde lege. Es ist dieser Aspekt, der Veerkamp zufolge im Zentrum der jüdisch-messianischen Zielsetzungen des Johannes steht. Thyen und Wengst übersehen ihn nur allzuleicht, indem sie die Erzählung von der Schlange sehr abstrakt in den Kontext einer Strafaktion Gottes (T210) gegen sein Volk, das „gesündigt hat, indem es gegen JHWH und gegen Mose, seinen Gedanken redete“, einordnen. Worum es konkret (W117) bei diesem „Murren des Volkes“ geht, bleibt völlig außerhalb ihres Blickfeldes.
Ton Veerkamp <257> sieht genauer hin und fragt sich, was es bedeutet, dass das Volk in 4. Mose 21,5 gegen Gott und gegen Mose redet: „Warum habt ihr uns hinaufgeführt aus Ägypten?“ Seine Antwort lautet:
Ursache der Katastrophe mit den Schlangen war das Murren des Volkes gegen die Führung, die es aus dem Sklavenhaus hinausführte. Macht das Volk die Befreiung rückgängig und verspielt es seine Freiheit, dann ist die Folge der Untergang. Die Symptome des Untergangs sind die Giftschlangen, deren Biss tödlich ist. Mose macht nun auf Geheiß seines Gottes ein Sinnbild der tödlichen Folgen einer verspielten Freiheit. Die verspielte Freiheit ist die Giftschlange. Sie wird angeheftet an einer Stange, unschädlich gemacht. Das Bild der festgemachten Schlange zu betrachten, heißt begreifen, dass die Unfreiheit nicht länger eine Verlockung ist. Wer sich das vor Augen führt, wer sich dessen bewusst wird, was verspielte Freiheit ist, der wird geheilt.
Audrücklich erwähnt Veerkamp in diesem Zusammenhang die von mir oben zitierte Deutung von Wengst (W118), das Zeichen der Schlange verweise „auf Gott als den alleinigen und wirklichen Retter“ bzw. auf „den gekreuzigten Jesus als Zeichen…, das auf Gott weist. Sich an dieses Zeichen zu halten und ihm zu folgen, heißt: das Herz dem Vater im Himmel unterwerfen“. Dafür hat Veerkamp nur beißende Kritik übrig:
Solche klassischen Formeln christlicher Orthodoxie verfehlen den Sinn des Midrasch. Was ist denn „Gott“ anders als der, der sich in Israel nur als „der aus dem Sklavenhaus hinausführende“ benennt. Einen anderen NAMEN hat er nicht. Israel, soviel meint Johannes zu wissen, befindet sich heute im Sklavenhaus Roms. Zu dem von den Römern, von denen, die Israel in ihrem weltweiten Sklavenhaus halten, hingerichteten, ans Folterinstrument Kreuz „gehefteten“ bar enosch, MENSCHEN, muss Israel hinaufblicken, um sich bewusst zu machen, was mit ihm wirklich geschieht. Das „Bild der kupfernen Schlange“, das „Kreuz“, ist drastische politische Schulung. Von den christentümlichen Kreuzidyllen ist noch kein Mensch besser, geschweige denn „heil“, geworden.
Ich gebe zu, dass mich diese Interpretation, als ich sie zum ersten Mal las, schwer zum Schlucken gebracht hat. Soll denn alles, was wir als Christen traditionell mit dem Kreuz Jesu verbinden, falsch sein? Und ist es wirklich berechtigt, all das, was am Karfreitag in christlichen Kirchen gefeiert wird und worüber in zahllosen Predigten nachgedacht wird, mit dem Stichwort „Kreuzidyllen“ abzutun? Das kann und will ich nicht behaupten. Aber zugleich plädiere ich dafür, nicht vorschnell Veerkamps politische Auslegung insgesamt zu verwerfen. Denn Johannes als jüdischer Messianist war sicher noch kein christlicher Dogmatiker, und es ist zu bezweifeln, dass er das ewige Lebens als Vertröstung auf das Jenseits verstehen wollte. Hören wir daher weiter Veerkamp zu, wie er uns die befreiungspolitische Botschaft des Johannes nahezubringen versucht:
Johannes verfremdet den bar enosch {Menschensohn} Daniels in ein zu Tode gefoltertes, elend zu Grund gehendes Menschenkind. Der hohe Repräsentant Roms führt den gedemütigten, der Lächerlichkeit preisgegebenen Jesus ben Joseph aus Nazareth dem Volk vor: „Da, der MENSCH“ – bar enosch – so sieht der Mensch aus, wenn er in unsere Hände fällt. Er scheint zunächst der absolute Gegensatz zu Daniels machtvoller Gestalt bar enosch zu sein. Was aber die Niederlage des Messias ist, das ist für Johannes der Ausgangspunkt für die Befreiung der Welt von der Ordnung, die auf ihr lastet. Die Verknüpfung von Daniel 7 mit Numeri 21 ist das Ende aller politischen Illusionen, die das zelotische Abenteuer suggeriert.
Eine politische Auslegung des Johannesevangeliums besteht nach Veerkamp also nicht darin, sich Jesus als Revolutionär mit einem Schwert oder Gewehr in der Hand vorzustellen, der den Aufstand gegen Rom anführt. Im Gegenteil. Seine Revolution wird mit den Waffen der agapē geführt werden, einer solidarischen Liebe, von der Johannes im nächsten Vers zum ersten Mal reden wird. Aber ist es nicht auch illusorisch, von der Niederlage des Messias am Kreuz und von Gottes „Liebe“ die Überwindung der tödlichen Strukturen der herrschenden Weltordnung zu erwarten? Dieser Frage müssen wir Christen uns stellen, selbst wenn wir keine Antwort wissen. Im Sinne des Johannes ist jedenfalls nicht die Flucht vor dieser Frage ins Jenseits:
Die Verfremdung von Daniel 7 löst eine Frage, um die nächste ungelöste – unlösbare? – Frage aufzurufen: Wie kann so eine befreite Welt entstehen? Die Christen, Nachfolger der Messianisten vom Schlage Johannes, machen aus dem Kreuz eine wahrhaft narrow escape aus dem irdischen Leben ins himmlische, nach dem Tod. „Apple pie in the sky, Life for you after you die“, verhöhnte der radikale Führer der Schwarzen in den USA, Malcolm X, die lähmende Welt der pietistischen Spirituals: Kampf dem Christentum, das aus dem Kreuz und seiner angeblichen Heilungskraft ein reines Placebo macht. Auf die Frage, wie aus der Niederlage ein Sieg werden kann, haben wir keine Antwort. Aber wir müssen sie stellen.
↑ Johannes 3,16: Die solidarische Liebe Gottes zur Welt im Sohn, dem Einziggezeugten
3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.
[28. April 2022] In Vers 16 wird (T213), wie die einleitenden Worte houtōs gar, „denn so“, zeigen, „der wahre Grund dafür“ genannt, „daß der ‚Sohn des Menschen‘ ans Kreuz erhöht werden muß.“ Dieser Grund besteht in „Gottes Liebe zum kosmos“, und die grammatische Form des griechischen Aorists ēgapēsen, „hat geliebt“, gibt Thyen zufolge
zu verstehen, daß hier nicht von Gottes Liebesgesinnung, sondern von seiner kontingenten Liebestat die Rede ist: hōste ton hyion ton monogenē edōken {dass er seinen einzigen Sohn gab}. … Mit V. 16 wird das für das gesamte Evangelium so überaus bezeichnende Lexem agapan {lieben} neu eingeführt und als Gegenstand dieses Liebens Gottes zugleich der kosmos {Welt} benannt.
Zum Stichwort agapan, gewöhnlich mit „lieben“ übersetzt, verweist Thyen darauf, dass „68 von insgesamt 143“ Stellen, wo es im Neuen Testament vorkommt, auf die johanneischen Schriften entfallen, davon 37 im Evangelium und 31 in den Johannesbriefen. „Auch dem Nomen agapē {Liebe} stehen in den Evangelien sieben joh Belegen nur je einer bei Mt und Lk gegenüber (hinzu kommen noch 21 Vorkommen von agapē in den JohBr…)“. In dasselbe Bedeutungsfeld rechnet Thyen „das dreizehnmalige Vorkommen von philein“, wörtlich „freundschaftlich verbunden sein“.
Abgesehen von diesen Hinweisen fehlt sowohl bei Thyen als auch bei Wengst jedes Wort der Erläuterung zur genauen Bedeutung des Wortfeldes agapan und agapē – außer dass Thyen die agapē als „kontingente Liebestat“ von „Gottes Liebesgesinnung“ abgrenzt. „Kontingent“ kann „zufällig“ bedeuten, ist philosophisch gesehen etwas, was möglich, aber nicht notwendig ist, also auf einer freien Entscheidung Gottes beruht. Beide scheinen vorauszusetzen, dass jeder weiß, was mit Liebe im Zusammenhang mit Gott und der Bibel gemeint ist, obwohl doch das Wort Liebe auch im Deutschen eine ungeheure Bandbreite an Bedeutungen haben kann. Es kann nüchterne Vorliebe und gefühlsmäßige Zuneigung bis zur heißen erotischen Liebe bezeichnen, für die Beziehung zu Kindern und Eltern, zum Ehepartner und zur Freundin, zum Nächsten und zu Gott verwendet werden und nicht zuletzt auch auf Tiere und sogar Gegenstände wie Lieblingsnahrungsmittel und Kleidungsstücke. <258>
Ton Veerkamp <259> zieht für „das Verb agapan … die Übersetzung „solidarisch sein mit“ vor und verweist zur Begründung auf eine frühere Arbeit, nämlich seine „Auslegung des ersten Johannesbriefes“. Es lohnt sich, außerordentlich weit auszuholen, um auf seine dortigen Überlegungen einzugehen, denn am Verständnis von agapē könnte sich die gesamte Interpretation des Johannesevangeliums entscheiden. Vorausgeschickt sei eine schlagwortartige Zusammenfassung seiner Auffassung, dass hier die Übersetzung „Solidarität“ und nicht „Liebe“ angemessen sein soll (V35):
Der erste Grund liegt in der fast absoluten Abnützung dieses Schlagerwortes. Aber wichtiger ist, daß „Liebe“ hier die falsche Kategorie ist. Ich bin der Ansicht, daß vor allem in den Texten der Johannesschule agapē nicht für das hebräische ahaba, sondern für das ebenfalls hebräische chessed steht. Es ist ein Grundwort der Theologie der ganzen Schrift.
Die Schwierigkeit, die richtige Bedeutungsnuance von agapan und agapē herauszufinden, beruht nach Veerkamp unter anderem darauf, dass die altgriechischen und hebräischen Wörter, die hier im Spiel sind, sehr unterschiedlich verwendet werden. Während das Griechische „verschiedene Wörter für drei verschiedene Stufen der Zuneigung“ kennt, nämlich agapan: „sich zufrieden geben, eine Vorliebe für etwas oder jemanden haben, also ein rechtes ‚cooles‘ Wort“, philein: „sich einem Menschen in Freundschaft zuwenden, aber oft auch küssen“, und eran: „lieben…; erasasthai, sich verlieben, heftig begehren, also die höchste Stufe der Emotionalität“, deckt das hebräische Wort ahab (also ähnlich wie das deutsche Wort „lieben“)
die ganze Bedeutungspalette der drei Verben ab. Die Übersetzer der LXX haben in etwa 80% der Fälle ahab mit agapan übersetzt. Dieses Verb kommt im Hohenlied vor, aber es taucht auch in einer sehr brutalen Szene auf: „Die Liebe (agapē), mit der Amnon sie [Tamar] geliebt hatte (ēgapēsen) …“ (2 Sam 13,15), eine Vergewaltigung! Im Lastwort „Mein Bote“ (Malachi) hören wir, 1,2f: „Ich habe Jaakob ,geliebt‘ und Esaw habe ich gehaßt.“
Aber wie kann Gott das eine Volk lieben und das andere hassen? „Paulus hatte diesen Satz in Röm 9,13 erklärt. Es handele sich um die Souveränität der Erwählung; der Grund der physischen Abstammung von Abraham und Jizchak spielte keine Rolle.“ Im 5. Buch Mose 7,7-8 findet sich dazu die Klarstellung (nach Luther 2017):
Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat.
An dieser Stelle, so Veerkamp, muss ahaba also tatsächlich
durch „Liebe“ übersetzt werden, weil nur so die Souveränität des Erwählungsaktes wiedergegeben werden kann. … Israel hat sich gefragt, warum wohl der NAME Israel zu seinem Bündnispartner gewählt hat; es findet keine andere Antwort als eben „Liebe“.
Israel wurde also nicht etwa erwählt,
weil es von sich aus ein „besonderes“ Volk gewesen wäre. Hellas oder Rom wären vielleicht „besonders“ leistungsfähige Völker, wenn überhaupt. „Besonders“ (ˀam segulla) war Israel nicht von sich aus, „besonders“ wurde es durch die Erwählung.
Mit diesem aus freier Liebe erwählten Volk hat Gott einen Bund geschlossen, das heißt, einen Vertrag mit klar geregelten Vertragsbedingungen. Gott als der sein Volk befreiende und ihm Recht schaffende NAME sichert ihm seine Treue zu, und das Volk verpflichtet sich daraufhin, die Gebote Gottes zu befolgen, ohne die das Volk nicht auf Dauer in Freiheit und Recht leben könnte. Wo von dieser Bundestreue Gottes die Rede ist, tritt neben die „Treue“ Gottes, emeth, in einer stehenden Redewendung nicht das Wort ahaba, das die freie Erwählung aus Liebe bezeichnet, sondern oft das Wort chessed, das mit „Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe“ übersetzt werden kann. Wie gibt (V36) die griechische Septuaginta (LXX) dieses Wort wieder?
Das Wort chessed wird in der LXX fast vollständig mit Begriffen umschrieben, die eine Zuneigung zu vor allem hilfsbedürftigen Personen andeutet. Meistens werden Wörter gebraucht, die vom griechischen Stamm eleē– (eleēmosynē z.B. bedeutet Mitleid) hergeleitet sind (vgl. unsere Verballhornung dieses Wortes in „Almosen“).
Dass „die LXX das Wort chessed nicht ein einziges Mal mit agapē übersetzt“, sieht Veerkamp durch „eine gewisse Einseitigkeit des Wortes“ begründet:
chessed als Zuneigung „von oben nach unten“. Aber das Wort hat auch eine „horizontale“ Dimension, ein gegenseitiges Verhältnis zwischen den Menschen.
Um dieses Verhältnis auf Gegenseitigkeit so klar wie möglich zu bezeichnen, bietet sich nach Veerkamp das „moderne Wort Solidarität“ an. Es
stammt aus der französischen Jurisprudenz des 17. und 18. Jh.s und bedeutet die Eigenschaft einer Solidargemeinschaft, die gesamtschuldnerisch haftet für die Schulden eines Mitglieds dieser Gemeinschaft. Alle Mitglieder der Solidargemeinschaft „Krankenversicherungsgesellschaft“ haften gesamtschuldnerisch für die Schulden, die einem Mitglied durch einen genau festgelegten Krankheitsfall (Versicherungsfall) entstehen, sie werden also von allen Mitgliedern gemeinsam gezahlt. In der Arbeiterbewegung erhält das Wort eine besondere Bedeutung. Entstanden ist diese neue Bedeutung durch die gemeinsame Verpflichtung, einzelne Mitglieder einer Gruppe von Arbeitern zu unterstützen, wenn im Fall eines Streites (Streik, Aussperrung usw.) diesen Mitgliedern Schäden entstehen. Die Gewerkschaft ist eine solche Solidargemeinschaft. Der Zusammenschluß und der Zusammenhalt von arbeitenden Menschen wird nicht nur durch die Abwendung oder Abfederung von bestimmten Schäden, sondern durch das Ziel des gemeinsamen Kampfes gegen die Verursacher solcher Schäden und für eine neue Gesellschaft bestimmt. Solidarität wird somit zu einem sozialen Kampfbegriff.
Wem es zu weit geht, den biblischen Begriff agapē als politischen Kampfbegriff zu definieren, sollte bedenken, wie hart die Propheten mit denjenigen ins Gericht gehen, die Rechtlose unterdrücken, und wie klar Gott seine Solidarität mit den Elenden und Armen ausspricht. Wo es um die „Haltung der Menschen in Israel zueinander“ geht, steht Veerkamps Einschätzung der agapē mit dem Konzept im Einklang, das wir aus 3. Mose 19,18 (wo die LXX ahab mit agapan übersetzt) als das Gebot der Nächstenliebe kennen:
Spätestens hier ist „Liebe“ nicht angebracht; die Menschen erwählen sich nicht. Sicherlich gibt es unter Menschen „Erwählungsakte“; Liebe ist ein sehr spezielles Verhältnis zwischen zwei Menschen. Geliebte lieben Geliebte und andere Menschen eben nicht; sie können Freundschaft für sie empfinden, aber auch das gilt einer beschränkten Zahl von Mitmenschen. Solidarität ist aber jedem Menschen gegenüber möglich, auch wenn man Gefühle von Antipathie empfindet. Niemand ist verpflichtet, oder auch nur in der Lage, mit allen Menschen „Freund“ zu sein, gar sie zu „lieben“. Aber solidarisch sein kann man mit allen Menschen, mit denen man eine gemeinsame Sache vertritt.
Nun mag man sich fragen, ob es nicht anachronistisch ist, den modernen Begriff der Solidarität auf die Welt der Bibel zu übertragen. Ich denke, man muss sich der damit verbundenen Gefahren bewusst bleiben, aber zugleich auch bedenken, ob nicht auch andere Übersetzungsmöglichkeiten die ursprüngliche Aussageabsicht eines Wortes wie chessed verfälschen könnten. Wenn zum Beispiel (V35) Martin Buber „dieses Wort immer mit Huld“ übersetzt und dabei weiß, dass es „ein Wort aus der Sphäre des Feudalismus“ ist, also aus der mittelalterlichen Welt von Lehnsherrschaft und Vasallentum, mag man ebenfalls bezweifeln, ob ein solches Verständnis das Verhältnis von Gott und seinem Volk angemessen wiedergibt.
Dasselbe gilt für die Übersetzung von chessed mit „Gnade“ oder „Barmherzigkeit“ dort, wo es um die Bündnistreue innerhalb des Bundes zwischen Gott und Israel geht: Wenn die menschlichen Vertragspartner sich an die Bedingungen des Bundes mit Gott halten, sieht sich auch Gott an die Vertragsbedingungen gebunden. Das ist unter diesen Umständen also gerade keine herablassende Gunst, keine von seiner Willkür abhängige „Gnade“ oder „Barmherzigkeit“, sondern sie dürfen sich dieser chessed gewiss sein, was man durchaus mit Gottes „Solidarität“ umschreiben kann.
Bisher habe ich erklärt, dass Veerkamp für die jüdischen Schriften ahaba, „Liebe“, als eine „Kategorie der Erwählung“ und chessed, „Solidarität“, als „eine Kategorie des Bundes“ unterscheidet. Wie kommt er aber nun darauf, dass der Evangelist Johannes mit dem griechischen Wort agapē nicht das hebräische Wort ahaba, sondern chessed im Sinne einer solidarischen Verbundenheit auf Gegenseitigkeit aufgreift, obwohl die LXX selbst es nirgends so übersetzt? <260>
Seine Begründung geht davon aus (V36), dass die synoptischen Evangelien und die apostolischen Schriften das Wort chessed zwar genau so umschreiben wie die LXX, nämlich unter Rückgriff auf das Wortfeld eleēmosynē, „Mitleid“:
Aber in den Texten der Johannesschule fehlen diese griechischen Umschreibungen gänzlich, bis auf die einzige Ausnahme 2 Joh 3. Es kann nicht sein, daß in einer jüdischen Schrift aus jenen Tagen das biblische Grundwort chessed unbekannt sein sollte. Aus diesem Grund bedeutet agapē als Platzhalter für chessed Solidarität. … Johannes will ein Wort, durch das klar wird, daß die chessed „Gottes“ (die Vertikale) die chessed zwischen den Menschen (die Horizontale) begründet und beständig macht. Das ist eine eminent theologische Entscheidung. Deswegen bietet sich das moderne Wort Solidarität als am ehesten geeignet an.
Konkret untermauert Veerkamp diese Behauptung mit seiner Auslegung einiger Verse des 1. Johannesbriefes (V33):
2,3 Und darin erkennen wir,
daß „wir Ihn erkannt haben“:
wenn wir Seine Gebote wahren.
2,4 Der sagt: „ich habe Ihn erkannt“,
und die Gebote nicht wahrt,
der ist ein Betrüger, und in so einem ist keine Treue.
2,5 Wer aber Seine Rede wahrt,
in dem kommt die Solidarität „Gottes“ zum Ziel,
darin erkennen wir, daß wir mit Ihm sind.
In 2,3 wird von der Erkenntnis Gottes, genauer gesagt, des Gottes Israels, des NAMENs, gesagt, dass sie in einer Praxis besteht, nämlich im Wahren, Halten oder Tun, tērein, seiner Gebote, entolais, bzw. seines Wortes, logos (V33f.): „Wir erkennen IHN, indem wir Seine Gebote wahren, indem unsere Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Raub und Mord und Verluderung wäre.“ Gott bzw. seinen NAMEN zu erkennen läuft also auf das hinaus, was er selbst nach Jeremia 22,15-16 über den König Josia sagt (V34), „er tat Recht und Wahrheit, und das war gut“, er half als „Rechtsbeistand im Gericht dem Unterdrückten und Bedürftigen, und das war gut: Wäre das nicht MICH erkennen?, spricht der NAME.“
Daraus ziehen die folgenden Verse 2,4-5 zwei Schlussfolgerungen, nämlich erstens im Blick auf den, der die Tora verfehlt, und zweitens den, der sie wahrt. Im letzteren Vers erfolgt die Definition des Wortes agapē, auf die es Veerkamp ankommt:
„Wer also sagt: ,ich habe IHN erkannt, und ich wahre die Gebote nicht“, ist ein Betrüger“. Hinzugefügt wird: „und die Treue wäre nicht in ihm.“ … Verfehlung heißt, die Gebote, die Tora, nicht wahren. Das führt zum nächsten Satz, der positiven Umkehrung des negativen Vorsatzes:
Wer aber Seine Rede wahrt
in dem kommt getreu {alēthōs} die Solidarität {agapē} „Gottes“ zum Ziel
darin erkennen wir, daß wir mit ihm sind.
Indem Veerkamp die drei Zeilen von Vers 5 als „Bedingungssatz“ sowie „Folgesatz 1“ und „Folgesatz 2“ markiert, stellt er heraus, dass das Wort agapē hier klar und deutlich in den Kategorien des Bundes definiert ist (V34f.):
Jemand, der die Gebote nicht wahrt, bricht den Bund und er verletzt die Treue tödlich. Im Bund verhält sich der NAME zum Bundesgenossen Israel als vollkommen getreu solidarisch. Diese Treue (emeth, alētheia) verwirklicht sich als Solidarität (ahaba <261>, agapē). Das geschieht aber nur, wenn der Bundesgenosse kein Betrüger ist und also untreu wäre („die Treue wäre nicht in ihm“). So bleibt der NAME zwar getreu, aber er kann mit dem treulosen Bundesgenossen nicht solidarisch sein.
Abgesehen davon, dass uns dieser Gedankengang in Erinnerung bleiben sollte, um im Evangelium des Johannes den Vers 3,18 angemessen auslegen zu können, belegen diese Verse im 1. Johannesbrief, dass im johanneischen Schrifttum zumindest dort das Wort agapē als eine Kategorie des Bundes verstanden wird.
Aber trifft das auch für das Evangelium des Johannes zu? Kann das Wort agapē in Johannes 3,16 im Rahmen des Bundes Gottes mit Israel verstanden werden, wenn Johannes doch ausdrücklich von der agapē Gottes zum kosmos spricht? Ist die Verwendung des Wortes kosmos nicht geradezu ein Erweis dafür, dass sich agapē hier gerade nicht nur auf Israel, sondern im Sinne einer zusätzlichen (oder sogar ersatzweisen) Erwählung auf die gesamte Menschenwelt aller Völker bezieht?
Von einer solchen Sicht der Dinge (teils mit und teils ohne eine Lehre der Enterbung Israels) scheinen so gut wie alle christlichen Exegeten auszugehen: Trotz der Sünde der Welt, die Jesus als das Lamm Gottes wegträgt (1,29), wendet sich Gott in Jesus vergebend der Welt zu und erwählt jeden Menschen zum ewigen Leben. Einzige Bedingung dafür ist der Glaube an Jesus, der wiederum eins ist mit dem Glauben an den Gott, der ihn gesandt hat und mit dem er eins ist. So sehen das offenbar auch Thyen und Wengst, denen ich mich noch einmal zuwende, bevor ich schließlich auf das eingehen werde, was Veerkamp konkret zu Johannes 3,16 zu sagen hat. Wie Thyen (T213) die Liebestat Gottes, deren Gegenstand die Welt ist, sicher im Sinne einer Erwählung aller glaubenden Menschen der Welt versteht, so wird Wengst zufolge (W119) in Vers 16 „die Hingabe des Sohnes, womit der ganze Weg Jesu in der Niedrigkeit im Blick ist, als Akt der Liebe Gottes zur Welt beschrieben“:
Die gedanklichen Zusammenhänge, die bei der Formulierung, dass Gott seinen Sohn gegeben habe, wachgerufen werden, lassen in erster Linie an seinen Tod denken. Die Fortsetzung stellt dieses Geben in den weiteren Horizont der Sendung, sodass an den Weg Jesu im Ganzen gedacht sein dürfte, wie er im Evangelium erzählt wird. Dessen Zielpunkt ist das Kreuz; darauf wird er von vornherein ausgerichtet. Dieser Weg gilt als Folge der Liebe Gottes zur Welt. Das aber heißt, dass er mit seinem Ziel eine Funktion für die Welt hat, nämlich die, ihr Gottes Liebe zu vermitteln.
Wengst macht, wie gesagt, nicht ausdrücklich deutlich, was er mit dieser Liebe meint, aber er setzt voraus, dass Johannes hier nicht von Gottes bleibender Bundestreue und Solidarität gegenüber Israel spricht, sondern von Gottes Liebe zur Welt im Sinne einer Hinzu-Erwählung zum bisherigen Volk Gottes.
Etwas naiv klingt der folgende Satz, in dem Wengst von der Welt sagt (W119f.):
Sie lässt sich diese Liebe gefallen, indem sie glaubt, indem sie im Blick auf Jesus Gott vertraut. So kann der Weg Jesu verstanden werden als vertrauensbildende Maßnahme Gottes gegenüber der Welt.
Das ist nicht falsch, insofern es auf diejenigen aus oder in der Welt bezogen ist, die auf Jesus bzw. Gott vertrauen. Aber in dieser Verallgemeinerung muss doch gefragt werden, ob Wengst hier den Widerstand dessen, was Johannes mit kosmos bezeichnet, gegen die „vertrauensbildende Maßnahme Gottes“ nicht doch verharmlost.
Thyen erinnert zum Begriff des kosmos daran, dass dieses Wort „in unserem Evangelium, je nach dem Aspekt, unter dem es gebraucht wird, höchst ambivalent ist“, und zitiert zustimmend Rudolf Bultmanns <262> Resümee seines Bedeutungsspektrums:
„Eben deshalb ist der kosmos beides: Gegenstand der Liebe Gottes (3,16) und Empfänger der Offenbarung (4,42; 6,33; 12,47) wie die lügnerische Macht, die sich gegen Gott empört (14,30; 16,11), die verworfen wird (12,31; 17,9). Beides konstituiert zusammen den kosmos-Begriff, und man darf nicht bei Joh zwei verschiedene kosmos-Begriffe unterscheiden“.
Für die Liebe Gottes zum kosmos weist Thyen auf eine Parallele im Buch der Weisheit Salomos hin (11,23-24), auf die Klaus Berger <263> aufmerksam gemacht hat (nach Luther 2017):
Aber du erbarmst dich über alle, denn du kannst alles und du siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren sollen. Denn du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Denn du hast ja nichts bereitet, gegen das du Hass gehabt hättest.
Dazu Thyen:
Die Analogie ist deshalb so nahe, weil hier Gottes Verhältnis zu „seiner Welt“ (ˁolamo ist stehende Redeweise bei den Rabbinen…) als seine Liebe zu seiner Schöpfung gepriesen wird. Das ist, soweit wir sehen, nur hier und in Joh 3,16 der Fall.
Zu bedenken ist allerdings, dass in Weisheit 11,24 nicht wörtlich von der Liebe Gottes zum kosmos die Rede ist, stattdessen von der Liebe zu „allem, was ist“, ta onta panta. Außer Acht bleibt bei Thyen auch der Unterschied zwischen dem hellenistisch-römischen kosmos-Begriff im Sinne einer räumlich verstandenen (angeblich) schmuckvollen Ordnung und dem rabbinisch-jüdischen Begriff des ˁolam als einer zeitlich verstandenen Abfolge verschiedener Äonen oder Weltzeiten.
Weiter zitiert Thyen Klaus Berger zum Rückbezug von Johannes 3,16 auf Weisheit 11,23-24 (T215f.):
„Glauben an den Sohn hat dieselbe Funktion wie ,Umkehr‘ in SapSal {Weisheit Salomos}; man könnte sogar annehmen, daß die Verbindung von ,Sohn‘ und ,glauben‘ bei Joh inhaltlich die Aussagen über Umkehr und Sündenvergebung ‚ersetzt‘.“
Dieser Gedanke wird Thyen zufolge (T216) durch „das Spiel mit der Wüstenepisode von Num 21 in V. 14“ bestätigt, denn „das ,Aufsehen‘ auf die ,eherne Schlange‘“ hatte ja tatsächlich „dem wegen seiner Sünde von den tödlichen Schlangenbissen heimgesuchten Volk einst das Leben gegeben.“ In diesem Zusammenhang spricht Thyen davon, dass die „Alten … in Joh 3,16 so etwas wie ‚das Evangelium im Evangelium‘ gesehen“ haben.
Schließlich zitiert Thyen noch eine letzte Beobachtung von Klaus Berger:
„Die Übereinstimmung in den universalistischen Aussagen (alles, was ist; jeder, der glaubt) ist ein weiteres Argument dagegen, daß es sich im JohEv um eine ,insider-group‘ handelt …, denn hier ist erkennbar, daß der universalistische Zug nicht zufällig ist, sondern traditionsinhärent und mit dem Schöpfungsglauben selbst verbunden“.
Im Blick auf die universalistischen Aussagen hat Berger Recht; lässt sich daraus aber der zwingende Schluss ziehen, die johanneische Gemeinde sei keine insider-group gewesen? Und ist die Schlussfolgerung zulässig, das Johannesevangelium müsse sich über Israel hinaus an die Völkerwelt als seinen Hauptadressaten richten? Eine solche Interpretation von Johannes 3,16 formuliert Klaus Wengst ausdrücklich (W120):
Der Weg Jesu mit seinem Ende am Kreuz ist äußerst partikular. Doch weil er der Liebe Gottes zur Welt entspringt, zielt er auf größte Weite. Wir können diesen Vers heute so lesen: Durch diesen Weg Jesu findet die – nichtjüdische – Welt zum Gott Israels; und indem sie so von Gott gefunden ist, geht sie nicht verloren.
Ich würde eine solche Verstehensweise für uns Christen aus den Völkern nicht grundsätzlich ablehnen. Aber ich denke, dass es noch nicht die Interpretation des Johannes war und erst recht nicht diejenige der Weisheit Salomos. Schon für die Tora und die Propheten gilt das Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer der gesamten Welt, und trotzdem steht Israel als das auserwählte Gottesvolk im Zentrum des befreienden und Recht schaffenden Handelns Gottes. Und das bleibt auch im Buch der Weisheit so, wie dessen letzter Vers unmissverständlich deutlich macht (Weisheit 19,22):
Herr, du hast dein Volk in allem groß und herrlich gemacht und hast es nicht verachtet, sondern ihm allezeit und an allen Orten beigestanden.
Dass unter den Bedingungen des Hellenismus und der Pax Romana sowohl Propheten als auch Apokalyptiker, Weisheitslehrer und Messianisten des Judentums ihren Blick so stark auf die Welt im Ganzen richten, sollte vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass im Unterschied zur Zeit des Exodus aus dem ägyptischen Sklavenhaus die Befreiung für Israel nicht mehr möglich ist, wenn nicht der gesamte kosmos von der unterdrückenden Ordnung befreit wird, die auf ihm lastet.
Recht zu geben ist Thyen (T216) all jenen Exegeten gegenüber, die die Liebe Gottes zum kosmos deswegen aus dem Johannesevangelium wegerklären wollen, weil „der kosmos bei Joh durchweg negativ qualifiziert sei“. Seine eingehenden Auseinandersetzungen (T217f.) mit Autorinnen und Autoren, die das Johannesevangelium durch unterschiedliche Formen eines gnostischen Dualismus geprägt sehen, gipfeln in dem Fazit, dass man (T218) dem Johannesevangelium Unrecht tut, wenn man ihm unterstellt, dass sich „die Liebe Gottes zum kosmos nur noch in der Sammlung der ohnehin schon Erwählten für die himmlische Welt auswirken kann“. <264>
Auch Wengst wendet sich dagegen (W120), „die Aussage von V. 16, dass Gott in der Gabe des Sohnes die Welt geliebt hat, in ihrer Bedeutung für das Johannesevangelium herunterzuspielen, indem man sie einmal als singulär behauptete und zum anderen als aufgenommene Tradition erklärte.“ Zwar mag Johannes Tradition aufgenommen haben, aber die
möglicherweise im Hintergrund stehenden rekonstruierbaren Formeln enthalten jedoch nicht das Motiv von der Liebe Gottes zur Welt. Das ist eine Eigentümlichkeit von Joh 3,16 und darum mit aller Wahrscheinlichkeit dem Evangelisten zuzuschreiben. Er stellt damit betont heraus, dass sich Gottes Heilswille auf die Welt richtet. Die Bedeutung dieser Aussage, dass Gott die Welt geliebt hat, lässt sich also nicht durch den Hinweis mindern, dass hier Tradition aufgenommen wurde.
Im Großen und Ganzen sind sich Wengst und Thyen also einig darin, Johannes 3,16 als den Ausdruck der göttlichen Liebe zur gesamten Menschenwelt anzusehen, die im Glauben an Jesus die Chance bekommt, der ewigen Verdammnis zu entrinnen.
Ton Veerkamp <265> verfolgt demgegenüber weiter seine politische Lektüre des Johannes, indem er Jesu Kreuzigung in dessen zeitgeschichtlichen Hintergrund einordnet und die Aussagen von Johannes 3,16 im Sinne eines komplexen Midrasch zu verschiedenen Texten des TeNaK auf diese Situation hin ausdeutet. Er beginnt mit der Ungeheuerlichkeit der Vorstellung, dass die Erhöhung des Menschensohns darin bestehen soll, dass er gekreuzigt wird. Uns ist das Kreuz Jesu als religiöses Symbol schon so vertraut, dass uns kaum noch auffällt, wovon da wirklich die Rede ist:
Johannes setzt hier noch einen drauf, er reibt Salz in offene Wunden. Wie kann ein Gott „lieben“, wenn er seinen Sohn – seinen Einzigen, monogenēs – so zum Spielball römischer Soldateska werden lässt? Denn Jesus erfährt an Leib und Seele, was das Volk im und nach dem judäischen Krieg erfahren muss. Israel fragt sich in jener katastrophalen Zeit der messianischen Kriege gegen Rom zwischen 66 und 135 u.Z., ob und wie sein Gott, der Gott der Befreiungen aus jedem Sklavenhaus, mit Israel noch solidarisch ist.
Obwohl hier also davon die Rede ist, dass Gottes agapan sich auf den kosmos bezieht, geht Veerkamp davon aus, dass Johannes hier die Frage stellt:
Wie kann Israels Gott mit Israel solidarisch sein? Johannes antwortet mit drei Sätzen:
(1) Denn so hat sich Gott solidarisch mit der Welt gezeigt,
(2) dass er den SOHN, den Einziggezeugten, gab,
(3) damit jeder, der ihm vertraut, nicht zugrunde geht,
sondern Leben in der kommenden Weltzeit erhält.
Zum ersten dieser Sätze weist Veerkamp darauf hin, dass die johanneische Rede vom kosmos die „Schöpfungserzählung“ voraussetzt:
Die Welt, der Lebensraum für die Menschen, wird nur durch die Tora (Wort Gottes) zum Werk Gottes, denn nur die Tora ordnet den Lebensraum. Ein Grieche würde den geordneten Lebensraum kosmos nennen.
Aber wie wird nach der Tora der kosmos, womit im ersten Satz auf „den materiellen und sozialen Lebensraum der Menschen“ geschaut wird, zu dem, was die Tora „Schöpfung“ nennt?
Die Tora erzählt, wie Israel zum erstgeborenen aller Völker wird, wie es aus dem Sklavenhaus befreit wird und die Disziplin der Freiheit in der Wüste lernen musste, damit es im Land der Freiheit das Leben der befreiten Sklaven führen kann.
Das Problem, vor das sich Johannes genau wie viele andere Juden seiner Zeit, insbesondere diejenigen, die dem Messias Jesus nachfolgen, gestellt sieht, formuliert Veerkamp folgendermaßen:
Genau diese Toraordnung des Lebensraumes der Menschen in Judäa gibt es nicht mehr und kann es unter den weltweiten Ordnungen Roms auch nicht mehr geben. Hier wird „Welt“ als „herrschende Weltordnung“ zu einer negativen Vorstellung.
Aber trotz dieser Verkehrung der Welt, die durch Gottes Tora geordnet sein sollte, in ein weltweites Sklavenhaus, gilt ihr Gottes Solidarität, denn nur auf diese Weise kann der Gott Israels auch mit seinem Volk Israel solidarisch bleiben. Ohne eine Befreiung der Welt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, kann auch Israel keine Befreiung erfahren; ein Auszug in ein anderes Land wie damals aus Ägypten kann keine Perspektive mehr sein, ebensowenig ein Sieg über Rom mit den Mitteln Roms, wie ihn die Zeloten erstrebten. Die einzige Perspektive ist eine Überwindung der tödlichen Grundstrukturen der Weltordnung selbst, und diese sieht Johannes ermöglicht eben in der agapē, der Solidarität Gottes mit der Welt, die wiederum machtvoll genug ist, dass Jesus seine Schülerinnen und Schüler mit ihr ausstattet, als Grundlage einer weltüberwindenden Praxis:
Durch das mandatum novum, das neue Gebot der Solidarität (13,34), wird die Welt so geordnet, dass Gott mit ihr solidarisch sein kann.
… Solidarisch ist der Gott Israels mit der Welt, indem er sie von der Ordnung, die auf ihr lastet, befreit.
Dieser grundsätzlichen Solidaritätsbekundung Gottes mit der Welt folgt nun im zweiten Satz von Vers 16 die Antwort auf die Frage:
Wie übt der Gott Israels seine Solidarität mit der Welt als Lebensraum für die Menschen aus?
Johannes antwortet darauf wieder mit einem Midrasch, und zwar „über die ‚Bindung Isaaks, des Einzigen‘, Genesis 22.“
Dass Johannes in der Formulierung ton hyion ton monogenē, „den Sohn, den einzigen“, die von Thyen (T214) im Anschluss an Lausberg so genannte „Isaak-typologische Wendung (Lausberg) vom monogenēs para patros {des Einziggeborenen oder -gezeugten beim Vater} aus dem Prolog“ (1,14) wieder aufnimmt, ist Thyen zufolge
insofern sachgemäß…, als sich ja die ,Fleischwerdung‘ des logos {Wortes} mit der Offenbarung seiner doxa {Herrlichkeit} erst in der ,Erhöhung‘ Jesu an das Kreuz von Golgatha und mit der „Hingabe seines Fleisches für das Leben des kosmos“ (6,51) als die „Erfüllung der Schrift“ vollendet (19,28-30).
Damit geht Thyen zwar indirekt darauf ein, dass im Hintergrund der Hingabe Jesu in den Kreuzestod die Erinnerung an die von Mose geforderte Hingabe des einzigen Sohnes Isaak steht, aber er überlegt mit keinem Wort, ob und inwiefern Jesus möglicherweise als zweiter Isaak bzw. Verkörperung des durch Isaak repräsentierten Volkes Israel zu verstehen sei.
Stattdessen fragt er sich nach Zusammenhängen mit dem paulinischen Vers Römer 8,32, der ebenfalls auf Isaaks Bindung anspielt und „von Gott sagt, er habe seinen eigenen Sohn nicht ,verschont‘, sondern ihn für uns alle ,dahingegeben‘ {paredōken}. … Daß Joh diesen paulinischen Vers kennt, ist durchaus möglich, schwerlich jedoch erweisbar.“ Anders als in Römer 8,32 und 4,25, den beiden einzigen Stellen im Neuen Testament, „wo Gott explizit als das Subjekt des paradidonai seines Sohnes erscheint“, also des Wortes, das sonst meist für das Aus- bzw. Überliefern Jesu durch Judas verwendet wird (T215), steht in Johannes 3,16 nicht das Wort paredōken „er übergab, er lieferte aus“, sondern edōken, „er gab“. Indem dieses Wort „im folgenden V. 17 durch apesteilen {hat gesandt} aufgenommen und interpretiert wird, dient es hier wohl der Bezeichnung von Jesu gesamter Sendung, die nach V. 14f freilich in seinem ,Erhöhtwerden‘ gipfelt.“
Thyen erwägt auch, ob Johannes vielleicht auch deswegen das Wort paredōken an dieser Stelle vermeidet, um „Gott nicht etwa als den ,Opferherrn‘ der blutigen Darbringung seines Sohnes erscheinen zu lassen.“ Denn der „ganzen, durch den Hellenismus geprägten, mediterranen Welt gilt jegliche Art eines ,Menschen-Opfers‘ als schlechthin verabscheuenswürdig“, auch dem Judentum. „Dagegen gilt aber das ,Selbstopfer‘ eines Menschen nicht nur als vorstellbar, sondern derartige Fälle werden oft als edle Vorbilder und Sühne schaffende Taten nachdrücklich beschworen“, und „diesen Gedanken des Selbstopfers Jesu“ bringt Johannes mehrfach zum Ausdruck (10,11.17f.; 15,13ff.; 18,2ff.).
Im Gegensatz zu solchen Überlegungen, die den Schrecken des in 3,16b uns vor Augen gestellten Bildes abmildern sollen, nimmt Veerkamp ernst, dass Johannes hier die Erzählung von 1. Mose 22 aufruft. „Dort wird von Abraham gefordert, seinen Sohn, ‚seinen Einzigen‘, als Opfer zu erheben.“ Und als Abraham ihm seinen Sohn, den Einzigen, nicht vorenthält, hindert ihn der „Bote des NAMENS“ am Opfer seines Sohnes:
Auf diesen Sohn hatte Abraham ein Leben lang gewartet; er ist seine Zukunft. Der Gott Abrahams muss Abraham in einer boshaft-drastischen Weise klar machen, dass dieser Isaak nicht der Sohn Abrahams, sondern der Sohn seines Gottes ist, des VATERS von Israel, dem Volk, das dazu bestimmt ist, Erstgeborenes unter den Völkern zu sein. Bleibt Isaak nicht am Leben, hat Abraham keine Zukunft. Er muss am Leben bleiben, aber nur als Gottes Sohn.
Genau diese Schriftstelle ruft Johannes mit „dem Wort monogenēs, jachid“, Veerkamp zufolge auf. Er denkt dabei nicht etwa bereits „an das Trinitätsdogma, Jesus als der ewige Sohn des VATERS, genitum non factum, ‚gezeugt, nicht gemacht‘.“ Es geht nicht um den einzigen oder eingeborenen Sohn Gottes, wie wir ihn im Glaubensbekenntnis bekennen, sondern um Jesus als die Verkörperung des erstgeborenen Sohnes Gottes (2. Mose 4,22), nämlich Israels bzw. dessen Vaters Isaak:
Johannes stellt hier Jesus vor als die Repräsentation Isaaks. Wie damals Isaak ist jetzt Jesus die Zukunft. Im hebräischen Text steht, dass Abraham seinen Sohn „erheben“ muss als Hebeopfer (haˁala le-ˁola). So weit kam es nicht; die Bindung Isaaks wird gelöst, die Schlachtung Isaaks unterbunden, weil Abraham nachweislich seinen Sohn nicht mehr als seine eigene, partikulare Zukunft sieht, sondern als die Zukunft „Gottes“ anerkennt. Die Solidarität Gottes mit Abraham zeigte sich damals in der Verhinderung der Opferung Isaaks. Bei Johannes muss der Gott Israels etwas tun, was von Abraham nie verlangt wurde. Hier wird Jesus/Isaak erhöht, blutig. Hier geht der Gott Israels den ganzen blutigen Weg mit der Welt der Menschen, weil es keinen anderen Weg gibt, um mit ihnen solidarisch zu sein.
Johannes verfremdet die Erzählung von der Bindung Isaaks. Führt die Zukunft Abrahams über die Lösung der Bindung Isaaks, so führt hier die Zukunft über die Schlachtung des Messias, so brutal muss man das Wort edōken, „hingegeben“, deuten. „Gott“ geht den ganzen blutigen Weg nach unten, weil die Weltordnung den Gott sozusagen zwingt, seinen Einzigen töten zu lassen.
Damit ist Thyen zwar darin Recht zu geben, dass Gott hier nicht selbst seinen Sohn opfert, etwa um in seiner stellvertretenden Bestrafung Genugtuung für seine gekränkte Ehre zu erlangen, aber auch in der freiwilligen Selbsthingabe des Sohnes, die das grausame Schicksal des Volkes Israel im Jüdischen Krieg und unter der römischen Versklavung widerspiegelt, beschreibt das Wort edōken, „er gab“, nichts weniger als die blutige Realität des Hebeopfers, das Abraham nicht vollziehen musste.
Welchen Sinn und Zweck soll aber ein solches Opfer haben? Auf diese Frage gibt der dritte Teil von Vers 16 eine Antwort. Wengst richtet in diesem Zusammenhang seine Aufmerksamkeit (W120) auf
zwei besondere Punkte. Einmal wird der Sohn jetzt nicht als Vermittler des Lebens genannt, sondern als Gegenstand des Glaubens bzw. Vertrauens. Das ist jedoch kein Glauben neben dem Glauben an Gott oder zusätzlich zu ihm, sondern Glauben an den Sohn ist immer zurückverwiesen an den Vater, der den Sohn gesandt bzw. gegeben hat.
Der andere Punkt ist der, dass „dem Haben des ewigen Lebens“ das verneinende Gegenteil vorangestellt wird, „nicht verloren zu gehen“. Damit wird nach Wengst die Vorstellung von Psalm 1,6 aufgegriffen, dass „der Weg der Frevler verloren“ geht:
Sie werden daher umherirren und sich im Nichts verlieren (vgl. Ps 37,20; 68,3), während „Gott den Weg der Gerechten kennt“, der damit nicht ziellos ist. Sich von Gott zu entfernen und damit verloren zu gehen, stellt Ps 73,27f. als Gutes entgegen, sich Gott zu nahen und bei ihm sich zu bergen. Solche biblischen Zusammenhänge dürften anklingen, wenn Johannes vom Verlorengehen spricht.
Veerkamp dagegen formuliert seine Antwort nicht religiös abstrakt, sondern politisch konkret:
Mit „damit“ (hina) fängt der dritte Satz an. Der Sinn ist, dass jeder, der vertraut, das Leben der kommenden Weltzeit erhält. Isaak, also Israel, hat Zukunft. Der kleine Vers Johannes 3,16 ist nichts anderes als der Versuch, mit der Niederlage Jesu im Jahr 30 und der Katastrophe für das ganze Volk im Jahr 70 fertig zu werden. Er will daran festhalten, dass die Ordnung der Welt keine Ordnung des Todes, sondern eine Ordnung des Lebens sein soll, sein kann, sein wird, sein muss. Mit der Schlachtung des Messias enden alle Hoffnungen, innerhalb der geltenden Ordnung einen Ort und somit eine Zukunft für Israel zu finden. Leben ist nur in der kommenden Weltzeit möglich. Vertrauen haben (pisteuein) trotz und wegen (!) der Schlachtung des Messias ist die Bedingung.
Kann eine solche Perspektive aber tatsächlich durchgehalten werden? Ist es überhaupt denkbar, dass Johannes ursprünglich eine solche konkrete Perspektive politisch vertreten hat? Die akademische Johannesauslegung scheint das ja für dermaßen unmöglich zu halten, dass eine solche Lektüre des Evangeliums nicht einmal erwogen wird. Und wenn es tatsächlich so war, dann dauerte es nicht lange, bis eine heidenchristlich dominierte Kirche die Erwartung der Zukunft Israels auf dieser Erde unter dem Himmel in eine Hoffnung auf das ewige Leben im jenseitigen Himmel umdeutete – aus dem Juden, die nicht an Jesus glauben wollten, jedoch ausgeschlossen blieben. Veerkamp beschreibt dieses Dilemma folgendermaßen:
War schon Genesis 22 eine Zumutung für alle Hörerinnen und Hörer des Wortes, so ist Johannes 3,16 erst recht unerträglich. Die zentrale politische These des Johannesevangeliums ist: nur durch die Niederlage dieses Einzigen ist Befreiung der Welt von der Ordnung, die auf ihr lastet, möglich. Diese These steht senkrecht auf allem, was als politische Strategie denkbar war – und ist. Die Strategie des Johannes ist Weltrevolution, auch wenn sie nicht auf der Tagesordnung steht. Genau das ist das Unpolitische an ihm, und genau das verleitet die Generationen nach ihm zur Verinnerlichung, zur Spiritualisierung, zur Entpolitisierung seines Messianismus.
Damit ist an uns die Frage gestellt, ob wir eine solche Verinnerlichung, Spiritualisierung, Entpolitisierung der Botschaft des Johannesevangeliums weiter mittragen wollen, indem wir ihre ursprünglich auf das Diesseits gerichteten Ziele der Befreiung Israels zum Leben der kommenden Weltzeit leugnen.
↑ Johannes 3,17-18: Statt Weltverdammung Befreiung durch Vertrauen auf den Namen des Sohnes
3,17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
dass er die Welt richte,
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.
3,18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,
denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
[30. April 2022] Verweilen wir zur Auslegung der nächsten Verse zunächst bei Ton Veerkamps <266> Einschätzung, es gehe Johannes tatsächlich um die Überwindung der Römischen Weltordnung durch den Messias Jesus, also um so etwas wie „Weltrevolution“. Dazu schreibt er im Blick auf Johannes 3,17:
Weltrevolution ist freilich nicht Weltverdammung. Johannes ist Kind seiner Zeit; er kennt die Weltverdammung der Gnosis. Weltverdammung wird hier zurückgewiesen. Wir haben es hier mit einem anti-gnostischen Text zu tun. Die Welt sei nicht zu richten, sondern zu befreien von der Weltordnung.
Hartwig Thyen dagegen (T218) legt Vers 17 jenseitsbezogen aus, indem er das Wort sōzein mit „erlösen“ übersetzt, statt in Betracht zu ziehen, dass es auch die Bedeutung „befreien“ haben kann. Mit einem Zitat von Karl Barth <267> stellt er heraus (T219), dass,
wie „die Sendung des Sohnes“ nach 3,14-17 „ganz unzweideutig auf die Errettung der Welt gerichtet (und) Lebensmitteilung und sonst nichts“ ist, so undialektisch ist auch „die Existenz des Glaubenden: ou krinetai {er wird nicht gerichtet}. „Das heißt nicht nur: die Entscheidung ist über ihn schon gefallen damit, daß er glaubt und das ewige Leben hat. Sondern: er ist als solcher der Möglichkeit einer Entscheidung, dem Bereich einer doppelten Möglichkeit überhaupt entrückt. Das Ja des Glaubens steht nicht neben, sondern schlechterdings über dem Nein“.
Mir sind diese steilen Thesen Barthscher Dogmatik durchaus vertraut und nach wie vor sympathisch; doch bezweifle ich mehr und mehr, ob bereits Johannes barthianisch gedacht hat.
Klaus Wengst fragt sich (W121), warum in unserem Text „überhaupt das Thema des Gerichts angesprochen“ wird, und er gibt die Antwort, dass mit dem
Titel Menschensohn … traditionell die Beauftragung Jesu zum endzeitlichen Gericht verbunden ist. Dieser Zusammenhang ist auch für Johannes gegeben. Er stellt ihn nicht in Frage, wie 5,27 zeigt. Er will keineswegs prinzipiell das Gericht verneinen, sondern es geht ihm… um die Herausstellung der Intention; und die ist nicht Richten, sondern Retten. Mit dem Wort „retten“ kennzeichnet er Jesus als Vermittler dessen, was er vorher mit „ewigem Leben“ und „Nicht-Verlorengehen“ benannt hat.
Dabei lässt Wengst unerwähnt, dass die traditionelle Verbindung Jesu als des Menschensohns mit dem Weltgericht, wie sie vor allem in Matthäus 25,31ff. erscheint, bereits auf das Buch Daniel (7,10.14.26) zurückgeht, worauf Veerkamp hinweist:
Jesus endet mit einer Erläuterung des Gerichtsverfahrens. Gemeint ist natürlich das Gerichtsverfahren aus der Vision Daniels: „Das Gericht setzt sich, Bücher werden geöffnet.“
Auch Thyen (T219) betont ohne einen ausdrücklichen Bezug auf Daniel, dass in den Versen 16-21 die Vorstellungen „der jüdisch-urchristlichen Eschatologie mit ihrer Erwartung des gerechten Gerichts Gottes über alle bösen Werke am Ende der Tage“ erscheinen, und er nimmt diese durchaus ernst gegenüber allen Exegeten, die meinen, Johannes habe eine solche angeblich naive jüdisch-christliche Lehre von den letzten Dingen vollständig preisgegeben „zugunsten einer rein präsentischen Eschatologie“, die der einzelne bereits in der Gegenwart erfährt – was auch immer damit konkret gemeint sein mag. Gegen alle „literarkritischen Amputationen“ des Textes, die das, was den Exegeten nicht passt, als nachträgliche Bearbeitungen aus dem Evangelium ausscheiden wollen, muss Thyen zufolge „jedenfalls für das überlieferte Evangelium gelten, daß im Gericht am Ende der Tage die Glaubenden freigesprochen, die Ungläubigen aber verdammt werden.“
Zwar ist der Sohn Gottes, wie Thyen mit Worten von Heinrich Julius Holtzmann <268> sagt, „sowenig gekommen, um zu richten, als die Sonne, um Schatten zu werfen“, aber: „Gleich dem Schatten ist das Gericht naturnothwendige Folge angesichts der Beschaffenheit und des Verhaltens des kosmos“. Daher stellen die im Perfekt stehenden und damit ein abgeschlossenes Geschehen bezeichnenden Verben „kekritai {ist gerichtet} und das als Indikativ hier regelwidrig durch mē anstelle von ou verneinte pepisteuken {hat nicht geglaubt} … als Folge des definitiven Bleibens im Unglauben die bleibende ,Verdammnis‘ heraus.“
Dass es hier um Freispruch und Verdammung im Blick auf ewiges Leben im Jenseits geht, begründet Thyen einerseits damit, dass Johannes in 12,25 „sehr wohl zwischen dem physischen (psychē) und dem ,ewigen Leben‘ zu unterscheiden weiß“, und andererseits mit 1. Johannes 2,28, wo von der parousia autou, „seinem Kommen“, die Rede ist. Aber, wie bereits gesagt, bezieht Johannes als messianischer Jude das ewige, äonische Leben, zōē aiōnios, wohl eher auf die kommende Weltzeit im Diesseits. Und für die Stelle im 1. Johannesbrief ist nicht einmal sicher, ob die dort bezeichnete parousia wirklich auf das Kommen Jesu zu beziehen ist oder nicht vielmehr auf ein Kommen Gottes, mit dem ebenfalls die Veränderung der Verhältnisse auf dieser Erde unter dem Himmel gemeint ist. Dazu schreibt Ton Veerkamp <269> in seiner bereits im vorigen Abschnitt zitierten Auslegung des 1. Johannesbriefs:
Das Offenbar-Werden des „Gottes“ Israels bedeutet, daß sich die Ordnungen des „Gottes“ siegreich durchsetzen, gegen eine herrschende Weltordnung, für eine kommende Weltordnung. … Das Judentum denkt bei der kommenden Weltzeit daran, daß die ursprüngliche Ordnung des „Gottes“ Israels die Revolution „Gottes“ der jetzt herrschenden Weltordnung sein wird. … Die Offenbarung des „Gottes“ Israels wird im letzten Wort dieses Satzes aufgegriffen durch das Wort parousia.
Das zugehörige Verb pareinai wird manchmal für das hebräische boˀ verwendet, kommen. Deswegen wird das Wort meistens durch die Ankunft, das Kommen (des Messias) wiedergegeben. Aber andere Stellen zielen mehr auf intensives Dasein ab. So heißt es in Psalm 139,8 : „Würde ich mich hinlegen im Gruftreich, Du bist da (hinnekha, parei)“.
Das Dasein ist Zukunft. Und diese Zukunft entwickelt sich nicht ganz gemächlich aus dem Heute, sondern sie bricht an, bricht durch. Das ganz Neue ist das, was immer sein wollte und sein sollte, aber nie sein konnte. Deswegen ist Parusie Anbruch, in dem dem „Gott“ Israels und seinen Ordnungen zum Durchbruch verholfen wird.
Geht man wie Veerkamp davon aus, dass auch das in Johannes 3 erwähnte Gericht mit dem Anbruch der Ordnungen Gottes zu tun hat, dann ergibt sich eine Einschätzung des in Johannes 3,18 erwähnten Gerichtet- oder Verurteiltseins der Nichtvertrauenden, das nicht auf ihre Verdammung im Jenseits, sondern auf ihre Verstrickung in die tödlichen Strukturen des Diesseits bezogen ist:
Wer kein Vertrauen darin hat, dass mit der Schlachtung des Messias alle Weltordnungsillusionen ein Ende finden, der ist gerichtet, das heißt, er ist zum Tode verurteilt, weil er an den Ordnungen des Todes festhält. Der Gegensatz ist das Vertrauen im NAMEN. Der NAME ist der „Gott“ Israels, und „der wie ein Mensch“ ist „der wie Gott“, der „Menschensohn“ ist der „Gottessohn“. Dieser Mensch ist in seinem ganzen Leben, in allem, was er tut und sagt und erleiden muss, „wie Gott“, wie der Gott Israels, der Befreier aus dem Sklavenhaus. Nur so kommt ein Ende an den Ordnungen Roms, an der Weltordnung des Todes. Wie steht auf einem anderen Blatt, es ist das zentrale Rätsel unseres Textes. Eine erste Andeutung kommt mit der Erläuterung des Gerichts. Wir hören, dass Vertrauen gleich Freispruch im Gericht ist.
Der Sohn Gottes ist also nicht gekommen, um die Welt als insgesamt böse zu verurteilen, sondern um sie von ihren tödlichen Strukturen zu befreien, was nur durch das Vertrauen auf den Sohn möglich ist; wer nicht auf den Sohn vertraut, bleibt daher der tödlichen Macht der herrschenden Weltordnung unterworfen.
Auch Klaus Wengst beschäftigt sich mit der Frage (W121), warum Jesus am Schluss seiner Rede als „Folge der liebenden Zuwendung Gottes zur Welt“ nun doch „von Richten und Gericht“ spricht:
Dem universalen Heilswillen Gottes steht faktisch nur eine partikulare Rettung gegenüber. Hier besteht offensichtlich eine spannungsvolle Differenz. Wie ist sie zu interpretieren?
Seine Lösung besteht darin, dass man keinesfalls „das Gegenüber von Glaubenden und Nicht-Glaubenden statisch“ verstehen darf (W121f.), weil man dadurch „die grundlegenden Aussagen des zweiten Teils als uneigentliche, missverständliche, gar nicht so gemeinte hinstellen“ würde. Johannes will Wengst zufolge also sagen (W122),
dass Gottes Wege mit der Welt noch nicht an ihr Ziel gekommen sind. Dann ist das Gegenüber von Glaubenden und Nicht-Glaubenden nicht statisch, dann sind die Feststellungen des dritten Teils Ausdruck des notwendigen Kampfgeschehens, in das die gesendete Gemeinde als Zeugin Gottes vor der Welt gestellt ist. Alles Gericht, alle Scheidung, die darin erfolgt, kann dann nur eine vorläufige sein, die in der Klammer steht, dass Gott die Welt in der Sendung und Hingabe des Sohnes geliebt hat, und unter der Verheißung, dass Gott die Welt retten will.
An dieser Stelle ist Thyen mit Wengst vollständig einig; er führt sogar wörtlich nach einer älteren Arbeit <270> seine von mir eben wiedergegebenen Zitate an und begreift (T223)
die besagte Differenz zwischen dem universalen Liebes- und Heilswillen Gottes und der ihm gegenüberstehenden faktischen Partikularität der Erwählung nur der Glaubenden sowie der Verwerfung der Nichtglaubenden als eine produktive Spannung…, in die der Erzähler seine Zuhörer absichtsvoll versetzt.
Daher wendet er sich auch dagegen (T224), diese Spannung etwa durch einen „prädestinatianisch akzentuierten Dualismus“ {Vorherbestimmung der einen zum Heil, der anderen zur Verdammnis} zu beseitigen, wie ihn Roland Bergmeier <271> vertreten hat. Dieser meint, dass alle, die
den Glauben … nicht als Leistung, sondern als unverdiente Gabe … empfangen haben, dazu von jeher ebenso prädestiniert gewesen sein sollen, wie die Masse der Übrigen dazu vorherbestimmt sein soll, diese Gabe und mit ihr das ewige Leben gar nicht empfangen zu können. „Der Evangelist denkt prädestinatianisch, entfaltet aber nicht eine den Gesetzen der Logik genügende Prädestinationslehre“. Man weiß hier nicht so recht, ob Bergmeier damit das Fehlen „einer den Gesetzen der Logik genügenden Prädestinationslehre“ beklagt oder begrüßt. Wir jedenfalls können es nur begrüßen, weil jede den „Gesetzen der Logik genügende Prädestinationslehre“ bloße Spekulation wäre und jenseits der wirklichen Situation des homo peccator coram deo {Mensch, der als Sünder vor Gott steht} stünde.
Damit lehnt Thyen nicht jegliche Form der Vorherbestimmung ab, aber jede Rede von Prädestination kann letztlich nur in einem menschlichen „Stammeln“ bestehen, die ernst nimmt, dass auch zuvor Erwählte wie Judas oder Petrus „abfallen können“:
Wie der Liebende die Geliebte nicht zur willkommenen Beute seines Liebeswerbens machen kann, sondern sich von ihr in Geiselhaft genommen, seit je erwählt und zur Verantwortung für sie berufen weiß, so weiß sich der Glaubende als Erwählter seit Grundlegung der Schöpfung. Und da er – Sünder, der er ist – sein Erwähltsein ja weder seinen Werken noch und schon gar nicht seinem Glauben verdanken kann, sondern allein der unverdienten Liebe Gottes, kann er natürlich auch umgekehrt den Unglauben seines Bruders, der ihm mit Haß begegnet, nicht zur Causa {Rechtsgrund} von Gottes Gericht erklären. So bleibt ihm als Glaubendem nur die Zuflucht zu dem – freilich auch in dieser Betroffenheit noch höchst problematischen – Stammeln von einer gemina praedestinatio {doppelten Vorherbestimmung}…
Die nicht auflösbare Spannung zwischen dem Willen Gottes, die Welt zu retten, und dem bereits Gerichtetsein derer, die nicht vertrauen, führt Thyen schließlich zu folgendem Fazit (T225):
Und wie Jesus Petrus von dem Makel seines Verleugnens heilt und erneut in seine Nachfolge beruft (21,15ff), so sendet er seine Jünger in eine Welt, die ihn ,haßt‘, und die auch ihnen mit gleichem Haß begegnen wird. Und er sendet sie nicht dazu, seine zuvor schon Erwählten zu sammeln, sondern die ,Hassenden‘ durch ihre in seiner Liebe gegründeten Liebe zu heilen, wie er das an Petrus und an ihnen allen getan hat.
Auch Wengst geht weiter auf die von ihm angesprochene Spannung ein und fragt (W122), was denn dazu nötigt, „jetzt überhaupt vom Gericht“ zu reden?
Das positive Ziel des „ewigen Lebens“, das sich schon in der Gegenwart niederschlägt, ist an den Glauben, an das rückhaltlose Vertrauen auf Gott gebunden. Aus ihm ergibt es sich sozusagen ganz von selbst. Solches Vertrauen erzwingt Gott nicht. Er ist kein Despot; er handelt nicht totalitär. Im Lichte des Weges Jesu versteht Johannes sein Handeln gegenüber der Welt als sich nach unten begebende Liebe. Es widerspricht der Liebe, Vertrauen zu erzwingen. Als die Welt Liebender tritt Gott ihr gegenüber gleichsam wieder einen Schritt zurück. Er drängt sich nicht auf. So gibt es ihm gegenüber die Möglichkeit der Verweigerung und also das faktische Sich-Verschließen vor seiner Wirklichkeit.
Hier erläutert Wengst das, was Thyen dogmatisch formuliert hatte, in seelsorgerlich dem einzelnen Menschen zugewandten Kategorien, auf die auch ich selber schon zurückgegriffen habe, um die Freiheit des Menschen zum Bösen bzw. zur Ablehnung der Liebe Gottes zu erklären. Trotzdem beschleicht mich mittlerweile ein Unbehagen bei den sich aus einer Verweigerung des Vertrauens gegenüber Jesus ergebenden Konsequenzen, wie Wengst sie schildert:
Es ist der unmögliche, aber naheliegende Versuch, sich außerhalb dieser Wirklichkeit zu stellen. Er ist unmöglich, weil es doch gegenüber dem die Welt liebenden Gott kein Außerhalb geben kann, sondern nur Flucht in eine Scheinwirklichkeit. Er ist naheliegend, weil es sich in dieser Scheinwirklichkeit, die nicht auf Gott rechnet, so trefflich einrichten lässt.
Wenn also das Leben im Schein, weil es kein wirkliches Leben ist, schon als Gericht verstanden wird, ist dieses sozusagen die Schattenseite der göttlichen Liebe, verursacht durch die Verweigerung ihr gegenüber.
Ist ein solches religiös fundiertes Gedankengebäude nicht letzten Endes fragwürdig, wenn nicht sogar verlogen? Gott soll kein Despot sein, er liebt die Welt, jeden einzelnen Menschen. Aber wenn einer dieser Menschen nicht an Jesus glaubt, wenn er etwa als Jude bezweifelt, dass Jesus der Messias Gottes ist, dann soll er daraufhin gerichtet sein, vom ewigen Leben ausgeschlossen und auf ewig verdammt sein? Ich hoffe, dass Wengst das nicht wirklich so meint, und bin gespannt darauf, wie er im weiteren Verlauf seiner Johannesauslegung mit dem Problem umgehen wird, dass tatsächlich die Mehrheit der Juden nicht bereit sein wird, auf Jesus zu vertrauen.
Verglichen damit ist Veerkamps Einschätzung des Gerichts in politischen Kategorien bodenständiger und meines Erachtens nachvollziehbarer: Es geht nicht um eine letztlich doch willkürliche göttliche Bestrafung von Menschen auf ewig, die den Glauben an einen bestimmten Menschen als den Sohn Gottes verweigern, sondern um die tödlichen Folgen der Verstrickung in die Todesstrukturen der herrschenden Weltordnung. So verstehen meines Erachtens schon die jüdischen Schriften das Gericht Gottes als notwendige Folge der Verfehlung des befreienden und Recht schaffenden Willens des NAMENS. Natürlich kann man auch dann fragen, ob eine solche politische Einschätzung angemessen ist, ob also die Propheten Recht damit hatten, das babylonische Exil als Folge der Abirrung Israels von der Tora Gottes als einer Disziplin der Freiheit und des Rechts für alle Entrechteten zu betrachten, oder ob Johannes in Jesus zu Recht die Verkörperung des NAMENS sieht, der in der Hingabe seines eigenen Lebens am römischen Kreuz eben die Weltordnung seiner Henker zu überwinden in der Lage ist. Aber ich wage es, gegen die Vorstellung einer ewigen Verdammnis für solche Menschen, die an den falschen Gott oder Messias glauben, das Vertrauen zu setzen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der aus Liebe sein Volk Israel erwählt hat und aus Solidarität mit Israel sogar die ganze Welt in diese Solidarität mit hineinnimmt, um sie von der Versklavung unter die böse Ordnung, die auf ihr lastet, zu befreien. Indem ich damit zugleich das Vertrauen verbinde, dass der Gott Israels zugleich barmherzig und gerecht ist, muss ich weder für mich noch für irgendjemand sonst befürchten, aus fragwürdigen Gründen mit ewiger Verdammnis bestraft zu werden.
↑ Johannes 3,19-21: Das Gerichtsverfahren des Lichts gegen die bösen Werke der Finsternis
3,19 Das ist aber das Gericht,
dass das Licht in die Welt gekommen ist,
und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht,
denn ihre Werke waren böse.
3,20 Wer Böses tut,
der hasst das Licht
und kommt nicht zu dem Licht,
damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
3,21 Wer aber die Wahrheit tut,
der kommt zu dem Licht,
damit offenbar wird,
dass seine Werke in Gott getan sind.
[1. Mai 2022] Im unmittelbaren Anschluss an seine von mir kritisch beleuchtete Deutung des Gerichtetseins der Nichtvertrauenden äußert Klaus Wengst selbst einen Einwand, der in die Richtung meiner Kritik geht (W122):
Aber bezieht sich Richten nicht immer auf Taten, wenn es denn nicht um Gesinnungsprüfung oder Überprüfung einer inneren Einstellung gehen soll – um Inquisition? Nachdem das Thema des Richtens eingeführt wurde, ist sofort auch von Taten die Rede.
Er nimmt darin keinesfalls „einen Gegensatz zwischen ‚Glauben und Werken‘“ wahr, sondern ihm zufolge geht es Johannes „um den unlösbaren Zusammenhang von Vertrauen auf Gott und davon bestimmtem Tun“, was „schon die Gliederung dieses Abschnitts“ zeigt. Nach der These von Vers 18, „dass die Vertrauenden nicht gerichtet werden, die Nicht-Vertrauenden schon gerichtet sind“, wird in den Versen 19-21 die Durchführung dieses Gerichts definiert, das heißt, es werden „den bösen Taten das Tun der Wahrheit und durch Gott gewirkte Taten entgegenstellt.“
Die bösen Taten der bereits Gerichteten werden Wengst zufolge durch Johannes „als Liebe zur Finsternis trotz und angesichts des Lichtes“ erläutert, wovon bereits (W123) „im Prolog in den V. 5.9-11“ die Rede gewesen war:
Die Aussage: „Ihre Taten nämlich waren böse“ begründet den Unglauben nicht in einer negativen moralischen Prädisposition, sondern benennt die konkrete Äußerung der Liebe zur Finsternis, des Gott verweigerten Vertrauens.
Gerade indem Wengst das Stichwort einer „negativen moralischen Prädisposition“ aufgreift, macht er deutlich, dass es Johannes ihm zufolge um das moralische Verhalten des Einzelnen geht, das zwar nicht auf einer unausweichlichen Veranlagung zum Bösen beruht, aber auf einer willentlichen Verweigerung des Vertrauens auf das Licht, das durch Jesus in die Welt gekommen ist.
Nicht ganz sicher bin ich mir, ob das folgende Zitat von Thomas Popp <272> zur Verdeutlichung seines eben von mir angeführten Satzes beiträgt (W123, Anm. 135):
„Bei aller Verschränkung von Tun und Sein wird allerdings zugleich zwischen Person und Werk differenziert. Ausdrücklich wird gesagt, dass die Werke und nicht die Menschen böse wären. Es bleibt ein Handlungsspielraum zum Beharren in der Gottesferne als dunkler Folie der durch Christus eröffneten Glaubensfreiheit“.
Unklar ist mir, worin der Unterschied zwischen Person und Werk bestehen soll. Ist einfach gemeint, dass Menschen nicht von vornherein als gut oder böse erschaffen sind, also zur Verantwortung für ihre Taten herangezogen werden können? Die weiteren Ausführungen von Wengst lassen erkennen, dass Menschen letztlich nicht auf Grund dessen, was sie tun, sondern was sie glauben, verurteilt werden (W123):
Die Verweigerung gegenüber der Liebe Gottes, das Nicht-Vertrauen auf ihn, äußert sich in bösen Taten. Sie sind Verleugnung Gottes, Götzendienst – und damit nicht wirkliches Leben, sondern verlorenes. Deshalb kann in ihnen selbst schon ein Aspekt des Gerichtes gesehen werden.
Ganz bewusst will Wengst (W123f.) diesen Text jedoch
aus drei Gründen nicht verabsolutieren, als wäre damit nun alles über das Gericht gesagt, was zu sagen ist. Einmal wird die Aussage vom endzeitlichen Richten Gottes bzw. Jesu als seines Beauftragten noch ausdrücklich im Johannesevangelium begegnen. Zum anderen ist es gewiss sinnvoll, verfehlendes und verfehltes Leben als verlorenes und damit schon gerichtetes zu charakterisieren. Aber darf das die einzige Aussage sein? Der Mörder ist schon durch die Tatsache seines Mordens gerichtet. Nichts weiter? Das könnte dem Mörder so passen!
Drittens schließlich gibt Wengst (W124) zu bedenken,
dass die Gegenüberstellung in V. 18-21 idealtypisch ist und so für das konkret gelebte Leben gar nicht zutrifft. Wer vertraut denn schon immer und zu jeder Zeit so unbedingt auf Gott, dass sich alle Taten als von Gott gewirkt erweisen, sodass von Gott her nichts zu richten gäbe? Von daher bekommen die V. 18-21 einen mahnenden Charakter.
Damit bestimmt er (W124, Anm. 140) das Verhältnis „der Teile V. 14-17 und V. 18-21 zueinander“ noch einmal neu:
Letzterer mahnt dazu, sich vorher zugesagte Liebe Gottes doch im konkreten Lebensvollzug gefallen zu lassen. Ein analoges Verhältnis liegt in mSan 10 <273> vor. Voran steht der Satz: „Ganz Israel hat teil an der kommenden Welt.“ Es folgt eine lange Aufzählung, welche Leute alle nicht daran teilhaben. Sie stellt den grundlegenden Anfangssatz nicht in Frage, sondern mahnt, die hier zugesagte Teilhabe doch nicht durch die aufgezählten Handlungsweisen zu verspielen.
Spannend ist nun, dass Wengst (W123) die Wendung „Wer die Wahrheit tut“, mit der die „vorher gebrachte positive These: ‚Wer auf ihn vertraut, wird nicht gerichtet‘ … aufgenommen“ wird, in Verbindung mit dem Gotteswort Hesekiel 18,1-9 bringt:
Mit „Tun der Wahrheit“ fasst Ez 18,9 den gesamten vorangehenden Kontext zusammen, der die Handlungen und Handlungsorientierungen des Gerechten aufzählt. Er hält sich an das von Gott Gebotene, sodass das zusammenfassende „Tun der Wahrheit“ auch als „Treue erweisen“ verstanden werden kann. Dieser Gerechte hat die Verheißung des Lebens.
Ich frage mich allerdings, ob es angemessen ist, das Tun dessen, der nach Hesekiel 18,5 „gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt“, lediglich als individualethische Handlungsanweisung zu verstehen, wenn er nach 18,7-8 einer sein soll,
der niemand bedrückt, der dem Schuldner sein Pfand zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten…
Diese Weisungen des NAMENS sind schon zur Zeit des Propheten Hesekiel an die Adresse der Wohlhabenden und Mächtigen gerichtet und können zur Zeit des Johannes als Anklage gegen die Unterdrückungsstrukturen der römischen Weltordnung gehört werden. Auf derartige politische Implikationen geht Wengst jedoch nicht ein; stattdessen greift er theologisch-dogmatisch auf die Hesekielstelle zurück:
Eine solche Gedankenverbindung lässt sich auch für Joh 3,18.21 herstellen: Die auf Gott vertrauen, auf seine Treue setzen, äußern dieses Vertrauen, indem sie ihrerseits Gott Treue erweisen im Tun des von ihm Gebotenen. Solches Tun scheut das Licht nicht. Die so handeln, stellen sich damit aber nicht selbst ins Licht, sondern geben zu erkennen, „dass ihre Taten durch Gott gewirkt sind“. Was sie tun, sind ihre Taten. Sie handeln und tragen dafür Verantwortung. Aber weil und solange sie auf Gott vertrauen, können sie gar nicht anders, als so zu handeln. Daher erweisen sich ihre Taten doch zugleich als durch Gott gewirkt und unterliegen daher nicht dem Gericht.
Hartwig Thyen (T220) sieht in „den nahezu definitorischen Worten autē de estin hē krisis, {darin aber besteht das Gericht}“ keinen Hinweis darauf, dass „hier das traditionell auf das ‚Jüngste Gericht‘ bezogene Lexem krisis im Sinne einer ,präsentischen Eschatologie‘ {endzeitliche Entscheidung bereits in der Gegenwart} redefiniert werden“ soll. Das in den Versen 17 und 18 beschriebene Richten und Gerichtetwerden will ihm zufolge überhaupt „nicht im formalen Sinn richterlicher Tätigkeit, sondern konkret als der richterliche Akt der ‚Verurteilung‘ begriffen sein“. Es soll also erklärt werden, „wie es zu dieser anscheinend definitiven Verurteilung und Verdammnis dessen hat kommen können, der den „Glauben an den Namen des einzigen Gottessohnes nicht bewahrt hat“ (mē pepisteuken).“
In diesem Zusammenhang setzt sich Thyen mit Heinrich Julius Holtzmann <274> auseinander. Dieser sieht in den Menschen, die nach Vers 19 die Finsternis lieben,
nicht die sündige Menschheit insgesamt im Gegenüber zum heiligen Gott, sondern nur die massa perditionis {Masse der Verdammtheit}, die „den Funken des Geistes im Wust und Schlamm des Fleischeslebens“ erstickt habe. Dagegen sei es „eine charakteristische Besonderheit des 4. Evglsten …, daß die prinzipiell guten Menschen zu Christus kommen, wie auf der synopt. Kehrseite die Sünder“. Doch Jesus ist bei Johannes schwerlich als ,Restlichtverstärker‘ allein zu denen gekommen, die als „gute Menschen“ den „Funken des Geistes“ noch nicht vollends im „Wust und Schlamm des Fleischeslebens“ erstickt haben, sondern er ist als „das Lamm, das der Welt Sünde trägt“ (1,29) gekommen, hina sōthē ho kosmos di‘ autou {damit die Welt durch ihn gerettet werde} (3,17). Und die in V. 19 genannten hoi anthrōpoi {die Menschen} sind eben dieser kosmos. Darum sind die Wenigen, die an den Namen des einzigen Sohnes Gottes glauben, auch nicht „die prinzipiell guten Menschen, (die) zu Christus kommen“, sondern gerechtfertigte Sünder, zu denen er gekommen ist… Sie sind also „aus der Welt Erwählte“ (15,19) nicht aufgrund ihrer Entscheidung, die ihnen irgendein Rest von Licht noch ermöglicht hätte, sondern allein aufgrund der Entscheidung Gottes, der in seiner Liebe seinen einzigen Sohn ,gegeben‘ und ,gesandt hat‘, hina sōthē ho kosmos di‘ autou {damit die Welt durch ihn gerettet werde} (V. 17). Der Sache nach besteht da weder zu den Synoptikern noch zu Paulus irgendeine Differenz.
In dem Satz „ēn gar autōn ponēra ta erga {denn ihre Werke waren böse}“, sieht Thyen nicht etwa eine Begründung dafür, „warum die Menschen die Finsternis liebten, das Licht aber haßten“, vielmehr äußert sich „der Haß auf das Licht … im Tun jener Werke“. Deutlicher als Wengst will Thyen diese „nicht einfach mit dem ,Unglauben‘ identifizieren“, stattdessen erinnert er daran (T222),
daß ,böse Werke‘ in der Tradition, aus der und mit der unser Evangelium spricht, stets Übertretungen der heiligen Gebote Gottes sind. Und an den „Namen des einzigen Gottessohnes nicht zu glauben“, das dürfte im Sinn unseres Erzählers die Übertretung der Mutter aller Gebote sein, nämlich des im schɘmaˁ jißraˀel {Höre, Israel!} von Deut 6,4ff formulierten Grundgebotes der Gottesliebe.
Während Wengst (W123) den Satz in Vers 20, „dass die Täter des Bösen das Licht scheuen, damit ihre Taten nicht aufgedeckt werden, nicht ans Licht kommen“, lediglich als „eine Erläuterung aus der allgemeinen Erfahrung“ bezeichnet und (Anm. 136) mit Hiob 24,13-17 vergleicht, weist Thyen (T222) „über diesen allgemeinen Sinn hinaus“ auf „fraglos symbolische Obertöne“ hin, „die nicht überhört werden dürfen.“ Mit dem Licht ist ja zugleich der gemeint, der sich später (8,12) als das Licht der Welt bezeichnen wird, und
es ist hier auch nicht bloß seine passive Lichtscheu, die den Übeltäter hindert, ans Licht zu kommen, sondern es ist sein aktives Hassen des Lichtes, mit dem er der Liebe Gottes (V. 16) und dessen Absicht widerspricht, die Welt zu erlösen (hina sōthē ho kosmos di‘ autou {damit die Welt durch ihn gerettet werde}: V. 17).
Zu Johannes 3,21 als dem letzten Vers unserer Szene betont Thyen, dass „hier nicht vom prädestinatianischen Determiniertsein zweier Menschenklassen, nämlich der einen zur Rettung, der anderen aber zur Verdammnis“ die Rede ist, „sondern vom Wunder des Glaubens“. Ähnlich wie Wengst betont er, dass
die Werke des „Täters der Wahrheit“ nicht von ihm selbst vollbracht, sondern „in Gott getan“ [sind], sie sind seine iustitia aliena {fremde, Gerechtigkeit = von außen kommende Rechtfertigung}.
Zur griechischen Wendung poiein tēn alētheian, von ihm hier mit „Tun der Wahrheit“ übersetzt, führt er als biblischen Hintergrund nicht die von Wengst angeführte Stelle Hesekiel 18,9 an, sondern unter anderem 1. Mose 32,11; 47,29; Jesaja 26,10; Tobias 4,6; 13,6. Seine Bemerkung, das hebräische Wort ˁaßah ˀemeth bedeute dort „den Glauben bewahren“, ist allerdings nicht stimmig; in 1. Mose 32,11 „tut“ Gott „Treue“ an Jakob, auch in 1. Mose 47,29 soll Josef nicht etwa an seinen Vater glauben, sondern ihm „Treue tun“. In Jes 26,10 kommt ˁaßah gar nicht vor. In Tobias 4,6 und 13,6 liegt kein hebräischer, sondern ein griechischer Text vor; auch hier meint poein tēn alētheian nicht unbedingt „Glauben bewahren“, sondern eher ein Handeln entsprechend dem Vertrauen auf Gott. Immerhin betont Thyen, dass „der Gebrauch des Verbums poiein (ˁaßah) {tun} darauf“ hinweist, „daß in diesen ,Glauben‘ seine Praxis stets eingeschlossen ist“.
Alles in allem verstehen sowohl Wengst als auch Thyen das in Johannes 3,19-21 vollzogene Gericht – unterschiedlich akzentuiert – im Sinne einer theologisch-dogmatisch fundierten Individualethik. Das Verhalten jedes einzelnen Menschen, das im Glauben oder Unglauben an Jesus bzw. durch ihn an Gott gründet, wird im Hinblick auf ewiges Leben oder Verdammnis nach dem Tode beurteilt.
Wie betrachtet demgegenüber Ton Veerkamp <275> das „Gerichtsverfahren“, das in diesen Versen erläutert wird? Wir hatten bereits gehört, dass er es von dem „Gerichtsverfahren aus der Vision Daniels“ (Daniel 7,10) her begreift und auf den Menschensohn bezieht, der als der einziggezeugte Sohn Gottes zugleich den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert. Zugleich ruft Johannes in den Worten Licht und Finsternis die erste Schöpfungserzählung der Schrift in Erinnerung:
Ein Gerichtsverfahren bringt Licht in alle finsteren Geschäfte. Licht ist für alle Juden, und daher auch für alle Christen, das erste und prinzipielle Geschöpf; das wissen wir seit Genesis 1,4. Und dann „trennte Gott zwischen dem Licht und der Finsternis“, zwischen Tag und Nacht. Alles klar, denken wir. Nichts ist klar.
Dass deswegen nicht alles klar ist, weil es in der jüdischen Schrift nicht nur Nacht und Tag gibt, sozusagen als Zähmung mythologischer Mächte aus anderen Kulturen, sondern auch Finsternis, für die Menschen innerhalb gesellschaftlicher Strukturen verantwortlich sind, hatte Veerkamp bereits bei der Auslegung von Johannes 1,5 hingewiesen. Hier fährt er fort:
Johannes beginnt mit dem Hauptsatz: „Dies ist das Gericht“ (3,19). Wir haben es also nicht mit gnostischen Urprinzipien, sondern mit Kategorien der Rechtsprechung zu tun. Was das Gericht ist, wird durch zwei Nebensätze erklärt, die miteinander durch die Partikel kai verbunden werden. „Denn das Licht ist in die Welt(ordnung) gekommen und/aber die Menschen erklären sich mehr mit der Finsternis solidarisch als mit dem Licht.“ Sie wollen nicht, dass Licht in die finsteren Geschäfte der Weltordnung gebracht wird. Man könnte denken: „So lebt man ruhiger.“ Wir werden hören, dass Johannes viel weiter geht. Seine Gegner wollen kein Licht in die Finsternis bringen, weil sie selber tief in diesen finsteren Geschäften verwickelt sind.
Was Veerkamp mit den finsteren Geschäften der Weltordnung meint, wurde bereits des öfteren gesagt. Sehr konkret geht es um die alltäglich spürbare und im Jüdischen Krieg mit extremer Brutalität hervortretende Unterdrückungs- und Ausbeutungsmaschinerie des Römischen Imperiums. Der Vorwurf der Verstrickung in die finsteren Geschäfte der Weltordnung trifft nach Veerkamp in den Augen des Johannes zunächst die judäische Führung in den Tagen Jesu, die mit Rom kollaboriert und nur den Kaiser als ihren König anerkennt (Johannes 19,15), aber auch das in der Zeit des Johannes entstehende rabbinische Judentum, das sich in einer Nische des Weltreiches als erlaubte Religion einrichtet und, statt dem Messias Jesus zu folgen, dessen Nachfolgern Steine in den Weg legt und ihnen den Schutz der Synagoge verweigert.
In der folgenden Verhältnisbestimmung zwischen Licht und Finsternis vertritt Veerkamp durchaus ähnliche Gesichtspunkte wie Wengst und Thyen. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass Veerkamp nicht individualethisch argumentiert, sondern die Finsternis auf das gesellschaftspolitische Übel der Weltordnung bezieht:
Auf alle Fälle ist der zweite Nebensatz keine massive anthropologische Aussage. Johannes sagt hier nicht so etwas wie: „Die Menschen sind eben so, sie sind von Grund auf schlecht.“ Nicht die Menschen sind schlecht, sondern ihre Ordnung, ihr kosmos ist schlecht. Und zwar ganz und gar. Ein später Schüler des Johannes erklärt bündig: „Die ganze Weltordnung liegt im Übel“, 1 Johannes 5,19. Dieses Übel ist finster, aber erst wenn es Licht gibt, gibt es auch Finsternis und nicht umgekehrt. Sonst wäre die Finsternis das „Normale“ nach dem Prinzip: Die Menschen sind eben so. Das Licht zeigt, dass die Menschen eben nicht „so“ sind, sie sind verantwortlich, verantwortlich für die Finsternis, die sie erzeugen.
Ähnlich hatten Wengst und Thyen davon gesprochen, dass erst die auf Jesus bzw. Gott vertrauenden Menschen dazu in der Lage sind, durch Gott gewirkte Taten zu tun und dem Gericht über böse Taten zu entgehen. Das Stichwort kosmos verstehen die beiden allerdings grundlegend anders, nämlich als die Welt der in (individualethisch verstandene) Sünde verstrickten Menschen, die nur durch den Glauben an Jesus als das Licht der Welt diese Sünde erkennen und von ihr erlöst werden können.
Nach Veerkamp dagegen ist Jesus als die Verkörperung des befreienden NAMENS zugleich das Licht, das den römischen kosmos als das entlarvt, was es ist: eine gigantische Welt-un-ordnung, unter der Israel zusammen mit der gesamten Menschenwelt versklavt ist. Sobald dieses Licht in den kosmos hineinscheint, so denkt Johannes, können die Menschen nicht anders, als sich so oder so zu entscheiden. Entweder schlagen sie sich auf die Seite der finsteren Weltordnung oder auf die Seite des Lichtes:
Der erste Nebensatz {das Licht ist in die Welt gekommen} ist ebenfalls eine massive Aussage mit dem berühmten Perfektum, das Johannes verwendet, um anzudeuten, dass etwas geschehen ist und die Situation deswegen eine völlig neue geworden ist, und zwar unumkehrbar. Erst wenn eine Alternative sichtbar wird, kann man sich entscheiden. Der Messias bringt Licht in die Sache „Weltordnung“. Das macht das Leben der Menschen nicht einfacher. Man hat sich arrangiert, man schlägt sich durch. Das geht eher schlecht als recht, aber es geht meistens gerade so. Sobald Licht in die verwirrte Sache des Lebens in dieser Welt kommt, kann man sich nicht länger durchmogeln.
An dieser Stelle gibt Veerkamp dem Exegeten Rudolf Bultmann <276> in der Hinsicht Recht, dass er Jesus „das eschatologische Ereignis“ nennt, also ein Geschehen, das auf eine endgültige, quasi endzeitliche Entscheidung hinausläuft. Allerdings kritisiert Veerkamp den Begriff der „Eigentlichkeit“, mit dem Bultmann diese Entscheidung verbindet:
Das massive ideologische Deutsch in diesem Ausdruck ist nicht jedermanns Geschmack. Bultmann meint wohl doch, dass das Licht, das gekommen ist, erst eine Entscheidung möglich macht. Er versucht, diesen Passus so auszulegen, dass ein Mensch des 20. Jh. ihn verstehen kann. Die ausführliche Erklärung zu 3,20 beruht aber auf einer Fehldeutung. Es geht nicht um Moralität, soweit ist Bultmann zuzustimmen. Dann heißt es:
„Vielmehr ist gemeint: in der Entscheidung des Glaubens oder Unglaubens kommt zutage, was der Mensch eigentlich ist und immer schon war. Eschatologisches Geschehen kann diese Sendung (Jesu) sein, weil in ihr Gottes Liebe dem Menschen die verlorene Freiheit zurückgibt, seine Eigentlichkeit zu ergreifen.“
Bei Johannes kommt nicht die Eigentlichkeit des Menschen „zutage“, jene Authentizität der damaligen Existentialisten, sondern die Werke der Menschen kommen ans Licht. Insofern kein Unterschied zu Matthäus {25,31-46}. Auch bei Matthäus geht es um die Werke, Hungrige ernähren, Durstigen zu trinken geben. Es ist die (politische) Praxis der Menschen, die zu be- und nötigenfalls zu verurteilen ist. Wer aber wie Bultmann aus dem Feldzug gegen die Werkgerechtigkeit Luthers eine existentialistische Weltanschauung macht und von dort her die Werke und ihre Falschheit bzw. ihre Zuverlässigkeit unterschlägt bzw. als „mythologisch verbrämten Moralismus“ diffamiert, hat offenbar wenig verstanden.
Von diesen Aussagen her muss man Wengst und Thyen zugutehalten, dass sie beide davon ausgehen, dass es keinen Glauben an Jesus gibt, der sich nicht in Taten bewährt. Umgekehrt beruht auch nach Veerkamp eine gottgemäße Praxis auf einem Vertrauen auf den Messias Jesus. Der Unterschied bleibt, dass Veerkamp den Gott Israels als den befreienden NAMEN versteht, der durch die Hingabe seines Sohnes die herrschende politische Weltordnung überwindet, so dass die kommende Weltzeit des Friedens für Israel inmitten der Völker anbrechen kann:
Wer lebt – und leben ist immer Praxis – aus dem Vertrauen auf diesen Messias Israels, wer „Treue übt“ (poiōn tēn alētheian), dessen Praxis, dessen Werke (erga) kommen ans Licht, werden öffentlich, müssen nicht versteckt werden, „weil sie gottgemäß erwirkt werden“. En theō, gottgemäß, nach der Maßgabe des NAMENS. Über Freispruch oder Verurteilung entscheidet die Praxis eines Menschen, freilich eine Praxis, die auf dem Vertrauen beruht, dass mit der Schlachtung des Messias die herrschende Weltordnung ein Ende findet. Wenn das ein „eschatologisches Ereignis“ genannt wird, kann man mit der Terminologie zur Not seinen Frieden haben.
Damit sind wir am Ende der Szene angelangt, die als Gespräch mit Nikodemus begann und aus der Nikodemus seit Vers 13 ausgestiegen zu sein scheint. Veerkamp beendet seine Auslegung dieser Verse mit den Worten:
Nikodemus schweigt.
Damit will er wohl andeuten, dass ein rabbinischer Jude, selbst wenn er messianisch denkt, mit der Vorstellung, dass ein ans römische Kreuz erhöhter Messias in der Lage sein soll, die Weltordnung zu überwinden, absolut nichts anfangen kann. Können wir es? Oder ziehen wir es vor, Johannes verjenseitigt umzuinterpretieren?
Obwohl ich Veerkamp hier bereits sehr ausführlich zitiert habe, ist es an dieser Stelle angebracht, auch noch auf seine erklärende Randbemerkung, „Scholion 2“, <277> über das „antagonistische Schema im Johannesevangelium“ einzugehen. Darin bringt er die Gegenüberstellung von Licht und Finsternis im Johannesevangelium in Verbindung mit der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht, in deren Filmfassung am Ende gesungen wird:
„Denn die einen sind im Dunklen
Und die andern sind im Licht
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkel sieht man nicht.“
Dazu bemerkt Veerkamp:
Niemand würde auf die Idee kommen, Bertolt Brecht Dualismus oder Gnostizismus vorzuwerfen. …
Klar ist, dass manche Menschen sich eher mit der Finsternis als mit dem Licht einverstanden erklären; von ihnen handelt ja die Dreigroschenoper. Sie gehen Geschäften nach, die aus wohlverstandenen Eigeninteressen im Dunkel bleiben sollen. Nach dem Vorurteil, in allem Dualismus Gnostizismus zu sehen, könnte man auch das Schema der antagonistischen Klassen, mit dem Brecht hier hantiert und das von Marx kommt, Gnostizismus nennen. Die Bourgeoisie neigt dazu, reale und innerhalb einer geltenden Gesellschaftsordnung (Wirtschaft- und Sozialordnung) herrschende Widersprüche nicht wahrnehmen zu wollen. Sie nennt heutige Klassengegensätze und überhaupt das Klassenparadigma kommunistischen Unsinn, wie sie den alten Dualismus im Römischen Reich religiöse Phantasiebildung – eben Gnosis – nennt.
Nach Veerkamp darf aber weder die Gnosis noch auch das Johannesevangelium losgelöst von ihrem gesellschaftlichen Kontext interpretiert werden:
Natürlich ist der Gnostizismus keine reine Modeerscheinung gewesen. Das Römische Reich verschärfte die gesellschaftlichen Gegensätze überall und die Menschen empfanden die weltweite Disharmonie an Leib und Seele. Die Gnostiker verflüchtigten die realen Gegensätze und machten aus der Gegensätzlichkeit ein absolutes Prinzip. Die Verabsolutierung der Gegensätze musste auf Widerstand solcher Menschen stoßen, die ihre Welt von der Tora her zu deuten versuchten. Das ist bei Johannes der Fall und genau aus diesem Grund ist sein Text ein anti-gnostischer Text.
Die bei Johannes auftauchenden „Gegensatzpaare…, die unversöhnlicher Natur sind“ und die es ähnlich auch „in der Sekte Qumrans“ gibt, muss man also Veerkamp zufolge „von der politischen Situation her deuten und nicht von den vordergründigen ideologischen Inhalten und Bildern her“:
Dieser Antagonismus zeigt, dass die Gegensätze in der Gesellschaft auf allen Ebenen – sozialen, politischen und ideologischen – unüberbrückbar geworden sind. Qumran zeigt das physisch durch den Rückzug aus der realpolitischen Welt. Johannes will aber politikfähig bleiben, dort ähnelt er eher seinen Lieblingsgegnern, den Peruschim {Pharisäern}. Aber genau in der Tradition der unüberbrückbar gewordenen politischen Gegensätze redet der Jesus des Johannesevangeliums.
Eine völlig andere Weltordnung und die traditionelle, toratreue judäische Gesellschaft stehen sich spätestens seit den makkabäischen Kriegen unversöhnlich gegenüber. Der Traditionalismus der Toratreue reiche, so Johannes, nicht mehr, man könne heute Mose nicht wiederholen bzw. aktualisieren. Das ist das Neue bei ihm. Aber immer noch stehe Israel vor der Wahl: entweder das Leben und das Gute oder der Tod und das Böse, entweder der NAME (Autonomie bäuerlicher Großfamilien) oder der Baal (Weltordnung des Großgrundbesitzes), Messias oder Rom. Das ist keine Gnosis, das ist der lange Atem der traditionellen Revolution, die von dem makkabäischen Aufstand bis zu den judäischen Kriegen des 1. und 2. Jh. u.Z. reicht.
Veerkamp gesteht allerdings durchaus auch der Gnosis zu (seine Anm. 137), dass sie „Widerstand gegen Rom“ ist,
aber ein phantastischer und abgehobener. Unter Rom sei die Weltordnung so schlecht und das Leben so unmöglich, dass nichts mehr zu machen ist. Bloß weg von hier, ist die Stimmung. Das geht aber nur magisch, durch Riten und Mysterien.
Während bei Johannes „die Welt selbst befreit“ wird, „da die Befreiung eines einzelnen Landes keine Lösung“ mehr ist, flüchtet sich die Gnosis in die „Befreiung der (Seelen von) Menschen von der materiellen Welt“.
Eine solche Weltverdammung und Weltflucht, wie sie die Gnosis lehrt, wird auch nach Wengst und Thyen im Johannesevangelium nicht vertreten. Sie ziehen aber ebenso wenig in Erwägung, dass Johannes die Überwindung der Römischen Weltordnung im Sinn gehabt haben könnte.
Das mag daran liegen, dass die bald schon heidenchristlich dominierte Kirche gar keine andere Wahl hatte, als sich ebenso wie das rabbinische Judentum an die Bedingungen des Lebens im Kaiserreich anzupassen und schließlich sogar unter Kaiser Konstantin zur „Staatsideologie“ zu werden. <278> Statt die Überwindung der Weltordnung tätig zu erwarten, gilt für das Diesseits eine Ethik nach den christlich interpretierten Geboten Gottes und für das Jenseits die Hoffnung auf Erlösung im Glauben an den sühnenden Kreuzestod Jesu. In diesem Sinne wurde ganz selbstverständlich auch das Johannesevangelium seit dem 2. Jahrhundert verstanden. Gerade deshalb ist es Zeit, in Erwägung zu ziehen, dass Johannes ursprünglich eine ganz andere Stoßrichtung verfolgt.
↑ Das Zeugnis des Johannes und die Stimme des Bräutigams (Johannes 3,22-36)
[2. Mai 2022] Nach den in Jerusalem spielenden Szenen im Tempel und im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus zieht Jesus mit seinen Schülern in die Gegend, wo Johannes seine Tauftätigkeit ausübt, um ebenfalls zu taufen. Abgesehen davon wird in der damit beginnenden Szene von keiner Tat oder Rede Jesu erzählt, stattdessen (W124) „tritt Johannes der Täufer auf“, und zwar „zum letzten Mal als selbst Redender und Handelnder“. Nach Klaus Wengst wird in den Anfangsversen 22-24 „das Wirken Jesu und das des Johannes einander“ parallelisiert:
Daraus ergibt sich die Frage, ob nicht eine Konkurrenz zwischen Jesus und Johannes besteht. Diese Frage wird von Johannes selbst in einer Rede geklärt (V. 27-36), die zunächst das Verhältnis zwischen Jesus und ihm als das zwischen dem Gesalbten und seinem ihm vorangehenden Zeugen kennzeichnet (V. 27-30) und dann ein den Bezeugten eindrucksvoll herausstellendes Zeugnis bietet (V. 31-36).
Ironisch äußert sich Wengst über Exegeten, die meinen, dass sie „klüger sind als der Text“ und deshalb „diesen sinnvollen Zusammenhang“ zerschlagen, etwa mit dem Argument, Johannes könne nicht mehr der Sprecher der Verse ab 31 sein, so dass man diese als Rede Jesu an irgendeine andere angeblich passendere Stelle verschiebt.
Ton Veerkamp <279> hält die Verse 31-36 zwar für „schwer zu deuten“, aber auch er wendet sich gegen Bultmann, der sie „dem Gespräch mit Nikodemus angeschlossen“ hat: „Diese Lösung ist bequem, macht aber ihre Deutung kaum einfacher.“
Er selbst sieht in Johannes 3,31-36 „eine Art von zusammenfassender Erläuterung des großen Abschnitts über die Tätigkeit des Messias in Judäa“, der mit der Tempelreinigung begonnen hatte. Zu Johannes als dem Freund des Bräutigams wird Veerkamp eine besondere Theorie vertreten, die mit seiner Auslegung der Hochzeit zu Kana als der messianischen Hochzeit zusammenhängt.
Überzeugend erscheint mir Hartwig Thyens Blick auf die Szene Johannes 3,22-36 als ein zusammengehöriges Ganzes. Auch er (T200) erteilt Zerstückelungen des Textes eine klare Abfuhr und verweist auf „eine bestechend einfache und einleuchtende Lösung der vermeintlichen literarkritischen Probleme von Joh 3“, die Yu Ibuki <280> vorgeschlagen hat:
Er hat nämlich auf den völlig und ganz offenbar absichtsvollen parallelen Aufbau der beiden Abschnitte 2,23-3,21 und 3,22-36 aufmerksam gemacht, die jeweils mit einer narrativen Einleitung eröffnet werden. In beiden Fällen schließt sich daran die Anrede, einerseits Jesu und andererseits des Johannes als ,Rabbi‘ an (3,2 und 3,26). Und hier wie da erscheint in der Antwort des so Angeredeten das Stichwort vom Hören einer phōnē, nämlich der ,Stimme des Geistes‘ in 3,8 und der ,Stimme des Bräutigams‘ in 3,29. Was diese Stimmen dann inhaltlich jeweils zu sagen haben, das wird zunächst als die ,Stimme des Geistes‘ in 3,13-21 laut und dann in 3,31-36 als die ,Stimme des Bräutigams‘, an der Johannes sich freut. Auf diese Weise braucht Ibuki nicht irgendwelche textexternen Größen wie eine „johanneische Gemeinde“ oder einen „Zeugenkreis“ als Sprecher dieser Textpassagen einzuführen. Er muß den Evangelisten nicht der Vergeßlichkeit und des dadurch verursachten Anachronismus zeihen, braucht keinen „kirchlichen Redaktor“ zu bemühen und kann endlich das, was diese ,Stimmen‘ sagen, dennoch zugleich als das Kerygma {Verkündigung} der Kirche wahrnehmen…
Der einzige strukturelle Unterschied zwischen dieser und der letzten Szene besteht nach Thyen darin (T226),
daß jetzt ein dem Wortwechsel zwischen Nikodemus und Jesus entsprechendes dialogisches Moment fehlt. Dem Meister-Jünger-Verhältnis entsprechend antwortet Johannes monologisch, ohne von seinen Fragestellern unterbrochen zu werden (3,27-30).
Wenn die strukturelle Analyse von Ibuki und Thyen zutrifft, kann man sagen, dass Johannes nach dem grundlegenden Zeichen der messianischen Hochzeit zunächst Jesu Konfrontation mit seinen judäischen Gegnern im Tempel zu Jerusalem schildert und dann auf die Beziehung seiner messianischen Bewegung einerseits zu messianisch gesinnten rabbinischen Juden, andererseits zur judäischen Täuferbewegung eingeht. Erstere bleibt ihm gegenüber skeptisch, dient Jesus aber dazu, die Stimme des Geistes über die Erhöhung das Gericht des Menschensohnes laut werden zu lassen; Letztere wird vom Zeugnis des Täufers selbst dazu animiert, dem Messias Jesus zu folgen, indem er als Freund des Bräutigams dessen Stimme zum Erklingen bringt.
↑ Johannes 3, 22-24: Jesus und Johannes taufen beide im judäischen Land
3,22 Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa
und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte.
3,23 Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim,
denn es war da viel Wasser;
und sie kamen und ließen sich taufen.
3,24 Johannes war ja noch nicht ins Gefängnis geworfen.
[3. Mai 2022] Mit den Worten meta tauta, „nach diesen Dingen“, markiert Johannes Hartwig Thyen zufolge (T226) „hier, wie in 2,12; 5,1; 6,1; 7,1; 21,1, … den Einsatz einer neuen Szene“ und gibt zugleich „nachträglich an, daß auch die bisher nicht lokalisierte Begegnung mit Nikodemus in Jerusalem zu denken ist.“ Denn nach dem Zusammenhang kann „die Richtungsangabe eis tēn Ioudaian gēn … nur die judäische Landschaft außerhalb der Stadt Jerusalem bezeichnen“.
Auch Klaus Wengst (W125) hält in wenigen Worten fest, dass hier ein „Szenenwechsel“ stattfindet:
Im vorangehenden Text war Jesu Aufenthalt in Jerusalem anlässlich des Pessachfestes vorgestellt. Er verlässt die Stadt mit seinen Schülern, bleibt aber in Judäa. Die Formulierung „das judäische Land“ – so wörtlich – betont den Unterschied zur Stadt Jerusalem. Eine genauere Ortsangabe wird nicht gemacht, die Zeitvorstellung ist unbestimmt. „Er hielt sich dort mit ihnen auf.“
Das Wort diatribein, „sich aufhalten“, taucht im Johannesevangelium nur hier auf; überhaupt ist es in der ganzen Bibel selten. In der Tora bezeichnet es (3. Mose 14,8) den siebentägigen Aufenthalt eines Aussätzigen außerhalb seines Zeltes nach seiner Reinigung und in den Propheten (Jeremia 42,7) die Verheißung langen Lebens in ihrem Lande an die abstinent lebenden Rechabiter. Am häufigsten wird es in der Apostelgeschichte verwendet, meistens (12,19; 14,3.28; 15,35; 16,12; 20,6) für längere Aufenthalte von Aposteln an bestimmten Orten.
Ton Veerkamp <281> nimmt den offenbar länger andauernden Aufenthalt Jesu im judäischen Land zum Anlass, über diese Region Palästinas eingehender nachzudenken. Er weist darauf hin, dass „judäische Land, Judäa, … während der Zeit des Hellenismus und des Römischen Reiches fast immer Opfer schrankenloser Ausbeutung mit ständig wechselnden Ausbeutungsakteuren“ war. Das wirtschaftliche Interesse der Kaiser, „Ruhe und Ordnung in ihren Provinzen zu bewahren“, führte dazu, dass nach dem allgemein begrüßten „Ende der herodianischen Monarchie im Jahr 6 u.Z.“ eine „direkte Verwaltung durch Rom mittels Prokuratoren oder Präfekten aus dem römischen Ritterstand“ eingeführt wurde:
Augustus strebte danach, neben Senatoren und Prätoren aus der klassischen römischen Aristokratie jene equites, Ritter, einzusetzen. Letztere verdankten nur dem Kaiser ihren beruflichen Aufstieg und waren ihm eher ergeben als die zu Intrigen neigenden römischen Aristokraten. Sie ließen sich „Freund des Caesars“ nennen (Johannes 19,12).
Mag diese Verwaltung durch römische Ritter, die zur Zeit Jesu „Präfekten, nach dem kurzen Intermezzo unter Herodes Agrippa (39-44) Prokuratoren genannt“ wurden, „zunächst als eine Erleichterung empfunden worden sein“, blieb das jedoch nicht so:
Der Präfekt Pontius Pilatus (26-36) wurde wegen Misswirtschaft abgesetzt. Die Prokuratoren der fünfziger und sechziger Jahre waren nicht selten korrupt und unfähig. Die unglückliche Provinz schlitterte seit den letzten Jahren unter dem Prokurator Felix (52-60) unaufhaltsam in den Bürgerkrieg.
Wie sah es zur Zeit Jesu mit der Ebene der Selbstverwaltung unterhalb der Ebene der römischen Oberherrschaft aus?
In Judäa hatten die Juden ein nicht unbeachtliches Maß an Selbstverwaltungsrechten. Nutznießer waren in erst Linie die Eliten Judäas, allen voran der Priesterstand; die Führung war eindeutig pro-römisch. Galiläa und das Land jenseits des Jordans standen unter der Verwaltung herodianischer Fürsten und waren in gewisser Weise unabhängiger als Judäa. Dennoch muss die Belastung durch die römischen Machthaber und die relativ wohlhabenden grundbesitzenden Schichten groß gewesen sein, denn der Widerstand gegen Herodianer und Römer war in Galiläa deutlich militanter als in Judäa.
Vor diesem Hintergrund versucht Veerkamp die Aussage, dass Jesus getauft habe (eine „Information“, die „etwas später vom Text wieder zurückgenommen“ wird), auf folgende Weise zu erklären:
Anders als bei den Synoptikern erfahren wir nicht, was das für eine Taufe war. Dass die Taufe mit der hereinbrechenden neuen Weltzeit zusammenhängt, ist sicher. Bis spät im 1. Jh. taufte die messianische Gruppe Johannes des Täufers; die messianischen Gemeinden hatten inzwischen eine eigene Taufpraxis. Den Unterschied aber beschreibt Lukas. Die Schüler des Johannes tauften mit Wasser „zur Umkehr“, Apostelgeschichte 19,3; Jesus „mit Feuer und der Inspiration der Heiligung“, Lukas 3,16 vgl. Johannes 1,33. Wo die Orte Aenon und Salim waren, weiß man nicht; die Namen haben mit Quelle und Friede zu tun. Leute aus dem Land Judäa „kamen herbei und wurden getauft“. Das heißt, sie wurden eingestimmt auf die kommende Weltzeit.
Die historische Frage, ob Jesus selbst getauft hat oder nicht, hält Wengst (W125, Anm. 142) für
müßig, weil sie einmal nicht klar entscheidbar ist und weil zum anderen ihre Beantwortung für das Textverständnis nichts austrägt. Relevant und lösbar ist dagegen die Frage, welche Funktion die Erwähnung des Taufens Jesu im Textzusammenhang hat.
Diese Funktion besteht Wengst zufolge einzig und allein darin, das Wirken Jesu mit dem Wirken Johannes des Täufers zu parallelisieren, der nach Vers 23 ebenfalls „noch dabei war zu taufen“, wie Wengst (Anm. 143) die „Konstruktion des griechischen Textes mit Hilfsverb und Partizip“, ēn de kai ho Iōannēs baptizōn, übersetzt:
Diese Parallelität im Wirken konnte er, da er den verkündigenden Johannes ausschließlich Jesu Zeugen sein ließ, nicht anders herstellen, als dass er auch von Jesus den Vollzug des Taufens aussagte. Für die Leser- und Hörerschaft ist sie nun unmittelbar im Text gegeben. Auf der erzählten Ebene sind aber das Wirken Jesu und das des Johannes räumlich weit voneinander getrennt.
Nach Hartwig Thyen dagegen (T226)
besteht die Pointe dieses singulären Redens von einer Tauftätigkeit Jesu zu Lebzeiten und in Konkurrenz zu derjenigen des Johannes offenbar darin, daß dem Erzähler und seinem impliziten Zuhörer die Taufe bereits als eingeschliffener Initiationsritus gilt. Danach wird einer zum Jünger (mathētēs), sei es des Johannes oder sei es Jesu, allein durch den Ritus der Taufe…(vgl. Mt 28,19: mathēteusate panta ta ethnē baptizontes autous ktl. {lehret alle Völker, indem ihr sie tauft usw.}).
Interessant ist, dass im Johannesevangelium (T227) in diesem Zusammenhang „auch das Taufen des Johannes … zum Initiationsritus in eine Art ‚Johanneskirche‘ geworden“ sein soll, obwohl es Thyen bewusst ist, dass man dieses „historisch wohl als ein eschatologisches Bußsakrament für ganz Israel wird begreifen müssen“. Außer Acht lässt er, anders als Veerkamp, die Erwägung, dass noch der Evangelist Johannes die Taufe als Ritual der Einstimmung auf die kommende Weltzeit sehen könnte.
Indem es allerdings nach Thyen „hier nicht um irgendeine theologische Deutung der Taufe, sondern allein darum geht, das Wachsen der Kirche Christi bei gleichzeitigem und gottgewolltem Schwund der ‚Johanneskirche‘ (3,30) darzustellen“, will er das Taufen Jesu vor allem „als eine Umschreibung dafür ansehen…, daß Jesus in Judäa zahlreiche Jünger gewann“. Nicht nur Wengst, sondern auch ihm zufolge wird Jesus also nur zu dem Zweck als Täufer dargestellt, um „das Taufen Jesu mit demjenigen des Johannes“ zu parallelisieren.
Zum inzwischen veränderten Ort der Taufe des Johannes, der „das transjordanische Bethanien (1,28) inzwischen verlassen“ hat, merkt Thyen an, dass er „westlich des Jordans liegen“ muss, ansonsten aber nicht sicher bestimmt werden kann. Dennoch will er „Ainon bei Salim“ nicht einfach wie Hans-Martin Schenke <282> „in den bloßen Symbolismus von „Quellen nahe beim Heil“ (Salim für Shalom) oder dergleichen“ auflösen:
Denn, auch wenn man bei Johannes, wie wir ja bereits gesehen haben, durchaus mit symbolischen Obertönen rechnen muß, erheben sich solche Obertöne beim echten Symbol im Gegensatz zur Allegorie jedoch stets über einem nichtsymbolischen Grundton. … Nicht zweifelhaft ist uns…, daß der Autor mit ,Ainon bei Salim‘ eine reale Gegend auf der Landkarte Palästinas im Auge gehabt haben dürfte…
Die Bemerkung, dass Johannes noch nicht ins Gefängnis geworfen worden war, zeigt (T228) „unzweideutig an…, daß unser Autor Leser voraussetzt, die von anderswoher um die Kerkerhaft des Johannes wissen“. Sie kann Thyen zufolge nur den Sinn eines Spiels mit Lukas 7,17ff. haben, wo wie bei Johannes erzählt wird,
daß die ,Jünger des Johannes‘ (hoi mathētai autou) ihrem Meister den großen Erfolg Jesu vermelden. Dabei versteht es sich nach der eindrucksvollen ersten Täufermartyria {Täuferzeugnis} unseres Evangeliums (Joh 1,19ff) ja wohl von selbst, daß Joh nun nicht mit der synoptischen Anfrage eines angefochtenen Täufers bei Jesus fortfahren konnte: „Bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“ (Mt 11,2-6 // Lk 7,18-23). Denn nirgendwo ist Johannes bei ihm ein Zweifler, sondern stets der von Gott gesandte Mann, der als der wahrhaftige Zeuge kam… (1,6-8). Angefochten, nämlich vom Neid über den großen Erfolg Jesu und davon, daß „alle zu ihm drängen“ (V. 26), sind hier allein die Jünger des Johannes. An sie muß sich darum seine martyria {Zeugnis} jetzt richten.
↑ Johannes 3,25: Johannesjünger streiten mit einem Judäer über die Reinigung
3,25 Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung.
[4. Mai 2022] Der Vers Johannes 3,25 gibt in doppelter Hinsicht Rätsel auf, erstens wegen des Streits über die Reinigung und zweitens wegen des einen Ioudaios, „Juden“ oder „Judäers“, mit dem die Schüler des Johannes diesen Streit ausfechten. Inhaltlich wird über diesen Streit nämlich nichts gesagt.
Klaus Wengst (W125) sieht die Funktion dieses Juden, „der zugleich näher als ‚Judäer‘ vorgestellt sein dürfte“, darin, „die Verbindung“ zwischen Jesus und Johannes herzustellen, deren Wirken auf „der erzählten Ebene … räumlich weit voneinander getrennt“ sind (W125f.):
Nach dem Text wirkt Jesus in Judäa und nun kommt ein Judäer nach Änon, trifft dort Johannes bei demselben Wirken an wie Jesus in Judäa, interpretiert das als Konkurrenz und streitet darüber mit den Schülern des Johannes. Der Streit „über die Reinigung“ kann sich nur darauf beziehen, ob in Hinsicht auf die Sündenvergebung die Taufe des Johannes oder die Jesu wirksam sei.
Im Hintergrund dieser Darstellung steht Wengst zufolge wohl
ein Problem der eigenen Zeit…, nämlich die Konkurrenz zwischen seiner Gemeinde und der weiter bestehenden Anhängerschaft Johannes des Täufers. Auf diesem Hintergrund stellt er Jesus und Johannes zunächst nebeneinander dar, um dann für seine Leser- und Hörerschaft das Verhältnis zwischen beiden von Johannes selbst so klären zu lassen, dass sie auf völlig unterschiedlichen Ebenen stehen und folglich eine Konkurrenz überhaupt nicht statthaben kann.
Auch Hartwig Thyen meint (T228), dass nach „dem Kontext … nur ein Streit um die reinigende Wirkung der Taufe“ gemeint sein kann, bezieht diese aber nicht auf die Sündenvergebung, sondern auf Reinigungsriten nach dem 3. Buch Mose (Leviticus):
Ob es sich dabei um levitische Reinigung von Unreinheit oder um Reinigung im Sinne der aphesis hamartiōn {Vergebung der Sünden} handelt, erfährt der Leser nicht. Da aber die Johannestaufe in unserem Evangelium nie ausdrücklich als baptisma metanoias eis aphesin hamartiōn {Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden} bezeichnet wird, wie bei Markus (1,4; vgl. Lk 3,3), und da hier der Täufer ausdrücklich auf Jesus verweist, der als ‚das Lamm Gottes die Sünde der Welt beseitigt‘ (1,29), dürfte eher das erstere im Blick sein.
Auch die Erwähnung des Juden deutet Thyen anders als Wengst nicht vor dem Hintergrund einer (T229) „einer vermeintlich noch aktiven und mit der Kirche konkurrierenden ,Sekte‘ Johannes des Täufers…, die ihren Meister ihrerseits messianisch verehrt hätte“, sondern er stellt ihn (T228) in einen Zusammenhang mit der „vorausgehenden Szene“. Hatte dort
nach einer kurzen dialogischen Partie der jüdische Ratsherr und ,Lehrer Israels‘, Nikodemus, die martyria {Zeugnis} Jesu 3,13-21 ausgelöst, so wird jetzt ein freilich sehr viel weniger prominenter jüdischer Anonymus, der zudem nur in einer Art Teichoskopie erscheint, zum Anlaß für die erneute martyria des Johannes für Jesus vor seinen Jüngern.
Demgegenüber hält er (T229) die Auffassung etwa von Alfred Loisy, <283> „ursprünglich müsse hier von einem Streit der Johannesjünger mit Jesus die Rede gewesen sein und der Text TOU IĒSOU anstelle von IOUDAIOU gelautet haben“, für abwegig. In Thyens Augen ist „dieser anonyme ‚Jude‘ … ein Repräsentant der sonst hoi Ioudaioi Genannten“, mit dem „nicht gegen, sondern vielmehr um Johannes gestritten“ wird, „den die Juden als einen der Ihren reklamieren, während unser Evangelium ihn als ‚den ersten‘ und exemplarischen ‚Christen‘ darstellt (vgl. dazu die Auslegung von Johannes 1,19-21, insbesondere meine Anm. 93).
Bis auf die anachronistische Annahme, Johannes sei bereits als „Christ“ zu bezeichnen, als sei er kein Jude mehr gewesen, kann ich seine Argumentation nachvollziehen; dann könnte es in dem Streit um die Reinigungstaufe zur Vorbereitung auf den Anbruch der messianischen Zeit gegangen sein.
Ton Veerkamp <284> hat noch eine andere Idee zu dem Ioudaios:
Die Tatsache, dass die Schüler sich bei Johannes über die Taufpraxis Jesu beschwerten, zeigt, dass dieser Judäer zur Gefolgschaft Jesu gehörte.
Das halte ich allerdings insofern für unwahrscheinlich, als im Johannesevangelium zwar auch von Juden/Judäern die Rede ist, die auf Jesus vertrauen, meistens aber repräsentieren sie doch diejenigen Juden, die Jesus als Gegner gegenüberstehen, so bereits in 2,18.20, oder Johannes einem Verhör unterzogen haben (1,19).
Obwohl wir nach Veerkamp über „den Disput, den die Johannesschüler und ein Judäer in der Frage der Reinheit führen, … nichts Genaues“ erfahren, nimmt er ihn doch zum Anlass, über das Thema „Reinigung“ nachzudenken, das „bereits während der Hochzeit zu Kana bei den sechs Gefäßen zur ‚Reinigung der Judäer‘ angedeutet“ wurde:
Die zwei Hauptaufgaben der Priester, also der politischen Führung in der Torarepublik seit den Reformen Nehemias und Esras, sind nach Leviticus 10,10f.:
Ihr sollt trennen
Zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen,
zwischen dem Reinen und dem Unreinen,
ihr sollt unterweisen die Kinder Israels
alle Gesetze, die der NAME durch Mose geredet hat.Was „rein“ ist und was nicht, wird in der Tora, vor allem im 3. Buch der Tora, Leviticus 11-15, ausgeführt. Rein/unrein ist in Israel ein Thema von großem Belang. Was für Messianisten rein und unrein ist, wird Jesus den Schülern später verdeutlichen, 13,1ff.
Wie Thyen bezieht also auch Veerkamp den Streit über die Reinigung nicht auf die Sündenvergebung, sondern auf die levitische Reinheits-Tora.
In seinem „Scholion 3: Über die Reinheit“ <285> geht Veerkamp auf dieses Thema insofern noch etwas näher ein, als er sich mit antijüdischen bzw. rassistischen Vorurteilen gegenüber von Reinheits-Ritualen geprägten Religionen auseinandersetzt:
In der Berliner Akademie der Künste hat vor einigen Jahren irgendein Literat Passagen aus Leviticus 11-15 vorgelesen und zum Gaudium des gebildeten Publikums der Lächerlichkeit preisgegeben. Diese Haltung ist unterschwellig verbreitet und eine Wurzel des Antijudaismus, überhaupt des Rassismus. Man darf sein Unverständnis diesen Reinheitsvorschriften gegenüber äußern. Man muss dann sagen: „Ich verstehe das nicht!“ Das ist etwas anderes als: „Lächerlich, unerhört!“ Vielmehr mag man an sich selbst ausprobieren, wie es mit der eigenen Toleranz steht, wenn man sich mit Leviticus 11-15 auseinandersetzt.
Bemerkenswert ist nach Veerkamp, dass Johannes „das System ‚Rein/Unrein‘ nicht in Frage“ stellt, jedenfalls nicht grundsätzlich,
er bezweifelt aber, dass unter den römischen, völlig neuen Umständen die Reinheit so zu verstehen ist, wie das rabbinische Judentum es will. Das ist eine politische Debatte. … Das rabbinische Judentum hat die Reinigungspraxis als Identifikationsmerkmal aufgefasst; sie dient der Sicherstellung der Identität dieses Volkes unter den anderen Völkern, vor allem das Zeichen der Beschneidung. Die Messianisten hatten eine andere Auffassung über die politische Lage, und diese führte sie zu einer neuartigen Auffassung von Reinheit. Diese Differenz müssen wir, zweitausend Jahre später, feststellen und respektieren.
Allerdings klingt bei Johannes noch nicht die spätere Haltung des Christentums an, das „die jüdische Auffassung von Reinheit diskriminiert“ hat. Er verkneift sich
jede billige Polemik gegen die Reinheitsauffassung seiner Gegner; Markus ist hier schärfer und derber. Das könnte mit der priesterlichen Herkunft des Johannes zusammen hängen, die manche beobachtet haben wollen. <286> Reinheit ergibt sich aus dem Vertrauensverhältnis dem Messias gegenüber, soviel ist für Johannes klar.
In diesem Zusammenhang macht Veerkamp auf zwei Aufsätze aufmerksam, in denen sich Rochus Zuurmond und Andreas Pangritz <287> „mit der Abqualifizierung des Systems ‚Rein/Unrein‘“ gegenüber dem „System ‚Schenkung/Schuld‘“ kritisch auseinandersetzen.
Diese Systeme laufen, sehr verkürzt zusammengefasst, darauf hinaus (Z23), dass einer priesterlichen Kultur der Unterdrückung mit einem ausgedehnten „Tabu-System“ von vor allem kultischen Gesetzen, „die die Welt auf anonyme Weise in ‚rein‘ und ‚unrein‘ aufteilen“, im „System der Gabe“ eine prophetische Kultur gegenübergestellt wird, „die auf gegenseitigem Tausch von Gütern und Dienstleistungen beruht“ und in der „Freiheit und Gleichheit“ herrschen.
Rochus Zuurmond (Z24) lehnt diese absolute Entgegensetzung „von Priester und Prophet“ ab, die aus dem „bürgerlichen Anti-Klerikalismus“ des 19. Jahrhundert stammt, da „der Priester und der Prophet in Israel nicht zu trennen sind“, und stellt die Frage (Z24f.):
Sollte die Befreiung, von der die Schrift zeugt, lediglich Befreiung vom religiösen Ritus bedeuten können? Oder sollte Befreiung nicht auch bereits innerhalb des „Systems der Reinheit“ aufleuchten können? Ist das so, dann dürfte die kultische Gesetzgebung Spuren davon tragen.
Solche Spuren findet Zuurmond beispielhaft in der Erzählung von Nadab und Abihu, den ältesten Söhnen des Priesters Aaron, im 3. Buch Mose (Leviticus) 10,1-2:
Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den HERRN, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie, dass sie starben vor dem HERRN.
So befremdlich und hart diese Geschichte uns anmutet, ist sie verständlich, wenn man wahrnimmt, dass Nadab und Abihu „das Feuer für den Weihrauch“ nicht von dem „bleibenden Feuer auf dem Brandopferaltar“ nehmen, das vom NAMEN selbst angezündet worden war, sondern dazu ein ˀesch sarah, „fremdes Feuer“, verwenden, womit gemeint ist: „fremd, nicht-von-uns und im späteren Hebräisch auch abgöttisch“. Das heißt, die Tora selbst verbietet es Priestern mit schärfstem Nachdruck, eigene Machtinteressen zu verfolgen und damit gegen den Willen des befreienden und Recht schaffenden NAMENS zu verstoßen (Z25):
Darum geht es in dieser Geschichte: Es darf in Israel kein Platz sein für freie Unternehmer in Religion. Der Kultus ist ein schwer bewachtes Gebiet. Nicht wegen eines magischen Tabus, sondem wegen der Gefahr, daß hier nach der Gewalt über die Seelen des Volkes gegriffen wird. Die kultischen Gesetze in Leviticus dürften wohl einmal einen limitierenden Charakter gehabt haben, und sie sind wohl nur deshalb so detailliert, um selbständige Initiative der Priester soweit wie möglich auszuschließen. Die jüdische Tradition hat das jedenfalls sehr stark so verstanden.
Andreas Pangritz (P38) geht in seiner Analyse von Markus 7,1-23 davon aus, dass Jesus auch nach dem Markusevangelium die „Denkkategorie der Reinheit“ nicht einfach aufgibt. Da unser diesbezügliches modernes Befremden aber in gewisser Weise „schon in der Antike“ vom „griechisch-römischen Westen … dem persisch-indischen Osten“ gegenüber geteilt worden zu sein scheint, sah
sich schon der Verfasser des Markus-Evangeliums gezwungen…, seinen heidnisch-westlichen Lesern zu erklären, daß die Juden (oder meint er die aus galiläischer Sicht besonders pingelichen Judäer?) „vieles übernommen haben einzuhalten“: wie die „Überlieferung der Alten“, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, so auch „Eintauchungen von Töpfen und Krügen und Kupfergeschirr und Krankenlagern“ (V. 4). Man ist gewohnt, dies als spöttische Distanzierung vom Judentum zu lesen. Hat man aber erst einmal akzeptiert, daß der synoptische Jesus auch in dieser Erzählung sich keineswegs vom „System der Unreinheit“ distanziert, sondem nur von seiner heuchlerischen Interpretation durch die Jerusalemer Pharisäer und Schriftgelehrten, dann wird deutlich, daß der Verfasser hier eine Information einschiebt, die die heidnischen Leser wissen müssen, um die Brisanz des Streites überhaupt verstehen zu können.
Nicht um die Abschaffung der Reinheitsgebote geht es Jesus also auch nach Markus, sondern um ihre „strengere, ins Herz dringende und aus dem Herzen hervorgehende“ Einhaltung, das heißt (P38f.), es kommt
darauf an, daß das Reinheitsgebot in der messianíschen Gemeinde nicht nur im „kultisch-zeremoniellen“, sondem auch im „ethischen“ Sinn verwirklicht wird, daß es sich im täglichen Lebensvollzug materialisiert. …
Schon in der hebräischen Bibel ist dem Reinheitsgesetz eine „ethische“ Dimension keineswegs fremd; vielmehr fließen kultlsche und ethische Aspekte untrennbar ineinander: es geht um die Reinigung des ganzen Menschen.
Die Abschweifung in diese Aufsätze von Zuurmond und Pangritz verstehe ich erstens als Anregung, sich ausführlicher mit ihnen zu befassen (wie überhaupt die gesamte exegetische Zeitschriftenreihe Texte & Kontexte sehr zu empfehlen ist), und zweitens als Warnung davor, moderne Antipathien gegenüber rituellen Reinheitsgeboten vorschnell auf Jesus bzw. die von ihm erzählenden Evangelisten zu übertragen.
↑ Johannes 3,26-27: Johannesjünger reagieren eifersüchtig auf den Tauferfolg Jesu
3,26 Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm:
Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast,
siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm.
3,27 Johannes antwortete und sprach:
Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
3,28 Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe:
Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt.
Hartwig Thyen (T229) macht in Johannes 3,26 auf die „Wendung ide {siehe}“ aufmerksam, die „das überraschte Erstaunen der Täuferjünger darüber“ ausdrückt,
daß auch Jesus tauft. Und ihre Meldung: pantes erchontai pros auton {alle kommen zu ihm}, impliziert wohl ihre Enttäuschung darüber, daß der Stern ihres Meisters jetzt zu sinken beginnt.
Thyen vermutet hier ein „absichtsvolles Gegenstück zu dem anfänglichen ,Erfolg‘ des Täufers“, wie er in Markus 1,5 dargestellt wird (nach Luther 2017):
Und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden.
Da die Johannesjünger „eine ähnliche Angst wie die Pharisäer“ in 12,19 äußern, ist es Thyen zufolge dringend,
daß Johannes seine alte martyria {Zeugnis} jetzt erneuert. Wohl haben sie dieses Zeugnis, wie das Perfekt memartyrēkas {du hast Zeugnis abgelegt} zeigt, durchaus noch im Ohr. Aber da ist es offenbar steckengelieben, denn anders als ihre Gefährten Andreas und sein anonymer Begleiter (1,35ff) haben sie sich diese martyria immer noch nicht zu Herzen genommen. Und das macht ihre Wiederholung notwendig.
Auch Klaus Wengst weist darauf hin (W126), dass im Gespräch zwischen Johannes dem Täufer und seinen Schülern mehrfach auf dessen erstes Zeugnis für Jesus als den Messias in Kapitel 1 zurückgegriffen wird. Die Schüler selbst tun es eingangs, und Johannes nimmt sie selbst als Zeugen eben dafür, dass er bezeugt hat: „Er [Johannes] ist nicht der Gesalbte, sondern der vor ihm [Jesus] her Gesandte.“ An dieser Stelle klingt Wengst zufolge nun doch die Prophetenstelle Maleachi 3,1 an, die in Johannes 1 vermieden worden war, um Johannes nicht mit Elia zu identifizieren.
Thyen (T230) hält es für „durchaus möglich, schwerlich jedoch definitiv entscheidbar“, ob „hier mit Lk 7,27 Mal 3,1 im Hintergrund steht“, drückt aber vor allem sein Erstaunen darüber aus, dass das Wort „emprosthen {vor} bisher stets umgekehrt ausschließlich das ‚Voraus- und Überlegensein‘ des präexistenten Jesus vor Johannes ausdrückte (1,15.30).“
Auf die eifersüchtige Aussage seiner Schüler, „dass ‚alle‘ zu Jesus gingen“, antwortet Johannes Wengst zufolge (W126) mit einem
allgemeingültigen Satz: „Ein Mensch kann aber auch nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben wäre.“ Damit wird herausgestellt, dass Jesus kein Usurpator ist, der sich anmaßt und nimmt, was ihm nicht zukommt.
Dazu merkt Wengst an (Anm. 149), dass der Exeget Michael Theobald <288> „diese Aussage nicht auf Jesus beziehen“ will,
weil sie der Christologie des Evangelisten nicht entspreche: „Für ihn ist Jesus kein ,Mensch‘, dem etwas ,vom Himmel gegeben‘ werden müsste, sondern er stammt selbst in persona von dorther“.
Auch Thyen meint (T229), dass Johannes
als der von Gott als Zeuge des ,Lichtes‘ gesandte anthrōpos {Mensch} (1,6) wohl schon hier eher von der göttlichen Notwendigkeit (dei) seines eigenen elattousthai {Abnehmens} als von Jesu auxanein {Wachsens} (V. 30) reden [dürfte].
Aber warum sollte Johannes nicht sowohl von Jesus als auch von sich selbst reden? Genau an dieser Stelle könnte bestätigt sein, dass Höhe und Tiefe der angeblich so hohen Christologie des Johannes genau darin zusammenfallen, dass es eben der Mensch Jesus in seiner konkreten Biographie ist, der sowohl Israel in seinem Kreuzesleiden als auch den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert. In Jesus nimmt kein übermenschliches Himmelswesen Fleisch an, sondern das Wort des NAMENS, von dem sich der Mensch Jesus gesandt und mit dem er sich eins weiß.
Ton Veerkamp <289> sieht in den Versen 26 und 28 den Prozess widergespiegelt,
in dem die Johannesgruppe in jenen messianischen Gruppen aufging, die Jesus als den Messias sahen. Dieser Prozess war in den Tagen der Abfassung des Johannesevangeliums noch nicht abgeschlossen. Johannes [der Evangelist] muss ähnlich wie die Synoptiker das Verhältnis zwischen beiden Gruppen klären. Die messianischen Gemeinden um Jesus redeten über Johannes [den Täufer] nie anders als mit der größten Hochachtung.
Johannes erinnert seine Schüler daran, dass er immer gesagt habe, er, Johannes, sei nicht der Messias, sondern er sei dem Messias vorausgeschickt worden. Die Schüler des Johannes lebten in der Erwartung des Messias, sie sahen ihn nicht als den Messias.
↑ Johannes 3,29-30: Johannes als der Freund des messianischen Bräutigams
3,29 Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam;
der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und ihm zuhört,
freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams.
Diese meine Freude ist nun erfüllt.
3,30 Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
[5. Mai 2022] Nach Klaus Wengst (W126) wird die „Zeugenschaft“ des Johannes in Vers 29
in einem neuen Bild ausgeführt, das das Verhältnis zwischen Jesus und Johannes mit dem zwischen dem Bräutigam und seinem Freund vergleicht.
Mit dem Freund des Bräutigams ist nicht irgendein Freund gemeint, sondern ein bestimmter, der eine institutionalisierte Funktion wahrnimmt: sein „Hochzeitsbeistand“ (schoschvín).
Dieser Freund (W127) „tritt für den Bräutigam als Zeuge ein und teilt seine Freude“, wobei mit dem Bild „von der Hochzeit … zugleich die messianische Dimension“ anklingt. Dabei weist Wengst darauf hin, dass die jüdische Tradition, wo sie „in messianischem Kontext von erfüllter Freude“ spricht, sich allerdings zurückhaltend äußert:
Im Psalmenmidrasch werden Ps 98,1 und Jes 42,10 so in Verbindung gebracht, „dass man in der kommenden Zeit ein Lied singen wird wegen der Hilfe an Israel. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Rabbi Acha sagte: ,Solange Israel im Exil weilt, ist gleichsam die Rechte des Heiligen, gesegnet er, versklavt. Aber wenn die Israeliten befreit werden – passt auf, was geschrieben steht: Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm.‘“ Nach dem Zitat von V. 3-7 des Psalms wird fortgefahren: „All das wegen des Exils Israels, um dich zu lehren, dass es keine vollkommene Freude gibt, bis die Israeliten befreit sind“. <290> Ein anderer Midrasch stellt fest: „Obwohl ein Mensch sich in dieser Welt freut, ist seine Freude nicht vollkommen.“ Das wird begründet und danach die Verheißung von Jes 25,8 zitiert, dass Gott den Tod auf immer verschlinge. „Zu der Stunde ist vollkommene Freude“. <291>
Auch wenn Wengst es nicht ausdrücklich sagt, erlauben diese Parallelen die Annahme, dass der Evangelist Johannes mit dem Bild der messianischen Hochzeit und der erfüllten Freude des Hochzeitsbeistands darauf anspielt, dass Johannes der Täufer sich bereits jetzt auf die baldige Befreiung Israels durch das Wirken des Messias Jesus freut – in einer Weltzeit hier auf Erden, in der sogar der Tod überwunden sein wird.
Nach Hartwig Thyen (T230) greifen die Hochzeitsmetaphern in Vers 29 „symbolische Obertöne“ auf, die bereits „in der Kanaerzählung … über der Rede von der Hochzeit, vom Bräutigam und von der unermeßlichen Fülle des köstlichen Weines, ,der Wasser gewesen war‘,“ erklungen sind und
als Ausdruck der eschatologischen Freude der Erlösten schon lange in den Bestand der Enzyklopädie Israels eingegangen waren (vgl. Israel als Braut oder Ehefrau JHWHs: Jes 62,4f; Jer 2,2; 3,20; Ez 16,8 ff; Hos 2,21; Zeph 3,17; die Kirche als Braut Christ: 2Kor 11,2; Eph 5,25ff; Apk 21,2; 22,17).
Indem jetzt auch die Braut genannt wird, „die bei der Kanaerzählung ja förmlich fehlte, obgleich sie doch neben dem Bräutigam fraglos die Hauptperson einer Hochzeit ist“, und außerdem der Freund des Bräutigams und die hochzeitliche Freude, „macht Johannes das Ensemble der Hochzeit erst vollkommen.“ Auch hier stellt Thyen Anspielungen auf die synoptischen Evangelien fest, etwa auf die „hyioi tou nymphōnos {Söhne der Brautkammer = Hochzeitsgäste}“, die nach Markus 2,19 „nicht trauern können, solange der Bräutigam unter ihnen ist“, oder auf die Menschen dieses Geschlechts, denen der Zeuge Johannes gewiss nicht gleicht, die nach Lukas 7,31f. „wie die lustlosen Kinder auf dem Marktplatz ,Hochzeit‘ und ,Beerdigung‘ spielen und sich am Ende als Spielverderber beschimpfen“.
Außerdem ruft Johannes nach Thyen sehr direkt Aussagen aus dem Prophetenbuch Jeremia über die Stimmen von Bräutigam und Braut auf:
Das Erklingen der „Stimme“ von Bräutigam und/oder Braut ist bei Jeremia nahezu sprichwörtlich als Äußerung der Freude der Erwählten. Aber wegen der Sünde Israels sind diese Stimmen verstummt, und mit ihnen ist die Freude verschwunden: Jer 7,34; 16,9; 25,10; Bar 2,23. Erst im Eschaton {Endzeit}, wenn JHWH das Los Judas und das Geschick Jerusalems wendet, „wird man wieder Freuden- und Wonnerufe hören, den Jubel des Bräutigams und das Jauchzen der Braut“ (Jer 33,11).
Statt diese Hintergründe jedoch konkret daraufhin auszuloten, was sie über die vom Evangelisten ausgedrückte Zukunftserwartung aussagen mögen, etwa im Blick auf die Befreiung Israels, äußert sich Thyen in etwas widersprüchlich klingenden Sätzen über das Gleichnis von Bräutigam und Braut:
Der Satz, ho echōn tēn nymphēn nymphios estin {wer die Braut hat, der ist der Bräutigam}, ist formal die Eröffnung eines Gleichnisses. Doch schon der situative Kontext zeigt, daß dieses Gleichnis einzig der Vermittlung der Antwort des Johannes auf die implizite Frage seiner Jünger dient. Zu ihrer von Angst und Eifersucht geprägten Meldung, daß jetzt „alle zu Jesus kommen“, während die eigene Gefolgschaft sichtbar schwinde, erklärt er: „Wer die ,Braut‘ hat der ist der ,Bräutigam‘“. Obwohl das so eröffnete Gleichnis seinen Sinn in sich selbst hat, darf und muß man seine Sätze wohl zugleich vor dem Hintergrund der biblischen Rede von JHWH als dem Bräutigam und Israel als seiner geliebten Braut und von der verheißenen eschatologischen Erneuerung dieses Verlöbnisses mit der Ungetreuen lesen.
Mir scheint, dass Thyen zwar nicht übersehen kann, wie klar das Gleichnis von der messianischen Hochzeit die Befreiung Israels in der kommenden Weltzeit in den Blick nimmt, aber den Konsequenzen dieser Einsicht dennoch ausweicht, indem er die Identifizierung des Bräutigams mit Jesus statt mit dem Täufer in den Vordergrund der Auslegung stellt und sich im Folgenden auf den Freund des Bräutigams konzentriert.
Auch Thyen sieht (T230f.) im
philos tou nymphiou {Freund des Bräutigams} … eine verständliche Gräzisierung des hebräischen Lexems schoschbin… Dieser schoschbin ist der zum „Brautführer“ erwählte Freund des Bräutigams <292>. Er ist vom Freund und durch die Sitte dazu bestimmt, dem Bräutigam seine Braut zuzuführen (und sie nicht etwa, wie es die eifersüchtigen Johannesjünger wohl gerne hätten, als die Seine zu beanspruchen). Als derart selbstloser und damit wahrer Freund steht der rechte Brautführer da und lauscht (ho hestēkōs kai okouōn {der bei ihm steht und ihn hört}), und in unbändiger Freude freut er sich über das Erklingen der Stimme des Bräutigams.
Dabei weist Thyen darauf hin, dass die „Wendung chara chairei {sich mit Freude freuen} … dem hebräischen infinitivus absolutus (vgl. etwa den Ausdruck: moth jamuth {des Todes sterben})“ nachempfunden ist. „Ist die ,Stimme des Bräutigams‘, wie wir gesehen haben, selbst schon Ausdruck der Freude, so freut sich dessen Freund also an der Freude des Freundes.“
Mit dem Satz, dass sich seine eigene Freude nun erfüllt habe, geht der Täufer über das Gleichnis hinaus und
identifiziert … nachträglich nicht nur sich selbst mit dem ,Freund des Bräutigams‘, sondern zugleich damit auch Jesus mit diesem Bräutigam des Gleichnisses. Er, Johannes, ist also von dem Freund, Jesus, durch die Sitte und in all dem zugleich durch eschatologische Notwendigkeit (dei) dazu bestimmt, ihm seine ,Braut‘ zuzuführen.
Darin, dass der Evangelist „es damit wagt, seinen Johannes in die exklusive und einzigartige Rolle dessen zu versetzen, den Jesus dazu erwählt und ausgezeichnet hat, ihm als ,sein Freund‘ das Volk als seine Braut zuzuführen“, erkennt Thyen wiederum ein Spiel mit Lukas 7,28 (Luther 2017):
Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes; der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er.
Schließlich parallelisiert Thyen auch die Art, wie Jesus bei seinem Abschied von seinen Jüngern deren Trauer in Freude verwandeln wird (Johannes 16,20.22), mit der Art, wie Johannes „hier als Scheidender…, auf den Kerker und Tod bereits warten (V. 24), … seine letzten Worte in unserem Evangelium“ spricht und „die Traurigkeit seiner Jünger in Freude verwandeln“ will. Wie Jesus (16,7) den eigenen Abschied als gut für seine Freunde darstellt, weil sonst der Paraklet nicht zu ihnen kommen kann,
so soll auch, gerade was die Johannesjünger beklagen, zum Grund ihrer Freude werden: „Er muß wachsen, ich aber schwinden“. Und das kann ja nur heißen, daß auch sie sich endlich aufmachen sollen, den Weg des Andreas und seines namenlosen Gefährten zu gehen, damit sie teilgewinnen an den Freuden des Bräutigams und seines ,Freundes‘.
Über die Ausführungen von Wengst und Thyen hinaus beschäftigt Ton Veerkamp <293> sich auch näher mit der Bedeutung des Satzes: „Bräutigam ist der, der die Braut hat“, den die beiden anderen nicht weiter hinterfragen:
In den meisten altorientalischen Gesellschaften „hat“ der Mann als Haupt der Hauswirtschaft, als „Eigentümer“, seine Frau als „Eigentum“; seine Frau gehört ihm wie alles weitere, das „sein ist“, Exodus 20,17. Das „Besitzen einer Frau“ ist eigentümlich für eine patriarchalische Gesellschaft.
Was ist damit aber für das Verhältnis von Bräutigam und Braut ausgesagt, wenn es die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel versinnbildlicht? Wird das Wort „haben“ hier überhaupt für einen solchen patriarchalischen „Besitzanspruch“ verwendet? Da „die semitischen Sprachen“ das „Verb haben“ überhaupt nicht kennen, ist es schwierig, nachzuvollziehen, was der Evangelist konkret mit dem Wort echein, „haben“, ins Griechische übertragen wollte:
Vielleicht müsste man übersetzen: „Wer die Braut zu eigen hat, der ist der Bräutigam.“ Wir müssen den Unterschied zwischen nachala, „Eigentum“, und ˀachusa, „Besitz“, sehen, zwischen dem, was einer Familie untrennbar als Basis für ihren Lebensunterhalt gehört, ihr zu eigen ist, und dem veräußerbaren Besitz, wie Ochs und Esel oder Sklaven aus fremden Völkern (Leviticus 25,44f.). <294> Israel ist das Eigentum und nicht der Besitz des NAMENS, Psalm 33,12:
Glücklich die Nation, für die der NAME Gott ist,
das Volk, das er sich zu eigen erwählte.
Dieser Unterschied zwischen „zu eigen haben“ und „besitzen“ markiert daher geradezu den entscheidenden Unterschied zwischen dem Gott Israels als dem befreienden und Recht schaffenden NAMEN einerseits und allen falschen Göttern, die im Dienst der Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen durch Menschen stehen:
Das Verhältnis zwischen dem NAMEN und Israel ist eben nicht das Verhältnis zwischen Besitzer (Baal) und Besitz. Das heißt, es steht Israel nicht frei, nach einem Baal – Herrn, Besitzer, Gatten, eben „Gott“ – Ausschau zu halten.
Am deutlichsten tritt dieser Unterschied zwischen dem NAMEN und Baˁal in einer Prophetenstelle hervor, die Thyen in seiner Aufzählung der Bibelstellen mit messianischen Hochzeitsmetaphern unerwähnt gelassen hat (Hosea 2,18 – Luther 2017):
An jenem Tage geschieht‘s, spricht der HERR, da wirst du mich nennen „Mein Mann“ und nicht mehr „Mein Baal“.
Während Israel unter der römischen Herrschaft dem Kaiser wie einem fremden Baalsgott unterworfen ist und Johannes der judäischen Führung vorwirft, sich ihm sogar freiwillig zu beugen (Johannes 19,15), erwartet Johannes Veerkamp zufolge mit Freude die Überwindung der Weltordnung durch den Messias Jesus, wenn mit dem Anbruch der kommenden Weltzeit die Hochzeit des NAMENS mit seinem Volk gefeiert werden kann:
Die messianische Hochzeit ist eine Hochzeit nach Hosea 2,18. Der Bräutigam hat die Braut, aber das heißt eben nicht: er ist ihr baˁal, ihr Herr Besitzer.
Welche Rolle spielt nun der „Freund des Bräutigams“ bei dieser messianischen Hochzeit? Wie Thyen und Wengst sieht auch Veerkamp den hestēkōs, „Beisteher“, in seiner Funktion „als (orientalischer) Trauzeuge“. Indem sich Johannes der Täufer mit diesem identifiziert, erhält
in dieser zweiten Hochzeitserzählung im Johannesevangelium … das Hauptzeichen in Kana seine eigentliche Dimension. Der Bräutigam ist der messianische König, die Braut ist Israel. … Johannes [der Täufer] ist der wichtigste aller Hochzeitsgäste, er ist der architriklinos aus Johannes 2,1ff.: „Auch ich wusste nichts von ihm“, sagte Johannes, 1,34, genauso, wie der architriklinos nicht wusste, wo der Wein herkam (2,9). Jetzt weiß der Freund. Denn er hört die Stimme des Bräutigams.
Diese „Stimme des Bräutigams“ ist Veerkamp zufolge „aus der Schrift sehr gut“ bekannt, wo sie (worauf auch Thyen aufmerksam gemacht hat) mehrfach im Buch Jeremia erklingt:
Dreimal lässt Jeremia diese Stimme wie einen finsteren Refrain hören, einmal wie eine Freudenbotschaft. In Jeremia 7,34 (vgl. 16,9 und 25,10) hören wir:
Ich will verabschieden aus den Städten Judas, aus den Straßen Jerusalems,
Stimme der Wonne und Stimme der Freude,
Stimme des Bräutigams und Stimme der Braut,
denn zu einer Einöde wird das Land.Aber in 33,10f. heißt es:
So hat der NAME gesagt:
Ja, gehört wird wieder in diesem Ort,
wovon ihr sagt: verödet ist er,
ohne Mensch, ohne Vieh,
und von den Städten Judas, von den Straßen Jerusalems:
verwüstet, kein Mensch, kein Bewohner, kein Vieh,
Stimme der Wonne, Stimme der Freude,
Stimme des Bräutigams, Stimme der Braut,
Stimme derer, die sagen:
Dankt dem NAMEN der Ordnungen,
denn gut ist der NAME,
in Weltzeit seine Solidarität … (= Psalm 136)Um die „erfüllte Freude“ geht es, die endgültige messianische Wende für eine Stadt, wo nur die Stimme des Krieges gehört wird und die in den Tagen des Evangelisten Johannes verwüstet ist. In den Tagen der messianischen Hochzeit tritt der Prophet – Jeremia, Johannes [der Täufer] – zurück. Der Messias, der Bräutigam, soll zunehmen, wogegen dieser geringer werden soll. Gegen diesen Hintergrund will der Evangelist den Prozess der wachsenden messianischen Gemeinde und die schrumpfenden Gruppen der Täuferschüler gedeutet sehen.
In den Augen von Wengst (W127) ist die „Aussage ‚Jener muss wachsen und ich kleiner werden‘ … sowohl Konsequenz der vorgenommenen Zuordnung von Johannes und Jesus als auch Überleitung zum nächsten und letzten Redeabschnitt des Johannes.“ Wie (Anm. 152) „der Hochzeitsbeistand … überflüssig geworden“ ist, „wenn Bräutigam und Braut sich haben und ihr Zusammenleben gut verläuft“, so kann Johannes nun „abtreten“, nachdem er Jesu Auftritt „vorzubereiten“ und ihm „mit seinem Zeugnis beizustehen“ hatte (W127f.):
Der Zeuge, der zunächst die Szene betritt und mit seiner Person für sein Zeugnis einsteht, muss sich selbst überflüssig machen, um dem von ihm Bezeugten den Platz zu überlassen. Will er wirklich Zeuge sein, darf er dem Bezeugten nicht im Wege stehen. Er muss von der Bühne abtreten, um jenem Raum zu geben. Von daher ist es angemessen, dass das nun folgende letzte Redestück des Johannes (V. 31-36) nichts enthält, was für seine Person spezifisch wäre, sondern genauso gut Jesusrede sein könnte. Auf diese Weise vermag der Evangelist in aller Klarheit herauszustellen, dass der Zeuge letztlich den Bezeugten selbst zu Wort kommen lassen muss.
↑ Johannes 3,31-33: Ein Zeugnis von der Erde für den, der vom Himmel kommt
3,31 Der von oben her kommt, ist über allen.
Wer von der Erde ist, der ist von der Erde
und redet von der Erde.
Der vom Himmel kommt, ist über allen.
3,32 Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er;
und sein Zeugnis nimmt niemand an.
3,33 Wer aber sein Zeugnis annimmt,
der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.
[6. Mai 2022] Ähnlich wie Wengst sieht auch Thyen (T231) die nun folgenden Verse als ein Bekenntnis des Johannes, in dem er „den Gehalt der ‚Stimme des Bräutigams‘“ offenbart. Was (T232) im Gespräch mit Nikodemus ab Vers 13 in eine Jesusrede als Verkündigung der Stimme des Geistes einmündete, das entspricht in den Versen 31-36 einem Glaubensbekenntnis des Johannes. In Vers 31 muss schon deswegen weiterhin Johannes als Sprecher angenommen werden (T233), weil kein „normaler Leser“ nachvollziehen könnte, dass hier nun plötzlich ein anderer, der gar nicht genannt wird, das Wort ergreifen soll. Und wenn man, wie es viele Exegeten tun, davon ausgeht, dass hier Jesusworte an einen anderen als den ursprünglichen Platz verschoben worden sind, dann müsste es schon „ein etwas beschränkter Redaktor“ gewesen sein, der aus Versehen die Verse 31-36 „doch tatsächlich Johannes in den Mund gelegt hätte.“
Hartwig Thyen (T232) beschäftigt sich zu Vers 31 zunächst mit textkritischen Überlegungen, da viele Handschriften hier die letzten drei Worte epanō pantōn estin, „ist über allen“, auslassen, so dass die Worte ho ek tou ouranou erchomenos, „der vom Himmel kommt“, als Subjekt zum nächsten Vers gezogen werden müssten. Er entscheidet sich aber für die vorliegende Lesart, denn „[d]erartige Wiederholungen, die das Vorige zugleich rhetorisch variieren, gehören zur persönlichen Handschrift unseres Evangelisten.“
Eingehend beschäftigt sich Thyen mit der Frage, auf wen sich das Sein und das Reden ek tēs gēs, „von der Erde“, bezieht. Theodor Zahn <295> hatte behauptet, nachdem hier „von der Erhabenheit Jesu“ die Rede sei, „aber nicht mehr im Gegensatz zu dem neidlos hinter ihn zurücktretenden Täufer, den seine Jünger zu einem eifersüchtigen Nebenbuhler hatten machen wollen, sondern im Gegensatz zu den erdgeborenen Menschenkindern“, könne schon
„mit dem nächstfolgenden Satz: ,Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her‘, der Täufer nicht sich selbst gemeint haben und insbesondere nicht sein eigenes Reden beurteilt haben“. Dieses Urteil ist in den vergangenen acht Jahrzehnten oft wiederholt und variiert worden.
So meint (T233) Ulrich Wilckens, <296> dass zweifellos jetzt „Jesus selbst wieder das Wort“ nimmt:
Vom Menschen allgemein ist hier die Rede, nicht etwa von Johannes, wie einige Ausleger meinen: Dieser hat als von Gott gesandt (1,6) keineswegs ,Irdisches‘ gesagt, sondern vielmehr ,für die Wahrheit Zeugnis abgelegt‘ (5,33)“.
Dagegen wendet Thyen mit Karl Barth <297> ein:
„Es ist eine jämmerliche Zerstörung dieser schönen Stelle, wenn man mit Zahn meint, das Folgende könne Johannes der Täufer nicht von sich selbst gesagt haben. Als ob es irgendeinen Sinn hätte, wenn Jesus hier in seinem Unterschied zu den anderen gewöhnlichen Menschen, den Nicht-Propheten, charakterisiert würde. Nein, was der Täufer da sagt, das ist er selber: der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde aus.“ Die „Jämmerlichkeit“ von Zahns Auslegung besteht darin, daß der Täufer, wenn er hier nicht zugleich auch von sich selbst redete, seine Gemeinschaft mit den „erdgebundenen Menschenkindern“ aufkündigte und sich der „Solidarität der Sünder“ entzöge.
Das Gegenüber von Himmel und Erde ist also kein absolut zu setzender dualistischer Gegensatz, sondern es ist „aus der biblischen Kluft zwischen dem heiligen Gott und der sündigen Menschheit zu erklären“. Daher sieht Thyen (T234)
in dem fast tautologischen Satz mit dem dreifachen Vorkommen des Lexems gē {Erde} ein absichtsvolles Abweichen von allem „Definitorischen“ und von jeglicher „dualistischen Wesensbeschreibung“. Hier „bekennt“ und „bezeugt“ vielmehr ein Glaubender, daß vor dem Heiligen Gott alle Menschen Sünder sind.
Bedenklich finde ich es allerdings, wenn Thyen sich mit einer so allgemeinen Formulierung auf den Gott Israels bezieht. Natürlich ist es richtig, dass Gott heilig ist und dass alle Menschen Sünder genannt zu werden verdienen. Aber Thyen sieht völlig davon ab, dass der Gott Israels einen konkreten NAMEN trägt, nämlich denjenigen der Befreiung aus jeglischem Sklavenhaus, und dass die Worte, die wir als Christen mit „Sünde“ übersetzen, sich auf die Abirrung von diesem Ziel der Befreiung beziehen. Das birgt die Gefahr, die Beziehung der Menschen zu Gott eben gerade nicht als befreiende, sondern als abhängig machende Erfahrung zu begreifen. Das wird in der weiteren Argumentation Thyens noch deutlicher, wenn er die Zeugenschaft des Johannes mit späteren Kategorien der neuzeitlichen Theologie und Philosophie zu umschreiben versucht:
Der Zeuge kommt her von einer Begegnung mit dem Absoluten: „Ich sah den Geist wie eine Taube herabschweben und auf ihm bleiben. … Und es steht mir vor Augen und ich bezeuge es: Dieser ist der Sohn Gottes“ (1,32-34). Allein davon zeugt sein Zeugnis. Mit ihm steht und fällt er: Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen, abnehmen bis dahin, daß der martys {Zeuge} zum Märtyrer wird. Im Blick auf die alte Lessing-Kierkegaardsche Frage nimmt der Zeuge tatsächlich das Recht in Anspruch, ein zufälliges Moment der Geschichte mit absolutem Charakter und ewiger Bedeutung zu bekleiden. … In der Begegnung mit dem Absoluten und unter der unentrinnbaren anankē {Zwang, Schicksal, Notwendigkeit}, die ihn fortan nötigt, ist der Zeuge zu einem Neugeborenen geworden. Da hat er die exousia {Vollmacht} empfangen, ,Gottes Kind zu werden‘ (1,11). Allein darin ist sein Zeuge-Sein gegründet. Wohl ist der Zeuge, wenn er auch ek tēs gēs {von der Erde} ist und bleibt, und nur ,lrdisches‘ (ek tēs gēs) redet und zu reden vermag, ein gerechtfertigter Sünder, aber eben auch als Gerechtfertigter ein Sünder.
Hier kommt deutlich reformatorisch-christliche Theologie zum Ausdruck, aber es ist sehr zu bezweifeln, dass Johannes so vom Verhältnis zwischen einem allgemein-göttlichen Absoluten und der allgemein-menschlichen Geschichte gedacht hat. Auch frage ich mich, ob der Begriff der anankē, der in der griechischen Philosophie die Verstrickung in ein von den Göttern verhängtes ausweglos-tragisches Schicksal bezeichnet, das richtige Wort für ein Zeugnis ist, das auf das befreite Leben der kommenden Weltzeit ausgerichtet ist.
Indem Thyen in der Erwählung des „Johannes vor allen anderen … zu besonderem Dienst“ weiterhin ein „intertextuelles Spiel“ mit Lukas 7,28 am Werk sieht, wo Johannes zugleich als größter „unter denen, die von einer Frau geboren sind“, und als „der Kleinste im Reich Gottes“ bezeichnet wird, meint er diese Gleichzeitigkeit sogar mit folgenden dogmatisch-christlichen Erwägungen von Eberhard Jüngel <298> in Verbindung bringen zu können (T234f.):
„Es ist nicht wahr, daß der Glaube den Menschen mit sich selbst identisch macht. Der Sünder will mit sich selbst identisch werden. Der Glaubende unterscheidet sich vom Sünder nicht dadurch, daß er der endlich mit sich selbst identisch gewordene Mensch ist. Sondern vom Sünder unterscheidet sich der Glaubende dadurch, daß er nicht mehr mit sich selbst identisch zu werden braucht. Als Glaubender ertrage ich die Unterscheidung des Menschen von sich selbst, indem ich Gott zwischen mir und mir wohnen lasse“.
Auch Ton Veerkamp, <299> der in den Versen 31-36 „eine Art von zusammenfassender Erläuterung des großen Abschnitts über die Tätigkeit des Messias in Judäa“ sieht, lehnt von der jüdischen Bibel her eine dualistische Entgegensetzung von Himmel und Erde ab:
Es gibt zwar einen eindeutigen Unterschied zwischen Himmel und Erde, aber keinen Gegensatz. Erde ist kein Synonym für Weltordnung. Psalm 115,16 sagt: „Die Himmel sind die Himmel des NAMENS, die Erde gab er den Menschenkindern.“ Dieses Fragment zeigt, dass es keinen Gegensatz gibt. Von der Schrift Israels gibt es hier keinen Dualismus, der Gott Israels ist „der Macher (ˁoße) von Himmel und Erde“ (Psalm 115,15).
Wie ist auf diesem Hintergrund aber das Gegenüber von Himmel und Erde in Johannes 3,31 auszulegen? Veerkamp identifiziert den „von oben [Himmel] Kommenden“ mit dem „bar enosch“, dem „MENSCHEN“ aus Daniel 7, wie er diese nach so vielen bestialischen Herrschern endlich menschlich regierende Macht bezeichnet. Zu den textkritischen Problemen meint er, dass man „nach der Analogie der ersten zwei Zeilen … erwarten“ würde:
„er redet von der Erde / Der vom Himmel Kommende … redet vom Himmel.“ Nicht zufällig ist die vierte Zeile schlecht überliefert. Aber sie erinnert an das Gespräch mit Nikodemus, 3,12f.
Diese Beobachtung mag durchaus dafür sprechen, dass diese und die nun folgenden Worte im Mund des Täufers die vorherige Rede Jesu im Anschluss an das Gespräch mit Nikodemus im Sinne eines Bekenntnisses aufnehmen, obwohl Veerkamp selbst es dahingestellt sein lässt, ob sie dem Täufer zuzuschreiben sind. Wenn das der Fall ist, könnte der Evangelist andeuten wollen, dass Nikodemus nicht einmal willens oder in der Lage war, von Jesus geäußerte irdische Dinge zu akzeptieren (vgl. die Auslegung von Johannes 3,12), während Johannes der Täufer eingesteht, dass er selbst zwar nur „von der Erde“ reden kann, aber dennoch als der Zeuge Jesu zugleich auf den hinzuweisen hat, der vom Himmel gesandt ist und im Auftrag des Gottes Israels zu reden weiß.
In einer Anmerkung zu seiner Übersetzung von Vers 31 aus dem Jahr 2005 <300> begreift Veerkamp inhaltlich die Gegenüberstellung von Himmel und Erde nicht als wesensmäßige, „ontologische Aussage“, sondern als „eine praktische Festlegung“:
Von seinen Reden (lalei {redet}), von seinen devarim, Worten und Taten her bestimmt sich das Sein eines Menschen, nicht von seiner Natur her. Aus seinen Taten kann man schließen, ob ein Mensch vom Himmel her denkt, handelt, redet oder nicht, ob er der Treue Gottes zu Israel gemäß denkt, handelt und redet oder nicht. Die Metapher „oben“ oder „von oben“ (anō, anōthen, 3,3.7.31; 8,23; 11,41!; 19,11!) bezeichnet keine metaphysische Transzendenz {übernatürliche Jenseitigkeit}. Im Denken der damaligen Juden kann ein Mensch nie aufhören, „Fleisch“ oder „irdisch“ zu sein. Er kann aber sehr wohl das scheinbar Schicksalhafte seiner Existenz aufheben, indem er „Fleisch“ oder „irdische Verhältnisse“ als herrschende Verhältnisse überwindet und sich für eine neue Erde – und dann auch einen neuen Himmel! – entscheidet. Das ist etwas anderes als Gnosis, Abschaffung der Erde und des Fleisches.
Damit sind einige abwegige Auslegungsmöglichkeiten unseres Textes aus dem Weg geräumt, aber es ist immer noch nicht jede Unklarheit über das Verhältnis des Irdischen und Himmlischen in den Versen Johannes 3,12 und 31 beseitigt.
Eine weitere Unklarheit ergibt sich in meinen Augen aus der Art, wie Klaus Wengst (W128) den Vers 31 in engem Zusammenhang mit den folgenden beiden Versen 32 und 33 interpretiert. Ihm zufolge wird hier Jesus in seiner „Überlegenheit“ dargestellt, insofern er „von oben“ bzw. „vom Himmel kommt“:
Dem entspricht es, wie er im Prolog als „das Wort“ gekennzeichnet wurde und in 3,13 als „der Menschensohn, der vom Himmel herabgestiegen ist“. Mit der Herkunftsangabe „von oben“ bzw. „vom Himmel“ – dass Jesus „aus Nazaret“ kommt, ist für den Evangelisten selbstverständlich (1,45; 7,41f.51f.) – soll das Wirken Jesu, sein Reden, Handeln und Erleiden, in bestimmter Weise gekennzeichnet werden, dass es nämlich sozusagen die Qualität Gottes hat.
Diese Aussage wird nach Wengst durch den folgenden Vers 32 unterstrichen, indem er „Jesus gleichsam als unmittelbaren Zeugen Gottes herausstellt, der ‚das bezeugt, was er gesehen und gehört hat‘.“ Dadurch ergibt sich aber die Unklarheit, in welcher Weise hier von welchem Zeugen, Jesus oder Johannes dem Täufer, die Rede sein soll:
In die wiederholte Aussage von der geradezu himmelhohen Überlegenheit Jesu ist eingeschlossen: „Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde.“ Nach der im vorangehenden Kontext vorgenommenen zuordnenden Gegenüberstellung von Jesus und Johannes müsste nun bei diesem Gegenüber zu dem himmelhoch Überlegenen wiederum Johannes als der exemplarische Zeuge im Blick sein. Damit ist aber hier ein grundsätzliches Problem angesprochen: Der Zeuge ist „von der Erde“ und kann als solcher gar nicht anders, als „von der Erde“, also irdisch, zu reden. Und doch muss er Zeuge sein für einen, der nicht „von der Erde“ ist, der als „der von oben Kommende“ „das bezeugt, was er gesehen und gehört hat“. Wie soll das gehen?
Eben weil es einem menschlichen Zeugen von der Erde her unmöglich ist, ein Zeugnis über himmlische Dinge abzugeben, hält Wengst die Aussage im zweiten Teil des sich unmittelbar anschließenden Verses 32 für folgerichtig: „Kein Wunder, dass ‚niemand sein Zeugnis annimmt‘.“
Aber nun wird es kompliziert. Denn den ersten Teil von Vers 32 bezieht Wengst offensichtlich auf „das sozusagen unmittelbare Zeugnis Jesu selbst“, wozu er bemerkt, dass auch dieses allerdings „nicht seine himmlische Herkunft“ nachweist:
Die Überlegenheit Jesu liegt nicht offen zutage, sondern ist im Gegenteil verborgen im Weg ans Kreuz. Wenn es doch welche gibt, die dieses Zeugnis annehmen, ist das nur als Wunder zu begreifen, als Wirken Gottes selbst: „Wer sein Zeugnis annimmt, hat damit besiegelt, dass Gott verlässlich ist.“
Kann es sein, dass hier ineinander verschachtelt vom irdischen Zeugnis des Johannes für das himmlische Zeugnis Jesu die Rede sein soll? Lässt der Evangelist damit im Bekenntnis des Täufers nochmals die Frage Jesu an Nikodemus anklingen, dass diejenigen, die nicht einmal ein Zeugnis über irdische Dinge annehmen, auch nicht bereit sein werden, ein Zeugnis von himmlischen Dingen zu akzeptieren?
Anscheinend hat die Aussage von Vers 31 bereits bei den ersten Abschreibern des Evangeliums für erhebliche Verwirrung gesorgt; so erzählt beispielsweise Veerkamp:
Der Kopist von P66 (um 200) <301> hatte eine Vorlage, in der die dritte Zeile vorkam. Beim Abschreiben vergaß er sie, fügte sie aber in der Marge hinzu. Offenbar ist es für ihn logischer gewesen, gleich von der zweiten zur vierten Zeile überzugehen.
Nach dieser Logik wäre hier gar nicht von einem irdischen, sondern nur vom himmlischen Zeugnis Jesu die Rede gewesen. Auf das gleiche Ergebnis würde die Auslassung der letzten drei Worte epanō pantōn estin, „ist über allen“, am Ende von Vers 31 hinauslaufen, die von vielen Handschriften bezeugt wird, denn dann wäre ho ek tou ouranou erchomenos, „der vom Himmel kommt“, eindeutig als derjenige zu verstehen, der das bezeugt, was er dort im Himmel gesehen und gehört hat.
Hartwig Thyen (T235) beschäftigt sich nun in Vers 32 mit einem Unterschied in der grammatikalischen Form der beiden Verben „sehen“ und „hören“; das erste steht im Perfekt, das zweite im Aorist:
ho heōraken heißt, „was er vor Augen hat“, und überträgt diesen Gegenwartsaspekt zugleich auf den nachfolgenden Aorist als einen komplexiven.
Merkwürdig ist, dass Thyen den Aspekt des gegenwärtigen Sehens und Hörens so stark betont sieht. Denn eigentlich bezeichnet das griechische Perfekt ein in der Vergangenheit abgeschlossenes Geschehen, dessen Wirkung in der Gegenwart nach wie vor anhält, während der Aorist, wenn er komplexiv zu verstehen ist, das Ende einer in der Vergangenheit stattgefundenen Handlung bezeichnet. Um das Sehen auf die Gegenwart zu beziehen, muss er es daher mit „vor Augen haben“ umschreiben.
Folgende Schlussfolgerung zieht er aus seiner grammatikalischen Beobachtung:
Darum sollte man das hier genannte „Sehen“ und „Hören“ auch nicht auf eine mythische Vorzeit des im Himmel Präexistenten reduzieren, als habe der sich durch seine Fleischwerdung für eine Weile von dem getrennt, den er seinen Vater nennt, und erinnerte sich jetzt nur des einst Gesehenen und Gehörten. Denn auch von dem Fleischgewordenen gilt ja: monos ouk eimi, all‘ egō kai ho pempsas me ho patēr {ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat} (8,16) und kai ouk eimi monos, hoti ho patēr met‘ emou estin (16,32 {aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir}; vgl. 8,29). So vollziehen sich auch sein „Sehen“ und „Hören“ in der Gegenwart. „Der Sohn kann nichts von sich selbst her tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht“ (5,19) und „reden hört“ (8,47: ho ōn ek tou theou ta rhēmata tou theou akouei {wer von Gott ist, der hört Gottes Worte}).
Problematisch ist nicht diese Schlussfolgerung selbst, insofern Thyen darin zuzustimmen ist, dass Jesus im Johannesevangelium tatsächlich nicht als ein Himmelswesen dargestellt wird, das seinen Aufenthalt im Himmel nur vorübergehend für eine Stippvisite auf der Erde verlassen hat.
Ein Problem würde aber für Thyen dann entstehen, wenn die Grundlage, auf der sie beruht, gar nicht zutrifft, also wenn ho heōraken kai ēkousen, „was er gesehen und gehört hat“, doch ein in der Vergangenheit abgeschlossenes Sehen und Hören bezeichnen würde. Allerdings basiert dieses Problem hauptsächlich darauf, dass er selbstverständlich davon ausgeht, dass hier auf jeden Fall von einem Zeugnis Jesu die Rede ist.
Nach Ton Veerkamp muss man das nicht so sehen. Wenn der Vers 31 im mittleren Teil vom irdischen Zeugnis (lalei, „redet“) des Täufers spricht und dieses Zeugnis den Inhalt der beiden Sätze umfasst, die den mittleren Teil einrahmen, dass nämlich Jesus von oben bzw. vom Himmel gekommen ist, dann kann auch der erste Teil des Verses 32 das Zeugnis des Täufers meinen:
Der Zeuge ist, wie wir gesehen haben, Johannes. Das Zeugnis wird nicht angenommen. Man könnte ihm vertrauen, weil er das, was er gesehen und gehört hat, bezeugt.
Zwar wird in Johannes 1,18 und 6,46 mit der Verbform heōraken gesagt, dass nur derjenige, der am Busen des Vaters ist bzw. von Gott ist, den Vater „gesehen“ hat, aber nach 14,9 hat auch derjenige, der Jesus „gesehen“ hat, den Vater „gesehen“, und da Letzteres beispielhaft auf den Zeugen Johannes zutrifft, mag der Evangelist genau diese Verbform hier für dessen Zeugnis verwendet haben. Die Absicht einer Anspielung auf diese drei Stellen könnte auch eine Erklärung für die nur hier und dort verwendete Perfektform heōraken sein. Wie bereits bei der Auslegung von Johannes 1,18 verweise ich zur genauen Bedeutung des Sehens Gottes auf die Beschäftigung mit den Versen 6,46 und 14,9.
Versteht man übrigens den Aorist ēkousen, „gehört hat“, effektiv, also als Bezeichnung einer in der Vergangenheit abgeschlossenen Handlung, dann könnte man das, was hier vom Zeugnis des Täufers ausgesagt ist, folgendermaßen umschreiben: Ihm steht bleibend vor Augen, wer Jesus als der Sohn Gottes ist (vgl. Johannes 1,34), was er aber nur deswegen überhaupt „hat sehen“ können, weil er auf ein zuvor an ihn gerichtetes Wort von Gott „gehört hat“, auch wenn von diesem Hören in Johannes 1,33 nicht wortwörtlich die Rede ist.
Thyen geht schließlich (T235) auf die Frage ein, ob die Aussage, dass „niemand“ sein Zeugnis annimmt, nicht „als eklatanter Widerspruch zu V. 26 verstanden“ werden muss, „wo die eifersüchtigen Johannesjünger sich bei ihrem Meister darüber beklagen, daß alle zu Jesus strömen (kai pantes erchontai pros auton).“ In diesem Falle könne „Johannes doch keinesfalls der Sprecher dieser Rede (31-36) sein“. Gegen solche Argumentationen wendet Thyen ein, dass auf „der Erzählebene“ die Worte „pantes und oudeis {alle und niemand} gerade nicht platter Widerspruch, sondern absichtsvoll miteinander korrespondierende Hyperbeln“, also übertreibende Ausdrucksweisen sind. Auf der einen Seite steht die „Angst und Eifersucht dieser Täuferjünger, die ihren Stern sinken sehen“, auf der anderen Seite reduziert der Evangelist immer wieder einen „angeblichen Massenandrang zu Jesus auf seine wahren Dimensionen“ (vgl. 1,10f; 3,11):
Gerade diese aufgeregten und immer noch ungläubig auf das Ihre fixierten Täuferjünger, die ihr Meister ausdrücklich an ihre Zeugenschaft seiner einstigen martyria {Zeugnis} für Jesus erinnern muß (V. 28), sind zudem der lebendige Beweis dafür, daß keiner Jesu martyria annimmt.
Tatsächlich gibt es also wie in 1,12f
Ausnahmen von der Regel. Es gibt solche, die seine martyria angenommen und damit „besiegelt“ haben, daß Gott wahrhaftig ist. Daß hier nicht von bloßer Möglichkeit, sondern von der lebendigen Wirklichkeit derer die Rede ist, die Jesu Zeugnis bereits angenommen haben, bestätigt der aoristische Aspekt beider Verben. sphragizō heißt hier wohl einfach „bestätigen“. Und dabei ist nicht an einen besonderen Akt solcher „Bestätigung“, etwa durch ein ,Bekenntnis“ zu denken, sondern an den Akt der glaubenden Annahme der martyria Jesu und des Bleibens in ihr.
Das Wort alēthēs übersetzt Thyen in diesem Zusammenhang mit „wahrhaftig“. Durch ihre bloße „Existenz als Glaubende“ bestätigen diese also (T236) „die ‚Wahrhaftigkeit‘ Gottes“. Außerdem fügt er hinzu, dass es „um die Verläßlichkeit der Verheißungsworte Gottes“ geht, „die an der Existenz der Glaubenden sichtbar wird“.
Ganz ähnlich sagt Wengst (W128):
Hinter dem hier mit „verlässlich“ wiedergegebenen griechischen Wort alethés dürfte das hebräische Wort neˀemán stehen: Gott ist wahrhaftig, er ist treu und in seiner Treue wirksam, sodass man sich auf ihn verlassen kann. Die das Zeugnis annehmen und damit auf Gott ihr Vertrauen setzen, bestätigen so ihrerseits die Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit Gottes, sind das lebendige Siegel darauf.
Veerkamp betont noch deutlicher, dass es im Zeugnis des Johannes für den vom Himmel gekommenen Jesus um einen Aufruf zum Vertrauen auf die Treue des Gottes Israels geht:
Man vertraut ihm {Johannes dem Zeugen} aber nicht. Man traut dem Gott Israels nicht über den Weg. Wenn man aber „dem Zeugnis vertraut“, gibt man Brief und Siegel (sphragizein) darauf, dass Gott getreu (alēthēs) ist.
Das Wort sphragizein, „besiegeln“, erläutert Veerkamp weiter durch eine Betrachtung von Johannes 6,27, der einzigen Stelle, an der es in unserem Evangelium noch einmal vorkommt:
Es geht um eine amtliche Bestätigung (Matthäus 27,66) durch den, der das Zeugnis annimmt. Er handelt in Übereinstimmung mit dem Gott Israels, der seinem Volk „das Essen“ gibt, das „bleibt (= am Leben erhält) bis zum Leben der kommenden Weltzeit“, 6,27. Wer vertraut, übersteht die kommende Katastrophe der Weltordnung: „Wen aber Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes.“
↑ Johannes 3,34: Der Gottgesandte und die Geistbegabung „nicht nach dem Maß“
3,34 Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte;
denn Gott gibt den Geist ohne Maß.
[7. Mai 2022] Im Rahmen textkritischer Erwägungen zu Vers 34 geht Hartwig Thyen (T236) unter anderem darauf ein, dass Rudolf Bultmann <302> eine „am dürftigsten bezeugte Lesart für ursprünglich“ hält, in der am Ende das Objekt to pneuma, „der Geist“, fehlt, weil „er to pneuma als ‚eine völlig unjohanneische Ergänzung‘ betrachtet“. Macht man aber anders als Bultmann die Verse 3,31-36 nicht „durch deren Umstellung zu einem Teil der Rede Jesu von 3,13-21“, sondern sieht
man dagegen mit dem überlieferten Text Johannes, der das pneuma „herabkommen und auf ihm bleiben sah“ und deshalb erklärte: houtos estin ho baptizōn en pneumati hagiō {dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft} (1,33), als den Sprecher von 3,31-36 an, so wird die vermeintlich „völlig unjohanneische Ergänzung“ zu einem nahezu notwendigen Element dieser Rede.
Auch auf Theodor Zahn <303> geht Thyen nochmals kritisch ein. Der „folgt dem überlieferten Text und sieht darum in Johannes den Sprecher von 3,31-36.“ Während Zahn jedoch [226ff.]
im Blick auf den Inhalt der V 32f bestritten [hatte], daß Johannes hier von sich selbst gesprochen haben könne (s. o.) <304>, so ändert sich dieses Bild für ihn mit V. 34. Denn mit dem Relativsatz hon gar apesteilen ho theos ta rhēmata tou theou lalei {denn der, den Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte}, soll Johannes als der anthrōpos apestalmenos para theou {der von Gott gesandte Mensch} (1,6!) nun plötzlich doch von sich selbst sprechen. Deshalb plädiert Zahn für die Ursprünglichkeit von to pneuma.
Für „den unseligen Anfang einer falschen Lektüre des Textes“ hält es Zahn allerdings, dass Gott den Geist (Objekt!) Jesus gegeben haben soll; ihm zufolge soll der Geist „das Subjekt dieses Satzes“ sein: „Der Geist gibt Johannes die rhēmata theou {Worte Gottes}, die er sagt, nicht ek metrou“ {ohne Maß}. Nach Thyen kann aber das
bloße Relativpronomen hon {der} … unmöglich ein zuvor nominell noch gar nicht bezeichnetes neues Subjekt des lalein in die Rede einführen, zumal V. 34 ja begründen soll (gar! {denn}), inwiefern derjenige, der Jesu martyria {Zeugnis} annimmt, damit die Wahrhaftigkeit Gottes bestätigt: Weil Jesus als der von Gott Gesandte nicht seine eigenen, sondern ta rhēmata tou theou {die Worte Gottes} spricht, entspricht der Glaube an ihn diesen Worten und bestätigt damit die Wahrhaftigkeit Gottes.
Dieser Argumentation Thyens kann ich folgen: Auch wenn (gegen Thyen) in den Versen 32-33 Johannes der Täufer als der irdische Zeuge des Kommens Jesu von oben anzusehen sein sollte, bezeugt Johannes hier Jesus als den von Gott Gesandten, der Gottes Worte redet.
Damit ist Thyens (T237) Auseinandersetzung mit Zahn aber noch nicht abgeschlossen. Diesem dient nämlich [228]
das Präsens didōsin {gibt}, weil es „dem Satz den Charakter einer allgemeingiltigen Regel“ gebe, als Argument dafür, daß nur der die Propheten seit je und immer wieder inspirierende Geist Subjekt des Satzes sein könne. Deshalb erklärt er: Es hätte nie „bezweifelt werden sollen, daß hier nicht die Rede ist von der unbegrenzt reichen Mitteilung des Geistes an den Sohn. Denn diese ist ein für allemal geschehen; es müßte also dedōken {hat gegeben} oder edōken {gab} dastehen“.
Das würde bedeuten, dass Gott Jesus den Geist einmalig bei seiner Taufe gegeben hätte, was Johannes in 1,32f. bezeugt. Auch nach Thyen geht es in Vers 34 um den Geist, der Jesus von Gott gegeben wird, aber nicht als eine nur einmalige Gabe:
Angesichts der bereits erörterten ununterbrochenen Kommunikation zwischen Vater und Sohn und ihrer Einheit (10,30) erscheint uns dieses Argument jedoch abwegig. Als Instanz der Inspiration spielt das pneuma bei Joh gerade keine Rolle. Weil Jesus schlechterdings der einzige Träger des eschatologischen Geistes ist, den es davon abgesehen vor seiner „Verherrlichung“ am Kreuz noch gar nicht gab (7,39), ist durch das Präsens didōsin auch keine „allgemeingiltige Regel“ formuliert, sondern es liegt der Normalfall eines durativen {eine Dauer bezeichnenden} Präsens vor. …. Der Satz besagt also, daß Gott dem von ihm Gesandten den Geist nicht dosiert, sondern ununterbrochen und in seiner ganzen Fülle zuteil werden läßt. Und daß dieser ,Gesandte‘ kein anderer als der vom Vater geliebte Sohn ist, und daß der Vater diesem Sohn mit der Gabe des Geistes die Verfügungsgewalt über „alles“ gegeben hat, macht der folgende Vers explizit.
Auch Wengst (W128f.) identifiziert den von Gott Gesandten, von dem in Vers 34 die Rede ist, mit Jesus, durch dessen Worte Gott wirkt:
Wie noch oft im Evangelium gebraucht Johannes hier im Blick auf Jesus die Begrifflichkeit des Sendens. Der Gesandte ist ganz und gar und nur Beauftragter; er ist Bote. Er hat überhaupt keine eigene Autorität, aber in ihm ist sein Auftraggeber präsent. Wer ihn hört, hört den, der ihn so zu reden beauftragt hat, nimmt dessen Wort an oder verweigert sich ihm. In der Anwendung dieser Begrifflichkeit auf Jesus will Johannes also wiederum deutlich machen, dass im Reden Jesu Gott selbst zu Wort kommt.
Weiter bringt auch Wengst diesen Vers nicht mehr ausdrücklich mit der Zeugenschaft Johannes des Täufers in Verbindung, wohl aber mit der indirekten Zeugenschaft des Evangelisten Johannes und jedes anderen, der für Jesu Worte Zeugnis ablegt (W129):
Da Jesus zur Zeit der Abfassung des Evangeliums nicht mehr als Mensch unter Menschen lebt und also seinerseits auf Zeugen angewiesen ist, geht es genauer um das Reden Jesu, wie es Johannes als sein Zeuge im Evangelium formuliert. Im Munde seiner Zeugen redet Jesus Gottes Worte.
Den zweiten Teil des Verses 34, ou gar ek metrou didōsin to pneuma, übersetzt Wengst (W124) mit „Ohne Maß nämlich gibt er die Geisteskraft“. Anders als Thyen bezieht er diese Gabe jedoch nicht auf den Geist, der Jesus fortwährend von Gott gegeben wird und auf den sich bereits das Täuferzeugnis von Johannes 1,32f. bezogen hatte. Vielmehr scheint er in der Zusage (W129), „dass Gott die Geisteskraft nicht knapp bemessen, sondern reichlich gibt“, eine Gewähr dafür zu sehen, dass es ganz allgemein bei vielen Menschen „zur Annahme dieses Zeugnisses kommt“:
„Geisteskraft“ würde sich demnach darin manifestieren, dass Menschen die bezeugten Worte Jesu als Worte Gottes annehmen und so veranlasst werden, ihr Vertrauen ganz und gar auf Gott zu setzen.
Wenn aber Johannes darauf hinaus wollte, dass Geisteskraft, pneuma, ohne jedes Maß für alle Menschen vorhanden ist, warum reicht ihre Kraft dann offenbar doch nicht aus, um auch die zahlreichen Gegner Jesu zum Vertrauen auf ihn zu bewegen? Könnte Johannes in einer solchen Weise vom Geist geredet haben, wenn er doch zwei Verse zuvor noch von der Annahme des Zeugnisses als einer Ausnahmeerscheinung gesprochen hat?
An dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, ob die Worte ou gar ek metrou, was ganz wörtlich „denn nicht aus Maß“ bedeutet, überhaupt mit „ohne Maß“ wiedergegeben werden dürfen, worin sowohl Thyen als auch Wengst dem folgen, was in Kommentaren und Bibelübersetzungen üblich ist. Ton Veerkamp <305> zweifelt das an:
Dann kommt ein Halbsatz, der schwer zu verstehen ist. „Nicht knapp bemessen, sondern reichlich“ deutet Wengst den Ausdruck, wie die anderen Kommentare: „nicht abgemessen, sondern in ganzer Fülle …“. <306> Johannes hätte dafür perisson {im Überfluss} schreiben können (vgl. 10,10). Er tut es nicht, er schreibt: „… nicht nach dem Maß (ou gar ek metrou).“ Metron, „Maß“, kommt bei Johannes nur hier vor.
Thyen vermerkt immerhin (T236), dass die
Wendung ek metrou …in der gesamten Bibel nur hier [begegnet]. Dabei dürfte metron nicht abstrakt das „Maß“ bezeichnen, sondern, wie seit Homer geläufig, ein konkretes Gerät zum Messen, also einen „Meßbecher“ o. dgl. <307>
Weiter lässt er sich aber nur darüber aus (T236f.), wie leicht der „ungewohnte Gebrauch von ek metrou“ dazu führen konnte, „daß frühe Kopisten die Wendung durch das ihnen geläufigere und wohl aus 1Kor 13,9.12 bekannte ek merous {aus Teilen bestehend, stückweise} ersetzt haben.“
Aber stimmt es überhaupt, dass wir über dieses metron, dieses „Maß“, von dem hier die Rede ist, in der gesamten Bibel nichts für unsere Stelle Klärendes herausfinden können? Tatsächlich taucht nirgends sonst die exakte Formulierung ek metrou auf. Ton Veerkamp macht jedoch aufmerksam auf die Kapitel 5 und 6 im Prophetenbuch Sacharja:
Dort haben wir die einzige Stelle im TeNaK, wo beide Wörter „Maß, Inspiration“ (metron, pneuma) gemeinsam vorkommen. Mit dem Sturm (ruach) wird das Verbrechen ins Land des Exils getragen. Anschließend wird der Sturm selber niedergelassen. Diese Inspiration treibt die Propheten an, im Land des Exils die Verschleppten mit der Möglichkeit und den Bedingungen des Neuanfangs vertraut zu machen. Unmittelbar darauf kommt die Ankündigung des Baus des Heiligtums und der königlichen Würde des Großpriesters Jeschua.
In deutschen Bibelübersetzungen ist dieser Zusammenhang nicht zu erkennen, weil sie für Sacharja 5,6.7.8.9.10 das in der LXX mit metron ins Griechische übertragene hebräische ˀephah, ein nach Wikipedia 22 Liter <308> umfassendes Scheffelmaß, entweder unübersetzt mit „Epha“ (Lutherbibel von 1545 und 1912, Elberfelder und Zürcher Bibel) oder mit „Fass“ (Einheitsübersetzung) bzw. „Tonne“ (Lutherbibel von 1984 und 2017) wiedergeben.
Das Wort pneuma wiederum, das in Sacharja 5,9 für das hebräische ruach steht, wird in allen deutschen Übersetzungen mit „Wind“ wiedergegeben, passend zu dem dargestellten Bild zweier Frauen, die mit Flügeln ausgestattet sind, die wie Storchenflügel aussehen. Angetrieben vom pneuma unter ihren Flügeln, tragen diese Frau das metron „zwischen Erde und Himmel dahin“. Könnte es von Bedeutung sein, dass hier wie in Johannes 3,31 gē und ouranos, „Himmel“ und „Erde“, gemeinsam auftreten?
Nur für den in Sacharja 6,8 erwähnten hebräischen ruach, den Gott im „Land des Nordens“ ruhen lässt, verwenden deutsche Bibelübersetzungen das Wort „Geist“, das in der LXX allerdings nicht mit metron, sondern mit thymos wiedergegeben wird. Da thymos auch den Zorn Gottes bezeichnen kann, frage ich mich, ob die Septuaginta-Übersetzer mit anklingen lassen wollten, dass Gott im Ruhen seines Geistes am Ort der Verbannung auch seinen Zorn ruhen lässt, bis er abgekühlt genug ist, um mit seinem Volk einen neuen Anfang zu wagen. Und wenn Johannes wiederum dieser Hintergrund bei der Formulierung von 3,31-36 vor Augen steht, könnte er in Vers 36 vom bleibenden Zorn Gottes (dort allerdings mit orgē ausgedrückt) über denjenigen gesprochen haben, die nicht auf den Sohn Gottes vertrauen.
Wie wäre vom Hintergrund der Sacharja-Kapitel 5 und 6 her aber nun Johannes 3,34 näher zu erklären? In seiner Auslegung aus dem Jahr 2006 schreibt Veerkamp:
Johannes sagt nun, nicht nach diesem Scheffelmaß gibt er den Sturmwind der Inspiration. Es wird anders zugehen als nach der ersten Zerstörung der Stadt, ganz anders. Es gibt keinen Wiederaufbau der Stadt und des Heiligtums. Was kommt, ist jener SOHN, der „über allen“ ist. Der VATER ist solidarisch mit dem SOHN, ihm hat er alles in die Hand gegeben. Der Zusammenhang ist freilich schwierig. Andererseits ist die Umschreibung maßlos ein Eingeständnis, dass man die Sache nicht richtig versteht.
Etwas anders sieht Veerkamp die Zusammenhänge in seiner Übersetzung von 2015. <309> Dort schreibt er über das Stichwort „metron, hebräisch ˀefa, ‚inhaltliches Maß, Scheffel, Gefäß, Maß“:
der Bezug könnte Sacharja 5-6 sein. Dort geht um das Maß (Scheffel) der Bosheit Israels, das es ins Exil führt, in das Land Schinar; dort lässt sich die Inspiration des NAMENS nieder: „Siehe die da ausfahren in das Land des Nordens, sie lassen ruhen meine Inspiration im Land des Nordens“ (6,8), am Ort der Verschleppung Israels. Die Inspiration wird nicht länger durch das „Maß der Bosheit“, sondern von der Inspiration bestimmt, die durch den Gott Israels und den Messias gegeben wird. Johannes geht davon aus, dass seine Zuhörer die Bezugsstelle Sacharja 5,1ff. kennen. Deswegen ist der bestimmte Artikel mit zu übersetzen, also nicht adverbial, etwa maßvoll.
Im vorletzten Satz müsste es heißen, dass „der bestimmte Artikel“ zu ergänzen ist, denn im Griechischen steht ja gerade kein Artikel. Ansonsten halte ich Veerkamps in mehrere Richtungen gehende Erwägungen für durchaus anregend.
Geht man wie Thyen davon aus, dass der hier erwähnte Geist zunächst nur den Jesus verliehenen Geist meint, könnte Johannes sagen wollen, dass Gott seinen Geist, pneuma, nicht mehr bis zum Verrauchen seines Zorns, thymos, „nach dem Maß der Bosheit“ Israels, ek metrou, im Land der gegenwärtigen Verwüstung nach dem Judäischen Krieg ruhen lassen will, um dann seinen Tempel wieder aufbauen zu lassen. Vielmehr übergibt er seinen Geist dem von ihm Gesandten (Vers 34), seinem Sohn (Vers 35), damit diejenigen, die auf ihn vertrauen, den Anbruch des Lebens der kommenden Weltzeit erleben (Vers 36a), während der Zorn Gottes, orgē, über denjenigen bleibt, die sich dem Sohn verweigern.
Ton Veerkamp <310> gesteht allerdings zu, dass der Bezug zum Propheten Sacharja, den er hier herstellt, „weit hergeholt“ zu sein scheint:
Aber der Ausdruck ek metrou ist nicht erklärt. Man muss also fragen: was hat metron (Maß) mit pneuma (Sturmwind, Geist) zu tun? Auf was will Johannes hinaus, was hat er im Kopf? Er hat den TeNaK im Kopf und Sacharja 5 und 6 ist die einzige TeNaKstelle, wo beide Wörter inhaltlich aufeinander bezogen werden.
In diesem Zusammenhang stellt er grundsätzliche Überlegungen „zur Funktion der expliziten und impliziten Zitate aus dem TeNaK“, der jüdischen Bibel, an. Während er es begrüßt, dass die Zerschneidung des Johannesevangeliums durch „Quellenhypothesen … auch in der gelehrten Welt“ inzwischen weitgehend aufgegeben wurde, hält er es für unerlässlich, „den TeNaK als Quelle“ des Evangelisten ernst zu nehmen:
Denn die Sprache der Schrift ist die gemeinsame Sprache aller Kinder Israels. Ob man eine wahrhafte Sprache spricht, lässt sich in den Auseinandersetzungen der Kinder Israels untereinander nur von der Schrift her nachweisen.
Sicher ist dabei, dass Johannes den TeNaK ausdrücklich zitiert, aber er spielt auch an vielen weiteren Stellen inhaltlich auf ihn an, wobei nicht immer deutlich ist, ob „Johannes die Septuaginta oder eine Vorform des massoretischen {heute vorliegenden hebräischen} Textes benutzt“. Auf jeden Fall ist „bei jedem Juden jener Zeit, der in die Synagoge ging“, vorauszusetzen, dass er „zutiefst von der Sprache der Schrift bestimmt“ war und dass ihm daher bei der Erwähnung bestimmter Stichworte ganze Textzusammenhänge der Schriften vor Augen standen. In seiner Auslegung geht es Veerkamp darum, ausdrücklich zu zitieren, „wo nach unserer Auffassung Johannes implizit zitiert, damit die Zusammenhänge nachvollziehbar und überprüfbar werden“.
Im Blick auf ein solches Vorgehen hat Klaus Berger <311> sich „über angebliche ‚Anspieljäger‘“ mokiert, „die als ‚Wissenschaftler‘ überall ‚Bezugnahme auf Geschriebenes‘ wittern“. Dazu schreibt Veerkamp:
Diese Polemik ist lächerlich. Johannes zitiert die Schrift wiederholt. Er erfüllt das Kriterium Bergers, nach dem „der Text, auf den angespielt wird, … allgemein bekannt gewesen ist“. Der TeNaK war unter Juden „allgemein bekannt“. Das Buch Sacharja spielte in messianistischen Kreisen eine große Rolle. Ein weiteres Kriterium wäre: „Die Funktion der Anspielung muss klar erkennbar und theologisch wichtig sein.“ Das versuchen wir nachzuweisen. Gegen Berger ist zu sagen: Umfassende Kenntnis der ganzen Schrift ist kein neuzeitlicher „Biblizismus“ und hat mit „Perfektionismus moderner Frommer“ nichts zu tun. Freilich lesen wir, anders als Professor Berger, Johannes nicht als christlichen, sondern als aus dem TeNaK geborenen heterodox-jüdischen Text.
Ich finde, dass Veerkamps Anregung, die neutestamentlichen Schriften nicht vorschnell als Texte einer neuen Religion, nämlich des Christentums, zu lesen, aufgegriffen zu werden verdient. Dann aber
müssen alle Lehrer der Exegese in erster Linie „Alttestamentler“ sein, und was sie lehren, kann nichts anderes als biblische Theologie sein. Wir müssen die von uns angegebenen Bezüge als Vorschläge zum besseren Verständnis des Textes auffassen, um sie dann im Lehrhaus <312> gründlich zu diskutieren. Unter Umständen kann dabei herauskommen, dass der Bezug zu weit hergeholt ist und der Vorschlag nicht weiterführt. Immer aber müssen wir Johannes vom TeNaK her zu begreifen suchen.
↑ Johannes 3,35-36: Das Vertrauen auf den Sohn des VATERS und der Zorn Gottes
3,35 Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben.
3,36 Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.
Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
[8. Mai 2022] Gegenüber der jüdisch-messianischen Johanneslektüre, die Veerkamp vertritt, legt Hartwig Thyen die Verse 35-36 strikt dogmatisch-christlich in Anlehnung an Karl Barth aus. So zitiert er zur Gegenwartsform agapa, „liebt“, die dem didōsin, „gibt“, in Vers 34 entspricht, und zur bei allem Unterschied zugleich bestehenden Entsprechung „zwischen dem Aorist ēgapēsen {hat geliebt} von 3,16 und diesem Präsens agapa {liebt}“ die treffende Äußerung Barths: <313>
„Aus der Liebe, mit der der Vater den Sohn liebte und liebt von Ewigkeit her, geht hervor das Ereignis seiner Liebe zur Welt“. Indem er seinem geliebten Sohn „alles in die Hände gelegt hat“, hat der Vater ihn zugleich zum „Vollstrecker“ jenes Ereignisses seiner Liebe zum kosmos eingesetzt: dia touto me ho patēr agapa, hoti egō tithēmi tēn psychēn mou ktl. {darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse usw.} (10,17; vgl. 13,1-3…).
Mit dieser „Aussage, der liebende Vater habe dem Sohn ‚alles in die Hände gelegt‘,“ nimmt der Vers 35 (T238f.) „den Eingangssatz des Johannes-Bekenntnisses: ho anōthen erchomenos epanō pantōn estin {der von oben kommt, steht über allen}, im Sinne einer Ringkomposition variierend“ wieder auf. In gleicher Weise verknüpft Vers 36 (T239)
unsere Johannesszene mit Jesu Worten der vorausgegangenen Nikodemus-Episode. Gerade durch diese Entsprechungen erweist sich der Täufer Johannes als der wahrhaftige Zeuge Jesu. „Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben“ ist deutliches Echo von 3,15f. Daß der Ungehorsame (apeithōn) dagegen das Leben nicht „sehen“ wird, variiert die Wendung: ou dynatai idein tēn basileian tou theou {er kann das Reich Gottes nicht sehen} von V. 3 ebenso wie die Rede vom „auf ihm bleibenden Zorn Gottes“ den Gegenwartsaspekt des Perfekts ēdē kekritai {der ist schon gerichtet} von V. 18 aufnimmt.
Den „Umstand, daß bei Joh einzig hier vom ‚Zorn Gottes‘ die Rede ist (orgē theou; vgl. Röm 1,18 u.ö.)“ führt Thyen darauf zurück, dass er „zumal im Munde des Täufers!“ als „eine absichtsvolle ,Erinnerung‘ an dessen markanten Bußruf: „Ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr nur dem kommenden Zorn(esgericht) entrinnen?“ (Mt 3,7; Lk 3,7…)“ betrachtet werden kann. Wie „der Ausdruck orgē theou“ kommt auch „die Bezeichnung des Ursprungs dieses ,Zornes‘ als apeithein (ungehorsam sein)“ nur hier in den johanneischen Schriften vor, wahrscheinlich weil „das ihm eigene aktive Element der Widersetzlichkeit der Rede vom ‚Zorn Gottes‘ besser korrespondiert als das eher passiv klingende mē pisteuein {nicht vertrauen}“.
Klaus Wengst (W129) betont zu den Aussagen von Vers 35, „dass der Vater den Sohn liebt und ihm alles in die Hand gegeben hat“, dass sie „ihr besonderes Profil“ bekommen,
wenn der Blick auf den Sohn dessen ganzen Weg umfasst, wie er im Evangelium als Weg ans Kreuz beschrieben wird. In seiner Liebe ist sich Gott nicht zu schade, diesen niedrigen Weg mitzugehen und damit der Macht der Mächtigen die Macht des Ohnmächtigen entgegenzusetzen. Wer „alles in seiner Hand“ hat, hat alle Macht. Das wird hier von dem gesagt, der am Ende seines Weges von Pilatus als dem Vertreter des imperialen Rom, der tatsächlich die Macht zu haben scheint, zum Tod am Kreuz verurteilt wird und der diesem – selbst ganz unten – doch in der Souveränität dessen gegenübertritt, der „von oben“ kommt.
Über die gängige christliche Auslegung hinaus erkennt Wengst zum
Verhältnis von Gott und Jesus, wie es hier verstanden ist, … eine strukturelle Analogie in der jüdischen Überlieferung im Blick auf das Verhältnis von Gott und Israel“. Im Kontext der Aussage, dass Gott in seiner Gegenwart mit Israel in jedem Exil war und ist, dass er trotz der Unreinheit der Israeliten unter ihnen wohnt, erzählt Rabbi folgendes Gleichnis: „Ein König sagte zu seinem Sklaven: ,Wenn du mich suchst – pass auf! -, ich bin bei meinem Sohn. Immer, wenn du mich suchst – pass auf! -, ich bin bei meinem Sohn.“ <314> Gott liebt Israel, seinen erstgeborenen Sohn, sein Volk, das er erwählt hat, und ist in seiner Mitte, auch im Exil. Wer Gott sucht, wende sich also an Israel. Wieder ist im Johannesevangelium auf Jesus konzentriert, was von Israel im Ganzen gilt.
Daraus zieht Wengst allerdings lediglich die Schlussfolgerung: „Wieder sollten wir diese Konzentration nicht gegen Israel wenden“, statt wie Veerkamp tatsächlich im Messias Jesus die Verkörperung Israels zu sehen, der eben in dieser Verkörperung die ganze agapē, chessed, „Solidarität“, des befreienden NAMENS erfährt. Genau mit diesem „SOHN, den ‚über allen‘ ist“, ist nach Veerkamp <315> der „VATER … solidarisch, … ihm hat er alles in die Hand gegeben.“ Umgekehrt ist dann aber auch das durch den Messias errungene Leben der kommenden Weltzeit nicht für eine christliche Kirche bestimmt, die – wenn die Juden Glück haben – das Judentum toleriert, sondern es gilt ganz und gar einem Israel, das auf Jesus vertraut – einschließlich der Samaritaner, Johannes 4, und vielleicht noch einiger Griechen, die sich für Jesus interessieren, Johannes 12,20f.
Da eine zunehmend heidenchristlich dominierte Kirche schon bald die im Johannesevangelium formulierten Verheißungen nur noch auf sich bezogen hat, ist es natürlich lobenswert, wenn Wengst wenigstens den judenfeindlichen Auswüchsen solcher Exegese zu widerstehen versucht (W129f.), indem er zu Vers 36 schreibt:
Zunächst wird positiv formuliert: „Die auf den Sohn vertrauen, haben ewiges Leben.“ Der Sohn weist auf den Vater zurück wie der Gesandte auf seinen Auftraggeber. Es gibt kein eigenständiges Vertrauen auf den Sohn; es ist nichts anderes als Vertrauen auf den Vater. Wir müssen wahrnehmen, dass es in Israel Vertrauen auf den Vater gab und gibt, das des Sohnes, der Jesus ist, nicht bedarf. Für uns Menschen aus den Völkern ist er es aber, durch den wir Vertrauen auf Gott gewinnen, ohne Jüdinnen und Juden werden zu müssen.
Mit dem letzten Satz gibt Wengst eine Einsicht wieder, die auf den Apostel Paulus zurückgeht, die aber vermutlich Johannes, der nirgends ausdrücklich von einer Völkermission spricht, noch nicht geteilt hat.
Auch im Blick auf die negative Aussage vom Zorn Gottes, die „das Gericht Gottes über die Verfehlungen der Menschen“ bezeichnet, strengt sich Wengst nach Kräften an, einer antijüdischen Auslegung entgegenzuwirken:
Wer auf Jesus vertraut als „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“ (1,29), ist dem Gericht entnommen. Wer Vergebung nicht beansprucht, steht noch unter dem Gericht. Auch hier sollten Christinnen und Christen wahrnehmen, dass es im Judentum bis in die Gegenwart Zuspruch von Gottes Vergebung gibt. Die Wendung vom „Bleiben des Zornes Gottes“ findet sich an zwei Stellen der Weisheit Salomos. (Weish 16,5; 18,20). Dort gilt der Zorn als befristet. Die erste nimmt Num 21,4-9 auf. Im Blick auf die tödlichen Schlangenbisse gegen das murrende Volk und die von Mose zur Rettung aufgestellte eherne Brandnatter heißt es: „Nicht bis zum Ende bleibt Dein Zorn.“ Die zweite Stelle vermerkt in Anspielung auf Num 17: „Aber nicht lange blieb der Zorn.“
Die Frage ist aber, ob eine Kirche, die gemäß Johannes 3,36 das ausschließliche Vertrauen auf Jesus als Voraussetzung für die Sündenvergebung bekennt, überhaupt zugestehen kann, dass die im Judentum vorhandene Erfahrung von Vergebung nach wie vor wirksam ist. Immerhin scheint ja Johannes 3,36 den weisheitlichen Zeugnissen Salomos 16,5 und 18,20 sogar entschieden zu widersprechen. Versteht man die in Johannes 3,36 verwendeten Worte Glauben und Ungehorsam, ewiges Leben und Zorn Gottes, als rein religiöse Kategorien, dann verstrickt man sich sehr leicht in Diskussionen über Absolutheitsansprüche der einen oder anderen Religion.
Ton Veerkamp nimmt dagegen an, dass Johannes eben nicht religiös argumentiert, jedenfalls nicht „dogmatisch-christlich“ gegenüber dem jüdischen Glauben. Vielmehr vertritt Johannes eine messianische Stimme innerhalb des Judentums, die sowohl dem rabbinischen Judentum als auch dem zelotischen Messianismus gegenüber von den jüdischen Schriften her radikale politische Kritik erhebt:
Der letzte Vers 3,36 gehört zu den Sätzen, mit denen Johannes immer wieder seine Botschaft zusammenfasst. Sie haben allgemein die Form: Wer … der, wer nicht … der nicht. „Wer dem SOHN vertraut, der erhält das Leben der kommenden Weltzeit. Wer dem SOHN misstraut, wird kein Leben sehen, sondern der Zorn Gottes lastet bleibend auf ihm.“ Durch das ganze Evangelium werden wir diesen Satz in unzähligen Variationen hören. Dem SOHN vertrauen heißt, darauf vertrauen, dass endlich Recht geschieht und dass dieses Recht das Recht des Gottes Israels sein wird. Wer dagegen dem SOHN misstraut, geht davon aus, dass der, dem die Macht, Recht zu schaffen, gegeben ist, nicht erscheint, also dass das Recht und die Rechtsordnung des Gottes Israels eine Illusion ist. Wer so leben will, lebt unter dem Zorn Gottes.
Ein solches Verständnis vom bleibenden Zorn Gottes als Folge eines verweigerten Vertrauens auf die befreiende und Recht schaffende Macht Gottes für das Volk Israel wurde natürlich von einer heidenchristlichen Kirche schon bald nicht mehr verstanden und hätte schon gar nicht das Fundament einer neuen Weltreligion bilden können, die wenige Jahrhunderte später dazu beitragen musste, Menschen im römischen Kaiserreich „ideologisch ‚sesshaft‘ zu machen, sesshaft im umfassenden Sinne des Wortes, feste Bleibe und Akzeptanz des gesellschaftlichen Ortes, an dem jeder Mensch zu leben gezwungen war.“ <316>
Nach Johannes, wie Veerkamp ihn sieht, lastet der bleibende Zorn Gottes aber gerade auf der römischen Weltordnung, weil sie das Recht und die Freiheit Israels in einer Weise beschneidet, die das Maß der Sklaverei in Ägypten oder der Verbannung in Babylon um ein Vielfaches übersteigt, gibt es doch keinen Ausweg aus ihr in Form eines Exodus oder einer Rückkehr in das Gelobte Land. Jedenfalls wird sich noch zeigen (Johannes 12,31 und 16,11), dass Gottes Gericht zentral der versklavenden Weltordnung bzw. ihrem archōn, „Fürsten“, also dem Kaiser Roms, gilt.
Zuletzt wirft Veerkamp einen vergleichenden Blick in den Römerbrief des Paulus:
Zorn, orgē, kommt in Johannes nur hier vor. Es ist das Wort des Römerbriefes, wo wir es elfmal hören. Johannes meint diesen Zorn und teilt mit Paulus die Ansicht, dass der Zorn ein Wesenselement der dikaiokrisia, des „bewährten Urteils“, des wahrhaftigen Gerichts ist. Sachlich meint Johannes 3,36 nichts anderes, und er verstärkt das durch das Verb menein, dauerhaft oder fest verbunden sein. Das Urteil des Zorns ist rechtskräftig und definitiv.
Indem Veerkamp diakaiokrisia mit „bewährtes Urteil“ übersetzt, greift er auf die Auslegung des Römerbriefs von Gerhard Jankowski <317> zurück, der zu der entsprechenden Stelle (Römer 2,5) schreibt [74]:
Es darf aber nicht sein, daß die Verrohung und die Verluderung der Menschheit nur benannt werden. Sie dürfen nicht bestehen bleiben. Über sie wird ein wahrhaftiges Urteil gesprochen werden. Von dem befreienden Gott her. Das weiß jeder Jude. Auch Paulus. Da hält er sich ganz an das, was in Israel gedacht wurde. Keiner wird dem Urteilsspruch entkommen, ein Urteilsspruch, in dem sich der befreiende Gott als bewährt erweisen wird. Um dieses Urteil zu kennzeichnen, benutzt Paulus einen Neologismus {neu gebildetes Wort}: dikaiokrisia, im Deutschen kaum in einem Wort zu übersetzen; wir versuchen die Übersetzung mit bewährtes Urteil. Dieses Urteil wird nach den Werken ergehen, also nach den Taten, die gemäß des Rechtsgeheißes Gottes getan werden sollen, wie es Psalm 62 sagt, ein Lied auf die Befreiung, dessen Schlußvers Paulus hier zitiert. Und ist das Urteil gesprochen, kann in der Epoche, die kommen muß und kommen wird, endlich vollgültig gelebt werden. Die Lehrer Israels sagten, daß dieses Urteil allen in Israel zugute kommen wird, die sich im Tun der Thora bewährt haben. Verurteilt werden vor allem die Völker, die Israel unterdrückt haben.
Hier verläßt Paulus die geltende Lehre. Er sieht auf die Taten der Menschen, die zu beurteilen sind und beurteilt werden. Das Urteil gilt, ob positiv oder negativ, zuerst Israel und dann auch den anderen Völkern, Juden und Griechen, sagt Paulus auch hier. Das ist neu gedacht.
Der erste Absatz dieses Zitats zeigt die Übereinstimmung zwischen Paulus und Johannes, der zweite zeigt den Unterschied. Beide sind sich einig in der Verurteilung der Verrohung der Menschheit unter der römischen Weltordnung, beide teilen sie [65] die „prophetische Kritik und Analyse“ des jüdischen TeNaK, „schonungslos aufdeckend und gleichzeitig wegweisend“. Auch nach Paulus regt sich Gottes Zorn,
wenn die Existenz Israels von innen oder außen bedroht ist. Ist sie von innen bedroht, richtet sich der Zorn gegen Israel, ist sie von außen bedroht, richtet er sich gegen die Völker, die Israel vernichten wollen. Gott kann es nicht ertragen, daß die gewährte Freiheit verspielt oder zunichte gemacht wird. Deswegen regt sich sein Zorn, und in letzter Konsequenz muß verschwinden, was Leben in Freiheit zu vernichten droht. Vielfach sind es die Götter der Unfreiheit, Idole der Barbarei der Fremdherrscher, die den Zorn besonders hervorrufen.
Im Unterschied zu Paulus denkt Johannes aber nicht darüber nach, wie Nichtjuden dem Zorn Gottes entzogen und in eine Gemeinschaft mit auf Jesus vertrauenden Juden hineingenommen werden können. Seine Hoffnung richtet sich allein auf die Befreiung Israels. Dass in seinen Augen dazu nicht nur die Juden aus Judäa und Galiläa gehören, sondern auch die verlorenen zehn Stämme Israels, die zur Zeit des Johannes in Gestalt der Samaritaner als ein mit den Judäern verfeindetes Brudervolk in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft leben, ist das zentrale Thema des nun beginnenden Kapitels Johannes 4.
↑ Die Samaritanerin am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1-42)
[12. Mai 2022] Um den richtigen Zugang zur Erzählung von der Samaritanerin am Jakobsbrunnen zu gewinnen, muss man nach Ton Veerkamp <318> „die politische Geographie des Landes kennen.“ Er bezieht sich dabei auf die Art und Weise, wie im jüdischen TeNaK die Geschichte Israels dargestellt wird. Diese geht davon aus, dass Israel nach der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei im Gelobten Land zu einem aus zwölf Stämmen bestehenden Königreich unter Saul, David und Salomo wurde, von dem sich unter Salomos Sohn Rehabeam die zehn Nordstämme unter König Jerobeam abspalteten. <319> Wenngleich also zwei Königreiche, „Süd (Juda) und Nord (Israel) … nach dem Tode des Königs Salomo getrennte Wege“ gingen, so blieben diese Wege „dennoch immer wieder miteinander verknüpft“:
Die Bücher der „vorderen Propheten“ (Josua, Richter, Samuel, Könige) zeigen den Gang Israels durch die Zeiten als einheitliche Geschichte, vom Überschreiten des Jordans unter Moses Nachfolger Josua bis zur Verwüstung des Heiligtums durch die Babylonier. … Diese Bücher waren das Werk der Besinnung auf die eigene Vergangenheit nach der Katastrophe der davidischen Monarchie in Juda/Jerusalem des 6. Jh. v.u.Z., womöglich im 5. Jh., was seinen Kernbestand betrifft. Sein Blickfeld blieb „ganz Israel“, alle zwölf Stämme.
Auch in den im TeNaK als „hintere Propheten“ benannten Büchern Jesaja, Jeremia und Hesekiel findet sich immer wieder die Hoffnung, dass Gott Israel und Juda wieder zusammenführen wird (Jesaja 11,13; Jeremia 23,6; 30,3; 31,27.31-34; 50,4.33; 51,5; Hesekiel 37,16). Beide Reiche können auch nach ihren Hauptstädten Samaria und Jerusalem benannt werden. Wie das Südreich, das sich nur aus den Stämmen Juda und Benjamin zusammensetzt, den Namen „Juda“ trägt, so werden die früheren Nordstämme Israels oft auch unter dem Namen „Ephraim“ als ihrem bedeutendsten Stamm zusammengefasst. Dazu muss man wissen, dass unter den zwölf Söhnen Jakobs der Sohn Levi wegen seiner rein priesterlichen Aufgaben keinen Landbesitz zugesprochen bekam; das Gelobte Land wurde aber trotzdem auf zwölf Stämme aufgeteilt, wobei der Stamm Josef dadurch verdoppelt wurde, dass Jakob die beiden Söhne Josefs, Manasse und Ephraim, als seine eigenen Söhne adoptierte (1. Mose 48,5). Dabei bestimmte Jakob gegen den Willen Josefs den jüngeren Sohn Ephraim zum Haupterben (1. Mose 48,13-20). <320>
Nach der Zerstörung des Nordreiches Israel im Jahre 722 v. Chr. durch die Assyrer blieb im Südreich Juda zwar die Erinnerung an das Nordreich lebendig, nicht zuletzt durch Flüchtlinge aus dem Norden, deren Hoffnungen auf die Errichtung eines gesamtisraelitischen Königreiches wohl erst die Vorstellung eines ursprünglichen Großkönigreiches unter David und Salomo hervorbrachten (siehe Anm. 319).
Die Bevölkerung in dem ehemaligen Gebiet des Nordreiches Israel konnte aber dennoch mit Misstrauen betrachtet werden, was nach Klaus Wengst (W134) zunächst „in der imperialen assyrischen Politik“ begründet war,
die in den zu Provinzen gemachten eroberten Gebieten durch Deportationen Mischbevölkerungen schuf – so auch in Samarien als dem Kernland des ehemaligen Nordreiches Israel nach dessen Zerstörung im Jahr 722 v. Chr.
Erst nach der Wiederansiedlung judäischer Rückkehrer aus der babylonischen Verbannung kam es nach Veerkamp „in der persischen und hellenistischen Zeit“ zu einer „Auseinanderentwicklung der beiden Distrikte Jehud/Judäa und Samaria“:
Die Leute Judäas betrachteten die Leute Samarias als Bastarde. Nach dem Ende der babylonischen Epoche machten die neuen persischen Herrscher Samaria zur eigenständigen Provinz der Großsatrapie „Jenseits des Stromes“, d.h. der syrophönizischen Region des persischen Großreiches. Jehud mit Jerusalem unterstand zunächst der Provinzverwaltung in Samaria, wurde aber um 440 v.u.Z. nach den Maßnahmen Nehemias zur eigenständigen Provinz.
Bei Wengst (W134) finden wir weitere Angaben zu dieser
akuten Trennung … in der frühen nachexilischen Zeit, als führende Jerusalemer Kreise beim Bau des Tempels und der Mauer Jerusalems die Bewohner Samariens von der Mitarbeit ausschlossen und sich von ihnen abgrenzten. Das führte unter Rückgriff auf Dtn 11 und 27 und Jos 8 mit Erlaubnis eines Satrapen Alexanders des Großen schließlich zum Bau eines eigenen Heiligtums der Samariter auf dem Berg Garisim bei Sichem [57-59]. <321> Die Samariter haben wie die Juden die Tora, die fünf Bücher Mose, als heilige Schrift. Die weitere Entwicklung im Judentum, in der auch „die Propheten“ und „die Schriften“ kanonische Autorität gewannen, teilten sie nicht.
Auf Grund dieser Entwicklung ist nachvollziehbar, dass in die jüdische Bibel neben der erwähnten Darstellung der Geschichte des gesamten Israel der zwölf Stämme in den vorderen Prophetenbüchern auch noch eine zweite Perspektive im dritten Teil der Schrift aufgenommen wurde, und zwar im Buch „Reden der Tage“ bzw. den Büchern der Chronik, wie wir sie nennen. Nach Veerkamp ging es in diesem „Remake“ des
Rückblicks auf die Geschichte Israels … nur noch um die Geschicke Judas, des Südens. Zwar wurden die Bewohner des Nordens als „unsere Brüder“ bezeichnet, 2 Chronik 11,4, aber die Verknüpfung zwischen Süd und Nord, so kennzeichnend für die Königsbücher, wurde gelöst. Nur in Zusammenhang mit den Verwicklungen unter der Norddynastie des Hauses Omris kam der Norden ins Blickfeld. Die großen Propheten des Nordens fehlen vollständig und der Prophet Elia taucht nur mit einem Brief an König Joram (2 Chronik 21,12ff.). auf, sozusagen als „Südprophet“. Für die Chronik und so für das Bewusstsein der Menschen in Jerusalem und Juda war Israel deckungsgleich mit Juda. Ein Israelit ist ein Judäer.
Wengst geht folgendermaßen weiter auf die geschichtliche Entwicklung ein (W134):
Von der Makkabäerzeit an „tritt an die Stelle eines gemeinsamen Traditionsfundus gegenseitige Polemik“ [92]. Die Feindseligkeiten erreichen ihren Höhepunkt, als Johannes Hyrkanos 129/128 v. Chr. den Tempel auf dem Berg Garisim zerstört. Wahrscheinlich 109 v. Chr. fügte er der Stadt Sichem dasselbe Schicksal zu. Auf der anderen Seite erzählt Josephus, dass – wahrscheinlich im Jahre 9 n. Chr. – Samariter im ganzen Tempelbereich in Jerusalem menschliche Knochen verstreuten, nachdem zu Beginn des Pessachfestes gewohnheitsgemäß kurz nach Mitternacht die Tempeltore geöffnet worden waren. <322> Die Voraussetzungen für ein sehr gespanntes Verhältnis zwischen Juden und Samaritern auch im 1. Jh. n. Chr. und danach waren also gegeben.
Wengst hebt allerdings hervor, dass es in der Beziehung zwischen Samaritanern und Juden auch andere Seiten gab:
Dennoch darf man nicht von durchgehender Feindschaft ausgehen. Safrai <323> schreibt: „Die Halacha der tannaitischen Zeit betrachtet sie in der Regel als Juden; ihre rituelle Schlachtung ist anerkannt, ihr Wein zu trinken erlaubt, ihr ungesäuertes Brot koscher für Pessach, samaritanische Zeugen dürfen einen Scheidebrief unterzeichnen, Samaritaner werden zum Tischgebet zugezogen, und in bezug auf rituelle Reinheit gelten sie als zuverlässig. An vielen Punkten ist die übliche Auffassung, nach der die Samaritaner landläufig als Juden galten, in die gesetzlichen Bestimmungen eingegangen.“
Vollständige Einigkeit herrschte darüber unter den Rabbinern jedoch nicht, so dass es Wengst zufolge „nicht verwunderlich“ war,
dass es immer wieder zu verbalen und auch handgreiflichen Auseinandersetzungen kam. In dieser Hinsicht bildete ein Ereignis aus dem Jahr 52 n. Chr. einen Höhepunkt, als ein galiläischer Festpilger in Samarien erschlagen wurde, was zu jüdischen Vergeltungsaktionen gegen samaritische Dörfer führte. Der Fall wurde vor den Statthalter Syriens und schließlich sogar bis nach Rom vor Kaiser Claudius getragen. <324>
Veerkamp sieht diesen Zwischenfall als Grund dafür, dass manche Judäer „lieber den Umweg von Jerusalem nach Galiläa oder umgekehrt durch das Jordantal bzw. durch Transjordanien“ machten, „als ihren Fuß auf den Boden Samarias zu setzen“:
Leute aus Samaria hatten Pilger aus Galiläa überfallen und viele von ihnen getötet. Daraufhin machte sich eine Truppe von zelotischen Judäern aus Galiläa auf den Weg, um die Pilger zu rächen. Sie verbrannten eine Reihe von samaritanischen Dörfern im Süden der Region. Die Bevölkerung wurde massakriert. Die Römer ließen eine Reihe von Zeloten kreuzigen; zugleich ließen sie einige der samaritanischen Eliten nach Rom bringen, wo sie hingerichtet wurden. <325> Der Hass zwischen beiden Völkern saß sehr tief und wurde ständig tiefer.
Langer Rede kurzer Sinn: Nach Ton Veerkamp müssen in der Auslegung von Johannes 4,1-42 zwei Dinge ernstgenommen werden:
Erstens die spätestens seit der Zeit des judäischen Fürsten Hyrkan bestehende Feindschaft zwischen Samaria und Judäa, und zweitens die in den Augen des Johannes nach den jüdischen Schriften nach wie vor bestehende Zusammengehörigkeit der samaritanischen Nordstämme mit den judäischen Südstämmen Israels. Anders als die anderen Evangelisten (im Gegensatz vor allem zu Matthäus 10,5) sieht Johannes es als ein hervorstechendes Ziel des Messias Jesus an, ganz Israel einschließlich Samarias in seiner messianischen Gemeinde zu sammeln, um gemeinsam auf das Leben der kommenden Weltzeit zuzugehen.
Hartwig Thyen verzichtet zu Beginn der Auslegung der Szene Johannes 4,1-42 auf längere einleitende Äußerungen, sieht allerdings (T241) in der in seinen Augen „unerwarteten“ Bemerkung, dass Jesus durch Samarien hindurchreisen „mußte“, edei, „ein erstes Signal dafür…, daß in unserer Szene symbolische Obertöne im Spiel sind.“ Dass „Josephus Ant. XX/118 von der zwischen Samaritanern und Juden bestehenden Feindschaft (echthra) redet“, erwähnt auch er.
Nach Wengst (W132) hat „die Lokalisierung in Samarien“ für die „wohlüberlegte Komposition“ der Szene Johannes 4,1-42 (W133) „entscheidende inhaltliche Bedeutung“, allerdings in anderem Sinn als bei Veerkamp, denn Wengst fasst das Bekenntnis der Samaritaner „zu Jesus als ‚dem Retter der Welt‘ in V. 42“ so auf, dass die
zu Jesus kommenden Samariter, die ja außerhalb Israels stehen, … sich in ihm als Repräsentanten ‚der Welt‘ zu verstehen“ geben. Und so belegen sie, dass in dem Messias Jesus der Gott Israels rettend nach seiner Welt greift.
Von daher begreift Wengst die hier vorliegende „Verschachtelung der Szenen“ als „[b]ewusste kompositorische Arbeit“, um eine „Missionssituation“ darzustellen:
Die erste und umfangreichste (V. 4-30) erzählt von der Begegnung Jesu mit einer samaritischen Frau am Brunnen, während seine Schüler in der Stadt Proviant besorgen. Diese Frau wird genau das, was Jesus nach V. 14 denen verheißt, die sich von ihm „lebendiges Wasser“ geben lassen: „eine Quelle von Wasser, das zum ewigen Leben sprudelt“. Sie gewinnt selbst Leben und wird für andere zur Lebensanstifterin. Bei der Rückkehr der Schüler verlässt sie den Brunnen und geht als Zeugin Jesu in die Stadt und veranlasst andere, zu Jesus hinauszugehen. Die Zwischenzeit wird für die Leser- und Hörerschaft durch die zweite Szene (V. 31-35) überbrückt, in der Jesus mit seinen Schülern spricht. Deren Thematik bereitet die der dritten vor, die zugleich an den Schluss der ersten anschließt. Im Gespräch mit den Schülern wird eine Missionssituation skizziert, die in der letzten Szene (V. 39-42) durch die zu Jesus kommenden Samariter – zunächst am Brunnen, dann in der Stadt – ihre konkrete Ausführung erhält.
Dass es in unserer Szene darum geht, Menschen für das Vertrauen auf den Messias Jesus zu gewinnen, ist nicht zu bestreiten. Aber nach all dem, was auch Wengst über die Verwurzelung der Samaritaner im Nordreich Israel weiß, ist seine Behauptung, dass die „Samariter … außerhalb Israels stehen“, unhaltbar. Sie stehen zwar außerhalb Judäas, aber nach Johannes keineswegs außerhalb von Israel, wie schon die Begegnung Jesu mit der Samaritanerin am Brunnen Jakobs zeigt, der von Gott den Namen „Israel“ bekam (1. Mose 32,29) und Namensgeber des Volkes Israel wurde.
Nachvollziehen kann ich, dass Wengst die johanneische Rede vom kosmos und insbesondere seiner Rettung auf die Völkerwelt beziehen will, die durch Jesus in die Rettung Israels mit einbezogen werden soll – ganz im Sinne des Apostels Paulus oder auch der Evangelisten Lukas und Matthäus. Aber in meinen Augen ist Veerkamp Recht zu geben: Ihm zufolge begreift Johannes die Rettung des kosmos als die Befreiung der Menschenwelt von der Welt(un)ordnung, die auf ihr lastet. Und gerade die Geschichte von der Samaritanerin am Jakobsbrunnen illustriert am deutlichsten, dass der johanneische Jesus nicht in erster Linie die Mission der Völker im Sinn hat, sondern die Sammlung ganz Israels. Von den Völkern ist im Johannesevangelium in Gestalt „einiger Griechen“ nur sehr zurückhaltend (12,20) die Rede.
↑ Johannes 4,1-3: Jesu erneuter Aufbruch aus Judäa nach Galiläa
4,1 Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war,
dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes –
4,2 obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger –,
4,3 verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa.
[13. Mai 2022] Klaus Wengst (W130) sieht in den Versen Johannes 4,1-3 die Begründung dafür, „warum sich Jesus wieder von Judäa nach Galiäa begibt“ (W131):
Denn als Aussage „der Pharisäer“ kommt Jesus zu Ohren: „Jesus macht mehr als Johannes zu Schülern und tauft sie.“
Dazu merkt Wengst an (Anm. 160), dass die „Wendung ‚zu Schülern machen‘ – auch mit anderen Verben – … Parallelen in der rabbinischen Literatur“ hat:
Vom „Zustandebringen“ bzw. „Aufstellen“ von Schülern ist z. B. in mAV 1,1 <326> die Rede, wo unter den drei Dingen, die die Männer der großen Versammlung sagten, an mittlerer Stelle steht: „Bringt Schüler in Menge zustande!“
Damit wird (W131) „die Ankündigung des Johannes von 3,30, Jesus müsse wachsen und er kleiner werden, schon Realität“. Es ist also genau dieser Missionserfolg, der Jesus dazu bringt, „Judäa zu verlassen“, und damit „wird hier zum ersten Mal angedeutet, dass dort der Aufenthalt für ihn gefährlich ist und dass die Ursache dafür ‚die Pharisäer‘ sind.“
Zu dieser Art der Darstellung kommt der Evangelist dadurch, dass Jesus schließlich in Jerusalem hingerichtet wurde – letztverantwortlich durch Pilatus, aber wahrscheinlich im Zusammenspiel mit führenden jüdischen Repräsentanten. Die bringt Johannes – historisch gewiss zu Unrecht – mit „den Pharisäern“ in Zusammenhang, weil das Judentum, mit dem er in Auseinandersetzung steht, pharisäisch bestimmt ist.
Da Wengst weit vorausgreift, möchte auch ich schon darauf hinweisen, dass er hier zu wenig differenziert: Diejenigen Ioudaioi, Juden oder Judäer, die Jesus verurteilen werden, wird Johannes in keiner Weise mit den Pharisäern in Verbindung bringen; nach der Gefangennahme Jesu ist nur noch von den führenden Priestern und einem von ihnen aufgestachelten Mob die Rede, die von Pilatus die Kreuzigung Jesu fordern. Dem pharisäisch bestimmten rabbinischen Judentum wirft Johannes allerdings auf dem Wege einer Rückprojektion in die Zeit Jesu vor, dass den Schülern Jesu der Schutz der Synagoge verweigert wird (9,22; 12,42; 16,2) und im Zuge scharfer Auseinandersetzungen Argumente durch Steinwürfe ersetzt werden (8,59 ; 10,31-33).
Nach Hartwig Thyen (T238) haben die Verse Johannes 4,1-3 „eine doppelte Brückenfunktion.“ Die „zweite Brücke“ wird „über die gesamte Samaria-Szene hinweg“ zum „zweiten Kanawunder (4,43-54)“ geschlagen und verbindet dieses mit dem ersten Zeichen zu Kana (2,11). Dass manche Abschreiber in Vers 3 das Wort palin, „wieder“, weglassen, beruht Thyen zufolge möglicherweise darauf, „daß sie angesichts der langen Samaria-Episode die doppelte Funktion dieses palin übersehen haben“, nämlich sowohl „zurück auf die Erzählung von der Kanahochzeit“ als auch „voraus auf das zweite Kana-Zeichen (4,43ff)“ zu verweisen.
Die erste Brücke sieht Thyen ähnlich wie Wengst. Sie soll „die Samaria-Episode mit der vorausgehenden Täuferszene“ verbinden und (T239) zugleich „Jesu Weggang aus Judäa … nach Galiläa“ motivieren:
Wie die „Pharisäer“ bereits 1,24 als die treibende Kraft genannt waren, auf deren Initiative hin die „Juden“ Jerusalems jene Delegation aus Priestern und Leviten zum „Verhör“ Johannes des Täufers gesandt hatten…, so „erkennt“ der allwissende Jesus nun, daß den „Pharisäern“ sein judäischer „Missionserfolg“, der denjenigen des Johannes weit in den Schatten stellt, zu Ohren gekommen ist. Deshalb verläßt er Judäa und wendet sich wiederum Galiläa zu.
Dabei weiß der von Johannes vorausgesetzte Leser (T240) „aus den Prätexten der synoptischen Evangelien“,
daß sich Jesu Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Ioudaioi zum tödlichen Konflikt zuspitzen wird. Eingeführt in die Johanneslektüre durch den Prolog weiß er aber zugleich, daß keinesfalls irgendeine Art von Konfliktscheu Jesu die Ursache seiner Abwendung von Judäa sein kann.
Daher sieht Thyen die sozusagen in Klammern eingefügte Bemerkung, dass nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger tauften, insofern als eine notwendige „Präzisierung“ von Vers 3,26 an, als die Zeit für Jesus Tauftätigkeit – vor der Stunde seines Kreuzestodes – noch gar nicht gekommen sein kann,
weil Johannes (der Täufer) Jesus ja als den bezeugt hatte, „der mit dem heiligen Geist taufen werde“ (1,33). Doch die Zeit dieser Geisttaufe, die denen, „die an ihn glauben“, den heiligen Geist mitteilen soll, ist noch nicht gekommen (7,39: to pneuma ho emelon lambanein hoi pisteusantes eis auton {der Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten}). Einstweilen gilt vielmehr: oupō gar ēn pneuma, hoti Iēsous oudepō edoxasthē {denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht} (7,39). Man muß das darum wohl so verstehen, daß jetzt allein Jesu Jünger in der Nachfolge des Johannes dessen „Wassertaufe“ üben (1,33), und daß erst Jesu „Verherrlichung“ durch seine Kreuzigung und Auferstehung jene „Wassertaufe“ zur Taufe mit dem Heiligen Geist wandeln wird. Auch hier gilt darum das Wort Jesu an seine Mutter: oupō ēkei hē hōra mou {meine Stunde ist noch nicht gekommen} (2,4; vgl. 7,6.8; 7,30; 8,20).
Mit seinen Bemerkungen über Jesu Allwissenheit und die Abwehr jeglichen Anscheins, Jesus könnte einem Konflikt mit seinen Gegnern aus dem Weg gegangen sein, erweckt Thyen allerdings wieder den Verdacht, dass er Johannes 1,14 nicht ernst genug nimmt: Gottes Wort nimmt das „Fleisch“, sarx, dieses Juden Jesus an, seine konkrete Biographie, seine ganze Menschlichkeit. Eigentlich weiß Thyen das auch, da er gegen Käsemann Jesus nicht als einen über die Erde wandelnden Gott betrachtet.
Ton Veerkamp <327> sieht sehr viel nüchterner Gerüchte im Schwange, die anzeigen, in welch „großer Gefahr“ Johannes der Täufer lebte:
Jesus wollte sich dieser Gefahr nicht ohne Not aussetzen. Jesus ging weg nach Galiläa, das Land der Zeichen. Er nimmt den Weg durch das Land Samaria, was keineswegs selbstverständlich ist.
Und zu den widersprüchlichen Aussagen über die Taufpraxis Jesu meint Veerkamp:
Hier wird gesagt: Taufen ist etwas, was die Schüler taten, Jesus tat das nicht! Offenbar muss es eine kontroverse Diskussion in der Gruppe um Sinn und Unsinn des Taufens gegeben haben.
↑ Johannes 4,4-6a: Jakobs Brunnen auf Josefs Feld bei der Stadt Sychar in Samarien
4,4 Er musste aber durch Samarien reisen.
4,5 Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar,
nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte.
4,6a Es war aber dort Jakobs Brunnen.
[14. Mai 2022] In den einleitenden Ausführungen zur Beziehung zwischen Judäa und Samarien war schon von der Bemerkung in Johannes 4,4 die Rede gewesen, dass Jesus durch Samarien reisen „musste“, edei. Dazu stellt Klaus Wengst fest (W133):
Prinzipiell „musste“ er das keineswegs. Denjenigen, die von Judäa nach Galiläa oder umgekehrt reisen wollten, boten sich drei Routen an: außer der durch Samarien die im Osten durch den Jordangraben oder die im Westen durch die Küstenebene. Wer allerdings den schnellsten Weg nehmen wollte, „musste durch Samarien hindurchgehen“. <328>
Wie Thyen (T241), der dieses edei als „ein erstes Signal“ für „symbolische Obertöne“ in unserer Szene ansieht, meint auch Wengst (W133f.):
Da an dieser Stelle nicht auf Eile abgehoben wird, dürfte in diesem „Musste“ mehr mitschwingen. Wenn biblisch ein Geschehen mit „muss“ verbunden wird, ist damit keine fatalistische Aussage gemacht. Vielmehr gilt, dass in diesem Geschehen Gott zum Zuge kommt.
Den (W134) Schauplatz „des folgenden Geschehens“ nennt Wengst „geschichtsträchtig“. Es handelt sich um (W134f.)
die Senke zwischen den Bergen Garisim und Ebal (Dtn 11,29f.; 27,11-26; Jos 8,30-35), nahe der alten Stadt Sichem, wo Jakobs Tochter Dina vergewaltigt wurde und ihre Brüder Simeon und Levi blutige Rache nahmen (Gen 34). Das zerstörte Sichem wird im Text nicht erwähnt, sondern „eine Stadt Samariens, die Sychar heißt“. Sie hatte wahrscheinlich Bedeutung in der Zeit nach der Zerstörung Sichems, bis dieses 72 n. Chr. als römische Kolonie Flavia Neapolis – diese Bezeichnung ist noch im heutigen arabischen Stadtnamen „Nablus“ erhalten – wieder neu gegründet wurde. Neben den impliziten biblisch-geschichtlichen Hinweisen auf Sichem und die Berge Garisim und Ebal wird eine ausdrückliche Anmerkung zu Sychar gegeben: „nahe dem Stück Land, das Jakob seinem Sohn Josef gab“. Das bezieht sich auf Gen 33,19; 48,22 und Jos 24,32. Nach der letztgenannten Stelle wurde Josef hier begraben und ein Josefsgrab wird bis heute gezeigt. „Dort war die Jakobsquelle.“ Diese Bezeichnung hat keinen biblischen Anhalt, beruht aber auf alter Tradition, wie schon der Text des Johannesevangeliums (V. 12) zeigt. Es handelt sich um einen Brunnen, der nicht vom Regen, sondern vom Grundwasser gespeist wird, also „lebendiges Wasser“ hat.
Nach Ton Veerkamp <329> ist der „in Johannes 4,5 erwähnte Ort Sychar“, der „in Sichtweite vom heiligen Berg Samarias, dem Gerizim, knapp 1 km nordöstlich von der Trümmerstätte Sichems“ liegt, ein
guter Ort für die Friedenserzählung, die jetzt folgt. …
Die Gegend war ein Geschenk Jakobs an seinen Sohn Joseph; Joseph steht hier für Samaria. Jakob gab „den Bergrücken [Schekhem {Sichem}], den ich [= Jakob] dem Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen weggenommen habe“, dem Joseph (Genesis 48,22).
Schon die beiden Namen Jakob und Joseph deuten also an, dass der Aufenthalt Jesu in Samarien auf dem Hintergrund der biblischen Ursprünge Samariens als Teil des Gottesvolkes Jakob/Israel zu begreifen ist.
Hartwig Thyen beschäftigt sich außerdem mit Lesarten anderer Handschriften, die anstelle von Sychar andere Ortsnamen enthalten. Die Lesart Sychem kann schon deswegen nicht stimmen (T242), weil
der ,Jakobsacker‘ als die bekannte Größe ganz offensichtlich der Identifizierung eines unbekannten Ortes namens Sychar dienen soll… Das spricht ebenso wie unsere gesamte Szene und zumal ihre Dialoge dafür, daß wir uns am Ort eines samaritanischen Heiligtums befinden.
Den Ortnamen Sychar bringt Thyen unter Berufung auf Helga Weippert <330> mit der Ortschaft Askar in Verbindung:
„Als Johannes I. Hyrkan die Provinz Samaria zu erobern versuchte (erster Versuch 128), zerstörte er den Garizim-Tempel (wohl erst 108/107) und die Stadt S(ichem), die nicht wieder aufgebaut wurde. Ihre Nachfolge traten das am Hang des Ebal liegende, in Joh 4,5 genannte Sychar (= ‚Askar‘) und das 72 n. Chr. von Vespasian gegründete Flavia Neapolis (heute Nablus) an. Die kultische Tradition auf dem Garizim lebte jedoch weiter“. Bei dem letzteren Feldzug zerstörte Hyrkan auch noch die stark befestigte hellenistische polis Samaria, auf deren Mauern Herodes der Große 27 V. Chr. zu Ehren des eben mit dem Titel „Augustus“ ausgezeichneten Kaisers Octavian die Stadt ,Sebaste‘ gründete (sebastos ist das griechische Äquivalent zu augustus: ,der Erhabene‘).
In diesem Zusammenhang kommt Thyen zu folgender Vermutung:
Möglicherweise hat der heilige Ort von ,Jakobsacker‘ und ,Jakobsbrunnen‘ in der Nachbarschaft Sychars nach der Zerstörung des Garizimtempels einen Teil von dessen Kultfunktionen an sich gezogen.
Zum „Acker (chōrion), den Jakob seinem Sohn Joseph geschenkt hatte“, erwähnt Thyen außer den von Wengst zitierten biblischen Bezügen, dass nach Apostelgeschichte 7,15-16 „nicht nur Joseph, sondern auch alle seine elf Brüder auf dem ,Jakobsacker‘ bei Sichem beigesetzt wurden“, was ihm zufolge „durchaus auf samaritanischer Lokaltredition beruhen“ könnte.
Sehr ausführlich beschäftigt sich Thyen mit dem Brunnen Jakobs, der ekei, „dort“, also „auf diesem Acker“ war:
Der ,Brunnen‘ ist also das bleibende Monument, das den ,Acker‘ überhaupt erst identifizierbar und wiedererkennbar macht. Er wird hier als pēgē bezeichnet, was eigentlich „Quelle“ heißt. Erst in V. 11f erscheint dann zweimal das Lexem phrear = Brunnen.
Gegen diejenigen, die aus dieser unterschiedlichen Benennung wieder ein „Argument zur Quellenscheidung“ abzuleiten versuchen, betont Thyen, dass „der Witz der Erzählung … gerade darin“ besteht (T243)
daß am Grunde des sehr tiefen Brunnens (to phrear estin bathy {der Brunnen ist tief}: V. 11) eine Quelle ,lebendigen Wassers‘ entspringt (hydōr zōn). Es handelt sich bei diesem Brunnen also wohl um eine ,gefaßte Quelle‘.
Obwohl es „für die Existenz und Verehrung dieses Brunnens, der doch der zentrale Motivspender unserer Szene ist, keinerlei literarische Zeugnisse gibt“, meint Thyen, „daß der Brunnen auf diesem Jakobsacker wirklich existierte und von den Samaritanern ‚ihrem Vater Jakob‘ zugeschrieben (V. 12) und entsprechend verehrt wurde.“ Zur Bedeutung dieses Brunnens für unsere Erzählung zitiert Thyen ausführlich aus einem Exkurs von Birger Olsson <331> über den Brunnen in der jüdischen Tradition. Nachdem er den „phrear hydatos zōntos {Brunnen lebendigen Wassers}“ der Hagar in 1. Mose 21,19 und denjenigen der Knechte Isaaks in 1. Mose 26,19 nur kurz streift, geht er ausführlicher auf die „Brautwerbung für Isaak“ in 1. Mose 24 ein, wo Abrahams „Knecht am Brunnen vor der Stadt Nachors“ Rebekka bittet: „Gib mir zu trinken“, und „zusammen mit Rebekka schließlich die Heimreise antreten“ kann.
Noch signifikanter ist die Erzählung von Jakobs Begegnung mit Rachel am Brunnen vor den Toren Harans und deren Rezeptionsgeschichte in der jüdischen Literatur (Gen 29): Auf der Flucht kommt Jakob in ein fremdes Land und rastet bei einem Brunnen auf einem Feld. Der Brunnen ist mit einem riesigen Stein verschlossen. Dann erscheint Labans Tochter Rachel mit ihrer Herde. Jakob hebt dann den Stein von der Brunnenöffnung und tränkt Labans Schafe. Gen 30 zeigt ihn dann als den Hirten der Herden Labans.
Spannend ist nun Thyen zufolge, wie die „Targumim Neofiti und Pseudo-Jonathan“ dieser Erzählung die Darstellung wundersamer Zeichen hinzufügt (T244),
die „unser Vater Jakob“ tat, als er von Beersheba nach Haran zog. Da heißt es zu Gen 29,10: „Und das fünfte Zeichen: Als unser Vater Jakob den Stein von der Öffnung des Brunnens hob, da floß er über und das Wasser schoß empor bis zum Rande. Und zwanzig Jahre lang, all die Tage, die Jakob in Haran weilte, floß der Brunnen über“. Und Gen 29,10.12 wird so paraphrasiert: „Mit nur einem Arm hob er den mächtigen Stein von der Brunnenöffnung. Und der Brunnen schwoll an und das Wasser sprang auf bis obenhin. Und er tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und seit er den Stein abgehoben hatte, strömte das Wasser zwanzig Jahre lang im Überfluß. Doch als er dann weggegangen war, da kamen die Hirten zum Brunnen und fanden kein Wasser. Und vergebens warteten sie drei Tage lang. Doch das Wasser strömte nicht mehr. Am dritten Tag kamen sie zu Laban. Und der erkannte, daß Jakob geflohen war. Denn aufgrund seiner Gerechtigkeit hatte der Brunnen zwanzig Jahre lang Wasser im Überfluß gespendet“.
Auch das „archaische ‚Brunnenlied‘ von Num 21,16-18“, das „fast unmittelbar der Episode von der ehernen Schlange“ folgt, erfährt im Targum Pseudo-Jonathan wundersame Ergänzungen:
„Und dort ward ihnen der lebendige Brunnen gegeben, der Brunnen, über den der Herr zu Mose gesagt hatte: ,Versammle das Volk und ich will ihm Wasser geben“. Und siehe, dann sang Israel zum Lobpreis dieses Lied, weil ihnen der eine Zeit lang verborgene Brunnen nun durch das Verdienst Mirjams wiedergegeben war: ,Springe auf, o Brunnen! Spring auf, du Brunnen!‘. So sangen sie und der Brunnen floß über; der Brunnen, den die Väter der Welt, Abraham, Isaak und Jakob, gegraben hatten, die Fürsten der alten Zeit gruben ihn, die Führer des Volkes, Mose und Aaaron, die Schreiber Israels fanden ihn mit ihren Stäben. Und von der Wüste(nzeit) an war er ihnen als Geschenk gegeben. Und von da an wanderte er mit ihnen hinauf auf die hohen Berge, und wieder hinunter zu den Hügeln rings um Israels Lager. Und er gab ihnen zu trinken, einem jeden am Eingang seines Zeltes“.
Diese Vorstellung von einem wunderbaren „Brunnen, der die Väter auf ihren Reisen und das Volk auf seiner Wanderung durch die Wüste begleitete“, ist im Judentum weit verbreitet; auch
Paulus weiß von dem wasserspendenden Felsen, der das Volk durch die Wüste begleitete (1Kor 10,4: epinon gar ek pneumatikēs akolouthousēs petras, hē petra de ēn ho Christos {denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus.}). Dem targumischen Umgang mit der Schrift entsprechend, könnte der Jakobsbrunnen bei Sychar durchaus der wunderbare Quellbrunnen Harans sein, der den Patriarchen auf seiner Reise begleitet und unterwegs den Durst der Karawane und ihres Viehs gestillt hat.
↑ Johannes 4,6b-7a: Jesus und die Repräsentantin der Stamm-Mütter Israels
4,6b Weil nun Jesus müde war von der Reise,
4,6c setzte er sich an den Brunnen;
4,6d es war um die sechste Stunde.
4,7a Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen.
Nachdem der Schauplatz des nun folgenden Gesprächs beschrieben ist, werden auch die am Gespräch Teilnehmenden benannt. Der erwähnte Brunnen ist Wengst zufolge (W135) „der Ort, an dem sich Jesus, ‚abgemüht von der Wanderung‘, niederlässt. ‚Es war um die sechste Stunde‘, also die Zeit des hohen Mittags.“ Die Frau, die genau in dieser Mittagshitze kommt, „um Wasser zu schöpfen“, wird mit der „Ortsangabe ‚aus Samarien‘“ … von vornherein als Samariterin“ charakterisiert. Das „Wasserschöpfen um diese Tageszeit durch eine einzelne Frau“ findet er jedoch „ungewöhnlich“. Normalerweise wurde diese Arbeit „am Morgen und Abend“ vor allem von den „zu heiratsfähigem Alter heranwachsenden Mädchen“ verrichtet, und zwar (W136) war „das Wasserschöpfen eine Arbeit für ‚die Töchter der Armen‘…, nicht aber für ‚die Töchter der Reichen‘.“ <332> Aus der ungewöhnlichen Tageszeit und daraus, „dass der Fortgang der Erzählung sie als nicht mehr junge Frau erweisen wird“, zieht Wengst weitreichende Schlussfolgerungen über den sozialen Status der Frau:
Wenn eine Frau so handelt, tut sie es nicht aus freien Stücken, sondern weil sie in irgendeiner Weise dazu gezwungen ist. Dass sie als Sklavin vorgestellt sei, macht ihr anschließendes freies Handeln nicht gerade wahrscheinlich. Eher ist an eine Lohnarbeiterin zu denken. Auf alle Fälle lebt, wer so zu handeln gezwungen ist, in einer bedrückenden sozialen Situation. <333>
Indem sich jedoch zeigen wird, „dass die Frau zu ungewöhnlicher Zeit genau richtig kommt“, bildet die „Zeitangabe ‚um die sechste Stunde‘ … auch ein Gegenstück zu der von 3,2, dass Nikodemus ‚nachts‘ zu Jesus kam“, der im übrigen (Anm. 172) auch „in sozialer Hinsicht“ als „‚Ratsherr‘ der Wasserträgerin antithetisch gegenüber“ steht.
Damit akzentuiert Wengst seine Auslegung dieser Geschichte von vornherein sozialgeschichtlich, was ihn dazu verleitet, den biblischen Hintergrund weniger stark zu berücksichtigen. So nimmt er zwar wahr (Anm. 170), dass die Szenerie des Brunnens „an biblische Geschichten über Brautfindungen am Brunnen“ erinnert
(z. B. Gen 24,10-25; 29,1-14). Allerdings bildet dieses Motiv hier nur den Hintergrund, der als solcher „einen grundsätzlich positiven Ausgang der Begegnung in Aussicht (stellt)“. <334>
Nach Hartwig Thyen sind aber gerade die biblischen Bezüge keineswegs zu vernachlässigen (T244):
Die ganze Episode erscheint uns als ein intertextuelles Spiel mit den genannten biblischen Brunnenszenen, unter denen die Erzählung von Moses Flucht aus Ägypten (Ex 2,15-22) die wohl „interessanteste Parallele“ darstellt.
Auf in besonderem Maße auffallende Übereinstimmungen macht Thyen in der von Josephus dargebotenen Nacherzählung von Moses Wüstenwanderung nach Midian aufmerksam (T245): <335>
Wie einst Mose, als ihm die Mordpläne und -befehle des Pharao gegen sein Leben zu Ohren gekommen waren, aus Ägypten nach Midian floh, so flieht hier der allwissende Jesus, der die finalen Absichten der Pharisäer bereits kennt, aus dem feindlichen Judäa ins freundliche Galiläa. Und wie damals Mose sich in der Hitze des Tages am Brunnen vor den Toren einer midianitischen Stadt erholte, so rastet Jesus nun „um die sechste, die heiße Mittagsstunde“ am Jakobsbrunnen von Sychar.
Die griechischen Vokabeln für die Ermüdung Jesu von einer mühevollen Reise (T244) nimmt Thyen hier übrigens zum Anlass für einen Seitenhieb auf Ernst Käsemanns Auffassung, der johanneische Jesus sei nicht wirklich Mensch geworden (siehe die Auslegung von Johannes 1,14a):
Ermattet (kekopiakōs) von der beschwerlichen Wanderung (hodoiporia) und durstig von der Hitze des Tages (V. 7) hat Jesus sich kurzerhand (houtōs) beim Brunnen niedergesetzt. Schwerlich schreitet so „ein Gott über die Erde“.
Ähnliche griechische Wörter verwendet Thyen zufolge Josephus (T245):
Josephus dramatisiert die Moseerzählung so: Weil der Pharao, um des Flüchtigen habhaft zu werden, alle Straßen bewachen läßt, muß sich Mose seinen Fluchtweg … mitten durch die weglose Wüste bahnen. Von kopos und talaipōria dieser beschwerlichen Flucht erschöpft, rastet er, zumal es gerade Mittag ist (mesēmbrias ousēs), an einem Brunnen (kathestheis epi tinos phreatos…). Und wie ihn dort in dieser Mittagsstunde „die sieben Töchter Reguëls“ finden, als sie zum Brunnen gekommen waren, um die Herden ihres Vaters zu tränken, so begegnet hier die zum Wasserschöpfen gekommene Samaritanerin dem fremden Juden Jesus. … Am Ende nimmt Reguël Mose „an Kindesstatt an“ und gibt ihm eine seiner Töchter zur Frau. Und wie einst auf die Erzählung von Reguëls Töchtern hin dessen Knechte Mose als Gast in das Haus ihres Herrn eingeladen hatten, so laden jetzt die auf die der Samaritanerin hin zum Jakobsbrunnen gekommenen Leute aus Sychar Jesus ein, ihr Gast zu sein (… Joh 4,40…).
Anders als Wengst beantwortet Thyen auch die „Frage, warum denn jene Samaritanerin ausgerechnet in der größten Hitze des Tages zum Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen“:
Die psychologisierende Auskunft, daß sie diese ungewöhnliche Zeit gewählt habe, um so „als bekannte Sünderin das Zusammentreffen mit den anderen Frauen“ zu vermeiden, entspricht schwerlich dem Charakter unserer Erzählung und grenzt mit ihrer moralistischen Attitüde eher ans Komische.
Immerhin muss man Wengst zugutehalten, dass seine Interpretation zwar in eine ähnliche Richtung geht, aber der Frau in ihrer sozialen Situation gerecht zu werden versucht.
Thyen zufolge (T144) dient die „Zeitangabe: hōra ēn hōs ektē {es war um die sechste Stunde}“ vor allem „der Motivation des Durstes Jesu“. Ob sie (T145)
darüberhinaus noch symbolische Obertöne zum Klingen bringen will, mag man fragen. Immerhin erscheint auf diese Weise die Samaritanerin im Gegensatz zum nächtlichen Besuch des archōn tōn Ioudaiōn {Oberen der Juden} Nikodemus (3,2; vgl. 13,30) im hellen Licht des Tages bei Jesus…
Thyen will in dieser Zeitangabe auch (T246) „Assoziationen zur Passionserzählung“, auf die R. H. Lightfoot <336> aufmerksam macht, nicht ausschließen:
Jesu Erschöpfung: 4,6 und 19,1f; seinen Durst: 4,7 und 19,28; und sein Vollenden des ihm vom Vater übertragenen Werkes: 4,34 und 19,30. Er macht darauf aufmerksam, daß auch die Zeitbestimmung, hōra ēn hōs ektē {es war um die sechste Stunde}, in 19,14 ihre wörtliche Entsprechung hat: Spricht Jesus am Jakobsbrunnen in der sechsten Stunde, nachdem die Frau ihre messianische Hoffnung ins Spiel gebracht hat, sein erstes egō eimi unseres Evangeliums (siehe unten zu 4,25f), so präsentiert Pilatus den Juden in der sechsten Stunde der paraskeuē {Vorabend} des Passa Jesus mit den Worten: ide ho basileus hymōn (19,14…).
Wie Thyen hält es auch Ton Veerkamp <337> für unerlässlich, den biblischen Hintergrund unserer Geschichte ernstzunehmen. Im Blick auf die Identifikation der Frau am Jakobsbrunnen geht er jedoch einen entscheidenden Schritt weiter:
Jesus setzt sich, wie die Väter Israels, wie Isaak und wie Jakob, an den Ortsbrunnen, den schon Jakob ausgehoben hatte. Drei Namen haben wir gehört: Jesus, Jakob, Joseph. Jetzt kommt eine Frau, die uns an Rebekka und an Rahel, an die Mutter Israels und an die Mutter Josephs (= Samarias) denken lässt. Die Frau am Brunnen ist nicht irgendeine dumme Person mit einer schmuddeligen Vergangenheit, sie ist eine der großen Frauen Israels. Wer sich das nicht gleich am Anfang vergegenwärtigt, wird hier nichts verstehen.
Diese Identifikation der Samaritanerin mit Rebekka und Rahel passt in Veerkamps Augen auch zu ihrer ausgesprochen selbstbewussten Argumentation in der nun beginnenden Diskussion mit Jesus:
Die Frau setzt den Wasserkrug ab. Sie stemmt die Hände in die Hüften – so dürfen wir uns ruhig die Frau vorstellen, die Erzählung wird uns recht geben! -, redet unmissverständlich und laut, von oben nach unten. So wird sie während des ganzen Gespräches bleiben, sie ist nicht kleinzukriegen.
Entscheidend für Veerkamps Auslegung ist ein doppelter Kontext, den er folgendermaßen beschreibt:
Außer dieser unfrommen bildlichen Vorstellung brauchen wir „Bibelfestigkeit“. Wir erklären einen biblischen Text, der Kontext der Erzählung ist die ganze Schrift und die aktuelle politische Lage, beides. Unsere Erzählung schickt uns erst einmal in das Buch Am Anfang, Genesis, 1 Mose.
Im 1. Buch Mose denkt Veerkamp zunächst an das Kapitel 24:
Abraham schickt seinen Knecht als Brautwerber zu Nahor, seinem Verwandten, um dort eine Frau für Isaak, seinen Sohn, zu finden. Der Knecht kommt in die Stadt „zur Abendzeit, der Zeit, wo die Schöpferinnen ausziehen“. Er sagt (Genesis 24,12-14):
Ewiger, Gott meines Herrn Abraham,
richte es heute ein für mich,
erweise Solidarität mit meinem Herrn Abraham.
Da, ich habe mich hingestellt beim Wasserbrunnen,
und die Töchter der Stadtleute ziehen aus, Wasser zu schöpfen.
Möge es geschehen:
Das Mädchen, zu dem ich sage:
„Halte deinen Krug hin, dass ich trinken kann“,
und sie sagt: „Trinke,
auch deinen Kamelen werde ich zu trinken geben“,
die hast du für deinen Knecht Isaak bestimmt,
an ihr erkenne ich, dass du dich solidarisch erwiesen hast mit meinem Herrn.Rebekka kam und erfüllte den Wunsch des Dieners Abrahams.
Dass die Szene bei Johannes nicht am Abend, sondern um „die sechste Stunde“ spielt, lässt Veerkamp zufolge
wieder an Rahel denken, weil Rahel mit ihren Schafen kam, als „es noch groß am Tag“, also am hellichten Tag war, Mittag, sechste Stunde (Genesis 29,7).
Genau diese Szene, in der Rahel mittags zum Brunnen kommt, spricht gegen die Annahme von Wengst und anderen Exegeten, die das Kommen der Samaritanerin in der Mittagsstunde auf soziale oder moralische Probleme der Frau meinen zurückführen zu können.
Was geschieht nun nach Veerkamp damals, als Rahel mittags zum Brunnen kam, und jetzt, in der erzählten Zeit des Johannes, als Jesus um die gleiche Stunde einer Frau am Brunnen begegnet?
In diesem Augenblick, am Brunnen, beginnen sich die Verheißungen Israels, die Jakob im Traum zu Bethel gesehen und die Jesus dem Nathanael in Erinnerung gerufen hatte (1,51), zu verwirklichen: mit der großen Liebe Jakobs und mit der großen Hochachtung, mit der Jesus der Frau aus Samaria begegnen wird.
Johannes ruft diese Stellen aus dem 1. Buch Mose mit voller Absicht auf, um durch die Parallelisierung der Zeit Jakobs mit der Zeit Jesu auf einen entscheidenden Unterschied der jeweiligen politischen Situation Israels hinzuweisen, denn im 1. Jahrhundert ist „die Situation Israels … eine völlig andere“ geworden:
Israel stand damals das Sklavenhaus noch bevor, hier befindet es sich, zerrissen und geschunden, im Sklavenhaus Roms.
Diese Zerrissenheit Israels wird in diesem Gespräch ausdrücklich darin offenbar werden (Vers 9), dass Judäer nicht mit Samaritanern verkehren.
↑ Johannes 4,7b-8: Jesu Bitte „Gib mir zu trinken!“ in Abwesenheit seiner Schüler
4,7b Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken!
4,8 Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen.
Nach Klaus Wengst (W136) spricht Jesus mit seiner Bitte, ihm zu trinken zu geben,
eine elementare menschliche Bitte aus, die seinem vorher beschriebenen Zustand der Erschöpfung entspricht. Er sitzt zwar am Brunnen, aber ohne Schöpfgerät kommt er nicht an das Wasser tief unten heran. Die Frau kann ihm helfen.
Die Bemerkung über den Weggang seiner Schüler, um in der Stadt Proviant zu beschaffen, soll Wengst zufolge „das Alleinsein Jesu am Brunnen“ begründen.
Hartwig Thyen (T246) betont zunächst, dass Jesus mit „seiner knappen Bitte: dos moi pein {Gib mir zu trinken}“, die Initiative ergreift:
Im Unterschied zu den synoptischen „Streitgesprächen“, die zumeist durch eine an Jesus herangetragene Frage oder Bitte eröffnet werden, ist das für die johanneischen Dialoge typisch.
Allerdings hält er die „objektlose Bitte“ (ohne ein Getränk zu erwähnen) für „zwar möglich und verständlich, aber dennoch ungewöhnlich“. Vermutlich will Johannes mit den Worten didonai, „geben“, und pinein, „trinken“, gleich zu Beginn die „die beiden den folgenden Dialog bestimmenden Motive ins Spiel“ bringen.
Da „der Leser Jesu Jünger als seine ständigen Begleiter und ‚Nachfolger‘ (1,38) an seiner Seite“ weiß, bezeichnet Thyen den Vers 4,8 als
eine notwendige ,szenische Bemerkung‘, denn der folgende Dialog Jesu mit der Samaritanerin ist im strengen Sinn ein „Gespräch unter vier Augen“, das die Gegenwart Dritter strikt ausschließt. Darum wird jetzt gesagt, daß die Jünger in die Stadt gegangen waren (Plusquamperfekt), um Speisen zu kaufen. So wird der Leser in die gespannte Erwartung der Rückkehr der Jünger versetzt und zugleich verknüpft der ,allwissende Erzähler‘ auf diese Weise geschickt Jesu Dialog mit der samaritanischen Frau mit seiner Erwiderung auf die Aufforderung seiner inzwischen zurückgekehrten Jünger: „Rabbi, iß doch!“ (4,31-38). Ebenso wird dann das zurückgelassene Schöpfgefäß der Frau (V. 28) ihren Auftritt mit dem Erscheinen der „vielen Leute aus der Stadt, die aufgrund ihres Zeugenwortes an {247} Jesus glaubten“ (39-42), verbinden.
Das klingt überzeugend. Seltsam finde ich allerdings Thyens Spekulationen über die Allwissenheit des Erzählers, die auf „der Erzählebene … damit begründet“ wird, „daß der, ‚der dieses geschrieben hat‘ (21,24), nämlich der geliebte Jünger, an der Brust seines Herrn lag {13,23}… Und wie sein Herr, ‚der an der Brust des Vaters liegt‘, dessen einziger ‚Exeget‘ ist (1,18), so ist unser Erzähler der Exeget Jesu…“.
↑ Johannes 4,9: Die samaritanische Frau im Konflikt mit Jesus, dem judäischen Mann
4,9 Da spricht die samaritische Frau zu ihm:
Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau?
Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. –
[15. Mai 2022] Wie reagiert die Samaritanerin auf Jesu Bitte? Wengst, Thyen und Veerkamp beurteilen ihre Antwort völlig unterschiedlich.
Klaus Wengst stellt zunächst einfach fest, dass „nicht erzählt“ wird, ob „sie seiner Bitte entspricht. Das Problem der Erschöpfung Jesu gerät aus dem Blick, weil Johannes Wichtigeres mitzuteilen hat.“ Dieses Wichtigere ist der Punkt,
den die Geschichte von vornherein im Blick hatte, als sie die Notwendigkeit des Durchzugs durch Samarien betonte, Sychar als „Stadt Samariens“ nannte und die Frau „aus Samarien“ kommen ließ: den Gegensatz von Juden und Samaritern.
Das kommt in der Frage der Frau zum Ausdruck: „Wieso bittest du, obwohl du Jude bist, von mir zu trinken, die ich doch eine samaritische Frau bin?“
Hier ist zunächst festzuhalten, dass Jesus als Jude angesprochen wird. Das nimmt er später in eigener Rede auf, indem er sich gegenüber den Samaritern mit allen anderen Juden in einem gemeinsamen Wir zusammenfasst. Nach 7,41.52 stammt Jesus aus Galiläa, ist jedoch nichtsdestoweniger Jude.
Nach Wengst sieht die Frau Konfliktpotential zwischen sich und Jesus aus mehreren Gründen: Erstens (W137) auf Grund von schlechten Erfahrungen mit galiläischen Festpilgern, die „stolz oder ängstlich“ denken würden: „Eher verdurste ich, als dass ich von einer Samariterin etwas annehme!“ Zweitens ist „auch der Gegensatz von Mann und Frau als ein Nebenaspekt mit im Blick“. Die Anmerkung: „Juden haben nämlich keinen Umgang mit Samaritern“ darf aber nicht im Sinne einer völligen „Isolierung voneinander“ verstanden werden, als ob Jesus sich im Kontakt mit der Frau verunreinigt hätte. Umgekehrt lässt die Frau, gerade indem sie „ihrer Verwunderung Ausdruck gibt, … auf ein Gespräch mit diesem Juden ein – ein Gespräch, in dem sie sich dann noch mehr verwundern wird. Dazu gibt er ihr gleich Anlass.“
Hartwig Thyen dagegen (T247) verurteilt die Samariterin mit scharfen Worten:
Anders als die von dem durstenden Elia um einen Trunk Wassers gebetene ,Witwe von Sarepta‘ von 1Kön 17, 7-16 oder als der ,barmherzige Samaritaner‘ von Lk 10,30ff zeigt sich diese Samaritanerin unfähig, ihrer elementarsten Menschenpflicht zu genügen. Obgleich dieser ermattete und durstige Fremdling ihr förmlich ausgeliefert und auf ihre Hilfe angewiesen ist, weil doch nur sie über das Mittel verfügt, seinen Durst zu löschen, hört sie nicht auf seine Stimme. Sie merkt nicht, daß in seinen Worten: „Gib mir zu trinken!“ Gott selbst spricht, daß darin das Gebot laut wird, das Juden wie Samaritaner bindet: „Wie ein Einheimischer aus eurer Mitte soll der Fremdling bei euch wohnen. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid ja auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott“ (Lev 19,34).
Stattdessen offenbart sich die Frau als eine „Gefangene religiöser und sozialer Vorurteile“:
Sie vermag in Jesus nur einen zu sehen, der willkürlich zwei eherne Tabus sozialer Konventionen verletzt: Den Mann, der eine fremde Frau anredet, und den Juden, der eine Samaritanerin um Wasser bittet. Und wie Nikodemus nur fragen konnte: pōs dynatai tauta genesthai? {Wie kann das denn geschehen?} (3,9), so bleibt auch der Samaritanerin nichts als eine derartige Frage: pōs sy … par‘ emou pein aiteis? {Wie kommst du dazu…, von mir etwas zum Trinken zu erbitten?}
Das heißt: Mehr als Wengst nimmt Thyen ernst, dass mit keinem Wort die Erfüllung der Bitte Jesu berichtet wird. Wie sein Urteil über die Samaritanerin zu beurteilen ist, lasse ich vorerst offen.
Zur erläuternden Zwischenbemerkung des Erzählers über den Konflikt zwischen Juden und Samaritanern sagt Thyen vom Kontext her, „daß hier sowohl Ioudaiois als auch Samaritais Bezeichnung religiöser und nicht etwa geographischer Zugehörigkeit sind“. Damit hat er insofern Recht, als die vorhandenen Spannungen natürlich nicht auf die Geographie zurückzuführen sind. Aber wieso ignoriert er neben dem religiösen Konfliktstoff die mindestens ebenso brennenden politischen Probleme, die sich spätestens seit dem judäischen Fürsten Hyrkan zwischen den verfeindeten Teilen des einstigen Volkes Israel aufgetürmt haben und die unter der Herrschaft des Römischen Imperiums nicht zu lösen sind?
Sehr genau betrachtet Thyen das Wort synchraomai, das „zumeist durch ‚keinen Umgang‘ oder ‚keine Gemeinschaft miteinander haben‘ wiedergegeben“ wird und das im Neuen Testament nur hier vorkommt. David Daube <338> hat dieser
üblichen Auffassung … scharf widersprochen. Er behauptet, daß es dafür keinerlei Belege gebe, und daß die Bildung dieses Kompositums aus syn und chraomai die Übersetzung fordere: (einen Gegenstand) „gemeinsam benutzen“ oder „gebrauchen“. Diese etymologische Worterklärung ist jedoch höchst fragwürdig. Denn Daube muß dazu das vermeintlich zu ergänzende Dativobjekt „not with the main body of the verb ‚chraomai‘ {nicht mit dem Hauptteil des Verbs chraomai, ‚brauchen‘}“ verbunden sein lassen, das in dem Dativ Samaritais ja sein explizites Objekt hat, sondern allein „with the prefix syn {mit der Vorsilbe syn, ‚gemeinsam mit‘}“. Auch wenn er für diese Konstruktion keinerlei Beleg anführen kann, schließt Daube kühn: „The possibility of this construction must have existed {Die Möglichkeit dieser Konstruktion muss existiert haben}“. Zudem stützt er seine Erklärung auf eine spezielle jüdische Regelung der Jahre 65 oder 66 n. Chr., wonach die „Töchter der Samaritaner von der Wiege an menstruieren“ und darum ,unrein‘ sind. <339>
Thyen gesteht zwar zu, dass „die emphatische Betonung des Frauseins der Samaritanerin … durchaus die darin implizierte Einschätzung der samaritanischen Frauen widerspiegeln“, aber er widerspricht der im Anschluss an Daube auch von Barrett <340> in folgender Form vertretenen Auffassung:
Er läßt unsere Samaritanerin ihre Unreinheit „notwendigerweise auf das Gefäß, das sie hielt, übertragen“ und behauptet: Johannes sage „ausdrücklich, daß Juden Gefäße zusammen mit Samaritanern nicht gebrauchen“. Doch von „Gefäßen“ ist in unserem Satz nicht die Rede, schon gar nicht „ausdrücklich“. Und daß die Frau ein Wassergefäß mitbringt, ist explizit in der Erzählung bis dahin noch gar nicht erwähnt.
Von daher erscheint Thyen die Übersetzung von Wilckens <341> am angemessensten: „Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritanern“:
Und klärender als Daubes historistischer Erklärungsversuch erscheint uns darum Bultmanns <342> eher ,strukturalistischer‘ Verweis auf die buddhistische Erzählung von Anandas Begegnung mit dem Mädchen aus der Candala-Kaste am Brunnen. „Als sie ihn warnt, sich mit ihr zu verunreinigen, erwidert er: ,Meine Schwester, ich frage dich nicht nach deiner Kaste noch nach deiner Familie; ich bitte dich nur um Wasser, wenn du es mir geben kannst‘“.
Während Wengst die Verweigerung des Wassers für Jesus durch die Samaritanerin einfach übergeht und Thyen die Frau dafür hart verurteilt, ordnet Ton Veerkamp <343> diesen Umstand in den politisch-religiösen Konflikt ein, der hier im Schwange ist:
Dass er, der Judäer, eine Frage an sie, die Samaritanische, richtet, ist schon ein Wunder. Männer, erst recht Männer mit der Würde und Autorität eines Rabbis, reden nicht mit Frauen, erst recht nicht mit einer Frau aus dem Bastardvolk von Samaria. Die Frau fühlt sich alles andere als geehrt durch die Bitte. In schroffem Gegensatz zu den altorientalischen Gepflogenheiten, die Rebekka verkörperte, weist sie ihn ab: „Wie kommst du, Judäer, dazu, mich, eine samaritanische Frau, um etwas zu trinken zu bitten? Judäer verkehren nicht mit Samaritanern“, sagt die Frau. Unter diesen Umständen kann sie nicht Rebekka, Mutter Israels, und nicht Rahel, Geliebte Israels sein. Jesus kann aus dem gleichen Grund der „herrschenden Zustände“ nicht der Messias Israels sein. Die Situation ist im wahrsten Sinne des Wortes unmöglich, weil es unmöglich ist, dass Jesus als Judäer in der Samaritanischen eine Tochter Jakobs, eine Tochter Israels, sehen kann. Erst recht ist es unmöglich, dass die Frau aus Samaria von einem Judäer glauben könnte, er sehe in ihr eine Tochter Israels. Er kann für sie nur der Herr im übelsten Sinne des Wortes sein, der sich von einer Samaritanischen als Sklavin bedienen lassen will. Nicht einmal die geheiligte orientalische Gastfreundschaft ist unter „bosnischen“ Verhältnissen möglich.
Indem Veerkamp an dieser Stelle von „bosnischen“ Verhältnissen redet, spielt er auf den Bosnienkrieg der Jahre 1992-1995 an und versucht verständlich zu machen, dass Johannes in seiner Erzählung nicht das individuelle Verhalten einer samaritanischen Frau moralisch bloßstellt, sondern die Folgen einer Jahrhunderte lang andauernden Feindschaft nachzeichnet, die mit verletzender Erniedrigung gerade auch zwischen Männern und Frauen verschiedener Volks- und Religionszugehörigkeit einhergeht:
Nur der Messias könnte die Situation „Judäer verkehren nicht mit Samaritanern“, diese mörderische politische Lage, aufheben: Das ist der Inhalt der Erzählung. Ort und Uhrzeit machen die samaritanische Frau, die Frau am Brunnen – das setting ruft die Assoziation auf –, zu Rebekka, der Mutter Israels, und zu Rahel, der Mutter Josephs, also Ephraims, also Samarias! Beide Namen, Jakob und Joseph, tauchen hier nicht zufällig oder beiläufig auf. Sie sind wesentlich! Alles hängt also davon ab, dass diese zwei, Jesus Messias und die samaritanische Frau, einen neuen Anfang für ganz Israel, Judäa und Samaria, bewirken. Johannes verknüpft die aktuelle politische Lage mit der Erzählung, in der Israel, der Sohn Rebekkas und Isaaks, der Geliebte Rahels, zum Erstgeborenen und den Völkern zum Volk aller zwölf „Söhne Jakobs/Israels“ wurde; Israel war nicht nur Juda. Ohne diese Verknüpfung wird die Erzählung unverständlich. Mit dieser Verknüpfung erweist sie sich als ein grundlegendes politisches Paradigma.
↑ Johannes 4,10: Jesus bietet der Frau lebendiges Wasser als Gabe Gottes an
4,10 Jesus antwortete und sprach zu ihr:
Wenn du erkenntest die Gabe Gottes
und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!,
du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.
Nachdem die Frau auf den Konflikt zwischen Samaritanern und Judäern aufmerksam gemacht hat, kontert Jesus, indem er verschlüsselt auf seine eigene Rolle als der Messias Israels hinweist. Dazu schreibt Ton Veerkamp <344> lapidar:
Sie wisse gar nicht, mit wem sie es zu tun habe, sagt Jesus, sie ahne nichts von der Gabe Gottes, vom „lebenden Wasser“, nicht sollte sie ihm, er vielmehr ihr zu trinken geben.
Klaus Wengst (W137) sieht die „Gabe Gottes“
ganz eng mit dem hier Sprechenden verbunden. Mit der Wendung „wer es ist, der dir sagt“ wird eine Frage formuliert, die den ganzen Zusammenhang bis V. 42 bestimmt und zusammenhält. Eine Antwort ist schon gegeben worden: Er ist Jude. Das ist eine zutreffende Antwort, die keinen Augenblick vergessen werden darf. Aber damit ist noch nicht alles über Jesus gesagt. Das zeigt schon die Platzierung der Frage an dieser Stelle, nachdem die Frau Jesus bereits als Juden angesprochen hat.
Das heißt, wer über die „Identität dieses Juden“ Bescheid weiß, der kennt zugleich die „Gabe Gottes“:
Das hieße, dass sich Gott in Jesus präsent macht, sich in ihm präsentiert und schenkt. Das führt der Text in dem durch den Ort der Erzählung und die vorangehende Bitte Jesu vorgegebenen Bildbereich aus. Die von Jesus verheißene Gabe, in der sich Gott selbst schenkt, wird als „lebendiges Wasser“ bezeichnet. In Jer 2,13 gilt Gott selbst als „Quelle lebendigen Wassers“ im Gegensatz zu „brüchigen Zisternen, die das Wasser nicht halten“. Wer sich an Gott hält und nicht an Götzen, hat Leben. Mit der Gabe „lebendigen Wassers“ wird die Gabe wirklichen Lebens assoziiert – und das verspricht Jesus hier zu geben.
Was Wengst mit der „Gabe wirklichen Lebens“ meint, bleibt an dieser Stelle offen. Der Bezug auf den Propheten Jeremia würde einen Zugang zur Konkretisierung ermöglichen, denn im dort folgenden Vers 2,14 heißt es: „Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geboren?“ Der ganze Zusammenhang des 2. Jeremia-Kapitels macht deutlich, dass die Gabe Gottes als der Leben schenkenden Quelle mit der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägyptens (2,6) und dem Recht der „Armen und Unschuldigen“ (2,34) zu tun hat, die das Volk Israel immer wieder aufs Spiel setzt, indem es sich aus der Bindung an den befreienden NAMEN löst und mit falschen Göttern Hurerei treibt (2,20), die Ausbeutung und Unterdrückung legitimieren.
Nach Hartwig Thyen (T248) ist es im Blick auf Vers 10 „zwar richtig, daß Jesus mit dieser Antwort alles Gewicht auf seine eigene Person verlagert. Doch deren Erkenntnis ist für die Samaritanerin einstweilen noch unerschwinglich und in weiter Ferne.“ Jedenfalls kann man Jesus kaum an „seiner ‚äußeren Erscheinung‘“ als den erkennen, der er „‚tatsächlich ist‘. Denn der Prologsatz, ho logos sarx egeneto {das Wort ward Fleisch}, setzt voraus, daß der Sohn Gottes umgekehrt ‚tatsächlich‘ gerade kein anderer als dieser durstige Wanderer ist.“ Ein näher liegendes Missverständnis legt Johannes Thyen zufolge „in dem absichtsvoll doppeldeutigen“ Ausdruck hydōr zōn an, der „einerseits sprudelndes Quellwasser und auf der Symbolebene andererseits ,lebendigmachendes Wasser‘ bezeichnen kann.“
Die nun folgenden Ausführungen Thyens lassen erkennen, dass er die Überwindung der inner-israelitischen Verfeindung zwischen Samaria und Judäa in keinster Weise als ein Ziel ansieht, das der johanneische Jesus anstreben könnte (T248f.):
Auf die Äußerung der Frau, die tief in der notorischen Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern begründet ist, geht Jesus überhaupt nicht ein. Seine Reise durch Samarien, sein Aufenthalt an diesem Brunnen und seine an die Samaritanerin gerichtete Bitte um Wasser mögen ihr deutlich genug sagen, daß ihr hier einer gegenübertritt, der jenseits dieser Querelen steht. Darum transponiert Jesus das Gespäch auch sogleich aus dem Feld irdischer Feindschaften auf die Ebene der Relation Gottes zu den Menschen und der Menschen zu Gott, indem er zunächst von der „Gabe Gottes“ (dōrea tou theou) und dem „Leben spendenden Wasser“ und dann von dem „wahren Gottesdienst“ der Menschen redet, einer Gottesverehrung, die diesen göttlichen Gaben entspricht (V. 20-23).
Meint Thyen also tatsächlich, dass der biblische Gott ein Lebenswasser anbietet, das jenseits irdischer Querelen auf einer spirituell-religiösen Ebene zu genießen wäre? Missversteht er mit einer solchen Sichtweise nicht vollständig die gesamte biblische Erzählung vom Gott Israels, der mit seinem einzigartigen NAMEN für die Befreiung und das Recht Israels steht und die Versöhnung von Ephraim und Juda verheißt? Nein, Jesus bietet hier kein jenseitiges, über irdische Feindseligkeiten erhabenes, vergeistigtes Lebenswasser an, sondern vielmehr das Wasser eines Lebens, das sich in seiner versöhnenden Kraft sogleich innerhalb dieses Gespräches als wirksam erweisen wird.
In Thyens (T249) Abwehr von jeder „fruchtlosen Textarchäologie“, im Rahmen derer verschiedene Exegeten auf Grund von „vermeintlichen ‚Brüchen‘ und ‚Spannungen‘ in der Erzählung“ nach unterschiedlichen Quellen fahnden, die hier unzureichend zusammengestückelt worden seien, ist ihm natürlich Recht zu geben.
Schließlich macht Thyen darauf aufmerksam, dass das Stichwort dōrea, „Gabe“, bei Johannes nur an dieser Stelle erscheint. Als Gabe Gottes wird „sie mit dem identifiziert, der soeben gesagt hatte: dos moi piein {gib mir zu trinken}.“ Im Hintergrund dieser „Gabe“ könnte Thyen zufolge nur „der aufmerksame Leser“ das Wort edōken, „gab“, aus Johannes 3,16 wiedererkennen, mit dem „der zentrale verbale Satz des vorausgegangenen Nikodemusgesprächs“ die (Hin-)Gabe des Sohnes durch Gott bezeichnet hatte. Der Samaritanerin dagegen „müssen Jesu Worte … einstweilen noch rätselhaft bleiben.“
↑ Johannes 4,11-12: Jesus in Konkurrenz zu Jakob – woher hat er lebendiges Wasser?
4,11 Spricht zu ihm die Frau:
Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest,
und der Brunnen ist tief;
woher hast du denn lebendiges Wasser?
4,12 Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob,
der uns diesen Brunnen gegeben hat?
Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh.
Zu Vers 11 wehrt Klaus Wengst (W249f.) die Annahme ab, die Frau habe „Jesus missverstanden“ und sie „denke nur vordergründig an das Wasser im Brunnen, begreife aber nicht die metaphorische Dimension des Redens Jesu.“ Er selbst meint,
dass die Frau sehr wohl versteht. Sie hat durchaus den hohen Anspruch in Jesu Worten vernommen. Den konfrontiert sie mit der Situation, in der sie Jesus vorgefunden hat: ein erschöpfter Wanderer, der nicht in der Lage ist, sich auf der elementarsten Ebene selbst zu helfen: „Herr, du hast nicht einmal einen Schöpfeimer und der Brunnen ist tief.“
Der weitere Fortgang ihrer Rede zeigt dann sehr deutlich, dass die Frau „angemessen weiter zu fragen“ versteht. Denn sie fragt
Jesus anschließend eben nicht, wie er denn nun das Brunnenwasser schöpfen wolle. Ihre Frage lautet vielmehr: „Woher also hast du das lebendige Wasser“ – von dem du gesprochen hast und das mehr und etwas anderes sein will als das Wasser aus diesem Brunnen? Sie stellt damit keine dumme, sondern die richtige Frage. Nach der Verbindung, die Jesus zwischen sich, der Gabe Gottes und dem lebendigen Wasser hergestellt hat, ist das zugleich die Frage nach dem Woher Jesu, um die es im Evangelium immer wieder geht.
Und sie stellt auch noch eine zweite Frage, mit der sie
bestätigt, dass sie aus Jesu Rede einen hohen Anspruch herausgehört hat. Den konfrontiert sie jetzt mit dem Stammvater, dessen Name mit diesem Ort verbunden ist: „Bist du etwa größer als unser Vater Jakob?“ Diese Frage ist aus ihrer Sicht selbstverständlich zu verneinen und sie kann das auch begründen. Immerhin hat Jakob „uns den Brunnen gegeben. Sowohl er selbst hat aus ihm getrunken als auch seine Söhne und seine Herdentiere“, während Jesus erschöpft dasitzt und nichts dergleichen vermag.
Hartwig Thyen zufolge (T249) bleibt es dagegen zunächst „der Frau noch verschlossen“, dass Jesus „symbolisch von einem ganz anderen Wasser geredet hat, das ewiges Leben zu verleihen vermag“. Indem sie sich im „Besitz ihres ,Schöpfgefäßes‘ … dem Fremdling überlegen“ fühlt, „fragt sie ihn, wie er angesichts der Tiefe des Brunnens ohne eine entsprechende Ausrüstung an dessen lebendiges Wasser gelangen will“. Dabei ist, wie er in der Auslegung von Johannes 4,6a erläutert hatte, vorausgesetzt, dass „der heilige Jakobsbrunnen eine ,gefaßte Quelle‘ ist, so daß an seinem Grunde hydōr zōn, lebendiges Wasser sprudelt.“
Zur zweiten Frage der Frau hält es Thyen für möglich (T250), dass sie
die mit dem Namen Jakobs verbundene ,Brunnenlegende‘ voraus[setzt], nach der Jakob keines Schöpfgefäßes bedurfte, weil der ihn auf seiner Reise seit Haran begleitende Brunnen in seiner Gegenwart und seiner Gerechtigkeit wegen stets überquoll, so daß er, seine Söhne und seine Herden ohne Mühe davon trinken konnten… Die nachdrückliche Betonung, daß nicht nur Jakob selbst, sondern auch seine Söhne und seine Herden aus diesem Brunnen getrunken haben, läßt an Labans Brunnen vor den Toren Harans denken, an die Begegnung des vor Esau fliehenden Patriarchen mit Rachel und an sein Hirtendasein im Dienste Labans.
Weiter erinnert Thyen an die „Targumim zu Num 21,19“, die „den Ortsnamen matthanah übereinstimmend als Gottes Gabe“ deuten, indem sie Mattanah etymologisch von nathan {geben} ableiten“:
Wenn er Jesus sagen läßt: „Wenn du doch die Gabe Gottes erkenntest“, dürfte der Erzähler mit dieser Überlieferung spielen. So mag er auf der vordergründigen Ebene an den wunderbaren Brunnen, den Gott seinem Volk einst ,gab‘ (Num 21,16), erinnern. Aber Jesus hatte ja mehr als das gesagt: Er hatte sich selbst mit dieser ‚Gabe Gottes‘ identifiziert. War er es also, der sein Volk Israel auf allen seinen Wegen als der wasserspendende Brunnen begleitet hat? Darf man den Satz, der von Mose sagt: peri gar emou ekeinos egrapsen {denn von mir hat jener geschrieben} (5,46; s.u. z. St., sowie zu 7,37-39 und 19,34) so verstehen, daß Mose in all den Brunnengeschichten und zumal in Num 21,15ff von Jesus als dem ,lebendigen Wasser‘ geschrieben hat? Und muß nicht in Analogie zu Jesu Wort über das Manna: amēn amēn legō hymin: ou Mōysēs dedōken hymin ton arton ek tou ouranou; all‘ ho patēr mou didōsin hymin ton arton ek tou ouranou ton alēthinon {Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel} (6,32), auch von diesem Brunnen gelten: Nicht Jakob gab euch lebendiges Wasser, sondern mein Vater gibt euch den wahren Quell des Lebenswassers?
In der Tat sind solche Deutungen nicht zu weit hergeholt. Die Frage ist nur, was damit ausgesagt werden soll. Wenn das Wort Gottes im „Fleisch“ des Menschen Jesus geschieht, dann kann dieser Mensch oder vielleicht auch eine ihm entsprechende himmlische Gestalt nicht bereits lange vor seiner Geburt in den alten Geschichten der Bibel sozusagen herumgegeistert haben, um es einmal salopp auszudrücken. Es geht vielmehr umgekehrt darum, das Wirken Jesu ganz und gar von der befreienden und Recht schaffenden Macht des heiligen NAMENS Gottes her zu begreifen. Was Jesus verkörpert, ist genau der NAME, der sein Volk bereits als die „Quelle lebendigen Wassers“ (Jeremia 2,13) begleitet hat, und dieser NAME ist es letzten Endes auch, der mit dem „wunderbaren Brunnen“ der Targumim bezeichnet wird.
Ton Veerkamp <345> sieht in den Versen 11 und 12 die Fortsetzung eines hitzigen Streitgesprächs auf Grund weitreichender politisch-religiöser Differenzen. In seinen Augen ist die samaritanische Frau
keineswegs beeindruckt, die politische Lage trennt sie. Sie nennt ihn zwar „Herr“, macht ihn zugleich lächerlich: Er habe nicht einmal einen Schöpfeimer, und da wolle er ihr zu trinken geben, ihr, einer Tochter Jakobs, der Israel als neuen Namen erhielt? Hatte er nicht selber ihnen, den Samaritanern, den Brunnen gegeben und so ihr Volk und ihr Vieh am Leben erhalten? Woher solle ausgerechnet er „lebendes Wasser“ holen, der Judäer, der außer der Tora noch vieles anderes gelten lässt? Die Leute aus Samaria kennen nur die Tora Moses, das allein ist genug. Sie ist stolz und unbeugbar, sie ist Kind der Tora, etwas anderes brauche sie nicht, was solle sie mit „lebendem Wasser“ ausgerechnet aus judäischer Hand anfangen?
↑ Johannes 4,13-14: Eine Wasserquelle, die „aufspringt zum Leben der kommenden Weltzeit“
4,13 Jesus antwortete und sprach zu ihr:
Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten;
4,14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden,
das in das ewige Leben quillt.
[16. Mai 2022] Nach Klaus Wengst (W138) nimmt Jesus in den Versen 13 und 14 zunächst auf, was „die Frau für unmöglich hält, dass Jesus größer sei als Jakob“, und zwar mit einer „Selbstverständlichkeit, die das, was Jakob getan hat, relativieren soll“. Indem Jesus sagt: „Alle, die von diesem Wasser trinken, werden wieder Durst bekommen“,
kommt ein anderes Wasser in den Blick, das den „Durst“, den Lebensdurst, wirklich löscht. So heißt es weiter: „Diejenigen jedoch, die von dem Wasser trinken, das ich ihnen gebe, werden nie mehr Durst bekommen.“ Hier wird Stillung des Lebensdurstes verheißen – nicht durch Übersättigung und Saturiertheit, sondern durch wirkliches Leben. Die unersättliche Gier nach Leben, die nie genug bekommen kann, soll ein Ende haben. Es soll Schluss sein mit den ständigen Lebensenttäuschungen, die es nicht zulassen, dass wirkliches Leben sich vollzieht.
Das klingt nach einer guten Predigtanregung für eine christliche Gottesdienstfeier unserer Zeit. Aber hat schon der johanneische Jesus solche Gedankengänge im Sinn? Lechzt er nicht eher nach der Stillung seines Durstes nach GOTT (vgl. Johannes 19,28) in dem Sinne, dass endlich das Leben der kommenden Weltzeit anbricht, in dem niemand verdursten und verhungern muss, niemand unterdrückt, ausgebeutet, Opfer von Gewalt wird? Tatsächlich wird Wengst selber ein wenig später auch auf eine solche Dimension unseres Textes eingehen.
In der zweiten Hälfte von Vers 14 werden Wengst zufolge (W138f.)
Bild und Sache … noch darüber hinaus geführt, indem es von den Empfängern dieses Wassers heißt, dass sie selbst zur Quelle werden, die ihrerseits Wasser hervorsprudeln lässt, das gültiges, bleibendes Leben hervorruft: „Das Wasser, das ich ihnen gebe“, wird in ihnen zu einer Quelle von Wasser, das fürs ewige Leben sprudelt.“ Als Quelle solchen Wassers wird ein Mensch zum Lebensanstifter für andere. Die weitere Erzählung zeigt, dass die samaritische Frau genau diese Rolle übernehmen wird. Auch diese Beobachtung spricht entschieden dagegen, in ihr diejenige zu sehen, die töricht missversteht.
In diesem Zusammenhang betont Wengst (W139) „die Dimension der Gemeinde“:
Das hier gebrauchte Bild kann gar nicht isoliert auf den Einzelnen bezogen gedacht werden. Eine Quelle ist ganz von selbst nicht nur für sich selbst da. Es kommen von diesem Bild her sofort andere in den Blick, mit denen zusammen Leben gewonnen wird. … Das wird noch deutlicher, wenn hier eine Einspielung aus Jes 58,11 erkannt ist. Dort wird dem Volk verheißen, „wie eine Wasserquelle“ zu sein, „deren Wasser nicht trügt“. Und diese Verheißung gilt für eine Gemeinschaft befreiter und solidarischer Menschen: „Wenn du aus deiner Mitte Unterjochung entfernst, Fingerzeigen und üble Nachrede, den Hungrigen den Bedarf deiner Kehle zubilligst, die darbende Kehle sättigst“ (Jes 58,9f.).
Für den Aufweis dieser Zusammenhänge bin ich Wengst dankbar. Fragen möchte ich lediglich, ob seine auf die christliche Gemeinde gerichtete Perspektive nicht außer Acht lässt, dass Johannes noch zu allererst die Sammlung ganz Israels und die Überwindung des weltweiten Systems der römischen Unterdrückungsordnung anstrebt.
Ton Veerkamp <346> besteht darauf, die Antwort Jesu auf die stolze Frage der Samaritanerin strikt im Zusammenhang mit der Erwartung der kommenden Weltzeit auszulegen, die in den Augen des Johannes auf dem Wege eines realen politischen Prozesses zu erreichen ist, der durch das Vertrauen auf den Messias Jesus angestoßen wird:
Wer von diesem, deinem Wasser trinke, sagt Jesus, werde wieder durstig; ihr Beharren auf der Tradition löse das mörderische Problem nicht. In Kapernaum wird er den Judäern ähnliches sagen: „Eure Väter aßen das Manna in der Wüste, sie starben dennoch“, Johannes 6,49. Beide Erzählungen sind an dieser Stelle strikt parallel; Jesus hat ganz Israel, Judäa wie Samaria, nur eines zu sagen: das Neue, das er ankündigt und ist, schafft eine Lage, dass Dinge, die nur noch mit Fäusten und Schwertern entschieden wurden, jetzt wieder besprochen werden können. Hier sind wir Augenzeugen des politischen Prozesses, den Jesus in Gang setzen will, die Vereinigung Israels. Wenn Israel das Wasser trinkt, das der Messias ihm geben wird, das der Messias ist, werde es bis zur kommenden Weltzeit nicht mehr dürsten, das heißt nicht länger in einer ausweglosen politischen Lage verharren. So werden die Menschen in der kommenden Weltzeit für sich eine reale Perspektive sehen, und das werde ihnen eine Kraft geben, durchzuhalten bis in jene neue Weltepoche, in der alle Probleme definitiv gelöst sein würden.
Derartige politische Perspektiven kommen Wengst nicht in den Sinn. Er macht (W139) auf Parallelen zum Bild vom Wassertrinken in „der rabbinischen Tradition“ aufmerksam, in denen das Wasser mit der Lehre der Weisen verglichen wird: „Ganz nah bei dem Bild von Joh 4,14b ist es, wenn Rabban Jochanan ben Sakkaj seinen Schüler Elasar ben Arach als ‚eine Quelle, die sich verstärkt‘, charakterisiert“, <347> was in den Aboth des Rabbi Nathan weiter ausgeführt wird:
Danach „nannte er ihn strömenden Bach und Quelle, die sich verstärkt, denn ihre Wasser verstärken sich und treten nach außen heraus, um auszuführen, was gesagt ist (Spr 5,16): Überfließen mögen deine Quellen nach draußen und auf die Gassen die Wassergräben.“
Hartwig Thyen setzt in der Auslegung von Vers 13 und 14 andere Akzente. Nachdem die Samaritanerin gefragt hatte, ob Jesus größer sei als Jakob, macht (T250) die „Art der Antwort deutlich, daß Jesus in der Tat beansprucht, nicht nur ‚größer‘ als Jakob, sondern mit dem Patriarchen schlechthin unvergleichbar zu sein.“ Er zitiert Jerome Neyrey, <348> demzufolge die Antwort Jesu geltend macht,
„dass er nicht nur ein neuer Jakob ist oder sogar dass Jakob ein Typus von Christus war. Es wird eine radikalere Behauptung aufgestellt: Jesus verdrängt/ ersetzt Jakob. Die Frage der Frau in 4,12 scheint ein Wortspiel zu enthalten, das darauf hindeutet, dass Jesus Jakob, den Verdränger, verdrängt und damit Jakob das antut, was er Esau angetan hat.“
Dass Johannes nicht wie die Offenbarung des Johannes (7,17; 21,6) oder Jeremia 2,13 vom „Wasser des Lebens“ spricht, sondern „die Wendung hydōr zōn {lebendiges Wasser}“ verwendet, die „im gesamten NT nur in unserer Szene und Joh 7,37-39 begegnet“, hängt Thyen zufolge (T250f.)
einerseits mit dem Jakobsbrunnen als Schauplatz unserer Szene zusammen und ist andererseits darin begründet, daß nur dieser ambivalente Ausdruck das Mißverständnis zu provozieren vermag, das sich nicht nur für den Leser, sondern am Ende auch für die mißverstehende Samaritanerin selbst als produktiv erweisen wird. Während die Frau die Qualität des frischen Quellwassers aus dem Jakobsbrunnen im Auge hat, redet Jesus von einem ganz andersartigen ,Wasser‘ und von einer Quelle, die dem Jakobsbrunnen unendlich überlegen ist. Wie sich Gott selbst die pēgē hydatos zōēs {Quelle des Wassers des Lebens} nennt und sein Volk anklagt, daß es ihn verlassen hat (Jer 2,13), so erscheint Jesus hier als die unversiegliche Quelle des Lebenswassers (V. 10).
Thyen scheint allerdings zu übersehen, dass die Überlegenheit der Quelle Jesu gegenüber dem Jakobsbrunnen nicht unter Berufung auf Jeremia 2,13 als eine überweltliche Andersheit dieses Wassers verstanden werden kann. Genau in diesem und dem folgenden Jeremiakapitel ist nämlich davon die Rede, dass Israel mit Ägypten und Assyrien „hurt“, sich also an deren unterdrückende Götter („Baale“) als ihre „Liebhaber“ hängt. Und genau damit verspielt es sein sehr diesseitig verstandenes Leben in Freiheit und Recht. Spannend sind dabei im Zusammenhang mit unserem Kapitel die Verse Jeremia 3,11-14 (nach Luther 2017):
Und der HERR sprach zu mir: Das abtrünnige Israel steht gerechter da als das treulose Juda. Geh hin und rufe diese Worte nach Norden und sprich: Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der HERR, so will ich nicht zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der HERR, und will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld, dass du wider den HERRN, deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen, und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, spricht der HERR. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der HERR, denn ich bin euer Herr! Und ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen nach Zion. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit.
Ich halte es durchaus für möglich, dass es Johannes und seinem ersten Publikum von diesem Text her aufging, warum ausgerechnet die als abtrünnig angesehenen Samaritaner (Israel) aufgeschlossener für den Messias Jesus sind als die mehrheitlich nicht auf Jesus vertrauenden Judäer (Juda). Die Verweise auf den Abfall zu fremden Göttern werden zu Johannes 4,16-18 noch eine Rolle spielen.
Auch in Johannes 4,14 taucht wieder (T251) das Wort didōmi, „geben“, auf, hier in der Form des „Futurum dōsō“, und zwar, wie Thyen sagt, gleich „zweifach und darum gewiß nicht zufällig“. Jesus wird „das Lebenswasser dann geben…, wenn seine ‚Stunde‘ gekommen ist“, also „die Stunde seiner Verherrlichung und Erhöhung an das Kreuz von Golgatha“. Das wird aus der einzigen Stelle deutlich werden, an der die „Wendung vom hydōr zōn {lebendiges Wasser}“, in Johannes 7,37-39 noch einmal aufgenommen wird. Thyen ist es sehr bewusst,
daß die Metapher hydōr zōn die biblische Verheißung aufnimmt, wonach Gott ,in den letzten Tagen‘ seinen lebendigmachenden und von aller Sünde und Unreinheit reinigenden Geist über alles Fleisch ausgießen will: „hoti egō dōsō hydōr en dipsei tois poreuomenois en anydrō, epithēsō to pneuma mou epi to sperma sou ktl. {Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen usw.} (Jes 44,3; vgl. Sach 12,9; 13,1; 14,8; Ez 47; Jes 32,15; Joel 4,18). Wie der auferstandene Jesus nach Joh 2,20f der endzeitliche ,Tempel Gottes‘ ist, so ist er auch die wunderbare Quelle, die am ,Tag JHWHs‘ aus dem Tempel entspringen und deren Wasser das Tote mit Leben erfüllen wird. Daß in diesem Licht auch das Strömen von Blut und Wasser aus der durchbohrten Seite Jesu gelesen sein will, wird unten zu Joh 19,31-37 zu begründen sein.
Was Thyen jedoch wieder ausblendet, das sind die diesseitigen Bezüge der jüdisch-messianischen Verheißungen. Wir wissen ja bereits, dass er bei „den letzten Tagen“ eher an den jenseitigen Himmel denkt als an die irdische Befreiung Israels oder Jakobs, die beispielsweise in den Jesaja-Kapiteln 44 und 45 von dem als Messias, Gesalbten, christos, bezeichneten persischen König Kyros erwartet werden darf.
Den „Gebrauch des Verbums hallomai“ im Zusammenhang mit Wasser findet Thyen
ungewöhnlich, denn es drückt in der Regel das ,Hüpfen‘ und ,Springen‘ von Mensch oder Tier aus und wird u.W. nie für das ,Sprudeln‘ von Wasser gebraucht.
Er erwägt mehrere verschiedene symbolische Deutungen. Eine davon kennen wir bereits von Wengst; Thyen zitiert sie nach Ernst Haenchen, <349> demzufolge die
ganze Wendung … meist so gedeutet [wird], „daß dieses Wasser den Empfänger zu ewigem Leben führt. … Aber eigentlich steht doch da: Dieses Quellwasser wird im Empfänger zu einer Quelle. Das legt eine andere Deutung nahe: Wen Jesus durch seinen Geist zu Gott führt, der wird selbst zur Quelle, zum Heilbringer für andere. Das erfüllt sich tatsächlich bei der Samaritanerin: selbst zum Glauben gekommen, führt sie die Samaritaner zum Glauben“.
Thyen selbst scheint eher John Henry Bernard <350> zuzustimmen, der zu dieser Stelle erklärt hatte: „Aber Wasser ist in diesem Abschnitt ein Symbol für den Geist“. Als die
„metaphorische Verheißung der endzeitlichen Ausgießung des belebenden Gottesgeistes … ist dieses ,Lebenswasser‘ auch das Band, das die beiden Gesprächsgänge Jesu mit der Samaritanerin fest miteinander verknüpft. Denn auch die in V. 21ff verheißene Anbetung Gottes „im Geist und in der Wahrheit“ durch seine ,wahren Anbeter“ (alēthinoi proskynētai) setzt ja die Präsenz des „Geistes der Wahrheit“ (14,17) voraus, dessen „Ausgießung“ erst in der „Stunde Jesu“ geschehen wird. Darum könnte man sagen, daß sich das „Trinken des Lebenswassers“ in eben diesem proskynein vollziehen wird. Doch damit greifen wir bereits allzuweit vor.
Anders geht Ton Veerkamp <351> mit dem scheinbar nicht zum Bild des Wassers passenden Wort hallomai um, das er mit „aufspringen“ oder „tanzen“ wiedergibt. Er wundert sich aber nicht darüber, dass das „Bild vom ‚tanzenden Wasser‘ (hydor hallomenos)“ sowohl (zunächst) für die Frau am Jakobsbrunnen als auch (bis heute) für viele Exegeten „unverständlich“ ist. Im Rahmen seiner politischen Auslegung des Johannesevangeliums erklärt er es auf Grund eines Liedes im Prophetenbuch Jesaja über den Anbruch der kommenden Weltzeit von Freiheit, Recht und Frieden:
Jesus bezieht sich auf das Lied jeßußum midbar, „Jauchzen soll die Wüste“, Jesaja 35. Alle entscheidenden Wörter in Johannes 4,13ff. kommen auch in jenem Lied vor. Darin heißt es:
Dann werden die Augen der Blinden geöffnet,
geöffnet die Ohren der Tauben.
Dann wird wie ein Hirsch der Humpelnde tanzen (jedaleg, haleitai),
jubeln die Zunge der Stummen.
Denn es brechen hervor in der Wüste die Wasser (majim, hydata),
und die Flüsse in der Steppe.
Die glühende Öde wird zum Wasserpfuhl,
das Durstige (zimmaˀon, gē dipsōsa) zu Quellen des Wassers (le-mabuˀe majim, pēgē hydatos).
Allerdings kommt Veerkamp sogleich auch auf die Skepsis zu sprechen, mit der diesen Hoffnungen bereits im Evangelium selbst begegnet wird:
Weder die Frau am Brunnen Jakobs noch die Schüler und die Judäer konnten einsehen, dass das, was Jesaja ausspricht, eine reale Perspektive in der römischen Zeit sein könnte.
Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Thyen solche Auslegungsmöglichkeiten gar nicht in Erwägung zieht und dass sie bei Wengst nur in Form sozialgeschichtlicher Ergänzungen zu einer christlichen Gemeindetheologie ihren Platz finden.
↑ Johannes 4,15: Die Bitte der Frau um ein Ende des Durstes und Wasserschöpfens
4,15 Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser,
damit mich nicht dürstet
und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen!
Wie bereits erwähnt, ist nach Ton Veerkamp <352> die samaritanische Frau zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs nicht in der Lage, zu verstehen, was Jesus mit dem zum Leben der kommenden Weltzeit aufspringenden Wasser meint. In seinen Augen ist sie in ihrer Antwort nach Vers 15
unschlagbar nüchtern. Für sie wäre wirklich eine neue Epoche gekommen, wenn die Maloche der Frauen, das Schöpfen von Wasser aus einem tiefen Brunnen und das Schleppen des Wassers vom Brunnen ins Dorf, einmal aufhört. Wasser im Überfluss ist ein Traum der messianischen Zeit, es ist der Traum des Paradieses des Korans fast in jeder seiner 114 Suren. Die beiden reden miteinander, aber aneinander vorbei! Beide reden politisch, Jesus von einer politischen Situation jenseits der mörderischen Lage, in der sich das Verhältnis zwischen beiden Völkern befindet, sie geht vom aktuellen Zustand aus.
In ihrer Antwort mischt sich unter ihre Nüchternheit sofort die Bitterkeit: Ausgerechnet der Judäer will angeblich nicht nur mich von meiner täglichen Mühsal, sondern auch unser Volk aus seiner aussichtslosen Lage befreien!
Damit könnte das Gespräch des Judäers mit der Samaritanerin an einem toten Punkt angelangt sein, denn
die Frau kann nur an das denken, was sie tagtäglich machen muss, Wasser schleppen. Für sie gilt zunächst und nicht zu Unrecht die Mühsal des täglichen Lebens; sie sieht nicht, dass die Mühsal unter den herrschenden Bedingungen nicht abgeschafft werden kann, wenn die Bedingungen nicht von Grund auf geändert werden. Jesus singt ihr eine Melodie des Liedes jeßußum midbar {Jauchzen soll die Wüste, Jesaja 35} vor; nach solchen Liedern steht ihr Sinn nicht. So kommen die zwei nicht weiter.
Es ist eine spannende Frage, wie Jesus diesen toten Punkt überwinden wird.
Dass Wengst das Gespräch Jesu mit der Frau nicht vor diesem politischen Horizont auslegt, haben wir bereits gesehen; allerdings will auch er (W139) „die Frau nicht für dumm erklären, als meine sie, Jesus habe ihr ein Wunderwasser angeboten, das – wenn es einmal im Krug ist – diesen nie mehr leer werden lasse.“ So wurde, wie er in seiner Anm. 179 sagt, „durchgängig interpretiert“, bis Luise Schottroff mit „dieser Tradition … zu Recht gebrochen“ hat (vgl. meine Anm. 333). Daher liest er den Text
so, dass sie versteht und sich sagt: „Ja, das wär‘s! Den Durst stillen. Den Lebensdurst wirklich stillen. Schluss mit den ständigen Lebensenttäuschungen. Schluss mit dieser harten Arbeitsfron, die nur gerade das Überleben rettet. Wirklich leben können. Ein eigener Mensch sein. Selbst Quelle werden, die andere zum Leben anstiftet. Mit ihnen zusammen ein Leben haben, das diesen Namen verdient. Ja, das wär‘s!“ Und so nimmt sie Jesus beim Wort und bittet ihn um dieses Wasser. Sie tut damit genau das, wozu er sie indirekt aufgefordert hat. Sie will Wasser, das den Lebensdurst stillt. Dazu gehört offenbar, dass sie aus ihrem bisherigen, sie isolierenden Lebenszusammenhang herauskommt. Deshalb will sie nicht mehr um die Mittagszeit zur Jakobsquelle gehen müssen. So lässt sie dann ja auch ihren Krug zurück.
Auf diese Weise bleibt Wengst konsequent bei seinem sozialgeschichtlichen Deutungsansatz, indem er die Samaritanerin zwar nicht wie Veerkamp als Repräsentantin des samaritanischen Volkes in seiner Identität mit den vormaligen zehn Stämmen Nordisraels, sondern als eine individuell unter ihrer sozialen Isolation leidende Frau betrachtet, die sich von Jesus die Überwindung ihrer persönlichen Lebensenttäuschungen und Identitätsprobleme erhofft.
Hartwig Thyen (T252) will sich nicht ganz von der Auffassung lösen, dass in der Bitte der Samaritanerin doch ein Missverständnis enthalten ist. Indem er Ludger Schenke <353> zitiert, wird noch einmal deutlich, dass er anders als Veerkamp und wohl auch Wengst von einem grundsätzlichen Unterschied des offenbar als übernatürlich zu begreifenden Wassers Jesu gegenüber „dem natürlichen Wasser“ ausgeht. So schreibt Schenke zur Äußerung der Frau in Vers 15:
„Von einem Mißverständnis kann keine Rede sein. Sie folgt genau der Spur Jesu. Er hat sie in 4,10 doch aufgefordert, diese Bitte auszusprechen, und in 4,13f hat er den Vorteil seines Wassers gegenüber dem natürlichen Wasser hervorgehoben, dessen sich die Frau nun versichern will. Ihre Bitte ist darum den Worten Jesu vollkommen gemäß, und der Leser versteht, daß jetzt folgen muß, was Jesus in 4,10 in Aussicht gestellt hat: und er wird dir lebendiges Wasser geben. Unter diesem Vorzeichen ist der folgende Gesprächsgang zu lesen“.
Dazu meint Thyen:
Man möchte dem zustimmen und ihm doch zugleich widersprechen. Denn die Ironie besteht doch darin, daß die Frau einstweilen weder weiß, was sie da erbittet, noch, von wem sie es erbittet… Und so problemlos, wie L. Schenke voraussetzt, scheint uns die dualistische Rede von irdischem und himmlischem Wasser auch wohl nicht zu funktionieren. Der Leser weiß ja um die immer noch unerfüllte Bitte des durstenden Jesus: „Gib mir zu trinken!“ Und er weiß, daß die Frau auch in Zukunft immer wieder zum Brunnen gehen und für sich und die Ihren irdisches Wasser schöpfen wird. Darum führen denn auch zahlreiche Ausleger die Bitte der Samaritanerin, obwohl sie „den Worten Jesu vollkommen gemäß“ zu sein scheint, auf eines der für unser Evangelium typischen Mißverständnisse zurück und behandeln unsere Szene als ein Beispiel der ironischen Erzählkunst seines Autors…
Immerhin muss man Thyen zugestehen, dass er „die überlegene Attitüde des impliziten Lesers, in der er die unverständige samaritanische Frau als das Opfer der Ironie Jesu wähnt“, als „allzu voreilig und unbesonnen“ beurteilt, <354> da „die Fleischwerdung des logos die dualistische Antithese von Irdischem und Himmlischem ein für alle Male durchkreuzt hat“. In seinem Augen wird zum einen erst später (Johannes 7,37ff.) klar werden, „daß das ,wunderbare Wasser‘, das Jesus geben wird, der lebendigmachende Gottesgeist ist“, und „zum anderen wird auf der Erzählebene dieser Geist erst in dem Augenblick ‚gegeben‘ werden, da der Gekreuzigte mit dem Ausruf: dipsō {Mich dürstet} seine frühere Bitte dos moi pein {Gib mir zu trinken} sterbend wiederholt“. Wenn überhaupt von Ironie die Rede sein soll, dann wird diese in Thyens Augen (T253) „verschlungen … von dem Paradox, daß der getötete Leib Jesu zur Quelle des verheißenen hydōr zōn {lebendigen Wassers} und damit der Tod zum Ursprung des Lebens wird (19,28ff).
↑ Johannes 4,16-18: Der Mann der Samaritanerin, der kein Mann ist, sondern ein Baˁal
4,16 Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her!
4,17 Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann.
Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt: „Ich habe keinen Mann.“
4,18 Denn fünf Männer hast du gehabt,
und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann;
das hast du recht gesagt.
[17. Mai 2022] Die Verse 16 bis 18 kann man als Schlüsselverse des 4. Kapitels im Johannesevangelium begreifen, denn an ihrem Verständnis scheiden sich die Geister im Blick auf die Beurteilung dieser Frau am Jakobsbrunnen. Unsere drei Exegeten Thyen, Wengst und Veerkamp sind allerdings in zwei Gesichtspunkten einig, nämlich erstens darin, dass der Gesprächsverlauf nach wie vor als folgerichtig aufeinander aufbauend betrachtet werden darf, und zweitens in der Einschätzung, dass es hier nicht um die „Aufdeckung ihres schon seit langer Zeit von Leichtsinn und ungebändigter Sinnlichkeit zeugenden, jetzt aber auch nach gesetzlichem Maßstab unsittlichen Lebens“ geht, wie viele ältere Kommentatoren Wengst zufolge meinten. <355>
Im einzelnen sieht Klaus Wengst (W140) in Jesu Aufforderung an die Frau: „Geh, ruf deinen Mann und komm hierher!“ genau den „Beginn dessen, dass Jesus ihrer Bitte entspricht und ihr ‚das lebendige Wasser‘ gibt“. Es geht also nicht um „die Einleitung zu einer bloßen Selbstdarstellung Jesu“, als ob Jesus seine hellseherischen Fähigkeiten unter Beweis stellen wollte. Stattdessen „besagt diese Aufforderung, dass der nicht gestillte Lebensdurst der Frau zu tun hat mit den Beziehungen oder Nicht-Beziehungen, in denen sie lebt oder zu leben gezwungen ist.“ In der „sehr kurzen und sehr schlichten Feststellung“ der Frau: „Ich habe keinen Mann“ erkennt Wengst
ein erstes Stück Loslösung aus ihrem bisherigen Lebenszusammenhang. Sie distanziert sich davon, worin sie – wie das Folgende zeigt – faktisch lebt. Die Antwort Jesu bestätigt die Frau, lässt sie aber zugleich erkennen, dass er weiß, was hinter ihrer Aussage steht: „Recht hast du gesprochen: ,Ich habe keinen Mann.‘ Fünf Männer nämlich hattest du. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du treffend gesagt.“
Das heißt: Im Rahmen seiner sozialgeschichtlichen Auslegung der Erzählung von der Samaritanerin meint Wengst also die „schwierige Lebenssituation“ der Frau weiter erschlüsseln zu können (W140f.):
Da der Mann, den sie jetzt hat, ausdrücklich als ihr Nicht-Mann benannt wird, gelten die fünf vorher als Ehemänner. Die hatte sie natürlich nacheinander. Eine solche Folge ist denkbar durch Tod von Ehemännern oder durch Entlassung der Frau aus der Ehe. In jedem Fall ist es für eine Frau, die verheiratet war, erstrebenswert, wieder durch eine Ehe abgesichert zu sein. Dass die Chancen dafür nach mehreren Ehen – und mit zunehmenden Jahren – sinken, liegt auf der Hand. Die Frau lebt nach den fünf Ehen in einem nicht legalisierten Verhältnis mit einem Mann, der ihr also den Schutz einer Ehe verweigert.
So begrüßenswert es ist, dass Wengst nicht der moralistischen Verurteilung des unsittlichen Lebenswandels der Frau in der älteren Johannes-Exegese folgt, ist doch zu bezweifeln, ob der johanneische Jesus tatsächlich die Frau sozusagen als Paartherapeut dazu bewegen will, eine toxische Beziehung aufzugeben, was sie bereits mit ihrer spontanen Antwort getan hat:
Die von ihr schon vorgenommene Distanzierung von ihm ist durch die aufdeckende Rede Jesu bestärkt worden. Er rückt danach nicht mehr ins Blickfeld. Die Sache mit ihm ist abgetan. Die Distanzierung, wie immer halbherzig sie zunächst von der Frau ausgesprochen worden sein mag, ist nun vollzogen. Weil damit jetzt gilt, was sie gesagt hat, dass sie nämlich keinen Mann habe, braucht sie auch die Aufforderung Jesu, ihn zu holen, nicht auszuführen. Diese Angelegenheit hat sich für sie erledigt.
Wie auch vieles andere, was Wengst interpretierend äußert, mag man auch diese Ausführungen als durchaus sinnvolle Denkanstöße betrachten, die durch einen biblischen Text im Blick auf heutige Problemlagen ausgelöst werden. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass bereits der Evangelist solche Vorstellungen hatte. Dass zu den Einwohnern von Sychar auch der nicht für seine Frau einstehende Lebensgefährte dieser Frau gehören soll, passt auch nicht zu der insgesamt positiven Einstellung der Leute dieser Stadt gegenüber Jesus, wie sie später dargestellt wird.
Wengst meint wiederum (W140, Anm. 181), dass jegliche allegorische oder
wie immer näherhin ausgestaltete symbolische Deutung … vom folgenden Gesprächsgang her eingetragen [ist], wohl dadurch veranlasst, dass man die tatsächlich erzählte Situation im Gespräch Jesu mit der Frau nicht wirklich wahrgenommen und so ein Bedürfnis nach „mehr“ empfunden hat.
Eine Überprüfung zweier Bezugsstellen, die für eine allegorisch/symbolische Auslegung herangezogen werden, ergibt nach Wengst, dass sie sich nicht „ungezwungen mit der Aussage von Joh 4,18 verbinden“ lassen. So siedelte nach 2. Könige 17,24-41
der assyrische König nach der Zerschlagung des Nordreiches Israel in Samarien fünf Völkerschaften an, die ihre je eigenen Götter verehrten. Als daraufhin Israels Gott strafend eingreift, schickte der König einen der exilierten Priester, dass er die in Samarien Angesiedelten „im Recht des Landesgottes unterweise“. Das Ergebnis: „So verehrten diese Völker den Ewigen, dienten aber zugleich ihren Götterbildern“ – und zwar „bis auf diesen Tag“. An der Aufnahme dieses Textes bei Josephus ist auffällig, dass sich die Samariter nach der Unterweisung im Dienste Gottes bekehrten und ihn eifrig verehrten und dem auch in der Folge stets treu geblieben seien. <356>
Wengst meint also offenbar, dass aus den genannten Stellen kein beständiger Abfall der Samaritaner zu fremden Göttern hervorgehe und erst recht nicht die Identität des jetzigen Mannes der Frau, der nicht wirklich ihr Mann ist.
Hartwig Thyen (T253) macht in seiner Auslegung unserer Verse zunächst darauf aufmerksam, dass der nun beginnende
zweite Gesprächsgang (4,16-26) … mit dem vorausgegangenen durch die ironische Wiederaufnahme des Lexems enthade verknüpft [ist]: Hatte die Frau Jesus soeben gebeten, ihr von seinem wunderbaren Wasser zu geben, damit sie in Zukunft nicht wieder „hierher“ (enthade) zum Brunnen gehen müsse, so fordert Jesus sie nun auf, ihren Mann zu rufen und mit ihm „hierher“ (enthade) zu kommen…
Darin sieht Thyen im Gegensatz zu Wengst „im Textzusammenhang“ durchaus einen „Übergang…, der es Jesus ermöglicht, der Frau sein wunderbares Wissen von ihrer Lebensgeschichte zu offenbaren und so ihr Vertrauen zu gewinnen (vgl. 1,42.47-49)“, zugleich aber ist in seinem Augen „Jesu Aufforderung an die Frau, ihren Mann zu holen“, auch nicht
lediglich ein literarischer Trick…, sein göttliches Allwissen an die Frau zu bringen. Der erzählte Jesus muß bei seiner Aufforderung also schon eben den Mann im Auge gehabt haben, von dem die Frau dann erklärt: ouk echō andra {Ich habe keinen Mann}.
Zur Antwort der Frau, sie habe keinen Mann, führt Thyen aus (T253f.):
Diese Auskunft nennt Lindars <357> treffend „a white lie“ {harmlose Lüge, kleine Unwahrheit}. Das mit „Notlüge“ zu übersetzen, wäre sicher schon zu stark, denn, was die Frau sagt, ist vielmehr in dem Sinne ,a white lie‘, wie wir alle ja nicht immer und in jedem Gesprächszusammenhang die ganze Wahrheit sagen. Deshalb sieht Lindars zu Recht auch keinen Anlaß zu der gelegentlich ausgesprochenen Mutmaßung, daß die Frau die Wahrheit über ihr Leben aus Scham verheimliche. Im Gegenteil! Die Frau erweist sich ja als eine äußerst selbstbewußte und -bestimmte Gesprächspartnerin Jesu, dessen wissender Blick auf ihr vergangenes Leben ebenfalls keinerlei moralistische Wertung erkennen läßt. lm Blick auf die Frauenfiguren unseres Evangeliums, nämlich die ,Mutter Jesu‘, die Samaritanerin, die Lazarusschwestern Maria und Martha (Joh 11) und Maria Magdalena (Joh 20), erklärt S. M. Schneiders: <358> „Diese Frauen scheinen weder von Ehemännern oder anderen männlichen Autoritätspersonen abhängig zu sein, noch suchen sie die Erlaubnis für ihre Aktivitäten bei männlichen Amtsträgern. Sie zeigen eine bemerkenswerte Originalität in ihren Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft.“
Darin ist Sandra Schneiders Recht zu geben. Welchen Sinn macht es dann aber, dass Jesus die selbstbewusst auftretende Samaritanerin nach ihrem Ehemann fragt, wenn er weder sie moralisch bloßstellen noch auch einfach nur seine eigenen übersinnlichen Fähigkeiten herausstellen will? Thyen zufolge wird jedenfalls aus
der weiteren – wenn auch wohl fiktionalen – Erzählung (vgl. insbesondere V. 29 u. 39: hoti eipen moi panta ha epoiēsa {der mir alles gesagt hat, was ich getan habe}) … deutlich, daß Jesus hier von dem realen Leben der Samaritanerin redet. Es handelt sich also keinesfalls um eine Allegorie.
Aber wenn die Samaritanerin, wie Veerkamp sicher zu Recht annimmt, für Israels Stamm-Mütter Rebekka und Rahel steht, dann sagt ihr Jesus als Prophet, was sie in ihrer Eigenschaft als Repräsentantin des Volkes Israel-Ephraim-Samaria getan hat, und der von Thyen zitierte und von Johannes mehrfach wiederholte Satz im Munde der Samaritanerin würde die symbolische Deutung sogar bestätigen (vgl. dazu, was Ton Veerkamp im Zusammenhang mit der Auslegung von Johannes 2,11 zum Thema Allegorie zu sagen weiß).
Interessant ist nun, dass Thyen selbst gar nicht einmal ausschließt,
daß hier wiederum zugleich symbolische Obertöne im Spiel sein könnten, so daß die Erzählung zum einen auf ihrer narrativen und zum anderen auf ihrer symbolischen Ebene gelesen sein will…
Auf der narrativen, also erzählerischen Ebene ist das, was Thyen nun auch als „Männergeschichten“ bezeichnet, etwas – da es sich „um ein ‚Gespräch unter vier Augen‘ handelt“ – was „allein die Frau angeht … und … für den Leser im Dunkeln bleiben“ kann und soll. Hier „kommt es allein darauf an, daß die Frau Jesu Worte als die Wahrheit über ihr Leben begreift“, und nicht auf genauere Klärungsversuche,
ob sie die einstigen fünf Männer etwa gleichzeitig „gehabt hat“ oder ob die womöglich einer nach dem anderen gestorben sind, oder ob sie gar die Ehe aufgekündigt und sich geschieden haben, weil diese Frau ihnen unerträglich geworden war. Angesichts des intimen Charakters dieses Gesprächs sollte der Leser seine Neugier bezähmen und sich alles Spekulieren darüber verboten sein lassen.
Diese Herangehensweise an die Erzählebene der Geschichte erscheint mir sogar als vertretbar – weitaus mehr jedenfalls als die Haltung von Wengst, der genau zu wissen meint, um was es hier gegangen ist.
Zugleich nimmt Thyen nun aber doch auch ernst, dass
unser gesamtes Kapitel … an einem samaritanischen Heiligtum spielt und die Frau gewissermaßen als Repräsentantin der Samaritaner auftritt, und … die Szene durchgehend von der Spannung zwischen Juden und Samaritanern sowie zwischen dem Tempelkult in Jerusalem und auf dem Garizim bestimmt ist…
Daher sollte „die signifikante Fünfzahl der einstigen Männer dieser Frau … doch wohl als Signal für den symbolischen Modus der Erzählung“ wahrgenommen werden. Dazu nennt er die oben bereits von Wengst angeführte Erzählung 2. Könige 17,24ff. Darüber hinaus (T255) führt Thyen aber auch mehrere Hosea-Stellen an:
Die Rede von JHWH als dem ,Ehemann‘ (anēr) und von Israel als seiner ,Ehefrau‘ (gynē) hatte Hosea bereits in die religiöse Sprache des Gottesvolkes eingeführt (vgl. Hos 2,4.9.18 LXX… Auf dieser Spur symbolisierten dann die fünf einstigen ,Männer‘ der Samaritanerin zugleich jene heidnischen Götter und ihr gegenwärtiger „Nicht-Mann“ wäre Symbol des in jüdischen Augen mehr oder weniger synkretistischen {religionsvermischenden} JHWH-Kultes der Samaritaner (vgl. Hos 2,4 LXX: hoti autē ou gynē mou, kai egō ouk anēr autēs {sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann!}).
Dazu passt auch, dass „nur Johannes die Wendung, ,einen Freund, einen Vater, eine Frau, einen Bruder oder einen Herrn haben‘ (echein) auf Gott überträgt“ (so z. B. in 1. Johannes 2,23; 5,12; 2. Johannes 9). Und „die folgende Frage der Frau (V. 19f)“ muss man im Rahmen einer solchen Symbolik auch
nicht mehr als plumpes rhetorisches Manöver verstehen, als ihren Versuch, Jesus durch die Einführung eines neuen Themas von ihrer vermeintlich „sündhaften“ Lebensgeschichte abzulenken. Vielmehr ergibt sich so eine erstaunliche Kohärenz der gesamten Szene.
Von diesen Gedankengängen her wirft Thyen den „meisten Exegeten“ vor, „das für den symbolischen Modus konstititive ‚Zugleich‘ von narrativer und symbolischer Ebene“ nicht wahrzunehmen; sie „wissen ihn nicht von dem allegorischen Modus zu unterscheiden. Und weil sie eine allegorische Interpretation der Szene zu Recht verwerfen, trifft dieses Urteil auch deren möglichen Symbolismus.“ Das verdeutlicht Thyen an Barnabas Lindars, <359> der selber folgende Auslegung befürwortet:
„Die Frau muss also als moralisch minderwertig für die Juden dargestellt werden, und insofern ist sie repräsentativ dafür, was sie von allen Samaritern hielten. Das reicht eigentlich aus, um die Zahl fünf zu erklären; aber es wirkt befremdlich und lädt so zu Spekulationen ein. In der Tat ist dies der Trumpf der allegorischen Auslegung (sic!).“
Eine solche in seinen Augen allegorische Bezugnahme auf die in 2. Könige 17,30f. erwähnten sieben Fremdgötter, aus denen Josephus an der oben bereits von Wengst angeführten Stelle fünf macht, lehnt Lindars mit folgender Begründung ab:
„Nach der allegorischen Sichtweise ist die Frau mit den fünf Männern die samaritanische Religion, die mit fünf Formen des Götzendienstes verunreinigt ist; aber man darf nicht zu sehr ins Detail gehen, denn sie hatte ihre Männer nicht gleichzeitig, wie die Andeutung des Synkretismus natürlich nahelegt. Man kann dann argumentieren, dass der nächste Schritt des Argumentationsgangs ganz natürlich aus diesem Hinweis auf die Unreinheit der Religion folgt. … Aber das wird nicht wirklich zutreffen, denn die samaritanische Religion war in neutestamentlicher Zeit nicht ernsthaft synkretistisch und stützte sich fest auf das Gesetz des Mose …; und die bemerkenswerteste Tatsache des ganzen Disputs ist sein Bewusstsein für aktuelle Themen. Ein Stück alter Geschichte durch eine zweifelhafte Anspielung hervorzuholen, ist einfach nicht relevant.“
Dagegen wendet Thyen wiederum ein, dass
es im Kontext von Joh 4 ja nicht darauf an[kommt], ob die Religion der Samaritaner zur Zeit Jesu in der Sicht des Religionshistorikers „seriously syncretistic“ {ernsthaft religionsvermischend} war oder nicht, sondern allein darauf, daß sie jedenfalls in den Augen der Juden eine falsche Gottesverehrung war.
Eine solche „falsche Gottesverehrung“ könnte den Samaritanern nach Barrett <360> möglicherweise auf zwei verschiedene Weisen vorgeworfen worden sein:
„Der eine, der ,nicht ein Ehemann‘ ist, repräsentiert entweder einen falschen Gott (man hat an Simon Magus gedacht) oder die falsche Verehrung des wahren Gottes durch die Samaritaner“.
Thyen zieht nur die letztere Möglichkeit in Erwägung, da es in den folgenden Versen sowohl
um den richtigen Platz“ als auch „um die rechte Weise der Anbetung Gottes geht. Und auf einen, der einen Gott anbetet, den er nicht kennt (V. 22), ist die Metapher von Gott als dem ,Ehemann‘ und der ihn anrufenden Gemeinschaft als seiner ,Ehefrau‘ ja schwerlich anwendbar.
Ein Bericht des Josephus <361> über die Samaritaner, den Wengst (W143) zu Vers 22 erwähnen wird, demzufolge diese sich während des brutalen Kriegszuges von König Antiochus IV. gegen Jerusalem (um 168 v. Chr.) von jeglicher Verwandtschaft mit den Juden losgesagt und in einem Brief an Antiochus darum gebeten hätten, ihren Tempel auf dem Berg Garizim, „der noch auf den Namen keines Gottes geweiht ist, dem hellenischen Zeus zu ehren benennen zu dürfen“, zeigt allerdings, dass noch lange nach der Assyrerzeit Vorwürfe gegen die Samaritaner im Schwange waren, die mit einem anonymen Gott, den sie durch Zeus zu ersetzen suchen, zu tun haben. Und in dem erwähnten Brief betonen die Samaritaner Josephus zufolge sogar ausdrücklich, dass ihre Vorfahren
infolge häufiger Heimsuchung ihres Landes durch Seuchen mit Rücksicht auf einen alten Aberglauben die Sitte eingeführt [haben], den Tag zu feiern, den die Juden Sabbat nennen, und … in dem Tempel, den sie, ohne ihn einem bestimmten Gotte zu weihen, auf dem Berge Garizim erbauten, feierliche Opfer dargebracht [haben].
Zumindest Josephus spiegelt eine jüdische Haltung gegenüber den Samaritanern wider, die diesen vorwirft, das Fähnchen ihrer Verbundenheit mit dem Volk Israel nach dem jeweiligen Wind auszurichten und ihre jeweiligen Götter beliebig auszutauschen, da sie in Wirklichkeit „Abkömmlinge der Meder und der Perser“ sind.
Wenn wir noch die Stellen im Buch Jeremia, Kapitel 2 und 3, hinzunehmen, in denen der Prophet sowohl Israel als auch Juda vorhält, dass sie mit den fremden Göttern Ägyptens und Assyriens und vielen anderen Liebhabern herumhuren, und insbesondere die Verheißung, dass dennoch (Jeremia 3,11) das „abtrünnige Israel gerechter dasteht als das treulose Juda“, dann kann kaum noch ein Zweifel daran bestehen, vor welchem Hintergrund der johanneische Jesus die samaritanische Frau nach ihrem Mann fragt, der nicht ihr Mann ist, und die fünf Männer erwähnt, die sie gehabt hat.
Obwohl Thyen diesen symbolischen Hintergrund in den Blick nimmt, ist aber fraglich, ob es ausreicht, ihn auf einer religiösen Ebene zu betrachten, wie er es tut, wenn er von religiösem Synkretismus spricht, also von der Vermischung der angestammten israelitischen Religion mit Elementen anderer Götterkulte bis hin zum Austausch des Gottes Israels durch heidnische Götter.
Ton Veerkamp <362> ist der Überzeugung, dass dort, wo dem Gott Israels andere Götter vorgezogen werden, immer Politik im Spiel ist. Entweder man zollt dem Gott mit dem befreienden NAMEN die gebührende Verehrung und folgt seiner Tora als einer Disziplin der Freiheit, die jedem Armen und Elenden im Lande sein Recht verschafft, oder man verfällt irgendeinem der üblichen altorientalischen Götter, in deren Namen Unterdrückung und Ausbeutung legitimiert werden. Von daher ist es in Veerkamps Augen sonnenklar, wer mit dem „Mann“ der Frau gemeint sein muss, die als Repräsentantin der Stamm-Mütter Israels in die Geschichte eingeführt worden ist:
Jesus versucht den Durchbruch, jetzt will er politisch Tacheles reden: „Geh‘ und hole deinen Mann!“ Wir haben es mit einer Tochter Jakobs und nicht mit der schmutzigen Exegetenphantasie über eine Schlampe und ihren „enormen Männerverschleiß“ zu tun. Sie redet von „Jakob, unserem Vater“. Welchen Mann hat die Tochter Jakobs? Welchen Mann hat die Tochter Zions – Klagelieder 2,1 usw.? Anders gefragt: Welche Herrscher, welche Götter haben die beiden Völker gehabt?
Ich habe lange überlegt, ob die Frage Jesu direkt auf der Erzählebene in einem solchen Sinn verwendet worden sein kann oder ob nicht doch Thyen zuzustimmen ist, dass auf der Erzählebene zunächst eine illegitime Beziehung dieser Frau im Blick ist, hinter der auf einer symbolischen Ebene andere Themen angesprochen werden. Wenn anzunehmen ist, was sowohl Wengst als auch Thyen tun, dass die Samaritanerin durchaus versteht, welches gottgegebene Lebenswasser Jesus ihr (4,13-14) anbietet, dann könnte seine Reaktion auf ihre Bitte um dieses Wasser (4,15 ) nun als ein Verweis darauf zu verstehen sein, dass dieses Wasser eben die Gabe dieses Gottes Israels ist, des „Mannes“, den die „Tochter Jakobs“ haben sollte (ähnlich wird Jesus später die Judäer (6,32) darauf hinweisen, dass nicht Mose ihnen das Manna gegeben hatte, sondern Gott ihnen Brot vom Himmel gibt). Wenn sie sich stolz auf Jakob und auf seinen wunderbaren Brunnen beruft, dann sollte sie auch wissen, dass bereits Jakob diesen Brunnen als Gabe Gottes empfangen hatte.
Veerkamp sagt nun, dass diese Aufforderung unter „den herrschenden Bedingungen zwischen den beiden Völkern“ von der „Frau am Jakobsbrunnen … nur als eine Beleidigung“ aufgefasst werden kann. Das kann er wohl nur so meinen, dass in der Frage schon der Vorwurf steckt: Ihr Samaritaner seid ja schon lange vom wahren Gott abgefallen, man weiß ja, dass ihr auf dem Garizim den Zeus angebetet habt. Insofern ist die Antwort der Frau in ihrer knappen Kürze an klarer, realistischer Einsicht nicht zu überbieten: „Ich habe keinen Mann.“
Von dieser Reaktion ist Jesus nun Veerkamp zufolge geradezu
begeistert: „Richtig (kalōs) sagst du das.“ Das ist kein Sarkasmus, keine Bitterkeit. „Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. In dem, was du gesagt hast, steckt Vertrauenswürdiges.“ Wir müssen äußerst genau lesen. Touto alēthes {dies Vertrauenswürdige} (Substantiv) eirēkas {hast du gesagt}. Ein paar Handschriften haben das verändert und schreiben das Adverb alēthōs {wahrheitsgemäß}. Nein, hier steht wörtlich: „Dies Vertrauenswürdige hast du gesagt“, denn das Wort alētheia bedeutet nicht Wahrheit, sondern Treue, ˀemeth.
Nach Veerkamp kann „wohl kaum bezweifelt werden“, dass „es hier um den zentralen politischen Punkt geht“. Nachdem es bereits bei der Hochzeit zu Kana (2,1-11) und im Hören der Stimme des Bräutigams durch seinen Freund (3,29) um die Hoffnung auf die messianische Hochzeit Gottes mit seinem Volk zum Auftakt des Lebens der kommenden Weltzeit ging, wird nun die Art und Weise angesprochen, wie die verlorenen zehn Stämme Nordisraels, die im Volk der Samaritaner überlebt haben, seit Jahrhunderten bis in die Zeit Jesu hinein in die weltumspannende Wirklichkeit der Hurerei mit fremden Göttern verstrickt geblieben sind:
Diese fünf Männer haben mit der politischen Lage Samarias zu tun gehabt. Die Ehe ist ein Symbol für das Verhältnis zwischen dem Gott Israels und dem Volk. Aber sie ist auch das Symbol für die Gewaltherrschaft des Königs:
Höre, Tochter, siehe, neige dein Ohr,
vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters.
Hat ein König Lust an deiner Schönheit,
weil er dein Herr ist – verneige dich vor ihm (Psalm 45,11-12).„Männer“ sind in Johannes 4 nicht irgendwelche individuellen Gatten, sondern baˁalim, Herrscher, Könige, vor denen das Volk von Samaria sich verneigen musste, die Könige Assurs und Babels, die Könige Persiens und der Griechen aus dem Süden (Ägypten) und dem Norden (Syrien), die Könige Judäas, ihre Ordnungen, ihre Götter. Die Frau sagt: „Ich habe keinen Mann“, und das heißt: „Ich erkenne die faktische Herrschaft, der wir uns zu beugen haben, nicht an. Ich vergesse nicht mein Volk und nicht das Haus meines Vaters! Ich habe keinen Mann (ˀisch), ich habe nur einen Herrn und Besitzer (baˁal).“ Johannes argumentiert auf der Linie des Propheten Hosea:
Es wird geschehen an jenem Tag, Verlautbarung des NAMENS.
du wirst rufen: „ˀischi, mein Mann“,
du wirst nicht mehr rufen: „baˁali, mein Herr und Besitzer“.Die fünf „Männer“, die das Volk je gehabt, waren baˁalim. Die verhängnisvolle Geschichte dieses Volkes unter den fünf baˁalim macht aus der Tora Samarias eine Art von Gegentora, alle politische Organisation der Gesellschaft Samarias war das Gegenteil einer durch die Tora strukturierten Gesellschaft. Das Ganze ist jetzt auf die Herrschaft von dem, der „kein Mann“ ist, hinausgelaufen, die Herrschaft Roms; da ist gar keine Tora mehr möglich, weder für die Judäer, noch für die Samaritaner, wie wir hören werden. Tatsächlich ist sie gezwungen, eine Herrschaft anzurufen, der er, Jesus, den Kampf angesagt hat und die sie, wie die jüngste Geschichte ihres Volkes zeigt, zurückweist. „Nein“, sagt er, „das ist nicht dein Mann, allenfalls dein Besitzer.“ Auf der Basis der gemeinsamen Ablehnung römischer Herrschaft, des römischen baˁal, ist politische Verständigung zwischen den beiden Völkern möglich. Deswegen lobt Jesus den Satz der Frau: „Ich habe keinen Mann.“
Aber kann es sein, dass mit dem Mann, den die Frau hat und der doch kein „Mann“, anēr, sondern ein „Besitzer“, baˁal, ist, wirklich Rom gemeint ist? Immerhin steht die Herrschaft Roms und seines Kaisers, den die priesterliche Führung Judäas als ihren einzigen König anerkennt (19,15), obwohl sie zugleich befürchtet, dass die Römer ihr den Tempel und die ethnische Autonomie entreißt, drohend im Hintergrund des gesamten Evangeliums; und es sind die Samaritaner, die (4,42) ihr Vertrauen auf den Messias Jesus zugleich in der Form ausdrücken, dass sie ihn als den Befreier des kosmos bezeichnen, womit im Johannesevangelium die Befreiung der Menschenwelt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, gemeint ist.
Es spricht also viel dafür, dass Jesu anerkennendes Wort gegenüber der Frau in den Versen 17b-18 „ein Bekenntnis zu einer Frau“ ist,
die ihre politische Lage realistisch erkennt. Hier gibt es wirklich eine Plattform für ein Gespräch, eine politische wohlgemerkt. Das Bekenntnis der Menschen zum Messias beginnt mit dem Bekenntnis des Messias zu den Menschen. „Ich habe keinen Mann“ ist die schonungslose Einsicht in die erbärmliche politische Lage ihres Volkes.
Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die Frau nun anfangen wird, von den Heiligtümern der Samaritaner und der Juden zu reden. Keineswegs geht es hier um die rein religiöse Frage, auf welchem Berg oder in welchem religiösen Gebäude Gott am liebsten angebetet werden will. Vielmehr spielen Heiligtümer im Hintergrund unserer Geschichte eine zentrale politische Rolle sowohl in den feindseligen Auseinandersetzungen zwischen Judäern und Samaritanern als auch in der kultischen Absicherung staatlicher Herrschaft:
Das Heiligtum auf dem Berg Gerizim wurde von den Judäern unter Johannes Hyrkan verwüstet. … [E]in Prophet [hatte] versucht, auf dem Berg Gerizim das Zentralheiligtum der Samaritaner wiederzuerrichten; dies wurde von den Römern mit einem Massaker beantwortet. Dieser Berg war vom Ort Sychar aus zu sehen. Die Leute aus Samaria haben keinen Ort mehr, wo sie dem Gott Israels jene Ehre erweisen können, die ihm als ihrem König gebührt (proskynein). Man umschreibt das Wort mit „anbeten“; tatsächlich geht es um politische Huldigung. … Die Judäer denken beim Heiligtum auf dem Berg Gerizim an den „Hellenistischen Zeus“, dem die Samaritaner laut Flavius Josephus um 170 v.u.Z. ihr Heiligtum weihten (Ant. 12,5,5). Das Heiligtum ist zerstört, statt dessen hat Herodes einen richtigen Baaltempel in Sebaste errichten lassen, in der Stadt, die er als Ersatz für die zerstörte Stadt Samaria hat bauen lassen: „In der Mitte der Stadt steckte er einen in jeder Hinsicht geeigneten Platz von anderthalb Stadien ab, auf dem er einen großen und herrlichen Tempel erbaute“ (Ant. 15,8,5). In solchen Königstempeln fand Staatskult statt.
↑ Johannes 4,19: Die Frau nennt Jesus einen Propheten
4,19 Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
[18. Mai 2022] Auf Jesu Äußerung über die fünf Männer der Frau und den einen, der nicht ihr Mann ist, reagiert die Samaritanerin (W141) mit einer respektvollen „Feststellung über Jesus.“ So gibt sie Klaus Wengst zufolge
eine Antwort darauf, „wer es ist“, der mit ihr redet: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.“ Ein Prophet hat Durchblick. Er nimmt Wirklichkeit unverstellt und durchdringend wahr und sagt frei heraus, was Sache ist. Das hat die Frau im Blick auf sich selbst an Jesus erfahren und so benennt sie ihn als Propheten.
Diese Interpretation der Funktion eines Propheten ist nicht falsch, deckt aber nicht die Hauptaufgabe biblischer Propheten ab, nämlich über den individuell-zwischenmenschlichen Bereich hinaus dem Volk Israel und anderen Völkern politische Einsichten zu vermitteln, die – je nach den Umständen schmerzhaft oder hoffnungsvoll – meist der gerade herrschenden öffentlichen Meinung widersprachen.
Nach Hartwig Thyen (T256) zeigt die Samaritanerin „mit der Qualifikation Jesu als ,Prophet‘…, daß sie auf dem Wege ist zu begreifen: ‚Wer der ist, der zu ihr gesagt hatte: Gib mir zu trinken!‘ (V 10)“:
War der Vokativ kyrie {Herr!} in V. 11 nur die konventionelle Formel der höflichen Anrede eines Fremden, so mischt sich in dessen Wiederholung in V. 15 vielleicht schon erstaunter Respekt vor diesem Juden. Vollends in die Nähe einer hoheitlichen Prädikation gerät die Anrede Jesu aber erst mit dem Satz: kyrie, theōrō hoti prophētēs ei sy {Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist!}.
Was kann aber eine samaritanische Frau unter einem Propheten verstehen, fragt sich Thyen, wenn es doch nach Teresa Okure <363>
„bekannt ist, dass die Samariter die prophetischen Bücher ablehnten und dass der einzige Prophet, den sie anerkannten, derjenige war, der wiederkommen sollte (Deut 18,15-18). In V. 19 erkennt die Frau Jesus einfach als jüdischen Propheten an. V. 20 unterstützt diese Interpretation; die Gegenüberstellung von ,unsere Väter‘ und ,du‘ zeigt, dass Jesus in den Augen der Frau im Wesentlichen ein Jude bleibt, ein jüdischer Prophet, ohne Zweifel, aber dennoch ein Jude. Jesu eigene Bemerkung in V. 22 unterstreicht diesen Punkt.“
Das heißt, die Frau erkennt „mit der prophetischen Sendung Jesu“ zwar „zugleich seine religiöse Kompetenz und Gottesnähe an“, indem sie im folgenden Vers die Frage des richtigen Ortes der Gottesanbetung anspricht, aber sie setzt ihn nicht gleich mit dem von den Samaritanern erwarteten „Propheten wie Mose“. <364>
Selbst wenn Letzteres nicht zutrifft, ist es aber doch kaum anzunehmen, dass die Frau ihre respektvolle Anerkennung Jesu als Prophet mit der abschätzigen Beurteilung verbinden würde, dass er ja nur ein jüdischer Prophet ist, der einer Samaritanerin eigentlich nichts zu sagen hat. Da in der von den Samaritanern anerkannten Tora durchaus von Propheten die Rede ist (1. Mose 20,7; 2. Mose 7,1; 4. Mose 11,29; 12,6; 5. Mose 13,2.4.6), und zwar auch abgesehen von dem Propheten wie Mose, der kommen soll (5. Mose 18,15.18.19.20.22; 34,10), ist die samaritanische Ablehnung der jüdischen Propheten-Bücher nicht gleichzusetzen mit grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber Propheten, zumal wenn sich einer – wie Jesus in diesem Gespräch – durch prophetische Erkenntnis als ein solcher erweist.
Hinzu kommt außerdem, dass es auf der Erzählebene gar nicht darauf ankommt, in welcher Weise eine historische Samaritanerin den historischen Jesus womöglich als einen Propheten verstanden haben könnte. Entscheidend ist, dass der Evangelist in dieser Frage offenbar keine nennenswerten Gegensätze sieht, ähnlich wie er später (Verse 25 und 29) die Samaritanerin und ihre Landsleute auch ganz unbefangen von ihrer Erwartung des Messias reden lässt.
Ton Veerkamp <365> geht in seiner Auslegung von Johannes 4,19 daher auch einfach von der generellen Einschätzung prophetischer Rede im jüdischen TeNaK aus. Ihm zufolge hat Jesus auch in den Augen der Frau
die Lage … korrekt zusammengefasst, der, den sie hat, sei gar nicht ihr Mann. Sie reagiert völlig korrekt: „Ein Prophet bist du“, denn Propheten hatten in Israel immer die Aufgabe, die politische Lage wahrheitsgemäß zu deuten.
Wenngleich also nach Veerkamp hier nicht über unterschiedliche Prophetenverständnisse spekuliert werden muss, nimmt jedoch auch er noch immer eine gewisse Zurückhaltung der samaritanischen Frau gegenüber dem judäischen Jesus wahr. Diese Zurückhaltung kommt für ihn nur deshalb in den Blick, weil er unsere Geschichte im Licht einer „Kontrasterzählung“ aus 2. Könige 4,8ff. betrachtet. Dort wird „vom Propheten Elisa und der Großfrau aus Schunem“, einer ˀischa gedolah, erzählt, die „wohl eine selbständige Grundbesitzerin nach Numeri 27 und 2 Könige 8,6“ war:
Auch diese Frau hatte einen Mann, der nicht ihr Mann war…, weil sie mit ihm keine Zukunft, keinen Sohn hatte. Elisas Dienstmann Gehasi bringt es auf den Punkt (V.14): „Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt.“ Sie bekommt ein Kind von ihrem Mann, nur weil Elisa es ihr zugesagt hatte. Als das Kind sterbenskrank wird, lässt der Mann das Kind zu seiner Mutter bringen; es ist offenbar nicht sein Kind. Das Kind stirbt, die Mutter geht zum Propheten: „Habe ich vielleicht ein Kind von meinem Herrn [Elisa] verlangt?“ (2 Könige 4,28.) Wir erfahren, wie der Prophet das Kind der Frau ins Leben zurückbringt.
Sie kam und fiel ihm [dem Propheten Elisa] zu Füßen,
sie verneigte sich vor ihm (thischthachu, prosekynēsen) zur Erde,
sie nahm ihren Sohn auf und ging hinaus (2 Könige 4,37).Die Großfrau aus Schunem hatte eine Zukunft, weil sie dem Propheten Elisa vertraut hatte. So weit sind wir hier noch lange nicht. Die Samaritanische durchschaut (theōrei) zwar, dass Jesus Prophet ist, aber er bleibt Judäer. Sie ist das Analogon zu den großen Frauen Israels: Genau in dem Punkt, wo sie ihnen ähnlich ist, unterscheidet sie sich von ihnen.
↑ Johannes 4,20: An welchem Ort soll man „sich verneigen“, proskynein?
4,20 Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet,
und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll.
[19. Mai 2022] Nachdem Klaus Wengst (W141) den Austausch über die Männer der Frau als Problem der persönlichen Lebensgeschichte der Frau abgehandelt hatte, kann er nicht umhin, die folgenden Worte der Frau nun doch auf die Volksgruppen zu beziehen, zu denen Jesus und sie gehören:
Den als Propheten Erkannten spricht die Frau auf das an, was Juden und Samariter trennt. Sie redet dabei betont als Samariterin: „Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg angebetet.“
Damit beansprucht sie „für den Garisim die Autorität der israelitischen Erzväter“ und auch des Mose, der angeordnet hatte,
von dort aus den Segen über die in das Land einziehenden Stämme zu sprechen (Dtn 11,29; 27,12). Zudem gab es die Tradition, auf dem Garisim habe Mose selbst die Kultgeräte der Stiftshütte vergraben. Deren Auffindung werde die Zeit des Heils einleiten (Ant 18, 85-87 {Ant. 18,4,1}).
Obwohl „der Tempel auf dem Garisim schon lange zerstört ist“, ist der Ort
wichtig; er ist und bleibt „gesegnet“. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Durch sie und Mose hat er eine Geschichte mit dem Volk gehabt, in der er als dieser Gott erkennbar wurde. So ist dieser Berg der Ort seiner Nähe.
Dieser Tradition der Samaritaner, an der sie festhält, stellt sie (W142), indem sie „Jesus als Repräsentanten aller Juden“ anspricht, die jüdische Behauptung gegenüber,„in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten müsse“:
Sie hat ihn gerade als Propheten erkannt. Aber damit ist nicht aufgehoben, dass er ein Jude ist. Im Blick auf die eigene Garisim-Tradition traf die Frau eine mit Autorität abgesicherte Feststellung, Jerusalem als Ort der Anbetung führt sie dagegen als Behauptung der Juden ein. Auch mit Jerusalem werden Traditionen der Väter verbunden, die davidisch-salomonischen kommen hinzu. Zur erzählten Zeit stand der Jerusalemer Tempel noch. Zur Erzählzeit war aber auch er zerstört wie der auf dem Garisim. Dennoch blieb die Stätte des zerstörten Tempels, wie die eben zitierte Geschichte zeigt, ein bevorzugter Ort der Anbetung Gottes. An der Westmauer des Tempels beten heute noch und wieder Jüdinnen und Juden und auf dem Berg Garisim feiert die kleine Gemeinde der Samariter ihr Pessachfest.
Wie für die Samaritaner der Garizim, so bleibt für Juden der Tempelberg in Jerusalem ein „Ort der Nähe Gottes, der Gewissheit gibt, mit Gott in Beziehung zu treten, von ihm gehört zu werden.“ Die rabbinische Tradition <366> bringt Jerusalem als „das Tor des Himmels“ mit dem Ort
in Verbindung, von dem Jakob nach seinem Traum von der Himmelsleiter spricht (Gen 28,17). „Von hier aus hat man gesagt: Fürwahr, alle, die in Jerusalem beten, sind so, als beteten sie vor dem Thron der Herrlichkeit. Denn das Tor des Himmels ist dort und die Tür steht offen, um das Gebet zu hören. Denn es ist gesagt (Gen 28,17): Und das ist das Tor des Himmels“.
Dass es im Zusammenhang mit dem Ort der Anbetung auch zu hässlichen Anfeindungen kommen konnte (W141), zeigt eine andere jüdische Überlieferung: <367>
„Rabbi Jischmael, der Sohn des Rabbi Jose, machte sich auf, um in Jerusalem anzubeten. Er kam an der Platane (am Berg Garisim) vorbei. Da sah ihn ein Samariter. Er sprach zu ihm: ,Wohin gehst du?‘ Er sprach zu ihm: ‚Ich mache mich auf, um dort in Jerusalem anzubeten.‘ Er sprach zu ihm: ‚Wäre es nicht besser für dich auf diesem gesegneten Berg anzubeten als auf jenem Misthaufen?‘“
Auch nach Hartwig Thyen (T256) stellt die Samaritanerin, nachdem sie „Jesus als einen ,Propheten‘ erkannt hat und ihn entsprechend respektiert“, in ihrer indirekten „Frage nach dem rechten Ort der Anbetung JHWHs … die uralte Praxis ‚unserer Väter‘ dem viel späteren Jerusalem-Dogma der Juden“ entgegen (T257):
Damit wird deutlich, daß es der Frau also um nichts Geringeres als um die Frage nach der göttlichen Autorisierung des jeweiligen Kultortes geht. Zu den „Vätern“, die Gott auf dem Garizim verehrt haben, gehören nach V. 6 und 12 bereits die Patriarchen Jakob und Joseph. Ja, schon längst vor diesen hat nach der Tradition der Samaritaner der Erzvater Abraham hier die Akeda {Bindung} Isaaks vollzogen. Seit jener Stunde wohnt darum die göttliche Schekina {Einwohnung} zusammen mit den Engeln und der Mose-Tora unsichtbar über diesem heiligen Berg. Und all das begründet in den Augen der Samaritaner seine Priorität und Überlegenheit dem erst seit der Ära Davids geltenden Grundsatz gegenüber, „daß man in Jerusalem anbeten muß“…
Ton Veerkamp <368> zufolge bringt die „Frau am Jakobsbrunnen“, die „nicht auf die Knie“ fiel „vor ihm, als sie ihn als Propheten bezeichnete“, stattdessen
das zur Sprache, was zwischen ihnen steht: die ganze blutige Geschichte zwischen ihren Völkern. In ihren Augen ist Samaria das Opfer, Judäa der Täter. Sie bringt es auf den Punkt: „Unsere Väter verneigten sich (prosekynēsan) auf diesem Berg hier. Aber ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man sich verneigen (proskynein) muss.“
Beim folgenden Gedankengang Veerkamps frage ich mich, ob er mir nur deshalb Kopfzerbrechen bereitet, weil er die Zwickmühle der samaritanischen Situation widerspiegelt:
Der Kult im neuen Tempel Sebastes wäre dann schieres Heidentum, für die Frau, die Botschafterin ihres Volkes, war das ein Greuel: „Einen Mann habe ich nicht!“
Wenn ich das richtig verstehe, beruft sich die Frau einerseits stolz auf ihre israelitische Vätertradition und wirft darum den Judäern vor, den Samaritanern zu Unrecht heidnischen Götzendienst zu unterstellen. Andererseits steht aber der Kult im Tempel der nach dem Kaiser Augustus benannten Stadt Sebaste (griech. sebastēs = lat. augustus, „erhaben“) tatsächlich im absoluten Widerspruch zur Anbetung des Gottes Israels, was sie durch ihre Feststellung, dass sie keinen Mann (gemäß Hosea 2,18) habe, auch bestätigt hat. Nach Veerkamp geht es also nicht einfach um einen bilateralen Konflikt zwischen zwei Völkerschaften oder Religionsgemeinschaften, sondern um ein kompliziertes Geflecht der Verstrickung in die Politik der Herrschenden:
Ihre Feinde sind die Römer und die Judäer, beide. Deswegen kann sie sich mit einem judäischen Propheten nicht verständigen: „Unsere Väter hatten gesagt …, ihr aber sagt …“ Sie kann daher nicht handeln wie ihre Vorgängerin, die Großfrau aus Schunem, sie kann und wird vor Jesus nicht auf die Knie gehen. Sie sagt: „Du durchschaust zwar unsere politische Lage, denn du bist ein Prophet. Aber solange die Dinge so zwischen uns stehen, kannst du uns hier keine politischen Aufgaben stellen.“
Kann der Messias Jesus aus dieser Konfliktlage einen Ausweg weisen, kann er Versöhnung bewirken? Die Chance dazu besteht, weil Jesus als der Messias nicht nur dem samaritanischen Götzendienst kritisch gegenübersteht, sondern bei der Tempelreinigung auch „zu Leuten seines eigenen Volkes sagte: „Macht nicht aus dem Haus meines VATERS ein Markthaus“ (Johannes 2,16)“, was er „mit einer keineswegs gewaltfreien Aktion“ nachdrücklich unterstrich.
Darum gilt nicht nur für das samaritanische, sondern auch für das judäische Volk:
Am Ort des Heiligtums in Jerusalem kann man dem Gott Israels nicht „politisch huldigen“, denn das bedeutet das Verb proskynein, „sich verneigen“.
Aber davon kann auf der Erzählebene die Samaritanerin nichts wissen. Jesus muss ihr genauer erläutern, worauf er hinaus will.
Wir werden uns in der Auslegung der folgenden Verse darüber klar werden müssen, ob wir dem von Veerkamp hier vorgelegten Verständnis von proskynein folgen wollen oder uns mit der traditionellen Übersetzung „anbeten“ zufriedengeben, die das Wort in einem rein religiösen Sinn auffasst. Veerkamp will darauf hinaus, dass derjenige, der sich vor dem Gott Israels verneigt, sich damit ganz und gar auf den befreienden und Recht schaffenden NAMEN dieses Gottes einlässt und jeglicher Unterdrückung und Ausbeutung eine Absage erteilt.
↑ Johannes 4,21: Die Anbetung des VATERS weder auf dem Garizim noch in Jerusalem
4,21 Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau,
es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge
noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
In den Versen 4,21-24 geht es um die Art und Weise dessen, was bereits in Vers 20 mit dem Wort proskynein, „sich verneigen“, angesprochen wurde. Dieses Wort kam dort schon zwei Mal vor und wird bis zum Vers 24 noch weitere sieben Mal verwendet.
Nach Hartwig Thyen (T257) ist diese Passage „die längste Rede der gesamten Szene“, deren „besonderes Gewicht … durch die einführenden Worte: pisteue moi, gynai {glaube mir, Frau}, markiert“ ist. Thyen vergleicht diese Einführung „mit dem verwandten Satz: amēn amēn legō hymin hoti erchetai hōra kai nyn estin ktl. {Amen, Amen, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt usw.} (5,25)“, zumal Jesus die Worte erchetai hōra kai nyn estin, „es kommt die Stunde und ist schon jetzt“ in Vers 4,23 genau wortgleich mit 5,25 aussprechen wird. Im Gegensatz zu dem „für unser Evangelium typischen doppelten nichtresponsorischen {nicht als Gebetsschluss verwendeten} Amen der Redeeröffnung Jesu“ ist Edeltraud Leidig <369> zufolge die „Aufforderung zum Vertrauen“ in der einzigartigen „Situation dieses Gesprächs eines jüdischen Mannes mit einer samaritanischen Frau“ jedoch ebenfalls einzigartig:
Mit deren persönlicher Anrede, „gynai“, signalisiert Jesus ihr zugleich, daß sie (und mit ihr der implizite Leser), nun etwas schlechthin Neues … hören wird, mit dem sie nicht hat rechnen können… Denn statt auf ihre Frage nach dem rechten Ort der Proskynese zu antworten, redet Jesus von der rechten Art und der nahen Zeit der wahren Anbetung und relativiert damit die Juden und Samaritaner trennende Frage nach deren rechtem Ort: erchetai hōra hote oute en tō orei toutō oute en Hierosolymois proskynēsete tō patri {die Stunde wird kommen, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet}.
An dieser Stelle schlägt Thyen fragwürdige Wege der Auslegung unserer Geschichte ein, und zwar erstens, indem er auf das Stichwort tō patri, „den Vater“ folgendermaßen eingeht:
Hatte die Samaritanerin von „unserem Vater Jakob“ und von „unseren Vätern“ geredet, um so den Kult auf dem Garizim zu legitimieren, so benennt Jesus mit diesem Prädikat (tō patri) nun Gott als seinen ,Vater‘, der, sobald mit der eben verheißenen ,Stunde‘ die Zeit der ,neuen Geburt‘ aus dem Geist angebrochen ist, als der Vater aller, „die an den Sohn glauben‘ (3,36), seien sie nun Juden, Samaritaner oder Heiden, gemeinsam von ihnen allen angebetet werden wird: proskynēsete {ihr werdet anbeten}…
Fragwürdig ist hier zunächst die Entgegensetzung der Väter als der Patriarchen Israels und der Bezeichnung VATER für den NAMEN des Gottes Israels, als dessen Sohn sich Jesus im Johannesevangelium versteht. Dasselbe Worte patēr wird hier doch in ganz unterschiedlichem Sinn verwendet: Die Samaritaner beteten ja nicht ihre Väter an, sondern beriefen sich vielmehr auf die Patriarchen Israels als Zeugen für den rechten Ort der Anbetung des einen Vater-Gottes, der auch für sie der Gott Israels ist. So jedenfalls muss man Johannes verstehen, wenn man das gesamte Setting der Erzählung am Brunnen Jakobs auf dem Feld Josefs ernstzunehmen gewillt ist.
Wenn es hier aber um den einen Gott Israels geht, der Johannes zufolge nicht nur der Gott der Judäer, sondern auch der Samaritaner (der Söhne Jakobs und Josefs) ist, dann beschäftigt sich Jesus hier ganz konkret mit dem Problem, dass man sich in seinen Augen weder hier auf dem Garizim noch in Jerusalem tatsächlich noch vor dem VATER verneigt. Ersteres hatte er in dem Gesprächsgang über den Mann, der kein Mann ist, verneint, Letzteres bei der Tempelreinigung in Jerusalem. Was Jesus hier ankündigt, muss also darauf hinauslaufen, wie eine Zukunft aussehen kann, in der sich ganz Israel (sowohl Judäa als auch Samaria) wieder vor dem VATER verneigen kann.
Thyens Formulierung von der Anbetung des Vaters Jesu durch alle, „‚die an den Sohn glauben‘ (3,36), seien sie nun Juden, Samaritaner oder Heiden“, klingt dagegen verdächtig nach einer Neudefinition des Gottes Israels vom christlich interpretierten Jesus her, statt dass vom befreienden NAMEN dieses Gottes her danach gefragt wird, wie die Versöhnung zwischen Judäa und Samaria und ihre gemeinsame Befreiung von der Weltordnung, die auf ihnen lastet, zustandegebracht werden kann. Spätestens wenn Juden mehrheitlich nicht bereit sind, an Jesus zu glauben, und wenn Samaritaner als halbe Heiden in der Völkerwelt aufgehen, müssen wir uns als Leserinnen und Leser des Johannesevangeliums dann nur noch mit uns selber, nämlich uns „Heiden“ oder Angehörigen der nichtjüdischen Völkerwelt, als dessen eigentlichen Adressaten beschäftigen. Und das, obwohl von einer allgemeinen Heidenmission im Johannesevangelium nirgends die Rede ist.
Was ich eben als Befürchtung formuliert habe, nämlich dass die Thyensche Auslegung unserer Geschichte dazu führen könnte, jegliches Interesse am konkreten judäisch-samaritanischen Konflikt zu verlieren, äußert Thyen dann sogar selbst als angebliche Absicht der Erzählung:
Wie Jesus in V. 10 auf den Antagonismus zwischen Juden und Samaritanern überhaupt nicht eingegangen war, sondern ihn mit dem Stichwort der dōrea tou theou {Gabe Gottes} auf die universale Ebene der Relation Gottes zu den Menschen transponiert hatte, und wie er am Ende unserer Szene die Aufforderung seiner Jünger, doch von dem Mitgebrachten zu essen, transzendieren und sie auf das Feld der eschatologischen {endzeitlichen} ,Ernte‘ verlagern wird (31-38), so verfährt er jetzt auch mit der Frage der Frau nach dem rechten Ort der Proskynese {Verneigung, Anbetung} und der vermeintlichen Alternative von Garizim oder Jerusalem.
Dagegen ist einzuwenden, dass es zwar um Universalität und Eschatologie geht, aber nicht in dem Sinne, dass irdische Feindschaften angesichts der Hoffnung auf den jenseitigen Himmel keine Rolle mehr spielen. Nein, Johannes sieht die Versöhnung der verfeindeten Judäer und Samaritaner als notwendigen Auftakt der Sammlung ganz Israels in der messianischen Gemeinde und das diesseitige Leben der kommenden Weltzeit, das der Messias Jesus anbrechen lassen wird.
Beiläufig weist Thyen darauf hin, dass Jesus, indem er die Zukunftsform proskynēsete, „ihr werdet anbeten“, verwendet, nicht schon zu seiner Zeit beide Kultformen auf dem Garizim und in Jerusalem für gleichrangig erklärt. Erst dann, wenn er „selbst, in dem der ewige Logos unter den Menschen „zeltete“ (1,14), … das eschatologische, alle vereinende „Tempelheiligtum“ sein (2,18-22)“ wird, dann werden beide ihre Bedeutung verloren haben (T257f.):
Bis dahin jedoch hat der Zions-Tempel in Jerusalem, um den Jesus sein Leben lang und mit tödlicher Folge „eifert“ (2,17), den er nachdrücklich „das Haus meines Vaters“ nennt (2,16f) und zu dem er, der Jude, zu den großen Festen mit seinem Volk „hinaufzieht“ (2,13; 5,1; 7,10), fraglos den unbestreitbaren Vorrang vor dem Garizim-Heiligtum.
Wieder geht es Thyen ausschließlich um Religion: Noch hat der jüdische Kult einen Vorrang gegenüber dem samaritanischen, nach Jesu Auferstehung werden beide von der christlichen Religion abgelöst werden.
Klaus Wengst handelt den Vers Johannes 4,21 sehr viel knapper ab. In seinen Augen geht es Jesus hier nicht um die zukünftige Anbetung Gottes (T257) durch „Juden, Samaritaner oder Heiden“, sondern (W142) Jesus spricht die Frau in der ersten Reaktion auf „die Alternative Garisim oder Jerusalem“, vor die sie ihn stellt,
zunächst als Repräsentantin ihres Volkes an und nimmt sie aus dieser Alternative heraus: „Glaube mir, Frau: Es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.“ Es ist zu beachten, dass Jesus hier nicht sowohl von Juden als auch von Samaritern spricht, die weder auf dem Garisim noch in Jerusalem anbeten werden, sondern er redet in der Frau nur die Samariter an. Sie werden nicht auf dem Garisim anbeten, aber sie werden auch nicht nach Jerusalem gewiesen. Sie müssen nicht erst Juden werden, um wahre Gottesanbeter zu sein.
Die Schlussfolgerung im letzten Satz dieser Argumentation läuft allerdings auf etwas ganz Ähnliches hinaus wie bei Thyen. Auch Wengst sieht Juden und Samaritaner trotz aller Rückbezüge der Frau auf die israelitischen Väter ihres Volkes als Angehörige zweier verschiedener Religionen. Er hatte ja schon einleitend (W133) die Samaritaner unter Hinweis auf Vers 42 als „außerhalb Israels“ stehend und „als Repräsentanten ‚der Welt‘“ betrachtet und scheint die Haltung des Johannes ihnen gegenüber analog zur Haltung des Paulus gegenüber den Nichtjuden aus den Völkern zu begreifen.
Ton Veerkamp <370> versteht den Ausblick auf die Zukunft in Vers 21 als eine realistische Beschreibung der Situation zur Zeit des Evangelisten. Diese Realität muss ernst genommen werden, wenn sie bewältigt werden soll:
Auf der Ebene der Erzählung (fiction) existiert das Heiligtum in Jerusalem noch; auf der Ebene des Erzählers (reality) sind beide Heiligtümer zerstört. Beide Völker haben „keinen Ort, nirgends“ mehr. „Weder Jerusalem noch Gerizim“ ist trostlose Realität, für beide Völker. Welche Zukunft haben sie denn? Wem können sie noch nachgehen, es sei denn dem Götzen dieser Weltordnung?
Mit seiner Antwort beginnt Jesus daher über die trostlose Ortlosigkeit der Anbetung der beiden Völker hinauszuweisen. Die Samaritanerin weiß zwar nicht,
dass er den Judäern das verlangte Zeichen ankündigte: „Löst diesen Tempel auf, und ich werde ihn in drei Tagen aufrichten“ (2,19), wobei Johannes bemerkte, er habe vom Tempel seines Körpers geredet, im Klartext, von der messianischen Gemeinde. Das alles wusste sie nicht und konnte es auch nicht wissen. Nicht einmal die Schüler wussten es: „Als er nun von den Toten auferweckt wurde, erinnerten sich die Schüler daran, dass er das gesagt hatte“ (2,22). Erst dann!
Schon im Laufe dieses Gesprächs mit der Samaritanerin wird sich aber zeigen, dass diese Frau nicht so schwer von Begriff ist wie seine Schüler. Und im Gespräch selbst geschieht bereits jetzt beispielhaft genau das, wovon Jesus hier redet und worauf sein ganzes Reden und Wirken gerichtet ist, nämlich die Sammlung ganz Israels in seiner messianischen Gemeinde, innerhalb derer die verfeindeten Geschwister Judäas und Samarias miteinander versöhnt werden und das Leben der kommenden Weltzeit des Friedens gemeinsam tätig erwarten können:
Der Abriss von absurden und mörderischen Trennmauern ist der Inbegriff messianischer Politik, Friedenspolitik (vgl. Johannes 14,27ff. und Epheser 2,14ff.).
↑ Johannes 4,22: „Rettung, Heil, Befreiung“, sōtēria, kommt von den Juden/Judäern
4,22 Ihr wisst nicht, was ihr anbetet;
wir aber wissen, was wir anbeten;
denn das Heil kommt von den Juden.
[20. Mai 2022] Dass Jesus Wengst zufolge (W142) in Vers 21 angeblich
nicht übergreifend und in gleicher Weise von Juden und Samaritern spricht, wird deutlich, wenn er anschließend eindeutig für die jüdische Position Partei ergreift. Die Frau hatte den als Propheten Erkannten indirekt aufgefordert, Stellung zu beziehen, und die Art ihrer Formulierung suggerierte eine Entscheidung für den Garisim. Jesus aber sagt nach der Ankündigung, dass die Samariter weder auf dem Garisim noch in Jerusalem anbeten werden: „Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen.“ Wieder wird die Frau als Repräsentantin ihres Volkes angeredet, während sich Jesus mit allen Juden in einem gemeinsamen „Wir“ zusammenfasst. Als den ihn die Frau zu Beginn des Gesprächs identifiziert hatte, als Juden, als den sie ihn bei ihrer gerade gemachten Aussage mit allen seinen Landsleuten zusammengeschlossen hatte, als der spricht er hier selbst. Er nimmt dabei eine streng jüdische Position ein: Die samaritische Gottesverehrung erfolgt ahnungslos, während die Juden wissen, was sie anbeten.
Indem Jesus jedoch in der Formulierung: „was ihr nicht kennt“, „was wir kennen“, nicht das Maskulinum, sondern das Neutrum benutzt, statt zu sagen: „wen ihr nicht kennt“, „wen wir kennen“, will er wohl „den Samaritern nicht direkt jede Gotteserkenntnis“ absprechen. Erst hier kommt auch Wengst (W143) zur Begründung „der Ahnungslosigkeit samaritischer Gottesverehrung“ auf die bereits mehrfach erwähnte Josephusstelle Ant. 12,5,5 zu sprechen, derzufolge die Samaritaner ein ursprünglich „namenloses (anónymon) Heiligtum“ dem „Zeus Hellenios“ weihen wollten, obwohl er zu Johannes 4,16-18 diese Stelle außer Acht gelassen und behauptet hatte, nach Josephus seien die Samaritaner dem Gott Israels stets treu geblieben.
Im Text von Johannes 4,22 selbst folgt als Begründung des Wissens der Juden und des Nichtwissens der Samaritaner ein Satz, den Wengst so übersetzt: „Denn die Rettung gibt es von den Juden her.“ Zur häufigen literarkritischen Ausscheidung dieses Verses „als sekundär“ in Vergangenheit und Gegenwart führt er als Beispiel (Anm. 188) Ernst Haenchen <371> an, der „betont, ‚daß für das J(ohannes-)E(vangelium) das Heil einzig von Gott und dessen Gesandten Jesus Christus kommt‘ und nicht von den Juden“. Nach Wengst ist „das eine falsche Alternative, weil es Gott gefallen hat, Israel als sein Volk zu erwählen“, und er merkt zusätzlich an (Anm. 187):
Auch wer wissenschaftlich von der Sekundarität überzeugt ist, sollte sich heute in Deutschland doch wenigstens dem sachlichen Problem stellen, dass DC-Pfarrer im 3. Reich diese Aussage im Konfirmandenunterricht aus der Bibel ausschwärzen ließen und dass sich 1938 der badische Landesbischof mit ihrer Tilgung beim Neudruck der „Biblischen Geschichten“ für den Religionsunterricht einverstanden erklärte.
Wengst sieht in dem Begründungszusammenhang (W143)
dann eine nachvollziehbare Logik, wenn hier implizit der Zusammenhang von Erwählung und Bund vorausgesetzt ist. Die Juden kennen deshalb Gott, weil es eben nicht um einen unbekannten, einen „anonymen“ Gott geht, sondern um Gott, der Israel erwählt und einen Bund mit ihm geschlossen und sich ihm so in einer gemeinsamen Geschichte bekannt gemacht hat. Gott und sein Volk Israel gehören unlösbar zusammen. Rettung gibt es von Gott her, der sich in Partnerschaft an dieses Volk gebunden hat.
In Anm. 189 argumentiert er aber nicht sehr konsequent, wenn er einerseits im „Blick auf die Samariter“ voraussetzt, dass diese „nicht in gleicher Weise wie die Juden an dieser Geschichte teilhaben, wie das in der von Josephus angeführten Überlieferung über ‚das anonyme Heiligtum‘ zum Ausdruck kommt“, andererseits aber darauf hinweist, dass es „zur Zeit Antiochus IV.“ nicht nur „hellenisierende Samariter gab“, sondern „auch die Existenz von in dieser Weise hellenisierenden führenden jüdischen Kreisen in Jerusalem belegt“ ist. Und genau das, nämlich die Verwandlung des Jerusalemer Tempels in ein hellenistisch-römisches Kaufhaus, hatte Jesus bei der Tempelreinigung doch auch den Juden vorgeworfen! Umgekehrt gesteht Wengst den Samaritanern zu:
Aufs Ganze gesehen entspricht die Aussage von V. 22a natürlich nicht samaritischem Selbstverständnis. Und so hat auch die samaritische Frau in V. 20 in aller Selbstverständlichkeit von „unseren Vätern gesprochen und damit keine anderen gemeint, als wenn Juden von „unseren Vätern“ sprechen. Dementsprechend hat – wie schon vermerkt – das rabbinische Judentum in seiner Mehrheit unter den meisten Gesichtspunkten Juden und Samariter gleichgestellt.
Mit all dem erzeugt Wengst ein verwirrendes Bild: Einerseits soll Jesus als Repräsentant der Juden für ein Israel sprechen, das im Bund mit seinem Gott steht, während die Samaritaner durch Abfall zum hellenischen Zeus sich aus diesem Bund gelöst haben. Andererseits gibt es auch Juden, die dem Bund mit Gott untreu geworden sind, während die Samaritanerin sich auf die Väter Israels beruft, was auf jeden Fall der zuvor von Wengst vertretenen Annahme widerspricht, die Samaritaner seien als von Israel unterschiedenes Volk und praktisch als Teil der Völkerwelt zu betrachten.
Nun gibt es Ausleger, die ein „Ablösungsmodell“ vertreten (W144), „als gelte der Bund mit Israel nur bis zu Jesus und die Aussage von Joh 4,22 insofern, als der aus dem Judentum kommt.“ Dazu zitiert Wengst den Reformator Johannes Calvin, <372> der einerseits betont, dass „Gott mit ihnen [den Juden] den Bund des ewigen Heils geschlossen hatte“, und feststellt, dass „nicht der geringste Zweifel daran“ besteht,
daß Christus deshalb die Juden bevorzugt, weil sie nicht irgendein unbekanntes Wesen verehrten, sondern den einen Gott, der sich ihnen offenbart hat und sie als sein Volk angenommen hat. Allerdings führt CALVIN diesen Gesichtspunkt nicht konsequent durch und so meint er schon auf der nächsten Seite, „daß die Juden des Schatzes verlustig gegangen sind, den sie bis dahin noch besaßen“.
Wengst selbst (W143) lehnt das „Ablösungsmodell“ ab: Einerseits gibt es
auch durch Jesu Wirken „Rettung von den Juden her“, da der in ihm präsente Gott kein anderer ist als Israels Gott. Weil die Bindung Gottes an Israel und damit die Partnerschaft zwischen Gott und seinem Volk bleibt, darf hier nicht in einem Ablösungsmodell gedacht werden…
Spannend finde ich schließlich, dass Wengst (W144) in der „Formulierung, dass es ‚Rettung von den Juden her‘ gibt…, noch eine weitere Dimension“ entdeckt,
nämlich eine politische: Der Begriff „Rettung“ (sotería, lateinisch: salus) war zur Zeit, als Johannes sein Evangelium schrieb, Bestandteil der politischen Ideologie des römischen Imperiums. Die allgemeine Wohlfahrt, die Rettung des Menschengeschlechts, sein Schutz und seine Sicherheit hängen an der Unversehrtheit und Wohlbehaltenheit des Kaisers, für die deshalb feierliche Rituale vollzogen werden. Das „Heil“, die „Rettung“, kommt vom Kaiser aus Rom. Gegenüber den Juden hatte Rom seine unwiderstehliche Macht vor nicht langer Zeit demonstriert. Für Johannes kommt das Heil dennoch nicht vom mächtigen Rom, sondern „die Rettung gibt es von den Juden her“.
Leider nutzt Wengst an dieser Stelle nicht die Chance, auch die Befreiung Israels politisch von den jüdischen Schriften her zu begreifen – und zwar als die Befreiung aus der Unterdrückung und Ausbeutung durch die römische Gewaltherrschaft selbst. Stattdessen sieht er offenbar das durch Jesus herbeigeführte „Heil“ lediglich als religiös-soziales Kontrastprogramm zur Versorgung der römischen Untertanen mit Sicherheit und Wohlfahrt durch den Kaiser.
Zur als selbstverständlich vorausgesetzten Annahme von Wengst, Jesus ergreife in Vers 22 als Vertreter der Juden Partei gegen die Samaritaner, stellt Hartwig Thyen (T258) zunächst fest, dass sie unter den Exegeten „höchst umstritten“ ist und „weiterer Klärung“ bedarf. Betont Jesus hier wirklich den „heilsgeschichtlichen Vorrang Jerusalems“? Viele Ausleger bestreiten
die Möglichkeit, die hymeis {ihr} mit den Samaritanern und die hēmeis {wir} mit den Juden zu identifizieren, weil Jesus sich damit ja in diese hēmeis einschlösse. Deshalb sehen sie in dem ,Wir‘ – in vermeintlicher Analogie zu Joh 3,11 – eine Referenz auf die Christen im Gegensatz zu Samaritanern und Juden.
Thyen jedoch (T259) hält es „angesichts der präzisen Unterscheidung der Zeiten in diesem Evangelium doch wohl“ für „kaum denkbar“, <373> dass
der Evangelist, der seine kommentierenden Bemerkungen zu Worten oder Taten seines Protagonisten stets als solche erkennbar macht, Jesus hier derart unvermittelt aus der erzählten Zeit seines irdischen Lebens in seine eigene nachösterliche Zeit des Erzählens versetzt und ihn zum Sprachrohr des Glaubens „der Christen“ gemacht haben sollte…
Wie Wengst wendet sich auch Thyen gegen die Ausscheidung des „ganzen V. 22 oder nur dessen begründenden Satz: „denn das Heil kommt von den Juden“ als eine sekundäre und“ angeblich „gänzlich unjohanneische Glosse aus dem Evangelium“. Dagegen spricht vor allem die Schwierigkeit, „erklären zu müssen, wie denn diese vermeintlich späte Glosse, noch dazu gegen den wachsenden antijudaistischen Trend der Folgezeit, in ausnahmslos alle uns bekannten Handschriften Eingang gefunden haben soll.“ Weiter argumentiert Thyen (T260):
Auf die Nähe des Satzes: hoti hē sōtēria ek tōn Ioudaiōn estin {denn das Heil kommt von den Juden}, zu Ps 75,2 (LXX): gnōstos en tē Ioudaia ho theos {Gott ist in Juda bekannt} machen Brown und Barrett aufmerksam und sehen – wie Schnackenburg und Lindars – in dem adversativen alla {aber}, das den folgenden V 23 eröffnet, die Bestätigung dafür, daß V. 22 genuiner Bestandteil des Textes sein muß, weil das alla signalisiere, daß die kommende eschatologische Stunde die heiligen Stätten Samarias und Jerusalems relativieren und den Streit um ihre Prioritäten obsolet machen werde. Gleichwohl gilt aber, daß damit der heilsgeschichtliche Vorrang der Juden nicht aufgehoben sein wird.
Damit hält Thyen ähnlich wie Wengst an der Einsicht fest, dass
für unseren Erzähler ein jüdischer Messias, der schon in der vergangenen Geschichte seines Volkes stets präsent war (vgl. Joh 8,56; 12,41), die Seinen auch in aller Zukunft mit seines Vaters erwähltem Volk verbinden und ihm verpflichten wird (siehe unten zu 19,25-27).
Allerdings geht er dabei doch selbstverständlich davon aus, dass „die Seinen“ Jesu mit den späteren Christen im Unterschied „zu seines Vaters erwähltem Volk“, also den Juden, zu identifizieren sind, als ob bereits Johannes eine solche religiöse Trennung im Sinn gehabt hätte.
Weder Wengst noch Thyen können in meinen Augen nachvollziehbar begründen, bis zu welchem Grad und aus welchem Grund sich Jesus hier mit den Juden und ihrem Vorrang in Bezug auf das „Heil“ gegenüber den Samaritanern zu identifiziert. Ton Veerkamp <374> gelingt das, indem er konsequent vom politisch-religiösen Hintergrund des judäisch-samaritanischen Konflikt ausgeht und die Rolle des judäischen Messias Jesus in diese Verstrickungen hineinzeichnet.
Zunächst betrachtet er den Doppelsatz: „Ihr verneigt euch vor dem, wovon ihr kein Wissen habt. Wir verneigen uns vor dem, wovon wir Wissen haben“ mit einigem Befremden, da er das soeben betonte „Weder… noch“ wieder aufzuheben scheint. Wird hier nicht „die Perspektive“ zerstört, „die Jesus seinem und ihrem Volk eröffnet hatte“?
Nun scheint es doch, als ob von der Frau und ihrem ganzen Volk verlangt wird, die Priorität der Judäer anzuerkennen. Es scheint kein Zweifel daran zu bestehen, was mit wir und ihr gemeint ist. Es geht um Bewusstsein (eidenai, „wissen“), oder besser, um Bewusstseinsinhalte. Wir wissen, worum es politisch geht. Unser Bewusstsein hat erstens die Befreiung (sōteria) zum Inhalt und zweitens, dass sie von den Judäern kommt. „Gott“ in Israel ist die Freiheit Israels.
Das Problem besteht darin, in welcher Weise nach Johannes die Befreiung für Israel in seiner Gegenwart kommt.
Sie kommt … nicht von den Judäern an sich, im allgemeinen, von dem Judentum überhaupt, sondern von einem ganz bestimmten Judäer, dem Messias Jesus ben Joseph aus Nazareth, Galiläa. Und dann von jenen ganz bestimmten Judäern, den Schülern des Jesus ben Joseph. Wir bedeutet Jesus und die, die folgen. Das bedeutet natürlich nicht die Christen! Es bedeutet diese ganz bestimmten Juden.
Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen einer Auslegung, die Thyen ablehnt, als ob das „Wir“ Jesu hier bereits die spätere christliche Kirche meint, und der jüdisch-messianischen Lektüre Veerkamps, die ernst nimmt, dass sich der Evangelist und seine ursprünglichen Adressaten noch ganz und gar als auf Israel und den befreienden NAMEN ausgerichtete Judäer betrachten. Sie missionieren nicht unter Juden und Samaritanern für eine neue Religion, sondern sie werben sowohl um ihre Mit-Juden als auch um die Samaritaner, sich einem erneuerten Gesamt-Israel aus beiden Völkern anzuschließen, das der Messias Jesus zusammenführt. Aber diesem Werben scheinen unter den gegebenen Umständen unüberwindbare Schwierigkeiten entgegenzustehen:
Durch den verheerenden Konflikt können die Samaritaner nicht sehen, dass von irgendwelchen Judäern überhaupt so etwas wie Befreiung kommen könnte; von denen, so meinen sie, käme nur Zerstörung. Deswegen halten sie sich an Traditionen, die keine Zukunft haben. Ihr Heiligtum ist und bleibt zerstört, genauso wie das Heiligtum in Jerusalem zerstört und als solches auch nie wieder aufgebaut werden wird. Für viele Judäer war Jesus kein Judäer, weil er sich nicht an der Vergangenheit orientiert. Die Judäer sagten zu ihm: „Sagen wir es nicht richtig, dass du ein Samaritaner und dass du besessen bist?“ 8,48. Für die Judäer war Jesus ein verrückter Samaritaner, für die samaritanische Frau ist er Judäer. Beide Völker lehnen ihn – zunächst – ab. Das ist das Dilemma der messianischen Bewegung im Land Samaria, und der Grund dürfte der judäische Ursprung der Bewegung gewesen sein.
Was bedeutet im Rahmen einer solchen Auslegung der Halbsatz, „dass die Befreiung von den Judäern her geschieht“, wie Veerkamp ihn übersetzt? Dazu geht er zunächst auf Friedrich-Wilhelm Marquardt ein, der an der traditionellen Übersetzung „denn das Heil kommt von den Juden“ festhält und das Anliegen verfolgt, „den christlichen Glauben aus seiner antisemitischen und für die Juden bis heute tödlichen Verkrampfung und so aus seiner Unfruchtbarkeit für die Welt zu befreien.“ Auf Marquardt hatte sich auch Wengst zustimmend berufen (W144, Anm. 190), indem dieser „gezeigt [hat], wie diese Aussage als Motto für die Christologie fruchtbar gemacht werden kann“. <375> Nach Veerkamp muss über Marquardt hinausgegangen werden, denn
seine „dogmatische“ Lektüre – im besten Sinne des Wortes – führt nicht zum Verständnis unserer Erzählung. Das „wir“ ist hier keine homogene jüdische Größe, was im Kontext des Johannesevangeliums auch nicht anders zu erwarten ist. Es ist das „wir“ der messianischen Gemeinde, die weiß, dass sie judäischen Ursprungs ist und das weder verleugnen will noch kann. Nur so ist sie eine Bewegung für und in Israel gewesen, nur so eine konkret-politische Befreiungsbewegung des Volkes Israels, das mehr ist als das Volk Judäas.
Dieses „mehr“ ist also nicht als Überwindung einer unzureichenden jüdischen oder auch samaritanischen Religion zu verstehen, die letzten Endes auf eine jenseits-orientierte Eschatologie hinausläuft, sondern als die Sammlung ganz Israels für das Leben der kommenden Weltzeit:
Das weder – noch weist über den Gegensatz zwischen Judäa und Samaria hinaus, freilich nicht in der Form eines christlichen, alle Gegensätze überwindenden Jenseits. Das „Jenseits“ ist für Johannes das Diesseits „ganz Israel in einer Synagoge bzw. einem Hof“, der Inhalt seines politischen Programms (11,52 bzw. 10,11-16). Diese messianischen Judäer wissen, vor wem sie sich verneigen, indem sie wissen, dass das historisch reale Heiligtum, das emporion, zum Markt, geworden war und zerstört wurde, ersetzt wurde durch das in drei Tagen aufgebaute Heiligtum des „Körpers des Messias“, d.h. der messianischen Gemeinde (2,18ff.).
Worin sieht Veerkamp aber nun den entscheidenden Unterschied zwischen dem „wir“ und dem „ihr“, das Jesus hier im Blick auf Judäer und Samaritaner verwendet?
Der Messias ruft die Judäer nicht dazu auf, auf ihren Ursprung zu verzichten und so eine neue Identität zu erhalten, sondern endlich ihrem Ursprung als Kinder Israels gerecht zu werden und die verrottete „Marktwirtschaft“, zu der das Haus des Vaters geworden ist, zu verlassen. Diesen Kampf um ihren eigenen Ursprung führen die Samaritaner nicht, sie wissen nicht, was sie politisch gesprochen eigentlich tun, sie wissen also nicht, was eigentlich bei ihnen los ist, „wem sie sich verneigen“. Der Hellenismus hat das Land Samaria in einer Weise kaputtgemacht, dass es nicht mehr weiß, was es ist und sein soll.
Genau diese samaritanische Situation ergibt sich bereits aus dem Gesprächsgang 4,16-18 über den Mann, der kein Mann ist, sondern ein Besitzergott, und zwar gerade weil der Evangelist die israelitischen Ursprünge Samarias so ernst nimmt, dass es mit Judäa in einem Gesamt-Israel zusammengeführt werden soll.
↑ Johannes 4,23-24: Die Verneigung vor dem VATER im Geist und in der Wahrheit
4,23 Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt,
dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden
im Geist und in der Wahrheit;
denn auch der Vater will solche Anbeter haben.
4,24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
[21. Mai 2022] In den beiden Versen 4,23-24 geht es weiter um die Anbetung des Vaters bzw. um die Verneigung vor ihm (weitere fünf Mal erscheint das Wort proskynein!), aber nun betont Jesus zwei Mal wortwörtlich, dass diese Anbetung en pneumati kai alētheia, „in Geist und Wahrheit“ erfolgen muss. Das wiederholte „in“ und der bestimmte Artikel in der Lutherübersetzung entsprechen nicht dem griechischen Original. Mitten drin steht auch noch der kleine Satz pneuma ho theos, wörtlich: „Geist der Gott“. Insgesamt stellen diese Verse die Exegese vor große Herausforderungen, mit denen Wengst, Thyen und Veerkamp wieder in sehr unterschiedlicher Weise umgehen.
Klaus Wengst ist es zunächst wichtig (W144), dass durch das „Aber“ in Vers 23 die eben geäußerte Aussage über „die Rettung“, die „es von den Juden her“ gibt, nicht eingeschränkt wird. Er betont, dass „immer noch die samaritische Frau als Repräsentantin ihres Volkes angeredet ist“, woraus er (Anm. 192) meint den Schluss ziehen zu können, „dass auch das Folgende nicht in Hinsicht auf Juden gesprochen wird.“ Wie also eben angeblich nur den Samaritanern die Zeit angekündigt wird, da sie „weder auf dem Garisim noch in Jerusalem anbeten werden“, soll nun also auch der Satz: „Aber die Stunde kommt und ist jetzt, da die wahrhaftig Anbetenden den Vater in Geisteskraft und Wahrheit anbeten werden“ nicht den Juden, sondern nur den Samaritanern gelten.
Die Absicht hinter dieser Argumentation ist offenbar eine doppelte: Einerseits will er einer antijüdischen Auslegung entgegenwirken, als ob Juden Gott noch nicht als ihren Vater „in Geisteskraft und Wahrheit“ angebetet hätten; andererseits sieht er die Voraussage dieses „Jetzt“ bereits am Ende dieser Erzählung erfüllt, wenn „Samariter aus Sychar Jesus als ‚den Retter der Welt‘“ bekennen. In diesem Bekenntnis (W145) erkennen sie das „Wirken Gottes“ durch Jesus an und verlassen sich darauf, wodurch sie jetzt schon die „Geisteskraft der Wahrheit“ erfahren, die Jesus „in den Abschiedsreden … seinen zurückbleibenden Schülern … als Beistand“ verheißen wird. Wengst deutet damit an, dass die Samaritaner hier nicht nur als erste Vertreter der Völkerwelt zu den Juden hinzuberufen werden, sondern im schon „jetzt“ erfolgenden Geistempfang sogar den jüdischen Schülern Jesu voraus sind.
Das Stichwort „Vater“ veranlasst Wengst zu zwei Anmerkungen. Zuzustimmen ist ihm (Anm. 193) in seiner Kritik an Marion Moser, <376> die „die Bezeichnung Gottes als ‚des Vaters‘ an dieser Stelle in unsäglicher Weise“ betont:
„Durch die letztgültige Offenbarung in und durch Jesus zeigt Gott ein neues Gesicht: Er wird zum Vater, was eine durch Nähe bestimmte Beziehung zu ihm ermöglicht“.
Gegen eine solche Sicht des Gottes Israels verweist Wengst einerseits auf Jesaja 63,16 und andererseits auf verschiedene Monographien, die herausstellen, dass Gott bereits im TeNaK und anderen jüdischen Schriften als Vater verehrt wurde. <377>
Die andere Anmerkung (Anm. 194) finde ich insofern seltsam, als Wengst die dreimalige Erwähnung des „Vaters“ in den Versen 21 und 23 dadurch veranlasst sieht, dass hier „das Bekenntnis zu Jesus im Blick ist“, weil damit „für ihn implizit die Relation zum ‚Sohn‘ gegeben“ ist. „Am Ende von V. 23 unterstreicht er, dass ‚auch der Vater solche verlangt, die ihn so anbeten‘.“ Recht hat Wengst natürlich damit, dass die Beziehung von Gott als dem Vater Jesu für das Johannesevangelium von zentraler Bedeutung ist. Aber wenn Jesus an dieser Stelle auf den Vater nicht ausdrücklich als seinen Vater Bezug nimmt, mag es doch sein, dass es gerade hier auch nicht direkt um das Bekenntnis zu Jesus geht, sondern um die Verneigung vor dem Gott Israels und seinem befreienden NAMEN.
Bei genauerem Nachdenken mag ich Wengst sogar noch einen weiteren Schritt entgegenkommen und einräumen: In der Tat ist der Evangelist Johannes der festen Überzeugung, dass nur durch das Vertrauen auf den Messias Jesus die Verneigung vor Gott wirklich vollzogen wird. Wenn das aber so ist, ist wiederum überhaupt nicht einzusehen, warum nur die Samaritaner und nicht auch die Judäer in diesen Versen angesprochen sein sollen, denn spätestens seit der Tempelreinigung ist klar, dass auch viele unter ihnen es an konsequenter Treue zu Gott fehlen lassen. Eine solche Sicht der Dinge hat nichts mit Antijudaismus, sondern mit innerjüdischer Kritik im Geiste der jüdischen Propheten zu tun.
Den kurzen Satz (W145) pneuma ho theos übersetzt Wengst mit „Gott ist Geisteskraft“, ansonsten verliert er dazu kein Wort. Stattdessen gibt er zusätzliche Erläuterungen zur Anbetung „in Geisteskraft und Wahrheit“, von der in Vers 24 nochmals die Rede ist. Diese ist
nicht ortlos. Sie macht sich nach dem Johannesevangelium an Jesus fest. Darum geht es hier immer und immer wieder: den Juden Jesus als Ort der Präsenz Gottes darzustellen, zu bezeugen, dass im Reden, Handeln und Erleiden Jesu Gott selbst, der Gott Israels, auf den Plan getreten ist. Und wie die Tradition von Jerusalem als dem Ort des Gebetes das Hören der Gebete durch Gott hervorhebt, weil dort das Tor zum Himmel ist, so betont Johannes mehrfach die Erhörungsgewissheit des Gebetes im Namen Jesu. Der Ort der Anbetung Gottes ist dann also die im Namen Jesu versammelte Gemeinde.
Hat Wengst hier vergessen, was er wenige Zeilen zuvor über die Verse 21-23 gesagt hat, dass Jesus in ihnen nur die Samaritaner anspricht? Auf einmal soll in Vers 24, der mit dem vorherigen Vers eine untrennbare Einheit bildet, Jesus nun doch den Juden bezeugt werden, und zwar soll er – in Gestalt der Gemeinde Jesu – den Ort der Gegenwart des Gottes Israels darstellen. Nach der bisher von Wengst vertretenen Logik macht das innerhalb des Gesprächs mit der Samaritanerin überhaupt keinen Sinn.
Als einziger Grund für eine dermaßen widersprüchliche Argumentation drängt sich mir auf, dass Wengst, nachdem er soeben die Juden vom Vorwurf meinte entlasten zu müssen, sie würden Gott nicht als ihren Vater anbeten, und zugleich die Samaritaner in ihrem geisterfüllten Bekenntnis zu Jesus als dem Retter der Welt gewürdigt hat, nun doch auch die Frage zu klären versucht, wie „religiöse Praxis“ ohne den konkreten Ort des Tempels in Jerusalem möglich ist, da dieser ja zur Zeit des Johannes längst zerstört war. In diesem Zusammenhang verweist Wengst einerseits darauf, dass für den Evangelisten „Jesus die Funktion des Tempels als Ort der Präsenz Gottes“ übernommen hat:
Diesen Ort „hat“ die Gemeinde aber nicht anders als in den Worten des Evangeliums, das seine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte hat ihren sehr bestimmten Ort im Land Israel. Das berechtigt allerdings christliche Israelpilger nicht, an Erinnerungsstätten Jesu so zu tun, als gehörten sie ihnen. Jesus war Jude und also Teil seines Volkes.
Diese Worte klingen gut, und ich kann ihnen als Befürworter des interreligiösen Dialogs zustimmen. Aber gehen sie nicht doch am Johannesevangelium mit seinen scharfen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen mitjüdischen Gegnern vorbei? Mir kommt es so vor, als gieße Wengst hier konfliktverschleiernde religiöse Zuckersoße über eine Auseinandersetzung, deren politische Tragweite er nicht ernst genug nimmt. Dazu passt eine Bemerkung von Wengst über „Stätten besonderer Glaubenserfahrungen und deshalb Stätten erinnernder Zeugenschaft“, die es später auch „in der Geschichte des Christentums“ gab:
Wo es gute ökumenische Partnerschaft gibt, haben in dieser Hinsicht evangelische Gemeinden von und mit katholischen Gemeinden Wallfahrten wieder zu schätzen gelernt.
Auch ich schätze solche Erfahrungen, habe aber nicht den Eindruck, dass sie zur Erhellung des Sinnes unserer Johannes-Stelle Sinnvolles beitragen.
Erst in seinem letzten Absatz zu diesem Thema steuert Wengst doch noch einen weiterführenden Gesichtspunkt zur Auslegung der Anbetung von Gott „in Geisteskraft und Wahrheit“ bei, nämlich indem er daran erinnert, dass diese Formulierung etwas mit der „Verlässlichkeit und Treue“ Gottes zu tun hat, allerdings ohne hier nochmals ausdrücklich zu betonen, dass allein dieses Verständnis des Wortes alētheia, hebräisch ˀemeth, „Treue“, dem jüdischen TeNaK angemessen ist.
Die Art, wie Wengst von dieser Treue redet, steuert dann doch wieder auf seinen Lieblingsgedanken zu, dass der Gott Israels in der Auferweckung Jesu zum „Gott für die Welt“ wird, worauf die Samaritaner am Ende unserer Szene in ihrem Bekenntnis zu Jesus als „Retter der Welt“ in seinen Augen bereits vorwegnehmend hinweisen. Dazu Wengst wörtlich (W145f.): „Gott selbst, der Geisteskraft und nicht ‚Fleisch‘ ist“, hat sich im „Blick auf Jesus“
so als wahrer, als treuer und verlässlicher Gott erwiesen, dass er ihn nicht dem Tod am Kreuz überließ, sondern ihn genau dort erhöht und verherrlicht hat in der Auferstehung. So ist er Gott für die Welt geworden. Von daher ist die Darstellung der zu Jesus kommenden und ihn als „Retter der Welt“ bekennenden Samariter am Ende dieses Zusammenhangs proleptisch {vorgreifend}. Darauf weist auch die Erwähnung der „Stunde“, die ja die Stunde der Kreuzigung und Auferweckung Jesu ist.
Wie bereits gesagt, bezweifle ich, dass das Johannesevangelium den kosmos im Sinne der Völkerwelt als Missionsfeld Jesu ins Auge fasst. Abgesehen davon ist das, was Wengst weiter von der Geisteskraft und ihrem Zusammenhang mit dem Gott Israels sagt, beherzigenswert:
Die von Jesus seinen Schülern verheißene Geisteskraft wird ihnen vom auferweckten Gekreuzigten eingehaucht (20,22). Von ihm hat die Gemeinde, für die Jesu Schüler stehen, ihren Lebensatem, der sie mit Israels Gott verbindet. In dieser Geisteskraft ist Jesus nach Ostern als der da, der er bis zu seinem Kreuz war: als der, der der Welt die Liebe Gottes nahebringt (3,16). Daher ist das Bekenntnis zu Jesus als dem Retter der Welt Anbetung Gottes in Geisteskraft und Wahrheit. Die Präsenz Gottes in Jesus kann als Präsenz des Gottes Israels nur erkannt und festgehalten werden, wenn keinen Augenblick das Judesein Jesu vergessen wird. Sonst wird aus dem Gott Israels, der gewiss der Gott aller Welt ist, ein Allerweltsgott und aus dem jüdischen Menschen Jesus ein Universalmensch, ein konturenloses Schemen, in das eigene Bilder projiziert werden.
Richtig daran ist im Blick auf das Verhältnis von Israel und dem kosmos die Erkenntnis, dass der Gott Israels zwar „aller Welt Gott“, aber kein „Allerweltsgott“ ist. Damit ist im Johannesevangelium aber zunächst noch keine Weltmission verknüpft, sondern die Hoffnung auf die Sammlung und Befreiung ganz Israels (einschließlich Samarias und vielleicht noch „einiger Griechen“, 12,20) von der versklavenden Weltordnung, die auf der gesamten Menschenwelt einschließlich Israels lastet.
Für Hartwig Thyen (T263f.) endet mit den Versen 23 und 24 ein langer und durch den Evangelisten kunstvoll gerahmter Gesprächsbeitrag Jesu, der mit den beiden letzten Worten in Vers 24, dei proskynein {wörtlich: es ist nötig anzubeten} „nicht ohne Ironie in Umkehrung der Wortfolge“ die Kritik der Samaritanerin an Jerusalem als der Stätte, hopou proskynein dei, „wo es anzubeten nötig ist“, aufgreift.
Anders als Wengst setzt Thyen es als selbstverständlich voraus (T260), dass sich die Aussage von Vers 23 sowohl auf die Samaritaner als auch auf die Juden bezieht; trotz des „heilsgeschichtlichen Vorrangs Israels (V. 22)“ ist die „künftige Anbetung“ Gottes, des Vaters, nicht mehr durch den „Zionstempel Jerusalems“ legitimiert, genau so wenig wie durch die „,Väter‘, die die Samaritanerin zur Legitimation des Kultes auf dem Garizim beschworen hatte“.
Zur Zeitangabe
erchetai hōra {es kommt die Stunde} aus V. 21 fügt er nun hinzu: kai nyn estin {und sie ist jetzt}. Die Paradoxie dieser doppelten Bestimmung der ,Zeit‘ der eschatologischen {endzeitlichen} Stunde darf weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin aufgelöst werden. Darum wird durch das kai nyn estin die Stunde nicht etwa total ,vergegenwärtigt‘ als solle damit die Verheißung ihres ,Kommens‘ außer Kraft gesetzt werden. Die Stunde bleibt vielmehr zukünftig, sie wird kommen. Gegenwärtig und wirksam ist sie einstweilen allein in dem ,Sohn‘, der hier die künftige Anbetung des ,Vaters‘ durch die alēthinoi proskynētai {wahren Anbeter} verheißt…
Dabei spricht Jesus mit der Stunde, die kommen soll (T261), die „Stunde seiner ‚Verherrlichung‘“ an, „in der er sterbend das ihm von seinem Vater aufgetragene ,Werk‘ vollenden wird (19,30). Denn erst diese Stunde des ‚Weggehens‘ Jesu eröffnet dem Geist ja die Möglichkeit seines „Kommens“ (16,7).“
Zur „Bedeutung der verheißenen Anbetung ‚des Vaters in Geist und Wahrheit‘“ referiert Thyen zustimmend die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung von Ignace de la Potterie. <378> Da „in der Wendung vom proskynein tō patri en pneumati kai alētheia {den Vater in Geist und Wahrheit anbeten} nur eine Präposition die beiden ihr folgenden Substantive regiert“, ist [704] der „Ausdruck als Hendiadyoin“ zu begreifen:
Das darf freilich nicht in dem Sinne geschehen, als sei alētheia {Wahrheit} eine Art adverbialer Näherbestimmung von en pneumati {im Geist} und mit alēthōs {wahrhaftig, wahrlich} synonym. Wie bei ähnlichen Doppelausdrücken, die für das Corpus Iohanneum typisch sind (vgl. hē charis kai hē alētheia {die Gnade und die Wahrheit} [1,14.17], hē alētheia kai hē zōē {die Wahrheit und das Leben} [14,6], en ergō kai alētheia {in Tat und Wahrheit} [1Joh 3,18], en alētheia kai agapē {in Wahrheit und Liebe} [2Joh 3]), liegt deren Akzent vielmehr stets auf dem letzten ihrer Substantive, in unserem Fall also auf alētheia.
Wie aber ist das Wort alētheia zu deuten? Die „seit der Zeit der griechischen Väter“ von vielen Auslegern vertretene „interpretatio graeca {griechische Deutung}“ geht davon aus, „als bezeichne es die ,wahre göttliche Wirklichkeit‘ im Unterschied zu deren bloßen typoi {Vorformen} und schattenhaften Präfigurationen im jüdischen Kult ebenso wie in allen antiken Kulten.“ Demgegenüber weist de la Potterie [701f.] „den genuin jüdischen Hintergrund“ des Wortes alētheia bei Johannes nach. So sind (T261f.)
der spezifisch johanneische Gebrauch des Lexems alētheia und zumal die Wendungen en alētheia {in Wahrheit} und poiein tēn alētheian {die Wahrheit tun} gut jüdisch und aus geläufigen Prädikationen der Tora auf Jesus übertragen… Jesus selbst in der Einheit seines Werkes und seiner Worte ist „die Wahrheit“ in Person (14,6). Dabei geht es aber gerade nicht um die Offenbarung seiner ,göttlichen Natur‘ und seines ,transzendenten Wesens‘, sondern um das Offenbarwerden dieses Menschen als des von der „Gnadengabe der Wahrheit erfüllten“ fleischgewordenen Logos (1,14).
So sehr ich es begrüße, dass Thyen unter Rückgriff auf de la Potterie den jüdischen Ursprung des johanneischen Begriffs alētheia hervorhebt, finde ich es doch bedenklich, dass hier mit keinem Wort auf den Hauptaspekt dieses Wortes eingegangen wird, der sich auf die Treue des Gottes Israel zu seinem Volk bezieht. Stattdessen erfolgt die Deutung der Fleischwerdung des Logos in Jesus in sehr abstrakter Form. Immerhin (T262) lehnen de la Potterie und Thyen die Unterscheidung verschiedener Formen der Wahrheit ab, deren höhere Erkenntnis allein einer Elite von geistbegabten „Pneumatikern“ vorbehalten ist [705]:
Wegen dieses einzigartigen personalen Bezuges darf alētheia auch nicht im abstrakten Sinne „wahrer Gotteserkenntnis” verstanden und dementsprechend zwischen einer proskynēsis kata alētheian {Anbetung gemäß der Wahrheit} und einer Anbetung kata planēn {gemäß des Irrtums} unterschieden werden…
Zwar enthält „die Bestimmung von alētheia als ,wahre (Gottes-)erkenntnis‘ natürlich gleichwohl ein Wahrheitsmoment“:
Aber diese ,wahre Erkenntnis‘ und ,Erkenntnis der Wahrheit‘ verdankt sich weder der göttlichen Natur des Pneumatikers noch irgendeinem Vermögen der transzendentalen Subjektivität des Ich zur Konstitution seiner Gegenstände, sondern allein der „Offenbarung Jesu“.
An dieser Stelle kommt Thyen nun wirklich auf den entscheidenden Punkt zu sprechen, der das jüdische Verständnis von alētheia von seiner griechischen Deutung unterscheidet. Jenseits aller abstrakt-philosophischen Wahrheits- und Wesensdefinitionen geht es nämlich um die Frage, von welchem Gott hier überhaupt die Rede ist. Dazu schreibt Thyen klar und deutlich:
Wir wählen absichtsvoll diese ambivalente Genetiv-Verbindung „Offenbarung Jesu“, weil das ,Objekt‘ dieser Offenbarung ja nicht etwa ein bis dato ,unbekannter Gott‘ ist, den Jesus erst bekanntmachen und bezeugen müßte. Denn wie Jesus als Jude eben zu der Samaritanerin gesagt hatte: „Wir (Juden) wissen, was wir anbeten“ (V. 22), so gibt es „merkwürdigerweise im ganzen Johannesevangelium keine Stelle, wo etwa von einem martyrein Jesu peri patros {Bezeugen Jesu über den Vater} die Rede wäre, immer nur vom Umgekehrten: von einem martyrein {Bezeugen} des Vaters für ihn und von seinem martyrein peri heautou {Bezeugen über sich}. Jesus, der unbekannte Sohn Gottes, wird bekannt durch den bekannten Vater“ <379> … Objekt der „Offenbarung Jesu“ ist also gerade der fremde und unbekannte Mensch Jesus selbst und vermittelt durch ihn diejenige des bekannten Gottes Israels als des „Vaters, der ihn gesandt hat“.
Von daher müsste man von Thyen erwarten können, dass er konsequent alles, was von Jesus als dem Messias des Gottes Israels zu sagen ist, vom befreienden NAMEN dieses Gottes her begreift und nicht umgekehrt diesen Gott von einer christlichen Interpretation Jesu her völlig umdeutet.
Keinesfalls darf Thyen zufolge „die verheißene Anbetung ,in Geist und Wahrheit‘“ im „Gegensatz zu allem an bestimmte Orte und Zeiten gebundenen Rituellen als ein rein spiritueller Kult verstanden“, also der Geist im Rahmen eines Dualismus von Fleisch und Geist im Sinne Platons nur „als Ausdruck der ‚Innerlichkeit‘ begriffen“ werden, wie es etwa Theodor Zahn <380> tut, den Thyen folgendermaßen zitiert:
„Erst diejenige Anbetung, welche von dieser Bindung an Örtlichkeiten und Äußerlichkeiten befreit ist und also en pneumati sich vollzieht, geschieht en alētheia. Dazu soll es dereinst kommen. Daß der im Fleisch lebende Mensch nicht anders als an einem bestimmten Ort der Erde beten kann, sei es im Tempel oder im Kämmerlein (Mt 6,6); und daß gemeinsame Anbetung nicht möglich ist ohne dafür bestimmte Orte, Zeiten und Formen, ist so selbstverständlich, daß Jesus nicht nötig hatte, das en pneumati durch Erinnerung an diese Trivialitaten abzuschwächen. Es war doch ein gewaltiger Schritt zu dem geistigen und wahren Kultus hin, welchen er hier in Aussicht stellte“.
Dagegen wendet Thyen ein (T262f.):
Weil aber das pneuma, von dem hier die Rede ist, nicht des Menschen Innerlichkeit bezeichnet, sondern den endzeitlichen ,Geist der Wahrheit‘, den der Auferstandene, die fleischgewordene Wahrheit, den Seinen ,einhauchen‘ und den er ihnen als das Medium ihrer neuen ,Geburt von oben‘ verleihen wird [704], erklärt Lindars zu Recht, nicht der Kontrast zwischen den Formen und Zeremonien des Tempels zu dem vermeintlich „geistigen Gottesdienst“ der Kirche werde hier beschrieben, sondern der Gegensatz zwischen einem Gottesdienst „fern von Christus“ und einem solchen „innerhalb seiner Sohnesantwort auf den Vater, die sich bald in seiner Passion offenbart“ <381> …
Zudem kritisiert Thyen (T263) an der Auffassung Zahns, dass er die Bedeutung der Worte kai nyn estin, „und das ist jetzt“, übersieht und „die ,Anbetung in Geist und Wahrheit‘ zu Unrecht in ein transmundanes {jenseitsweltliches} ‚Dereinst‘“ vertagt:
Aber mit dem erhörungsgewissen Gebet „im Namen Jesu“ (14,13; 15,16; 16,23f.26) wird der ,Vater‘ von den alēthinoi proskynētai {wahren Anbetern} als „im Fleisch lebender Menschen“ durchaus schon in Zeit und Geschichte ,in Geist und Wahrheit‘ angebetet werden.
Daher sind nach Thyen
die kreatürlichen Notwendigkeiten, seinen Durst mit irdischem Wasser zu löschen und seinen Hunger mit irdischer Speise zu stillen, sein Beten an bestimmten Orten und als ein gemeinsames zu bestimmten Zeiten und in geprägten Formen zu verrichten, sowenig „Trivialitäten“ wie Jesu Wege zu den Pilgerfesten seines Volkes „hinauf nach Jerusalem“ und der Schrei des Gekreuzigten: „Mich dürstet!“. Vielmehr verwandelt gerade die Anbetung des Vaters in Geist und Wahrheit all diese vermeintlichen Trivialitäten in sprechende Symbole und Zeichen des Kommenden.
Mit diesem „Kommenden“ meint Thyen allerdings nicht das, was in den jüdischen Schriften mit der kommenden Weltzeit von Freiheit, Recht und Frieden auf der Erde unter dem Himmel erwartet wird. Vielmehr deutet er mit einem Zitat von Teresa Okure an, dass die Glaubenden erst jenseits von „Zeit und Geschichte“ und jenseits der Grenze des Todes das wahre Leben durch den Glauben an Jesus erlangen können: <382>
„Aufgrund ihres Glaubens an Jesus ist der Tod jedoch nicht mehr als Endpunkt zu sehen, sondern stellt den letzten Schritt im Prozess des Übergangs vom Tod zum Leben durch den Glauben an Jesus dar (5,25.28f; 11,25f)“.
Gerade die hier von Okure zitierten Johannes-Stellen werden aber genau zu überprüfen sein, ob sie wirklich in diesem Sinne eines erst durch Jesu Auferstehung zu erlangenden ewigen Lebens im Himmel zu begreifen sind oder nicht vielmehr als die Erfüllung jüdisch-diesseitiger Hoffnungen auf das Leben der kommenden Weltzeit.
Zur zweiten Hälfte der Verse 23-24 geht Thyen auf das Wort zētein, „suchen“, ein, das sowohl in der Übersetzung der Lutherbibel als auch bei Wengst (W132) praktisch verschwindet, indem sie sinngemäß umschreiben, dass der Vater solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, „haben will“. Nach Thyen (T263) ist dieses
zētein des Vaters kein passives Abwarten, sondern ein aktives Suchen… Dieses Suchen vollzieht der Vater durch Sendung und Werk des ,Sohnes‘. Es ist Grund und Bedingung der Möglichkeit seiner endzeitlichen Anbetung in Geist und Wahrheit als ,Vater‘. Insofern entspricht das ,Suchen des Vaters‘ seinem ,Ziehen‘: oudeis dynatai elthein pros me ean mē ho patēr ho pempsas me helkysē auton {Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat} (6,44), und seinem ,Geben‘: oudeis dynatai elthein pros me ean mē ē dedomenon autō ek tou patros {Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben} (6,65; vgl. 15,1f…).
Im Gegensatz zu Wengst beschäftigt sich Thyen auch näher mit der „Wendung: pneuma ho theos {seine Übersetzung: Gott ist Geist}“, die ihm zufolge ähnlich „wie die Sätze: ho theos phōs estin {Gott ist Licht} (1Joh 1,5), und ho theos agapē estin {Gott ist Liebe} (1Joh 4,16) … „definitorischen Charakter“ hat:
Definiert wird damit freilich nicht jeweils ein abstraktes ,Wesen‘ Gottes, sondern seine verläßliche Relation zu den Menschen und seine Gabe von Geist, Licht und Liebe an sie…
Was Thyen mit dieser Definition meint, erklärt er, indem er auf die Parallele in 1. Johannes 4,16 eingeht. Dort folgt
aus dem Satz, ho theos agapē estin {Gott ist die Liebe} (1Joh 4,16): kai ho menōn en tē agapē en tō theō menei kai ho theos en autō menei {und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm}. Und diese Liebe wird sodann als diejenige bestimmt, hēn echei ho theos en hēmin {die Gott zu uns hat}.
Da wir „dieses wechselseitige ‚Beiben-in‘ … daran erkennen, hoti ek tou pneumatos dedōken hēmin {dass er uns von seinem Geist gegeben hat} (1Joh 4,13)“, dürfte nach Thyen genau dies der „Anbetung in Geist und Wahrheit“ entsprechen.
In meinen Augen gewinnt die Definition der Beziehung Gottes zu den Menschen in dem Ausdruck „Gott ist Geist“ durch die Parallele des wechselseitigen Bleibens des Menschen in Gott und Gottes in ihm allerdings nicht unbedingt an Klarheit, denn dieses „Bleiben-in“ ist ja selber äußerst erklärungsbedürftig. <383>
Und wenn nach Thyen, wie wir vorhin gesehen haben (T262), durch die „Offenbarung Jesu“ kein unbekannter Gott erst bekannt gemacht werden muss, kann dann nicht auch die Annahme fragwürdig sein, dieser Gott Israels werde durch Formulierungen wie „Gott ist Liebe, Licht, Geist“ sozusagen neu definiert? In seiner Auslegung des 1. Johannesbriefs <384> übersetzt Ton Veerkamp daher den Satz ho theos agapē estin nicht mit „Gott ist Liebe“, sondern mit „‚Gott‘ geschieht als Solidarität“ (zur Deutung von agapē als „Solidarität“ vgl. die Auslegung zu Johannes 3,16), um anzuzeigen, dass in erfahrener solidarischer Liebe der immer schon mit seinem Volk Israel solidarische Gott in Erscheinung tritt und nicht etwa ein alttestamentlich strafender Gott nun neutestamentlich als ein „lieber“ Gott umdefiniert wird.
Befragen wir nun Ton Veerkamp <385> auch nach seiner Übersetzung von pneuma ho theos in Johannes 4,24. Dieser Satz hat ihm zufolge „die Form eines Urteilssatzes“ und drückt aus, dass das betont am Anfang stehende pneuma, also das, „was Menschen inspiriert“, zur Bestimmung dessen dient, was ihr „Gott“ ist:
Und was sie als „Gott“ erkennen, als das, worum es eigentlich geht, dem müssen sie politisch huldigen. In Israel ist das der VATER; mit diesem Wort umschreibt Johannes den unaussprechlichen NAMEN.
So gelangt Veerkamp zu seiner Übersetzung: „Als Inspiration wirkt Gott“.
Um diese ungewöhnliche Umschreibung in ihrer ganzen Tragweite zu begreifen und nicht von vornherein als abwegig zu verwerfen, muss Veerkamps Auslegung des ganzen Zusammenhangs ins Auge gefasst werden. Auch für die Anbetung in Geist und Wahrheit schlägt er nämlich eine alternative Wiedergabe und Deutung vor, die voll und ganz den befreienden NAMEN des Gottes Israels ernstnimmt. Genau dieser NAME ist es nämlich, von Johannes mit VATER umschrieben, der den ursprünglichen Adressaten des Johannesevangeliums noch bekannt war und von dem her der zunächst unbekannte Jesus von Nazareth bekannt gemacht wird:
„Es kommt die Stunde – und das ist jetzt! -, dass die, die sich wirklich vor dem VATER verneigen, sich inspiriert und getreu verneigen.“ In Geist und Wahrheit übersetzt man immer. Nicht falsch, aber abgegriffen, verschlissen.
Klarer geben die Worte „inspiriert und getreu“ den Doppelausdruck en pneuma kai alētheia wieder, denn pneuma, hebräisch ruach, „Geist“, meint im jüdischen TeNaK einen Sturmwind der Begeisterung, der Menschen ein neues Bewusstsein verschafft und sie bewegt, und der Inhalt dieses Bewusstseins ist „die Treue Gottes zu Israel“ und umgekehrt die Treue zu diesem getreuen Gott, wobei das Wort „Treue“ sehr zentral die Bedeutung der biblischen Worte alētheia, hebräisch ˀemeth, wiedergibt. Diese „Treue“ wirkt inspirierend. Warum wählt Veerkamp als alternative Übersetzung zu „Geist“ das Wort „Inspiration“?
Inspiration – das Wort enthält das lateinische Wort spiritus (pneuma, ruach) – ist das, was das Handeln, Reden und Denken der Menschen orientiert, von der Treue her, auf die Treue hin. „Gott“ ist das, was die letztendliche Loyalität der Menschen beansprucht, es ist das, worum es einem Menschen eigentlich geht. „Gott“ hat in Israel einen NAMEN, und diesen NAMEN kann man nur aussprechen als: Der aus dem Haus des Sklaventums herausführt (Exodus 20,2), als moschiaˁ jißraˀel, Befreier Israels (Jesaja 45,15).
Das Problem ist aber nun, wie Jesus bereits im Tempel zu Jerusalem feststellen musste und worum es im Gespräch über den Mann der Samaritanerin ging, der kein Mann, sondern ein Baˁal ist, dass man (jedenfalls in den Augen des johanneischen Jesus) weder in Judäa noch in Samaria bereit ist, sich vor Gott als diesem NAMEN, als dem „Befreier Israels“, zu verneigen und sich von seiner Treue inspirieren zu lassen. In seinen Augen würde das erst geschehen, wenn die Menschen in Judäa und Samaria beginnen, auf ihn als den vom NAMEN gesandten Messias Jesus zu vertrauen:
„Gott“ funktioniert aber tatsächlich als alles mögliche andere, als namenlose Götter. Samaria ist aufgerufen, nur diesem NAMEN als „Gott“, als dem, worum es eigentlich geht, zu huldigen.
Solche suche der VATER, „denn Gott“, so Jesus, „darf nur noch als diese Inspiration funktionieren“. Das heißt: sich durch den Befreier und seine Befreiung inspirieren lassen, seine ganze politische Tätigkeit auf diese Befreiung ausrichten, diese Befreiung „Gott“ sein lassen. Es geht in diesem Gespräch nicht um akademische Klarstellung, ob Gott ein „Geist“ sei. Nein: Gott inspiriert durch seine Treue zu seinem Volk, das er befreien will, wie er einst Israel aus dem Sklavenhaus befreite.
Auch Veerkamp stellt die Frage, was denn in diesem Zusammenhang der Satz „Und das ist jetzt?“ bedeuten soll. Seine Antwort lautet:
Christliche Orthodoxie sieht hier einen innerlichen Vorgang: wer sich darauf einlässt, ist „erlöst.“ Das ist nicht ganz falsch. Wer sich diese politische Perspektive zum Lebensinhalt macht, lebt tatsächlich anders. Für ihn ist die Spaltung Israels tatsächlich überwunden.
Was geschieht aber, wenn sich „die Realität der erbitterten Feindschaft dieser vernünftigen Perspektive nicht öffnet“? Dann kann man nach Veerkamp „auf zwei Weisen reagieren“, am Ende nennt er sogar drei:
Einmal kann man sagen: „Alles Illusion“, wie Pilatus: „Was ist schon Treue“, 18,38. Oder man kann diese Perspektive verinnerlichen und die Realität eben diese katastrophale Realität sein lassen. Die zweite Reaktion ist die Entstehung der christlichen Religion. Zwar bleibt die eschatologische Hoffnung auf die Verwandlung der Welt; einstweilen ist von der Welt nichts mehr zu erwarten, und die einstweilige Perspektive der einzelnen Menschen ist das Leben nach dem Tod und der Himmel. Die Frau aus Samaria reagiert auf eine dritte Weise, mit Skepsis.
Zur Reaktion der Samaritanerin kommen wir gleich. Mit der zweiten Reaktionsweise umschreibt Veerkamp ziemlich genau auch die christlich-eschatologischen Vorstellungen der beiden Exegeten Wengst und Thyen. Beide würden allerdings vermutlich den Vorwurf der Befürwortung von Weltflucht weit von sich weisen. Eine solche unterstellt Veerkamp der christlichen Kirche aber auch gar nicht, indem er anmerkt (Anm. 170):
Die Gnosis lässt nicht einmal die Spur einer Weltverwandlung mehr. Alles Materielle ist an sich böse und muss verbrennen. Leben soll und kann nur das Nichtmaterielle, die Seele, das Geistige. So weit ging das Christentum nie.
So weit gehen auch Wengst und Thyen nicht; allerdings nehmen sie nicht die Möglichkeit wahr, dass Johannes mehr will als eine verjenseitigte Eschatologie des Trostes für jeden Sterbenden (die ist bei ihm nicht ausgeschlossen, vielmehr mit Daniel 12,2 jedem auf den Gott Israels Vertrauenden bereits gegeben), indem sich Gott in der Überwindung der Feindschaft zwischen Samaria und Judäa und der Befreiung Gesamt-Israels aus der weltweiten römischen Sklaverei durch den Messias Jesus erneut als der unaussprechliche und unverfügbare herrliche NAME erweist.
↑ Johannes 4,25: Die Erwartung des Messias, der alles verkünden wird
4,25 Spricht die Frau zu ihm:
Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt.
Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen.
[22. Mai 2022] Zu Johannes 4,25 betont Klaus Wengst erneut (W146), dass die Samaritanerin „als Verstehende geschildert wird“. Sie versteht die letzte Äußerung Jesu „als Charakteristikum der Endzeit…, will ihm aber auch nicht einfach zustimmen, sondern nennt die endzeitliche Erwartung ihrer eigenen Tradition“:
Johannes lässt sie dabei jedoch mit „Messias“ einen Begriff gebrauchen, der nicht samaritisch ist, an dem ihm aber selbst im Zusammenhang seines Evangeliums entscheidend liegt. Die samaritische Endzeiterwartung kennt den Propheten wie Mose nach Dtn 18,15.18, aber auch die Gestalt des Taheb. <386> Dieser „Umkehrende“ repräsentiert als solcher die samaritische Gemeinschaft und bewirkt ungeheuchelte Gottesverehrung. Das zeigt der folgende samaritische Text: „Heil der Welt, wenn der Umkehrende und seine Versammlung kommt. Fürwahr der Friede tritt ein, Barmherzigkeit breitet sich aus, das Unglück wird entfernt, die Schlechtigkeit wird weggenommen und der Schöpfer der Welt wird ohne Heuchelei gepriesen.“
Hartwig Thyen geht mit einer solchen ihm zufolge „fragwürdigen messianischen Interpretation des samaritanischen Taheb“ hart ins Gericht, zumal wenn dieser „zudem noch fälschlich mit dem ,Propheten wie Mose‘“ identifiziert wird. Den von Wengst als Gewährsmann angeführten Kippenberg <387> zitiert Thyen wie folgt:
„Joh 4,25 hat mit dem Taheb nichts zu tun. Überhaupt kennen die Samaritaner gar keinen maschiach. Lediglich die Erwartung eines Propheten (Joh 4,19) ist samar., hat aber wiederum mit dem Taheb nichts zu tun“ [303]. Eine Verbindung der Taheb-Erwartung mit Deut 18,15.18 wurde erst nach dem Untergang der Dositheaner im 14. Jh. n. Chr. möglich [273]. Darum kann von einer Selbstidentifikation Jesu mit einem „samaritanischen Messias“ und von einem damit vermeintlich zum Ausdruck gebrachten fast höhnischen Antijudaismus, wie ihn L. Schottroff hier ausmachen will, nicht im Entferntesten die Rede sein. Im Gegenteil! Die Samaritanerin nimmt hier vielmehr Jesu Wort, daß ,das Heil von den Juden komme‘, durchaus positiv auf und redet jetzt von dem Messias, den die Juden als den erwarten, der Israel und den Völkern das Heil bringen wird.
Ähnlich wie Wengst vorhin den Gesprächsgang über den Mann der Samaritanerin sozusagen paartherapeutisch meinte deuten zu können, interpretiert Thyen nunmehr die in Vers 25 geäußerte Einsicht der Frau im Sinne einer psychischen Reifung:
Zum ersten Mal verbirgt sich die Frau nicht mehr hinter der Autorität der ,Väter‘ und wappnet sich nicht mehr mit der samaritanischen Praxis, sondern sagt mit ihrem oida {ich weiß} „ich“; und, wenn auch noch fragend, nimmt sie mit diesem oida zugleich Jesu anfängliches ēdeis {erkenntest, wüsstest} auf: ei ēdeis tēn dōrean tou theou kai tis estin ho legōn soi: dos moi pein, sy an ētēsas auton kai edōken an soi hydōr zōn {Wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann bätest du (umgekehrt) ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser} (V. 10…). Ja, daß sie hier nicht mehr als Repräsentantin des Samaritanismus, sondern als ein durch die Begegnung mit dem fremden Anderen zum Ich gereiftes Individuum spricht, offenbart auch ihr durch das oida {ich weiß} prädizierter Satz, hoti Messias erchetai ho legomenos christos; hotan elthē ekeinos, anangelei hēmin hapanta {daß der Messias kommen wird, das heißt der Gesalbte, und wenn der kommt wird er uns alles kund tun}. Denn, weil die Erwartung des oder eines „Messias“ den Samaritanern fremd ist, entspricht sie damit exakt Jesu Wort, daß ,das Heil von den Juden kommt‘ (V. 22).
Aber auch Thyens Versuch, therapeutischen Einblick in die seelische Entwicklung der Samaritanerin zu nehmen, scheitert schon daran, dass wenige Verse später (4,29) die Frau ihre samaritanischen Landsleute auf Jesus als den Messias ansprechen kann, ohne dass diese in vergleichbarer Weise darauf vorbereitet worden wären, eine solche nur auf die Juden beschränkte Vorstellung zu akzeptieren. Der Evangelist verwendet also den Titel „Messias“ in seiner an das Hebräische maschiach angelehnten griechischen Form, den die Frau selbst ausdrücklich mit christos, „der Gesalbte“, übersetzt, für eine endzeitliche Gestalt, deren Erwartung die Samaritaner mit den Juden verbindet. Dennoch war es Johannes sicher bewusst, worauf er selber ja auch fortwährend anspielt, dass die Samaritaner einen solchen Gesalbten Gottes nicht aus dem Stamm Juda, sondern aus dem Stamm Josef erwarten würden und auch nicht als einen König, sondern als einen Propheten wie Mose, der, wie Gott in 5. Mose 18,18 sagt, „zu ihnen alles reden wird, was ich ihm gebieten werde.“
Ton Veerkamp <388> setzt ebenfalls voraus, dass der Evangelist hier eine gemeinsame Messiaserwartung beider Völker voraussetzt, wie sie auch immer konkret geartet sein mag. Er nimmt in Vers 25 wahr, wie eben schon angedeutet, dass die Frau auf den letzten längeren Gesprächsbeitrag Jesu skeptisch reagiert. Im Gegensatz zu Thyen sieht er die Frau bei weitem noch nicht völlig von Jesus überzeugt:
Wiederum ist es die Frau, die in die Realität der Erzählung zurückführt. „Der Messias, Christos genannt“ müsste kommen, der würde, „wenn er kommt, alles verkünden“. Wenn er kommt: ihre Skepsis ist unüberhörbar. Es bleibt für sie noch vieles offen. Sie hat sich die Ausführungen Jesu über die fundamentalen Voraussetzungen seiner Politik angehört, das alles werde sie sehen, wenn der Messias kommt. Immerhin gibt sie zu, dass das Dilemma zwischen beiden Völkern zu überwinden ist. Weder – noch war für sie und vermutlich auch für nicht wenige in Samaria keine Perspektive; der Konflikt gab Scharfmachern mit politischen Ambitionen in beiden Völkern eine gewisse Daseinsberechtigung. Für die Frau am Jakobsbrunnen ist aber eine messianische Perspektive reine Utopie. Schön wäre es, wenn „der Messias, genannt Christos“, kommt. Damit wischt sie den Satz vom Tisch. Jesus hatte gesagt: „Es kommt die Stunde, und das ist jetzt.“ Jetzt ist für sie Sankt Nimmerleinstag.
↑ Johannes 4,26: Im Reden Jesu mit der Frau geschieht der NAME Gottes: „ICH BIN“
4,26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin‘s, der mit dir redet.
[23. Mai 2022] Jesu Antwort (W146) auf „die Feststellung der Frau über das Kommen des Messias und die damit verbundene Erwartung“ besteht aus nur fünf Wörtern: egō eimi ho lalōn soi {wörtlich: Ich bin [es], der Redende [zu] dir}, die Klaus Wengst wie in der Lutherbibel übersetzt:
„Ich bin‘s, der mit dir redet.“ Was die Frau von der Zukunft erwartet, ist in Jesus schon da. Damit ist eine weitere Antwort auf die die das ganze Stück bestimmende Frage gegeben, wer Jesus sei: Er ist der Messias, der Gesalbte.
Damit endet „das Gespräch zwischen Jesus und der samaritischen Frau“, indem es „durch die Rückkehr der Schüler“ abgebrochen wird. Aber es muss auch (W146f.)
nicht fortgesetzt werden. Mit der Aussage von der Anwesenheit des endzeitlich erwarteten Messias ist die Gemeinde als Ort der Anbetung Gottes in den Blick gekommen. Dass solche Gemeinde auch auf der Ebene der Erzählung entsteht, dafür wird die samaritische Frau als Zeugin Jesu gleich den Anstoß geben. So zeigt sie in der Tat, dass sie von Jesus „lebendiges Wasser“ bekommen hat und selbst „Quelle“ geworden ist.
Wieder spricht Wengst recht unvermittelt von der „Gemeinde“, als sei bereits für Johannes die uns Christen vertraute Kirchengemeinde, die aus beliebigen Mitgliedern der Völker aller Welt besteht, die religiöse Gemeinschaft, auf die alle Missionsbemühungen Jesu als des Messias hinauslaufen. Dass der jüdische Messianist Johannes zunächst nur die Sammlung ganz Israels im Blick haben und mit dieser Sammlung die Hoffnung auf die baldige Überwindung der römischen Weltordnung und den Anbruch der kommenden Weltzeit verbinden könnte, bleibt völlig außerhalb seiner Erwägungen.
An dieser Stelle betont Wengst auch nochmals seine sozialgeschichtlich gefärbte Gegenüberstellung der Samaritanerin und des Nikodemus (W147):
Dem Mann steht die Frau gegenüber, dem geachteten Ratsherrn und großen Gelehrten die einfache Lohnarbeiterin in schwieriger sozialer Situation. Nikodemus kommt nachts zu Jesus, die Samariterin begegnet ihm am hellen Mittag. Auch Nikodemus unterliegt nicht Missverständnissen; er versteht sehr wohl. Aber er will nicht wahrhaben und wahr sein lassen, was Jesus sagt. So verläuft dort das Gespräch im Sande und Nikodemus gerät unversehens aus dem Blick. Hier aber bleibt die Frau bis zuletzt in der Szene. Sie wird zur Quelle für andere und es entsteht Gemeinde.
Damit erschöpft sich nach Wengst die Aussage der wenigen Worte Jesu. Nur ganz am Rande (W146, Anm. 200) geht er auf in seinen Augen „überspannte Aussagen“ anderer Exegeten ein, die in dem egō eimi Jesu eine Anspielung auf den NAMEN des Gottes Israels erkennen, wie er sich in 2. Mose 3,14 dem Mose offenbart hat. Zwar gesteht Wengst zu, dass „für die Leser- und Hörerschaft das in den anderen Stellen mit „Ich bin‘s“ Ausgesagte mitschwingt“, doch er hält Thyens Aussage für nicht angebracht (T268), „Gottes ureigener Name“ von Ex 3,14 sei „Jesu Name, mit dem er sich dieser Frau hier bekannt macht, wie Gott sich einst Mose bekannt gemacht hat“. Vor allem wendet sich Wengst damit gegen Thyens Annahme,
mit seinem „Ich bin‘s“ identifiziere sich Jesus „nicht direkt mit dem von der Frau erwarteten Messias“ … Warum muss Jesus unbedingt „mehr als der Messias“ sein, wo doch der Evangelist die Bewahrung des Glaubens an Jesus als Messias als Ziel seines Schreibens angibt (20,31)?
Ich verstehe das Anliegen von Wengst, einer übersteigerten Vergöttlichung Jesu entgegenzuwirken, die er wohl auch zu Recht bei Thyen wahrnimmt. Andererseits läuft Wengst Gefahr, wesentliche Anteile dessen, was Johannes in seinem Evangelium vom Messias Jesus aussagen will, zu übersehen, wenn er nicht ernstnimmt, dass, wie Thyen sagt (T265), mit „Jesu Antwort: egō eimi, ho lalōn soi (V. 26) … in unserem Evangelium zum ersten Mal sein prominentes egō eimi“ erscheint.
Um das in seiner vollen Tragweite zu begreifen, beschäftige ich mich zunächst mit Ton Veerkamp, <389> für den das egō eimi Jesu zu Recht zu den zentralen Aussagen des Johannesevangeliums gehört, indem es in einzigartiger Weise den befreienden NAMEN des Gottes Israels aufruft:
Jesus beendet das Gespräch. Wir hören zum ersten Mal in unserem Text die Worte: „ICH WERDE DASEIN, ICH BIN ES.“ 24mal werden wir im Johannesevangelium dieses egō eimi, „ICH WERDE DASEIN, ICH BIN ES“, hören, 24mal wird uns so die Offenbarung des NAMENS in Exodus 3,14, der Grund des prophetischen Selbstbewusstseins, in Erinnerung gerufen werden.
Indem Jesus „ICH BIN“ sagt, geschieht der NAME, geschieht buchstäblich das, was in der Bibel mit Gott gemeint ist, im Gespräch Jesu mit der Samaritanerin:
Dieses Friedens- und Befreiungsgespräch des Messias mit der Frau am Jakobsbrunnen ist die „Seinsweise Gottes“ in Israel, und zwar jetzt. Für den Menschen, für den diese Worte fundamentale Bedeutung haben, fängt ein neues Leben an. Damit wird die Ankündigung bewahrheitet: „Vertraue mir, Frau, denn die Stunde (des weder – noch) kommt …, und das geschieht jetzt!“ In dem Augenblick, in dem Jesus die Blockade: Judäer verkehren nicht mit Samaritanern, sondern sie schlagen sich gegenseitig tot, aufhebt, geschieht der NAME, geschieht Ich werde dasein, so wie ich dasein werde (Exodus 3,14). Der NAME geschieht im Reden, in diesem politischen Gespräch, wo ein Ausweg sichtbar wird, der noch nie war.
Zu den weiteren Vorkommen dieses Ausdrucks egō eimi führt Veerkamp aus:
Den Ausdruck gibt es in zwei Formen, einmal absolut, ohne weitere Bestimmung: egō eimi („ICH WERDE DASEIN“), einmal mit einer prädikativen Bestimmung, egō eimi ho lalōn („ICH BIN ES, der Redende“), egō eimi ho artos („ICH BIN ES, das Brot“) usw. Die erste Form kommt eigentlich nur viermal vor, 6,20; 8,24.28.58 (die Stellen 9,9, 18,5.6.8 setzen das Prädikat voraus). In diesen vier Fällen kommt, will uns scheinen, nur der direkte Bezug zu Exodus 3,14 in Frage. Deswegen übersetzen wir mit „ICH WERDE DASEIN.“ In den anderen Fällen, wo Jesus das Subjekt des Satzes egō eimi ist, müssen wir an die emphatische prophetische Schlussformel denken: ˀani hu {ICH BIN ES} oder ˀani JHWH {ICH BIN ES, DER NAME}. Die Emphase muss man in der Übersetzung immer wiedergeben, etwa: „ICH BIN ES, ich Erster, ich Letzter“, Jesaja 48,12. Mit dem Satz: „ICH BIN ES, der mit dir Redende“, ruft Jesus für die Frau die gemeinsame Befreiungserzählung auf. Das geschieht hier und jetzt, das ist Messias.
Wir werden sehen, dass Hartwig Thyen auf diese befreiungstheologischen Implikationen des jüdischen Gottesnamens so gut wie gar nicht eingeht.
Zunächst beschäftigt sich Thyen (T265) in Vers 26 erst einmal mit dem Ausdruck ho lalōn soi {der ich mit dir rede}. Dieser Satz nimmt in raffinierter Weise den „Anfang seines Gesprächs mit der Samaritanerin“ in Vers 10 wieder auf, indem Jesus „sein tis estin ho legōn soi {wer der ist, der zu dir sagt} durch die Worte egō eimi, ho lalōn soi {Ich bin es, der ich mit dir rede}“ folgendermaßen „variiert und beantwortet“:
Die Variation besteht darin, daß es statt des tis estin {wer es ist} nun egō eimi {ich bin} und anstelle des der Eröffnung des Gesprächs dienenden ho legōn soi {der zu dir sagt} jetzt ho lalōn soi {der ich mit dir rede} heißt. Dabei darf man den Gebrauch des Lexems lalein {reden} im Unterschied zu dem alltagssprachlichen legein {sagen} zumal in seiner Verbindung mit dem solennen {feierlichen} egō eimi {ich bin} ebenso wie das vorausgehende anangellein {verkünden} der Samaritanerin wohl als Offenbarungs-Terminus ansehen.
Während legein, „sagen“, bei Johannes 474mal vorkommt, taucht lalein, „reden“, 59mal bei Johannes auf, wobei letzteres Wort häufig mit anangellein, „verkünden“, gleichbedeutend verwendet wird, um eine Offenbarung auszudrücken (etwa in Johannes 8,38; 6,63; 15,22; 16,13). Von dieser Beobachtung her kommt Thyen auf eine Studie von Frances Margaret Young <390> über die Beziehung des Propheten Jesaja zum vierten Evangelium zu sprechen, denn von „den rund 280 Vorkommen des Verbums anangellein in der LXX finden sich im Jesajabuch allein 57“, und (T266) der „besondere Gebrauch“ von anangellein durch Johannes an sieben von „insgesamt nur 14 neutestamentlichen Belegen“ (Johannes 4,25; 5,15; 16,13.14.15.25; 1Joh 1,5) „entspricht, wie Young [225ff.] gezeigt hat, schwerlich zufällig präzise demjenigen Deuterojesajas.“ In diesem Buch des zweiten Jesaja (ab Jesaja 40) ist nämlich anangellein Young zufolge [224ff.] „ein spezifischer Offenbarungsterminus“.
Insbesonders weist Young zu Deuterojesaja darauf hin, dass in „Jes 45,19 – ebenso wie Joh 4,25f – die Verben lalein und anangellein nahezu als Synonyma“ erscheinen, dass das „anangellein … Gottes Privileg“ ist (41,26; 43,9; 48,14) und dass im „Gegensatz zu den Götzen und ihren Astrologen“ (47,13) „allein Gott die Macht“ hat, „die Ereignisse zu ,verkündigen‘ (anangellein), ehe sie geschehen“ (44,7; vgl. 46,9f). Dagegen gibt es unter den Heidenvölkern und ihren Götzen keinen anangellōn, keinen Verkünder, der eine entscheidende Ansage machen könnte (41,28), während „Gottes anangellein … nicht bloßes Referat, sondern rettendes Handeln“ ist (43,12).
Kritisch möchte ich dazu anmerken, dass es anscheinend in weiten Teilen dieser Youngschen Analyse lediglich um den formalen Akt der Verkündigung geht, zu dem laut Jesaja nur der Gott Israels fähig ist; einzig im zuletzt angeführten Jesaja-Vers wird mit dem Verb sōzein {retten, befreien} auch der Inhalt dieses Verkündigens angedeutet. Auf dieses befreiende und Recht schaffende Handeln Gottes (so zum Beispiel auch 43,11; 45,19; 48,17) zugunsten des Volkes Israel (44,21-22) und gegen seine Unterdrücker wie etwa Babylon (47,1.15) geht Young (zumindest in dem, was Thyen von ihr referiert) nicht näher ein.
Dazu passt, dass Young <391> in einem Vergleich von Johannes 4,25-26 mit Jesaja 52,6 auch auf die Offenbarung des Gottesnamens nur formal eingeht, statt ihn in seiner inhaltlichen Bestimmung als den befreienden und Recht schaffenden NAMEN wahrzunehmen [225]:
„Als Jesus die samaritanische Frau zur Rede stellt, sagt sie zu ihm: oida hoti Messias erchetai ho legomenos christos; hotan elthē ekeinos, anangelei hēmin hapanta. legei autē ho Iēsous: egō eimi, ho lalōn soi {Ich weiß, daß der Messias kommen wird, das heißt der Gesalbte, und wenn der kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der ich mit dir rede}. Hier erkennt Jesus implizit seine Funktion als ho angellōn hapanta {der alles Verkündende}, der Offenbarer aller Dinge, an. Und die Worte Jesu haben eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Jesaja 52,6: dia touto gnōsetai ho laos mou to onoma mou en tē hēmera ekeinē, hoti egō eimi ho lalōn {Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!}. So wie die Offenbarung des Namens der wichtigste Faktor bei Jesaja ist, so ist hier die Offenbarung von hapanta {alles} in gewissem Sinne gleichbedeutend mit der Offenbarung ‚des Namens‘.“
Das läuft nach Thyen letzten Endes wirklich auf das hinaus, worauf Wengst hingewiesen hat (T268), dass nämlich „Jesus sich mit seinem egō eimi {ich bin [es]} nicht direkt mit dem von der Frau erwarteten Messias identifiziert.“ Mit dieser Einschätzung beruft sich Thyen zustimmen d auf Ulrich Wilckens, <392> den er folgendermaßen zitiert:
„Er [Jesus] sagt nicht: ,Ich bin der Messias‘, sondern: ,Ich bin (es), der mit dir redet‘. Seine Worte in V. 23f weisen ihn als den aus, der er ist. Doch in V. 23f ist von Jesus ja nicht die Rede, sondern nur vom ,Vater‘ und von Gott, der Geist ist. Wenn er sich auf diese Worte zurückbezieht, muß dieses ,Ich bin‘ seinen eigentlichen Sinn von deren Inhalt her haben. Jesus ist selbst ,Geist und Wahrheit‘ Gottes; von ihm gilt, was im Prolog vom Logos gesagt ist: ,Gott war der Logos‘. Das ,Ich‘ Jesu und Gottes eigenes ,lch‘ stimmen überein. Gottes ureigener Name: ,Ich bin, der ich bin‘ bzw. ,Ich werde sein, der ich sein werde‘ (Ex 3,14; vgl. Ex 20,2), ist Jesu Name, mit dem er sich dieser Frau hier bekannt macht, wie Gott sich einst Mose bekannt gemacht hat. Darum ist die Rede von „Gott“ in V. 24 durch die Rede vom ,Vater‘ in V. 23 bestimmt: Gott ist Gott als der Vater des Sohnes.“
Vieles davon scheint zuzutreffen, aber der letzte Satz lässt mich stutzen: Wenn Gott nur noch Gott ist, indem er der „Vater des Sohnes“ ist, wird dann nicht der Gott Israels von Jesus her neu bekannt gemacht, statt dass der Gott Israels den Sohn als den bis dato unbekannten Messias bekannt macht? Nein, nicht Gott wird neu definiert durch diesen Sohn, sondern es muss ernst genommen werden, dass der Sohn die Verkörperung des befreienden NAMENS des Gottes Israels ist – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einen gewaltigen Schritt zu weit gehen diese Äußerungen auch darin, dass das „‚Ich‘ Jesu und Gottes eigenes ‚Ich‘“ einfach identifiziert werden. Aber Johannes behauptet nicht, dass Jesus mit Gott identisch ist; vielmehr ist Jesu gesamter Wille und sein gesamtes Wirken identisch mit dem, was der heilige NAME des Gottes Israels ausdrückt. Dabei bleibt aber Jesus voll und ganz Mensch und verwandelt sich nicht wesenhaft in Gott. Im Sinne dieser Bedenken ist auch fraglich, ob wirklich zutrifft, was Wilckens aus der obigen Argumentation folgert:
„ln diesem Sinn ist Jesus nicht nur mehr als ein Prophet (V. 19), sondern auch mehr als der Messias der samaritanischen Erwartungstradition (V. 25). Dieser Unterschied bleibt freilich der Frau auch jetzt noch verborgen. Nur die Leser begreifen den Sinn der Selbstvorstellung Jesu in V. 26 als egō eimi (vgl. 20,31)“.
Letzteres trifft ja schon insofern nicht zu, als mindestens die vier Leser Wengst, Thyen/Wilckens und Veerkamp das egō eimi Jesu an dieser Stelle sehr unterschiedlich auslegen, und das heißt doch, dass nicht sie alle es angemessen begreifen. Allenfalls kann man zu erschließen versuchen, was Johannes dem von ihm vorausgesetzten Adressatenkreis zu verstehen zutraut. Indem Johannes alle Verheißungen der biblischen Überlieferung darauf zuspitzt, dass sie in dem Messias Jesus als der Verkörperung des NAMENS ihre Erfüllung finden, dann geht es zwar in diesem Sinne um Überbietungen und Veränderungen der Tradition, aber in der entscheidenden Frage, wer Jesus als dieser Messias eigentlich ist, bleibt Johannes auf der prophetischen Linie der Befreiung Israels durch den NAMEN aus jedweder Sklaverei zum Leben der kommenden Weltzeit.
Zwiespältig empfinde ich die Ausführungen von Gail O‘Day, <393> die Thyen ergänzend im Blick auf die Leser von Vers 26 zitiert. Sie
erklärt im Blick auf den vorangegangenen Dialog, jetzt sei der Leser „mit einer direkten und endgültigen Offenbarung Jesu konfrontiert, die eine andere Art von Entscheidung erfordert als das ironische Wechselspiel des übrigen Dialogs. Jetzt besteht die Entscheidung nur noch darin, zu bejahen oder zu verneinen. Der Leser ist jedoch nur deshalb zu dieser Entscheidung bereit, weil er am Offenbarungsprozess des vorangegangenen Dialogs teilgenommen hat. Das ego eimi wird also erlebt, nicht nur nacherzählt“.
Wieder bleibt auf der einen Seite die Frage offen, wozu eigentlich dieses klar Ja oder Nein vom Leser gesagt werden soll: Geht es darum, Jesus mit Gott zu identifizieren (Thyen)? Oder ist Jesus der von Gott gesandte Messias, der die Völker der Welt in den Glauben an den Gott Israels mit hineinnimmt (Wengst)? Oder soll Jesus als der erkannt werden, der den befreienden NAMEN Gottes verkörpert (Veerkamp)?
Wenn auf der andereren Seite nach O‘Day das egō eimi „erlebt, nicht nur nacherzählt“ wird, frage ich mich, warum nur der Leser und nicht zu allererst gerade die Samaritanerin diesen Offenbarungsprozess am eigenen Leibe erfahren haben soll. Genau das Letztere ist ja nach Veerkamp der Fall, wie wir gesehen haben. Immerhin ist es dieses Wort Jesu, das die Frau dazu veranlasst, ihren Schöpfeimer stehen zu lassen und ihren Landsleuten begeistert von Jesus zu erzählen.
Noch einmal zurück zur Annahme Thyens, dass „die Bezeichnungen Jesu in unserer Erzählung eine absichtsvolle Steigerung erfahren“ (T266f.):
Nennt die Frau Jesus zunächst einen „Juden“ (V. 9), so fragt sie alsbald, ob er womöglich „größer als Jakob“ sei (V. 12), äußert sodann ihre Überzeugung, daß er ein „Prophet“ sei (V. 19), gibt darauf ihre Gewißheit kund, daß der „Messias“ kommen werde, den sie als christos qualifiziert (V. 25), und nach dem darauf folgenden solennen egō eimi Jesu (V 26) erreicht diese Reihe in dem Bekenntnis der Samaritaner, daß Jesus der „Retter der Welt“ sei (V. 42), endlich ihre Klimax.
Gegen eine solche lineare Steigerung spricht, dass nicht der Gottesname egō eimi den Höhepunkt bildet. Können die verschiedenen Bezeichnungen für Jesus nicht einfach unterschiedliche Blickrichtungen auf den Messias Jesus sein, der dem Evangelisten zufolge als genau dieser jüdische Mensch den befreienden NAMEN verkörpert?
Zurück auch noch einmal zu Thyens Beschäftigung mit den egō eimi-Worten Jesu. Er verweist auf eine Dissertation von Heinrich Zimmermann, <394> in der dieser
die absoluten egō eimi-Worte Jesu … treffend als „die neutestamentliche Offenbarungsformel“ bestimmt. Zugleich hat er sie als den Schlüssel der Interpretation auch der durch Lexeme wie „Brot“ (Joh 6), „Licht“ (Joh 8 u. 9), „Guter Hirte“, „Tür“ (Joh 10), „Auferstehung und Leben“ (Joh 11), „Weg, Wahrheit und Leben“ (Joh 14) und „Weinstock“ (Joh 15) prädizierten Ich-bin-Worte erwiesen…
Von der oben angeführten Auslegung Ton Veerkamps her frage ich mich, ob dieser Interpretationsschlüssel von Zimmermann bzw. Thyen richtig herum ins Schloss eingeführt wird: das Stichwort „prädiziert“ verweist auf eine Art der christlichen Entschlüsselung, die dem Gott Israels durch Jesus zusätzliche Prädikate verleiht. Verwendet man den Schlüssel andersherum, also von der Tora und den Propheten her, dann wird Jesus in all seinem Wollen und Wirken vom befreienden NAMEN her bestimmt.
Thyen ist voll und ganz Recht zu geben, wenn er im Vorgriff auf die Auslegung von Johannes 8 und 9 darauf verweist (T268f.), dass „Jesu absolutes egō eimi und seine Selbstprädikation als ,Licht der Welt‘ ein absichtsvolles intertextuelles Spiel mit den ˀani-huˀ-Worten {ICH BIN ES-Worten} JHWHs des Jesajabuches“ darstellen, „das, wie Youngs Studie zeigt, überhaupt eine nahezu unerschöpfliche Quelle unseres Evangeliums ist“. Wir werden sehen, in welcher Weise er diese Quelle auszuschöpfen versucht (T269), auch etwa „die paradoxe Bezeichnung des Kreuzestodes Jesu als das hypsōthēnai und doxasthēnai {Erhöht- und Verherrlichtwerden} des ,Menschensohns‘ (3,14; 7,39; 8,54; 12,16.28; u. 21,19) als intertextuelles Spiel mit den jesajanischen ,Gottesknechts-Liedern‘“. Zu unserer Stelle schreibt er von dorther:
Darum dürfen wir im Hintergrund unseres V. 26 wohl auch den Vers Jes 52,6 vermuten: hoti egō eimi autos ho lalōn {dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!}. Doch dieses intertextuelle Spiel muß Spiel bleiben und darf nicht zu der doktrinären Behauptung führen, Jesu egō eimi sei nicht zugleich auch seine Identifikation mit dem von der Frau erwarteten ,Messias‘, ho legomenos christos. Denn was der implizite Leser hier ahnen mag und wohl auch ahnen soll, das bleibt der Samaritanerin, wie ihre Kunde an ihre Landsleute zeigen wird (mēti houtos estin ho christos {ob nicht dieser der Christus ist}: V. 29), noch verborgen.
Wahrscheinlich iest es aber genau andersherum, nämlich wie Veerkamp es oben verstanden hat: eben im Gespräch Jesu mit der Samaritanerin geschieht der befreiende und versöhnende NAME des Gottes Israels, und genau darin erfährt sie ihn als den von Samaritanern und Juden erwarteten Messias. So gesehen bleibt der Samaritanerin weniger verborgen als so manchem christlichen Exegeten.
Schließlich sei noch darauf eingegangen, dass Thyen (T267) auf Grund der „kunstvollen und vielgestaltigen Verknüpfung aller Details unserer Szene zu einer dynamischen Einheit“ einen engen Zusammenhang „zwischen dem ‚Lebenswasser‘ und der ‚Anbetung des Vaters in Geist und Wahrheit‘“ feststellt, der darin besteht,
daß die „Gabe Gottes“ (V. 10), die als „das Wasser, das ich geben werde“ (egō dōsō), zugleich die Gabe Jesu ist (V. 14), im Herzen desjenigen, der es „trinken“, d. h. an Jesus glauben wird, zum nie versiegenden Quell jener Anbetung und zum Ursprung des ewigen Lebens werden wird. Mit dieser Identität der Gabe Gottes mit derjenigen Jesu ist schon hier jene „Einheit des Sohnes mit dem Vater“ impliziert, die erst Jesu Wort: egō kai ho patēr hen esmen {ich und der Vater, eins sind wir} (10,30), dramatisch explizieren wird. Und wie die „Gabe Gottes“ sein hyios ho monogenēs {einziggeborener Sohn} ist, den er in seiner Liebe zum Kosmos „gibt“ (3,16), so ist die „Gabe Jesu“ dieser Geber selbst, der sein Fleisch „gibt für das Leben der Welt“ (6,51).
Von daher will Thyen nun auch „Jesu scheinbar ausweichende Antwort“ auf die Frage nach dem Ort der rechten Anbetung, „in der anstelle des erfragten rechten Ortes nur noch von der rechten Art der Anbetung des Vaters die Rede zu sein schien“, in folgendem tieferen Sinn verstehen:
Antiker Tradition entsprechend geht es der Fragestellerin dabei nämlich nicht nur um die höhere Dignität dieses oder jenes Heiligtums. Impliziert ist vielmehr die viel entscheidendere Frage danach, welchen dieser Orte Gott dazu erwählt hat, unter seinem Volk zu „wohnen“.
Wie bereits in Johannes 1,14 vom fleischgewordenen Logos die Rede war, der unter den Menschen wohnt (eskēnōsen), und in 2,21 vom Tempel des Leibes Jesu, so ist auch hier Jesus selbst der neue „Ort der Gegenwart Gottes unter den Menschen“:
Er ist der Tempel der messianischen Ära, aus dem nach 7,38 die von den Propheten verheißene Quelle lebendigen Wassers entspringen wird (vgl. Ez 47,1ff; Joel 4,18; Sach 13,1; 14,8; sowie Jes 43,19f; 49,10…).
Während nach biblischer, rabbinischer und qumranischer Tradition (etwa Sprüche 13,14 und 14,27) „die Tora (und/oder die Weisheit) die nie versiegende Quelle“ ist, „der das ‚Lebenswasser‘ entspringt“, übernimmt Thyen zufolge nach dem Johannesevangelium Jesus diese Rolle.
Auch diese Ausführungen Thyens sind nicht einfach falsch, wenn sie so verstanden werden, dass Jesus in den Augen des Johannes die befreiende Tora des NAMENS nicht aufhebt und ersetzt, sondern in der Weise verkörpert, dass er durch seinen Tod am Kreuz die versklavende Weltordnung überwindet und seinen Nachfolgern den Geist Gottes übergibt, durch dessen Inspiration sie auf dem Wege der Erfüllung des neuen Gebots der agapē, einer weltverändernden solidarischen Liebe, den Anbruch der neuen Weltzeit von Freiheit, Recht und Frieden tätig erwarten können.
Leider erweckt Thyen allerdings den Eindruck, dass die Bedeutung der Tora und der jüdischen bzw. samaritanischen Heiligtümer eher religiös durch Jesus und die Praxis einer neuen christlichen Religion abgelöst werden soll.
↑ Johannes 4,27: Die Verwunderung der Schüler Jesu über sein Gespräch mit der Frau
4,27 Unterdessen kamen seine Jünger,
und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete;
doch sagte niemand: Was willst du?, oder: Was redest du mit ihr?
[24. Mai 2022] Während Jesus noch mit der Frau geredet hat, sind seine Schüler aus der Stadt zurückgekommen. Zur ersten stummen Reaktion der Schüler schreibt Ton Veerkamp: <395>
Inzwischen waren die Schüler gekommen. Denen passte das Ganze nicht. In dieser Lage haben sie zwei Nachteile, sie sind Männer und sie sind Judäer. Sie wundern sich über einen judäischen Mann und Lehrer, der mit einer wildfremden Frau aus einem verhassten Volk redet. Niemand kommt Jesus mit irgendwelchen dummen Fragen von der Sorte: „Was hast du bei der Frau zu suchen, was hast du mit ihr zu bereden?“ Sie wollen sich keine Blöße geben. Sie sind aber judäische Männer, sie denken: Unsereiner verkehrt nicht mit Samaritanern und erst recht nicht mit samaritanischen Frauen.
Klaus Wengst beschäftigt sich zum „Aspekt des Gegensatzes von Mann und Frau, der in der Szene angelegt war“ und nun hervortritt, zunächst mit dem Vorurteil von Exegeten gegenüber einem „angeblich frauenfeindlichen“ Judentum. Die „pauschale Behauptung“ von Adolf Schlatter: <396> „Das Rabbinat verdächtigte und verbot jedes Gespräch mit einer Frau“ trifft ihm zufolge
selbstverständlich nicht zu. Was es jedoch gibt, ist der Ausspruch eines einzelnen Lehrers, das Gespräch mit der Frau nicht lang zu machen, der als allgemeine Lehrmeinung der Weisen aufgenommen wurde.
Dieser Ausspruch wird auf „Jose ben Jochanan“, <397> einen „Mann aus Jerusalem“, zurückgeführt, der
„sagt: ,Dein Haus sei weit geöffnet und die Armen seien deine Hausgenossen. Und mache das Gespräch mit der Frau nicht lang,‘ Mit der eigenen Frau, sagte man, um wieviel mehr nicht mit der Frau des Nächsten. Von daher sagten die Weisen: ,Wenn ein Mann das Gespräch mit der Frau lang macht, verursacht er Schlimmes für sich selbst, vernachlässigt die Worte der Tora und erbt am Ende den Gehinnom.‘“
Im babylonischen Talmud <398> gibt es eine hintergründige Erzählung über Berurja, die Frau Rabbi Meïrs, die diese „Weisung, das Gespräch mit der Frau nicht lang zu machen“, unterläuft:
„Rabbi Jose der Galiläer war einst unterwegs. Er traf Berurja und sagte zu ihr: ,Auf welchem Weg geht man nach Lod?‘ Sie sagte zu ihm: ,Törichter Galiläer! Haben nicht so die Weisen gesprochen: Du sollst das Gespräch mit der Frau nicht lang machen? Du hättest sagen sollen: Wie nach Lod?‘“ Die Regel der Weisen wird zitiert – aber von einer Frau, um einen Weisen zu belehren, und damit verlängert sie das Gespräch mit ihm. Jesus hat nach dem Text von Joh 4 keine Probleme damit, das Gespräch mit einer Frau lang zu machen. Aber seine Schüler wundern sich darüber.
Abwegig ist in meinen Augen die Annahme von Luise Schottroff, <399> die „Verwunderung“ der mathētai, mit denen ihr zufolge ganz selbstverständlich „nicht nur ‚Schüler‘, sondern auch ‚Schülerinnen‘“ gemeint sind, „gelte nicht dem Sprechen mit einer Frau, sondern betreffe die Tatsache, dass der vorher so ermüdete Jesus überhaupt spricht.“ Indem Schottroff auf diese Weise allzu angestrengt eine anachronistische Gendergerechtigkeit in das Johannesevangelium hineinzulesen versucht, übersieht sie erstens die pointiert ausgedrückte Kritik des Johannes am Macho-Verhalten der männlichen Schüler Jesu und zweitens den spezifisch johanneischen Blick auf Jesu Schülerinnen. Wengst ist nämlich nicht vollständig Recht zu geben, wenn er (W148) „im Johannesevangelium keinen Hinweis darauf“ sieht,
dass unter mathetaí auch Schülerinnen mitgemeint seien. Wo Schüler namentlich genannt werden, handelt es sich ausschließlich um Männer. Wo Frauen in Beziehung zu Jesus auftauchen, werden sie nicht als Schülerinnen bezeichnet. Mirjam aus Magdala geht nach 20,18 zu „den Schülern“ und nicht zu „den anderen Schülerinnen und Schülern.“
Das ist zwar insofern richtig, als für Johannes außer Frage steht, dass der Führungskreis der Zwölf Apostel, den er für die Jerusalemer messianische Gemeinde voraussetzt, ausschließlich aus Männern besteht. Man darf sich nicht der romantischen Vorstellung hingeben, dass auch nur in einer der vielen christlichen Urgemeinden der allgemein herrschende Patriarchalismus außer Kraft gesetzt gewesen wäre.
Dennoch lässt der Evangelist Maria Magdalena in Johannes 20,16 ausdrücklich als ihren rabbouni und didaskalos, „Rabbi“ und „Lehrer“, anreden und bezeichnet sie damit indirekt sehr deutlich als Jesu Schülerin – und nicht etwa als Geliebte oder bloße Unterstützerin. In meinen Augen deutet alles darauf hin, dass Johannes den Schülerinnen Jesu mehr Einsicht und mehr Vertrauen auf den Messias Jesus zutraut als den Schülern, zugleich aber davon ausgeht, dass unter den gegebenen Umständen an den entstehenden Führungsstrukturen der messianischen Gemeinde nicht zu rütteln ist (vgl. dazu das Wettrennen zwischen Petrus und Johannes zum Grab Jesu und die Übertragung des Hirtenamts an Petrus im Schlusskapitel 21).
Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass Johannes sowohl die männlichen Jünger als auch speziell die Brüder Jesu oft sehr kritisch sieht, während er ausnahmslos alle von ihm portraitierten Frauen positiv und als den männlichen Schülern überlegen darstellt. Ob das mit dem Einfluss starker Frauenpersönlichkeiten in seiner Gemeinde zu tun gehabt hat (seine Darstellung der Mutter Jesu lässt darauf schließen, dass sie in der Gemeinde besonders wertgeschätzt wurde), kann nur vermutet werden.
Mit einem Verweis (Anm. 203) auf die „Aussagen von 1. Tim 2,11-15“ als „wohl sozusagen nur … die Spitze eines Eisbergs“ äußert auch Wengst (W148) eine Vermutung zu der „Beobachtung, dass die Schüler Jesu es sind, die sich wundern und die unterschwellig die Frage an die Frau haben, aber nicht aussprechen: ‚Was willst du?‘“:
In den Gemeinden gab es in den beiden letzten Jahrzehnten des 1. Jh.s Tendenzen, die aktive Rolle von Frauen zurückzudrängen. Es ist ein Aspekt der Erzählung von der samaritischen Frau, mit der Jesus ein langes Gespräch hat und die anschließend eine wichtige Rolle übernimmt, solchen Tendenzen zu wehren.
Hartwig Thyen (T269f.) macht in seiner Auslegung von Vers 27 zunächst auf das Verb thaumazein aufmerksam, mit dem „das ,Schockiertsein‘ der zurückkehrenden Jünger darüber“ ausgedrückt wird, „daß sie Jesus im Gespräch mit einer samaritanischen Frau finden“. Wichtig ist ihm dabei, dass es sich sozusagen um einen doppelten Schock handelt, worauf er mit einem Zitat von Teresa Okure <400> hinweist (T270):
„Der Schock der Jünger erhält also seine volle Wucht, wenn man seinen Gegenstand in seinem ganzen Horror sieht: Jesu Gesprächspartnerin ist eine Frau, eine Samariterin, und er spricht mit ihr in der Öffentlichkeit. Sie haben also allen Grund, schockiert zu sein, aber je tiefer der Schock, desto mehr sollte die Lektion einschlagen, wenn sie erteilt wird (VV 31-42)“.
Weiter geht Thyen auf die Fragen ein, „die den schockierten Jüngern auf den Lippen liegen: ti zēteis ē ti laleis met‘ autēs? {Was suchst du? oder: Was redest du mit ihr?}“, von denen der Erzähler „weiß, daß sie es nicht wagen, sie auszusprechen.“ Hier werden Jesu Jünger ihn vergeblich zu einer Mahlzeit auffordern (Vers 31) und wagen es auf Grund ihres Schocks nicht, ihm diese Fragen zu stellen. Am Ende des Evangeliums wird Jesus seinen Jüngern ein Mahl bereiten, und es wird wieder heißen (T270f.):
oudeis de etolma tōn mathētōn exetasai auton: sy tis eis eidotes hoti ho kyrios estin {Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr}. Da es nach Joh 13,25.37; 14,5.8.22 geradezu ein „Attribut“ eines mathētēs {Schülers} ist, Fragen zu stellen, damit er so in die ,Wahrheit‘ geführt werde, muß auch das in ihrem ,Schockiertsein‘ gründende ,Nicht-Fragen-Können´ als negative Qualifikation verstanden werden. Anders steht es dagegen in 21,12, denn jetzt ist Jesu Verheißung erfüllt: kai en ekeinē tē hēmera eme ouk erōtēsete ouden {Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen} (16,23), jetzt ist an die Stelle ihrer ,Verwunderung‘ ihr Wissen (eidotes) um die Gegenwart ihres kyrios und ihre unverlierbare Freude daran (16,22) getreten…
Weil hier in Vers 27 das Wort zētein, „suchen“, aus dem Vers 23 über die Suche des Vaters nach wahren Anbetern wiederaufgenommen wird, kann der „Leser die Antwort auf die ungestellte Jüngerfrage: ti zēteis {Was suchst du?}“ wissen:
Als derjenige, dessen ,Speise‘ es ist, „den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat und sein Werk zu vollenden“ {Vers 32 und 34}, ,sucht‘ Jesus auch in Samaria die alēthinoi proskynētai proskynousin tō patri en pneumati kai alētheia {wahren Anbeter, die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, Vers 23}. Aber was die Jünger jetzt, da noch die Zeit dafür ist, nicht zu fragen wagen, wird Jesus ihnen im folgenden dennoch beantworten.
↑ Johannes 4,28-30: Die Samaritanerin als messianische Evangelistin ihrer Landsleute
4,28 Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt
und spricht zu den Leuten:
4,29 Kommt, seht einen Menschen,
der mir alles gesagt hat, was ich getan habe,
ob er nicht der Christus sei!
4,30 Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm.
[25. Mai 2022] Die Verse 28 und 29 machen nach Klaus Wengst deutlich (W148), dass die Samaritanerin wirklich „‚lebendiges Wasser‘ bekommen“ hat „und … zur ‚Quelle‘ geworden“ ist:
Das Zurücklassen des Wasserkruges und das Weggehen in die Stadt stehen im griechischen Text in der gleichen Zeitform nebeneinander. Ersteres ist also nicht ein Nebenaspekt, der etwa die Vergesslichkeit oder den Eifer der Frau und ihren eiligen Aufbruch in die Stadt zum Ausdruck bringen soll. Die Form als selbständiger Hauptsatz weist vielmehr daraufhin, es als einen bewussten Akt zu verstehen. Der steht auf derselben Ebene wie die Distanzierung von dem Mann. Indem die Frau ihr Arbeitsgerät zurücklässt, löst sie sich auch aus diesem Teil ihres bisherigen Lebenszusammenhanges. Damit erfüllt sich ihr Wunsch, nicht mehr zum Schöpfen an den Brunnen zu kommen. Sie hat jetzt Wichtigeres zu tun.
Dieses Wichtigere wird in einer anderen Zeitform geschildert, nämlich dem „praesens historicum“, mit der vergangene Vorgänge lebhaft vergegenwärtigt werden (W148f.):
Sie wird – wenn in ihrer hoffnungsvollen Rede auch noch Zweifel mitklingt – in der Stadt zur Zeugin Jesu, die ihre Erfahrung mit ihm an andere weitergibt und sie auffordert, selbst hinzugehen und zu „sehen“. Das Erstaunliche geschieht: Auf ihr gar nicht so glaubensstarkes Wort hin gehen welche aus der Stadt zu Jesus.
In diesem Zusammenhang weist Wengst einerseits (Anm. 205) auf die Parallelen der Jüngerberufungen in Johannes 1,39 und 46 hin und andererseits (Anm. 204) auf alte Kirchenlehrer, die – allerdings in sehr zurückhaltender Form – die Samaritanerin als eine Apostelin dargestellt sehen, so Origenes <401> mit dem Satz: „Gleichsam als einen Apostel gegenüber den Einwohnern der Stadt gebraucht er diese Frau, indem er sie durch seine Worte so sehr entflammt, das die Frau schließlich ihren Krug zurücklässt, in die Stadt geht und zu den Leuten spricht…“, und Thomas von Aquin, <402> „der im Zurücklassen des Kruges den ‚Nutzen dargelegt‘ findet, ‚der vonseiten der Frau kommt, die das Amt der Apostel übernimmt durch das Verkünden‘.“
Wengst zufolge wird in dieser Geschichte mit „Samarien das erste Missionsgebiet“ erschlossen, „in das die messianische Verkündigung über den jüdischen Raum hinaus vordrang“; damit übersieht er, wie gesagt, dass Johannes die Samaritaner ausdrücklich als Teil des Volkes Israel betrachtet, das gemeinsam mit den Judäern ein messianisch wiedervereinigtes Gesamt-Israel bilden wird.
Auch sieht Wengst seine sozialgeschichtliche Vorstellung bestätigt, dass sich Menschen, „deren bedrücktes Leben perspektivlos erschien, die durch Lebensbrüche hindurchgegangen waren“, in der Gemeinde „neue Lebensmöglichkeiten“ auftaten:
Sie fanden im geteilten Leben in der Gemeinde erfülltes Leben. Nur deshalb kann von der samaritischen Frau erzählt werden, dass sie sich sowohl von dem Mann, der nicht ihr Mann ist, distanziert als auch aus ihrer bedrückenden Arbeit löst.
Da diese Auslegung den politischen Hintergrund der weltweiten Unterdrückungssituation außer Acht lässt, auf die sowohl die Arbeitssituation der Frau als auch die Symbolik des Mannes, der kein Mann, sondern ein Baˁal ist, hinweist, halte ich die Annahme für ziemlich naiv, die Lebenssituation der Frau könne sich allein dadurch zum Besten wenden, wenn sie ihrem unzuverlässigen Lebensgefährten den Rücken kehrt und beschließt, sich nicht mehr ausbeuten zu lassen.
Hartwig Thyen (T271) sieht in der Notiz vom Zurücklassen des Wasserkrugs „wohl ein Signal für deren symbolischen Modus“, und zwar „darf und soll hier spekuliert werden“. Zunächst einmal „macht der Erzähler die Frau und die Jünger wechselseitig zu Zeugen der Gegenwart des jeweils anderen“. Auf diese Weise erfährt die Frau, dass Jesus „nicht allein ist, sondern von einer Gruppe umgeben ist, die ihn verehrt“:
Und zugleich werden die Jünger so zu Zeugen des Aufbruchs der Samaritanerin, die in dem Relikt ihres zurückgelassenen Wasserkruges gleichsam präsent bleibt und die unterdrückten Fragen der Jünger an ihren Herrn nicht zur Ruhe kommen läßt. Zudem will doch bedacht sein, daß diese Samaritanerin, die sich in der größten Hitze des Tages aufgemacht hatte, Wasser vom heiligen Jakobsbrunnen zu holen, nach ihrer Begegnung mit dem fremden Juden nun diesen Zweck ihrer Mühe vergessen zu haben und so unverrichteter Dinge in ihre Stadt zurückzukehren scheint.
Zur Erklärung dafür folgt Thyen (T272) am ehesten dem Hinweis auf „die symbolischen Obertöne“, die Sandra Schneiders <403> hier vernimmt:
„Wir sollten es nicht versäumen, die weibliche Version der Standardformel des Evangeliums für die Antwort auf den Ruf zum Apostelamt zu bemerken, nämlich ‚alles zu verlassen‘, insbesondere die gegenwärtige Stellung, sei es symbolisiert durch Boote (z. B. Mt 4,19-22) oder das Zollhaus (vgl. Mt 9,9) oder den Wasserkrug“.
Hendrikus Boers <404> bringt diese Symbolik „so auf den Begriff“:
„Wenn Jesus das, was er tut, so interpretiert, dass er eine andere Nahrung hat, nämlich den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein Werk zu vollenden, dann dürfte kaum ein Zweifel daran bestehen, dass seine Mitarbeiterin bei diesem Werk an dem lebendigen Wasser teilhat, das er ihr angeboten hat, was durch das Fallenlassen ihres Kruges zum Ausdruck kommt“.
Die in ihre Stadt zurückkehrende Frau beschreibt Thyen als „noch unwissend von dem Lebenswasser erfüllt, das Jesu Worte ihr vermittelt haben“. Die Worte, mit denen sie die Einwohner der Stadt zu Jesus ruft, enthalten das Fragewort mēti, „ob nicht“; dieses erfordert
mit dem Indikativ ebenso wie das einfache mē im klassischen Griechisch eine verneinende Antwort, doch in der Koine {Umgangssprache} verschwindet diese Eindeutigkeit (vgl. auch V. 33). Da kann die Frage: mēti houtos estin ho christos? durchaus die Einstellung des Fragestellers offenlassen und den Sinn gewinnen: „das muß am Ende doch der Messias sein“ oder: „ob der nicht womöglich der Christus ist“…
Die Verbform ērchonto in Vers 30 versteht Thyen als ein „impf. de conatu“, ein Imperfekt des Versuchs, denn noch sind die Samaritaner ja nicht bei Jesus angekommen, sondern sie „machen sich … auf das Zeugnis der Frau hin auf den Weg“ zu ihm.
Ton Veerkamp <405> meint im Blick auf die Samaritanerin nach der das Gespräch abschließenden Aussage Jesu:
Die Frau bleibt skeptisch. Soviel ist ihr aber jetzt deutlich, dass sie diese Sache mit ihren Leuten bereden muss. …
Inzwischen hat die Frau die Gelegenheit, die Bühne zu verlassen, um ihren Auftrag zu erfüllen: als die erste messianische Evangelistin in Samaria zu ihren Leuten zu gehen, ihr Wasser zurücklassend; dieses Wasser braucht sie offenbar nicht mehr.
Trotz ihrer Skepsis bleibt die Frau offen für die neue Perspektive, die Jesus ihr eröffnet hat, und legt ihre noch von Zweifeln bestimmte Frage ihren Landsleuten vor:
Nach 1,39 und 1,46 hören wir zum dritten Mal im Evangelium: „Komm und sieh.“ Sie sollen kommen, damit sie sehen und hören, genauso wie die beiden ersten Schüler, wie Nathanael kommen sollen, damit sie sehen. Hier sollen sie sehen „einen Menschen, der mir gesagt hat alles, was ich getan habe“. Die meisten Ausleger denken natürlich an ihre „schmachvollen Ehegeschichten“. Er hat ihr aber die ganze Geschichte ihres Volkes, ihre Geschichte, auf den Punkt gebracht und ihr eine Perspektive jenseits der Geschichte von Mord und Hass eröffnet. Vielleicht ist nun doch ein friedlicher Ausgang der blutigen Geschichte zu erwarten: „Ob der nicht doch der Messias ist, ob nicht messianische Politik uns doch Realpolitik sein könnte?“ Sie bleibt skeptisch, bleibt aber offen für Überraschungen. Die Leute machen sich auf den Weg.
↑ Johannes 4,31-34: Die den Schülern unbekannte Speise Jesu, das Werk Gottes zu vollenden
4,31 Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss!
4,32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst.
4,33 Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht?
4,34 Jesus spricht zu ihnen:
Meine Speise ist die,
dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat,
und vollende sein Werk.
[26. Mai 2022] Bevor die Samaritaner bei Jesus ankommen (W149), schiebt Johannes ein „Gespräch Jesu mit seinen Schülern“ ein, in dem er Wengst zufolge „die jetzt ins Auge gefasste Missionssituation“ näher beleuchten wird:
Den Ausgangspunkt dieses Abschnitts bildet die Aufforderung der Schüler an Jesus zu essen (V. 31). Ihr setzt Jesus den Verweis auf eine Speise entgegen, die sie nicht kennen (V. 32). Darauf reagieren sie, indem sie untereinander eine unverständige Frage stellen (V. 33).
Darin sieht Wengst
eine gewisse Entsprechung zu V. 10. Dort hatte Jesus, nachdem er vorher um einen Trank gebeten und sich die Frau darüber verwundert hatte, seinerseits „lebendiges Wasser“ angeboten. Es gibt aber auch Unterschiede. Dort kommt es zu einem Gespräch, in dem die Frau weitergeführt wird und wirkliche Teilnehmerin ist. Hier stellt Jesus von vornherein fest, dass die Schüler nicht wissen, wovon er spricht. Sie sprechen dann auch nicht Jesus an, sondern reden „zueinander: ‚Hat ihm etwa jemand zu essen gebracht?‘“ Sie verstehen nicht die metaphorische Dimension der Rede Jesu.
Dass es „im Johannesevangelium gerade die Schüler“ sind, was „sich noch öfter zeigen“ wird, „die nicht verstehen“, nimmt Wengst zum Anlass für eine zeitlose Kritik am Innenleben einer christlichen Gemeinde:
Bleibt Gemeinde unter sich, wird in ihr nur „zueinander“ geredet, und lebt sie nicht vom Hören auf ihren Herrn, wird sie unverständig und ihr Reden zu belanglosem Geschwätz.
Diese Formulierung mag Anklang finden unter Christinnen und Christen, die sich dessen gewiss sind, auf den Herrn zu hören; sie garantiert aber noch nicht ein tatsächliches Verstehen der Worte des Herrn. Das zeigt schon die Art und Weise, wie die folgenden Worte Jesu von unterschiedlichen Theologen gedeutet werden.
Nach Wengst (W149f.) stellt die
erste, unmittelbar auf diese Situation bezogene Antwort Jesu … heraus, wovon er wirklich „lebt“, was ihn in seiner ganzen Existenz ausmacht: „Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich geschickt hat, und sein Werk zu Ende führe.“ Jesus ist nichts als Beauftragter Gottes, der darin aufgeht, dass er ausführt, womit er beauftragt ist. Das ist eine im Johannesevangelium geläufige Weise, zum Ausdruck zu bringen, dass im Reden, Handeln und Erleiden Jesu Israels Gott auf den Plan tritt.
Andere christliche Theologen (W150, Anm. 206), wie etwa Michael Theobald, <406> deuten „die hier erstmals vorkommende Wendung ‚der mich geschickt hat‘,“ als eine
„für den Evangelisten … vollgültige (christologische) Gottesaussage…, die sein Wesen sozusagen auf den Punkt bringt“. Er bestimmt damit Gott ganz und gar von Jesus her, während es Johannes umgekehrt darum geht, Jesus als im Auftrag des biblisch bezeugten und von daher bekannten Gottes darzustellen und verstehbar zu machen.
Hier formuliert auch Wengst die oben bereits von Thyen vertretene Auffassung, dass Jesu Sendung vom bekannten Gott Israels her zu begreifen ist. Meine Frage ist, ob nicht Wengst und Thyen diesen Weg doch nur halb beschreiten, denn beide nehmen die Fokussierung des Gottes Israels auf die Sammlung und Befreiung Israels nicht ernst genug, sondern unterstellen Johannes analog zu Paulus, Lukas oder Matthäus die Absicht einer generellen Mission der Völkerwelt, wobei das Ziel des Anbruchs der kommenden Weltzeit von Freiheit, Recht und Frieden für Israel inmitten der Völker auf der Erde unter dem Himmel Gottes erst recht aus dem Blick gerät.
Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt, wie Wengst (W150) die Beauftragung Jesu durch Gott näher beschreibt, in deren Ausführung
Israels Gott auf den Plan tritt. Dass das gerade auch für das Leiden und den Tod Jesu gilt, lässt die Formulierung vom „Zu-Ende-Führen“, vom „Vollenden“ des Werkes Gottes anklingen. Nach 19,28 weiß der am Kreuz hängende Jesus, „dass schon alles vollbracht ist“, und nach 19,30 sagt er vor seinem Tod: „Es ist vollbracht.“ Mit dieser Anspielung auf die Passion, die die Schüler in der Erzählsituation nicht verstehen, wohl aber die Leserinnen und Leser des Evangeliums, deutet Johannes wieder an, dass es kein wirkliches Verstehen Jesu gibt abgesehen von seinem Ende am Kreuz und vom Zeugnis seiner Auferweckung.
Damit ist zwar die Art und Weise beschrieben, wie Jesus nach dem Johannesevangelium sein Ziel erreicht und sein Werk vollendet. Aber worin genau dieses Werk besteht, das doch identisch sein soll mit dem Werk des Gottes Israels, darüber verliert Wengst kein einziges Wort. Meint er, dass sich das von selbst versteht? Sieht er als das Ziel des Kreuzestodes Jesu einfach seine darauf folgende Auferweckung und mit ihr die Hoffnung auf ewiges Leben für alle, die an ihn glauben?
Nach Hartwig Thyen (T273) wird in dem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern „der Sache nach der Dialog mit der Samaritanerin über das ,Lebenswasser‘“ wiederholt, „nun auf der Ebene fester Nahrung“. Aber obwohl die Jünger das Gespräch eröffnen, indem sie ihren Rabbi zum Essen auffordern, bleiben sie anschließend im Gegensatz zur Samaritanerin „nur stumme Zuhörer“. Nachdem die Frau sich durch das Gespräch ein Wissen angeeignet hat (siehe Vers 10 und 25), spricht Jesus die Jünger auf ihr Unwissen an (Vers 32). Noch einmal zitiert Thyen Hendrikus Boers: <407>
„Die Rolle, die sie in der Geschichte spielen, besteht darin, ihre Unwissenheit zu zeigen und Jesus die Gelegenheit zu geben, die Bedeutung der Geschichte zu kommentieren. Ihre Unwissenheit wird durch ihre Vermutung unterstrichen, dass jemand anderes ihm etwas zu essen gegeben haben muss. Ironischerweise hat das tatsächlich jemand getan, nämlich die Frau durch ihr Gespräch mit Jesus, aber es war nicht die Art der Nahrung, die sie im Sinn hatten.“
An dieser Stelle geht Thyen gar nicht auf das Werk Gottes ein, das Jesus zu vollenden hat, und nur sehr knapp auf „den Willen dessen“ ein, „der ihn gesandt hat“. Dieser Wille besteht ihm zufolge in diesem Zusammenhang darin, dass
er sich dem göttlichen dei {es ist nötig} fügt, durch Samaria zu ziehen (V. 4). Und er tut ihn durch sein Gespräch mit der Samaritanerin, das sie zu seiner Zeugin unter ihren Landsleuten macht. Strukturell ist das ein ganz ähnlicher Vorgang, wie der Weg der beiden Johannesjünger, die Jesus auf die martyria {Zeugnis} ihres Meisters über das ,Lamm Gottes‘ hin ,nachfolgen‘ und jenen Tag ,bei ihm bleiben‘, um dann ihrerseits als seine Zeugen, andere zu ihm zu rufen (1,35ff).
Nach Ton Veerkamp <408> hat die „johanneische Strategie des Missverständnisses“ in der Schilderung des Verhaltens der Schüler Jesu, die „ziemlich ratlos“ sind,
etwas von einer Humoreske: „Ich habe Speise zu essen, von der ihr nichts wisst“, sagt Jesus, wohl wissend, dass sie ihn falsch verstehen: „Hat jemand – gar diese Person – ihm etwas zu essen gegeben?“
In seiner Auslegung von Vers 24 bringt Veerkamp kurz und knapp auf den Punkt, worin das Werk des Gottes Israels besteht. Jesus klärt seine Schüler
umgehend darüber auf, dass essen für den Messias heißt, den Willen dessen zu tun, dessen Gesandter er ist. Er muss das Werk Gottes zu Ende führen. Das Werk Gottes ist Israel, alle zwölf Söhne Israels.
Nur wenn die Sammlung ganz Israels einschließlich der verlorenen Stämme Samarias und das Leben dieses Gesamt-Israel in der kommenden Weltzeit auf dieser Erde ernstgenommen wird, legt man konsequent den Gott, der Jesus sendet, vom jüdischen TeNaK her aus. Wie er das konkret meint, wird Jesus in den folgenden Versen mit Hilfe einer Erntemetapher erläutern.
↑ Johannes 4,35-38: Jesu Rede über die Ernte zum Leben der kommenden Weltzeit
4,35 Sagt ihr nicht selber: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte?
Siehe, ich sage euch:
Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder: sie sind schon reif zur Ernte.
4,36 Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben,
auf dass sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet.
4,37 Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet.
4,38 Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt;
andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.
[27. Mai 2022] Soeben sprach Jesus vom Werk seines Vaters, das er zu vollenden hat, nachdem seine Schüler sich als schwer von Begriff gezeigt hatten. Nun traut Jesus genau diesen Jüngern offenbar das Einbringen einer Ernte zu, die irgendetwas mit diesem Werk des Vaters zu tun haben muss. Aber was?
Klaus Wengst (W150) zufolge knüpft Jesus in Vers 35 an „die allgemeine Erfahrung“ seiner Schüler an, dass „vom Ende der letzten Aussaat bis zum Beginn der ersten Ernte … vier Monate“ vergehen:
Dieser allgemeinen Erfahrung setzt Jesus seine Aussage entgegen: „Passt auf! Ich sage euch: Macht eure Augen auf und schaut auf die Felder! Sie sind reif für die Ernte.“ Der Satz wird nicht der Erfahrung widersprechen wollen – und vermöchte das auch nicht –, dass vor dem Nissan nicht geerntet wird. Er kann nur Geltung beanspruchen auf einer metaphorischen Ebene. Im Zusammenhang der Erzählung dürften die Samariter im Blick sein, die nach V. 30 aus der Stadt zu Jesus hinausgegangen sind und nach V. 39 ihr Vertrauen auf ihn setzen werden. Die zur Ernte reifen Felder werden also zum Bild für die Mission.
Im folgenden Vers 36 tritt das „Hinüberspielen auf eine andere Ebene“ noch deutlicher hervor, indem das Einbringen der Ernte, von der hier die Rede ist, ausdrücklich „fürs ewige Leben“ erfolgen soll. Diesen Begriff verbindet Wengst (W150f.) wie zu Vers 14 mit dem
Aspekt von erfülltem, gültigem, gemeinschaftlichem Leben…, das in der Gemeinde Ereignis wird. Darauf weist jetzt auch die Zielangabe: „damit der Sämann sich zugleich freue mit dem Schnitter“. Dass man sich bei der Ernte freut, ist sprichwörtlich (Jes 9,2). Solche Freude ist da, wo Gemeinde entsteht – wie jetzt gleich in der erzählten Situation in Samarien -, in der neues Leben möglich ist.
In „diesen weiten Horizont“ der Weltmission ordnet Wengst auch „die folgende Aussage“ ein:
„Denn hier trifft der Spruch zu: Einer ist der Sämann und ein anderer der Schnitter.“ Normalerweise ist es so – und soll es auch so sein -, dass diejenigen, die säen, auch ernten, was sie gesät haben. Wo das auf dieser elementaren Ebene nicht geschieht, ist es schlimm. So wird in Mi 6,15 Jerusalem wegen seines Unrechts angedroht: „Du wirst säen, aber nicht ernten.“ Im Blick auf das Entstehen und Wachsen von Gemeinde ist das allerdings kein Unglück, dass diejenigen, die säen, andere sind als diejenigen, die ernten. In der Ernte, wer immer sie vollzieht, kommt die Arbeit derer zum Ziel, die gesät haben; und die in den Genuss der Ernte kommen, werden selbst wieder solche, die säen – wenn anders Gemeinde als lebendige deshalb zugleich werbende, an-ziehende, attraktive Gemeinde ist.
Das klingt alles sehr folgerichtig, allerdings nur dann, wenn tatsächlich im Johannesevangelium eine Völkermission in diesem Sinne das Werk darstellen würde, zu dessen Vollendung Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde.
Zum abschließenden Vers 38 verzichtet Wengst (W151, Anm. 212) auf eine Darstellung seiner „vielen Deutungsmöglichkeiten“. Ihm zufolge übersteigt Jesus „die erzählte Situation“, indem er sagt: „Ich habe euch gesandt zu ernten, worum ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und ihr seid in ihre Mühe eingetreten“, denn
Jesus hat in der bisherigen Erzählung des Evangeliums seine Schüler noch nicht ausgesandt. Sie treten auch jetzt in Samarien nicht in Aktion. Erst in den Abschiedsreden wird er sie beauftragen im Blick auf die Zeit, wenn er selbst nicht mehr da ist. Er blickt also weit voraus und spricht damit über die Schüler die Leserinnen und Leser des Evangeliums an. Sie stehen in einer Traditionskette. Ihnen kommt die Mühe der ihnen Vorangegangenen zugute. Indem sie sich ihrerseits um das ihnen Überlieferte redlich abmühen, tragen sie dazu bei, dass die Kette nicht abreißt.
Anders als die Lutherbibel übersetzt er das Wort kopian, das ein schweres Sich-Abmühen bezeichnet, nicht einfach mit „arbeiten“ und entdeckt einen möglichen Zusammenhang mit Vers 6, wo „dasselbe Wort“
den am Brunnen zurückbleibenden Jesus charakterisiert hatte: „abgemüht“? Gewiss, das gilt dort in einem ganz elementaren Sinn. So heißt es ja ausdrücklich: „abgemüht von der Wanderung“. Aber von V. 38 her wächst dieser Charakterisierung noch eine Bedeutungsdimension zu. Die „Wanderung“ Jesu geht noch weiter – bis zum Kreuz. So gehört er mit Sicherheit und an herausragender Stelle zu den „anderen“, die sich abgemüht haben. Aber es wird hier nicht exklusiv von ihm gesprochen. Johannes formuliert im Plural. Und Jesus selbst und seine Schüler stehen ihrerseits in der Traditionskette Israels, was auch das Johannesevangelium auf Schritt und Tritt belegt. Diese Traditionskette ist nicht abgebrochen, sondern neben der Kirche weitergegangen und sollte von ihr wahrgenommen und nicht ignoriert werden.
Diese Beobachtungen von Wengst sollten auf jeden Fall ernstgenommen werden.
Hartwig Thyen (T273) beschreibt Jesu Wort über Saat und Ernte als Glied einer Kette von analogen Formulierungen in unserer Szene:
[W]ie Jesus schon dem guten Wasser des Jakobsbrunnens, der nach dem Glauben der Samaritaner seit den Tagen des Patriarchen nie versiegt war, sein unendlich besseres ,Lebenswasser‘ gegenübergestellt hatte und wie er die Speise, die ihm seine Jünger fürsorglich beschafft hatten, unberührt ließ um seiner besseren ,Speise‘ willen, nämlich „den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein Werk zu vollenden“, so stellt er jetzt der verläßlichen Erfahrung der Zeit zwischen Saat und Ernte mit den Worten: idou legō hymōn {siehe, ich sage euch}, seine neue Zeit und eine ganz andere Art von Ernte entgegen.
Spannend ist nun, wie Thyen darauf eingeht, dass „das Wortfeld um Saat und Ente, Reifen und Fruchtbringen seit alters zum festen und bevorzugten Bestand der religiösen Metaphorik Israels“ gehörte. Vor allem (T273f.) die Worte
therismos und therizō {Ernte und ernten} dieses Feldes sind zu derart gängigen Metaphern für Gottes endzeitliches Kommen zu Heil und Erlösung (Jes 27,12; Hos 6,11; Ps 126,5f) wie zu Gericht und Verderben (Joel 4,13; Jes 18,5; 63,1ff) geworden, daß die Jünger unmittelbar begreifen müssen, von was für einer Art von ,Ernte‘ Jesus hier redet, und wie er damit eben die Fragen beantwortet, die zu stellen sie nicht gewagt hatten…
Was hatte denn Jesus bei der Samaritanerin gesucht? Wozu hatte er mit ihr gesprochen? Indem Thyen seiner eigenen Aussage zu Johannes 4,10 widerspricht, dass das Gespräch Jesu mit der Frau jenseits der Querelen zu betrachten ist, die „in der notorischen Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern begründet“ sind, macht er nun deutlich, dass genau die Überwindung dieser Feindschaft eine zentrale endzeitliche Hoffnung der jüdischen Propheten ist:
Denn zur eschatologischen ,Ernte‘ gehört zuerst die Sammlung der Zerstreuten und die Versöhnung der Verfeindeten des Gottesvolkes, und das heißt vornehmlich: die Heilung des Bruchs zwischen Ephraim (Israel) und Juda (vgl. Ez 37,16ff; Jer 31,17-20; Sach 10,61). Von dieser endzeitlichen Versöhnung Ephraims mit Juda her, die ein notwendiger Teil jenes ,Werkes Gottes‘ ist, das zu vollenden, Jesus seine ,Speise‘ nennt, will nun auch das edei {er musste} des am Anfang unserer Szene noch dunklen Satzes: edei de auton dierchesthai dia tēs Samareias {Er musste aber durch Samaria hindurchreisen} (V. 4) verstanden sein…
Es ist Thyen also durchaus bewusst, dass die Samaritanerin Nord-Israel, „Ephraim“, repräsentiert, was er bisher nicht so deutlich herausgestellt hat.
Weiter erinnert Thyen daran, dass bereits die Passage Johannes 1,32-34 über den „Geist Gottes“, der nach dem Zeugnis des Täufers „auf Jesus herabgekommen und auf ihm geblieben sei“, außer „der synoptischen Tauferzählung“ auch das messianische Kapitel Jesaja 11 aufruft, wo in Vers 2 vom Ruhen des Geistes auf dem Messias Gottes die Rede ist. In diesem Kapitel heißt es in den Versen 11 und 12 (Luther 2017):
Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feinde Judas werden ausgerottet. Ephraim wird nicht mehr neidisch sein auf Juda und Juda Ephraim nicht mehr feind.
Dazu schreibt Thyen mit vollem Recht:
Um diese Sammlung der ,Verlorenen Israels‘ geht es in unserer Szene. Und wenn Jesus seine Jünger auffordert, ihre Augen zu erheben und wahrzunehmen, daß die Felder bereits ,weiß‘, d. h. reif sind zur Ernte sind, dann sollen sie natürlich auf die von ferne bereits nahenden Samaritaner blicken. Sie sind das Feld und die Frucht dieser reichen Ernte.
Leider wird Thyen aus dieser Erkenntnis trotzdem nicht die Konsequenz ziehen, die Sammlung ganz Israels und seine diesseitige Befreiung als zentrales Ziel des Messias Jesus im Johannesevangelium zu betrachten.
Weiter untersucht Thyen die Bedeutung des Wortes ēdē, „schon“, das die Lutherbibel auf den Schlusssatz von Vers 35 bezieht, dass die Felder „schon reif zur Ernte“ sind. In seiner Übersetzung (T269) verfährt Thyen ebenso, in seiner Auslegung dagegen (T274) versteht er es als das erste Wort des folgenden Satzes. Indem der in Vers 36 genannte therizon {Erntende} seinen Lohn „schon jetzt“ und „nicht erst nach getaner Erntearbeit“ empfängt,
kann es sich bei ihm nur um den Herrn der Felder handeln, dessen ,Lohn‘ in der eingebrachten Ernte selbst besteht. Zudem zeigt die aus der Metaphorik ausbrechende Wendung: kai synagei karpon eis zōēn aiōnion {und sammelt Frucht für das ewige Leben}, daß dieser therizōn als derjenige, der ,ewiges Leben‘ gewährt, nur Jesus selbst sein kann. Und er sammelt diese ,Frucht‘ jetzt, „damit sich der Säende zugleich mit dem Erntenden freue“ (V. 36).
Wenn aber Thyen zufolge (T275) „der ,Erntende‘ … fraglos Jesus selbst“ ist, wer ist „dann der ,Säende‘…, der nach V. 36f an seiner Freude über die reiche Ernte teilhat“? Er folgt der von Hendrikus Boers <409> wohlbegründeten Lösung,
die Samaritanerin als die ,Säende‘ zu begreifen: „Sie ist Jesu Mitarbeiterin in einer noch nie dagewesenen Weise, konkreter sogar als Johannes der Täufer, denn Johannes wies lediglich auf Jesus als ‚das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt‘ (1,29). Die Frau nimmt aktiv mit Jesus daran teil, den Willen seines Vaters zu tun; … Die Bedeutung der Parallele zwischen Johannes und der Frau wird durch die Aussage des Johannes unterstrichen … ‚Es ist der Bräutigam, der die Braut hat. Der Freund des Bräutigams, der dort steht und seine Stimme hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. So ist meine Freude (chara) vollkommen. Er muss zunehmen (an Bedeutung), ich abnehmen‘ (3,29-30). Was Johannes sagt, ist die andere Seite dessen, was Jesus über den Sämann und den Schnitter sagt (4,36-37)“.
Dass auch die Frau wie Johannes der Täufer an Bedeutung abnehmen muss (T276), wird sich nach Thyen schon bald bewahrheiten, indem „die Samaritaner der Frau am Ende erklären, sie glaubten nun nicht mehr auf Grund ihrer Rede, sondern weil sie selbst gehört und erkannt hätten, daß Jesus tatsächlich der sōtēr tou kosmou {Retter der Welt} sei (4,42)“.
So bestechend allerdings diese Argumentation erscheint, bleibt doch eine Frage offen: Warum sollte Jesus in zwei von fünf Versen der an die Jünger gerichteten Rede (36-37) ausschließlich von der Frau als der Säenden und sich selbst als dem Erntenden sprechen und dabei ausdrücklich weder auf sie noch auf sich Bezug nehmen? Gerade wenn sie so unverständig sind, wie in den Versen zuvor dargestellt, wären sie doch gar nicht in der Lage, den von Thyen so akribisch herausgearbeiteten Bezug wahrzunehmen.
Schließlich bedenkt Thyen im Blick auf die in seinen Augen „gewiß nicht zufällige Analogie zwischen der Hochzeitsfreude des Johannes und der Erntefreude der Samaritanerin“ auch „noch einmal das intertextuelle Spiel unsers Autors mit den biblischen Brunnenszenen“. Nach Paul D. Duke <410> liegt in Johannes 4 eine „ironische Situation“ vor, die er folgendermaßen umschreibt:
„Die Situation entspricht genau der einiger alttestamentlicher Geschichten, in denen ein Mann eine Frau an einem Brunnen trifft … Wenn Jesus sich also auf ein fremdes Territorium begibt und eine Frau an einem Brunnen trifft, wird der richtig eingestimmte Leser sofort einen Zusammenhang oder einen Unterton des Werbens und der bevorstehenden Ehe vermuten. Eine solche Annahme wird hier belohnt, denn … der Autor hat diese Erzählung unmittelbar nach einer Geschichte platziert, in der das in Hochzeitswein verwandelte Wasser dem Bräutigam zugesprochen wird (2,1-11), und fast unmittelbar nachdem Johannes der Täufer davon gesprochen hat, die Stimme des Bräutigams zu hören (3,29). Ein solcher Kontext verstärkt die Ironie der Unkenntnis der Frau über die Identität Jesu…“.
Thyen zufolge (T276f.) macht Duke „die symbolische Erzählung dann jedoch zu Unrecht nahezu zur Allegorie, wenn er etwa zu Jesu Aufforderung an die Frau, ihren Mann zu rufen, und zu deren Antwort, daß sie keinen Mann habe, erklärt“ (T277):
„Überraschend ist die plötzliche Offenbarung Jesu, dass sie entgegen der Erwartung des Lesers und der Andeutung der Frau nicht deshalb unverheiratet ist, weil sie eine Jungfrau ist, sondern weil sie eine fünffache Verliererin ist und derzeit eine unerlaubte Affäre hat. Das ist situative Ironie par excellence. In den alttestamentlichen Brunnenszenen kommt immer eine naarah vor, ein Mädchen, dessen Jungfräulichkeit vorausgesetzt und manchmal auch ausdrücklich betont wird (Gen 24,16). Wenn der himmlische Bräutigam Jesus diese Szene spielt, entpuppt sich sein Gegenüber jedoch als Flittchen. Er vermählt sich nicht mit der Unschuld, sondern mit verletzter Schuld und Entfremdung“.
Das klingt nach Thyen „zwar erbaulich, wird aber weder unserer Erzählung noch auch ihrer keineswegs als reuige Sünderin, sondern als selbstbewußte Frau erscheinenden Samaritanerin gerecht“. Zumal wegen der engen „Verwandtschaft der Rollen der Frau am Jakobsbrunnen mit derjenigen Johannes des Täufers“ will er „nicht diese individuelle Frau, sondern die wachsende Gemeinde Jesu als bräutliches Symbol“ begreifen. Ich wollte schon schreiben, dass Thyen damit allerdings genau wie Wengst unsere Geschichte allzu schnell mit christlichen Missions- und Gemeindevorstellungen kurzschließt, aber er fährt fort:
Dank des Wirkens der Frau, die gesät hat, was Jesus jetzt ernten kann, und sich darüber zusammen mit ihm freut, beginnt hier mit dem Kommen der Samaritaner und ihrem Glauben die endzeitliche Restitution des erwählten Zwölf-Stämme-Volkes. Um ihretwillen mußte Jesus durch Samarien reisen (4,4).
Wenn Thyen auf diese Weise den Bezug von Judäa und Samaria auf Juda und Ephraim ernstnimmt, könnte er die Symbolik der messianischen Hochzeit auch auf die Überwindung des von Hosea und Jeremia angeklagten vielfachen Herumhurens von Israel (und Juda!) mit fremden Göttern beziehen. Tatsächlich ist Samaria alles andere als eine unangetastete bräutliche naˁarah, sondern ein von fremden Eroberern und ihren Göttern vielfach vergewaltigtes und ausgebeutetes Land; das ist die bis zur gegenwärtigen Zeit der römischen Herrschaft nicht überwundene Situation, die Jesus der Samaritanerin in den Versen 4,17-18 prophetisch vor Augen stellt und von der Judäa genau so betroffen ist.
Nun zu den Schwierigkeiten, die Vers 38 der Auslegung bietet. Er gehört Thyen zufolge (T278) „zu den am heftigsten umstrittenen unseres Evangeliums“, da in ihm erstens Jesus davon spricht, seine Jünger bereits zur Ernte ausgesandt zu haben, und zweitens andere erwähnt, die bereits „vor den Jüngern mühsam gearbeitet haben“. Nun wurden aber
die Jünger nach der Erzählung unseres Evangeliums bisher zu keiner Zeit von Jesus ausgesandt, geschweige denn mit dem Einbringen der eschatologischen „Ernte“ betraut; ihre ausdrückliche Sendung wird vielmehr erst durch den Auferstandenen und unter dem Geleit des österlichen Geistes erfolgen (20,21-23…). Und zum anderen wird das Problem der Identität der alloi {anderen}, die vor den Jüngern gearbeitet haben sollen, höchst kontrovers diskutiert.
Nach Thyen ist „die hier im Tempus der Vergangenheit genannte Sendung der Jünger“ erneut ein intertextuelles Spiel mit „synoptischen Prätexten“; sie kann sich nur
auf einen in unserem Evangelium nicht erzählten Missionsauftrag Jesu an seine Jünger schon zu seinen Lebzeiten zurückbeziehen, wie ihn die Synoptiker berichten (vgl. die Aussendung der Zwölf: Mk 3,16-19 und 6,7ff; Mt 9,37f und 10,1ff; Lk 9,1ff; ihre Rückkehr: Mk 6,30; Lk 9,10 sowie die Aussendung der Zweiundsiebzig: Lk 10,1ff).
Dagegen lehnt Thyen (T279) die Vorstellung ab, hier habe Jesus seine Jünger „im Geiste“ bereits „in den Status ihrer österlichen Sendung versetzt“, zumal ihnen dieser Geist „noch gar nicht verliehen wurde“.
Nimmt man dagegen ernst, dass Johannes bewusst mit dem „Thema der eschatologischen Ernte und der Jüngeraussendung“ spielt, wie es etwa in Matthäus 9,37f. und der anschließenden „Sendung der Zwölf“ oder in der „durch das gleiche Wort von der ‚großen Ernte‘ eingeleitete Aussendung der Zweiundsiebzig bei Lukas (10,1ff)“ dargestellt wird, erhält man sogar noch als Zugabe eine Erklärung, wer die in Johannes 4,38 erwähnten alloi, „anderen“, sein mögen. Nach der Rückkehr der ausgesandten Jünger heißt es dort am Ende:
„Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht! Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige begehrten zu sehen, was ihr seht, und sahen es nicht, und zu hören, was ihr hört, und konnten es nicht hören“ (V. 23f). …
Die in V. 38 als alloi Bezeichneten wären dann diese bei Lukas genannten „Propheten und Könige“. Und das erscheint uns auch als die weitaus plausibelste Lösung der viel diskutierten Frage nach deren Identität.
Thyen weiß sich also (T281) unter anderem auch „mit den Kirchenvätern“ einig, „daß Mose und die Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer und unserer samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen jene alloi sein müssen, die die Saat ausgebracht und die Felder bestellt haben, in deren Ernte die Jünger eintreten.“
Viele andere Autoren dagegen (T280) „beziehen … die ‚Aussendung‘ der Jünger unter Berufung auf den Kontext von Joh 4 auf deren Samaria-Mission“, wozu sie allerdings den Vers 38 „mit der (nachösterlichen) christlichen Mission Samarias Act 1,8 und 8,4ff)“ verbinden müssen. Genau mit dieser speziellen Mission werden Thyen zufolge aber gerade nicht Jesu Jünger beauftragt (T279f.):
Die Eröffnung dieser Mission ist vielmehr die göttliche Bestimmung Jesu (edei de auton dierchesthai dia tēs Samareias {er musste aber durch Samaria hindurchreisen}: V. 4), Als der „gute“ und „einzige Hirte“ (Ez 34,23) ist er dazu gesandt, die verirrten und getrennten Schafe Ephraims und Judas wieder zu vereinen zu der einen Herde seines ,Vaters“ (s. u. zu Joh 10 als intertextuellem Spiel mit Ez 34…). Da der Reiz jeglicher Intertextualität auf der Spannung beruht, die sie zwischen dem neuen Text und seinen Prätexten erzeugt, bleibt der neue Text auf den alten angewiesen. Wie sehr sein Autor den alten Text auch variieren mag, so setzt sein intertextuelles Spiel den Prätext gerade in Kraft, und es würde scheitern, wenn er ihn einfach ersetzen wollte. Vor dem Hintergrund von Jesu ausdrücklichem Gebot an seine zur Mission ausgesandten Jünger, keine Stadt der Samaritaner zu betreten (Mt 10,5), gewinnt darum Jesu ureigene Eröffnung dieser ,Mission‘ ihren spezifischen Reiz.
Im Ergebnis unterscheidet Thyen also zwischen zwei verschiedenen Missionsfeldern: Während Jesus selbst die von der Samaritanerin ausgestreute Saat unter ihren Landsleuten als eine Ernte einbringt, an der sich der Erntende gemeinsam mit der Säenden erfreuen kann (was Thyen zufolge als ein Ausnahmefall dargestellt ist), können seine Jünger Früchte ernten, die vor ihnen von anderen ausgesät worden sind.
Abgesehen von den bereits oben geäußerten Bedenken kommt mir diese Unterscheidung nicht sehr logisch vor, zumal Thyen unter diese „anderen“ ja auch selbst „nicht nur Mose und die Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer“, sondern auch die „Frau am Jakobsbrunnen“ rechnet. Ein leiser Verdacht regt sich in mir, dass Thyen die von Jesus bewirkte Versöhnung Judas mit Ephraim deswegen als besonderen missionarischen Ausnahmefall behandelt, um nicht die gesamte Zielsetzung des johanneischen Jesus auf die Zusammenführung von Judäa mit Samaria in einem Gesamt-Israel zuspitzen zu müssen, auf dessen Befreiung im Leben der kommenden Weltzeit das durch Jesus zu vollendende Werk des Vaters hinausläuft.
Ton Veerkamp <411> zufolge stellt Jesus seinen Schülern im Bild der Ernte vor Augen, dass mit der Ankunft der Samaritaner die Vollendung genau dieses Werkes Gottes beginnt:
Das Werk Gottes ist Israel, alle zwölf Söhne Israels. In welchem Zustand Israel, der Augapfel Gottes, verkehrt, erfahren wir im fünften Kapitel: Israel ist ein Krüppel, 5,5. Hier aber geht es darum, dass die Zeit reif ist: „Es geht auf die Ernte zu“, sie müssen ihre Augen erheben. In der Schrift erheben die Menschen ihre Augen zum Gott Israels, Psalm 121,1; 123,1. Im Buch Jeremia heißt es, 16,14f.:
Deswegen:
da kommen die Tage,
Verlautbarung des NAMENS,
da sagen sie nicht:
„Es lebe der NAME,
der die Kinder Israels hinaufbrachte
aus dem Land Ägypten“,
vielmehr:
„So wahr der NAME lebt,
der die Kinder hinaufbrachte aus dem Nordland (Babel),
aus allen Ländern (ˀarazoth, chōrai),
in die er sie hineingejagt hatte,
sie zurückkehren zu lassen zum Boden,
den er unseren Vätern gab.“Die Schüler müssen ihre Augen erheben, sie müssen die Länder der Welt sehen, die chōrai, ˀarazot, in die Israel verjagt wurde. Diese Länder sind reif für die Ernte, reif dafür, das ganze zerstreute Israel zurückkehren zu lassen.
Anders als Wengst und Thyen oder auch die Lutherbibel achtet Veerkamp bei der Übersetzung des Wortes chōrai auf dessen Doppelsinn. Natürlich kann im Zusammenhang mit der Ernte an abzuerntende Felder gedacht werden, aber bei der Sammlung Israels ist an die Länder zu denken, in denen die versprengten Teile des Volkes in der Diaspora leben. Später wird der Evangelist ausdrücklich verdeutlichen (11,52), dass das Werk, dass „der Gott Israels, der VATER, Jesus aufgetragen hat, die ‚Zusammenführung Israels in eins‘“ ist.
Worauf diese Ernte letztlich hinausläuft, macht Johannes hier klar, indem er die Bildrede aufgibt und von „Frucht für das Leben in der kommenden Weltzeit“ spricht: „Die kommende Weltzeit ist jene Weltordnung, in der ganz Israel bei sich sein kann“, endlich im Frieden, in einer Ordnung der Freiheit und des Rechts. Zu seiner Zeit kann es nicht mehr um einen Exodus aus Ägypten in ein Gelobtes Land oder um die bloße Rückkehr Israels aus der Verbannung gehen, vielmehr muss die gesamte versklavende Weltordnung überwunden werden, um Befreiung für Israel zu erreichen. Gerade darum sind Bezüge auf den jüdischen TeNaK notwendig,
um die politische Belehrung Jesu verstehen zu können. Bei Johannes ist Jesus der, der Israel neu stiftet, wie im Buch Jeremia die Rückkehr aus Babel die Stelle der Befreiung aus Ägypten einnehmen soll. Solche „neuen Bünde“ gab und gibt es immer wieder.
Aber noch einmal zurück zum Bild von Saat und Ernte. Wie versteht Veerkamp das Verhältnis des Säenden zum Erntenden?
Der Erntende kann seine Arbeit nur tun, wenn der Säende seine Arbeit getan hat. Das Ganze ist das Ergebnis der Arbeit beider, deswegen ist ihre Freude eine gemeinsame Freude.
Thyen hatte diese Aussage auf die gemeinsame Freude Jesu mit der Samaritanerin über den Missionserfolg bei ihren Landsleuten bezogen. Veerkamp formuliert den Satz wie eine grundsätzliche Aussage über Saat und Ernte, unabhängig davon, ob der Säende den Erfolg seiner Saat noch erlebt. Außerdem findet er zur gleichzeitigen Freude des Säenden mit dem Erntenden eine biblische Parallele in Psalm 126:
Als der NAME kehren ließ, Wiederkehr nach Zion,
ist es uns wie im Traum,
ja, voll des Lachens unser Mund,
voll des Jubelns unsere Zunge.
Ja, da wird man unter den Volksmächten sagen:
„Großes hat der NAME an diesen getan.“
Großes hat er an uns getan,
Freude ist uns geworden.
Lasse, Ewiger, uns kehren,
wie die Wasserläufe im Negev.
Die säen in Tränen, jubeln beim Ernten,
wer ging, ging weinend aus, trug Samenlast,
wer kommt, kommt jubelnd zurück, bringt Garben ein.
Dazu stellt Veerkamp fest: Damals in diesem „Wallfahrtslied ist der Weinende identisch mit dem Jubelnden. Hier aber nicht.“ In seiner Gegenwart sieht der Evangelist
einen Unterschied zwischen dem, der säte, und dem, der erntete, ausdrücklich nach dem Prophetenwort: „Du säst zwar, aber erntest nicht“, Micha 6,5. Die jubeln werden, sind nicht die, die geweint, hier: sich abgemüht haben, wie Josua in seiner Abschiedsrede den Kindern Israels sagte, Josua 24,13:
Ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht bemüht habt (jagaˁtha, ekopiasate!),
Städte, die ihr nicht gebaut habt – ihr wohnt darin!
Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt habt – ihr esst davon!
Und jetzt: habt Ehrfurcht für den NAMEN und dient ihm …Im Buch Josua ist der Unterschied: Abgemüht haben sich die Völker, die vor Israel im Land gewohnt haben. Diese sind bei Johannes nicht gemeint. Gemeint kann nur sein, dass die messianische Gemeinde („ihr“) nicht gesät hat, nicht die Bedingungen für die Ernte geschaffen hat, denn „andere haben sich abgemüht“, haben die Bedingungen für die Ernte geschaffen. Wer sind diese anderen? Es sind die Propheten Israels…
In diesem Punkt sind Wengst und Thyen mit Veerkamp einig, wie wir gesehen haben. Außerdem meint Veerkamp wie Wengst, dass durch das Wort kopian in Vers 38 eine Verbindung zu Vers 6 hergestellt wird, in dem es auf Jesus bezogen war. Während Wengst dabei in erster Linie an Jesu Weg ans Kreuz denkt, erinnert das Wort Veerkamp zufolge daran, dass
die messianische Bewegung … in Jesus auch den letzten und definitiven „Propheten“ [sah]. Hier schließt sich der Kreis der Erzählung: Jesus saß „abgemüht durch die Wegstrecke“ (kekopiakōs) am Brunnen, andere haben sich „abgemüht“ (kekopiakasin). Jesus sieht sich in einer Reihe mit den Propheten. Einer von ihnen sagte, Jesaja 49,4:
Ich aber habe gesagt: „Ich habe mich ins Leere bemüht (jagaˁthi, ekopiasa).
Für Chaos und Nebel all meine Kraft verbraucht.
Aber mein Recht liegt im NAMEN, mein Wirken in meinem Gott.“„Obwohl er solche Zeichen vor ihnen getan hatte, haben sie ihm nicht vertraut“, sagt Johannes als Resümee (12,37), mit einer ausdrücklichen Bezugnahme auf das Buch Jesaja. Johannes sieht Jesus auch als einen der großen Propheten Israels und befindet sich damit im Einklang mit den anderen Evangelien.
↑ Johannes 4,39-42: Die Samaritaner erkennen Jesus als den Befreier der Welt
4,39 Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt
um des Wortes der Frau willen, die bezeugte:
Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.
4,40 Als nun die Samariter zu ihm kamen,
baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe; und er blieb dort zwei Tage.
4,41 Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen.
4,42 Und sie sprachen zu der Frau:
Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen;
denn wir haben selber gehört und erkannt:
Dieser ist wahrlich der Welt Heiland.
[28. Mai 2022] Indem (W151) der mit Vers 39 beginnende Abschnitt „den nach V. 30 unterbrochenen Erzählfaden“ wieder aufnimmt, ist er nach Klaus Wengst „zugleich erzählerische Illustration des in dem Zwischenstück V. 31-38 Reflektierten“, denn die Frau hat mit ihrem Zeugnis Glauben geweckt (W151f.)
und es entsteht Gemeinde als neue Sozialität. Das der Frau von Jesus Verheißene ist ausgeführt. Was er ihr gesagt hat, hat sich als „Wasser“ erwiesen, das in ihr „zu einer Quelle von Wasser“ geworden ist, „das fürs ewige Leben sprudelt“, sodass nun „Frucht fürs ewige Leben“ eingesammelt wird (V. 36).
Zum zweitägigen Aufenthalt Jesu bei den Samaritanern meint Wengst (W152):
Wo Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen und Gemeinde entsteht, da „bleibt“ Jesus unter ihnen – auch länger als zwei Tage. Und wenn Jesus in der Gemeinde „bleibt“, wird es zu je eigenem Hören und Vertrauen auf ihn kommen, zum Glauben, der sich seiner selbst gewiss ist…
Indem Wengst (Anm. 213) in Vers 41 die „von fast allen Handschriften gebotene Lesart pleíous“, die sie als Steigerungsform im Nominativ Plural auf noch viel „mehr“ Menschen beziehen würde, die Vertrauen zu Jesus gewinnen, „als sekundär betrachtet“ und „die nur von Papyrus 75 und den altlateinischen Handschriften e und r1 bezeugte Lesart pleíon“ für ursprünglich hält, bezieht er das „mehr“ auf die Intensität des Vertrauens (W152):
„Und noch viel mehr gewannen sie Vertrauen um seines Wortes willen. Und der Frau sagten sie: ,Nicht mehr um deinetwillen vertrauen wir.‘“ Die um des Wortes Jesu willen glauben, sind also dieselben, die um der Rede der Frau willen zum Glauben kamen. Das aber heißt, dass der Text die Situation nicht so vorstellt, dass die Anwesenheit Jesu in Sychar eine quantitative Ausweitung der Glaubenden dort bewirkte.
Daran anschließend versucht Wengst zu erklären, wie Menschen, die Jesus nicht mehr persönlich begegnen können, dennoch auf sein eigenes Wort hören können:
Der vom Reden der Zeuginnen und Zeugen initiierte Glaube wächst und wird stärker im Hören auf das Wort Jesu selbst – das seinerseits nicht anderswo zu vernehmen ist als im Reden der Zeuginnen und Zeugen.
Das die Szene abschließende Bekenntnis der Samaritaner: „Dieser ist wahrhaftig der Retter der Welt“ rundet die Beantwortung der Frage ab,
wer Jesus ist (V. 10). Er ist Jude; er ist Prophet; er ist der Messias; er ist der Retter der Welt. Keine Aussage überholt die vorangehende in der Weise, dass diese dann überflüssig würde oder gar nicht mehr zutreffend wäre. Nur zusammen beschreiben sie die Identität Jesu: Er ist der Prophet und Messias aus Israel für die Völker. In dieser Geschichte wird nicht den Juden der Messias präsentiert, sondern den Völkern ihr Retter, der ein Jude ist. Es geht darum, zu Israels Gott in Beziehung zu treten. Dazu verhilft der Messias Jesus den Völkern.
Dieser Versuch, das Johannesevangeliums in den interreligiösen Dialog einzubauen, ist mir sympathisch, trifft aber sicher nicht die ursprüngliche Aussageabsicht des Johannes, denn in seinen Augen sind die Samaritaner definitiv nicht „die Völker“, sondern sie repräsentieren Ephraim oder Josef bzw. Nord-Israel als wesentlichen Teil des aus zwölf Stämmen bestehenden Volkes Israel. Zwar schlägt also tatsächlich das „Bekenntnis zu Jesus als ‚dem Retter der Welt‘ … einen Bogen zurück zu der Aussage von V. 22, dass ‚es Rettung von den Juden her gibt‘“ und (Anm. 214) „die Einführung dieses Bekenntnisses mit ‚wir wissen‘ stellt eine Beziehung her zu dem in 4,22 vorangehenden Satz: ‚Wir beten an, was wir kennen‘.“ Aber es sind nicht die Völker, sondern die Samaritaner als ein Teil Israels, die im Vertrauen zu Jesus nun wie die Juden wissen, dass die Befreiung von den Juden kommt, indem der jüdische Jesus sie für ganz Israel bewirken wird. Diese jüdisch-messianische Sichtweise des Johannes verchristlicht Wengst vorschnell, indem er paulinisch-lukanische und matthäische Theologie in sein Evangelium einträgt.
Zu kurz greift in diesem Zusammenhang auch Wengsts erneuter Hinweis (W152) „auf die politische Dimension“, indem er daran erinnert, dass der Titel „Retter der Welt“ zur Zeit des Johannes vom „Kaiser in Rom“ beansprucht wurde:
Wenn demgegenüber Jesus als „Retter der Welt“ bekannt wird, dann wird hier „Heil“ nicht von imperialer Gewalt erwartet, dann ist dieses Bekenntnis zugleich eine Absage an alles triumphalistische Götzentum.
Das ist zwar bis zu einem gewissen Grad richtig, klingt aber zugleich so, als ob das „Heil“, das Jesus für die „Welt“ bewirken will, überhaupt nichts mit der Politik des Römischen Reiches zu tun hat, sondern sich auf einem ganz anderen Gebiet auswirkt, nämlich der Religion, des mitmenschlichen Zusammenlebens in der Gemeinde und endzeitlicher Hoffnungen auf ein himmlisches ewiges Leben. Dass die Samaritaner Jesus als den Befreier der Welt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, bekennen könnten, kommt Wengst nicht in den Sinn.
Hartwig Thyen zufolge (T281) wird nach „der Einführung der Erntemetaphorik“ nun das Kommen der Samaritaner als das Einbringen eines missionarischen Ernteertrages beschrieben. Dass Thyen die wörtliche Wiederholung des Zeugnisses der Frau „Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe“, das (T282) „ausdrücklich als Grund des Kommens der Samaritaner zitiert wird“, dabei weniger auf „ihre anfängliche Einsicht in das prophetische Wesen Jesu“, sondern vielmehr auf „ihre hoffnungsvolle und endlich von ihren Landsleuten bestätigte Erwartung“ des Messias beziehen will, ist in meinen Augen nicht schlüssig, da doch eben der Bezug auf das prophetische Wissen Jesu wiederholt wird. In meinen Augen mag Johannes andeuten wollen, dass die Samaritaner genau wie zuvor die Frau eben durch die prophetischen Einsichten Jesu über die Unterdrückungssituation ihres Volkes zum Vertrauen auf ihn als den Messias Israels und den Befreier der Welt gelangen.
Die Wendung in Vers 39, dass viele Samaritaner „um den Wortes der Frau willen“ an Jesus glaubten, sieht Thyen wie Sandra Schneiders <412> als die „Kennzeichnung der Frau als Apostelin“. Dazu führt Thyen weiter aus:
Wenn ihre Landsleute diesen logos der Samaritanerin in V. 42 als lalia {Rede} bezeichnen und ihrer lalia als den wahren Grund ihres Glaubens den logos {Wort} Jesu gegenüberstellen, so darf dieses stilistisch motivierte Spiel mit Synonyma doch keinesfalls als Herabstufung des ,apostolischen logos‘ der Frau zum bloßen „Gerede“ und der dadurch erweckte Glaube der Samaritaner als unvollständiger und nur vorläufiger begriffen werden.
Dazu weist Thyen darauf hin, dass Jesus selbst in Johannes 8,43 die Worte lalia und logos auf seine eigene Rede und sein eigenes Wort bezieht.
Die Frage, warum nach Vers 42 für den Glauben der Samaritaner das Zeugnis der Frau hinter das Hören Jesu selbst zurücktritt, hat Thyen zufolge Rudolf Bultmann <413> angemessen beantwortet, indem er (T282f.)
unter Verweis auf Kierkegaards ,Philosophische Brosamen‘ eine „symbolische Darstellung des Problems der Hörer ,zweiter Hand‘“ erkennt und erklärt: Der Evangelist „konnte ja nicht wohl eine Szene bilden, in der Hörer der Boten Jesu zu diesem selbst vordringen, denn nach seinem Plane werden die Jünger ja erst vom Auferstandenen entsandt. Sie werden deshalb hier von der Frau vertreten; diese repräsentiert die vermittelnde Verkündigung, die den Hörer zu Jesus selbst führt. … Damit ist gesagt: der Glaube darf nicht auf die Autorität Anderer hin glauben, sondern muß selbst seinen Gegenstand finden; er muß durch das verkündigte Wort hindurch das Wort des Offenbarers selbst vernehmen. Es entsteht also die eigentümliche Paradoxie, daß die unentbehrliche Verkündigung, die den Hörer zu Jesus führt, doch gleichgültig wird, indem der Hörer im glaubenden Wissen selbständig und damit auch zum Kritiker an der Verkündigung wird, die ihn selbst zum Glauben führte“.
In diesem Zusammenhang dient nach Thyen (T283) die
scheinbare Herabsetzung der Frau ironischerweise in Wahrheit gerade ihrer Erhöhung und Bestätigung als „wahrhaftige Zeugin“, die – wie Johannes der Täufer – „abnehmen muß“, damit der Bezeugte „wachse“.
Das Bleiben Jesu bei den Samaritanern enthält in Thyens Augen Erinnerungen an „die Patriarchen der biblischen Brunnenerzählungen“ und will außerdem
auf dem Hintergrund und im Gegensatz zu der fast förmlichen „Flucht“ Jesu aus Judäa verstanden sein, wo er keine „Bleibe“ fand, weil seinem allwissenden Blick die sich anbahnende Feindschaft der ,Pharisäer‘ nicht verborgen bleiben konnte (4,1-3). Zugleich mag Jesu menein {Bleiben} in Sychar erinnern an das Bleiben von Andreas und dessen anonymem Gefährten, den Erstlingen seiner Jünger (1,37-40).
Klar ist Thyen zufolge jetzt jedenfalls endgültig (T284),
warum Jesus durch Samarien reisen mußte (edei 4,4). Denn nun ist deutlich, daß nicht die geographische Lage Samariens und Jesu Absicht, möglichst rasch nach Galiläa zu gelangen, ihn zur Wahl gerade dieser Route genötigt hatten. Sie erweist sich dem Leser jetzt vielmehr insofern als ,heilsnotwendig‘, als Jesus als der messianische ,Schnitter‘ in Samaria den ,Anbruch‘ seiner eschatologischen ,Ernte‘ unter den verlorenen Söhnen Jakobs einbringen mußte, der hier dank der ,Sämanns-Arbeit‘ der Frau vom Brunnen des Patriarchen gereift war.
Das (T283) „Bekenntnis der Samaritaner zu Jesus als dem sōtēr tou kosmou {Retter der Welt}“ versteht Thyen „in der Welt unseres Textes“ hauptsächlich
als die Nominalisierung der vorausgegangenen verbalen Aussage…, daß Gott seinen Sohn gesandt habe: hina sōthē ho kosmos di‘ autou {damit die Welt durch ihn gerettet werde} (3,17). In der Welt der frühen Leser unseres Evangeliums könnte dieses Bekenntnis aber zugleich als Antithese zu der im Kaiserkult ausgebildeten und z.B. für Hadrian belegten Prädikation des Imperators als sōtēr tou kosmou begriffen worden sein.
Bestätigt wird „diese Perspektive“ nicht nur durch die intertextuelle Aufnahme des Bekenntnisses in 1. Johannes 4,14 und den Schlusssatz des 1. Johannesbriefs „Kindlein, hütet euch vor den Götterbildern!“ (5,21), den Ekkehard Stegemann <414> „als aktuelle Warnung vor dem Verleugnen des Christusbekenntnisses dem Kaiserbild gegenüber“ begreift, sondern auch im Johannesevangelium selbst:
In diesem Zusammenhang wird unten auch die Rede der ‚Juden‘ Pilatus gegenüber: ouk echomen basileia ei mē Kaisara {Wir haben keinen König außer dem Kaiser} (19,15) sowie das an die Prädikation Domitians erinnernde Bekenntnis des Thomas: ho kyrios mou kai ho theos mou {Mein Herr und mein Gott} (20,28), zu erörtern sein.
Auch bei Thyen führt dieser Blick in die politische Dimension des römischen Kaiserreichs aber nicht zu einer Einsicht in die befreiungstheologische Zielsetzung der johanneischen Proklamation des Messias Jesus.
Nach Ton Veerkamp <415> dagegen ist das Vertrauen „der Leute aus Sychar“ auf den Messias Jesus nur im Rahmen eines befreiungstheologischen Settings zu begreifen:
Viele vertrauen diesem Messias, des Zeugnisses der Frau wegen, weil er ihr gesagt habe, was sie alles getan hat. Johannes liegt daran, diesen Umstand zu unterstreichen, er sagt es zum dritten Mal. Weswegen sollen Leute vertrauen, weil ein Fremder das von ihr wusste, was sie alle ohnehin wussten, es sei denn per absurdum, sie lebe in ihrem orientalischen Dorf klammheimlich mit irgendeinem Mann? Das würde Neugierde, aber kein Vertrauen erwecken. Er hat der Frau aufgedeckt, was mit ihr, also mit ihrem Volk, geschehen war, er hat sie politisch aufgeklärt. Hier ist endlich ein Judäer, der verstanden hat, was vor allem während des vorherigen Jahrhunderts mit diesem unglücklichen Volk in Samaria geschah. Das weckt Vertrauen, und das hat ihnen die Frau vermittelt.
Das Bleiben Jesu bei den Samaritanern versteht Veerkamp von der semitischen Färbung des Wortes menein im Sinne von „standhalten, durchhalten, festbleiben“ her:
Er bleibt bei ihnen zwei Tage, genauso wie er zwei Tage in Transjordanien bleibt, nachdem er gehört hatte, dass sein Freund, der einzige Freund, in Judäa erkrankt war, 11,6. Diese zwei Tage in Sychar sind das Vorspiel für das andere Zeichen: „Dein Sohn lebt“ (wie die zwei Tage in Transjordanien das Vorspiel für das letzte, endgültige Zeichen sind: „Lazarus, komm heraus« (11,43), wie schließlich auch die zwei Tage zwischen dem Tod des Messias und seinem Kommen mitten unter die Schüler (20,19).
Dass am Ende die Samaritaner nicht mehr auf Grund der Worte der Frau, sondern auf Grund eigenen Hörens auf Jesus vertrauen, erklärt Veerkamp folgendermaßen:
Während dieser zwei Tage muss Jesus in Sychar eine intensive biblisch-politische Lehrhausveranstaltung durchgeführt haben. Die Leute aus Sychar vertrauten zunächst dem Zeugnis der Frau, jetzt, nach der Lehrhausanstrengung, vertrauen sie dem Messias selbst. Sie haben selber zugehört und wissen, ihr Bewusstsein hat sich geändert. Johannes kann schwerlich daran gelegen sein, das Zeugnis der Frau herunterzuspielen. Die letzten Worte der Frau zeigten den messianischen Vorbehalt. Sie repräsentiert eine Situation in Samaria, wo man der messianischen Gemeinde distanziert begegnete. <416> Das feierliche Bekenntnis kommt daher nicht aus dem Mund der Frau, sondern aus dem Mund derer, die „selber gehört und erkannt hatten, dass dieser wirklich der Befreier der Welt ist“.
Auch Veerkamp verweist darauf, dass der Titel „Befreier der Welt“ sich „in Inschriften zweier Kaiser, Nero (54-68) und Hadrian (117-138)“ findet:
Dieser Titel gebühre ihnen, weil sie überall im Imperium „Ordnung“ schaffen wollten, was bei Nero eine lächerliche Anmaßung ist. Bei Hadrian geht die Bezeichnung so weit in Ordnung, so lange man unter befreiender und heilsamer Ordnung jene tüchtige römische, aber immer noch ausbeuterische Verwaltung der Adoptivkaiser des 2. Jh. versteht, die der Korruption der Provinzbehörden eine gewisse Grenze setzte. Aber mit Befreiung nach den Maßstäben der Tora hat das nichts zu tun, insofern ist auch die Selbstbezeichnung Hadrians eine Anmaßung.
Was meinen aber nun Veerkamp zufolge die Samaritaner, wenn sie dieses „Schlüsselwort in der politischen Propaganda des römischen Kaiserregimes“ auf Jesus beziehen?
Die Leute aus Samaria stellen mit ihrem Satz „Dieser ist wirklich Befreier der Welt“ zwei Dinge klar. Erstens ist für sie nur der Gott Israels Befreier Israels gewesen, moschiaˁ jißraˀel, sōtēr tou Israēl, niemand sonst, wie es im Buch Jesaja heißt; wenn sie den Propheten Jesaja nicht gelten ließen, so kannten sie doch die Tora und den Satz Exodus 14,30: „Und der NAME befreite (wa-joschaˁ JHWH) an diesem Tag Israel aus der Hand Ägyptens.“ Der NAME ist im alten Orient immer auch Lebensprogramm. Der NAME Gottes ist wesentlich Befreiung; der NAME Jesus bedeutet „Befreiung“, und zwar Befreiung gemäß Exodus 14,30. Und zweitens sprachen sie Rom den Anspruch ab, Befreier der Welt zu sein. Sie erkannten als erste die politische Implikation des messianischen Bekenntnisses.
Damit ist das Bekenntnis der Samaritaner „der offene Aufstand gegen die real existierenden, sich ‚Befreier der Welt‘ nennenden Kaiser Roms“.
↑ Das andere messianische Zeichen in Kana, Galiläa: „Dein Sohn lebt!“ (Johannes 4,43-54)
[30. Mai 2022] Zur nun folgenden Szene Johannes 4,43-54 stellt Wengst zunächst fest (W153), dass der Zusammenhang der beiden Teile dieses Abschnitts
nicht sofort ersichtlich zu sein scheint. Der erste Teil berichtet von der positiven Aufnahme, die Jesus bei seiner Rückkehr nach Galiläa vonseiten seiner Landsleute erfährt (V. 43-45). Der zweite erzählt, dass er nochmals ein Zeichen wirkt, als er wiederum nach Kana kommt (V. 46-54). Es besteht hier jedoch ein analoger Zusammenhang, wie er zwischen 2,23-25 und 3,1f. vorliegt. Dort war in Hinsicht auf das Pessachfest in Jerusalem von vielen die Rede, die aufgrund der von Jesus gewirkten Zeichen ihr Vertrauen auf ihn setzten. Als deren Repräsentant kam dann Nikodemus zu ihm. Auf diese Situation des Festes in Jerusalem bezieht sich der jetzige Text ausdrücklich zurück. An ihm haben auch die Galiläer teilgenommen und aufgrund dessen, was sie dort gesehen haben, nehmen sie nun Jesus auf (V. 45).
Indem nun der königliche „Hofmann“ als einer dieser Galiläer im zweiten Teil dieses Abschnitts auftritt und „anders als Nikodemus .. nicht spurlos mitten aus der Szene“ verschwindet, sondern „zum Vertrauen auf Jesu Wort hin“ kommt, „ohne schon das ihn betreffende Zeichen gesehen zu haben“, sind er und „die samaritische Frau“ beide als „Kontrastfiguren zu Nikodemus“ zu betrachten.
Nach Ton Veerkamp <417> bildet diese galiläische Szene mit dem zweiten Zeichen zu Kana, das auch ausdrücklich als solches benannt wird, den Abschluss des ersten erzählenden Teils des Johannesevangelium, in dem die „Gründung … der messianischen Gemeinde“ beschrieben wird und dem er die Überschrift „Der offenbare Messias“ gibt. Der Anfang der Zeichen, archē tōn sēmeiōn, zum Abschluss der messianischen Woche, in der Johannes Jesus als den Messias bezeugt und Jesus seine ersten Schüler gesammelt hatte, fand mit der messianischen Hochzeit ebenfalls in Kana zu Galiläa statt; seitdem erfuhr Jesus als der Messias in Jerusalem ersten Widerstand seitens seiner judäischen Gegner und zurückhaltendes Interesse bei Nikodemus als dem Lehrer Israels, während er im judäischen Umland von Jerusalem Nachfolger vor allem unter denen fand, die zuvor Schüler Johannes des Täufers gewesen waren. Jesu Abstecher nach Samarien verlief ausgesprochen erfolgreich, indem Jesus die verlorenen Stämme Nord-Israels für sein messianisches Projekt der Sammlung ganz Israels und der Befreiung der Welt von der Weltordnung, die auf ihr lastet, gewinnen konnte.
Galiläa spielte für Jesus von Anfang an insofern eine besondere Rolle, als es zwar religiös-ethnisch zu Judäa gehörte, aber zugleich der Jerusalemer Metropole und ihrer Führungsschicht gegenüber eher ein randständiges Gebiet der politischen Unruhe darstellte. Diese betont randständige Lage ist Johannes zufolge der Ort der beiden entscheidenden messianischen Zeichen, die (wie zur Auslegung von Johannes 2,11 gesagt) an die beiden Zeichen von 2. Mose 4,8 erinnern, die Moses Sendung zur Befreiung Israels aus Ägypten beglaubigen: Nach dem grundlegenden Zeichen der bevorstehenden messianischen Hochzeit des NAMENS mit seinem Volk Israel geschieht nun auch das andere Zeichen der Belebung des Sohnes eines Königlichen an einem dritten Tage und verweist symbolisch sowohl auf die Auferweckung Jesus als auch auf diejenige des Lazarus und damit zugleich, wie sich zeigen wird, auf das Leben der kommenden Weltzeit für Israel.
Hartwig Thyen (T293) lässt mit der Darstellung des zweiten Zeichens den zweiten Akt enden, wonach durch den „Neueinsatz mit meta tauta {nach diesen Dingen} und der erneuten Festreise Jesu ,hinauf nach Jerusalem‘ in 5,1“ der nächste Akt der „dramatischen Historie Jesu“ beginnt. Er markiert zwar diesen Einschnitt zwischen Kapitel 4 und 5 nicht so deutlich wie Veerkamp, teilt aber dessen Einschätzung der überragenden Bedeutung der beiden Zeichen zu Kana.
Klaus Wengst wiederum teilt mit Veerkamp die Einschätzung eines veränderten Klimas, in dem sich ab Kapitel 5 das Wirken Jesu vollzieht, denn auch ihm zufolge (W156)
liegt nach Kap. 4 ein Einschnitt innerhalb des ersten Teils des Johannesevangeliums vor. Bisher tauchte Bedrohliches nur am Rande auf. Von Kap. 5 bis 12 jedoch ist die Darstellung von offener Gegnerschaft gegen Jesus geprägt.
↑ Johannes 4,43-45: Die Aufnahme Jesu, der in seiner patris, „Vaterstadt“, nichts gilt, in Galiläa
4,43 Aber nach den zwei Tagen zog er von dort nach Galiläa.
4,44 Denn er selber, Jesus, bezeugte,
dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt.
4,45 Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf,
die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte;
denn sie waren auch zum Fest gekommen.
[31. Mai 2022] In der Zeitbestimmung „Nach den zwei Tagen“ sieht Klaus Wengst (W153) nicht mehr als die Markierung eines Übergangs. Die Begründung für „Jesu Weiterreise von Samarien … nach Galiläa“ stellt er zunächst in einen Zusammenhang mit der vorherigen Begründung für „den Aufbruch von Judäa nach Galiläa“. Sein missionarischer Erfolg in Judäa
erregte Aufsehen und ließ „die Pharisäer“ als bedrohliche Größe am Horizont erscheinen. Jetzt begründet er Jesu Weiterreise von Samarien, wo er gerade sehr erfolgreich war, nach Galiläa, er habe selbst bezeugt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet werde.
Diese Begründung wirft eine Reihe von Fragen auf. Zunächst einmal die, dass sich (W153, Anm. 217) Johannes „hier auf eine Aussage Jesu“ bezieht,
die er in seiner Erzählung bisher nicht geboten hat und auch später nicht bringt. Dieses Wort gehört zum Traditionsbestand der Gemeinde; er setzt es bei seiner Leser- und Hörerschaft als bekannt voraus. Es begegnet bei ihm also in einem ganz anderen Zusammenhang als in den synoptischen Evangelien. Dort steht es im Kontext des Auftretens Jesu in Nazaret und begründet die Ablehnung, die er in diesem Ort erfährt (Mt 13,57; Mk 6,4; Lk 4,24). patrís meint dort den „Heimatort“, bei Johannes aber „Heimat“, bezogen auf ganz Galiläa.
Damit, dass Johannes dieses Wort aus den Synoptikern oder einer ihnen verwandten Tradition kennt und in verändertem Sinn verwendet, hat Wengst sicher Recht. Aber sehr umstritten ist die Frage, ob Johannes mit Jesu patris tatsächlich Galiläa meint. Für Wengst gibt es gar keine andere Antwort auf diese Frage, weil an den Stellen Johannes 1,45 und 7,41.52 „in aller Selbstverständlichkeit Galiläa als Herkunftland Jesu vorausgesetzt ist.“ Von daher meint er (W152, Anm. 216), die Annahme schon des Kirchenlehrers Origenes und in neuerer Zeit Hartwig Thyens (T285f.) ausschließen zu können, „als patris Jesu in der Sicht des Evangelisten an dieser Stelle Jerusalem“ anzunehmen. Er übersieht offenbar völlig, dass im Johannesevangelium Jesus zugleich der leibliche Sohn Josefs und der Sohn des VATERS im Himmel ist. Ebenso ist trotz seiner biographischen Herkunft Jesu aus Nazareth in Galiläa zugleich die Stadt seines VATERS, nämlich Jerusalem, als seine wahre Vaterstadt anzusehen.
Diese Fehlwahrnehmung führt Wengst nun zu einer wahrhaft abstrusen Kette von Schlussfolgerungen (W153f.):
Demnach hat Jesus die Erwartung, in Galiläa nicht beachtet zu werden und also hier kein Aufsehen zu erregen und damit auch vor möglichen Nachstellungen sicher zu sein. Als er aber das Ziel der Reise erreicht, zeigt es sich, dass er in seiner Erwartung enttäuscht wird: „Die Galiläer nahmen ihn auf.“
Ich wundere mich, dass Wengst für Jesus überhaupt eine solche Erwartung Jesu annehmen kann, in Galiläa hoffentlich keine Wertschätzung und keinen Verkündigungserfolg zu erfahren, nur damit er vor Verfolgung sicher ist, da Wengst doch selber (Anm. 218) um den Sinn des „nur hier im Johannesevangelium“ auftretenden Verbs déchomaí weiß, bei dem wie beim Wort lambáno in 1,12; 5,42; 13,20 neben der Bedeutung „‚aufnehmen‘ und ‚annehmen‘ auch die Bedeutung ‚akzeptieren‘“ mitklingt.
Noch verrückter klingt die Aussage, Jesu Erwartung, nicht akzeptiert zu werden, sei „enttäuscht“ worden, als ob er nun Angst haben müsste, auch in Galiläa verfolgt zu werden. Ein wenig später werden wir allerdings sehen, wozu Wengst das Argument einsetzt (W155, Anm. 221), „dass sich Jesus in dieser Geschichte zweimal in seiner Erwartung getäuscht sieht – einmal was seine Aufnahme in Galiläa und zum anderen was den Glauben des Hofmanns betrifft“, nämlich zu dem Zweck, Jesus menschlich erscheinen zu lassen, indem Johannes ihn eben doch „nicht in jeder Hinsicht und in jeder Situation als den alles Wissenden und alles Überschauenden“ darstellt. Erneut ist dagegen einzuwenden: Jesu Menschlichkeit muss im Johannesevangelium nicht durch verkrampft-verschlungene Argumentationen erwiesen werden; diese ist für ihn ebenso selbstverständlich gegeben wie seine völlig Übereinstimmung mit dem Willen und Wirken des VATERS.
Hartwig Thyen (T284) beschreibt den nach „der Unterbrechung … am Jakobsbrunnen bei Sychar“ nun fortgesetzten Weg Jesu sehr klar als eine „Reise aus dem feindlichen Judäa ins freundliche Galiläa“ und versteht den Satz über den Propheten, „der in seinem eigenen Vaterland kein Ansehen genieße“, als ein „Spiel des Erzählers mit den synoptischen Prätexten“:
Wir sagen ,Spiel‘ und nicht ,Zitat‘, weil nicht nur der Erzähler, sondern auch sein impliziter ,Zuhörer‘ natürlich weiß, daß Jesus dieses Wort in den älteren Evangelien im Zusammenhang seiner ,Verwerfung‘ im galiläischen ,Nazareth‘ äußert: Mk 6,4 in der Passage Mk 6,1-6a; Mt 13,57 in V 53-58; Lk 4,24 in 4,16-30 … Bei dieser Äußerung Jesu handelt es sich wohl um die Variante eines Sprichworts aus der Welt der Philosophen …
Im anspielenden Umgang (T286) auf das von Markus, Matthäus und Lukas ganz anders verwendete Wort
traut und mutet er [der Evangelist Johannes] seinem Leser die aktive Teilnahme an diesem Spiel zu. Wie die Variationen eines musikalischen Themas ihren Reiz allein aus der Spannung beziehen, die sie zwischen sich und dem vorgegebenen Thema erzeugen, so versetzt auch diese neue Gestaltung der alten Erzählung von Jesu Verwerfung in Nazaret (Lk 4,16ff) den Leser in erstaunte Spannung und fordert ihn dazu heraus, darüber nachzudenken, ob – trotz Jesu unbestrittener Herkunft aus Galiläa und seiner Verwerfung in Nazaret, um die er ja aus den älteren Evangelien weiß – die wahre patris des messianischen Gottessohnes in einem tieferen Sinn nicht dennoch nur die Davidsstadt Jerusalem sein kann. Das hätte in Jesu Wort: „Das Heil kommt von den Juden“ (4,22) seine Entsprechung.
Das heißt: Von den im Johannesevangelium angesprochenen drei Landesteilen Judäa, Galiläa und Samaria verweigert ausgerechnet das judäische Jerusalem, woher Jesus zufolge das Heil oder die Befreiung kommt, Jesus die ihm zukommende Ehre. Und genau darauf wird Johannes im zweiten Teil des Evangeliums, in den Kapiteln 5 bis 12, in aller Ausführlichkeit zurückkommen.
Die von der Mehrheit der Exegeten wie auch von Wengst vertretene Meinung, das Sprichwort müsse sich auf jeden Fall auf das Land der Herkunft Jesu beziehen, führt auch Thyen zufolge zu Schlussfolgerungen, die in seinen Augen (T284f.) „unbegreiflich“ sind, etwa diejenige von Adolf Schlatter, <418> der zwar weiß, dass „Jerusalem … die patris jedes Juden“ ist, der aber dennoch „die in V. 44 genannte ,eigene Heimat‘ Jesu mit Nazaret“ identifiziert und davon ausgeht, dass
der hier zitierte Spruch „den Gedanken ab(weisen [soll]), daß Jesus deshalb nach Galiläa gegangen sei, weil er timē {Ansehen} gesucht habe“, und daß ihm „nur da, wo er keine Ehre empfing … das Wirken noch nicht verwehrt“ gewesen sei.
Erst recht „unbegreiflich“ ist es Thyen, wie man „die freundliche Aufnahme Jesu durch die Galiläer negativ bewerten“ kann, etwa unter Rückgriff auf Vers 48, „der beweisen soll, daß Jesu freundliche Aufnahme in Galiläa nicht ihm selbst, sondern allein dem Täter großer sēmeia kai terata {Zeichen und Wunder} galt“. Vielmehr kann (T286) gerade die
Formulierung, daß die Galiläer Jesus ,gastlich aufnahmen‘ (edexanto) … ein Hinweis darauf sein, daß Johannes hier mit der lukanischen Gestalt der Erzählung spielt. Denn bei Johannes begegnet das Lexem dechomai {aufnehmen} einzig an dieser Stelle und das Wort vom verachteten Propheten lautet bei Lukas so: amēn legō hymin oudeis prophētēs dektos estin en tē patridi autou {Amen, ich sage euch: Kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland} (4,24).
Anscheinend sieht Johannes die Haltung der Menschen gegenüber Jesus im randständigen Galiläa gegenüber dem zentralen Judäa in einem etwas anderen Licht als die synoptischen Evangelien. Aus der Begründung für die gastliche Aufnahme in Galiläa mit dem Hinweis auf „alles, was Jesus während des Festes in Jerusalem getan hatte“, darf man jedenfalls Thyen zufolge
keine nur halbherzige Aufnahme durch die Galiläer herauslesen und ihren Glauben als vermeintlich „bloßen Wunderglauben“ negativ bewerten. Denn zum einen ist hier von ,Wundern‘ (sēmeia) mit keiner Silbe die Rede, und zum anderen kommt es ja gerade auf das richtige „Sehen“ der Zeichen an. Jesus tadelt die Galiläer, die ihn nach dem Brotwunder jenseits des Jordan endlich in Kapharnaum finden, ja nicht, weil sie seine „Zeichen“ gesehen hätten. Sein Tadel trifft sie vielmehr, weil sie seine sēmeia gerade nicht gesehen, sondern nur „von den Broten gegessen haben und satt geworden sind“ (6,26). Und nicht allein als einst sichtbare Geschehnisse sind Jesu sēmeia konstitutive Indizien dafür, daß der Vater diesen Sohn gesandt hat, die Welt zu retten, sondern noch als in diesem Evangelium erzählte und aufgeschriebene Spuren sollen sie seinen Lesern dazu verhelfen, unbeirrt an dem Glauben festzuhalten, daß Jesus der messianische Gottessohn ist, damit sie in solchem Glauben das ewige Leben gewinnen (20,30f).
Ton Veerkamp <419> fragt zunächst, warum Johannes so betont erzählt, dass Jesus „nach den zwei Tagen“ von Samaria nach Galiläa geht. Es sind die beiden Tage „politischer Schulung der Menschen Sychars“, aber „das ist nur die halbe Antwort. Der Tag in Kana ist ein dritter Tag, der Tag vom Tod ins Leben.“
Die Frage, warum Jesus sich nach Galiläa wendet, beantwortet Veerkamp in einer ähnlichen Richtung wie Thyen:
Warum nach Galiläa? Die Antwort lässt Johannes Jesus selber geben. Die Antwort bezieht sich auf die Vaterstadt Jesu. Bei Markus und den anderen Synoptikern liegt die Vaterstadt in Galiläa (Markus 6,1 par.) Dort heißt es: „Nicht würdelos ist ein Prophet, es sei denn in seiner Vaterstadt.“ Aber bei Johannes ist die Vaterstadt Jerusalem, der Ort dessen, den Jesus VATER nennt. Die Zeichen und die Worte des Messias erwecken Vertrauen in Samaria und in Galiläa. Der Auftrag des Messias ist es, die auseinander getriebenen Kinder Israels zusammenzubringen. Die Zeichen rufen auch Widerspruch auf, in Jerusalem, Johannes 5 und 9, aber auch in Galiläa, Johannes 6. Aber die Entscheidung über Zustimmung oder Ablehnung fällt in Jesu Vaterstadt, Jerusalem. Denn der Messias und sein Werk, die Befreiung, kommen von den Judäern her, wie bereits gehört.
Zum Widerspruch zwischen der biographischen Herkunft Jesu und seiner messianischen Vaterstadt verweist Veerkamp auf erzählerische Methoden von Matthäus und Lukas, die in vergleichbarer Weise Jesu Herkunft aus Nazareth mit ihrer von den Schriften her begründeten Einschätzung des Messias Jesus in Einklang bringen:
Jesus ben Joseph stammt aus Nazareth, Galiläa, aber der Messias kommt aus Jerusalem. Ein ähnliches Verfahren entwickeln Matthäus und Lukas in ihren Herkunftserzählungen (Matthäus bzw. Lukas 1-2). Ihr Messias muss aus der Stadt Davids kommen, er wird das Königtum Davids erneuern. Der Messias ist bei Johannes ein priesterlich-prophetischer Messias, deswegen muss er aus Jerusalem kommen.
↑ Johannes 4,46-47: Ein Hofbeamter aus Kapernaum sucht in Kana Hilfe bei Jesus für seinen todkranken Sohn
4,46 Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa,
wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte.
Und es war ein Mann im Dienst des Königs;
dessen Sohn lag krank in Kapernaum.
4,47 Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war,
und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen
und seinen Sohn zu heilen;
denn der war todkrank.
In Johannes 4,46 stellt Klaus Wengst (W154) „einen weiteren Bezug zum vorangehenden Kontext“ fest:
Jesus geht „wiederum“ nach Kana. Es wird daran erinnert, dass er dort „das Wasser zu Wein gemacht hatte“. Damit ist das Signal für die Erzählung eines weiteren Zeichens gestellt…
Der Mann, der hier in Kana Jesus aufsucht, weil sein „Sohn in Kafarnaum krank lag“, und der von Johannes als basilikos bezeichnet wird, ist Wengst zufolge (Anm. 219) ein
„zum König Gehöriger“, sei es durch Verwandtschaft oder durch irgendein Dienstverhältnis. Da der Mann in Joh 4 selbst Sklaven hat und offenbar über seine Zeit recht frei verfügen kann, ist er nicht als Sklave, sondern als relativ gut gestellter Freier vorgestellt. Als „König“, dem er zugeordnet ist, muss Herodes Antipas gelten. Der war zwar offiziell lediglich Tetrarch, aber im Volk wurde er als „König“ bezeichnet. Der basilikós ist also am ehesten als „Hofmann“ gedacht.
Neben der Kennzeichnung seiner gehobenen sozialen Stellung betont Wengst, dass dieser Hofmann anders als in den „synoptischen Fassungen“ der gleichen Erzählung „bei Johannes nicht als Nichtjude gekennzeichnet“ wird. „Er gilt ihm als Jude. … Die Erzählung spielt in jüdischem Kontext.“ Unter Verzicht auf (Anm. 220) weitere Ausführungen zur „Vorgeschichte der drei Texte und nach ihren literarischen Beziehungen“ konzentriert sich Wengst auf das besondere Profil „der johanneischen Erzählung“, zu dem es gehört,
dass das Gegenüber Jesu kein nichtjüdischer Hauptmann, sondern ein galiläischer Hofmann ist. Sowohl sein Kommen zu Jesus und seine Bitte in V. 47 als auch dessen Wort an ihn in V. 48, das im Plural gehalten ist, charakterisieren ihn als Repräsentanten der Galiläer, die Jesus aufgrund des in Jerusalem Gesehenen akzeptieren. Die positive Zeichnung dieses Repräsentanten erweist es als falsch, den hier genannten Galiläern „Gier nach ,Spektakeln‘“ zu unterstellen. <420>
Hartwig Thyen (T287) sieht in der „Erzählung von der Heilung des Sohnes eines Königlichen (Hofbeamten?) … fraglos eine Variante der synoptischen Geschichte des ,Hauptmanns von Kapharnaum‘ (Mt 8,5-13 // Lk 7,1-10)“, denn „hier wie da ist es ein Bewohner Kapharnaums, der Jesus um Hilfe bittet, und hier wie da ereignet sich auf das Wort Jesu hin eine ,Fernheilung‘.“ Wieder weigert sich Thyen, die Unterschiede der Erzählungen „auf das Konto verschiedener Quellen“ zu verbuchen, und führt sie stattdessen (T288) auf „ein freies Spiel unseres Evangelisten mit seinen synoptischen Prätexten und insbesondere mit Lk 7,1-10“ zurück.
Dabei ergeben sich „aus spezifisch johanneischen Interessen“ die folgenden „drei gewichtigsten Differenzen zur synoptischen Gestalt der Erzählung“:
Erstens „erreicht es der Erzähler, durch das bereits erörterte dichte Geflecht von Reisenotizen Jesu wundertätiges Wort wiederum im galiläischen Kana ergehen zu lassen.“ Dabei legt Thyen besonderen Wert auf „die große Entfernung Kanas, wo Jesus sein heilendes Wort spricht, von Kapharnaum, wo der kranke Sohn des basilikos mit dem Tode ringt“, wodurch wie an vielen anderen Stellen des Johannesevangeliums „zugleich das Wunderbare gesteigert“ wird. Außerdem lässt der Evangelist in der Wendung ēmellen gar apothnēskein, „der war dabei zu sterben“, die „im gesamten Neuen Testament nur bei Johannes und hier gleich vierfach“ vorkommt, auch das Sterben und Auferstehen Jesu anklingen, denn an den anderen drei Stellen, „nämlich außer 4,47 noch 11,51; 12,33 und 18,32“, bezieht sie sich auf Jesu bevorstehenden Tod.
Zweitens ist es bei Johannes kein
doulos oder pais {Sklave oder Knecht}, sondern der geliebte Sohn, den Jesus mit dem Wort: ho hyios sou zē {dein Sohn lebt} dem Leben und seinem besorgten Vater zurückgibt. Da dieses lebendig-machende Wort Jesu: ,Dein Sohn lebt!‘ in den V. 50.51 u. 53 gleich dreifach erscheint, ist sein Gewicht kaum zu unterschätzen, zumal es zugleich biblische Erinnerungen wachruft. Mit dem Wort: blepe, zē ho hyios sou {siehe, dein Sohn lebt}, hatte nämlich Elia einst der Witwe von Sarepta ihren toten Sohn lebendig wiedergegeben (1Kön 17,17ff).
Dabei zeigt bereits der Kontext der lukanischen Version unserer Erzählung, dass diese Übereinstimmung mit Elias Heilung „schwerlich bloßer Zufall ist“, denn Lukas 4,24-26 bezieht sich ausdrücklich auf sie.
Drittens schließlich (T289) ist der Bittsteller in der johanneischen Geschichte kein römischer Offizier im Rang eines hekatontarchos, also des Befehlshabers einer Hundertschaft. Dadurch
verschwindet nicht nur die ganze militärische Metaphorik von Befehl und Gehorsam aus der Erzählung, sondern mit dieser zugleich auch ihre Pointe, daß Jesus einzig bei diesem Heiden den Glauben findet, den er in Israel so schmerzlich vermißt.
Thyen zufolge ersetzt Johannes
den römischen Offizier durch einen herodianischen Beamten…, weil für ihn – ohne daß er Jesus das ausdrücklich aussprechen ließe, wie es Matthäus tut (15,24) – die Devise gilt, daß Jesus in der Zeit seines irdischen Wirkens ausschließlich zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel gesandt ist. … Durch diese scheinbar geringfügige Änderung seines Berufes aber ist der Mann aus Kapharnaum nun nicht mehr die Ausnahme eines glaubenden Heiden unter vielen ungläubigen Juden, sondern als pars pro toto der exemplarische Fall der freundlichen Aufnahme, die Jesus unter den Galiläern erfahren hat, und des Glaubens, den er dort fand.
Hätte Thyen hier nicht mittendrin noch die Bemerkung eingeschoben: „Erst wenn die ,Stunde Jesu‘ gekommen, erst wenn das ,Weizenkorn in die Erde gefallen und erstorben ist‘, wird es (auch unter den ,Griechen‘) reiche Frucht bringen (s.u. zu 12,20ff)“, stimmte seine diesbezügliche Sichtweise ziemlich genau mit derjenigen von Veerkamp überein; ob die Bemerkung über „einige Griechen“ in 12,20 es rechtfertigt, Johannes dann doch die Perspektive einer nachösterlichen generellen Völkermission zu unterstellen, wird zur Stelle zu prüfen sein.
Ton Veerkamp <421> ist mit Thyen und Wengst jedenfalls einig darin, dass der „Dienstmann des Königs“, wie er ihn nennt, ein Jude ist. Zwar nicht dessen soziale Stellung, wohl aber dessen soziales Ansehen beurteilt er ganz anders als Wengst:
Das messianische Exempel des anderen Zeichens soll an einem königlichen Dienstmann geschehen. Johannes nimmt seinen Stoff aus einer Tradition, die auch die Synoptiker bearbeitet haben. Markus hat die Erzählung nicht. Bei Matthäus und Lukas geht es um einen centurio, hekatontarchos, einen „Hundertmann“, also einen römischen Unteroffizier. Bei Johannes geht es nicht um einen goj {Nichtjuden}, zumindest nicht um einen römischen Militär. Der Mann ist im Dienst eines von den Römern eingesetzten Klientelkönigs aus dem Haus Herodes. Solche Filialleiter des Unternehmens Rom beuteten die Bevölkerung zusätzlich aus. Herodes Antipas und seine Dienstleute waren in Galiläa verhasst. Diese Leute waren nominell Israeliten, ihre Dienstleute rekrutierten sie aus der regionalen Bevölkerung. Es geht in unserer Erzählung um eins „der verlorenen Schafe des Hauses Israel.“ Bei Johannes geht es außerdem um dessen Sohn, nicht um einen Sklaven, wie bei Matthäus und Lukas. In Israel sind Judäa und die Judäer das Zentrum, Samaria, Galiläa und ihre Einwohner die Peripherie. Die Dienstleute der Herodianer waren, was ihr soziales Ansehen in Galiläa betrifft, eine periphere Gruppe.
Man kann also sagen, dass mit dieser Erzählung der Aufbau der messianischen Gemeinde Jesu insofern zu einem Abschluss kommt, als nach der Sammlung der verlorenen Stämme Israels, die sich hinter den mit den Judäern verfeindeten Samaritanern verbergen, sich Jesus nun um einen Teil Israels kümmert, der – ähnlich wie die Zöllner in den synoptischen Evangelien – der Verachtung preisgegeben war, jedoch von Jesus nicht von vornherein aufgegeben wird.
Indem mit der „tödlichen Erkrankung“ des Sohnes auch die Zukunft dieses Vaters „auf dem Spiel“ steht, klingt hier wohl auch symbolisch die Frage an, ob ganz Israel mit all seinen von Verlorenheit und Tod bedrohten Teilen die Aussicht auf Zukunft und Leben hat.
↑ Johannes 4,48: Ohne Zeichen und Machterweise Gottes ist kein Vertrauen möglich
4,48 Da sprach Jesus zu ihm:
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.
[1. Juni 2022] Trotz der mit aller Dringlichkeit vorgetragenen Bitte des königlichen Hofmanns geht Jesus Klaus Wengst zufolge (W154f.)
auf die Bitte nicht ein, sondern trifft eine über den Bittsteller hinausgehende, aber ihn einbeziehende tadelnde Feststellung: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, kommt ihr nie und nimmer zum Vertrauen.“ Dieser Tadel entspricht der Aussage von 2,24, dass sich Jesus seinerseits denen nicht anvertraute, die ihr Vertrauen auf seinen Namen setzten, weil sie von ihm gewirkte Zeichen gesehen hatten. Demnach käme es darauf an, dass das Vertrauen von Zeichen unabhängig wird. Solches Vertrauen erwartet Jesus in Galiläa offenbar nicht. Denn er spricht in der Form der stärkst möglichen Verneinung.
Hier argumentiert Wengst widersprüchlich, um weiter der bisher eingeschlagenen Spur einer negativen Einschätzung der Galiläer durch Jesus folgen zu können. Abgesehen davon, dass fraglich ist, ob in Jesu Aussage überhaupt ein Tadel enthalten ist und ob er ein von Zeichen unabhängiges Vertrauen erwartet (dazu später), widerspricht Wengst seiner eigenen Aussage (W104) zu Johannes 2,24, dass der Glaube an Jesu Namen „aufgrund von Zeichen … ihr Verhalten nicht als negativ qualifizieren“ muss, denn „in 2,11 wurde dieselbe Aussage von den Schülern Jesu im Blick auf das erste Zeichen in Kana gemacht“. Er meint offenbar, dass Jesus, so wie ihn Johannes darstellt, dem Vater des todkranken Kindes erst einmal den Kopf zurechtsetzen muss, bevor er zur heilenden Tat schreitet, da er von einem Galiläer kein blindes Vertrauen erwarten kann.
Vehement wehrt sich Wengst allerdings dagegen, unsere Stelle als Beleg für eine angebliche „‚Wundersucht‘ des Judentums“ anzunehmen. Dazu beruft er sich auf eine von Adolf Schlatter angeführte rabbinische Stelle: <422>
Dieser Text reflektiert, dass es für das auf Gott bezogene Vertrauen, den Glauben, entscheidend ist, sich nicht auf Zeichen, sondern auf Gottes Zusage zu gründen: „‚Und er (Aaron) tat die Zeichen vor den Augen des Volkes und das Volk glaubte‘ (Ex 4,30f.). Sie handelten damit so, wie es der Heilige, gesegnet er, gesagt hatte (Ex 3,18): Und sie werden auf deine Stimme hören. Man könnte meinen, sie hätten nicht geglaubt, bis sie die Zeichen sahen? Nein! Vielmehr (Ex 4,31): Und sie hörten, dass der Ewige sich der Kinder Israels angenommen hatte. Auf das Hören hin glaubten sie und nicht auf das Sehen der Zeichen hin“. Die Aussage: „Auf das Hören hin glaubten sie“ entspricht sachlich genau und auch dem Wortgebrauch nach der paulinischen Feststellung in Röm 10,17, dass „der Glaube aus dem Hören“ kommt. Das zeigt dann auch der Fortgang der johanneischen Erzählung, dass das Vertrauen dem sich zusagenden Wort gilt.
Ton Veerkamp <423> merkt dazu an, dass „dieser Midrasch keine Abwertung der Zeichen als Argument für den Gehorsam (etwas anderes als ‚Glauben‘)“ meint.
Auch Hartwig Thyen (T289) beurteilt die „scheinbar abweisende Antwort Jesu auf die Bitte des basilikos, doch rasch mit ihm nach Kapharnaum zu eilen und seinem sterbenskranken Sohn Hilfe zu bringen“, als „sperrig“, sieht aber keinen Grund für die Annahme von „literarkritisch versierten Vertretern der Semeia-Quellen-Theorie“,
der „Evangelist“ [habe] diesen Satz hier seiner „Semeia-Quelle“ einverleibt…, um so mit deren vermeintlich ,naivem Wunderglauben‘ zugleich auch den ihrer mutmaßlichen ,Tradenten‘ seiner radikalen Kritik zu unterwerfen.
Klar widerspricht Thyen auch denjenigen, die sich wie Wengst „in der Zwangslage“ sehen, „hinter der doch anscheinend durchaus positiven Notiz von der freundlichen Aufnahme Jesu durch die Galiläer dennoch Negatives aufweisen zu müssen“, und sich dazu auf die Jerusalemer berufen, die an Jesu Namen auf Grund von Zeichen glauben (2,23-25). In seinen Augen (T290) ist
ein besserer oder vollerer Glaube als der in der Erkenntnis seiner ,Zeichen‘ gegründete ,Glaube an seinen Namen‘ (vgl. 1,12) … für Johannes überhaupt nicht denkbar (vgl. 20,31). Darum ist die Interpretation, daß Jesu Mißtrauen seinen Grund in dem vermeintlich „bloßen Wunderglauben“ dieser Jerusalemer habe, mit Sicherheit verfehlt. Sie ist ein spätes Kind des Rationalismus des neunzehnten Jahrhunderts. Daß Jesus sich ihnen nicht anvertraut, hat seinen Grund vielmehr darin, daß sie es nicht wagen, ihren Glauben öffentlich zu bekennen und meinen, ihn – wie ihr Repräsentant Nikodemus – im Schutze der Nacht verbergen zu können… Im Gegensatz zu diesen kekrymmenoi mathētai {verborgenen Jüngern} (19,38) Jerusalems haben die Galiläer Jesus jedoch durchaus einen öffentlichen Empfang bereitet. Darum läßt sich sein Mißtrauen den Jerusalemern gegenüber auf sie keinesfalls übertragen.
Nun bleibt aber für Thyen die Frage zu klären, ob
die Spiritualisierung unseres Evangeliums wirklich bereits so weit fortgeschritten {ist}, daß schon die Fürbitte eines besorgten Vaters für seinen mit dem Tode ringenden Sohn ein „Mißverständnis“ genannt werden müßte…
Rudolf Bultmann <424> wollte Jesu Satz als „Abweisung der Bitte des Vaters“ verstehen, stand aber damit vor einem Dilemma, denn Jesus erfüllt die Bitte dann ja doch. Dazu unterstellt Bultmann Thyen zufolge,
der Evangelist müsse wohl „eine Missionspraxis im Auge haben, die unter Berufung auf sēmeia kai terata um Glauben warb. Er wollte offenbar durch seine Bearbeitung den naiven Wunderglauben, wie ihn die synopt. Tradition zeigt, korrigieren, und hat deshalb das bei den Synoptikern neben der Wunderüberlieferung stehende Motiv, das das Wunder als Legitimation abweist, hier in die Wundergeschichte selbst eingearbeitet. Damit hat freilich Jesu Wort den Charakter einer in der Situation begründeten Abweisung verloren und ist zur allgemeinen Klage über die Schwäche der Menschen geworden, die das Wunder fordern, und denen es (wie 20,26ff) schließlich konzediert wird; es hat ja immerhin die Möglichkeit, sie weiter zu führen. Was die Geschichte so an innerer Geschlossenheit verloren hat, hat sie an sachlichem Gehalt gewonnen“.
Thyen hält jedoch (T291) „sowohl diese spiritualistische Voraussetzung als auch und zumal Bultmanns Verständnis von V. 48 als ‚Abweisung der Bitte des Vaters‘“ für „höchst fragwürdig.“ Dass Jesu Zeichen im Johannesevangelium nicht „nur Konzessionen an die Schwäche der wundersüchtigen Menschen wären“, zeigt schon der feierliche Satz 20,31. Und gerade die Thomaserzählung 20,26ff. stellt „sein Glaubenkönnen unter Bedingungen“, erhebt also praktisch „eine ‚Zeichenforderung‘“, die Jesus sonst zurückweist, wozu Thyen auf „6,30; 2,18 und Mt 12,38; 16,1ff; Mk 8,11; Lk 11,16.29f“ verweist.
Wie versteht nun Thyen selbst das Bedingungssatzgefüge Jesu, in dem beide Teile „verneint sind, die letztere sogar mit ou mē, dem stärksten Instrument der Negation“?
Der durch die doppelte Verneinung potenzierte Sinn dieses Satzgefüges kann nur der sein, daß hier das „Sehen von Zeichen und Wundern“ als die notwendige Bedingung des Glaubens proklamiert wird. Sein zweifaches Nein ersetzt also gewissermaßen ein amēn amēn legō hymin {Amen, Amen, ich sage euch}.
Dass die Anrede an den Hofbeamten im Singular (wie in Johannes 3,7 im Kontakt zu Nikodemus) sofort „in die pluralische Aussage“ übergeht, macht Thyen zufolge „deutlich, daß der basilikos unserer Erzählung ebenso als der Repräsentant der Galiläer (4,45) verstanden sein will…, wie zuvor Nikodemus die Jerusalemer repräsentierte.“ Da es nach Wolfgang Bittner <425> entsprechend aufgebaute Satzgefüge „im gesamten Neuen Testament nur 21mal“ gibt, davon allein 14mal bei Johannes, kann man darin „wohl eine ‚johanneische Stileigentümlichkeit‘ sehen“, für die er nirgendwo, auch in der gesamten Septuaginta nicht, irgendeinen
„Beleg für ironische oder negative Verwendung dieses Satzmodells findet. Unser Satz wäre also auch der einzige Beleg dafür, daß mit einem Bedingungssatz eben keine Bedingung formuliert, sondern negativ gegen die Bedingung Stellung genommen“ würde.
Thyen versteht also den Vers 48 als feierliche „Verheißung und Formulierung der notwendigen Bedingung des Glaubens“, was „noch durch die Aufnahme des Hendiadyoins sēmeia kai terata {Zeichen und Wunder} aus der Exoduserzählung“ bestätigt wird (T291f.):
Denn da sind Gottes ,wunderbare Zeichen‘ stets Zeugnisse seiner rettenden Macht, die er gewährt, damit Glaube daraus erwachse. Ambivalent sind die sēmeia beim Exodus wie bei Joh nicht, weil ein auf sie gegründeter Glaube etwa unzureichend wäre, sondern allein darum, weil sie zugleich eine kritische Funktion haben. Denn indem sie mit dem Glauben der einen zugleich die Verstockung und Feindschaft der anderen provozieren, trennen sie. Daran, daß unter ihnen ,Zeichen und Wunder‘ geschehen, sollen die Ägypter erkennen, daß JHWH der Herr ist (Ex 7,3-5; 11,9f). Und wenn Israel, sein Eigentumsvolk, ihm den Glauben verweigert, klagt Gott: „Wie lange will mich dies Volk noch verschmähen? Wie lange noch wird es mir keinen Glauben schenken trotz alle der Zeichen (sēmeia), die ich unter ihnen getan habe? (Num 14,11).
Thyens Bestimmung der kritischen Funktion biblischer Zeichen und Wunder greift allerdings in einer Hinsicht zu kurz, da er sie lediglich formal im Blick auf das von ihnen Hervorgerufene – Glauben oder Verstockung – bestimmt. Nur beiläufig erwähnt er im Zusammenhang mit einem Psalmzitat (104,5.27 LXX) die „Befreiung aus Ägypten“.
Dass jedoch die Zeichen und Wunder des NAMENS genau auf die Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung, sowohl durch fremde als auch innerisraelitische Mächte, gerichtet sind, betont nur Ton Veerkamp. <426> Da er Thyens Auslegung nicht kennt, schreibt er verallgemeinernd: „Die Kommentare sehen in V.48 immer einen Vorwurf.“ So zitiert er Ulrich Wilckens <427> zu Jesu Zeichen und Wundern mit den Worten, dass sich der „alttestamentische Ausdruck … in der urchristlichen Missionssprache eingebürgert“ hat und „insofern … in V.48 sicher ein kritischer Ton in der Überwertung von Wundern im Zusammenhang des Gläubigwerdens herauszuhören“ ist. Aber die von Wilckens zur Begründung angegebenen „neun Stellen aus der Apostelgeschichte, aus Paulus und dem Hebräerbrief“ äußern sich allesamt nicht „kritisch über ‚Zeichen und Wunder‘.“ Weiter schreibt Veerkamp:
Jesus ist auch kein theios anēr, „göttlicher Mann“, wie die antiken Wunderdoktoren; solche hat Bultmann in seiner Semeiaquelle des Johannesevangeliums ausfindig gemacht, und seitdem spukt die Erfindung durch die Kommentare. Der Glaube ist in dieser Art von Theologie immer etwas, was nicht zu sehen ist, und bewirkt immer etwas, was nicht zu sehen ist. Der Sinn der Antwort Jesu ist nach diesen Kommentaren ein Vorwurf, so in dem Sinne: „Ich muss immer wieder Zeichen und Wunder tun, damit ihr glaubt; wann glaubt ihr, ohne dass ich Wunder tun muss?“ Der Vorwurf ist absurd, er würde die ganze Schrift außer Kraft setzen. Wir hören Deuteronomium 4,34:
Hätte es je ein Gott erprobt,
zu kommen, sich ein Volk zu nehmen aus der Mitte eines Volkes,
mit Erprobungen, mit Zeichen, mit Machterweisen,
mit Krieg, mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm,
mit all diesen Ehrfrucht einflößenden großen Dingen,
die der NAME, euer Gott, für euch getan hat, in Ägypten, vor deinen Augen?Befreiung muss in Israel immer sinnlich erfahrbar sein: „Vergesst nicht“, sagt Mose, „alle Reden, die du gesehen hast, dass sie nicht weichen aus deinem Herzen alle Tage deines Lebens …“ (Deuteronomium 4,9). Hätte also Israel schon damals keine Zeichen und Machterweise gesehen, dann hätte es nicht vertraut und auch nicht vertrauen können.
Den Doppelausdruck sēmeia kai terata versteht Veerkamp als
die doppelte Bezeichnung dessen, was geschieht; Zeichen (ˀothoth, sēmeia) beziehen sich auf das Objekt der Handlung Gottes, Israel; Machterweise (mofthim, terata) beziehen sich auf das Subjekt, Gott selbst. Deswegen kommen diese Wörter oft zusammen vor, vor allem, wenn das Handeln Gottes bei der Befreiung aus Ägypten und in der Wüste zur Sprache gebracht wird. Zeichen und Machterweise bedeuten immer den Nachweis der Befreiungsmacht des Gottes Israels.
Nicht ganz einverstanden bin ich mit der nur vergangenheitsbezogenen Form der Übersetzung von Vers 48, die Veerkamp vorschlägt: „Wenn ihr keine Zeichen und Machterweise gesehen hättet, dann hättet ihr nicht vertraut.“ Inhaltlich will er zu Recht darauf hinaus, dass die Zeichen und Machterweise Gottes schon immer die Grundlage für das Vertrauen Israels gewesen sind. Ich denke aber, dass die grammatikalische Form des Aorist im Konjunktiv das, was in der Vergangenheit der Fall war, auch für die Gegenwart und Zukunft voraussetzt: Ohne Zeichen und Erweise der befreienden und heilenden Macht des NAMENS ist in den Augen des johanneischen Jesus kein Vertrauen möglich.
↑ Johannes 4,49-53: Das durch das Leben des Sohnes bestätigte Vertrauen des Hofbeamten auf Jesu Wort
4,49 Der königliche Beamte sprach zu ihm:
Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt!
4,50 Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt!
Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.
4,51 Und während er noch hinabging,
begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt.
4,52 Da fragte er sie nach der Stunde,
in der es besser mit ihm geworden war.
Und sie antworteten ihm:
Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber.
4,53 Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war,
in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt.
Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.
[2. Juni 2022] Klaus Wengst zufolge (W155) lässt sich der Hofmann „durch den Tadel nicht von seiner Bitte abbringen“. Was er zuvor „in indirekter Rede“ erbeten hat, widerholt er „nun in direkter Rede…: ‚Herr, steige hinab, bevor mein Kind stirbt!‘“ Als Jesus daraufhin die Bitte mit den Worten erfüllt: „Geh! Dein Sohn lebt“, erlebt Jesus zum zweiten Mal, dass seine Erwartung sich nicht erfüllt, denn der Hofmann „glaubt dem ihm sich zusagenden Wort, ohne dass er sähe oder wüsste, wie es seinem Sohn jetzt ergeht“, und zwar „[o]bwohl Jesus mit Bestimmtheit festgestellt hat, dass die Leute nie und nimmer glauben würden, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sähen“. Damit erweist sich Wengst nochmals als Vertreter jener „Art von Theologie“, von der Veerkamp soeben gesprochen hatte, für die der „Glaube … immer etwas“ ist, „was nicht zu sehen ist, und … immer etwas“ bewirkt, „was nicht zu sehen ist.“
Allerdings kann Wengst seine Auffassung, dass „die besondere Ausprägung dieser Geschichte im Johannesevangelium“ darin besteht, „dass der Glaube auf das sich ihm zusagende Wort bezogen wird“, dann doch nicht hundertprozentig durchhalten, denn die Geschichte geht ja weiter, indem
[d]ieses Wort … dann aber auch Zeichen [setzt], sodass die Geschichte weiter und zu Ende erzählt werden kann. Während der Hofmann noch von Kana nach Kafarnaum hinabsteigt, kommen ihm schon seine Sklaven mit der Kunde entgegen, dass sein Sohn lebt. Die Nachfrage ergibt, dass die Besserung genau zu der Zeit eintrat, als Jesus ihm die Zusage gab. Wenn es daraufhin von dem Hofmann noch einmal heißt, dass „er Vertrauen gewann“, kann das im Zusammenhang nur bedeuten, dass dem Zeichen glaubensstärkende Kraft zukommt.
Es klingt aber wie ein Zugeständnis an ein ihm nicht zusagendes Detail der Geschichte, wie Wengst hier vom Wort spricht, das ein Zeichen setzt. Während der Glaube einfach durch das Wort Jesu hervorgerufen wird, hat das Zeichen lediglich eine verstärkende Funktion. Unklar bleibt, ob Wengst auch meint, dass der Glaube der anderen Mitglieder seines Hausstandes auf das Zeichen zurückzuführen ist, denn er sagt dazu nur (W155f.): „Dass nun nicht nur er, sondern auch ‚sein ganzes Haus‘ glaubt, muss ebenfalls im Zusammenhang der ganzen Geschichte gelesen werden.“
Worauf deutet aber nun eigentlich das Zeichen hin, das Jesus hier vollbringt? Nach Wengst ist die „elementare Dimension“, dass der Sohn des Hofmanns „nicht stirbt, sondern gesund wird…, bei dem nicht ausgespart, der zuvor als ‚der Retter der Welt‘ bekannt wurde“. Zugleich aber nimmt Wengst „eine weitere Dimension“ wahr, die offenbar das Leben nach dem Tode betrifft:
Dass einer aus Todesgefahr wieder zum Leben kommt, wird zum Zeichen für ein anderes Hinüberschreiten vom Tod zum Leben, von dem Jesus in 5,24 sprechen wird. Nicht nur dort wird dann auch der Zusammenhang von Glauben bzw. Vertrauen und Leben thematisiert.
Anders als Wengst begreift Hartwig Thyen (T292) die Erzählung vom todkranken Sohn des Hofbeamten weiterhin vor dem Hintergrund der parallelen Geschichten von Elia und den Synoptikern, was auch inhaltliche Konsequenzen mit sich bringt. So betont er, dass der Erzähler „seinen Leser an Elias Worte bei der Erweckung des einzigen Sohnes der Witwe von Sarepta erinnert“, indem er
Jesus nun zu dem Vater sagen sagen [lässt]: „Gehe hin! Dein Sohn lebt“. Die Formulierung, daß „der Mann dem Wort glaubte, das Jesus gesagt hatte“, ist wohl ein Spiel mit dem Satz des „Hauptmanns“ der Prätexte: „… Aber sprich nur ein Wort (alla eipe logō), so wird mein Knecht gesund werden“ (Mt 8,8; Lk 7,7). Über den „Glauben“ des Mannes im religiösen Sinne, daß er also etwa „an Jesus“ geglaubt hätte, ist damit noch nichts gesagt. Denn pisteuein {glauben} mit dem Dativ logō {dem Wort} bedeutet nicht mehr, als daß er Jesu konkretem Wort: ho hyios sou zē {dein Sohn lebt}, einfach ,Glauben schenkt‘ und darum dessen Aufforderung „Gehe hin!“ sogleich befolgt: kai eporeueto {und er ging hin}. Fehl am Platz sind darum alle tiefsinnigen Spekulationen um einen wahren, allein auf „das Wort“ gegründeten Glauben im Unterschied zum ,bloßem Wunderglauben‘ der Menge.
Zum Hinabsteigen des Hofbeamten nach Kapernaum meint Thyen, dass „[d]ieses ,hinab‘ (kata) … einerseits gewiß topographisch motiviert“ ist, „denn es setzt voraus, daß ,Kana‘ hoch im galiläischen Bergland, Kapharnaum aber unten in der Ebene am See Genezaret liegt. Zugleich aber könnten hier auch symbolische Obertöne im Spiel sein.“ Dabei denkt er recht vage an die Möglichkeit, dass der mehrfache Aufenthalt Jesu in Kana diesem Ort „den symbolischen Rang einer Art galiläischen ,Jerusalems‘ verleihen“ könnte (vgl. dazu die von Andreas Bedenbender vertretenen Anschauungen zum Abstieg nach Kapernaum, auf die ich zu Johannes 2,12 eingegangen bin).
Thyen bleibt dann aber doch „auf der Ebene des Geschehens“ und stellt fest (T293), dass erst, „als der Vater von seinen Sklaven“ erfährt, dass „die glückliche Wende … in eben dem Augenblick“ eingetreten ist, „da Jesus zu ihm gesagt hatte: ‚Gehe hin, dein Sohn lebt!‘…, ihm keine andere Wahl [bleibt] als diese: kai episteusen autos kai hē oikia autou holē {Und er glaubte, er selbst samt seinem ganzen Hause}.“ Erst an dieser Stelle bezeichnet das Wort episteusen den Glauben an Jesus, wobei das
eis auton {an ihn} … nicht eigens gesagt zu werden [braucht], denn es ergibt sich aus dem Kontext. Der Mann wird mit seinem ganzen Hauswesen zum Jünger und Nachfolger Jesu. Damit ist ein Doppeltes impliziert: Zum einen bestätigt sich von diesem Ende her Jesu Wort, daß nur wer seine Zeichen und Wunder offenen Auges wahrnimmt, glauben wird. Und zum anderen kann die Wendung: kai hē oikia autou holē {und sein ganzes Haus}, die uns aus Texten wie Act 16,34 geläufig ist, ja nichts anderes bedeuten, als daß dieser Repräsentant der Galiläer sich mit seinem Haus öffentlich zu Jesus bekennt. So wird an diesem Einzelfall illustriert, was es mit dem edechanto auton hoi Galilaioi {die Galiläer empfingen ihn freundlich} (V. 45) auf sich hatte. Und endlich bestätigt sich von hier aus noch einmal, daß nur Jerusalem/Judäa mit seinen kekrymmenoi mathētai dia ton phobon tōn Ioudaiōn {heimlichen Jüngern aus Furcht vor den Juden} (vgl. 19,38) die patris {Vaterstadt}Jesu sein kann, die ihren ,Propheten‘ verachtet.
Ganz anders als Wengst und Thyen geht Ton Veerkamp <428> mit dem scheinbaren Widerspruch um, dass der Hofbeamte dem Wort Jesu vertraut, obwohl Jesus doch gesagt hatte, dass die Menschen nur auf Zeichen und Machterweise Gottes hin vertrauen. Das Problem beschreibt er so:
Der Beamte insistiert: „Lauf hinunter, bevor mein Kindchen stirbt!“ Die Antwort ist: „Dein Sohn lebt.“ Der Mann vertraut diesem Wort. Ohne etwas gesehen zu haben! Das scheint dem zu widersprechen, was wir gerade sagten: Zeichen und Machterweise bewirken das Vertrauen Israels.
Die von Veerkamp konsultierten Kommentare deuten das „antijüdisch“:
Juden „glauben“, wenn sie Zeichen und Machterweise sehen, Christen „glauben“ ohne dergleichen, und das sei echt „glauben“. Wir sprechen es aus, damit nichts Antijüdisches schwelen bleibt.
Nach Veerkamp ist die Frage sehr ernst zu nehmen, ob man zur Zeit Jesu oder des Johannes unter der verheerenden weltweiten Herrschaft des Römischen Imperiums überhaupt noch auf die Zeichen und Wunder des Gottes Israels vertrauen kann:
Natürlich kann man in den Tagen des Scheiterns des Messias, seines Weggangs, nichts als die unerschütterliche Macht der Weltordnung und die Trümmer Jerusalems sehen. Es ist der Unterschied zwischen dem Israel der sinnlich erfahrenen und erfahrbaren Befreiung und dem Israel vor den Trümmern seiner Geschichte. Diesem Israel wird das Festhalten an einer messianischen Perspektive abverlangt in einem Augenblick, wo es seine Zukunft verloren zu haben scheint. Sicher gibt es in dieser Lage eine Spannung zwischen sehen und vertrauen. Es gibt Zeiten ohne Zeichen und Machterweise, wie Israel weiß und im trostlosen Lied: Warum, Gott, verabscheust du für ewig, Psalm 74,9 singt:
Unsere Zeichen sehen wir nicht mehr,
Nirgends mehr ein Prophet,
keiner ist mit uns, der wüsste, bis wann…
Vor diesem Hintergrund nimmt Veerkamp ernst, dass Jesu logos, „Wort“, vom hebräischen davar her zu begreifen ist: Das heißt, Jesu Wort repräsentiert genau die göttlichen „Tatworte“ oder „Worttaten“, die sich in Gottes Zeichen und Wundern befreiend und belebend auswirken. Der Hofbeamte vertraut auf Jesu Wort also deshalb, weil dieser durch sein Wort eben das Leben schaffende Zeichen wirken wird, das er erbeten hat, und zwar nicht spirituell, sondern diesseitig-konkret:
Dem Beamten steht freilich der Sinn nicht nach Theologie, er mahnt Jesus, er solle sich beeilen, bevor es zu spät ist. Das Zeichen wird zu sehen sein: „Dein Sohn lebt.“ „Der Mensch“ – so heißt er auf einmal – „vertraute dem Wort (logos, davar), das Jesus ihm sagte.“
Von daher ist klar, warum kein Widerspruch zwischen dem Vertrauen auf Jesu Wort und dem durch sein Zeichen bewirktes Vertrauen besteht: beide sind grundsätzlich identisch – aber wenn sich nicht im Nachhinein herausstellen würde, dass das Vertrauen gerechtfertigt war, bliebe letzten Endes der Verdacht bestehen, man hätte vielleicht doch auf den falschen Gott oder Messias vertraut:
Dem Beamten bleibt keine andere Wahl als zu vertrauen. Erst im nachhinein wird der Mann erfahren, ob er einem messianischen Scharlatan aufgesessen war. Was wahr und deswegen vertrauenswürdig ist, ist immer nachher feststellbar, ob im Guten oder im Bösen. Er muss die Bestätigung dafür haben, dass sein Sohn lebt. Das Fieber habe sein Kind verlassen, sagen seine Sklaven. „Wann?“ „In der siebten Stunde.“ Der Beamte muss sicher sein, dass es sich nicht um eine Spontangenesung handelt, sondern dass das Wort Jesu das Kind ins Leben zurückgerufen und seine Zukunft begründet hat. Die genaue Zeitangabe ist wesentlich. Erst jetzt kann man wirklich vertrauen; das erste Vertrauen war ein Vertrauen auf Vorschuss. Nur wenn sichergestellt ist, dass sich wirklich etwas geändert, zum Guten gewendet hat, wird das Wort Jesu zum Zeichen und Machterweis. Er und sein ganzes Haus, Frau, Kinder, Gesinde, vertrauen, weil alle gesehen haben, dass das Wort geschieht.
Damit ist jedoch noch nicht jeder Zweifel ausgeräumt, wozu Veerkamp auf die Thomas-Erzählung ganz am Ende des Johannesevangeliums vorausblickt:
Wenn die Menschheit Zeichen und Machterweise sieht, die befreien und beleben, dann vertraut sie. Aber was ist, wenn man nichts mehr sieht, wie kann man dann noch vertrauen? Johannes ruft die Frage auf, beantwortet sie erst in 20,24ff.
↑ Johannes 4,54: Das zweite Zeichen, das den Messias Jesus offenbart
4,54 Das ist nun das zweite Zeichen,
das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam.
[3. Juni 2022] Der Vers Johannes 4,54 (W156) markiert Klaus Wengst zufolge
in mehrfacher Hinsicht einen Abschluss. Das einleitende „Dies“ bezieht sich auf das unmittelbar vorher Erzählte zurück. Der Nebensatz: „nachdem er aus Judäa nach Galiläa gekommen war“ nimmt den Anfang des Kapitels wieder auf, wo Jesus in Judäa das Reiseziel Galiläa ins Auge gefasst hatte. Beides ist miteinander verknüpft, indem Johannes dieses Zeichen als zweites in Galiläa gewirktes zählt. Damit wird schließlich – wie schon in V. 46a, unmittelbar vor der Erzählung des Zeichens – der gesamte Zusammenhang bis zum Anfang von Kap. 2 überspannt. Alle diese Bezüge zurück weisen auf einen gewissen Abschluss hin, der jetzt erreicht ist.
Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass Wengst die nun folgenden Kapitel 5 bis 12 insofern von den ersten vier Kapiteln unterscheidet, als erst ab jetzt „die Darstellung von offener Gegnerschaft gegen Jesus geprägt“ ist. Am Rande geht er zu Recht kritisch darauf ein, dass Johannes Beutler <429> diese „ersten vier Kapitel des Johannesevangeliums“ mit dem Satz charakterisiert:
Sie „künden vom Eintritt des göttlichen Logos in die Welt“. Dass lógos nicht übersetzt wird, wirkt m. E. mystifizierend. Vor allem aber verdeckt dieser Satz, dass nach biblischem Zeugnis Gottes Wort von Gen 1 an „in die Welt“ getreten ist.
Wengst selbst fasst die Kapitel 1 bis 4 nicht unter einem besonderen Gesichtspunkt zusammen.
Hartwig Thyen betont, dass der Satz Johannes 4,54 „die Heilung des Sohnes des basilikos {königlichen Hofbeamten} ausdrücklich als sēmeion {Zeichen}“ bezeichnet und „[z]usammen mit V. 46a … deren Erzählung“ rahmt:
Beide Verse sind durch das Stichwort palin {wieder} miteinander verbunden. Es erinnert den Leser daran, daß es ebenfalls in Kana geschah, wo Jesus als die archē tōn sēmeiōn {Anfang der Zeichen} das Wasser zu Wein gemacht hatte. Hier hat er nun, nachdem er aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, dieses deuteron sēmeion {zweite bzw. andere Zeichen} getan.
Außerdem lehnt Thyen nochmals ausdrücklich die Behauptung ab, dass „V. 54 ein Rudiment aus einer vermeintlichen Semeia-Quelle sei oder ein solches auch nur enthalten soll“. Seinen Zweifel „daran, daß diese Art der ,Zählung‘ als ‚zweites Zeichen‘ als Indiz für die Existenz einer derartigen Quelle in Anspruch genommen werden darf“, hatte er ja bereits im Zusammenhang mit seiner Auslegung von Johannes 2,11 unter Verweis auf 2. Mose 4,8 überzeugend begründet. Er beschließt die Auslegung das Kapitels 4 mit folgenden Worten:
U. E. ist der gesamte V. 54 ebenso wie die Benennung der Wundertaten Jesu als sēmeia {Zeichen} ganz und gar eine Schöpfung unseres Evangelisten, der seinen Erzähler damit Jesu Weg von Judäa nach Galiläa abschließend resümieren läßt. Wie der Neueinsatz mit meta tauta {nach diesen Dingen} und der erneuten Festreise Jesu ,hinauf nach Jerusalem‘ in 5,1 zeigen, ist 4,54 zugleich der Abschluß des zweiten Aktes unserer „dramatischen Historie Jesu“.
Für Ton Veerkamp <430> ist mit der Erzählung des zweiten Zeichens zu Kana alles, was weiterhin vom Messias Jesus zu erzählen ist, grundgelegt. Die Befreiung ganz Israels, die unter Einschluss Samarias vor allem auf Judäa gerichtet ist und aus Judäa herkommt, kann von dem judäischen Messias Jesus offenbar nur bewirkt werden, indem sie gegen den Widerstand der führenden Judäer in der Metropole Jerusalem vom randständigen Galiläa aus in die Wege geleitet wird. Von dort stammt Jesus ja biographisch gesehen, dorthin führen ihn immer wieder seine Wege, dort vollbringt er auch seine beiden grundlegenden Zeichen:
Die erste Wegstrecke führte Jesus nach Kana in Galiläa, 1,43ff. Dann führt der Weg ein zweites Mal, über Jerusalem, das Land Judäa, den Jordan und über Samaria zurück nach Kana in Galiläa. Dort geschieht das andere Zeichen. Der ganze Lebensweg Jesu, aus Galiläa (1,43) nach Galiläa (21,1ff.), ist in diesem Abschnitt 2,1 bis 4,54 konzentriert. Es sind die Wege zum ersten und zum zweiten Zeichen in Kana. Ein drittes Mal wird der Weg vom Land Judäa nach Galiläa führen, 5,1-7,1. Zuletzt finden wir Jesus in Galiläa; 21,1ff. erzählt aber den letzten Gang Jesu von Jerusalem nach Galiläa nicht: er ist, oder geschieht in Galiläa, als „der Herr“ (21,7). Alle Zeichen, die in Israel, Judäa, Jerusalem und in Galiläa geschehen, können und müssen auf die zwei Zeichen 2,1ff. und 4,46ff. zurückgeführt werden. Mit diesen zwei Zeichen, der messianischen Hochzeit und der Belebung des Sohnes, ist das Fundament für das Kommende gelegt. Hier – und so – wurde der Messias „offenbar“.
Damit endet nach Ton Veerkamp der erste Teil des Johannesevangeliums, in dem ihm zufolge der „offenbare Messias“ und die Gründung seiner messianischen Gemeinde im Mittelpunkt stand.
An diesem Punkt beende ich auch den ersten Teil meines Johannes-Blogs, da dieser Beitrag schon so lang geraten ist, dass die Vervollständigung zuweilen technische Probleme verursacht. Im Johannes-Blog, Teil 2, geht es dann weiter mit der Auslegung der Kapitel 5 bis 12.
↑ Anmerkungen
<01> Eine Liste meiner zu dieser Thematik verfassten Beiträge findet sich hier: Johannes – antijüdischer oder jüdisch-messianischer Evangelist?
<02> In meinem Beitrag Augenzeuge – der Zeichen des Messias Jesus! habe ich mich mit dem Versuch von Günter Reim auseinandergesetzt, der davon ausgeht, dass Johannes auf eine Wunderquelle, ein viertes synoptisches Evangelium (neben Markus, Matthäus und Lukas), und eine Weisheitstradition zurückgegriffen habe.
<03> Hartwig Thyen, Das Johannesevangelium, Tübingen 2005. Die im folgenden Text in runden Klammern (…) angegebenen Seitenzahlen oder Verweise auf Anmerkungen mit vorangestelltem „T“ beziehen sich auf die jeweils folgenden Zitate aus diesem Buch. Sind solche Zitate als eigener Absatz eingerückt, werden sie blau hervorgehoben.
Um es nicht überall ausdrücklich erklären zu müssen, merke ich schon hier an, dass dort, wo Thyen sich in Zitaten auf „Barth“ bezieht, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, gemeint ist, wie er sich in seiner Kirchlichen Dogmatik. Die Lehre von Gott. Bd. II/2, Zürich 1948, oder in seiner Erklärung des Johannes-Evangeliums. Ges. Ausg. 9, Zürich 1976, zum Johannesevangelium geäußert hat.
<04> Der Kommentar von Wengst bestand ursprünglich aus zwei Bänden und war bereits in 1. Auflage 2000 und 2001 (2. Auflage 2004/2007) erschienen. Ich lese und beziehe mich auf die stark gekürzte einbändige Neuausgabe Klaus Wengst, Das Johannesevangelium, Stuttgart 2019. Die im folgenden Text in runden Klammern (…) angegebenen Seitenzahlen oder Verweise auf Anmerkungen mit vorangestelltem „W“ beziehen sich auf die jeweils folgenden Zitate aus diesem Buch. Sind solche Zitate als eigener Absatz eingerückt, werden sie grün hervorgehoben.
<05> Ton Veerkamp, Solidarität gegen die Weltordnung. Eine politische Lektüre des Johannesevangeliums über Jesus Messias von ganz Israel, Gießen 2021. Zitate aus diesem Werk erhalten, wo sie einen eigenen Absatz bilden, eine rote Hervorhebung und werden durch einen Link zum jeweiligen Abschnitt der Online-Version belegt (mit der Angabe des jeweiligen Absatzes, wobei der gesamte dem Abschnitt vorangestellte Bibeltext als 1. Absatz gezählt wird). In Klammern wird nach der Abkürzung Veerkamp 2021 nicht nur die Seitenzahl der PDF-Version angegeben, sondern verbunden mit dem jeweiligen Erscheinungsjahr auch die Seitenzahl einer der Zeitschriften, in der das Werk ursprünglich veröffentlicht worden war: Veerkamp 2002 = Ton Veerkamp, Der Abschied des Messias. Johannes 13-17, in: Texte und Kontexte 96/96 (2002), Veerkamp 2005 = Ton Veerkamp, Das Evangelium nach Johannes in kolometrischer Übersetzung, in: Texte und Kontexte 106/107 (2005), Veerkamp 2006 = Ton Veerkamp, Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1-10,21, in: Texte & Kontexte 109-111, 2006, Veerkamp 2007 = Ton Veerkamp, Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22-21,25, in: Texte & Kontexte 113-115, 2007, und Veerkamp 2015 = Ton Veerkamp, Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen, 2., grundlegend überarbeitete Auflage, in: Texte und Kontexte Sonderheft Nr. 3 (2015).
Außerdem zitiere ich mit dem Kürzel Veerkamp 2013 meinen Beitrag Ton Veerkamp: „Die Welt anders“, in dem ich ein weiteres Buch dieses Autors zusammenfasse: Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung © Institut für Kritische Theologie Berlin e. V. nach der in Berlin erschienenen Ausgabe © Argument Verlag 2013.
<06> Ich gebe altgriechische Buchstaben mit ihrer deutschen Entsprechung wieder und unterscheide dabei die beiden t-Laute durch t und th und kennzeichne die langen e- und o-Vokale ēta und ōmega mit ē und ō.
Die hebräischen Buchstaben beth/veth, gimel, daleth, he, waw, chet, tet, jod, kaf/khaf, lamed, mem, nun, pe/fe, zade, qof, resch, schin und thaw gebe ich mit ihren hier fett hervorgehobenen Anfangsbuchstaben wieder. Vom weichen zajin = s unterscheide ich die scharfen s-Laute auf ungewöhnliche Weise: samech = ss und sin = ß. Bis auf die beiden Zeichen ˀ und ˁ für die Knacklaute ˀalef und ˁayin verwende ich keine diakritischen Zeichen. Stumme Konsonanten an den Wortenden (alef, he, waw und jod) lasse ich weg. Auch unterscheide ich weder zwischen einfachen und doppelten Konsonanten noch gebe ich die unterschiedlichen Längen der Vokale an (allerdings verwende ich manchmal ein ɘ für einen nur angedeuteten e-Laut).
<07> Diesen Gedanken führt Wengst (W37, Anm. 9) auf Wilhelm Heitmüller, Das Johannes-Evangelium, SNT 4, Göttingen, 3. Auflage 1918, 37, zurück:
„Zum nachfolgenden Evangelium verhält sich der Prolog wie eine Ouvertüre. Es erklingen schon hier die Haupt-Themen, die dann im Evangelium näher ausgeführt werden.“
<08> Dazu zitiert er Hartwig Thyen, Aus der Literatur zum Johannesevangelium, ThR 39, 1975, 223: „so scheint mir der Prolog die Anweisung an den Leser zu enthalten, wie das ganze Evangelium gelesen und verstanden sein will“, und Hartwig Thyen, Artikel Johannesevangelium, TRE 17, 1988, 213, wo er vom Prolog als „Lektüreanweisung“ spricht.
<09> Wengst bezieht sich auf den Kommentar von H. J. Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg 1894, 21.
<10> Allerdings nicht in seinem Johannes-Kommentar von 2005, sondern 17 Jahre zuvor in Hartwig Thyen, Artikel Johannesevangelium, TRE 17, 1988, 201.
<11> Die Vorrede, 1,1-18, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 19; 2006, 7).
<12> F. Kermode, St. John as Poet: JSNT 28 (1986) 3-16.
<13> Das Wort und das Leben, 1,1-3, Abs. 1-5 (Veerkamp 2021, 20-21; 2015, 9 und 2006, 7-8).
<14> Ich verstehe nicht ganz, wie Wengst (W46, Anm. 26) aus diesen Zeilen zur folgenden kritischen Schlussfolgerung an diesen Äußerungen Thyens gelangt:
Die mystifizierende Rede von „dem Fleischgewordenen“ suggeriert, als wäre der jüdische Mensch Jesus vorher etwas anderes gewesen. Nach dem Zeugnis des Prologs hat nicht „Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, […], Fleisch angenommen“, sondern ist „das Wort Fleisch geworden“ – das schöpferische Sprechen Gottes, mit dem die Erzählung der Bibel beginnt und von dem sie weiter erzählt in der Geschichte Gottes mit der Welt und seinem Volk Israel besonders. Auf dem Grund und im Raum dieser Erzählung steht das Johannesevangelium von seinem ersten Satz an und also auch das „Preisgedicht“ des Prologs.
Ziemlich genau in diesem Sinne meine ich auch Thyen – jedenfalls an dieser Stelle – verstehen zu können, gerade weil ihm zufolge im Prolog eben keine Vorgeschichte der Fleischwerdung erzählt wird.
<15> Vgl. dazu in Veerkamp 2013, Große Erzählung – messianistisch interpretiert und Von den Pastoralbriefen bis zu Justin und Ignatius, im letzteren Abschnitt insbesondere Abs. 5:
Mit dem Bischof Ignatius von Antiochien beginnt die Tendenz, (351) nicht mehr „das Evangelium von der Schrift her“ zu lesen, sondern „die Schrift wird nur noch verständlich, wenn sie auf das Evangelium hin verkündigt wird.“ (352) „Nach Ignatius schließen sich Joudaismos (jüdische Lebensführung) und Christianismos (christliche Lebensführung) aus.“
<16> Die folgenden Zitate in: Das Wort und das Leben, 1,1-3, Abs. 8-11 (Veerkamp 2021, 22-23; 2006, 8-9).
<17> Auch Wengst sagt ausdrücklich (W43), dass Jesus „im Johannesevangelium nicht als ‚der über die Erde schreitende Gott‘ verstanden ist“. Von einer solchen Vorstellung war (W43, Anm. 18)
die liberale Interpretation der johanneischen Christologie gekennzeichnet (vgl. Wilhelm Heitmüller, Das Johannes-Evangelium, SNT 4, Göttingen, 3. Auflage 1918, 27: „Der Johannes-Christus ist, kurz gesagt, eine über die Erde wandelnde Gottheit.“), die in eindrucksvoller Weise von Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen, 3. Auflage 1971, wieder aufgenommen worden ist. Die Wendung „von dem über die Erde schreitenden Gott“ findet sich ausdrücklich auf S. 137.
<18> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Das Wort und das Leben, 1,1-3, Abs. 13-17 (Veerkamp 2021, 23-24; 2006, 9-10), seine Übersetzung von Johannes 1,1bc.2 ebenda, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 20; 2015, 9).
<19> Martin Luther, Großer Katechismus, Auslegung des ersten Gebots, Bekenntnisschriften der evang.-lutherischen Kirche (BSLK) 560,22-24.
<20> Nachträglich geht Thyen (T107f.) bei der Auslegung von ho ōn eis ton kolpon tou patros, „der im Schoß des Vaters ist“, in Johannes 1,18 dann doch darauf ein, dass Johannes „die Präpositionen pros und eis c. Acc. {mit Akkusativ} durchweg im Sinn eines dynamischen Gerichtetseins auf eine Sache oder Person“ gebraucht, „und mit der LXX unterscheidet er zwischen eis {in etwas hinein} und en {in} ebenso präzise wie zwischen pros c.Acc. {auf etwas hin mit Akkusativ} und para c. Dat. {bei mit Dativ}“.
So schreibt er (T107) unter Berufung auf Ignace de la Potterie (La Vérité dans Saint Jean I: AnBib 73, Rom 1977, 228):
Er, der den Vater ständig vor Augen und seine entolē {Gebot} im Ohr hat (vgl. ho heōrakamen martyroumen {wir bezeugen, was wir gesehen haben} [3,11]; ho heōraken kai ēkousen, touto martyrei {was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er} [3,32]; sowie 11,41f), ist stets hingeneigt zum Herzen des Vaters („Le Fils unique tourné vers le sein du Père“…).
Und im Blick auf die Verse 1 und 18, die den gesamten Johannes-Prolog umschließen, fügt er hinzu:
Auf diesem, durch kai ho logos ēn pros ton theon {und der Logos war bei Gott} zu Eingang des Prologs und durch ho ōn eis ton kolpon tou patros {der im Schoß des Vaters ist} an seinem Ausgang markierten, stetigen Orientiertsein des Sohnes auf den Vater beruhen doxa und alētheia seines Weges.
Wie allerdings schon an den im letzteren Zitat in geschweiften Klammern hinzugefügten Übersetzungen Thyens (T63) leicht zu erkennen ist, haben seine Einsichten zur Bedeutung der Präpositionen pros und eis offenbar nicht einmal Konsequenzen für seine eigene Übersetzung, und er zieht aus ihnen auch keine weiteren Schlussfolgerungen, wie es etwa Ton Veerkamp tut, und zwar sowohl in seiner Übersetzung von Johannes 1,1, „das Wort ist auf GOTT gerichtet“, als auch in seiner Auslegung der aletheia Jesu von der „Treue“ des Gottes Israels her, dessen „Ehre“ in der Befreiung und im Leben seines Volkes Israel besteht.
<21> Das Wort und das Leben, 1,1-3, Abs. 17-20 (Veerkamp 2021, 24-25; 2006, 10-11):
Ein im Denken der spätantiken Kultur geschulter Grieche des 3. oder 4. Jh. kann solche Sätze nicht anders als im Rahmen seiner Logik lesen, im Rahmen der abendländischen Logik überhaupt. Natürlich wird er seine Probleme haben.
Der logische Satz das Wort = Gott scheint gegen den monotheistischen Hauptsatz der Schrift zu verstoßen. Er muss den Satz dann interpretieren. Er kennt die alexandrinische philosophische Tradition und ihren großen Höhepunkt, die Philosophie Plotins, er benutzt ihre wissenschaftlichen Kategorien, er hat ja gar keine anderen. Er muss fragen: „Welcher Art ist die Identität Wort = Gott?“ Manche interpretieren: Das Wort ist nicht Gott, sondern göttlich. Das sahen aber andere anders, und der Streit begann.
Ist die Identität zwischen Gott und Wort als Wesensgleichheit oder als Wesensähnlichkeit, auf griechisch homoousios oder homoiousios, zu denken? Der Unterschied scheint subtil, das Problem ist wichtig. Ordnet man das Wort dem Gott Israels unter, reduziert man den Christus der christlichen Religion letztlich zu einem der großen Propheten Israels. Dem Judentum und später dem Islam gegenüber hätte das Christentum dann keine wesentlichen ideologischen Vorteile. Macht man aus dem Wort auf neoplatonische Weise eine der Emanationen des Einen (to hen), verliert das Christentum der Spätantike gegenüber seinen einmaligen Charakter.
Das Christentum sollte aber nach 323 – in dem Jahr übernahm Konstantin die Alleinherrschaft über das Reich – die Rolle einer einzig legitimen und universalen – oder besser gesagt: hegemonialen – Reichsideologie spielen. Nachdem die spätantike Kultur unter Kaiser Julianus (361-363) noch einmal und vergeblich versucht hatte, das verlorene Terrain zurück zu erobern, wurde sie als Heidentum unter Theodosius (379-395) verboten. Das Christentum hatte das Rennen gemacht, das christliche Mittelalter, basierend auf der neu organisierten Ausbeutung bäuerlicher Arbeit (Kolonat), begann. Mit der plotinischen Übersetzung und Deutung des Satzes „und das Wort ist Gott“ war das Christentum in seinem Bereich, Byzanz, dem Abendland, ideologisch hegemoniefähig geworden. Seitdem können wir kaum noch anders, als Johannes 1,1-18 griechisch zu lesen. Unsere Lektüre hier ist aber orientalisch, wenn man will.
<22> M. Blanchot, Etre juif. In: L‘entretien infini. Paris 1969, 1871.
<23> H. Lausberg, Jesaja 55,10-11 im Evangelium nach Johannes: NAWG PH 1979, 131-144.
<24> Veerkamps Übersetzung und Zitat in: Das Wort und das Leben, 1,1-3, Abs. 1 und 23 (Veerkamp 2021, 21 und 25-26; 2015, 9 und 2006, 11).
<25> Dass er (W47, Anm. 27) auf Spekulationen „gnostischer Denker“ verzichtet, „für die der dualistische Gegensatz von Licht und Finsternis und das Verschlagensein von Licht in Finsternis fundamental sind“, darin hat Wengst selbstverständlich Recht.
<26> Die folgenden Zitate in: Das Leben und das Licht, 1,4-5, Abs. 1-9 (Veerkamp 2021, 26-28; 2015, 9 und 2006, 12-13).
<27> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der Zeuge, 1,6-8, Abs. 1-7 (Veerkamp 2021, 26-28; 2015, 9 und 2006, 12-13).
<28> Dazu erläutert Veerkamp in seiner Anm. 33 (Veerkamp 2021, 29; 2006, 14):
In Jesaja 7,9 sagt ein Prophet dem König Judas in einer sehr kritischen Situation, er solle nicht die Nerven verlieren: „Vertraut ihr (selber) nicht, findet ihr keine Treue (bei anderen).“ (im lo thaˀaminu ki lo thaˀamenu, kai ean mē pisteusēte oude mē synēte.) Die Septuaginta wird dem hebräischen Wortspiel mit der kausativen und der passiven Form der Wurzel ˀaman nicht gerecht. Buber übersetzt: „Vertraut ihr nicht, bleibt ihr nicht betreut.“ Der Sinn ist, dass Panik das Volk ins Verderben führen muss. Der König soll seinem Berater, das Volk dem König vertrauen und entsprechend handeln. Diese Haltung ist dem Messias gegenüber einzunehmen, und das ist mehr als glauben.
<29> Das Licht und die Weltordnung, 1,9-11, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 30; 2015, 9).
<30> Der Zeuge, 1,6-8, Abs. 7 (Veerkamp 2021, 29-30; 2006, 14) und Anm. 34 zur Auslegung von Johannes 1,9 (Veerkamp 2021, 30; 2015, 8).
<31> Die folgenden Veerkamp-Zitate in: Das Licht und die Weltordnung, 1,9-11, Abs. 1-6 (Veerkamp 2021, 30-33; 2015, 9 und 2006, 15-16).
<32> Anm. 37 zur Auslegung von Johannes 1,10 (Veerkamp 2021, 30; 2005, 14, Anm. 10).
<33> Anm. 35 zur Auslegung von Johannes 1,10 (Veerkamp 2021, 30; 2015, 9).
<34> Das Licht und die Weltordnung, 1,9-11, Abs. 7 (Veerkamp 2021, 33; 2006, 16).
<35> Martin Luther, Das Evangelium ynn der hohe Christmesß auß S. Johanne am ersten Capitel: Kirchenpostille von 1522, WA 10, 180-247, 226.
<36> Geburt, 1,12-13, Abs. 1-2 (Veerkamp 2021, 33-34; 2015, 11 und 2006, 16).
<37> Geburt, 1,12-13, Abs. 4 (Veerkamp 2021, 34; 2006, 16-17).
<38> Die folgenden Zitate in: Geburt, 1,12-13, Abs. 2-19 (Veerkamp 2021, 33-37; 2006, 16-19).
<39> Dazu verweist Wengst (54, Anm. 36) auf Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV 1, 181, und Jochen Denker, Das Wort wurde messianischer Mensch. Die Theologie Karl Barths und die Theologie des Johannesprologs, Neukirchen-Vluyn 2002, 259-262.
<40> Wengst zitiert Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, nach der 5. Auflage 2016, 58.
<41> Wengst zitiert Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009, 127.
<42> Thyen zitiert Schleiermachers Glaubenslehre II, 34. Im Literaturverzeichnis erscheint die Quellenangabe: Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik. Hgg. u. eingel. von M. Frank. stw 211, Frankfurt 1977.
<43> Thyen zitiert Johannes Fischer, Glaube als Erkenntnis, BevTh 105, München 1989, 34.
<44> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 40f.
<45> Thyen zitiert Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen, nach der 4. Auflage 1980, 27f.
<46> Die folgenden Zitate in: Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 3-5 (Veerkamp 2021, 38-40; 2006, 20-21).
<47> Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 37; 2015, 11).
<48> Ein Begriff aus Heinrich Lausberg, Der Johannes-Prolog: NAWG PH 1984, 238.
<49> Dazu verweist Thyen auf Bernd Janowski, Gottes Gegenwart in Israel, Neukirchen-Vluyn 1993, 223-246; das folgende Zitat steht auf S. 240.
<50> Wengst zitiert ihn (Anm. 42) mit MekhJ, Bo 14, zu Ex 12,41 (mechilta d‘Rabbi Jischmael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 [Erstausgabe Frankfurt am Main 1931], 51-52).
<51> Diese Worte zitiert Wengst nach SifBam Beha‘alotcha § 84 (Sifre zu Num sifrej al sefer bamidmar ve-sifrej suta, hg. v. H. S. Horovitz, Nachdruck Jerusalem 1992 [Leipzig 1917]), 81 und 82.
<52> Wengst bezieht sich auf Jörg Frey, Between Torah and Stoa. How Could Readers Have Understood the Johannine Logos?, in: The Prologue of the Gospel of John. Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts, ed. by Jan van der Watt, R. Alan Culpepper, Udo Schnelle, Tübingen 2016, 232.
<53> Das erste folgende Zitat stammt aus: Michael Wyschogrod, Inkarnation aus jüdischer Sicht, EvTh 55, 1995, 22f., das zweite aus: Michael Wyschogrod, Gott und Volk Israel. Dimensionen jüdischen Glaubens, Stuttgart 2001, 23.
<54> Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 6 (Veerkamp 2021, 40; 2006, 21).
<55> Anm. 51 zur Übersetzung von Johannes 1,14 (Veerkamp 2021, 37; 2015, 10).
<56> Hier ist allerdings anzumerken, dass Martin Buber selbst das Wort „Ehre“ in der Regel gerade nicht zur Verdeutschung von kavod verwendet, wo es sich auf Gott bezieht, sondern das Wort „Erscheinung“ (Martin Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift, in: Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Gütersloh 2007, 1105):
Nicht immer aber geht es an, auf den ursprünglichen Wortsinn zurückzugehn, um der biblischen Absicht Genüge zu tun. So ist dem eigentlichen Sinn des Wortes kabod, das man mit „Ehre“, wo von den Menschen, mit „Herrlichkeit“ übersetzt, wo von Gott die Rede ist, keine abendländische Entsprechung zu finden. Dem Wurzelsinn gemäß bezeichnet es das innere Gewicht eines Wesens, aber als sich manifestierend, als erscheinend. lm menschlichen Bereich muß es wohl bei „Ehre“ bleiben, aber für den kabod Gottes darf das Wort „Erscheinung“ verwendet werden, als das Sichtbarwerden der unsichtbaren majestas, ihr Scheinendwerden – Lichtglorie am Himmel als Ausstrahlung der „Wucht“. Diese Unmittelbarkeit der Sprachwahrnehmung beim Leser vorausgesetzt, darf der Dolmetsch das zugehörige Verb in der Reflexivform an Stellen wie 2 M{ose} 14,4, 17f.; 3 M{ose} 10,3, statt mit „Ehre einlegen“, „sich verherrlichen“ oder dgl., ein gut deutsches Wort erneuern und Gott sprechen lassen: „Ich erscheinige mich.“
Ich vermute, dass Veerkamp sich von Bubers Verdeutschung von Psalm 115,1 hat leiten lassen, wo das Wort kavod in doppelter Weise auf Israel und auf Gott bezogen wird und Buber sich für die Verwendung des Wortes „Ehre“ entschieden hat.
<57> Jetzt ist meine Seele erschüttert, 12,27-33, Abs. 5-6 (Veerkamp 2021, 287; 2007, 33).
<58> Wengst (Anm. 44) zitiert nach: Aboth de Rabbi Nathan, (A) 2, hg. v. S. Schechter, verb. Ausgabe New York 1967 (Erstausgabe Wien 1887), 7a.
<59> Wengst (Anm. 45) zitiert nach: Midrasch Tanchuma B, übersetzt v. Hans Bietenhard, Bern u. a. 1980 (Band 1), 1982 (Band 2), Bemidbar 20 (9b) und gibt als Parallele an: Midrasch Tanchuma, Nachdruck in Israel o. O. u. o. J., Bemidbar 17 (Wilna 246a).
<60> Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 8 (Veerkamp 2021, 41; 2006, 22).
<61> Thyen zitiert Heinrich Lausberg, Der Johannes-Prolog: NAWG PH 1984, 240.
<62> Thyen zitiert Gerard Pendrick, monogenēs: NTS (1995) 587ff.
<63> Thyen zitiert Michael Theobald, Die Fleischwerdung des Logos, Münster 1988, 247 (m. Anm. 192) u. 256.
<64> Die folgenden drei Zitate in: Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar, in: Texte & Kontexte 71/72 (1996), 14, 12, 12f.
<65> Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 1 und 7 (Veerkamp 2021, 37-38 und 40; 2015, 11 und 2006, 22).
<66> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 47ff.
<67> Thyen zitiert Ignace de la Potterie, La Vérité dans Saint Jean I: AnBib 73, Rom 1977, 117-241.
<68> Thyen zitiert Friedrich Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe, 8. Abt., 1. Bd., Berlin & New York 1974, 47 [= Nr. 182].
<69> Thyen zitiert Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt 1970, 388.
<70> Ebd. 389. Der Titel von Ton Veerkamps Buch „Die Welt anders“, auf dessen Besprechung ich hier mit dem Kürzel Veerkamp 2013 verweise, beschreibt seine Überzeugung, dass die „Große Erzählung“ Israels, auf der noch die messianischen Schriften aufbauen (die wir das Neue Testament nennen), nicht auf eine Erlösung im Jenseits ausgerichtet sind, sondern eine konkrete Veränderung dieser Welt auf der Erde unter dem Himmel Gottes für möglich halten.
<71> Wengst zitiert (Anm. 49) Adolf Deissmann, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen, 4. Auflage 1923, 99f.
<72> Das Wort und die menschliche Wirklichkeit, 1,14, Abs. 1 und 9 (Veerkamp 2021, 38 und 41; 2015, 11 und 2006, 22-23).
<73> Dazu verweist Thyen auf Gerard van Belle, Les parenthèses dans l‘évangile des Jean, Leuven 1985.
<74> Thyen zitiert Heinrich Lausberg, Der Johannes-Prolog: NAWG PH 1984, 247.
<75> Anm. 61 zur Übersetzung von Johannes 1,15 (Veerkamp 2021, 43; 2015, 12), und Ein Nachwort, 1,15-18, Abs. 2 (Veerkamp 2021, 43; 2006, 23).
<76> Ruth B. Edwards, CHARIN ANTI CHARITOS (John 1.16). Grace and the Law in the Johannine Prolog: JSNT 32 (1988) 3-15.
<77> Dorit Felsch, Die Feste im Johannesevangelium. Jüdische Tradition und christologische Deutung, Tübingen 2011, 148.
<78> Hans Weder, Mein hermeneutisches Anliegen im Gegenüber zu Klaus Bergers Hermeneutik des Neuen Testaments, EvTh 52, 1992, 320.
<79> Dazu gibt Wengst (Anm. 59) die Quellen „ShemR 33,1 (Wilna 61b)“ an. In seinem Literaturverzeichnis finde ich dazu den Midrash Shemot Rabbah (I-XIV), hg. v. A. Shinan, Jerusalem u. Tel Aviv 1984. Die Angabe in der Klammer (Wilna) mag sich auf einen Nachdruck zusammen mit dem Midrasch Mischlej, hg. von S. Buber, Jerusalem 1965 (Wilna 1893), beziehen.
<80> Anm. 56 zur Übersetzung von Johannes 1,17 und Ein Nachwort, 1,15-18, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 42; 2015, 12-13).
<81> Alle Zitate bis zum Ende dieses Abschnitts in: Ein Nachwort, 1,15-18, Abs. 3-10 (Veerkamp 2021, 43-45; 2006, 24-25).
<82> Dazu beruft sich Veerkamp (Anm. 62 und 63) auf Gerhard Jankowski, Die große Hoffnung. Paulus an die Römer. Eine Auslegung, Berlin 1998, 165-170. Das Wort „geledigt“ verwendet Jankowski (152f.) als Übersetzung für das Wort katērgētai in Römer 7,2, denn gemäß der Tora ist eine Witwe durch den Tod ihres Ehemannes wieder zur Ledigen geworden. Vgl. auch in Veerkamp 2013 den Abschnitt Paulus: Volk und Völker – Tora undurchführbar.
<83> Thyen zitiert hier Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 2 Bde, München, 2. Auflage 1973, § 879, sowie Heinrich Lausberg, Das Epiphonem des Johannes-Prologs (1,18): NAWG PH 1979, 272 und 273.
<84> Dazu verweist Wengst (Anm. 64) allerdings nicht auf Isaak, wie es Veerkamp tut, sondern auf den „späten Midrasch ShirS“, in dem „in 1,1 unter den 70 Namen Israels an vierter Stelle: ‚Einziger‘“ erscheint.
<85> Wengst (Anm. 66) zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 27.
<86> So Wengst zufolge Dorit Felsch, Die Feste im Johannesevangelium. Jüdische Tradition und christologische Deutung, Tübingen 2011, 152.
<87> Alle Veerkamp-Zitate bis zum Ende dieses Abschnitts in: Ein Nachwort, 1,15-18, Abs. 1 und 11-19 (Veerkamp 2021, 42-43 und 45-47; 2015, 13 und 2006, 25-26).
<88> In diesem gesamten Abschnitt beziehe ich mich auf die jeweiligen Inhaltsverzeichnisse der drei Autoren; hier das Inhaltsverzeichnis der Johannes-Auslegung von Ton Veerkamp.
<89> Zweiter Teil: Der verborgene Messias, 5,1-12,50 (Veerkamp 2021, 139; 2006, 95).
<90> Vgl. die Informationen über Die jüdische Hochzeit auf der Internetseite www.talmud.de.
<91> Dafür wird er später im Zusammenhang mit der Hochzeit zu Kana zusätzliche Gründe anführen, auf die ich dort näher eingehe.
<92> Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 2 (Veerkamp 2021, 73; 2006, 44).
<93> Thyen zitiert Peter von der Osten-Sacken, Der erste Christ: Johannes der Täufer als Schlüssel zum Prolog des vierten Evangeliums: ThViat 13 (1975/76), 155-173.
<94> Die drei folgenden Veerkamp-Zitate in: Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 2, Anm. 70 (Veerkamp 2021, 49-50; 2006, 28), Anm. 64 zur Übersetzung von Johannes 1,19 (Veerkamp 2021, 48; 2015, 14) und Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 2 und 4 (Veerkamp 2021, 49-50; 2006, 28-29).
<95> Thyen zitiert Andreas Obermann, Die christologische Erfüllung der Schrift im Johannesevangelium, WUNT II/83, Tübingen 1996, 112.
<96> Thyen zitiert William Wrede, Charakter und Tendenz des Johannesevangeliums, Tübingen 1903 (Reprint: ebd. 1933), 64f.
<97> Thyen verweist dazu auf die Quelle: „Ant. Iud. 18,116-119“ und bezieht sich damit auf die Edition des griechischen Textes von Benedikt Niese (1890). Ich zitiere Werke von Josephus nach der in https://archive.org veröffentlichten Quelle: Flavius Josephus Werke: Altertümer, Krieg, Apion, Leben. Übersetzt von Heinrich Clementz, 1900, und zwar die „Jüdischen Altertümer“ (Kürzel: „Ant.“) und den „Jüdischen Krieg“ (Kürzel: „Bell.“) mit der Angabe von Buch, Kapitel und Abschnitt, hier: Josephus, Ant. 18, 5, 2.
<98> Thyen verweist dazu auf die Quelle „Dial 49“, nachzulesen unter Justin der Märtyrer, Dialog mit dem Juden Trypho, 49 (Bibliothek der Kirchenväter).
<99> Dazu beruft sich Wengst (Anm. 10) auf die Quelle „MekhJ Jitro (BaChodesch) 2“, die im Literaturverzeichnis so erscheint: Mechilta d‘Rabbi Ismael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 (Erstausgabe Frankfurt am Main 1931).
<100> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 11-12 und 14 (Veerkamp 2021, 52; 2006, 30).
<101> Dazu merkt Wengst (Anm. 13) an, dass das schon Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes,. wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960 (=1930), 42, herausgestellt hat.
<102> Thyen zitiert Maarten J. J. Menken, The Quotation from Isa 40,3 in John 1,23: Bib. 66 (1985), 195ff.
<103> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Anm. 68 zur Übersetzung von Johannes 1,24 (Veerkamp 2021, 49; 2015, 14) und Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 5-6 (Veerkamp 2021, 50-51; 2006, 29).
<104> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 14-17 (Veerkamp 2021, 52-53; 2006, 30-31).
<105> Siehe das hebräische halakh ˀachare bzw. griechische poreuomai opisō, 5. Mose 6,14; 8,19; Hosea 11,10.
<106> Wengst zitiert „tQuid 1,5“, Tosefta Quiddushin, wozu im Literaturverzeichnis steht: The Tosefta, hg. v. S. Lieberman, seder serajim, Jerusalem, 2. Auflage 1992; seder moˀed, New York 1962; seder naschim (sota, gittin, kidduschin), New York 1973.
<107> Dazu zitiert Wengst „ShemR 25,6 (Wilna 46b)“, was in Midrash Shemot Rabbah (I-XIV), hg. v. A. Shinan, Jerusalem u. Tel Aviv 1984, zu finden sein könnte.
<108> Der erste Tag. Die Befragung, 1,19-28, Abs. 18 (Veerkamp 2021, 53; 2006, 31).
<109> Nach Wengst (Anm. 18) ein Ausdruck von Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 170.
<110> So formuliert nach Wengst (Anm. 18) Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes, GSL.NT 4, Düsseldorf (1a: 1981), 130.
<111> Der zweite Tag. Einer wie Gott, 1,29-34, Abs. 3 (Veerkamp 2021, 55; 2006, 31).
<112> Die folgenden beiden von Thyen angeführten Zitate (von mir übersetzt) aus: Geza Vermes, Scripture and Tradition in Judaism: = Studia Post-Biblica IV, Leiden 1961, 202: “the most obvious explanation is to be sought in the usual midrashic process, namely, in the interpretation of one scriptural passage by the light of another”, und 208: „In short, the Binding of Isaac was thought to have played a unique rôle in the whole economy of the salvation of Israel, and to have a permanent redemptive effect on behalf of its people. The merits of his sacrifice were experienced by the Chosen People in the past, invoked in the present, and hoped for at the end of time“.
<113> Wengst zitiert (Anm. 24) „MekhJ Mischpatim (Nesikin) 10“ und bezieht sich damit auf Mechilta d‘Rabbi Ismael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 (Erstausgabe Frankfurt am Main 1931).
<114> Wengst zitiert sie mit „mShevu 1,6“: Mischna Shevuˁot, zu finden in: Mischna: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<115> Alle folgenden Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der zweite Tag. Einer wie Gott, 1,29-34, Abs. 8-9.12-14 und 3.7 (Veerkamp 2021, 55-58; 2006, 31-33).
<116> Eine genauere Beschäftigung mit diesem Begriff verschiebe ich auf die zentrale Stelle Johannes 8,44, wo das Wort diabolos in prägnanter Weise verwendet wird – mit einer Wirkungsgeschichte, deren Folgen nur als katastrophal bezeichnet werden können.
<117> Tatsächlich wird mindestens etwa ein Drittel aller über 650 Vorkommen von naßaˀ in der Septuaginta mit airein übersetzt, allerdings, wie Wengst ja angemerkt hat, nur sehr selten im Zusammenhang mit dem Tragen von Verfehlungen.
<118> Thyen zitiert Walter Bauer, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen, 3. Auflage 1933, 36.
<119> Der zweite Tag. Einer wie Gott, 1,29-34, Abs. 15-16 (Veerkamp 2021, 58; 2006, 34).
<120> Damit wendet sich Wengst „gegen Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009, 171, nach dem Israel ‚in Differenz zu ,den Juden‘ […] nur die von Gott erwählte Heilsgemeinde‘ meine.“
<121> Alle weiteren Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der zweite Tag. Einer wie Gott, 1,29-34, Abs. 17-25 (Veerkamp 2021, 58-60; 2006, 34-36).
<122> Was mit religiöser Musikalität gemeint ist, habe ich In meiner Arbeit Geschichten teilen im einführenden Kapitel 1 in Anm. 18 unter Rückgriff auf Hildegard König: Religiös musikalisch oder nicht? – Spirituelle Kompetenz von Erzieherinnen. In: Katrin Bederna / Hildegard König (Hrsg.): Wohnt Gott in der Kita? Religionssensible Erziehung in Kindertageseinrichtungen, Berlin 2009, 219f., zu erläutern versucht:
„Es war der Philosoph Jürgen Habermas, der 2001 in einer vielbeachteten Rede sich selbst einen ‚religiös eher unmusikalischen‛ Menschen nannte. Habermas hatte diese Umschreibung nicht selbst erfunden, sondern von dem Soziologen Max Weber übernommen. Der lebte etwa 100 Jahre früher“ und schrieb „1909 in einem Brief an einen Freund, er sei zwar religiös absolut unmusikalisch, aber nach genauer Selbstprüfung weder antireligiös noch irreligiös.“ … „im Religionsmonitor 2008 oder in den Sinusstudien zur religiösen Landschaft in Deutschland … bezeichnen sich in Westdeutschland etwa 70% der Bevölkerung als mehr oder weniger religiös musikalisch und etwa 30% als religiös ganz unmusikalisch, um bei dieser Umschreibung zu bleiben. In Ostdeutschland ist das Verhältnis nahezu umgekehrt: Etwa 35 % der Befragten halten sich für religiös musikalisch, 65 % dagegen nicht“.
<123> Hier darf nicht verschwiegen werden, dass sogar biblische Texte die Einsicht widerspiegeln, dass auch der biblische Gott in diesem Sinne missbraucht werden kann. Vgl. in Veerkamp 2013 den Abschnitt Die Sprache der Großen Erzählung.
<124> Dabei lässt er völlig den Sinn der befreienden sēmeia kai terata, „Zeichen und Machterweise“, des Gottes Israels in den jüdischen Schriften außer Acht, auf die sich Johannes in der Erzählung von den sēmeia Jesu beziehen wird; aber dazu später an Ort und Stelle mehr.
<125> Die folgenden Zitate Veerkamps in: Der zweite Tag. Einer wie Gott, 1,29-34, Abs. 25-26 (Veerkamp 2021, 60-61; 2006, 36).
<126> Anm. 84 zur Übersetzung von Johannes 1,36 (Veerkamp 2021, 61; 2015, 16), alle weiteren Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der dritte Tag. Der Messias, 1,35-42, Abs. 3-5 und 7-11 (Veerkamp 2021, 62-65; 2006, 37-39).
<127> Ton Veerkamp, Autonomie und Egalität. Ökonomie, Politik und Ideologie in der Schrift, Berlin 1993. Eine kurze Zusammenfassung entsprechender Aussagen in einem anderen Buch Veerkamps findet sich (Veerkamp 2013) zur Gründung der Torarepublik in: Esra und Nehemia: Bildung der Torarepublik, zum Erstarken des Hellenismus in: Hellenismus und zum Buch Hiob in: Hiob.
<128> Verisimile, lateinisch: „dem Wahren ähnlich, wahrscheinlich“. Dem „Gesetz des Verisimile“ folgen erzählerische Bemerkungen, durch die etwas Erfundenes plausibel gestaltet wird.
<129> Aboth de Rabbi Nathan, hg. v. S. Schechter, verb. Ausgabe New York 1967 (Erstausgabe Wien 1887), 3a.
<130> Die folgenden Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der dritte Tag. Der Messias, 1,35-42, Abs. 12 und 6 (Veerkamp 2021, 65 und 63; 2006, 39 und 38).
<131> Thyen zitiert Ferdinand Hahn, Die Jüngerberufung Joh 1,35-51. In: J. Gnilka (Hg.), NT und Kirche. FS R. Schnackenburg, Freiburg 1974, 184f.
Ähnliche Vorstellungen wie Hahn vertritt Günter Reim, JOCHANAN – erweiterte Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums, Erlangen 1995, 425-486, von mir besprochen in: Augenzeuge – der Zeichen des Messias Jesus!
<132> Thyen zitiert Joachim Jeremias, Artikel Iōnas: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament III (1938), 410.
<133> Josephus, Ant 18, 2, 1 und Bell 2, 13, 1 sowie Bell. 3, 10, 7.
<134> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der vierte Tag. Der MENSCH, 1,43-51, Abs. 2-3 sowie 6 und 4 (Veerkamp 2021, 66-68; 2006, 39-40).
<135> Bei Lukas freilich muss die messianische Gemeinde in Jerusalem bleiben, weil bei ihm die messianische Bewegung (Paulus!) aus dem Zentrum Israels auf das Zentrum der Weltordnung Rom zugehen wird.
<136> Josephus, Ant. 13, 11, 3.
<137> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der vierte Tag. Der MENSCH, 1,43-51, Abs. 6-8 (Veerkamp 2021, 68; 2006, 40-41).
<138> Wengst (Anm. 66) zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 41.
<139> Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HTHK IV, 1 Bd, Freiburg, Basel u. Wien 1965, 314, erklärt Thyen zufolge „zur Rede von der Vaterschaft Josephs“:
„Wenn Philippus Jesus als den Sohn Josephs ausgibt, so heißt das noch nicht, dies sei auch die Meinung des Evangelisten. Es ist vielmehr die im Volk übliche Vatersbezeichnung (vgl. 6,42); der Evangelist gibt auch den Anstoß im Volk, der Messias müßte in Bethlehem geboren sein (7,41f), ohne Kommentar wieder – er äußert sein Wissen nicht“.
<140> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der vierte Tag. Der MENSCH, 1,43-51, Abs. 8-12 (Veerkamp 2021, 68-69; 2006, 41-42).
<141> Wengst zitiert Josef Blank, Das Evangelium nach Johannes 1a, GSL.NT 4, Düsseldorf 1981, 161.
<142> Veerkamp zitiert Charles K. Barrett, Das Evangelium nach Johannes (KEK), Göttingen 1990, 208.
<143> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 73.
<144> Thyen zitiert Johann Anselm Steiger, Nathanael – ein Israelit, an dem kein Falsch ist: ThViat NT 9 (1992) 50-73. Die weiteren in diesem Abschnitt in eckigen Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.
<145> Der vierte Tag. Der MENSCH, 1,43-51, Abs. 1 (Veerkamp 2021, 66; 2015, 21). Alle weiteren Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der vierte Tag. Der MENSCH, 1,43-51, Abs. 13-25 (Veerkamp 2021, 69-71; 2006, 42-44).
<146> Vgl. dazu meine Buchbesprechung Augenzeuge – der Zeichen des Messias Jesus!, insbesondere im Kapitel 3 Ein Wunderevangelium als Quelle für das Johannesevangelium.
<147> Wengst (Anm. 44) zitiert Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/1, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 124, für die postulierte Semeiaquelle, deren Text hier zugrunde liegen soll.
<148> Wengst zitiert die Quelle: Pirke de-Rabbi Elieser 35, übers. v. Dagmar Börner-Klein, Berlin u. a. 2004, 434/435.
<149> Christian Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes. Teilband 1: Johannes 1-12, ZBK.NT 4,1, Zürich 2001, 61.
<150> Dieses Zitat stammt (von mir übersetzt) von Hugo Odeberg, The Fourth Gospel, Amsterdam 1974 (= Uppsala 1929), 36, auf den sich Thyen folgendermaßen bezieht:
Unter Berufung auf den (späten vom Geist des platonischen Dualismus von Idee und Erscheinung geprägten) Midrasch Genesis Rabba (68,18) erklärt er: „Here, however, the ascending and descending angels step in. They symbolize the connection of the earthly man with his celestial counterpart … The disciples of Jesus will see the angels of God ascending and descending upon the son of man, i. e. they will see the connexion being brought about between the celestial appearance, the Glory, doxa, of Christ, and his appearance in the flesh; it implies the manifestation (phanērōsis) of his doxa (2,11) on earth“.
<151> Meine Übersetzung des englischen Zitats von Delbert Burkett, The Son of Man in the Gospel of John, JSNT S. 56, Sheffield 1991, 118:
„This is the only interpretation which both satisfies the grammar of Jesus‘ statement and maintains the parallel between Jacob and the disciples. Like Jacob, the disciples will find themselves in Bethel, the house or household of God, i. e. the community of God‘s people. Like Jacob, the disciples will see a connection between the house of God on earth and Yahweh in heaven. Unlike Jacob, they will see not a ladder but the Son of the Man ,standing on the earth with (his) head reaching to heaven‘, as the connection between God and the household of God. Like Jacob, they will see angelic ministers passing by means of this connection upward from God‘s house to God und downward from God to his house“.
<152> Unter Berufung auf Herbert Schnädelbach, Vernunft und Geschichte, stw 683, Frankfurt 1987, 125ff. u. 279ff., hält er es „für einen Fall des von Schnädelbach so benannten ‚morbus hermeneuticus‘,“ also ironisch gesprochen, einer hermeneutischen Krankheit, wenn man Texte krampfhaft von ihrem Entstehungsprozess her verstehen will, nach dem Motto: „Etwas Verstehen heißt Verstehen, wie es geworden ist“. Als Beispiel dafür zitiert Thyen den Exegeten Walter Lütgehetmann, Die Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11). Zu Ursprung und Deutung einer Wundererzählung im Rahmen johanneischer Redaktionsgeschichte, BU 20, Regensburg 1990, 39:
„Ein Text läßt sich nur noch aus seinem Werden verstehen, sobald eine Entwicklungsgeschichte angenommen werden muß. Ein erst redaktionell hinzugefügtes (sic) Teil hat seinen Sinn in seiner Funktion als Nachtrag zu einem bereits zuvor funktionierenden Text, d. h. der Sinn erschließt sich erst aus diesem Nachtragsverhältnis“.
<153> Wengst zitiert Peter Wick, Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des Johannesevangeliums, Bib. 85, 2004, 183.
<154> Esther Kobel, Dining with John. Communal Meals and Identity Formation in the Fourth Gospel and its Historical and Cultural Context, Leiden: Brill 2011.
<155> Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 6 (Veerkamp 2021, 74; 2006, 45).
<156> Veerkamp zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes (KEK), Göttingen 1941, 83.
<157> So nach Wengst Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig, 5. Auflage 2016, 90.
<158> Wengst zitiert Pinchas Lapide, Ist die Bibel richtig übersetzt?, 1986, 89:
„Deshalb fand jene Hochzeit zu Kana – wie die meisten jüdischen Trauungen bis auf den heutigen Tag – ,am dritten Tag‘ der Schöpfungswoche statt“.
<159> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 2-6 (Veerkamp 2021, 73-74; 2006, 44-45).
<160> Obwohl nach Thyen die Erzählung von der Hochzeit zu Kana durchaus „als ein absichtsvolles intertextuelles Spiel mit synoptischen Prätexten zu begreifen“ ist. Er denkt dabei allerdings mehr an den „Hintergrund von Mk 2,18-21“, vor dem sie „eine höchst lebensvolle Illustration der Worte Jesu“ darstellt, „daß die Hochzeitsgäste gar nicht fasten können, solange der Bräutigam bei ihnen ist, und von dem neuen Wein und den alten Schläuchen“. Diese Zusammenhänge wird er jedoch gar nicht im einzelnen entfalten.
<161> Dazu verweist Thyen auf die Belege bei Ethelbert Stauffer, Art. gameō, gamos: Thelogisches Wörterbuch zum Neuen Testament I (1933, Nachdruck 1949), 652.
<162> Diesen Begriff der „Sinai-Leinwand“ für den oben skizzierten Hintergrund der Sinai-Erzählung für die Hochzeit zu Kana übernimmt Thyen von Birger Olsson, Structure and Meaning in the Fourth Gospel. A Text-Linguistic Analysis of 2:1-11 and 4:1-42, CB NT 5, Lund 1974.
<163> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 520f.
<164> Dazu beruft sich Thyen auf Paul S. Minear, The Martyr‘s Gospel, New York 1984, 143ff.
<165> Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 7-8 und 18-20 (Veerkamp 2021, 74-75 und 77-78; 2006, 45-46 und 48).
<166> Wengst zitiert die Tosefta Pesaḥim 10,4, hg. v. S. Lieberman, seder serajim, Jerusalem, 2. Auflage 1992; seder moˀed, New York 1962; seder naschim (sota, gittin, kidduschin), New York 1973.
<167> Thyen zitiert damit den Titel von Marinus de Jonge, Jesus, Stranger from Heaven and Son of God, SbibSt 11, Missoula 1977.
<168> Dazu verweist Wengst auf die Quelle „DER 6,2“: M. Van Loopik, The Ways of the Sages and the Way of the World. The Minor Tractates of the Babylonian Talmud: Derekh ˀEretz Rabbah, Derekh ˀEretz Zuta, Pereq ha-Shalom, Tübingen 1991.
<169> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 10-13 (Veerkamp 2021, 75-76; 2006, 46-47).
<170> So etwa (Anm. 62) Jürgen Becker, Das Evangelium des Johannes, ÖTBK 4/1, Gütersloh, 3. Auflage 1991, 128.
<171> Thyen verweist auf Gail R. O‘Day, ‚I Have Overcome the World‘ (John 16:33): Semeia 53 (1991) 153-166.
<172> Thyen zitiert Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie, Bd 2, München & Gütersloh, 1992, 287.
<173> Wengst (87f. und Anm. 54) zitiert dazu Heinrich Julius Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg 1894, 46:
„Die dem äusseren Ceremoniell dienenden Gefässe des Judenthums enthalten das Wasser, welches durch Jesus in Wein verwandelt werden soll: äusserlich reinigendes Wasser in herzstärkenden Wein. Dieser aber bedeutet im Gegensatz zum blossen Sinnbilde das geistige Leben selbst. […] Die Hülflosigkeit des Alten liegt zu Tage, die Lebenskraft ist ihm ausgegangen: dem gesetzlichen Judenthum ,gebricht es an Wein‘“.
<174> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 14 und 11 (Veerkamp 2021, 76 und 75; 2006, 47 und 46).
<175> Wengst zitiert Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009, 214.
<176> Thyen zitiert Edwyn Clement Hoskyns (ed. by F. N. Davey), The Fourth Gospel, London, 2. Auflage 1947, 197.
<177> Thyen zitiert Heinrich Lausberg, Die Verse J 2,7-9 des Johannes-Evangeliums: NGWG. PH 1986/5, Göttingen 1986, 189. Auf weitere Zitate aus diesem Werk in diesem Abschnitt wird mit Seitenzahlen in eckigen Klammern […] verwiesen.
<178> Wengst zitiert Mischna Avot 4,16: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<179> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 15-21 (Veerkamp 2021, 76-78; 2006, 47-48).
<180> So hält Edmund Little, Echoes of the Old Testament in the Wine of Cana in Galilee (John 2: 1-11) and the Multiplication of the Loaves and Fish (John 6: 1-15). Towards an Appreciation, Paris: J. Gabalda, 1998, unter Bezug auf Jean-Pierre Charlier, Le signe de Cana, études religieuses No 740, La Pensée Catholique: Brussels-Paris 1959, 64, diese Identifizierung für
eine Art fruchtbares Paradoxon, das in der Schrift und der Theologie zu finden ist. Israel wird im Alten Testament als Braut (Jesaja 62,5), Tochter (Jesaja 62,11) und Sohn (Hosea 11,1) dargestellt. Maria ist die Mutter Jesu, aber als Vertreterin Israels ist sie auch die Braut Gottes und die Braut ihres Sohnes. Paulus’ Bild von der Kirche als Leib Christi (1 Korinther 12,12-30) passt gut zu der Vorstellung von der Kirche als Braut Christi. So wird Christus, rein rational betrachtet, zu seiner eigenen Braut. Eine Ehe zwischen dem buchstäblichen Verstand und der poetischen, insbesondere theologischen Symbolik wird immer unglücklich sein.
Vgl. dazu meine Besprechung des Buches von Edmund Little im Abschnitt 1.3.2.10 Jesus und Maria als Bräutigam und Braut bei der Hochzeit zu Kana?
<181> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts bis zur Anm. 183 in: Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 21-22 (Veerkamp 2021, 78; 2006, 48-49).
<182> Wengst zitiert hier Shemot Rabba 23,5 (Wilna 43a): Midrasch Rabba über die fünf Bücher der Tora und die fünf Megillot. midrasch rabbah, 2 Bde., Nachdruck Jerusalem o. J. (Romm, Wilna 1887).
<183> Scholion 1: Was ist so verwerflich an allegorischer Auslegung?, Abs. 2-5 (Veerkamp 2021, 79-80; 2006, 49-50).
<184> Thyen bezieht sich dazu auf Wolfgang J. Bittner, Jesu Zeichen im Johannesevangelium, WUNT II/26, Tübingen 1987, 24ff., insbesondere auf Bittners Exkurs „Die jüdischen ‚Zeichenpropheten‘ bei Josephus“, 57-74. Auf weitere Zitate aus diesem Werk in diesem Abschnitt wird mit Seitenzahlen in eckigen Klammern […] verwiesen.
<185> Vgl. die Titel der beiden Bücher von Andreas Bedenbender zum Markusevangelium: Frohe Botschaft am Abgrund. Das Markusevangelium und der Jüdische Krieg, Leipzig 2013, und Der gescheiterte Messias, Leipzig 2019.
<186> Thyen ergänzt dazu die Bemerkung:
diesen ,Widerspruch‘ gegen die vermeintliche ,Intention‘ des Lukas beseitigt Bittner mit dem fragwürdigen Argument, daß der Autor hier nicht Herr geworden sei über das Eigengewicht seiner mutmaßlichen ,Quellen‘.
<187> Gerhard Jankowski, Das Evangelium nach Lukas. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen, in: Texte & Kontexte Nr. 145-147 (2015), 1-191, sowie Die Apostelgeschichte des Lukas. Eine Auslegung desselben Autors in folgenden drei Zeitschriftenbänden: Und sie werden hören, Erster Teil (1,1-9,31), in: Texte & Kontexte Nr. 91/92 (2001); Und dann auch den Nichtjuden, Zweiter Teil (9,32-21,14), in: Texte & Kontexte Nr. 98/99 (2003); Rom, Dritter Teil (21,1), in: Texte & Kontexte Nr. 101/102 (2004).
<188> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Messianische Gemeinde, 2,12, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 78-79; 2006, 49).
<189> Wenn Lukas in Apostelgeschichte 1,13-14 neben den namentlich genannten Schülern Jesu, seiner Mutter und seinen Brüdern auch noch weitere Frauen erwähnt, dürfte das bestätigen, dass auch in seiner Sicht der Dinge jedenfalls zum führenden Kreis der Schüler keine Frauen gehörten.
<190> Das von mir übersetzte Zitat steht in: Birger Olsson, Structure and Meaning in the Fourth Gospel. A Text-Linguistic Analysis of 2:1-11 and 4:1-42, CB NT 5, Lund 1974, 105:
„lt would then stand for the seventh and eight(h) days, Ex 24. The shifts in the material at John‘s disposal were so great that he could only link the events with the vague ou pollas hēmeras. Several of the themes in Ex 24 and Jn 2:12-22 go together: sacrifice to atone for the sins of the people, the blood of the covenant, Jesus‘ death, God‘s shekinah, the eighth day as the day of resurrection etc.“
<191> Die folgenden Zitate dieses Abschnittes und die folgenden drei Anmerkungen stammen aus Andreas Bedenbender, Frohe Botschaft am Abgrund. Das Markusevangelium und der Jüdische Krieg, Leipzig 2013, im Kapitel 14, „Am Ort und im Schatten des Todes“. Die neutestamentlichen Ortsangaben Kapernaum, Bethsaida und Chorazin als poetische Verweise auf das Römische Reich, 413ff. Die zugehörigen Seitenzahlen und Anmerkungen sind in eckigen Klammern […] angegeben.
<192> [Anm. 45]:
Vgl. nur den von Jesus gegenüber seinen jüdischen Kontrahenten in Joh 8,44 erhobenen Vorwurf: „Ihr habt den diabolos zum Vater“ mit dem Satz der Hohenpriester, der unmittelbar zur Kreuzigung Jesu führt: „Wir haben keinen König als den Kaiser“ (19,15).
<193> [432, Anm. 43]:
Neun von sechzehn anabainein-Belegen des Joh-Ev beziehen sich auf Jerusalem oder den Tempel, weitere fünf … auf den Aufstieg in den Himmel.
<194> [Anm. 42]:
Eine Parallele außerhalb der Evangelien wäre Apg 1,14 (nur Jesus fehlt hier; er ist ja bereits zum Himmel aufgefahren).
<195> Messianische Hochzeit, 2,1-11, Abs. 22 (Veerkamp 2021, 78; 2006, 49), und Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 2 (Veerkamp 2021, 81; 2006, 51). Das von ihm hier verwendete hebräische Wort traqlin als Bezeichnung für den Jerusalemer Tempel erklärt er in Abs. 16 (Veerkamp 2006, 47):
„Rabbi Jakob sagt: Diese Welt gleicht einer Vorhalle zur zukünftigen Welt: rüste dich in der Vorhalle, damit du in den Palast (triklinos, traqlin auf Mischnahebräisch) eintreten kannst“ (Mischna Avot 4,16).
<196> Thyen beruft sich dazu außer auf Anthony R. Harvey, Jesus on Trial, London 1976, auch auf Théo Preiss, La justification dans la pensée johannique. In: Hommage et reconnaissance, FS K. Barth Neuchâtel 1951, 46-64. Deutsche Übersetzung: Die Rechtfertigung im johanneischen Denken: EvTh 16 (1956), 289-310.
<197> Dazu verweist Thyen auf John Ashton, Understanding the Fourth Gospel, Oxford 1994, 133.
<198> In meiner Besprechung des Aufsatzes von Günter Reim, Der Augenzeuge, in: JOCHANAN – erweiterte Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums, Erlangen 1995, 425-486, im Abschnitt 4.2.6 Erzählt Johannes ursprünglicher von der Tempelreinigung als die Synoptiker? bin ich auf Reims Versuch der Rekonstruktion einer ursprünglichen Version der Tempelreinigungsgeschichte kritisch eingegangen.
<199> Thyen zitiert Ekkehard W. Stegemann, Zur Tempelreinigung im Johannesevangeliums. In: E. Blum, C. Macholz, E. W. Stegemann (Hgg:), Die hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte, FS Rendtorff, Neukirchen-Vluyn 1990, 509ff.
<200> Wengst zitiert Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009. Die entsprechenden Seitenzahlen sind in eckigen Klammern […] angegeben.
<201> Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 81; 2006, 51).
<202> Josephus, Bell. 2, 12, 1. Wengst weist dazu auch (Anm. 85) auf den Vorgang hin, „wie ihn Lukas in Apg 21,27-33 bei der Verhaftung des Paulus beschreibt.“
<203> So zum Beispiel Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 74.
<204> Wengst zitiert Mischna Berakhot 9,5: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<205> Wengst zitiert Ekkehard W. Stegemann, Zur Tempelreinigung im Johannesevangeliums. In: E. Blum, C. Macholz, E. W. Stegemann (Hgg:), Die hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte, FS Rendtorff, Neukirchen-Vluyn 1990, 509.
<206> Thyen zitiert Victor Epstein, The Historicity of the Gospel Account of the Cleansing of the Temple, ZNW 55 (1964), 42-58.
<207> Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 4-5 und 7 (Veerkamp 2021, 81-83; 2006, 51-52).
<208> Veerkamp zitiert Martin Hengel, Jerusalem als jüdische und hellenistische Stadt, in: ders., Kleine Schriften II, Tübingen 2002, 115ff.
<209> Außer in 5. Mose 33,19, wo das Wort neutral für „verborgene Schätze im Sande“ verwendet wird, und in Hesekiel 27,3, wo sich emporion ebenfalls auf Tyrus bezieht, kommt es in der gesamten Bibel nur an dieser Stelle vor.
<210> Thyen zitiert Francis J. Moloney, Reading John 2:13-22: The Purification of the Temple, RB 97 (1990), 441f. (das Zitat wurde oben von mir übersetzt):
„In the Synoptic report of this event all the Evangelists have Jesus cite Isaiah 56:7 claiming that the Temple is ,my house‘ … Such a claim would not fit the Johannine presentation of Jesus. While lsrael relates to God through its Temple, Jesus now challenges such a relationship by claiming that even their Temple belongs to him in a special way, as it is the house of his Father“…
<211> Thyen zitiert Dieter Lührmann, Das Markusevangelium, HNT 3, Tübingen 1987, 193.
<212> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 221.
<213> Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 6 (Veerkamp 2021, 82; 2006, 52).
<214> Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 7-9 (Veerkamp 2021, 83-84; 2006, 52-53).
<215> Ein Lehrstück, 2,13-22, Abs. 10-11 (Veerkamp 2006, 53).
<216> Die folgenden Zitierungen beziehen sich auf die Überschriften der jeweiligen Abschnitte bei Veerkamp: Pascha. Der Messias als Lehrer Israels, 2,13-3,21, Ein Lehrstück, 2,13-22 und „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21 (Veerkamp 2021, 80ff. und 84ff.; 2006, 51ff. und 54ff.)..
<217> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 88; 2006, 54).
<218> Wengst zitiert Bereschit Rabba 65,12 (b‘reschit rabbah, hg. v. J. Theodor u. Ch. Albeck, 3 Bde., korrigierte Neuausgabe Jerusalem 1965, 2. Auflage 1996 (Berlin 1912-1936) 723.
<219> Thyen zitiert die von mir übersetzte Stelle nach John Neville Suggit, Nicodemus – The True Jew: Neotest 14 (1981), 93:
„But although Nicodemus is a Jew, he is presented also as a type of all humanity: the double reference to ho ánthrōpos in 2:25 is a deliberate preparation for the account of Nicodemus, a particular representative of mankind. This is made clear by the use of the anarthrous ánthrōpos in 3:1, and possibly even by the use of the name Nicodemus, found among both Jews and Greeks“.
<220> Thyen zitiert Marinus des Jonge, Nicodemus and Jesus: Some Observations on Misunderstanding and Understanding in the Fourth Gospel, in: derselbe, Jesus. Stranger from Heaven and Son of God, SbibSt 11, Missoula 1977, 30.
<221> So formuliert Wengst zufolge (Anm. 113) mit einem „Vielleicht“ Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 1, HthK 4, Freiburg u. a., 3. Auflage 1972, 379.
<222> So zitiert Wengst (Anm. 114) Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, 20. Auflage 1985 (= 10. Auflage 1941), 94, Anm. 1.
<223> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 4 und 6 (Veerkamp 2021, 88 und 89; 2006, 54).
<224> Bar Kochba (Der Sternensohn) war die führende Persönlichkeit des letzten messianischen Krieges gegen Rom, 132-135.
<225> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 7 (Veerkamp 2021, 89; 2006, 55).
<226> Diese Übersetzung wählt Wengst (Anm. 119) „als eine geglückte Formulierung“ im Anschluss an Emanuel Hirsch, Das vierte Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt verdeutscht und erklärt, Tübingen 1936, zur Stelle.
<227> Wengst zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 86f.
<228> Wengst zitiert „bSan = Talmud Bavli Sanherib 104b-105a“ (talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<229> Das Zitat (von mir übersetzt) stammt aus G. C. Nicholson, Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent-Schema, SBL DS 63, Chico, 1983, 81:
„How can we understand 3,3 as a christological statement? First of all we can say that to affirm that Jesus is born anōthen is the same thing as saying that he comes anōthen (3,31) – i. e. his origin is ,above‘ pros ton theon (1,1f). It is interesting to note that the other place in the Gospel were gennaō is used of Jesus (18,37), juxtaposes gennaō and erchomai, when speaking of Jesus. That Jesus bears witness as a consequence of his ,seeing‘ the things above is also not uncharacteristic of the Fourth Gospel. In 8,38 the same verb (horaō) is used to contrast the ,seeing‘ and the ,speaking‘ of Jesus on the one hand, and that of the Jews on the other. It is exactly this contrast that is being made in chapter 3. The one who is born katō, or ek tēs sarkos, is sarx and speaks accordingly. But since Jesus is from anō, i. e. since he has been born anōthen, he can speak of what he has seen with his Father (8,38; cf. 3,32; 5,19; 6,46)“.
<230> Das von mir übersetzte Zitat stammt aus Nicholson, ebd. 82:
„If this approach is correct, than at this point in the dialog Jesus is not speaking about the necessity of this birth anōthen – that will come later. On the contrary, he is giving the correct assessment of himself as the one who is from above. Jesus is the ,teacher come from God‘ only in the sense that he is sent by God and speaks the words of God (3,34), or, as it is put in 3,31-32, inasmuch as he comes from above, he speaks of what he has seen and heard“.
<231> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 7-8 (Veerkamp 2021, 89; 2006, 55).
<232> Anm. 121 zur Übersetzung von Johannes 3,3 (Veerkamp 2021, 85; 2005, 24).
<233> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 95.
<234> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 8 (Veerkamp 2021, 89; 2006, 55).
<235> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 8-9 (Veerkamp 2021, 89-90; 2006, 55).
<236> Thyen zitiert M. Morgen, Jean 3 et les évangiles synoptiques. In: A. Denaux (ed.), John and the Synoptics, BETL 101, Leuven 1992, 518ff.
<237> Thyen zitiert Hans Hinrich Wendt, Die Schichten des vierten Evangeliums, Berlin 1911.
<238> Das von mir übersetzte Zitat steht bei Margaret Pamment, John 3,5: „Unless One is Born of Water and the Spirit, He Cannot Enter the Kingdom of God“, NT 25 (1983), 192:
„Commentators have been inclined to reject the phrase ,of water‘ because water is not mentioned in the elucidation of the saving in the following verse: ,That which is born of flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit.‘ But if we interpret the water as a reference to the breaking of the water in natural birth, this reference to physical birth finds a parallel in V. 6. … The expression of the braking of the water in natural birth makes sense of the double expression ,of water and spirit‘ as a description of birth and rebirth. As always in the Fourth Gospel, the experience of natural existence is interpreted in terms of a doctrine of creation: the creator God creates and sustains his creation and natural birth points beyond itself to the life which comes from God“.
<239> Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium 1, HthK 4, Freiburg u. a., 3. Auflage 1972, 383.
<240> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 10-13 (Veerkamp 2021, 90; 2006, 55-56).
<241> „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 14-17 (Veerkamp 2021, 90-91; 2006, 56-57).
<242> Die Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 18-19 (Veerkamp 2021, 91-92; 2006, 57).
<243> Roland Bergmeier, Gottesherrschaft, Taufe und Geist – Zur Tauftradition in Joh 3, ZNW 86 (1995), 71.
<244> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 106f.
<245> Wout van der Spek, Zwischen Galiläa und Judäa. Auslegung von Joh 2,12-5,18, in: Texte & Kontexte 26 (1985), 14-36, hier 21.
<246> Thyen zitiert Peder Borgen, Some Jewish Exegetical Traditions as Background for Son of Man Sayings in John‘s Gospel (Jn 3,13-14 and Context). In: M. de Jonge (ed.), L‘évangile de Jean, BETL 44, Leuven 1977, 243-258.
<247> Thyen zitiert Delbert Burkett, The Son of Man in the Gospel of John, JSNT, Sheffield 1991. Seitenzahlen dieses Abschnitts in eckigen Klammern […] beziehen sich auf dieses Buch.
<248> An dieser Stelle der griechischen Übersetzung der Schrift ist spannend, dass es im hebräischen Text heißt: wɘjirˀu ˀeth ˀlohej jißraˀel, „und sie sahen den Gott Israels“, während die Septuaginta (LXX) die Anstößigkeit dieses Sehens Gottes durch die Einfügung des topos, des „Ortes, wo dort der Gott Israels stand“, abschwächt. (Im griechischen Zitat lässt Thyen irrtümlich das Wort ekei, „dort“, aus.)
<249> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 20-22 (Veerkamp 2021, 92; 2006, 57-58).
<250> Thyen bezieht sich auf G. C. Nicholson, Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent-Schema, SBL DS 63, Chico, 1983, 75ff.
<251> Thyen zitiert Herbert Kohler, Kreuz und Menschwerdung im Johannesevangelium, AthANT 72, Zürich 1987. Seitenzahlen dieses Abschnitts in eckigen Klammern […] beziehen sich auf dieses Buch.
<252> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 235.
<253> Zu diesen Worten en autō, „in ihm“, im griechischen Text von Vers 15 ist anzumerken, dass es in manchen Handschriften auch die Lesart eis auton, „an ihn“, gibt. Letztere wäre, wie es die Lutherbibel tut, auf das pisteuein, „glauben“, zu beziehen: „alle, die an ihn glauben“. Thyen jedoch (T211) hält die schwierigere „Lesart en autō“, „in ihm“, für ursprünglich, und versteht diese Worte so, dass „jeder, der glaubend hinsieht auf den ,erhöhten Menschensohn‘ in ihm das Leben gewinnen“ wird (Hervorhebungen von mir). Denn Johannes verwendet das Wort pisteuein, „glauben“, sonst nirgends mit der Präposition en plus Dativ, sondern immer (34mal) mit eis plus Akkusativ.
<254> Dass Wengst die Schlange ein „Zeichen“ nennt, nehme ich zum Anlass, am Rande eine Überlegung Thyens zu erwähnen, die nirgends sonst hingepasst hat. Er fragt sich nämlich (T212), warum Johannes das in der Septuaginta zur Übersetzung des hebräischen Wortes ness, („hohe Fahnen- oder Signalstange“) verwendete Wort sēmeion, „Zeichen“, hier eben gerade nicht aufgreift. Das wundert ihn vor allem deswegen, weil sowohl der Barnabasbrief (12,5-7) als auch Justins Dialog mit Tryphon (91,4) in ihrem Rückgriff auf die Szene mit der Schlange „das Wort sēmeion geradezu zum Schlüssel ihrer typologischen Auslegung der Schlangen-Episode machen“. Dennoch „scheint Joh es absichtsvoll zu vermeiden“, aber Thyen zufolge nicht etwa deswegen, weil er es ausschließlich für „mirakulöse Taten Jesu“ verwendet, sondern weil
sēmeion bei Joh wie die ägyptischen sēmeia der Mosezeit nie ,omen‘ im Sinne von Vorzeichen (von Zukünftigem) bedeutet, sondern stets Erweis der Identität Jesu als des vom Vater zum Heil der Welt Gesandten ist.
Wenn das heißen soll, dass Johannes die Schlange der Wüstenzeit nicht als „Vorzeichen“ der Erhöhung des Menschensohnes bezeichnen will, weil beim ihm das Wort sēmeion für die befreienden Machttaten des gottgesandten Messias reserviert ist, kann ich das einigermaßen nachvollziehen.
<255> Wengst verweist dazu beispielsweise auf Mischna Sanherib 10,1: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<256> Dazu verweist Wengst auf „bSan = Talmud Bavli Sanherib 92b“ (talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886). Zur Auslegung von „Num 21,8f., verbunden mit Ex 17,11“ hatte er (W118) zuvor „MekhJ Beschallach (Amalek) 1“ (Mechilta d‘Rabbi Ismael. mechilta d‘Rabbi Jischmael, hg. v. H. S. Horovitz u. I. A. Rabin, Jerusalem, 2. Auflage 1970 [Erstausgabe Frankfurt am Main 1931], 179f.) zitiert:
„Ebenso verhält es sich (mit Num 21,8): Da sprach der Ewige zu Mose: Mache dir eine Brandnatter! Tötet denn etwa eine Schlange und macht lebendig? Vielmehr: Solange er so handelte, blickten die Israeliten auf ihn und vertrauten dem, der Mose angeordnet hatte, so zu handeln. Und der Heilige, gesegnet er, schickte ihnen Heilungen.“
<257> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 23-31 (Veerkamp 2021, 92-94; 2006, 58-59).
<258> Vgl. dazu auch meine Überlegungen zu Liebe und Zorn in Helmut Schütz, Missbrauchtes Vertrauen. Sexueller Missbrauch als Herausforderung an Seelsorge, Kirche und Bibelauslegung.
<259> Wo Veerkamp-Zitaten dieses Abschnitts Seitenzahlen mit „V“ vorangestellt werden, sind sie seiner Auslegung des 1. Johannesbriefs entnommen: Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar (= Texte & Kontexte 71/72 (1996)), 35ff. Veerkamp verweist auf diesen Text in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 32 (Veerkamp 2021, 94; 2006, 59).
<260> Zuvor hatte Johannes das Wort chessed bereits im Prolog mit dem griechischen Wort charis aufgegriffen, vgl. dazu die Auslegung von Johannes 1,14e.
<261> Ich vermute, dass Veerkamp an dieser Stelle versehentlich das Wort ahaba statt chessed benutzt; wenige Zeilen später erklärt er (V35), dass „in den Texten der Johannesschule agapē nicht für das hebräische ahaba, sondern für das ebenfalls hebräische chessed steht“.
<262> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 34.
<263> Thyen zitiert Klaus Berger, Exegese des Neuen Testaments, UTB 658, Heidelberg 1977, 182f.
<264> Damit beruft sich Thyen auf die Kritik von T. Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium, WMANT 56, Neukirchen-Vluyn 1984, 53f., an Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen, nach der 4. Auflage 1980, 132.
<265> Alle weiteren Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 32-44 (Veerkamp 2021, 94-97; 2006, 59-62).
<266> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts (außer wo anders angegeben) in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 45-46 (Veerkamp 2021, 97; 2006, 62).
<267> Thyen zitiert Karl Barth, Erklärung des Johannes-Evangeliums, Ges. Ausg. 9, Zürich 1976, 222.
<268> Thyen zitiert Heinrich Julius Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg, nach der 3. Auflage 1908, 68.
<269> Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar (= Texte & Kontexte 71/72 (1996)), 57f.
<270> Thyen zitiert Klaus Wengst, Bedrängte Gemeinde und verherrlichter Christus, München, nach der 4. Auflage 1992, 236 und 237.
<271> Thyen zitiert Roland Bergmeier, Glaube als Gabe nach Johannes, BWANT 112, Stuttgart 1980, 231.
<272> Thomas Popp, Grammatik des Geistes. Literarische Kunst und theologische Konzeption in Johannes 3 und 6, Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte, Leipzig 2001, 170.
<273> Wengst zitiert damit Mischna Sanherib 10: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<274> Thyen zitiert Heinrich Julius Holtzmann, Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, HC 4, Freiburg, nach der 3. Auflage 1908, 70.
<275> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts (außer am Schluss meine Bezugnahmen auf sein „Scholion 2“) in: „Du bist der Lehrer Israels, und das verstehst du nicht?“, 2,23-3,21, Abs. 46-54 (Veerkamp 2021, 97-99; 2006, 62-66).
<276> Veerkamp zitiert dazu (Anm. 134) Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes (KEK), Göttingen 1941, 114-115.
<277> Die folgenden Veerkamp-Zitate in: Scholion 2: Das antagonistische Schema im Johannesevangelium?, Abs. 1-5.7.9-11 (Veerkamp 2021, 99-101; 2006, 64-66).
<278> Vgl. dazu Veerkamp 2013, Die verwandelte Große Erzählung: Das Glaubensbekenntnis der Kirche, insbesondere im Abschnitt Gesellschaftliche Platzzuweisung und christliche Religion.
<279> Himmel und Erde; Vertrauen und Misstrauen, 3,31-36, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 108-109; 2006, 70-71).
<280> Thyen zitiert Yu Ibuki, kai tēn phōnēn autou akoueis. Gedankenaufbau und Hintergrund des 3. Kapitels des Johannesevangeliums, Bulletin of Seidei University 14 (1978), 9-33.
<281> Der Täufer und der Messias, 3,22-30, Abs. 3.5-7 (Veerkamp 2021, 103-104; 2006, 66-67).
<282> Thyen zitiert Hans-Martin Schenke, „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen“. Der Konflikt zwischen Jesusjüngern und Täufergemeinde im Spiegel des Johannesevangeliums. In: C. Elsa u. H. G. Kippenberg (Hgg.), Loyalitätskonflikte in der Religionsgeschichte, FS C. Colpe, Würzburg 1990, 311.
<283> Thyen zitiert Alfred Loisy, Le quatrième évangile. Les épitres dites de Jean, Paris, nach der 2. Auflage 1921.
<284> Der Täufer und der Messias, 3,22-30, Abs. 8-10 (Veerkamp 2021, 104; 2006, 67).
<285> Scholion 3: Über die Reinheit, Abs. 1-3 (Veerkamp 2021, 106-107; 2006, 69-70).
<286> Veerkamp verweist hier (Anm. 147) auf Martin Hengel, Die johanneische Frage (WUNT 67), Tübingen 1993, 306ff.
<287> In zwei Artikeln der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 24 (1984): Rochus Zuurmond, Der Tod von Nadab und Abihu, Lev. 10, 1-5, 23-27, und Andreas Pangritz, Jesus und das „System der Unreinheit“ oder: Fernando Belo die Leviten gelesen, Mk. 7, 1-23, 28-46. Die folgenden Zitate beziehen sich auf diese Artikel, wobei die Seitenzahlen mit vorangestelltem „Z“ sich auf Zuurmond und diejenigen mit „P“ auf Pangritz beziehen.
<288> Wengst zitiert Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009, 286.
<289> Der Täufer und der Messias, 3,22-30, Abs. 10-11 (Veerkamp 2021, 104; 2006, 67-68).
<290> Wengst zitiert Mischna Tehillim 98,1: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<291> Wengst zitiert Pesikta de Rav Kahana Nispachim 2, 2 Bde., hg. v. B. Mandelbaum, New York, 2. Auflage 1987, 458.
<292> Dazu verweist Thyen auf (H. Strack /) P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. 2, München, 3. Auflage 1961, 429.
<293> Der Täufer und der Messias, 3,22-30, Abs. 12-22 (Veerkamp 2021, 104-107; 2006, 68-69).
<294> Dazu ergänzt Veerkamp (Anm. 142 – Veerkamp 2021, 105; 2006, 68):
Zwar machen Texte wie Leviticus, Numeri und Ezechiel 40-48 keinen konsequenten Unterschied zwischen nachala und ˀachusa. Nirgends wird gesagt, dass Israel „Besitz“ (ˀachusa) des NAMENS ist, 29mal sein „Eigentum“ (nachala) und sechsmal, dass umgekehrt der NAME „Eigentum“ (nachala) Levis bzw. der Priester ist. Das Eigene des NAMENS ist Israel, das Eigene der Priester der NAME. Von dort her ist das metaphorische Verhältnis Bräutigam – Braut zu deuten.
<295> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 223f.
<296> Thyen zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 76f.
<297> Thyen zitiert Karl Barth, Erklärung des Johannes-Evangeliums, Ges. Ausg. 9, Zürich 1976, 230f.
<298> Thyen zitiert Eberhard Jüngel, Gott – als Wort unserer Sprache, EvTh 29 (1969), 21.
<299> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts (außer wenn anders angegeben) in: Himmel und Erde; Vertrauen und Misstrauen, 3,31-36, Abs. 3 und 6-7 (Veerkamp 2021, 109; 2006, 70-71).
<300> Anm. 148 zur Übersetzung von Johannes 3,31 (Veerkamp 2021, 108; 2005, 27f., Anm. 36).
<301> Auf der im Internet zugänglichen Wiedergabe von Johannes 3,31 im Papyrus 66 sieht man einen Schrägstrich als Auslassungszeichen hinter ek tēs gēs estin in der sechstletzten Zeile von unten; die ausgelassenen Worte kai ek tēs gēs lalei sind ganz unten in einer Halbzeile mit niedrigerer Schrifthöhe ergänzt.
<302> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 119, Anm. 1.
<303> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983). Die in diesem Abschnitt in eckige Klammern eingeschlossenen Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.
<304> Zahns Bestreitung, dass Johannes von sich selbst gesprochen haben könnte, bezog sich allerdings gar nicht auf die Verse 32f., sondern auf den mittleren Teil von Vers 31. Hier muss Thyen also ein fehlerhafter Rückverweis unterlaufen sein, denn für die Verse 32f. hatte er ja selber vorausgesetzt, dass vom Zeugnis Jesu die Rede sei, was in meinen Augen allerdings gar nicht feststeht.
<305> Die folgenden Veerkamp-Zitate in: Himmel und Erde; Vertrauen und Misstrauen, 3,31-36, Abs. 8-10 (Veerkamp 2021, 110; 2006, 71-72).
<306> Damit bezieht sich Veerkamp auf die Übersetzung von Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes (KEK), Göttingen 1941, 119.
<307> Dazu verweist Thyen auf E. F. K. Deissner, Art. metron ktl.: ThWANT IV (1942), 635-638.
<308> So z. B. im Anhang der Elberfelder Bibel, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, Auflage von 1985.
<309> Anm. 149 zur Übersetzung von Johannes 1,34 (Veerkamp 2021, 108; 2015, 30).
<310> Die weiteren Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts stammen aus seinem Scholion 4: Die Quelle des Johannes, Abs. 6 und 1-5.7 (Veerkamp 2021, 111-112; 2006, 72-74).
<311> Veerkamp bezieht sich auf Klaus Berger, Am Anfang war Johannes, Stuttgart 1997, 18ff.
<312> Was Ton Veerkamp unter einem solchen Lehrhaus (Veerkamp 2021, 17-18; 2002, 12-13) versteht, wird ansatzweise im Verein für politische und theologische Bildung LEHRHAUS e. V., Dortmund, erprobt, der 1978 gegründet wurde und seitdem die exegetische Zeitschrift Texte & Kontexte herausgibt.
<313> Thyen zitiert Karl Barth, Erklärung des Johannes-Evangeliums, Ges. Ausg. 9, Zürich 1976, 233.
<314> Wengst zitiert SifBam § 161 nach Sifre zu Num. sifrej al sefer bamidbar ve-sifrej suta, hg. v. H. S. Horovitz, Nachdruck Jerusalem 1992 (Leipzig 1917), 223.
<315> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Himmel und Erde; Vertrauen und Misstrauen, 3,31-36, Abs. 10-11 (Veerkamp 2021, 110-111; 2006, 72).
<316> So zitiere ich Veerkamp 2013 in Gesellschaftliche Platzzuweisung und christliche Religion, Abs. 3.
<317> Gerhard Jankowski, Die große Hoffnung. Paulus an die Römer. Eine Auslegung, Berlin 1998. Die beiden folgenden Seitenzahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf dieses Buch.
<318> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Samaria, 4,1-4, Abs. 3-4.6.5.7 (Veerkamp 2021, 113-114; 2006, 74-75).
<319> Da es hier um die Art und Weise geht, wie der Evangelist Johannes auf die Geschichte Israels geblickt hat, ist hier nicht von Belang, was die archäologische Wissenschaft heute über den tatsächlichen Verlauf der Geschichte der Königreiche Israel und Juda herausgefunden hat, dass nämlich die Vorstellung eines gemeinsamen Großkönigreichs unter David und Salomo späteren Rückprojektionen auf eine ideale Ursprungszeit entspricht. Vgl. dazu meine Buchbesprechungen Israel Finkelstein und das vergessene Königreich Israel und David und Salomo – wie die Geschichte ihr Bild formte.
<320> Vgl. meinen Gottesdienst Jakob segnet seine Enkel über Kreuz.
<321> Wengst beruft sich dazu auf Hans G. Kippenberg, Garizim und Synagoge: Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur samaritanischen Religion der aramäischen Periode, Berlin und New York 1971. In seinem Literaturverzeichnis taucht dieser Titel nicht auf. Seitenzahlen dieses Abschnitts in eckigen Klammern beziehen sich auf dieses Buch.
<322> Dazu nennt Wengst die Quellenangabe „Ant 18, 29f.“ nach der Edition des griechischen Textes von Benedikt Niese (1890). In seinem Literaturverzeichnis führt er zu den Jüdischen Altertümern des Josephus für deren 18. Buch die englische Ausgabe der Jewish Antiquities, XVIII-XX, 1965 (L. H. Feldman) an, die mir nicht vorliegt. In der im Internet zugänglichen Übersetzung dieses Buches von Heinrich Clementz, die allerdings laut Wikipedia „mit Vorsicht zu gebrauchen“ ist, wird im Inhaltsverzeichnis zum Buch 18 zwar der Inhalt des Kapitels 4 mit dem Satz: „Wie die Samariter Totengebeine in den Tempel warfen und so das Volk für sieben Tage verunreinigten“, zusammengefasst, tatsächlich aber wird diese Entweihungshandlung des Jerusalemer Tempelbereichs bereits in Kapitel 2 (Ant. 18,2,2) beschrieben.
<323> Wengst zitiert hier Shmuel Safrai, Die Wallfahrt im Zeitalter des Zweiten Tempels, Neukirchen-Vluyn 1981, 113.
<324> Wengst verweist hierzu auf Flavius Josephus, De Bello Judaico. Der jüdische Krieg, Griechisch und Deutsch, Band 2, hg. v. O. Michel und O. Bauernfeind, München 1959-1969, 232-246. Die Stelle ist unter Bell. 2,12,3-7 in der Übersetzung von H. Clementz einsehbar.
<325> Er führt dazu die Parallelstelle zu Bell. 2,12,3-7 aus den Jüdischen Altertümern von Flavius Josephus: Ant. 20,6,2 an.
<326> Wengst zitiert Mischna Avot 1,1: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<327> Samaria, 4,1-4, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 113; 2006, 74).
<328> Wengst verweist dazu auf zwei Stellen bei Josephus, die in der Übersetzung von Heinrich Clementz im Internet unter Ant. 20,6,1 und Selbstbiographie 52 zu finden sind:
Das scheint auch der von galiläischen Festpilgern am meisten genutzte Weg gewesen zu sein. So schreibt Josephus: „Die Galiläer, die sich zu den Festen in der heiligen Stadt einstellten, hatten die Gewohnheit, durch das Gebiet von Samaria zu gehen“ (Ant 20, 118). In Vita 269 stellt er fest, dass durch Samaria reisen muss, wer von Galiläa aus schnell nach Jerusalem kommen will: „So ist es in drei Tagen möglich, von Galiläa nach Jerusalem einzukehren.“
<329> Samaria, 4,1-4, Abs. 8, und lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 4 (Veerkamp 2021, 114 und 116; 2006, 75-76).
<330> Thyen zitiert Helga Weipperts Artikel „Sichem“ im Biblischen Reallexikon, 2. Auflage Tübingen 1977, 295. Zur Zerstörung des Garizim-Tempels und der Stadt Samaria bezieht sich Thyen außerdem auf Josephus, Ant XIII/255f.275, das sind vermutlich die im Internet unter Ant. 13,9,1 und Ant. 13,10,3 zugänglichen Stellen. Zu Sychar = Askar ergänzt Thyen:
Gegenüber der erneuten Bevorzugung der Lesart Sychem durch H{endrikus} Boers {Neither on this Mountain nor in Jerusalem, SBL. MS 35, Atlanta 1988} (155) hat Schenke durch seine minutiöse archäologische Beschreibung von ,Jakobsbrunnen, Josephsgrab und Sychar‘ die Identität Sychars mit dem heutigen Askar wohl gegen alle früheren Zweifel erwiesen ({H. M. Schenke,} Jakobsbrunnen{-Josephsgrab-Sychar. Topographische Untersuchungen und Erwägungen in der Perspektive von Joh 4,5.6, ZDPV 84 (1968),} bes. 182-184).
<331> Thyen zitiert den Exkurs „The Well in Jewish Tradition“ nach Birger Olsson, Structure and Meaning in the Fourth Gospel. A Text-Linguistic Analysis of 2:1-11 and 4:1-42, CB NT 5, Lund 1974, 162-173.
<332> Dazu beruft sich Wengst auf „bNid 48b“, also den Traktat Nidda 48b im Babylonischen Talmud: talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<333> Dazu vermerkt Wengst (Anm. 171) den diesbezüglichen nachdrücklichen Hinweis von Luise Schottroff, Die Samaritanerin am Brunnen (Joh 4), in: Auf Israel hören. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen mit Beiträgen von Frank Crüsemann, Jürgen Ebach, Philipp Potter, Luise Schottroff, Dorothee Sölle, Martin Stöhr, Marie-Theres Wacker, Luzern 1992, 119-122 (in seinem Literaturverzeichnis taucht allerdings dieser Titel nicht auf):
Wesentliche Thesen dieses wichtigen Beitrags nehme ich in der Kommentierung von Joh 4 auf. Die Tagelöhner im Gleichnis von Mt 20,1-16 sagen nach V. 12: „Wir haben die Last des Tages und die Hitze getragen.“
<334> So zitiert Wengst Jürgen Zangenberg, Frühes Christentum in Samarien. Topographische und traditionsgeschichtliche Studien zu den Samarientexten im Johannesevangelium, Tübingen und Basel 1998, 110.
<335> Thyen zitiert die Stelle „Ant 256f“; vgl. die Übersetzung von H. Clementz: Ant. 2,11,1-2.
<336> Thyen zitiert Robert Henry Lightfoot, St. John‘s Gospel, London 1956, 7. Auflage Oxford, London und New York (ed. by C. F. Evans), 122.
<337> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 4.3.5-7.9 (Veerkamp 2021, 116-117; 2006, 76-77).
<338> Thyen zitiert David Daube, The New Testament an Rabbinic Judaism, London 1956, 373ff.
<339> Dazu beruft sich Daube auf den Traktat Nidda 4,1 im Babylonischen Talmud.
<340> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 251.
<341> Thyen zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 78.
<342> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 131.
<343> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 10-11 (Veerkamp 2021, 117-118; 2006, 77-78).
<344> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 12 (Veerkamp 2021, 118; 2006, 78).
<345> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 12 (Veerkamp 2021, 118; 2006, 78).
<346> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 13 (Veerkamp 2021, 118-119; 2006, 78).
<347> Wengst zitiert zunächst Mischna Aboth 2,8: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988). Die nähere Erläuterung findet sich in: avot de-rabbi Natan (A) 14, hg. v. S. Schechter, verb. Ausgabe New York 1967 (Erstausgabe Wien 1887), 29b.
<348> Thyen zitiert Jerome H. Neyrey, Jakob Traditions and the Interpretation of John 4:10-26, CBQ 41 (1979), 424 (die Übersetzung oben stammt von mir):
„The response of Jesus … claims that he is not just a latterday Jacob or even that Jacob was a type of Christ. A more radical claim is made: Jesus supplants/ replaces Jacob. The woman‘s question in 4,12 seems to contain a pun, implying that Jesus is supplanting Jacob, the Supplanter, thus doing to Jacob what he did to Esau“.
<349> Thyen zitiert Ernst Haenchen, Johannesevangelium. Ein Kommentar (hg. von U. Busse), Tübingen 1980, 241.
<350> Thyen zitiert John Henry Bernard, A Critical an Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, Bd. 1, Edinburgh 1928 (Reprint 1953), 141:
„But water in this passage is symbolic of the Spirit“.
<351> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 15-17 (Veerkamp 2021, 119; 2006, 79).
<352> lm Land des Anfangs, 4,5-15, Abs. 14-15.17 (Veerkamp 2021, 119; 2006, 78-79).
<353> Thyen zitiert Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 86f.
<354> Vgl. dazu meine Buchbeschreibung Ironische Glaubensgewissheit im Johannesevangelium?
<355> So zitiert Wengst (W140, Anm. 184) Theodor Zahn, Das Evangelium des Johannes, KNT 4, Leipzig, 5. und 6. Auflage 1921, 244, und fährt fort:
Leider ‚hält auch {Ludger} Schenke {Johannes, Kommentar, Düsseldorf 1998, 87} noch die Frage für „zulässig, ob der enorme ,Männerverschleiß‘ nicht ein bestimmtes Licht auf die Frau werfen soll. {Thomas L.} Brodie {The Gospel according to John, AncB 29, 1.2, London u. a., 2. Auflage 1971, 214} spricht von „Kurzzeitehen und Affären mit Männern“.
<356> Wengst zitiert Joseph mit „Ant 9, 288-291“; die Stelle ist im Internet nach dem Übersetzung von Heinrich Clementz unter Ant. 9,14,3 zu finden:
3. Als aber die Chuthäer (so benannt von dem Lande Chutha in Persien, wo auch ein Fluss desselben Namens sich befindet) nach Samaria übergesiedelt waren und ihre Götter mitgebracht hatten (sie bestanden aus fünf Völkerschaften, von denen jede ihren besonderen Gott verehrte), erregten sie den Zorn des allmächtigen Gottes. Infolgedessen brach bei ihnen die Pest aus, an der sie zahlreich dahinstarben, und gegen die es kein Heilmittel gab. Da wurden sie durch eine Weissagung ermahnt, sie sollten sich zur Verehrung des allmächtigen Gottes bekehren, dann werde das Übel weichen. Sie schickten daher Gesandte zum Könige der Assyrier und liessen ihn bitten, er möge ihnen von den gefangenen Priestern der Israëliten einige zusenden. Als das geschehen und sie in dem Dienste Gottes unterrichtet waren, fingen sie an, ihn eifrig zu verehren, worauf die Pest auch bald verschwand. Diesen Gebräuchen sind die Chuthäer (so heissen sie im Hebräischen, während die Griechen sie Samariter nennen) in der Folge stets treu geblieben. Übrigens nennen sie sich, sobald sie sehen, dass es den Juden gut geht, deren Verwandte, da sie von Joseph abstammten und also gleichen Ursprung mit ihnen hätten. Bemerken sie indes, dass es den Juden schlecht geht, so behaupten sie, sie hätten zu ihnen keinerlei Beziehungen, weder freundschaftliche noch verwandtschaftliche, sondern sie seien Ausländer und stammten von einem fremden Geschlechte ab. Doch es wird sich später noch Gelegenheit finden, hiervon ausführlicher zu sprechen.
<357> Thyen zitiert Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 185.
<358> Thyen zitiert Sandra M. Schneiders (im Text oben von mir übersetzt), Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the Contemporary Church, BTB 12 (1982), 44:
„These women do not appear dependent on husbands or other male legitimators, nor as seeking permission for their activities from male officials. They evince remarkable originality in their relationships within the community.“
<359> Thyen zitiert Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 186f. (oben im Text von mir übersetzt):
„So the woman has to be shown as morally inferior to the Jews, and to this extent she is representative of how they felt about all Samaritans. This really is sufficient to account for the number five; but it looks odd, and so invites speculation. In fact it is the trump card of the allegorical interpretation (sic!). …
On the allegorical view, the woman with five husbands is the Samaritan religion contaminated with five forms if idolatry; but the details must not be pressed, for she did not have her husbands concurrently, as the suggestion of syncretism naturally implies. It can then be argued that the next step of the argument follows naturally on this indication of impurity of religion. … But this will not really hold, for in NT times Samaritan religion was not seriously syncretistic, and was firmly based on the Law of Moses …; and the most remarkable fact of the whole discourse is its awareness of current issues. To drag up a piece of ancient history by means of a doubtful allusion is simply not relevant.“
<360> Thyen zitiert Charles Kingley Barrett, Das Evangelium nach Johannes, KEK, Sonderband Göttingen 1990, 253.
<361> Ich zitiere Josephus Ant. 12,5,5 nach der Übersetzung von Heinrich Clementz.
<362> Alle Veerkamp-Zitate dieses Abschnitts in: Der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, 4,16-19, Abs. 2-9 (Veerkamp 2021, 120-122; 2006, 79-81).
<363> Thyen zitiert Teresa Okure, The Johannine Approach to Mission. A Contextual Study of John 4,1-42, WUNT II/31, Tübingen 1974, 114 (oben im Text von mir übersetzt):
„it is well known that the Samaritans rejected the prophetic books and that the only prophet they recognized was the one who was to return (Deut 18,15-18). In v 19, the woman simply recognizes Jesus as a Jewish prophet. v 20 supports this interpretation; the juxtaposition of ,our fathers‘ and ,you‘ shows that in the woman‘s mind, Jesus remains essentially a Jew, a Jewish prophet, no doubt, but a Jew nontheless. Jesus‘ own remark in v 22 underscores this point“.
<364> Damit widerspricht Thyen Hans G. Kippenberg, Garizim und Synagoge: Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur samaritanischen Religion der aramäischen Periode, Berlin 1971, 313, der „hier den ältesten Beleg für die samaritanische ‚Erwartung des Propheten wie Mose‘ erkennen“ will.
<365> Der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, 4,16-19, Abs. 10-12 (Veerkamp 2021, 122-123; 2006, 81-82).
<366> Wengst zitiert die Quelle Midrasch Tehillim 91,7 nach midrasch tehilim, hg. v. S. Buber, Nachdruck Jerusalem 1977 (Wilna 1891), 200b.
<367> Wengst zitiert Bereschit Rabba 81,3 bzw. 32,10 nach b‘reschit rabbah, hg. v. J. Theodor u. Ch. Albeck, 3 Bde., korrigierte Neuausgabe Jerusalem 1965, 2. Auflage 1996 (Berlin 1912-1936), 974 bzw. 296.
<368> Weder – noch, Inspiration und Treue, 4,20-24, Abs. 2-4 (Veerkamp 2021, 124; 2006, 82-83).
<369> Thyen zitiert die Theologische Dissertation von Edeltraud Leidig, Jesu Gespräch mit der Samaritanerin und weitere Gespräche im Johannesevangelium, Basel 1979, 97.
<370> Weder – noch, Inspiration und Treue, 4,20-24, Abs. 4 (Veerkamp 2021, 124; 2006, 82).
<371> Wengst zitiert Ernst Haenchen, Das Johannesevangelium, hg. v. U. Busse, Tübingen 1980, 243.
<372> Wengst zitiert Johannes Calvin, Auslegung des Johannes-Evangeliums, übers. v. M. Trebesius u. H. C. Petersen, Neukirchen-Vluyn 1964, 98f.
<373> Mit den folgenden Ausführungen stellt er sich auch gegen seine „eigene früher vorgelegte Interpretation der Passage“ in Hartwig Thyen, „Das Heil kommt von den Juden“, in: Kirche, FS G. Bornkamm, Tübingen 1980, 170.
<374> Weder – noch, Inspiration und Treue, 4,20-24, Abs. 5-8 (Veerkamp 2021, 124-126; 2006, 83-84).
<375> Dazu zitiert Wengst Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Christologie 1, München 1988, 98-105. Sehr lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch Friedrich-Wilhelm Marquardt, Johannes – aus dem Hebräischen gedacht.
<376> Wengst zitiert Marion Moser, Schriftdiskurse im Johannesevangelium. Eine narrativ-intertextuelle Analyse am Paradigma von Joh 4 und Joh 7, Tübingen 2014, 84; vgl. 135.
<377> Annette Böckler, Gott als Vater im Alten Testament. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung eines Gottesbildes, Gütersloh 2000; Angelika Strotmann, Mein Vater bist du! Sir 51,10. Zur Bedeutung der Vaterschaft Gottes in kanonischen und nichtkanonischen frühjüdischen Schriften, FTS 39, Frankfurt a. M. 1991; Elke Tönges, „Unser Vater im Himmel“. Die Bezeichnung Gottes als „Vater“ in der tannaitischen Literatur, Stuttgart 2003.
<378> Thyen zitiert Ignace de la Potterie, La Vérité dans Saint Jean II, AnBib 74, Rom 1977, 673-706. Die folgenden Seitenzahlen in eckigen Klammern weisen auf Zitate aus diesem Buch hin.
<379> So zitiert Thyen Karl Barth, Erklärung des Johannes-Evangeliums, Ges. Ausg. 9, Zürich 1976, 365f.
<380> Thyen zitiert Theodor Zahn, Das Evangelium nach Johannes, KNT 4, Leipzig, 6. Auflage 1921 (Nachdruck: Wuppertal 1983), 249.
<381> So zitiert Thyen Barnabas Lindars, The Gospel of John, NCBC, London 1972, 189:
„within his filial response to the father soon to be revealed in his passion“.
Ich hoffe, in meiner obigen Übersetzung den Ausdruck „filial response“ mit „Sohnesantwort“ richtig wiedergegeben zu haben.
<382> Thyen zitiert Teresa Okure, The Johannine Approach to Mission. A Contextual Study of John 4,1-42, WUNT II/31, Tübingen 1974, 167 (das Zitat wurde oben von mir übersetzt):
„However, because of their faith in Jesus, death can no longer be seen as a termination; rather it constitutes the final step in the process of passing over from death to life through believing in Jesus (5,25.28f; 11,25f)“.
<383> Klaus Scholtissek, In ihm sein und bleiben. Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften, Freiburg im Breisgau 2000, hat dazu eine ganze Monographie vorgelegt, auf die Thyen allerdings nirgends Bezug nimmt.
<384> Ton Veerkamp, Weltordnung und Solidarität oder Dekonstruktion christlicher Theologie. Auslegung des ersten Johannesbriefes und Kommentar (= Texte & Kontexte 71/72 (1996)), 102.
<385> Weder – noch, Inspiration und Treue, 4,20-24, Abs. 11.1.9-10.12-13 (Veerkamp 2021, 123 und 126-127; 2015, 25 und 2006, 84-85).
<386> Zum Propheten wie Mose zitiert Wengst Hans G. Kippenberg und Gerd A. Wewers, Textbuch zur neutestamentlichen Zeitgeschichte, Göttingen 1979, 499f., zur Gestalt des Taheb verweist er auf Hans G. Kippenberg, Garizim und Synagoge: Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur samaritanischen Religion der aramäischen Periode, Berlin und New York 1971, 276-305; das folgende Zitat steht auf S. 298f.
<387> Thyen zitiert das in der vorigen Anm. 386 erwähnte zweite Buch von Kippenberg, auf das sich die folgenden Seitenverweise in eckigen Klammern beziehen. Mit der Erwähnung von L. Schottroff in der folgenden Passage reagiert er auf Luise Schottroff, Johannes 4,5-15 und die Konsequenzen des johanneischen Dualismus, ZNW 60 (1969), 206.
<388> lCH BIN ES, 4,25-30, Abs. 2 (Veerkamp 2021, 128; 2006, 85).
<389> lCH BIN ES, 4,25-30, Abs. 3-4 (Veerkamp 2021, 128; 2006, 85-86).
Heute, am 23. Mai 2022, erfuhr ich mit Bestürzung und Trauer, dass Ton Veerkamp bereits am 28. Februar 2022 in Schmarsau/Wendland gestorben ist, von seinen „Freundinnen und Freunden aus Berlin und Berliner Zeiten“ mit folgenden Worten in einer Todesanzeige verabschiedet:
„Die Welt anders – niemand Sklave und niemand Herr… Unser Freund, Lehrer und Mitstreiter für die biblische Botschaft vom messianischen Reich Gottes, für Frieden und Gerechtigkeit, für Autonomie und Egalität zwischen den Menschen aus verschiedenen Welten hat sich aus dieser Welt verabschiedet und auf den Weg in andere Welten aufgemacht. Wir sind dankbar für seine Freundschaft und Inspirationen. Wir werden sie weitertragen.“
<390> Thyen zitiert Frances Margaret Young, A Study of the Relation of Isaiah to the Fourth Gospel, ZNW 46 (1955), 215-233. Die folgenden Seitenverweise in eckigen Klammern beziehen sich auf diese Studie.
<391> Das folgende Zitat von Young habe ich oben ins Deutsche übersetzt:
„When Jesus confronts the Samaritan woman she says to him: oida hoti Messias erchetai ho legomenos christos; hotan elthē ekeinos, anangelei hēmin hapanta. legei autē ho Iēsous: egō eimi, ho lalōn soi. Here Jesus by implication acknowledges His function as ho angellōn hapanta, the revealer of all things. And the words of Jesus bear a remarkable resemblance to lsaiah 52,6: dia touto gnōsetai ho laos mou to onoma mou en tē hēmera ekeinē, hoti egō eimi ho lalōn. Obviously, as the revelation of the name is the most important factor in lsaiah so here the revelation of hapanta is in one sense the equivalent of the revelation of ,the name‘“.
<392> Thyen zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, Göttingen 1998, 86f.
<393> Das oben von mir übersetzte Zitat von Gail R. O‘Day, Revelation in the Fourth Gospel. Narrative Mode and Theological Claim, Philadelphia 1986, 72f, führt Thyen auf Englisch an:
„faced with a direct, definitive revelation of Jesus that calls for a type of decision different from that of the ironic interplay of the rest of the dialogue. Now the decision is only to affirm or deny. The reader is prepared to make this decision, however, only because she or he has been involved in the revelatory process of the earlier dialogue. The ego eimi is therefore experienced, not just recounted“.
<394> Thyen zitiert Heinrich Zimmermann, Das absolute „Ich bin“ als biblische Offenbarungsformel, Dissertation Bonn 1951, und derselbe, Das absolute egō eimi als die neutestamentliche Offenbarungsformel, BZ 4 (1960), 54-69 und 266-276.
<395> lCH BIN ES, 4,25-30, Abs. 5 (Veerkamp 2021, 128-129; 2006, 86).
<396> Wengst zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 128.
<397> Wengst zitiert Mischna Aboth 1,5: schischah sidrej mischnah, hg. v. Ch. Albeck, Bde. 1-6, Jerusalem u. Tel Aviv 1952-1958 (Nachdruck 1988).
<398> Wengst zitiert „bEr 53b“, also den Traktat ˁEruvin 53b im Babylonischen Talmud: talmud bavli, Bde. 1-20, Nachdruck Jerusalem 1981 (Romm, Wilna 1880-1886).
<399> Wengst zitiert Luise Schottroff, Die Samaritanerin am Brunnen (Joh 4), in: Auf Israel hören. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen mit Beiträgen von Frank Crüsemann, Jürgen Ebach, Philipp Potter, Luise Schottroff, Dorothee Sölle, Martin Stöhr, Marie-Theres Wacker, Luzern 1992, 124.
<400> Thyen zitiert Teresa Okure, The Johannine Approach to Mission. A Contextual Study of John 4,1-42, WUNT II/31, Tübingen 1974, 134 (das Zitat wurde oben von mir übersetzt):
„The shock of the disciples, then, receives its full force when its object is seen in all its horror: Jesus‘ dialogue partner is a woman and a Samaritan and he is speaking with her in a public setting. They have every reason, therefore, to be shocked, but the deeper the shock, the more the lesson should strike home when it is given (VV 31-42)“.
<401> Wengst zitiert Origenes, Werke IV, hg. v. Erwin Preuschen, GCS, Berlin 1903; dt.e Übers.: Origenes, Das Evangelium nach Johannes, übers. v. Rolf Gögler, Zürich 1959, XIII 28, 169.
<402> Wengst zitiert Thomas von Aquins Kommentar zum Johannesevangelium, Teil 1, Göttingen 2011, Nr. 624.
<403> Thyen zitiert Sandra M. Schneiders (im Text oben von mir übersetzt), Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the Contemporary Church, BTB 12 (1982), 40:
„We should not fail to note the feminine version of the standard Gospel formula for responding to the call to apostleship, namely to ,leave all things‘, especially one‘s present occuppation, whether symbolized by boats (e. g., Mt 4,19-22), or tax stall (cf. Mt 9,9), or water pot“.
<404> Thyen zitiert Hendrikus Boers, Neither on this Mountain nor in Jerusalem, SBL. MS 35, Atlanta 1988, 182 (vgl. 139), oben von mir ins Deutsche übersetzt:
„If Jesus interprets what he does in terms of having other food for nourishment, which is to do the will of the one who sent him and to complete his work, there schould be little doubt that his coworker in this work partakes of the living water which he offered her, signified by the dropping of her jar“.
<405> lCH BIN ES, 4,25-30, Abs. 5-6 (Veerkamp 2021, 128-129; 2006, 86).
<406> Wengst zitiert Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, RNT, Regensburg 2009, 332.
<407> Thyen zitiert Hendrikus Boers, Neither on this Mountain nor in Jerusalem, SBL. MS 35, Atlanta 1988, 187f., oben von mir ins Deutsche übersetzt:
„The role they play in the story is to show their ignorance, providing Jesus with the opportunity to comment on the meaning of the story. The ignorance they show is highlighted by their presumption that someone else must have provided him with something to eat. Ironically, someone did, the woman through her conversation with Jesus, but it was not the type of food they had in mind“.
<408> lCH BIN ES, 4,25-30, Abs. 7 (Veerkamp 2021, 129; 2006, 86), und Was heißt hier essen, 4,31-38, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 130; 2006, 87).
<409> Thyen bezieht sich auf Hendrikus Boers, Neither on this Mountain nor in Jerusalem, SBL. MS 35, Atlanta 1988, 92-94 u. 182ff. Das folgende Zitat (185f.) wurde oben von mir ins Deutsche übersetzt:
„She is Jesus‘ co-worker in an unprecedented way, more concretely even than John the baptist, in the sense that John merely pointed to Jesus as ,the Lamb of God who takes away the sins of the world‘ (1,29). The woman participates actively with Jesus in doing the will of his Father; … The significance of the parallel between John and the woman is highlighted by John‘s statement … ,It is the bridegroom who has the bride. The friend of the bridegroom who stands there and hears his voice rejoices because of the bridegrooms voice. Thus my joy (chara) is complete. He must grow (in significance), I diminish‘ (3,29-30). What John says is the other side of what Jesus says about the sower and the reaper (4,36-37)“.
<410> Thyen zitiert Paul D. Duke, Irony in the Fourth Gospel, Atlanta 1985. Von mir wurden oben folgende zwei Passagen ins Deutsche übersetzt (101 und 102f.):
„The situation is precisely that of some Old Testament stories in which a man meets a woman at a well … When Jesus therefore ventures into foreign territory and meets a woman at a well, the properly conditioned reader will immediately assume some context or overtone of courtship and impending marriage. Such an assumption is rewarded here, for … the author has placed this account closely following a story in which water transformed into wedding wine is attributed to the bridegroom (2,1-11), and almost immediately after John the Baptist has talked about hearing the Bridegroom‘s voice (3,29). Such a context enriches the irony of the woman‘s ignorance of Jesus‘ identity…“.
„What is surprising is Jesus‘ sudden revelation that contrary to both the reader‘s expectation and the woman‘s implication, her unmarried status is not because she is a maiden but because she is a five-time looser and currently committed to an illicit affair. This is situational irony par excellence. The Old Testament well scenes invariable feature a naarah, a girl whose virginity is assumed and sometimes made explicit (Gen 24,16). When the heavenly Bridegroom Jesus plays this scene, however, his opposite turns out to be a tramp. He weds himself not to innocence but to wounded guilt and estrangement.“
<411> Was heißt hier essen, 4,31-38, Abs. 3-13 (Veerkamp 2021, 130-132; 2006, 87-88).
<412> Thyen zitiert Sandra M. Schneiders, Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the Contemporary Church, BTB 12 (1982), 40 (oben von mir übersetzt):
„apostolic identification of the woman“.
<413> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 148ff.
<414> Thyen zitiert Ekkehard W. Stegemann, Kindlein, hütet euch vor den Götterbildern, ThZ 41 (1985), 284-294.
<415> Befreier der Welt, 4,39-42, Abs. 2-6 (Veerkamp 2021, 132-134; 2006, 89-90).
<416> In diesem Zusammenhang verweist Veerkamp (Anm. 173) auf andere Quellen, aus denen geschlossen werden kann,
dass diese messianische Bewegung gerade in Samaria große Probleme hatte: Lukas 9,52; Apostelgeschichte 8,14. Vgl. dazu Gerhard Jankowski, Und sie werden hören. Die Apostelgeschichte des Lukas. 1. Teil (1,1-9,31), in: Texte & Kontexte 91/92 (2001), 1-169, hier 139ff.
<417> Erster Teil: Der offenbare Messias, 1,19-4,54, Eine Vorbemerkung (Veerkamp 2021, 47; 2006, 27).
<418> Thyen zitiert Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes, Stuttgart 4. Auflage 1975, 135).
<419> Das andere Zeichen in Kana, Galiläa: Dein Sohn lebt, 4,43-54, Abs. 2-3 (Veerkamp 2021, 135; 2006, 90).
<420> Wie es Wengst zufolge Ludger Schenke, Johannes. Kommentar, Düsseldorf 1998, 91, tut.
<421> Das andere Zeichen in Kana, Galiläa: Dein Sohn lebt, 4,43-54, Abs. 4-5 (Veerkamp 2021, 136; 2006, 90-91).
<422> Wengst zitiert Midrash Shemot Rabbah 5,13: midrasch schemot rabbah (paraschot 1-14), hg. v. A. Shinan, Jerusalem u. Tel Aviv 1984, 166f., und verweist darauf, dass Adolf Schlatter, Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart, 3. Auflage 1960, 1. Auflage 1930, 138, leider eine falsche Stelle angibt.
<423> Anm. 179 (Veerkamp 2021, 136-137; 2006, 91) zu seiner Auslegung von Johannes 4,48, auf die ich später zu sprechen komme.
<424> Thyen zitiert Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK, Göttingen, nach der 21. Auflage 1986, 152f.
<425> Thyen zitiert Wolfgang J. Bittner, Jesu Zeichen im Johannesevangelium, WUNT II/26, Tübingen 1987, 131 und 130.
<426> Das andere Zeichen in Kana, Galiläa: Dein Sohn lebt, 4,43-54, Abs. 5-9 (Veerkamp 2021, 136-137; 2006, 91-92).
<427> Veerkamp zitiert Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes (NTD Band 4), Göttingen 2000, 90.
<428> Das andere Zeichen in Kana, Galiläa: Dein Sohn lebt, 4,43-54, Abs. 11-12.10.13.10 (Veerkamp 2021, 137-138; 2006, 92-93).
<429> Wengst zitiert Johannes Beutler, Das Johannesevangelium, Freiburg u. a., 2. Auflage 2016, 179.
<430> Das andere Zeichen in Kana, Galiläa: Dein Sohn lebt, 4,43-54, Abs. 14 (Veerkamp 2021, 138; 2006, 90-91).
