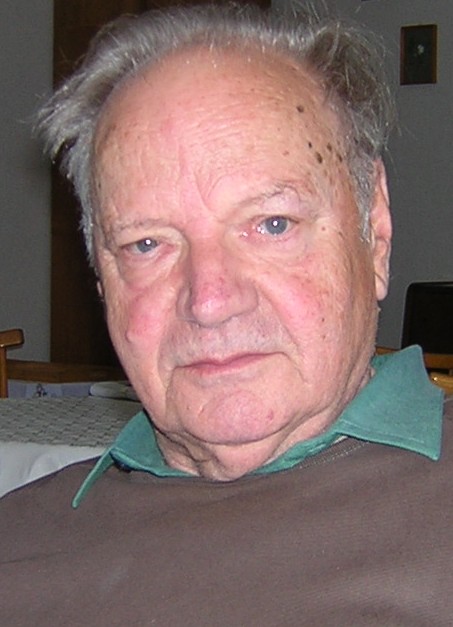Da unser Leben endlich ist, können wir viel weniger an uns und der Welt ändern, als wir es uns oft erträumen. Das ist eine schmerzhafte, aber doch heilsame Einsicht, die der Philosoph Odo Marquard immer wieder entfaltet hat. Mit den folgenden Gedankenschnipseln will ich neugierig darauf machen, in den Schriften des Philosophen nachzulesen, wie er Wahl und Beliebigkeit unterscheidet und was er mit Üblichkeiten meint. Die in Klammern angegebenen Stichworte verweisen auf die ausführlichen Literaturangaben in der chronologisch nach Jahreszahlen geordneten Bibliographie mit 103 Schriften von Odo Marquard.
Schicksal im Gegenüber zur Wahl und Beliebigkeit
↑ Erfahrung statt Erwartung
Faktenzensur
[D]ie mathematische Naturwissenschaft erkennt auf Grund einer Faktenzensur, eines numerus clausus für Tatbestände. Sie läßt nur Tatbestände zu, die sich experimentell erfahren lassen. (Ästhetik, 1960, S. 26)
Erwartungshorizonte
Erwartungshorizonte sind ästhetisch das, was praktisch Üblichkeiten und theoretisch Vorurteile sind. Wie Urteile stets nur partielle Abweichungen von jenen Vorurteilen sind, ohne die wir nicht leben können, sind ästhetische Rezeptionen Abweichungen von Erwartungen, in denen wir unvermeidlich stecken: Das einzelne Werk – der Roman, das Drama, das Gedicht sowie ihr Ausbruch aus dem Genre – dementiert die Erwartung der Rezipienten. Das aber – das Dementi der Erwartung durch das Veto einer Realität – ist das, was üblicherweise Erfahrung heißt. … Erfahrungen sind Erwartungskrisen; darum gilt normalerweise: Die Krise der Erwartung ist die Stunde der Erfahrung. (Krise, 1981, S. 76f.)
Vergleiche dazu Harald Schmidts Äußerung: „Ich bin flexibel in meinen Vorurteilen.“
Lebenslange Schulpflicht
Das moderne Zeitalter des Erfahrungsverlustes ist – als das pädagogische Zeitalter – die Ära der wachsend allgemeinen und lebenslangen Schulpflicht: schließlich vom Kindergarten über Schule nebst Hochschule und die Erwachsenenbildung bis zur Seniorenakademie. Dort aber lernt man unter den Bedingungen eines Wirklichkeitsmoratoriums: Als lebenslange Schüler lernen wir, indem wir Erfahrungen erwerben, die wir selber nicht wirklich machen… (Krise, 1981, S. 79)
Erfahrungsexperten
[D]as moderne Zeitalter des Erfahrungsverlustes wird die Ära der experimentellen Empirie. Je fleißiger, erfolgreicher, apparateintensiver und spezialsprachlicher aber ihre Erfahrungsexperten arbeiten, desto weniger können wir – und „wir“ sind im Hinblick auf ihr spezielles Erfahrungspensum immer fast alle – ihnen noch wirklich folgen und müssen so immer mehr Erfahrungen hinnehmen, die wir nicht selber machen… (Krise, 1981, S. 80)
Differenzspiele
Die elementare Folge des Erfahrungsverlustes ist unter anderem, daß Alter und Jugend sich immer weniger durch Erfahrungsunterschiede unterscheiden können; gerade das zwingt sie heute, ihre altersspezifische Identität anders, nämlich über demonstrativ theatralische Differenzspiele zu suchen. (Krise, 1981, S. 80)
Verantwortungsgesinnung
[E]s trennt sich die Erwartung von der Erfahrung und wird weltfremd: Die Menschen verwandeln sich zu erfahrungslosen Erwartern… Dabei triumphiert weithin jene Gesinnungsethik, die sich als Verantwortungsethik tarnt, indem sie zur Ethik einer bloßen Verantwortungsgesinnung wird, die etwa Entsorgungsprobleme bei den eigenen Denkfolgen regelmäßig übersieht. (Krise, 1981, S. 81)
Erfahrung statt Erwartung
[I]n dem Maße, in dem die Wirklichkeit weg von der ‚Erfahrung‘ hin zur ‚Erwartung‘ tendiert, bewegt sich – gegenläufig: kompensatorisch – das Ästhetische weg von der ‚Erwartung‘ hin zur ‚Erfahrung‘… (Antifiktion, 1983, S. 98)
(Ent-)Sokratisierung
Lebenserfahrung ohne Konventionen ist leer; Konventionen ohne Lebenserfahrung sind blind: indem Aristoteles die Ethik an die Lebenserfahrung bindet, bindet er sie an schon erprobte Lebensgewohnheiten, an überlieferte Konventionen: sie ist die Anknüpfung (Hypolepsis) an Üblichkeiten, an Traditionen. Diese – traditionelle Konventionen, Lebensgewohnheiten, Lebenserfahrung – sind etwas, was man in ein Gespräch einbringen, aber niemals ausschließlich durch ein Gespräch – schon gar nicht durch ein absolutes Gespräch, zu dem sie nicht zudürfen – erwerben kann: insofern – und wenn man den platonischen Sokrates exklusiv als Diskursethiker versteht – entsokratisiert Aristoteles die Ethik. Wenn man allerdings Sokrates vor allem als die Urfigur jenes lebensklugen „Laien“ mit docta ignorantia begreift, der Reflexionsspiele auf den Boden der Lebenswelttatsachen zurückholt und – durch common sense in der Reflexion – Reflexionsschlösser mit diesem Boden konfrontiert: dann im Gegenteil sokratisiert Aristoteles die Ethik, indem er sie entplatonisiert; denn er bindet sie – als Abwehr jeder Ethik, die spinnt – an die Lebenserfahrung. (Über-Wir, 1984, S. 41f.)
Apriorismus
[D]er Apriorismus der Ethik Kants [ist] die Antwort … auf die Frage: Wie ist Ethik ohne Lebenserfahrung möglich? (Über-Wir, 1984, S. 42)
Schule
Eine … Kultur des Erfahrungsersatzes (des erfahrungsentlasteten – erfahrungsentfernten – Erfahrungserwerbs, den man heute meint, wenn man „Lernen“ sagt) ist … die Schule, die ebendarum erst modern eigentlich entsteht und jedenfalls expandiert; denn immer mehr – zum Erfahrungsersatz – muß gelernt werden. … die Wirklichkeit [wird] mit der Schule identifiziert durch die Gesamtschule (Weltfremdheit, 1984, S. 84)
Sonderphilosophie vom Menschen
Fast alle Philosophien handeln vom Menschen: Warum braucht es da eine eigenständige Sonderphilosophie, die vom Menschen handelt, nämlich die philosophische Anthropologie? (Utopie, 1991, S. 142)
Lebenswelt statt Weltfremdheit
Kants „Kritik der reinen Vernunft“ kritisiert zwei Weltfremdheiten: die Weltfremdheit jener Metaphysik, die sich in die Scheinwelt bloßer Begriffe verliert, und die Weltfremdheit der experimentellen Naturwissenschaft, die nur die Experimentalwelt der „Erscheinungen“ kennt. Beiden entgeht – entrückt in Begriffsträume oder beschränkt aufs Labor – die wirkliche Welt des wirklichen Menschen, in der der Mensch tagtäglich sein Leben lebt, „weltklug“ sich verhalten muß, „und hiezu die Kenntnis des Menschen braucht“: Heute nennen wir das die menschliche Lebenswelt. Dieser menschlichen Lebenswelt gilt – diesseits von Begriffsmetaphysik und exakter Experimentalphysik – das Interesse der philosophischen Anthropologie, die – wie Kant sagt – „Menschenkenntnis“ durch „Weltkenntnis“ sucht. Die philosophische Anthropologie … ist eine Lebensweltphilosophie des Menschen. Wo – auch das ist wichtig – die christliche Religion die Psalmenfrage „was ist der Mensch, daß du (Gott) seiner gedenkst?“ nicht mehr vertrauenswürdig beantworten kann und darum – wie 1748 bei Johann Joachim Spalding – nach der „Bestimmung des Menschen“ nun mühsam suchen muß, und wo die metaphysische Formel vom Menschen als „animal rationale“ zu abstrakt wird und die physikalistische Definition des Menschen als Objekt oder Subjekt von mathematisierbaren Experimenten erst recht abstrakt bleibt: da und allererst da – also spezifisch modern – braucht es eine ausdrückliche Philosophie vom Menschen, um den ganzen Menschen in seiner lebensweltlichen Wirklichkeit wirklich festzuhalten und zu verstehen, eine Sonderphilosophie vom Menschen, die ebendarum modern erst entsteht: die philosophische Anthropologie. (Utopie, 1991, S. 144f.)
Anthropologie
Die Anthropologie zerfiel in Biologie und Belletristik.
Dieser Verlauf – die Nichtinstitutionalisierung der Anthropologie als Gesamtwissenschaft vom Menschen – ist mitnichten ein Unglück, sondern – ganz im Gegenteil – ein Glück. Vor allem konnten sich die verschiedenen speziellen Humanwissenschaften frei ausbilden und autonom entwickeln. Das betrifft nicht nur die Geisteswissenschaften. Es betrifft ebenso die Naturwissenschaften vom Menschen: etwa die Kernfächer der Humanmedizin und Sektoren der Biologie. Außerdem betrifft es die pragmatischen Handlungswissenschaften vom Menschen: Jurisprudenz, Ökonomie, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften und wohl auch die Theologie. Schließlich betrifft es auch die philosophische Anthropologie. (Utopie, 1991, S. 152f.)
Ethik des bürgerlichen Lebens
Ritter zeigt: Die metaphysische Philosophie des Aristoteles kommt – anknüpfend an die griechische „polis“ – zu einer institutionellen Ethik des „bürgerlichen Lebens“. Die eudämonismuskritische, moderne, nur noch normative Ethik im Anschluß an Kant verengt die menschliche Praxis auf die menschliche Möglichkeit und Innerlichkeit. Demgegenüber verpflichtet sich die institutionelle Ethik des Aristoteles – die, über Kant hinausgehend, Hegel modern wiederherzustellen versuchte – der menschlichen Praxis, die in Familie, Haus und ökonomischer Gesellschaft, in Stadt und Staat durch Vernunft und Wissenschaft zur menschlichen Wirklichkeit kommt. Zum „Glück“ gehört die Stadt: mit ihr ist eine Sozialform in die Geschichte – der griechischen „polis“, des Christentums und der modernen bürgerlichen Gesellschaft – eingetreten, deren „Subjekt der Mensch als Mensch ist“. So gehört zur Ethik zugleich das abstrakte Recht und die Ökonomie und die Politik, also die ganze Breite der bürgerlichen Praxis. (Bürgerlichkeit 3, 2003, S. 160f.)
↑ Schicksal im Gegenüber zur Wahl und Beliebigkeit
Fatalismusbedarf
Die Menschen haben … einen unabweislichen Fatalismusbedarf; nicht etwa nur diejenigen, die – opportunistisch – vom laufenden Ablauf Vorteile erwarten, oder diejenigen, die – defätistisch – der Ungewißheit des Ausgangs die Gewißheit der Niederlage vorziehen. Denn wer überhaupt in bestimmten Bereichen handeln will, muß sich darauf verlassen, daß er in anderen – die immer die meisten sind – nicht zu handeln braucht. (Schicksal, 1976, S. 78)
Angetan
Das ist eine indirekte Ermächtigung des Schicksals: Je mehr die Menschen die Wirklichkeit selber machen, um so mehr erklären sie sie schließlich – enttäuscht – zu der, für die sie nichts können und die ihnen nur noch angetan wird. (Schicksal, 1976, S. 83)
Lassen
Die Erfahrung des Geschichtlichen ist … weniger die der Veränderbarkeit als die ihrer – kontingenten aber unvermeidlichen – Grenzen. … Auch unser Tun kann das Faktische nicht restlos wegarbeiten; denn wir müssen immer mehr lassen, als wir tun. Der Satz, daß jedes Lassen indirekt ein Tun ist, trifft nicht mehr zu als der Satz, daß jedes Tun indirekt ein Lassen ist: wir können nur tun, indem wir das meiste lassen; oder anders gesagt: Es braucht jedermann viel Fatalismus, der kein Fatalist sein will. (Üblichkeiten, 1979, S. 69)
Handlungen und Zufälle
Es widerfährt uns etwas, was wir nicht gewollt und gewählt haben. Denn wir Menschen sind nicht nur unsere – absichtsgeleiteten – Handlungen, sondern auch unsere Zufälle. (Zufällig, 1984, S. 119)
Beliebigkeit und Schicksal
Entweder … ist das Zufällige „das, was auch anders sein könnte“ und durch uns änderbar ist (z. B. kann man Wurst essen oder es lassen und statt dessen Käse essen, und dieser Vortrag könnte Ihnen auch Wurst sein, weil er Käse ist, oder er könnte auch gar nicht oder auch anders gehalten werden); dieses Zufällige als „das, was auch anders sein könnte“ und durch uns änderbar ist, ist eine beliebig wählbare und abwählbare Beliebigkeit: ich möchte es das Beliebigkeitszufällige nennen, das Beliebige. Oder das Zufällige ist „das, was auch anders sein könnte“ und gerade nicht durch uns änderbar ist (Schicksalsschläge: also Krankheiten, geboren zu sein und dgl.); dieses Zufällige als „das, was auch anders sein könnte“ und gerade nicht – oder nur wenig – durch uns änderbar ist, ist Schicksal: in hohem Grade negationsresistent und nicht oder kaum entrinnbar; ich möchte es gern das Schicksalszufällige nennen, das Schicksalhafte. (Zufällig, 1984, S. 128)
Mitleid und Toleranz
Das bisherige Fazit ist: zur Würde des Menschen gehört, daß er das Zufällige leiden kann; und zu seiner Freiheit gehört die Anerkennung des Zufälligen. Darin steckt positiv: die Respektierung menschlicher Würde ist vor allem das Mitleid; und die Respektierung menschlicher Freiheit ist vor allem die Toleranz. Darin steckt zugleich negativ: die Würde des Menschen ist nicht die einer absoluten Diva, die permanent beleidigt ist, nicht als Gott – oder als ausschließlicher Selbstzweck wenigstens halbwegs als Gott – behandelt zu werden; und die Freiheit des Menschen ist nicht (als die Macht der Vernunft) die absolute Wahl, für die es nichts Nichtgewähltes – nichts Zufälliges – gibt. (Zufällig, 1984, S. 132)
Buntheit
Ebendarum sind … die Menschen – die stets mehr ihre Zufälle (Schicksalszufälle) sind als ihre Wahl – gleichwohl nicht Gefangene ihres Schicksals und nicht Treibgut des Zufalls. Zwar gilt: die menschliche Wirklichkeit ist überwiegend das Zufällige, das, was auch anders sein kann. Aber wenn es anders sein ‚kann‘, dann – wenn auch zufälligerweise – ‚ist‘ es häufig auch anders: die zufällige Wirklichkeit – zufällig – ist vielfach so und auch noch anders; sie umfaßt Verschiedenes: sie ist vielgestaltig, bunt. Diese Buntheit der Wirklichkeit – gerade sie – ist die menschliche Freiheitschance. (Gewaltenteilung, 1988, 87)
↑ Philosophie der Üblichkeiten
Legitimationslegitimation
Dialog 1 – Philosoph: Mit welchem Recht, Laie, tust du, was du da tust? – Laie: Das ist bei uns so üblich, das haben wir immer schon so gemacht. – Philosoph: Das ist keine Rechtfertigung! Also noch einmal: legitimiere dich! – Laie: Gestatte mir, Philosoph, eine Gegenfrage: Mit welchem Recht fragst du ‚mit welchem Recht‛? und mit welcher Legitimation verlangen deine Zunftgenossen von uns Legitimationen? – Philosoph: Das ist bei uns so üblich, das haben wir immer schon so gemacht. (Üblichkeiten, 1979, S. 62)
Beweislastverteilung
Dialog 2 – Philosoph: Rechtfertige dich! – Laie: Bitte nach dir. Was in diesem Kurzdialog als hinterhältige Höflichkeit erscheint, entspricht der einzig praktikablen Beweislastverteilung. (Üblichkeiten, 1979, S. 63)
Lob der Trägheit
Ein endliches – kapazitätsknappes, zeitknappes – Wesen kann nicht das Sein und Sosein bzw. Gelten und Sogelten von allem begründen, sondern nur das Abweichen davon. Alles andere (das stets das meiste ist) gilt weiter, und zwar im Kontext Norm unvermeidlich als Üblichkeit. – Das Abweichen von Üblichkeiten wird begründet nach Begründungsüblichkeiten für Abweichungen von Üblichkeiten, das Abweichen davon wieder nach Üblichkeiten, zu denen auch die Philosophie gehören kann. – Diese Überlegung ist ein gedämpftes Lob der Trägheit: … wer menschlich sein will, sei lieber träge als transzendental. (Üblichkeiten, 1979, S. 65f.)
Antiprinzip Anknüpfung
Jede Veränderung muß an Vorhandenes anknüpfen… Dies nenne ich das ‚Antiprinzip Anknüpfung‛. Anknüpfung – Hypolepsis – besagt: Das, was bleibt, ist die Möglichkeitsbedingung von Veränderung… Innovation lebt von Tradition… Entüblichungen setzten die Untilgbarkeit von Üblichkeiten voraus; Zukunft braucht Herkunft… [Dieses] Antiprinzip … mäßigt die Frage: mit welchem Recht gilt überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? zur Frage: Warum soll – im bestimmten Fall – etwas anderes gelten, als schon gilt? … [und] ersetzt die Letztbegründungsfrage durch Nächstbegründungsfragen. Das bedeutet einen Abschied vom Prinzipiellen. (Üblichkeiten, 1979, S. 68)
Nichtwahl, die ich bin
[E]s hat wegen seiner Lebenskürze kein Mensch die Zeit, sich von der Vergangenheit, die er ist, in beliebigem Umfang zu distanzieren; stets bleibt er überwiegend seine Herkunft… zur „Wahl, die ich bin“ [Sartre], gehört unvermeidlich meine herkunftsgeschichtliche Vergangenheit als die Nichtwahl, die ich bin. Diese durch ihre Sterblichkeit den Menschen auferlegte Unvermeidlichkeit, stets überwiegend das zu bleiben, was sie schon waren, nenne ich Herkömmlichkeit. Gegen diese Herkömmlichkeit wehren sich die Menschen: sie wollen ändern. (Hermeneutik, 1979, S. 122f.)
Konservativ
[D]ie Beweislast hat der Veränderer. Indem sie diese Regel übernimmt, die aus der menschlichen Sterblichkeit folgt, tendiert die Skepsis zum Konservativen. „Konservativ“ ist dabei ein ganz und gar unemphatischer Begriff, den man sich am besten von Chirurgen erläutern läßt, wenn diese überlegen, ob „konservativ“ behandelt werden könne, oder ob die Niere, der Zahn, der Arm oder Darm herausmüsse: lege artis schneidet man nur, wenn man muß (wenn zwingende Gründe vorliegen), sonst nicht, und nie alles; es gibt keine Operation ohne konservative Behandlung: dann man kann aus einem Menschen nicht den ganzen Menschen herausschneiden. (Prinzipiell, 1981, S. 16)
Sinn für Trägheiten
[F]ür eine Quintessenz der Erfahrung mit der Geschichte halte [ich], … daß nur die erste Erfahrung mit ihr – durch die freilich jeder hindurch muß – diese ist: wieviel hat sich selbst dort geändert, wo sich fast gar nichts geändert hat; die zweite und nachhaltigere Erfahrung aber diese: wie wenig hat sich selbst dort geändert, wo sich fast alles geändert hat. Der historische Sinn ist vor allem Inertialsinn, Sinn für Trägheiten: die Grunderfahrung des Geschichtlichen ist – meine ich – mehr als die der Veränderlichkeit die ihrer Grenzen. (Multiversalgeschichte, 1982, S. 69)
Zustimmung zum Leben
Man muß … ablassen vom Unsinn der Bindung der Lebensbejahung an den absoluten Sinnbeweis. … Wenn wir … bereits leben, haben wir dem Leben – zwar nicht prinzipiell, aber faktisch und als Üblichkeit – durch Leben jeweils schon irgendwie zugestimmt. (Sinnerwartung, 1983, 52)
Kleinkorrekturen
Was besprochen, überprüft, begründet werden kann, sind vielmehr überschaubare Änderungen, Kleinkorrekturen der Normenlage: darum liegt, wenn hier überhaupt begründet werden soll, die Begründungspflicht vernünftigerweise beim Veränderer, der er allein – wenn er überschaubare Veränderungen vorhat – kann ihr genügen. Seine Abänderungsbegründung aber braucht die vorhandene Sitten- und Normenlage als „Handlungsgrundlage“. (Über-Wir, 1984, S. 55f.)
Ethikveränderungsethik
Ich nenne jenen Teil der Ethik, der Handlungen betrifft, die Ethikveränderungen sind, Ethikveränderungsethik. Für sie sind – meine ich – mindestens zwei Tugenden unabdingbar, nämlich als Zukunftsverhältnis – gegen die ungezügelte Weltveränderungswut – Vorsicht und als Vergangenheitsverhältnis – gegen die ungezügelte Negationswut gegenüber dem Vorhandenen – Rücksicht. (Neugier, 1984, S. 88)
Heile Diesseitswelt
Je mehr Vertrautheit nicht mehr erfahren wird, um so mehr wird sie – ungeduldig – erwartet: durch die Illusion einer endgültig nicht mehr fremden, einer endgültig heilen Diesseitswelt. … die ideologische Naherwartung der heilen Diesseitswelt … ist der mentale Teddybär des modern verkindlichten Erwachsenen. (Weltfremdheit, 1984, S. 87)
Vergangenheit
Kein Zeitalter hat mehr Vergangenheit vertilgt als unseres, kein Zeitalter hat zugleich mehr Vergangenheit festgehalten: museal aufbewahrt, konservatorisch gepflegt, ökologisch behütet, archivalisch gesammelt, archäologisch rekonstruiert, historisch erinnert. (Weltfremdheit, 1984, S. 93)
Zukunft braucht Herkunft
[O]hne … Üblichkeiten – Traditionen, Sitten, Usancen des Wissens und Handelns – können wir nicht leben… Die Wahl, die wir sind, wird getragen durch sie als die Nichtwahl, die wir sind: Zukunft braucht Herkunft; Wahl braucht Üblichkeiten. Das bedeutet mitnichten, daß stets alle Traditionen unangetastet und alle Üblichkeiten unverändert bleiben müssen, denn im Gegenteil: Üblichkeiten sind durchaus änderbar, reformierbar. Es bedeutet nur: stets müssen mehr Üblichkeiten aufrechterhalten werden als verändert, sonst ruiniert man unser Leben; und die – durchaus immer wieder einmal erfolgreich zu tragende – Beweislast hat stets der Veränderer. (Zufällig, 1984, S. 125)
Schreibtischtaten
Eichmanns Schreibtischtaten litten nicht an einem Zuviel, sondern an einem Zuwenig von Üblichkeiten…; man sollte sich daran erinnern, daß der Widerstand vor allem aus intakten Traditionen kam. (Zufällig, 1984, S. 126f.)
Kritik als Üblichkeit
Kritik ist vor allem der Konflikt zwischen Üblichkeiten; um zu ihm fähig zu sein, muß man Üblichkeiten haben; und in unseren Zeiten undGegenden ist dann schließlich Kritik selber eine Üblichkeit, die durch Üblichkeiten geregelt ist. (Zufällig, 1984, S. 127)
Usualismusbedarf des Originellen
Skepsis ist Usualismus: … denn so, wie man Fatalismus braucht, um ein Nichtfatalist sein zu können, benötigt man Üblichkeiten, um ein einzelner sein zu können: gerade auch das Originelle braucht – um sich von ihm tragen zu lassen und um sich von ihm abzusetzen – das, „wie man es immer schon gemacht hat“, das Usuelle. (Gewaltenteilung, 1988, S. 78)
Kontinuitäten
Der historische Sinn ist vor allem Sinn für Kontinuitäten, für Langsamkeiten; die Grunderfahrung des Geschichtlichen ist – meine ich – mehr als die Erfahrung der Veränderlichkeit die ihrer Grenzen. (Herkunft 1, 1988, S. 72f.)
Dauerlauf Geschichte
Gerade in einer Welt mit hoher Innovationsgeschwindigkeit sind alte Lebensformen am wenigsten veraltungsanfällig, weil sie schon alt sind. … Zum wachsenden Veraltungstempo gehört das wachsende Tempo der Veraltung auch ihrer Veraltungen: je schneller das Neueste zum Alten wird, desto schneller kann Altes wieder zum Neuesten werden; jeder weiß das, der nur ein wenig länger schon lebt. So sollte man sich beim modernen Dauerlauf Geschichte – je schneller sein Tempo wird – unaufgeregt überholen lassen und warten, bis der Weltlauf – von hinten überrundend – wieder bei einem vorbeikommt; immer häufiger gilt man dann bei denen, die überhaupt mit Avantgarden rechnen, vorübergehend wieder als Spitzengruppe: so wächst gerade durch Langsamkeit die Chance, up to date zu sein. (Herkunft 1, 1988, S. 73)
Teddybär
Die Fortschrittskultur der modernen Welt ist die gesteigerte Kultur seiner Schnelligkeit; die Erinnerungs- und Bewahrungskultur der modernen Welt ist die gesteigerte Kultur seiner Langsamkeit; durch sie nimmt der Mensch in die immer schneller sogleich wieder anders und dadurch fremd werdende moderne Welt das schon Vertraute mit, just so, wie die ganz jungen Kinder – für die die Wirklichkeit ja ebenfalls unermeßlich neu und fremd ist – ihre eiserne Ration an Vertrautem ständig bei sich führen und mit sich herumtragen: ihren Teddybären; denn der Teddybär – als transitional object – sichert ihnen Kontinuität. Die moderne Erinnerungskultur, von den Geisteswissenschaften über den konservatorischen und ökologischen Sinn bis zum Museum, ist – je moderner, desto notwendiger – das funktionale Äquivalent des Teddybären für den erwachsenen modernen Menschen in seiner Welt der beschleunigten Fortschritte… (Ausrangieren, 1997, S. 53f.)
Langsamkeitspflege
Je schneller die Zukunft modern für uns das Neue – das Fremde – wird, desto mehr Kontinuität und Vergangenheit müssen wir – teddybärgleich – in die Zukunft mitnehmen und dafür immer mehr Altes auskundschaften und pflegen. … Die moderne Welt – je schneller sie wird – braucht Ausgleich durch Langsamkeitspflege. … Zukunft braucht Herkunft. (Zeit, 1997, S. 11f.)
Nachträgliche Lebewesen
Daß Kompensationen „nach“ dem kommen, was sie kompensieren, ist kein Defekt, sondern menschlich. Denn Menschen … sind nachträgliche Lebewesen; ihre Aktivitäten sind nicht ex nihilo, sondern sie „antworten“ auf vorgegebene Lagen; selbst Avantgarden kommen post festum. … Denn die Menschen sind … anknüpfende Lebewesen. (Stattdessen, 1999, S. 42)
Unbeliebigkeit
Wir haben – in unserem ‚Leben vor dem Tode‘ – immer schon Lebensformen, Üblichkeiten, Traditionen: das ist eine völlig unbeliebige Lage, deren Unbeliebigkeit mit der Kürze unseres Lebens zusammenhängt. Die zuweilen dann entstehende Frage, ob wir einen Teil einer Üblichkeit verlassen sollten (die Frage der Kritik), setzt immer schon Üblichkeiten voraus, die wir haben, und Üblichkeiten, die in Konkurrenz dazu treten. … Ich gehe dabei von einem begrenzten Gewimmel von Herkünften aus. Ich räume ein, daß darin ein partielles ‚Multikulti‘-Motiv steckt: ich muß mit den Herkünften anderer zusammenleben, nach Möglichkeit tolerant. Aber wir haben – trotz aller Unsicherheiten, die zum Leben gehören – nicht die Möglichkeit, auf beliebigen Herkünften beliebig zu spielen. … Meine Herkunft ist die aus der Antike kommende (vor allem aristotelische) Tradition der liberalen Bürgerlichkeit, das Christentum (mit einem leicht protestantischen Schlenker), die konziliante Form der Aufklärung, die skeptische Tradition der Moralistik. Und wir erkennen das, was wir brauchen, nicht durch bequeme Aprioris, sondern – was ein durchaus mühsamer Weg ist – durch Lebenserfahrung. (Weigerungsverweigerer, 2003, S. 17)
Spießer
Spiegel: Sind Sie ein konservativer Spießer?
Marquard: Der Begriff des Spießers bedarf auch der Überprüfung. Ich sage: Nicht jede Veränderung ist per se gut. Die Beweislast trägt nicht das Vorhandene und Überkommene, sondern der Veränderer. Nur insofern bin ich konservativ. Ich bin gegen den Generalverdacht, alles Überkommene sei unvernünftig und müsse deshalb geändert werden. Ich bin gegen die ständige Stimulierung des Außerordentlichkeitsbedarfs, eine deutsche Krankheit, die damit zu tun hat, dass die Deutschen lange die Nation entbehren und reale Veränderungen durch absolute Philosophie kompensieren mussten. (Götter, 2003, S. 153)
↑ Endlichkeit und Lebenskürze
Mortalität
[I]n der menschlichen Gesamtpopulation beträgt die Mortalität hundert Prozent. Der Tod aber – wie lange er auch zögert – kommt immer allzubald: vita brevis. Jedenfalls ist das Menschenleben zu kurz für den absoluten Diskurs. (Über-Wir, 1984, S. 52)
Lebenskürze
Der Zufall, der uns am schicksalhaftesten und – falls man ihn nicht als den Trost betrachtet, nicht endlos weiterturnen zu müssen – am härtesten trifft, ist unser Tod: wir sind – aus Schicksalszufall – durch Geburt zum Tode verurteilt, d. h. zu jener Lebenskürze, die uns nicht die Zeit läßt, uns aus dem, was wir zufällig schon sind, in beliebigem Umfang davonzumachen; unsere Sterblichkeit zwingt uns, jener Schicksalszufall, der für uns unsere Vergangenheit ist, zu „sein“, d. h. überwiegend zu bleiben. (Zufällig, 1984, S. 129)
Frühe Alterserfahrung
Die Angst vor der Beliebigkeit ist eine optische Täuschung der Jugend, die nur andauert, weil gilt: „daß es keinen Menschen gibt, der erwachsen wäre“. Die Erfahrung des Überwiegens und der Lebensbedeutsamkeit jener Zufälle, die uns prägen, obwohl sie gerade nicht in unserem Belieben stehen…, ist eine Alterserfahrung, die man schon früh im Leben machen kann, weil ebenso gilt: jeder – auch der jüngste – Mensch ist schon alt, d. h. so nah dem Tode, daß er jedenfalls nicht die Zeit hat, die Zufälligkeit der Zufälle, aus denen sein Leben besteht, in nennenswerter Weise zu löschen. (Zufällig, 1984, S. 131)
Natalität und Mortalität
Unser Leben ist kurz, weil wir nicht immer da waren, sondern geboren sind, und nicht immer dableiben, sondern sterben: also durch Geburt und Tod, wobei gilt: wie die Natalität beträgt auch die Mortalität der menschlichen Gesamtpopulation nach wie vor hundert Prozent.(Herkunft 1, 1988, S. 70)
Endlichkeit
Darum muß man noch vor aller Medizinethik die Menschen ethisch an ihre Pflicht erinnern, nicht unwürdig über die Verhältnisse ihrer Endlichkeit zu leben… (Medizinkritik, 1989, S. 109)
Kostbare Zeit
Je knapper ein Gut ist, desto kostbarer wird es. Das Menschenleben ist kurz: seine Zeit ist kostbar. Wenn für Menschen die Zeit – sterblichkeitsbedingt – knapp und darum jede Zeit kostbar ist, ist nur die beste aller möglichen Zeiterfüllungen legitimierbar. Für Seneca – in De brevitate vitae – war diese beste aller möglichen Zeiterfüllungen die Philosophie; modern (im Zeichen der Positivierung der Zeit) wird … diese beste aller möglichen Zeiterfüllungen: die Musik. (Musik, 1990, S. 142f.)
Weltappetit und Lebenskürze
Hans Blumenberg [entwickelt in seinem Buch] … Lebenszeit und Weltzeit… – auf der Grundlage einer eigenwilligen und glanzvollen Interpretation der „genetischen Phänomenologie des späten Husserl – als zentrales Zeitproblem die menschliche Lebenskürze: Je mehr die Menschen – nach ihrer Vertreibung aus der „Lebenswelt“ der unmittelbaren Selbstverständlichkeiten – die objektive Welt mit ihrer unfaßlich riesigen „Weltzeit“ entdecken, desto unausweichlicher entdecken sie zugleich, daß ihre „Lebenszeit“ eine ultrakurze Episode ist, limitiert durch den Tod, der unerbittlichen Grenze für ihren vital und kognitiv grenzenlosen Weltappetit. (Zeit und Endlichkeit, 1991, S. 45)
Zeitvergeudungen
Seneca hat in seiner Schrift De brevitate vitae die Klagen über die Kürze unseres Lebens zurückgewiesen. Unser Leben – meinte er – ist nicht kurz, sondern wir machen es kurz, indem wir unsere Lebenszeit an Dinge verschwenden, die nicht der Mühe wert sind. … Das Leben ist nicht kurz, sondern wir machen es kurz, durch Zeitvergeudungen. Aber gerade dieses Argument von Seneca – so zutreffend es ist – setzt die Kürze unseres Lebens voraus. Hätten wir beliebig viel Zeit, könnten wir beliebig viel Zeit vergeuden, ohne Zeit zu verlieren; es gäbe ja immer wieder neue. (Zeit und Endlichkeit, 1991, S. 47f.)
Galinist
Wir kommen spät und gehen früh, und die Strecke dazwischen, die unser Leben ist, ist, wie lang sie auch sein mag, kurz. Denn wir Menschen sind stets Spätgeborene; wo wir anfangen ist nicht der Anfang: wir fangen nicht ab ovo an, sondern a galina (als Hermeneutiker, das merken Sie, bin ich bei der Frage nach Henne und Ei kein Ovist, sondern Galinist); und unser Tod, wie lang er auch zögert, kommt immer allzubald. (Zeit und Endlichkeit, 1991, S. 48)
Temporales Doppelleben
[W]ir müssen – unvermeidlicherweise – stets beides: schnell leben und langsam leben, Eiler und Zögerer sein. … dieses temporale Doppelleben schützt uns – als eine Art Gewaltenteilung der Zeit – vor temporalen Gleichschaltungen: davor, nur – zukunftshungrig – schnell oder nur – herkunftsdominiert – langsam zu leben. Das gilt für die Zeit jedes Menschen, und es gilt ebenso für die moderne und gegenwärtige Zeit, die beides forciert: unsere Schnelligkeit und unsere Langsamkeit. Dadurch scheint sie uns zwar zu zerreißen; aber gerade das müssen wir aushalten. Wir müssen – auch und gerade in der modernen Welt – beides leben, unsere Schnelligkeit und unsere Langsamkeit, unsere Zukunftsbegierde und unsere Herkunftsbezogenheit, sonst leben wir unser Leben nur halb.(Zeit und Endlichkeit, 1991, S. 50)
Erde auf Erden
Wir müssen uns … hüten, denen zuzustimmen, die uns – absolut und prinzipiell – den Himmel auf Erden versprechen; denn sie mißachten unsere Endlichkeit. Wer den Himmel auf Erden will, erfährt die vorhandene Wirklichkeit zwangsläufig als Hölle auf Erden und übersieht, was sie wirklich ist: Erde auf Erden. (Zustimmung, 1992, S. 11)
Zeitmangel-Wesen
Der Mensch ist endlich… Darum … ist der Mensch das Zeitmangel-Wesen, das seinen Zeitmangel kompensieren muß und kompensiert: durch Schnelligkeit, durch Langsamkeit, durch die Multitemporalität seiner Mitmenschen, durch Universalisierungen und Pluralisierungen, durch Rationalitätskultur und Kontinuitätskultur und durch die ästhetische und humoristische Einbeziehung des Ausgeschlossenen. (Vorbemerkung Skepsis und Zustimmung, 1994, S. 7)
Vizelösungen
Die Texte dieses Buches … verteidigen … in bezug auf den Menschen das Unvollkommene: die zweitbesten Möglichkeiten, die Vizelösungen, das, was nicht das Absolute ist. Das Absolute – das schlechthin Vollkommene und Außerordentliche – ist nicht menschenmöglich, denn die Menschen sind endlich. ‚Alles oder nichts‘ ist für sie keine praktikable Devise: Das Menschliche liegt dazwischen, das Wahre ist das Halbe. (Unvollkommen, 1995, S. 9)
Endlichkeitsphilosophie
Seit dem Konkurs jener finalisierungstrunkenen Revolutionsphilosophien, die – fiat utopia, pereat mundus – die Individuen hinwegfinalisieren wollten, ist eine Endlichkeitsphilosophie fällig… (Bürgerlichkeit 2, 1995, S. 91)
Fristcharakter
Die „Kongruenz“ von „Lebenszeit und Weltzeit“ [so auch der Titel eines Buches von Blumenberg von 1986] erweist sich als Wahn; die „Öffnung der Zeitschere“ zwischen „Lebenszeit und Weltzeit“ erweist sich als Wirklichkeit. So wird der Fristcharakter unserer Lebenszeit für Hans Blumenberg zentral… [er] sieht den Tod … als Freiheitsbedingung. (Entlastung, 1996, S. 117)
Tod und Geburt
Das Menschenleben ist kurz. Unsere gewisseste Zukunft ist unser Tod. Unsere unvermeidlichste Vergangenheit ist unsere Geburt. Das gilt für jeden Menschen: denn … die Mortalität und die Natalität der Menschen beträgt nach wie vor durchschnittlich 100 Prozent. (Zeit, 1997, S. 9)
Knappste Ressource
Hätten wir beliebig viel Zeit, könnten wir beliebig viel Zeit vergeuden, ohne Zeit zu verlieren: es gäbe ja immer wieder neue. Die aber gibt es gerade nicht. Unsere Zeit ist endlich, sie ist Frist, sie ist knapp. Die knappste unserer knappen Ressourcen ist unsere Lebenszeit. (Zeit, 1997, S. 9)
Gewisseste Zukunft
Unsere gewisseste Zukunft ist unser Tod. Im Alter wird diese Zukunft immer aufdringlicher. Aber der Tod ist jene Zukunft, die besiegelt, daß wir keine Zukunft mehr haben. (Alter, 1999, S. 135)
Endlosigkeits- und Vollendungsillusion
Eine der Zukunftsillusionen ist die Endlosigkeitsillusion… Eine andere Zukunftsillusion ist die Vollendungsillusion: Unsere Zeit sei die Zeit für Vollendungen…
Gerade Vollendungsillusionen verlangen auch vom Merken und Sagen Rücksicht darauf, ob es der zukünftigen Vollendung diene: der Aufgabenerfüllung, der Lebenserfüllung, der Geschichtsvollendung. Im Leben nehmen wir auf diese Zukünfte – mit fututalem Opportunismus, in zukunftstaktischem Gehorsam – Rücksicht; man erlaubt sich nur das zu merken und zu sagen, was die Vollendungen nicht gefährdet und die Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigt: was einem die Zukunft nicht allzu unangenehm macht, z. B. womit man nicht zu vielen Leuten (einschließlich unserer selbst) auf die Füße tritt. Unser Blick auf die Wirklichkeit ist darum illusionsbereit und illusionsanfällig, denn er ist durch unsere Zukunft bestechlich. Diese Bestechlichkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab, weil wir immer weniger Zukunft haben und schließlich an jenem Ende sind, das kein Ziel ist: dem Tod. (Alter, 1999, S. 135f.)