Im zweiten Kapitel des Buches stellt Pfarrer Helmut Schütz die Frage nach dem, was Mark Terkessidis Interkultur und Paul Mecheril Migrationspädagogik nennt. Was sind überhaupt Kulturen, was gehört zur interkulturellen Kompetenz und zur vorurteilsbewussten Erziehung? Und was bedeutet Inklusion?
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
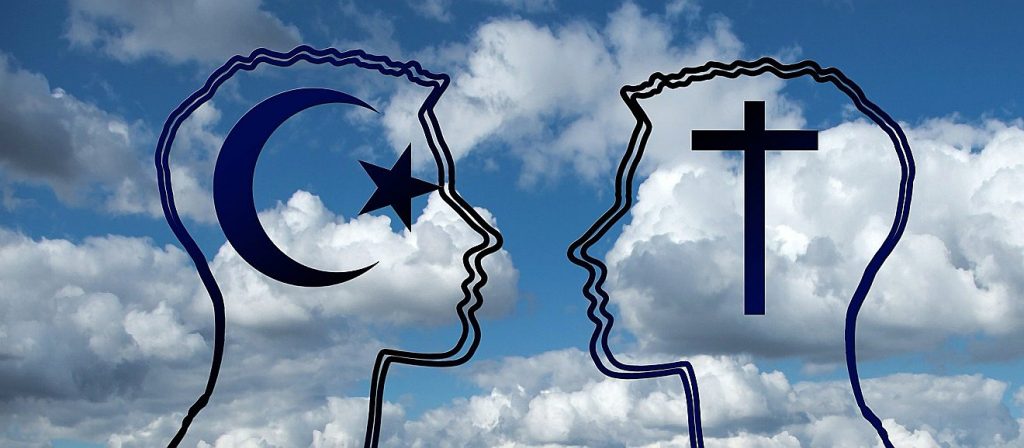
Inhalt dieses Kapitels
3.1.1 Der unterscheidende Blick auf „MmM“s und „MoM“s
3.1.2 Interkulturelle Kompetenz mit liebevoller Selbstironie
3.1.3 Hybridität und der „Dritte Stuhl“
3.1.4 Gemeinsames betonen, ohne Fremdes zum Verschwinden zu bringen
3.1.5 Kollektivismus und Individualismus
3.1.6 Interkulturelles Projekt: „Wo liegt das Türkisch-Land?“
3.2 Sprachen und Kulturen sichtbar machen
3.3 Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
3.3.1 Kulturalismus- und Rassismuserfahrungen im Kindergarten
3.3.2 Mehrsprachigkeit als Diskriminierungsgrund oder als zu fördernder Reichtum
3.3.3 Ein Seitenblick auf das Tabu-Thema „Regenbogenfamilien“
3.4 Ein Seitenblick auf die Integration von Menschen mit Behinderung
↑ 3.0 Begriffsklärungen
Nach der Beschäftigung mit dem Islam trete ich einen Schritt zurück, um allgemeine Rahmenbedingungen des interreligiösen Miteinanders zu betrachten. Die Probleme beginnen schon damit, dass es schwierig ist, Worte zu finden, die das angemessen beschreiben, was Menschen, die in derselben Gesellschaft miteinander leben, von ihrer Herkunft her unterscheidet und verbindet. Ähnlich wie sich im sozialen Bereich Begriffe für die finanzielle Unterstützung durch staatliche Stellen abgewechselt haben, weil sie als politisch nicht korrekt empfunden wurden – von der „Fürsorge“ (206) über die „Sozialhilfe“ bis hin zum „Arbeitslosengeld 2“ bzw. „Hartz IV“ – hat es auch für das erwünschte Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft ganz unterschiedliche Bezeichnungen gegeben. Im Bereich der Schule spricht man nicht mehr von „Ausländerpädagogik“, sondern vom „interkulturellen Lernen“ und neuerdings von „Migrationspädagogik“. Aus „Gastarbeitern“, die man allerdings kaum mit der Ehrerbietung behandelt hatte, die Gästen gewöhnlich zukommt, wurden, als sie im Land blieben, „ausländische Mitbürger“; im Zuge der Einbürgerung vieler Ausländer und der Einwanderung auch einer großen Zahl von Osteuropäern deutscher Abstammung schien es passender zu sein, von „Migranten“ zu reden. Die Eingliederung der vom Ausland ins Inland kommenden Menschen wurde zunächst unter dem Gesichtspunkt der „Integration“ betrachtet, der zum Beispiel auch für die gemeinsame Betreuung und Erziehung behinderter und nicht-behinderter Kinder im Kindergarten verwendet wird; auch dieser Begriff ist fragwürdig geworden, da er einen Aspekt der Anpassung von nicht der Normalität entsprechenden Menschen an eine fraglos vorausgesetzte Normalität enthält. Stattdessen benutzt man heute zunehmend den Begriff der „Inklusion“, um zu signalisieren, dass unterschiedliche Menschen in eine Gemeinschaft auf gleichberechtigter Basis ohne Benachteiligungen „eingeschlossen“ werden sollen. Aus diesen Überlegungen folgt: Es kommt weniger auf die Wahl eines bestimmten Begriffs an als auf die Klärung, was man mit den Worten, die man wählt, tatsächlich meint.
In diesem Kapitel werde ich vor allem zu klären versuchen, wie der Kulturbegriff und das „inter“ in „interkulturell“ oder „interreligiös“ zu verstehen ist. Auch der Begriff der „Inklusion“ taucht in mehreren Zusammenhängen auf: sowohl mit der „vorurteilsbewussten Erziehung“ als auch mit dem Seitenblick auf die „Integration von Menschen mit Behinderung“.
Interreligiöse Fragen können als eine Teilmenge der interkulturellen Thematik verstanden werden, aber was meinen wir eigentlich mit dem Begriff „interkulturell“? Wozu benutzen wir den Begriff „Kultur“? Was signalisieren wir, wenn wir die Vorsilbe „inter“ (lateinisch: „zwischen“) mit guten Absichten benutzen, um die Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Kultur oder Religion zu bezeichnen und zu verbessern?
Zur Komplexität des Kulturbegriffs zitiere ich einleitend eine erfahrene Psychologin und Leiterin einer sozialpädagogischen Einrichtung (207):
„Was den Kulturbegriff betrifft, finde ich interessant, dass in Deutschland unter multikulturell, interkulturell etc. meistens vor allem die Herkunft aus einem bestimmten Land gemeint ist. Vielleicht dicht gefolgt von Zugehörigkeit zu Religionsgruppen, die eher in anderen Ländern zu finden sind. In den USA habe ich dies anders erlebt. Sexuelle Identität, Geschlecht als solches, Behinderung, sozioökonomische Stellung etc. spielen dort eine ebenso wichtige Rolle, wenn es um den Kulturbegriff geht. Und ich finde, dass das auch sehr nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen ist. Für einige mögen einzelne Dinge viel wesentlicher sein als die Herkunft der Familie aus einem bestimmten Land. Auch die Verbindung von verschiedenen Zugehörigkeiten spielt bestimmt eine wichtige Rolle. Ein lesbisches Paar türkischer Herkunft fühlt sich vielleicht viel näher an anderen lesbischen Paaren als an Menschen, die heterosexuell sind, aber türkischer Herkunft. Kinder dieser Paare vielleicht ebenso oder eben auch ganz anders als die Eltern. Bei einem so weiten Kulturbegriff ist natürlich wieder die Gefahr da, dass er zu einem Begriff wird, der sich überwiegend darauf reduziert: ‚alle Menschen sind eben verschieden’. Eigentlich ist es ja genau das. Nur für die Forschung ist eine solche Beschreibung wiederum schwierig. Deshalb muss letztlich wieder darauf zurückgegriffen werden, einzelne Facetten von dem, was das Selbstverständnis eines Menschen und die Lebenserfahrungen durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ausmacht, herauszugreifen. Aber dabei finde ich es sehr wichtig, im Kopf zu haben, wie viele verschiedene Dinge die Lebenswelt eines Menschen in dieser Gesellschaft ausmachen. Und dass vielleicht die herausgegriffene Facette gar nicht die für den einzelnen Menschen relevante Facette ist. Für viele Kinder beschreibt meiner Ansicht nach die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Nicht-Getauften viel mehr die Gruppe der Kinder, deren Eltern nicht gut integriert sind, wenig Alltagskompetenz besitzen und sozioökonomisch deutlich schlechter gestellt sind als die meisten anderen. Und dass die ‚Nicht-Kirchenzugehörigkeit’ da eigentlich nur dranhängt, als solches aber viel weniger oder fast keine Bedeutung hat.“
Den Begriff „Interkultur“ in der Überschrift dieses Kapitels habe ich ausgeliehen vom Titel eines programmatischen Buches von Mark Terkessidis, auf das ich erst nach Abschluss des Studienurlaubs aufmerksam wurde und aus dem ich nur eine Leseprobe gelesen habe. Ich vermute, dass sich dieses Kunstwort kaum allgemein als politisch korrekt durchsetzen wird, aber gerade weil es sich gegen ein allzu vordergründiges und selbstverständliches sowieso-schon-Wissen-was-gemeint-ist, sperrt, eignet es sich sehr als Anregung zum Nachdenken über eine komplizierte Thematik:
„Der Begriff Kultur in Interkultur hat … keine primär ethnische Bedeutung – er bedeutet, etwa im Sinne der frühen Cultural Studies, ein übergreifendes Prinzip der Organisation. Nicht die Unterschiedlichkeit der Kulturen oder der gegenseitige Respekt stehen im Vordergrund – es heißt nicht Interkulturen, sondern Interkultur, also Kultur-im-Zwischen. Und das ist eine treffende Beschreibung für den Ausgangspunkt und den Prozess: Es geht um das Leben in einem uneindeutigen Zustand und die Gestaltung einer noch unklaren Zukunft. In diesem Sinne geht es bei dem Programm der Interkultur, das ich in diesem Buch entwerfe, nicht darum, bestehende oder unterstellte Unterschiede einfach zu respektieren. Es geht vielmehr um das Knüpfen neuer Beziehungen.“ (208)
↑ 3.1 Migrationspädagogik
Nicht nur Mark Terkessidis prägte für den Diskurs über interkulturelle Fragen den neuen Begriff der „Interkultur“, auch Paul Mecheril empfand die Bezeichnung seiner „Professur für Interkulturelles Lernen und Sozialen Wandel“ an der Fakultät für Bildungswissenschaften an der Universität Innsbruck als unzureichend und definierte beim Fortbildungstag zum Thema „Interkulturelle Bildung“ am 5. November 2010 im Zentrum Bildung in Darmstadt auch das Tagungsthema kurzerhand um: Statt um „interkulturelle Bildung“ gehe es ihm um „Migrationspädagogik“, also um Lernprozesse innerhalb einer Migrationsgesellschaft. Sein Anliegen war es weniger, bestimmte Inhalte zu lehren, als dazu anzuleiten, bestimmte Redeweisen und Unterscheidungsformen zu verlernen.
↑ 3.1.1 Der unterscheidende Blick auf „MmM“s und „MoM“s
Zum Beispiel wies Mecheril darauf hin, dass es eine Menge Studien über MmMs („Menschen mit Migrationshintergrund“) gibt. Man weiß inzwischen, dass es unter ihnen große Unterschiede gibt. Keine Studien gibt es dagegen über MoMs („Menschen ohne Migrationshintergrund“). Wird eine solche Unterscheidung vollzogen, baut man ein selbstverständliches „Wir“ auf, von dem „andere“, die nicht zum „Wir“ gehören, ab- und ausgegrenzt werden. Wenn ein Staatssekretär sagt: „Die meisten MmMs sind bereit, sich in die Gesellschaft einzufügen“, wird ein Unterschied zwischen Migranten und Gesellschaft konstruiert, als ob Migranten nicht Teil der Gesellschaft wären, was Paul Mecheril mit der sarkastischen Bemerkung kommentierte: „In manchen Stadtteilen oder Schulklassen ist kaum noch Gesellschaft vorhanden.“ (209)
Auch die scheinbar unschuldige Frage: „Woher kommst du?“ (210) wird in der Regel nur bestimmten Menschen gestellt, die von ihrem Äußeren her wie ein Migrant wirken. Die Frage ethnisiert den Menschen, konstruiert Fremdheit bzw. erinnert den Gefragten an seine Fremdheit und sein trauriges Gefühl: „Ich gehöre nicht hierher.“ Und zwar auch dann, wenn der MmM hier geboren und aufgewachsen ist und sein angebliches Heimatland noch nie gesehen hat. Die Frage „Wo kommst du her?“ impliziert zugleich die Frage: „Wo gehst du hin?“ und enthält mit der Zuschreibung „Du gehörst nicht fraglos dazu!“ einen versteckten (Kultur-)Rassismus (211).
Wie man positiv mit kulturethnischen Zuschreibungsfragen umgehen kann, zeigt ein Gespräch, in dem ein Kind im Grundschulalter die Hauptrolle spielt (Mutter und Sohn gestatteten mir, es hier zu veröffentlichen):
„Wir bekamen Besuch von einem Bekannten; wir unterhielten uns über Religionen, Kulturen; der fragte unseren Sohn (damals im Grundschulalter): ‚Was bist Du?‛
Liwan wollte es wohl ‚ganz richtig machen‛ und sagte: ‚Mein Papa hat den türkischen Pass, er ist aber Kurde, meine Mama hat die griechische Staatsangehörigkeit, ist aber Türkin, ich habe den türkischen und deutschen Pass……‛ Er wirkte etwas genervt und beendete es mit den Worten: ‚Das ist doch alles egal, ich bin der Liwan!!!‛
Unserer Meinung nach hat unser Sohn es auf den Punkt gebracht !!!“
Diese Überlegungen haben auch Folgen für den Begriff des Interkulturellen Lernens, nämlich dann, wenn durch ihn Differenzen als kulturelle Differenzen festgeschrieben werden. Eine Lehrerin, die es gut meinte, forderte die Kinder ihrer Schulklasse dazu auf, zu einem Interkulturellen Frühstück Spezialitäten aus ihrer Heimat mitzubringen und nötigte auf diese Weise ihre Familien dazu, sich als Ausländer zu inszenieren (ein Kind bringt also zum Beispiel Schafskäse und Oliven mit, obwohl die zu Hause sonst nie gegessen werden). Man darf nicht übersehen:
„Gerade die zweiten oder gar dritten Generationen von Migranten kennen die ihnen zugeschriebenen kulturellen Eigenheiten aus den Herkunftsländern ihrer Eltern oder Großeltern oft auch nur noch aus touristischen Erfahrungen. Es wird immer deutlicher, dass sich Kulturen verändern und soziale und gesellschaftliche Strukturen (Arbeitslosigkeit, Bildungsstand u. ä.) z. T. größeren Einfluss auf die Lebensgestaltungen der Menschen haben, als die über Generationen verblassende Herkunftskultur (212).
Was Paul Mecheril „Migrationspädagogik“ nennt, zu der notwendig eine Rassismus- und Diskriminierungskritik gehört, ist für ihn kein zusätzliches Projektthema, sondern eine Querschnittsaufgabe für alle pädagogischen Bereiche mit dem Bildungsziel der Handlungsfähigkeit in einer Migrationsgesellschaft. Seine „Einführung in die Migrationspädagogik“ empfehle ich als Pflichtlektüre jedem Pädagogen. Hinweisen möchte ich auf einige Einsichten, die ich dem Buch entnommen habe, zum Beispiel , dass es „Ethnizität“ erst in der Neuzeit als etwas gibt, auf dem Menschen ihre Identität aufbauen, nachdem „vormoderne“ religiöse Gewissheiten zerbrochen waren (213). Außerdem habe ich gelernt, was unter der Gefahr der „Kulturalisierung“ (214) zu verstehen ist:
„Sobald die Perspektive »kulturelle Differenz« eingeführt wird…, ist diese Perspektive mit der Gefahr verknüpft, … die Analyse der Verhältnisse zwischen sozialer Mehrheit und Minderheiten unangemessen einzuengen. … Die eingeschränkte Perspektive trägt zur Kulturalisierung sozialer Verhältnisse bei.“ (215)
„Die Affirmation der Wirklichkeit »kultureller Differenz« geht mit der Gefahr der Überbetonung dieses Differenzaspektes einher. Die Komplexität der Beschaffenheit des gesellschaftlichen Raumes, in dem Einzelne sich verorten und verortet werden, wird simplifiziert. Der Bezug auf »kulturelle Differenz« schafft ein einseitiges Bild, das von anderen Differenzlinien absieht“ (216) und „zur Stärkung der national-ethnischen Unterscheidung bei[trägt], im Zuge derer »Wir« und »Nicht-Wir«, gelegentlich in einer fraglosen Art und Weise, als Funktion national-ethnischer Zugehörigkeit begriffen wird.“ (217)
Aber: „Erst die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie in zeitgeschichtlicher, familialer und individueller Hinsicht klärt die erleichternden und erschwerenden Voraussetzungen der Bezugnahme auf natio-ethno-kulturelle Andere.“ (218)
Mecheril plädiert dafür, dass nicht nur „Wir“ sogenannte „Menschen mit Migrationshintergrund“, die wir als „Andere“ definieren, anerkennen und auf sie pädagogisch Einfluss nehmen, sondern dass wir bereit sind, „Migrationsandere als potenzielle Subjekte auch pädagogischen Tuns anzuerkennen und sichtbar werden zu lassen“ sowie – im Sinne einer „Befremdung des Eigenen“ – uns selbst „aus dem Blickwinkel eines Anderen als Anderer oder Andere wahrzunehmen“ und „das gewissermaßen Uneigene am Eigenen zur Kenntnis [zu] nehmen.“ (219)
↑ 3.1.2 Interkulturelle Kompetenz mit liebevoller Selbstironie
Kann man dennoch von „interkultureller Kompetenz“ reden? Mecheril meint: jeder
„institutionelle Ort…, an dem das pädagogische Handeln stattfindet[,] … kann auf seine »interkulturellen« Eigenschaften befragt werden: Sind Minderheitenangehörige in der Institution beschäftigt? In welcher Position? Welche Sprachen werden in der Institution formell und informell gesprochen? Besteht ein multilinguales Angebot? Richtet sich die institutionelle Öffentlichkeitsarbeit auch an Menschen mit Migrationshintergrund?“ (220)
„]Inhaltlich ist es nach Mecheril
„sinnvoll, nicht allein das Nicht-Verstehen, sondern die Verschränkung von Verstehen und Nicht-Verstehen als interkulturelle Perspektive zu betrachten.“ (221)
Wenn jeder Versuch, einen Anderen zu verstehen und seine Fremdheit zu beseitigen, Gefahr läuft, ihn zugleich an eigene Wahrnehmungsmöglichkeiten anzupassen und für das Eigene zu vereinnahmen, gibt es nur die Lösung, im Gespräch miteinander zu bleiben und gerade auch aus Fehlern zu lernen.
„In fehlerfreundlichen Zusammenhängen ist es möglich, aus nicht intendierten Ereignissen und Abweichungen von Erwartetem zu lernen.“ (222)
Gerade die äußerst komplexe Situation dessen, was man Interkulturalität in einer Migrationsgesellschaft nennen kann, muss also nicht zu einer Selbstüberforderung führen.
„Interkulturell ist eine Chiffre für die Undurchschaubarkeit und die Nicht-Vorhersehbarkeit von kommunikativen Situationen, für die Zerstörbarkeit der fraglosen Voraussetzungen des unbedachten wie des bedachten Handelns, für die Grenzen des Berechenbaren, Planbaren und Erwirkbaren.
Insofern erfordert Interkulturalität ein »schwaches Subjekt« und fordert ein Subjekt, das in der Lage ist, sich als schwaches zu verstehen und als schwaches zu zeigen, ohne sich dadurch aus der Verantwortung zum Handeln und aus der Verantwortung zur Auseinandersetzung mit dem und der Anderen zu verabschieden. An diesem Punkt ist es sinnvoll, Ironie und Selbstironie zu bedenken.“ (223)
„Selbstironie findet ihr Motiv nicht darin, dem Einwand anderer zuvorzukommen, sondern ist vielmehr um handlungsorientierende Einsichten bemüht und begleitet selbst dieses Bemühen selbstironisch, also durchaus liebevoll und freundlich. Es geht hier nicht um Spott, nicht um polemische Rhetorik, sondern um einen reflexiven Modus der Ernsthaftigkeit Dingen und sich selbst gegenüber, die in einer nicht voraussagbaren Weise Handeln ermöglicht. Selbstironie muss hier als Disposition verstanden werden, die Handlungsfähigkeit nicht aufhebt, sondern – weil sie aus Handlungszusammenhängen herauslugend in diese zurückverweist – die Lust zu handeln mobilisiert.“ (224)
Auf der genannten Tagung zitierte Mecheril außerdem Franz Hamburger, der bis September 2011 als Professor für Sozialpädogik an der Universität Mainz lehrte, mit dem Satz:
„Das Besondere der sozialen Arbeit mit Migrantinnen und Migranten besteht vor allem darin, das Allgemeine besonders gut zu können.“
Dieses Allgemeine ist aber kein von Differenzen bereinigtes Allgemeines. Interkulturelle Kompetenz ist also wichtig als eine allgemeine Kompetenz, die vorhandene Unterschiede wahrnimmt, aber nicht festschreibt. In einem Aufsatz plädiert Franz Hamburger wegen „der Bedeutung von Kulturen für Selbstdefinitionen von Menschen und Gesellschaften“ für ein „in kritischen Situationen“ angemessenes „interkulturelles Lernen“, das
„jedoch nicht dauerhaft institutionalisiert werden soll. Das Bewusstwerden eines gesellschaftlichen Wandels, von neuen Formen der religiösen und kulturellen Selbstdefinition, von erweiterten Bandbreiten gesellschaftlicher Toleranz und der Pluralisierung von Lebensformen macht situativ interkulturelles Lernen erforderlich.“ (225)
↑ 3.1.3 Hybridität und der „Dritte Stuhl“
Wichtig ist es auch, als normal wahrzunehmen, dass es in der Migrationsgesellschaft immer mehr Menschen mit einer gemischten Identität der Vielfalt gibt, die man auch „hybrid“ nennt. In einem „Essay über Hybridität“ beschreibt Paul Mecheril unter dem Titel „Politik der Unreinheit“ komplexe und widersprüchliche Zusammenhänge auf eine Weise, die mich fasziniert hat, obwohl ich Mühe hatte, den Gedankengängen zu folgen (226). Einleuchtend war für mich die Darstellung der Problematik, fremde Menschen in ihrer Andersartigkeit vollständig anzuerkennen:
„In jedem expliziten Modell der Anerkennung des Anderen finden sich Annahmen darüber, was ‚Wir‛ sind oder sein sollten. Jedes Anerkennungsmodell muss darüber Auskunft geben, was und wer anerkannt werden kann und nicht. Sobald Anerkennungsmodelle bemüht werden, um beispielsweise über Fragen des Multikulturalismus, der Regelung territorialer, kultureller oder politischer Aufnahme von Personen zu beratschlagen, die um diese Aufnahme ersuchen, werden Wir-Vorstellungen mobilisiert. Dies geschieht – um eine bildungsbürgerliche Gegenüberstellung zu bemühen – sowohl an den Stammtischen als auch in sozialwissenschaftlichen Debatten.
Erst der Regelungsbedarf, in dem die Frage des Zugangs zur Gemeinschaft thematisiert wird, macht es erforderlich, über formelle Kriterien des Zugangs nachzudenken und diese Kriterien zu explizieren. Sobald aber Kriterien angegeben werden, findet zweierlei statt: erstens erstarkt die homogenisierende Rede von Wir, und zweitens wird nunmehr die Grenze der wie auch immer gearteten Zumutung benannt und damit gefestigt. Jede Politik der Anerkennung kann folglich in dem Sinne als produktiv bezeichnet werden, dass sie die Grenze der Anerkennbarkeit benennt und durch diese Benennung die imaginäre Linie zieht, bis zu der wir noch von Wir sprechen können. Über diese Linie gehen wir nicht hinaus, weil wir dazu nicht willens, nicht bereit oder nicht in der Lage sind. Jede Anerkennungspolitik kann mithin nur Derivate ihrer selbst zulassen und achten.
Das radikal und tatsächlich Andere wird somit nicht einbezogen und kann auch gar nicht einbezogen werden. Es muss ausgeschlossen bleiben, weil ansonsten der Ort, von dem aus Anerkennung formuliert und praktisch wird, aufgegeben würde. Ist erst einmal die tatsächliche Grenze der Zumutung durch das Fremde, das Andere benannt, findet nicht ein Einbezug, sondern der Ausschluss des Anderen statt. Dies ist die unhintergehbare Voraussetzung jeder Anerkennungspolitik. Sie lässt allenfalls domestizierte Varianten des Anderen zu; diese werden – gerne von moralischen Gesten der Großzügigkeit untermalt – aufgenommen. ‚Muslimische Fundamentalisten‛ aber, ‚kriminelle Ausländer‛ oder wie auch immer die Konkretisierung des radikal Anderen im Diskurs des Multikulturalismus aussieht, müssen wie (latent wilde) Hunde, die den ordnungsgemäßen Ablauf in einem Fleischerladen gefährden, draußen bleiben.“ (227)
In einer anderen Untersuchung hatte Mecheril mit dem Begriff „Zugehörigkeitsmanagement“ angedeutet,
„dass Personen sich in verschiedenen Situationen zu unterschiedlichen Gruppen als zugehörig definieren. Zugehörigkeit ist somit kein Schicksal, sondern eine Entscheidung, die allerdings auch von (Nicht-) Zugehörigkeitserfahrungen abhängt, die eine Person in der Gesellschaft erlebt.“ (228)
Ein Mensch mit hybrider Identität kann nicht eindeutig sagen, wer er ist oder welcher Kultur er angehört. Das heißt aber nicht, dass er gar keine Identität hat. Es geht vielmehr um die Akzeptanz neuer Identitätsformen. Nora Räthzel schreibt dazu:
„Es wird behauptet, MigrantInnen würden zwischen den Kulturen aufwachsen und könnten deshalb keine eindeutige Identität entwickeln. Ihre Orientierungen seien diffus, sie seien zerrissen zwischen den entgegengesetzten Anforderungen der jeweiligen Kulturen, wüssten deshalb nicht, was sie wollten und wer sie eigentlich seien. Dagegen setzen MigrantInnen den Begriff der Hybridität, der die Position zwischen den Stühlen als eine der Stärke reklamiert.“ (229)
Im Kapitel 6.5 werde ich einen theologischen Ansatz von John M. Hull vorstellen, der die Angst vor kulturellem und religiösem „Mischmasch“ mit interreligiösem Mut überwindet.
Für Tarek Badawia wird aus dem unbequemen Platz zwischen den Stühlen in seiner Studie über bildungserfolgreiche Immigrantenjugendliche mit Lebensmittelpunkt in Deutschland der „Dritte Stuhl“ als eine angemessene „Metapher“, um die „Besonderheiten des Immigrantenstatus aus der individuellen Perspektive der Jugendlichen mit bikulturellem Selbstverständnis“ zu beschreiben. Ihm zufolge träumen diese „von einer neuen Kultur in neuen Lebensformen, die mehr als die Summe zweier Kulturen ist.“ Ihr Handeln im Alltag ist paradox angelegt: „Ich gehöre dazu und bin trotzdem anders“ und „Ich werde nicht integriert, sondern ich integriere mich selber“ (230). Eine 19-jährige Deutsch-Marokkanerin drückt das so aus:
„Also ich habe mich früher sehr damit auseinandergesetzt, wer ich eigentlich bin und wozu ich eigentlich gehöre und habe mich auch zeitweise versucht einfach nur der einen Kultur zu widmen und mir zu sagen, hey ich bin jetzt Marokkanerin oder der anderen Kultur, also dass ich jetzt einfach eine Deutsche bin und habe halt gemerkt, dass weder das Eine noch das Andere geht, weil ich weder zu der Einen noch zu der Anderen gehöre, das heißt, ich stehe irgendwo zwischendrin also zwischen zwei Stühlen, die mir aber nicht passen, irgendwie nicht für mich die Stühle, das habe ich mir damals immer gedacht, mittlerweile denke ich, ich sitze auf einem richtigen Stuhl, das ist so eine ganz andere Situation.“ (231)
Zur Metapher des „Dritten Stuhls“ führt Badawia weiter aus:
„Für den Einzelnen ist der ‚Dritte Stuhl‛ eine sinnvolle Orientierungsperspektive zur neuen Selbstbestimmung und Selbstverortung außerhalb der ‚Gefahrenzone‛ des zerreißenden ‚Zwischen den Kulturen‛. Kennzeichnend für die Wertorientierung bzw. moralische und motivationale Konsistenz des ‚Dritten Stuhls‛ sind die flexible Prinzipienorientierung, die Orientierung an individuellen Ressourcen und – ganz wichtig – der untergeordnete Stellenwert von ethno-nationalen Selbstidentifikationskriterien im Sinne der Relativierung solcher ‚Selbst‛-Rahmungen.
Der ‚Dritte Stuhl‛ ist auch eine Form der individuell gestalteten Bikulturalität, die einen sehr hohen Modernisierungsanspruch erhebt. In der Studie wurden vier Modelle der bikulturellen Identitätstransformation generiert…:
1. ‚Ich bin eine kulturelle Mischung‛ – Bikulturelle Identitätstransformation als Reflexion des Gegebenen;
2. ‚Dazu kommt eine Riesenkomponente‛ – Selbstverortung im transkulturellen Überbau;
3. ‚Weder noch und trotzdem beides‛ – Identitätstransformation als bikulturelle Kompromisssuche;
4. ‚Ich möchte die deutschen Tugenden darin einsetzen als Iraner‛ – Bikulturelle Identitätstransformation als Implementierung von Neuem.“ (232)
↑ 3.1.4 Gemeinsames betonen, ohne Fremdes zum Verschwinden zu bringen
Auch einige andere Autoren möchte ich im Blick auf interkulturelle Konfliktfelder kurz zu Wort kommen lassen. Andreas Feindt und Matthias Spenn schreiben zum Thema „Kinder, Bildung und Migration“:
„Auf dem Hintergrund der Migration ist es … nur noch sehr eingeschränkt berechtigt, von einer religionslosen oder säkularisierten Gesellschaft in Deutschland zu sprechen. Diese Entwicklung ist elementar bedeutsam für Kindertageseinrichtungen und Schulen wie auch für alle anderen Akteure in der Arbeit mit Kindern und Familien.“ (233)
„Dabei ist allerdings auch die Frage zu berücksichtigen, inwiefern es sich bei der Kategorie »Migrationshintergrund« um eine gesellschaftliche Konstruktion handelt, die weniger bestehende Differenzen beschreibt als diese Differenzen erst mitkonstruiert.“ (234)
Eine „interkulturelle Pädagogik“ muss daher auch folgende Fragen im Blick behalten:
„Welche Themen sind sowohl für Kinder mit als auch ohne Migrationshintergrund relevant? Wo haben Kinder die gleichen Sorgen, Ängste und Beschränkungen? Wo teilen sie Freude, Geborgenheit und Zuversicht? Aus diesen Fragen ergeben sich Perspektiven für die Arbeit, die stärker das Gemeinsame der Kinder einer Gruppe in den Vordergrund stellen und weniger die Unterschiede immer wieder neu manifestieren.“ (235)
Astrid Messerschmidt plädiert wiederum mehr dafür,
„interreligiöse wie interkulturelle Bildung als Entgegensetzung zu verstehen, als dauernden Einspruch gegen das vermeintliche Wissen über den anderen. Es handelt sich um einen Ansatz, der sich gegen Entfremdung richtet, d. h. gegen die Tendenz, alles Fremde zum Verschwinden zu bringen und es zu beherrschen.“
Sie regt „Lernprozesse des Befremdens“ an, für die „Gegenstände“ wichtig sind,
„anhand derer es möglich wird, fremden Lebensverhältnissen und fremder Religiosität zu begegnen, ohne dass das Fremde sich als Projektionsfläche anbietet. Es bedarf erzählter Geschichten, die uns Vertrautes in den Fremdheiten dieser Welt und Fremdes in vertrauten Kontexten nahe bringen. Diese erzählten Geschichten können in Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen ein drittes Element im Dialog bilden, ein Material, das zu keinem gehört. Bildungsprozesse geraten dadurch in Bewegung.“ (236)
Wenn ich im Kindergarten den Kindern mit Hilfe von Zappi, Fischli und Jamal Geschichten erzähle (Kinder-Stuhlkreis), kann ich mir vorstellen, dies im Sinne eines solchen Vertrautheits-Fremdheits-Zusammenhanges zu tun.
↑ 3.1.5 Kollektivismus und Individualismus
Beispiele solcher „Lernprozesse des Befremdens“ im von Messerschmidt genannten Sinn konnte ich während meines Studienurlaubs bei einer einer Fortbildungsveranstaltung für Erzieherinnen mit Jean-Félix Belinga Belinga vom Zentrum Ökumene der EKHN erleben (237).
Im Rollenspiel „Das Leben auf Albatros“ wurde deutlich, welche Missverständnisse dadurch auftreten können, dass von „einer fremden Kultur … kaum mehr 10 Prozent sichtbar [sind]. Die unsichtbaren Werte, u. a. religiöse Werte liegen im Verborgenen.“ (238)
Ein weiteres Rollenspiel über die imaginären Völker „Majos“ und „Minos“, die sich unter von außen vorgegebenem Zeitdruck über ein gemeinsames Entwicklungsprojekt einigen sollten, brachte in den Vertragsverhandlungen die Teilnehmer/innen aus der Gruppe der sozusagen „westlich“ denkenden „Majos“ an den Rand der Verzweiflung, als sie mit der völlig anderen Denkweise der „Minos“ konfrontiert waren: ihnen war „Geld nicht wichtig“, stattdessem ging es ihnen um ganz andere Ziele: „Freundschaft und Liebe…, viel Zeit für alles, Schönheit der Insel zeigen, … vertrauensbildender Prozess (Kennenlernen), … die Hälfte des Geldes war genug, … gemeinsam teilen, Beziehungen müssen gepflegt werden“. Bei den „Minos“ auf der anderen Seite konnte die „Überheblichkeit“, die die „Majos“ ausstrahlten, als „rassistisches Denken“ ankommen und „sehr negative Gefühle hervorrufen. Auf der Suche nach Wegen, um die Ziele zu realisieren ist das Gespräch kaum möglich, solange man nur das eigene Denken als Ausgangspunkt benutzt. Weiterführende Strategien benötigen dringend das Einbeziehen der anderen Seite.“ (239)
Besonders aufschlussreich in dem Seminar war für mich die Gegenüberstellung von Grundzügen unterschiedlicher Denkweisen in eher traditionell und eher modern geprägten Gesellschaften unter den Stichworten „Kollektivismus und Individualismus“.
Während im Kollektivismus der einzelne Mensch in der Gruppe aufgeht und sich vor allem in Bezug auf sein Land, seine Religion und seine Großfamilie definiert, empfindet sich das Individuum im Individualismus als autonom und selbständig und seine Bezugsgruppen sind in erster Linie einzelne Menschen, vor allem Freunde und die Kleinfamilie. Aktivitäten müssen für Individualisten sinnvoll sein oder Spaß machen, während für im Kollektiv verankerte Menschen gemeinschaftliche Ereignisse und Feiern in der Gruppe von unhinterfragter Bedeutung sind. Die Führung, die im Kollektivismus wichtig ist, spielt im Individualismus eine untergeordnete Rolle. Entsprechend betonen Kollektivisten bzw. Individualisten bei ihrer Einstellung zu den anderen Menschen eher die vertikalen bzw. die horizontalen Beziehungen. Erstere sind auf Harmonie, auf die Bewahrung von Scham, auf den Schutz und das Zeigen von Ehre bedacht, Letztere sprechen bewusst Konflikte an und haben ein individuelles Konzept von Verantwortung und Schuld. Als wichtigste Werte gelten im Kollektivismus Alter, Geschlecht, Familie, Funktion, Beziehungen, Wahrung des Gesichts, gleiche Verteilung, während im Individualismus Freiheit, Verträge, Ehrlichkeit, Leistung (um sozialen Status zu erlangen) und Verteilung nach Leistung auf der Werteskala ganz oben stehen (240).
Macht man sich im Konfliktfall bewusst, ob diametral entgegengesetzten Verhaltens- und Sichtweisen derartige Haltungsunterschiede zu Grunde liegen, hat man einen Ansatzpunkt, um einander wenigstens besser zu verstehen, vielleicht sogar Lösungsmöglichkeiten für Meinungsverschiedenheiten zu finden. Man kann aber nicht neutral entscheiden, welche Haltung mehr oder weniger im Recht ist. Welche Werte gelten sollen, ob das Individuum oder die Gemeinschaft wichtiger genommen wird, muss letzten Endes von den in den jeweiligen Gemeinschaften zusammenlebenden Individuen entschieden werden, ist also unter den heutigen Bedingungen selbst ein konfliktgeladener Prozess.
Zu beachten ist außerdem, dass man diese Haltungen nicht pauschal bestimmten Ländern bzw. Volksgruppen oder religiösen Gemeinschaften zuordnen kann. So gibt es in traditionell-kollektivistisch geprägten Gesellschaften immer auch individualistisch denkende Menschen, die damit anecken; eine Modernisierung von oben wie zum Beispiel in der Türkei unter Kemal Atatürk ließ sich nicht bei allen Bewohnern des Landes durchsetzen; eine moderne Gesellschaft wie die deutsche war trotz Aufklärung und demokratischer Staatsverfassung anfällig für extrem kollektivistische totalitäre Ideologien. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Zuge des „Wirtschaftswunders“ und des durch die 68er-Bewegung forcierten „Traditionsabbruchs“ der Individualismus zur vorherrschenden, aber nicht ausschließlichen Haltung der Bevölkerung.
In der mittlerweile entstandenen global vernetzten Migrationsgesellschaft sind die Karten noch einmal völlig neu gemischt worden: zwar kann keine althergebrachte kollektivistische Tradition auf unhinterfragte Autorität pochen, aber auch der aufgeklärte säkulare Individualismus wird durch eine Vielzahl mit ihm und miteinander in hoffentlich friedlichen Wettbewerb tretender kultureller Traditionen in Frage gestellt.
Am Rande der Fortbildungsveranstaltung fiel mir eine Einzelheit auf, die ein bezeichnendes Licht auf das Thema „Inklusion“ und „Interreligion“ wirft. Die Seminarleitung ging offenbar selbstverständlich davon aus, dass an einem Seminar für Erzieherinnen von drei evangelischen Kindertageseinrichtungen nur Christinnen teilnehmen und leitete eine Arbeitsaufgabe folgendermaßen ein: „Die Religion als normative Instanz und Stütze ist in vielen Kulturen selbstverständlich. Besonders häufig ist dies in Gesellschaften zu beobachten, in denen der Islam eine wichtige Rolle spielt. Im Islam gibt es Elemente, an denen sich die Menschen im Alltag festhalten können. Die religiöse Praxis ist für die Muslime eine konkrete Stütze für den Alltag.“ Daraufhin wurden die Teilnehmenden, anknüpfend an die Fünf Säulen des Islam, nach der „Religion als Stütze in unserem christlichen Kontext“ gefragt und ihnen die „individuelle Aufgabe“ gestellt: „Gibt es im christlichen Glauben auch Elemente, die als Stützen für den Alltag wahrgenommen werden? Welche sind diese für uns?“ (241) Da ich wusste, dass eine muslimische Erzieherin aus unserem Kindergarten an der Veranstaltung teilnahm, konnte ich mir vorstellen, wie befremdend eine solche Anweisung bei ihr ankommen musste. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wurde sie durch diese Formulierung praktisch aus der Runde der christlichen Teilnehmerinnen ausgeschlossen; zweitens waren die fünf Säulen des Islam so pauschal als Stütze für den Alltag aller Muslime eingeführt worden, dass kein Raum blieb für Muslime, die ihren Glauben anders praktizieren, ohne auf alle diese Stützen zurückzugreifen. Die muslimische Erzieherin schrieb dann wie alle anderen die „Säulen“ ihres ganz persönlichen eigenen Glaubens auf, die inhaltlich nicht von den Vorstellungen der meisten christlichen Kolleginnen abwichen. Dieser Vorfall zeigte mir, wie wenig „wir“ manchmal darüber nachdenken, in welchen Zusammenhängen wir „wir“ sagen und wen wir damit als „nicht-wir“ ausschließen.
↑ 3.1.6 Interkulturelles Projekt: „Wo liegt das Türkisch-Land?“
Einen Einblick in praktische interkulturelle Arbeit ermöglichte mir die Erzieherin Gülhan Hasan mit dem Bericht über ihr interkulturelles Projekt „Wo liegt das Türkisch-Land?“ (242), das sie im Jahr 2006 als Anerkennungspraktikantin in einem Gießener Kindergarten durchführte. Wichtig ist ihr insbesondere die Einsicht:
„Interkulturelle Bildung und Erziehung kann eigentlich nicht durch ein Projekt vermittelt werden.
Es ist eine Haltung!
Ich sehe mein Projekt als einen Anstoß!“ (243)
Das heißt:
„Interkulturelles Lernen kann nicht in einzelne Themenvorschläge oder Aktionen verpackt werden nach dem Motto:
Unser nächstes Thema in der Tagesstätte ist interkulturelles Lernen.
So etwas kann man einmal durchführen und dann auch wieder abhaken. Die Fähigkeiten, die durch interkulturelles Lernen gefördert werden sollen, werden letztlich aber durch lebenslanges Lernen in vielfältigen Beziehungen erworben. Und dabei spielt der Alltag in Tageseinrichtungen eine wichtige Rolle, für die Kinder wie auch für die beteiligten Erwachsenen.“
Was in vorangegangenen Abschnitten theoretisch durchdacht wurde, setzt Gül Hasan in praktische Zielformulierungen für die Arbeit mit den Kindern um:
„Die Kinder sollen einen angemessenen Umgang mit der Befremdung entwickeln. Bei Kindern können unterschiedliche Reaktionen auf Unvertrautes beobachtet werden. Je nach Vorerfahrung gehen die einen sehr unbefangen um mit allem, was neu und unbekannt für sie ist. Andere reagieren mit Ablehnung, Abwehr und Unsicherheit. Es ist wichtig, solche Verhaltensweisen nicht mit dem moralischen Zeigefinger zu bewerten, weil damit nur die Abwehr verstärkt wird. Im Gegenteil muss darauf geachtet werden, dass Kinder Worte finden für das, was ihnen seltsam vorkommt und was sie irritiert.
Ein Leitziel des Interkulturellen Lernens ist, eine Grundlage für tolerante Lebensweisen zu erwerben. Toleranz sollte nicht als eine Haltung (miss-)verstanden werden, die kritiklos alles als möglich akzeptiert. Denn dann müsste jeder Widerspruch gegen eine geäußerte Meinung oder jede Nachfrage nach einer gezeigten Verhaltensweise schon als Zeichen von Intoleranz gewertet werden. Eine so verstandene Toleranz wäre aber eher ein Zeichen von Gleichgültigkeit als von echtem Interesse. In der multikulturellen Gesellschaft ist Toleranz sicher wesentlich mehr als das Akzeptieren unterschiedlicher Lebensformen. Es sollte eine Haltung der Toleranz angestrebt werden, die Eigenes wie Anderes ernst nimmt und die sich auf Konflikte einlässt mit dem Ziel, sie nicht hierarchisch, sondern partnerschaftlich zu lösen.“ (244)
Mit einer Reihe von Aktionen von der „Geschichte meines Namens“ über die Betrachtung von Bilderbüchern zum Thema „Anders sein“ bis hin zur „Kinder-Weltkarte“ wurden diese Ziele in die Tat umgesetzt. Die Frage „Wie leben, wohnen ausländische Menschen?“ wurde nicht nur in einem Stuhlkreis thematisiert, sondern konkret erfahrbar, indem die Erzieherin, die selber einen Migrationshintergrund hat, die Kinder einmal zu sich nach Hause einlud (245).
Aus dem Projekt ergaben sich kleine nachhaltige Veränderungen in der Haltung vieler Kinder und im alltäglichen Zusammenleben in der Kita.
„Während der gesamten Projektzeit haben sich ‚kleine Aktionen‛ entwickelt, die weder von den Kindern noch von mir geplant waren. Es haben sich interessante Auswirkungen gezeigt. Nach unserer ersten Aktion Die Geschichte meines Namens haben die Kinder bei jeder Gelegenheit die Bedeutung ihrer Namen genannt.“
Unter anderem kam es immer wieder zu Gesprächen über interkulturelle Themen, wie zum Beispiel, dass Schwarzhaarige nicht nur aus Italien, sondern auch aus der Türkei stammen können, oder „dass nicht alle Menschen aus Brasilien schwarz“ sind. Zu diesem Thema fragte die Erzieherin noch einmal nach: „Sind diese Menschen wirklich schwarz?“, und ein Kind sagte nachdenklich: „Stimmt, Güli, eigentlich sind die ja braun!“ Es gab noch viele weitere Auswirkungen des Projekts, zum Beispiel, dass die Weltkarte im Gruppenraum immer wieder Interesse findet, ein Flaggen-Puzzle zu Gesprächen über Länder und Flaggen Anlass bietet, eine Weltkugel gebastelt, ein interkulturelles Sommerfest geplant und Vorurteile abgebaut wurden (246).
Am wichtigsten ist für Gülhan Hasan der Aufbau „einer Kommunikationsfähigkeit“ sowohl unter den Kindergartenkindern als auch zwischen dem Kita-Team und den Eltern, um gegenseitiges Verständnis aufzubauen und Konflikte zu lösen. An einem Beispiel verdeutlicht sie, was sie damit meint:
„Durch Erzählungen meiner Kolleginnen habe ich erfahren, dass früher mehr ausländische Kinder in der Einrichtung gewesen waren. Als ich fragte, wieso das jetzt nicht mehr der Fall wäre, erzählten sie, dass es Probleme mit den Kindern bzw. mit deren Eltern gegeben hätte. Um nur ein Beispiel zu nennen: Diese Eltern hätten nicht gewollt, das ihre Kinder im Sommer nackt im Garten spielen. Dieser Konflikt konnte wohl nicht gelöst werden.“
Ihrer Einschätzung nach wurde
„in der Einrichtung zu wenig auf den Bereich der Kommunikation eingegangen… Wie ich schon erwähnt hatte, wird kein Stuhlkreis o. ä. durchgeführt. Die Kinder bekommen wenige Gelegenheiten angeboten, um zu kommunizieren. Mir ist aufgefallen, das die Kinder, mit denen ich unseren Erzählkreis durchführe, eine bessere Kommunikationsfähigkeit besitzen.
Kommunikation ist die Basis für ein Zusammenleben und für Konfliktlösungen.“ (247)
↑ 3.2 Sprachen und Kulturen sichtbar machen
Als Einführung in die „Interkulturelle Arbeit mit Kleinstkindern“ ist ein von Susanne Viernickel und Petra Völkel herausgegebenes Buch, das „Sprachen und Kulturen sichtbar machen“ will, sehr gut geeignet. Es enthält Informationen über Zusammenhänge zwischen „Migration und Pädagogik“ (248) und leitet zum Umgang mit sozialer Wahrnehmung und Vorurteilen an:
„Bei der ‚Sozialen Wahrnehmung‛ gehen wir … von äußerlichen Merkmalen aus und schließen von diesen Merkmalen auf andere Eigenschaften, die mit diesen Merkmalen zunächst nichts zu tun haben. …
Im Gegensatz zur ‚Sozialen Wahrnehmung‛ dienen Vorurteile nicht der Orientierung, sondern stellen ein Zerrbild der Realität dar“ (249).
Der Kultur-Begriff wird in diesem Buch mit Hilfe des „Eisberg-Modells“ definiert:
„Während Natur bzw. natürlich alles das ist, was ohne unser Zutun zustande kommt, sind kulturelle Erzeugnisse alle Dinge, die vom Menschen erschaffen wurden und werden. Hierzu gehören ‚hochkulturelle Erzeugnisse‛ in Kunst, Literatur, Architektur ebenso wie Kleidung, Essgewohnheiten, Arbeitsverhalten, aber auch religiöse oder politische Systeme. All diese unterschiedlichen Dinge werden als Kulturstandards bezeichnet. Bei den Kulturstandards unterscheidet man wiederum sichtbare und nichtsichtbare Standards. Sichtbare wären z. B. die Kleidung (Jeans, Kopftuch usw.). Nicht-Sichtbare wären Normen, Werte, Einstellungen (z. B. Einstellung zum Geschlechterrollenverhältnis, aber auch der Musikgeschmack). Um die Vielzahl von Kulturstandards in einen Zusammenhang zu bringen, eignet sich das Modell des Eisbergs.
Wie in der Geschichte der Seefahrt schmerzlich deutlich geworden ist, ragt nur ein kleiner Teil des Eisbergs aus dem Wasser, ist also an der Oberfläche sichtbar. Der größte Teil des Eisbergs ist hingegen unter Wasser und somit in der Tiefe des Meeres nicht sichtbar. Ebenso verhält es sich mit kulturellen Erzeugnissen. So können wir Bekleidungsstücke, bestimmte Essgewohnheiten oder zum Beispiel Rituale sehen. Was wir nicht sehen können, sind die darunter liegenden Hintergründe, Ursachen und Bedeutungen. Dies nicht zu beachten hieße in Gefahr zu geraten, in der interkulturellen Situation ‚Schiffbruch zu erleiden‛.“ (250)
Als „Ausgangspunkt für den Erwerb interkultureller Kompetenz“ gehen die Autorinnen von einem „generell vorhandenen Kulturzentrismus“ aus, das heißt:
„Wir alle halten unsere eigenen Regeln, unsere Kulturstandards für die ‚normalen‛. Dies gilt aber auch für Menschen, die andere Standards haben. Um den eigenen Kulturzentrismus bewusst zu machen, müssen wir versuchen, unsere eigene ‚kulturelle Brille‛ einmal abzunehmen. Dieser Prozess ist schwierig und oftmals geradezu schmerzhaft. Schließlich machen unsere Kulturstandards unsere Persönlichkeit ganz wesentlich aus. All dies in seiner Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen, also sich vorzustellen, dass Dinge aus einer anderen Perspektive auch anders aussehen und wirken können, kann durchaus auf Widerstände stoßen. Andererseits ist Empathie, also die Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen, eine wesentliche Schlüsselkompetenz für pädagogisch Handelnde, was auch auf die kulturelle Ebene übertragen werden sollte. Ein weiterer Schritt zu interkultureller Kompetenz, also zur Fähigkeit konstruktiv mit Fremdheit umzugehen, könnte darin liegen, einmal eine andere ‚kulturelle Brille‛ aufzusetzen und die Welt mit den Augen einer fremden Kultur zu sehen. Es geht also um die Fähigkeit der Perspektivübernahme. Hierdurch kann sich unsere bisher selbstverständliche Perspektive erweitern. Man könnte auch sagen: Durch Spiegelung in einer anderen ,kulturellen Brille‛ wird unsere eigene ‚kulturelle Brille‛ sichtbar.“ (251)
Das Buch enthält außerdem konkrete Vorschläge zur „vorurteilsbewussten Erziehung“ mit Kinder bis zum Alter von 3 Jahren mit den vier Zielsetzungen
„Ich- und Bezugsgruppen-Identität stärken“,
„Vielfalt kennen lernen und Empathie entwickeln“,
„Einseitigkeiten thematisieren u. kritisieren“ und
„Diskriminierung aktiv widersprechen“ (252)
sowie der Empfehlung, mit „Persona Dolls“ zu arbeiten, „um Vorurteilsbildung oder negative Gefühle und Einstellungen, z. B. gegenüber Kindern, die anders sind als sie selbst, zu verhindern.“ (253)
„Für das Anknüpfen an die Lebenswelt der Kinder bietet das Anne-Frank-Zentrum im Rahmen sogenannter ‚Interkultureller Lernhilfen‛ ein Lernpaket mit sogenannten Kniebüchern an. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten von zwölf Kindern aus unterschiedlichen Ländern. … Im Sinne des Ansatzes ‚Vorurteilsbewusster Erziehung‛ werden Kinder hierdurch eingeladen, Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten zu suchen. … Außerdem bietet es weiterreichende Ideen für die Arbeit im Hinblick auf Sprachförderung an.“ (254)
Besonders eingehend beschäftigt sich das Buch mit „Sprachlernprozessen in Anlehnung an den situationsbezogenen Ansatz“ (255). Zur „Sprachentwicklung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache“ (256) wird
„zusammenfassend festgehalten…:
• Kinder haben generell von Geburt an die Fähigkeit, die Sprache zu lernen, ohne dass hier eine spezielle Förderung notwendig wäre.
• Auch das Erlernen einer zweiten Sprache, wenn diese in der Umgebung des Kindes gesprochen wird, ist generell unproblematisch.
• Zweisprachigkeit ist weltweit gesehen eher die Regel als eine Ausnahme.
• Wichtig für den gesamten Entwicklungsprozess ist die soziale Zuwendung.
• Ein guter Erstspracherwerb ist wesentlich für einen guten Zweitspracherwerb.
• Wichtig ist immer, den Erstspracherwerb zu fördern, bzw. die Erst- bzw. Herkunftssprache wertzuschätzen.
• Eltern sollte immer deutlich gemacht werden, dass sie mit ihren Kindern die Sprache sprechen sollten, die sie selbst am besten beherrschen (also die Herkunftssprache der Familien).
• Das Prinzip „Eine Person – Eine Sprache“ hat sich in der Praxis bewährt.
• Weisen Sie Kinder nicht auf Fehler hin, sondern sprechen Sie Sätze grammatikalisch korrekt nach.
• Seien Sie generell Sprachvorbild (benutzen Sie z. B. keine grammatikalisch unvollständigen Sätze).“ (257)
Für die Eingewöhnungsphase
„unter der Voraussetzung der nichtdeutschen Herkunftssprachen … kann es von besonderer Bedeutung sein, wenn Sie als pädagogische Fachkraft in der Lage sind, einige einfache, aber wichtige Sätze in der Familiensprache mit dem Kind zu sprechen.“
Zu diesem Zweck enthält das Buch aus dem „Förderprogramm ‚Sprachförderkoffer‛ … die folgenden zehn ‚Brückensätze‛ … in zehn wichtigen Sprachen…
1. Ich heiße… . Wie heißt du?
2. Guten Tag. Guten Morgen.
3. Auf Wiedersehen. Bis Morgen.
4. Deine Mutter kommt bald, um dich abzuholen.
5. Was hast du? Was ist los? Warum weinst du?
6. Musst du auf die Toilette?
7. Möchtest du mitspielen?
8. Kann ich dir helfen?
9. Zeig mir bitte, was du möchtest.
10. Kannst du das bitte auf Deutsch (in meiner Sprache) sagen, ich verstehe dich sonst nicht.
Bezüglich der Aussprache ist es sicherlich hilfreich die Eltern zu befragen. So wird gleichzeitig Wertschätzung und Interesse gegenüber der Herkunftssprache signalisiert und die Eltern in die pädagogische Arbeit miteinbezogen.“ (258)
Das Kapitel über die „Interkulturelle Zusammenarbeit mit Eltern“ enthält viele konkrete Vorschläge, von der Erstellung einer Situationsanalyse und einer Familienkartei bis hin zu Elterngesprächen über Themen wie „erste Trennung“, „Sauberkeit“, „aggressives Verhalten“ und „Grenzen setzen“ (259).
↑ 3.3 Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung (260)
Weitere Einblicke in die „Grundlagen einer vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung“ in Einrichtungen für Kinder eröffnete mir das „Handbuch Kinderwelten“ über Erfahrungen in dem gleichnamigen Berliner Projekt. Dieses Konzept basiert auf dem in Amerika entwickelten „Anti-Bias“-Ansatz gegen Einseitigkeiten und Diskriminierung; das Wort „bias“ bedeutet dabei „Vorurteil“, „Parteilichkeit“ oder „Befangenheit“.
Louise Derman-Sparks als Initiatorin dieses Ansatzes umschreibt im „Handbuch Kinderwelten“ die vier bereits im vorigen Abschnitt genannten Ziele vorurteilsbewusster Erziehung, „in denen die Erwartungen beschrieben werden, die Kindern im Kindergarten ermöglicht werden sollen:
Ziel 1: Jedes Kind drückt Selbstbewusstsein und Zutrauen in sich selbst aus, es zeigt Stolz auf seine Familie und positive Identifikationen mit seinen Bezugsgruppen.
Ziel 2: Jedes Kind zeigt Freude und Behagen gegenüber Unterschieden zwischen Menschen, spricht darüber in einer sachlich korrekten Sprache und pflegt innige und fürsorgliche Beziehungen zu anderen Menschen.
Ziel 3: Jedes Kind erkennt unfaire Äußerungen und Handlungen immer besser, verfügt zunehmend über Worte, um sie zu beschreiben und versteht, dass sie verletzen.
Ziel 4: Jedes Kind zeigt Handlungsfähigkeit, sich alleine oder mit anderen gegen Vorurteile und/oder diskriminierende Handlungen zur Wehr zu setzen.“ (261)
Petra Wagner formuliert im Blick auf eine vorurteilsbewusste Erziehung im Kindergarten „für die pädagogischen Fachkräfte folgende Ziele…:
• sich seines eigenen kulturellen Hintergrunds bewusst werden
• unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und Kommunikationsstile von Menschen in Erfahrung bringen können
• Einseitigkeiten und Diskriminierung aufdecken – in der eigenen Arbeit, in konzeptionellen Ansätzen und im System der frühen Bildung
• Dialoge über Einseitigkeiten und Diskriminierung initiieren und gemeinsam mit anderen auf Veränderungen hinwirken“ (262).
Speziell fand ich in ihrem Aufsatz wertvolle Anregungen, um mit alltäglichem Ärger umzugehen:
„Zweifellos ist es unangenehm oder leidvoll, von anderen schlecht behandelt zu werden. Aber nicht jede schlechte Behandlung ist eine Diskriminierung. Dennoch muss für das Leiden an jedweder Form schlechter Behandlung oder Abwertung Raum sein; es muss anerkannt werden, dass so etwas unschön und belastend ist und es muss als solches benannt werden: Wenn zum Beispiel Eltern sich gegenüber Erzieherinnen unhöflich, respektlos oder abwertend verhalten, muss über diese Erfahrungen und Gefühle gesprochen werden. Sobald man dazu in der Lage ist, sollte das Gespräch mit den Eltern gesucht werden. Tut man es nicht, so wird die ungute Erfahrung zu Groll und Bitterkeit, die jede weitere Kommunikation und Verständigung erschwert. Im Handumdrehen befindet man sich in einem »Teufelskreis des Leidens«. Weil kein Raum da ist für die eigenen Leidenserfahrungen, gesteht man es auch anderen nicht zu, über ihre Leiden zu sprechen. Man verweigert gerade das Mitgefühl und die Hilfe, die man selbst braucht und nicht bekommt.“
Petra Wagner macht auch einen konkreten Vorschlag, um mit solchen belastenden Ereignissen umzugehen:
„Eine Anregung ist, Vorkommnisse aufschreiben, in denen man sich über Eltern ärgert oder durch eine Äußerung verletzt ist. »Beschreiben statt zuschreiben« hilft, die Interpretationen zu trennen von der Schilderung dessen, was geschehen ist.“ (263)
Regine Schallenberg-Diekmann steuert für das „Handbuch Kinderwelten“ Erfahrungen aus dem „europäischen Netzwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training)“ bei, das „pädagogische Ansätze“ unterstützt, „die für Inklusion und gegen Exklusion arbeiten.“ Die Überschrift ihres Artikels „Europäische Zusammenarbeit für Vielfalt und Gleichwürdigkeit“ enthält das Kunstwort „Gleichwürdigkeit“, mit dem sie den englischen Begriff „equity“ übersetzt; er „drückt aus, dass es um gleiche Rechte bei unterschiedlichen Voraussetzungen geht“ (264). Die beiden folgenden Abschnitte fand ich erwähnenswert:
„Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Fokusgruppen der DECET-Arbeitsgruppe wurden danach gefragt, was bei ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit auslöst. Sie gaben viele Beispiele – »Kleinigkeiten« – und dennoch so wichtig: »ein zugewandtes Lächeln; die tägliche freundliche Begrüßung; die genaue Kenntnis dessen, was in der Einrichtung im Zusammenleben passiert; dass die Erzieherinnen und Erzieher den Namen des Kindes und auch der Eltern wissen und sich um korrekte Aussprache bemühen; dass wahrgenommen wird, wenn jemand etwas auf dem Herzen hat; dass niemand das Gefühl haben muss, zu stören; dass die jeweils eigene Schrift und Sprache Raum finden; dass es in der Einrichtung Spuren der Familien gibt, Fotos, Bilder, mitgebrachte Gegenstände …« So äußerte ein Mädchen mit einem deutschen Vornamen und einem türkischen Familiennamen: »Ich bin so froh, dass Anette, die Erzieherin, weiß, dass ich zwei Namen habe – einen von meiner Mutter und einen von meinem Vater!«“ (265)
„Die Schilderung einer Mutter zeigt, wie bestärkend die selbstverständliche Repräsentanz aller Familien in der Kindertageseinrichtung für Kinder und Eltern sein kann: »Bei meinem ersten Besuch in der Kindertageseinrichtung nahm mich der dreijährige Jusuf mit zur Familienwand. Er lud mich ein, mich hinzusetzen und zeigte mir mit großem Stolz seine ganze Familie: Eltern, Onkel, Tanten, Großmutter, Schwestern und Bruder, mit denen er eng zusammenwohnt. Ich malte mir aus, wie meine eigene Tochter ihre Familie vorstellt, wenn sie erstmal in seinem Alter ist.«“ (266)
In dem einzigen Aufsatz zum Thema „Religion“ im „Handbuch Kinderwelten“ fragt Christa Dommel, ob Religion eher ein „Diskriminierungsgrund“ oder eine „kulturelle Ressource für Kinder“ im Kindergarten ist (267).
Sie plädiert für „das Abschiednehmen von einer Kultur des Rechthabens, die »die Wahrheit« als Besitz der jeweils eigenen Religionsgemeinschaft betrachtet – aber auch von der Anmaßung, alle religiös Gläubigen als »irrational« zu belächeln.“ (268)
Auf ihren Ansatz der Religions-Bildung im Kindergarten werde ich im Kapitel 7 ausführlich eingehen.
↑ 3.3.1 Kulturalismus- und Rassismuserfahrungen im Kindergarten
Zum Stichwort „Kulturalismus“ allgemein ist oben im Abschnitt 3.1.1 über Migrationspädagogik bereits einiges gesagt worden.
Anke Krause geht in ihrem Aufsatz speziell auf „Herkunftsfragen“ im Kindergarten ein:
„Ethnisch-nationale Herkunft ist kein wertfreier und neutraler Aspekt von Vielfalt. Er ist eingebettet in Vorstellungen von »Wir« und »den Anderen«, in Diskurse der Zugehörigkeit, der Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen, Wertschätzung und Anerkennung. Die Beschäftigung mit dem Thema kann nicht aus der Angst heraus vermieden werden, man könnte etwas Falsches sagen, tun oder vermitteln. Vielmehr heißt es, die vielfältigen Zugehörigkeiten respektvoll und im Bewusstsein der ungleichen Bewertungen von Unterschieden zu erkunden.“
An Hand eines typischen Beispiels zeigt sie, was man anders machen kann als bisher:
„Im Eingangsbereich der Kita hängt eine Weltkarte. Eine dieser Weltkarten, die wir überall in Einrichtungen für Kinder finden: Die Native American Indians werden als »Indianer« in Lendenschurz und mit Feder im Haar abgebildet, in Afrika steht ein kleiner Mensch mit Bastrock vor einer Rundhütte. Um die Weltkarte herum sind Fotos der Kinder aus der Kita angebracht. Von jedem Foto aus führt ein Bindfaden zum jeweiligen »Heimatland« des Kindes. Die Vielfalt der Kulturen soll auf diese Weise sichtbar gemacht werden. Gut gemeint? Bestimmt, aber die meisten der Kinder sind in Berlin geboren. Wie wird diese Zugehörigkeit gesehen und sichtbar gemacht? Wie wird sie durch diese Art der Darstellung ausgeblendet? Nach Diskussionen im Team, mit den Kindern und Eltern wird die Karte umgestaltet: Jetzt führen die Bindfäden von den Fotos zu Orten auf der Landkarte, zu denen für die einzelnen Kinder wichtige Bezüge bestehen: nach Trabzon, wo die Großeltern eines Kindes leben; nach Alicante, wohin die Familie eines Kindes seit vier Jahren in die Sommerferien fährt; nach Köln, wo der beste Freund eines Kindes hingezogen ist; nach Berlin, wo der Lebensmittelpunkt der Familien und Kinder ist. Die stereotypen Bilder, die Kinder in den Ländern der Welt repräsentieren sollten, werden überklebt. Stattdessen sammeln Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Eltern Bilder, die die Vielfalt des Lebens in den Ländern widerspiegeln und gestalten aus ihnen eine »reale« Weltkarte.“ (269)
Weitere Anregungen folgen:
„Eine Reihe von Erkundungen in der Kindertageseinrichtung und darüber hinaus schließen sich an: Was heißt es, deutsch, türkisch, angolanisch, US-amerikanisch, thailändisch oder russisch zu sein? Welche Bilder gibt es, welche Stereotypen, welche Erzählungen? Welche Bewertungen? Was ist daran unfair? Stimmen die Aussagen? Woher stammen die Informationen über Menschen, die sich von einem selbst unterscheiden? Die Fragen und Antworten auf der Suche nach Vielfalt hören nie auf – ähnlich einem Kieselstein, den man in den Teich wirft, und der immer weitere Kreise zieht.“ (270)
Stefani Boldaz-Hahn schreibt über „Rassismuserfahrungen im Kindergarten“ und meint damit Erfahrungen wie die folgende:
„Hat ein Kind in seiner Kindergruppe zum Beispiel als einziges eine dunkle Hautfarbe, wird es diesen Unterschied wahrnehmen, auch wenn er von der Erzieherin nicht direkt thematisiert wird. Dies geschieht zunächst einmal ohne weitere Bewertung, ist aber häufig mit Fragen verbunden – wie: »Warum habe ich eine dunkle Hautfarbe und die anderen Kinder nicht?«
Hat ein Kind hingegen eine helle Hautfarbe und sieht sich in der Kindertageseinrichtung in der Mehrheit, so fühlt es sich in seinem äußeren Merkmal bestätigt und wird seine eigene Hautfarbe nicht unbedingt thematisieren oder gar in Frage stellen. Es kann dann sogar im Kontakt zu dunkelhäutigen Kindern in seiner Erfahrung bestärkt werden, zur weißen dominanten Mehrheit zu gehören“ (271).
Es gibt vielfältige Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung, die zum Teil auch ungewollt und unbewusst ablaufen. Ein Beispiel ist die rassistische Botschaft, die allein mit der Zuschreibung einer bestimmten Hautfarbe zusammenhängt, selbst die scheinbar neutrale „Bezeichnung »farbig« suggeriert beispielsweise, dass nur Menschen dunkler Hautfarbe »Farbe« in der Haut haben und hellhäutige Menschen nicht“ (272). Als Alternative empfiehlt Boldaz-Hahn:
„Im Gespräch mit Kindern ist es wichtig, freundliche oder neutrale Bezeichnungen für die unterschiedlichsten Brauntöne von Hautfarben zu finden: wie z. B. »goldbraun«, »hell-, mittel- oder dunkelbraun«. In der konkreten Praxis mit Kindern wird der kompetente Umgang mit Hautfarben jedoch eine Herausforderung bleiben. Neben einer neutralen und respektvollen Bezeichnung von Hautfarben sind weitere Reflexionen entscheidend, um zu einer diskriminierungsbewussten pädagogischen Praxis zu kommen: Wie bewertet man selbst Hautfarben? Wie nimmt man den sozialen Umgang damit wahr? Wie kann man eingreifen? Und warum tut man es nicht immer?“ (273)
Das Buch von Heidi Rösch, „Jim Knopf ist nicht schwarz“, empfehle ich ergänzend zur Lektüre. Im Abschnitt „Die Ohrfeige für Mustafa – Ethnisierungen aufbrechen“ (274) schildert sie die Lösung eines Konflikts zwischen einer Lehrerin und einem türkischen Jungen:
„Unsere Schwierigkeiten hatten offensichtlich die gleichen Hintergründe und waren Ausdruck ethnizistischen Denkens: So wie Mustafa für mich ‚türkisches Männerverhalten‛ repräsentierte, repräsentierte ich für ihn ‚deutsches Lehrerinnenverhalten‛.“ (275)
Und unter der Überschrift „‚Alek ist ein blöder Pole!‛ – Antirassismus-Versuche“ (276) zeigt sie, „wie wichtig und wie schwierig Gespräche über Fremdenfeindlichkeit sind und dass sie auch bereits mit kleinen Kindern möglich und notwendig sind“ (277).
↑ 3.3.2 Mehrsprachigkeit als Diskriminierungsgrund oder als zu fördernder Reichtum
Besondere Beachtung verdient eine Diskriminierung, die Petra Wagner mit einem Begriff von Robert Phillipson „Linguizismus“ nennt und die mit der Sprache oder den Sprachen zu tun hat, die jemand spricht:
„Linguizismus nennt man die Ideologie von der Höherwertigkeit bestimmter Sprachen, die Sprecherinnen und Sprecher dieser Sprache privilegieren bzw. Sprecherinnen und Sprecher anderer Sprachen benachteiligen. Ähnlich wie Sexismus, Rassismus usw. rechtfertigt der Linguizismus die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen, hier mit Verweis auf die Dominanz bestimmter Sprachen. Unzählige Beispiele ließen sich anführen, die auf Linguizismus in Deutschland hinweisen, z. B. in der selbstverständlichen Gleichsetzung von deutscher Sprache und Sprache allgemein: Da heißt es »Sprachförderung« statt »Deutschförderung«, »Sprachproblem« statt »geringe Deutschkenntnisse«. Wer Deutsch kann, gilt als »integrationswillig« – unwillig sind die, die kein Deutsch sprechen und sich in »Parallelwelten« flüchten.“ (278)
Nach einer Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts erleben mehrsprachige Kinder im Alter von 4 bis 10 „ihre Mehrsprachigkeit als eine Sonderkompetenz mit »unsicherem Wert«…, denn sie kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Die mehrsprachigen Kinder haben Lust an Sprache; es gefällt ihnen, dass sie mehrere Sprachen können, sie fühlen sich kompetent
• Sie äußern Interesse an weiteren Sprach-Erfahrungen
• Andererseits machen sie Diskriminierungserfahrungen über Sprache, erleben Beschämungen über Sprache (Nicht-Können, Nicht-Verstehen)
• Ihre Kompetenzerfahrungen über Sprache (sie können ihre Mehrsprachigkeit als Mittel des Einschlusses oder Ausschlusses anderer verwenden, können übersetzen …) brechen sich in den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen; dort sind sie eher die »Inkompetenten«
• Kinder erleben ihre Eltern als nicht Deutsch-kompetent: so wünschte sich ein Junge eine internationale Sprache für alle, damit seine Mutter nicht mehr in Sprachnöte kommt
• Die Kinder erleben Sprache auch als Zwang: Sie müssen in manchen Situationen eine bestimmte Sprache sprechen“ (279)
Abschließend mahnt Petra Wagner eindringlich dazu, die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu fördern:
„Mit fünf Jahren können Kinder überraschende Kompetenzen ausgebildet haben, sich mit vielen Sprachen durch sie hindurch zu bewegen, sich dieser Kompetenzen bewusst zu sein und sich selbst stolz als mehrsprachige Kinder zu sehen. Mit fünf Jahren können Kinder bereits massive Erfahrungen mit Versagen und Ungenügen und Unterlegenheit gemacht haben, gerade im Hinblick auf ihre sprachlichen Kompetenzen. Die Gefahr ist, dass sie eingeschüchtert und unsicher sind und sich auf weitere Bildungsprozesse im Sinne lernender Weltaneignung nur begrenzt einlassen können. Das muss alarmieren angesichts der Lernchancen, die das Handeln quer durch viele Sprachen hindurch in einer mehrsprachigen Umwelt für alle Kinder eröffnen kann.“ (280)
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Artikel von Peter Auer; er zeigt im Vergleich zwischen Martin Luthers vermischtem Gebrauch der lateinischen und deutschen Sprache in seinen Tischreden und Beispielen spanisch-deutscher und türkisch-deutscher Sprachvermischung aus dem modernen Alltag,
„dass sich kompetente bilinguale Sprecher in allen Bildungs- und Sozialschichten und bei allen Formen von Mehrsprachigkeit (migrationsbedingt oder nicht) finden. Ihre sprachliche Praxis ist durch Codemixing und -switching gekennzeichnet. Unter Codemixing verstehen wir die strukturell von bestimmten ‚Regeln‛ eingeschränkte Vermischung mehrerer Sprachen innerhalb von kleineren Einheiten wie ‚Sätzen‛. Die Beherrschung dieser Regeln, zeugt von einer Metagrammatik, die die Sprecher problemlos beherrschen. Unter Codeswitching wurden hier diejenigen Formen des Alternierens und Inserierens verstanden, die stilistisch-rhetorische Funktion haben. Sie werden insbesondere als Kontextualisierungsmittel eingesetzt, um bestimmte sprachliche Handlungen zu kennzeichnen.“ (281)
Bei Nermi Uygur fand ich interkulturell-sprachphilosophische Betrachtungen zum jeweiligen besonderen Reichtum der deutschen und türkischen Sprache:
„Das Türkische berührt die äußere Wirklichkeit wie eine Tangente, während das Deutsche die Wirklichkeit aus allen möglichen Gesichtswinkeln betrachtet und erwägt. Bildlich gesehen hat das Türkische demgegenüber leichte Füße, die – sobald sie den Boden der äußeren Wirklichkeit berührt haben – ihn wieder verlassen. Die deutsche Sprache besitzt, so möchte ich sagen, eine Vorliebe dafür, die äußere Wirklichkeit in all ihren Möglichkeiten bis in ihre Hintergründe zu erfassen. Sie findet Zufriedenheit erst in der Umsicht, Voraussicht, Allsicht.“ (282)
„Deutsch neigt dazu, die Welt zu substantivieren, zu verdinglichen, mit einem philosophisch beladenen Terminus, zu hypostasieren: ‚das Ansich‛, ‚das Gute‛, ‚das Sehen‛, ‚das Zeitliche‛ usw. Diese allzu leichte, bequeme sprachliche Möglichkeit gibt dem Deutschsprechenden die Möglichkeit, abstrakt zu denken, d. h. sich von den einzelnen wirklichen Dingen abzulösen. Die deutsche Philosophie ist, wie weltbekannt, sehr reich an abstrakten Denkstilen.
Im Türkischen hat man nicht die genannte Möglichkeit zur Verfügung. ‚Das Gute‛? (was für eine abstrakte Idee! Wer hat jemals die Bekanntschaft ‚des Guten‛ gemacht? Gewiss, es gibt – so und so – ‚gute‛ Menschen, ‚gute‛ Fahrräder, – aber ‚das Gute‛), – ‚das Gute‛ müsste man auf Türkisch mit iyiye ilişkin şeyler, iyi şeyler, iyi olan şeyler wiedergeben, was ins Deutsche übersetzt soviel besagt wie: ‚Dinge, die mit den guten Sachen zu tun haben‛, ‚gute Dinge‛, ‚Dinge, die gut sind‛.“ (283)
„Die türkische Sprache neigt dazu, sich die äußere Wirklichkeit aus dem Standpunkt der inneren vorzustellen. Ihre Denkrichtung geht sozusagen von innen nach außen. Sie ver-innerlicht gerne. Eine Vielzahl von Worten, Sprichwörtern und Redensarten bezeugen diese Tatsache.
Gewiss, auch das Deutsche enthält Worte und Redensarten, die die Subjektivität des Menschen oder seine vom Subjekt her geprägte Haltung dem Äußeren gegenüber zur Sprache bringen. Mystik und Romantik fehlen nicht in der deutschen Kulturtradition. (Die sogenannte unveränderliche kollektive Substanz eines Volkes, diejenige, die man in manchen Kreisen ‚Volksseele‛ nennt, – auch sie verändert sich wohl im Fluss der Zeit.) Eines aber ist heute klar, falls mein Deutscherlebnis mich nicht irreführt: Worte der Subjektivität, wie ‚Gemüt‛, ‚Seele‛, ‚Herz‛ und ‚Inneres‛ haben im Deutschen kein großes Ansehen mehr.“ (284)
Dagegen sind mühelos viele alltägliche Beispiele für „die ‚Innerlichkeit‛ der türkischen Sprache“ zu nennen:
„Beispiele in bezug auf gönül (‚das Gemüt‛): gönül bolluğu (‚die Fülle des Gemüts‛): ‚die Freigiebigkeit‛; gönlümden koptu (‚es hat sich aus meinem Gemüt gerissen‛): ‚ich habe mich plötzlich entschieden‛; gönlüm takildi (‚mein Gemüt hat sich gehängt‛): ‚ich interessiere mich für …‛; seni gönlümden çikaramam (‚ich kann dich nicht aus meinem Gemüt wegschaffen‛): ‚ich kann dich nicht vergessen‛; gönül vermek (‚sein Gemüt geben‛): ‚sein Herz verschenken‛, ‚sich verlieben‛.
Beispiele, die sich um das Wort iç (‚das Innere‛) zentrieren: içi kara (‚mit schwarzem Inneren‛): ‚bösartig‛; içini dökmek (‚sein Inneres werfen‛): ‚sich aussprechen‛; içim kan ağliyor (‚mein Inneres weint Blut‛): ‚ich gräme mich‛; içi dar (‚mit engem Inneren‛): ‚voreilig‛; içi geniş (‚mit breitem Inneren‛): ‚geduldig‛.
Beispiele, die mit can (‚Seele‛) zu tun haben: Canim burnuma geldi (‚meine Seele kam bis in meine Nase‛): ‚ich bin völlig erschöpft‛; can Çikmayinca huy çikmaz (‚solange die Seele nicht entflieht, bleibt der Charakter‛): ‚niemand kann aus seiner Haut heraus‛; cana kiymak (‚die Seele hacken‛): ‚umbringen‛; can kulağiyla dinlemek (‚mit dem Ohr der Seele zuhören‛): ‚mit großer Aufmerksamkeit zuhören‛; canini dişine almak (‚seine Seele in die Zähne nehmen‛): ‚seinen ganzen Mut zusammennehmen‛ usw.“ (285)
Abschließend werfe ich mit Uygur noch einen Blick auf den Unterschied der Verabschiedungsrituale:
„Im Deutschen verabschiedet man sich voneinander, indem man sich „Auf Wiedersehen“ sagt; im Türkischen sagt der Weggehende allahaismarladik (‚wir haben uns zum Allah bestellt‛), und derjenige, der bleibt oder nach dem ersten geht, sagt dem anderen: güle güle (‚lachend lachen‛), was auf Deutsch lächerlich klingt, doch auf Türkisch einen herzlich-heiteren Eindruck macht.“ (286)
Serap Şıkcan, wiederum im „Handbuch Kinderwelten“, macht auf wichtige Aspekte der Elternarbeit im Blick auf Familien mit Migrationshintergrund aufmerksam, die unter anderem auch mit der oder den in der Familie gesprochenen Sprache(n) zu tun haben:
„Macht das Kind die Erfahrung, dass es selbst und seine Familie im Kindergarten geschätzt werden und willkommen sind, dann kann es leichter auf Bildungsprozesse eingehen. Wenn Kinder auf ihren Entdeckungsreisen keine Verbindung zwischen sich, der Familie und dem Kindergarten feststellen, an Vertrautes nicht anknüpfen können, sind sie zunächst verunsichert und gehemmt. Und erhalten sie zusätzlich die Botschaft, ihre familiäre Kultur sei »unnormal«, »unwichtig« und »nicht erwünscht«, was sich z. B. in dem Verbot, in der Familiensprache zu sprechen, zeigen könnte, dann verlieren sie ihr Selbstvertrauen und können sich schwer auf neue Herausforderungen einlassen und Neues hinzulernen“ (287).
Um mit diesen Herausforderungen umzugehen, macht sie zunächst folgenden Vorschlag:
„Es gilt, die kulturellen Hintergründe und Lebensgewohnheiten im Einzelnen zu erfragen und stereotype Darstellungen und Abbildungen zu vermeiden: »Ist die Vielfalt aller Kinder und ihrer Familien im Kindergarten zu sehen? Wie sehen die Kinder und ihre Familien aus? Wie heißen sie? Welche Sprachen sprechen sie? Wer gehört zu ihnen? Was machen sie am liebsten zu Hause? Womit spielen sie gern? Was essen sie am liebsten?« Je mehr ein Kind erlebt und sieht, dass seine Familie respektiert und geachtet wird, desto eher kann es ein positives Bild von sich und von sich und der Welt entwickeln. Es stärkt seine Wurzeln und kräftigt seine Flügel, wenn ein Kind im Kindergarten an Vertrautes anknüpfen und von da aus neue Erfahrungen machen kann. Bildungsprozesse gelingen vor allem dann, wenn ein Kind sich mit all seinen Identitätsaspekten, zu denen auch seine Familie gehört, wohl fühlt.“ (288)
Aber was tun, wenn Eltern mit Migrationshintergrund sich kaum an Elternabenden beteiligen?
„Erzieherinnen berichten: »Unsere Elternabende sind schlecht besucht. Es kommen immer wieder die gleichen Eltern, die ohnehin engagiert sind.« Die Aufforderung lautet: »Plant die Elternabende so, dass ein offener Austausch unter gleichwertigen und gleichberechtigten Partnern möglich wird.« Gesagt, getan: Die Erzieherinnen kürzen den Infoteil zu Beginn des Elternabends auf das Wesentliche und fordern die Eltern dann auf, folgende Fragen zu beantworten: »Wie heißt Ihr Kind? Welche Bedeutung hat der Name? Wer hat dem Kind diesen Namen gegeben? Drückt der Name für Sie etwas Bestimmtes aus, eine Hoffnung, eine Erwartung, einen Wunsch?« Diese Fragen können alle Eltern beantworten – und niemand anderes: Hier sind sie die Experten! Auch diejenigen, die sonst eher still sind, erzählen viel. Manche tun sich schwer beim Erzählen auf Deutsch, andere springen übersetzend ein. Wunderbare und lustige Geschichten kommen zum Vorschein, die man anders nicht hätte erfahren können. Dieser Elternabend ist für viele interessant, weil er am Erleben der Eltern selber angelehnt ist. Dadurch fördert er auch den Austausch und das Kennenlernen unter den Eltern: Man kommt sich näher und entwickelt Empathie und Verständnis füreinander.“ (289)
„Ein anderer Weg, die Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen, Erziehern und Eltern zu initiieren und partnerschaftlich zu gestalten, sind Elterngesprächskreise über Erziehungsfragen: Ein Kreis von Müttern und Vätern kommt zusammen, um sich über Themen auszutauschen, die die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder berühren. …
Die Erzieherin hat die Gesprächsleitung, sie initiiert und moderiert die Gesprächskreise, bereitet die Treffen vor und lädt die Eltern ein. Sie ist diejenige, die darauf achtet, neben dem Bedürfnis der Eltern nach Austausch auch deren Interesse an Sachinformationen über Fragen frühkindlicher Entwicklung zu berücksichtigen. …
Die Botschaft »Ihr seid kompetente Eltern« und die Versicherung »Perfekte Eltern gibt es nicht« ermutigen die Mütter und Väter, von ihrem Elternsein zu erzählen und davon, was ihnen wichtig ist und ihnen bei ihrem Kind gut oder weniger gut gelingt. Die Gesprächsleiterin achtet darauf, dass bei solchen Erfahrungsberichten keine Schuldzuweisungen oder Bewertungen durch andere Eltern stören.“ (290)
Schließlich gibt Şıkcan eine Anregung zur Personalpolitik im Kindergarten:
„Mehrsprachige Fachkräfte können helfen, eine Brücke zwischen Kindergarten und den Familien zu schlagen, deren Familiensprache nicht Deutsch ist. Die Brücke besteht in sprachlicher Verständigung und auch darin, dass sie von den Familien als »ihresgleichen« wahrgenommen werden und die Identifikation mit der Einrichtung erleichtern können.“ (291)
Auch die in unserer Kindertagesstätte beschäftigte Erzieherin Gülhan Hasan spricht eine Empfehlung in gleicher Richtung aus:
„Mitarbeiter/innen ausländischer Herkunft in den Kindertageseinrichtungen wären der beste Garant für ein Angebot von Mehrsprachigkeit.
Da sie selbst Migrationserfahrungen haben, wären sie die besten Vermittler bei der Auseinandersetzung mit befremdenden Verhaltensweisen. Dies setzt voraus, dass sie verstärkt in der Ausbildung zu Erzieherinnen und Erziehern berücksichtigt und gefördert werden, dass die Träger sie einstellen und die Kolleginnen sie in ihrer besonderen Kompetenz schätzen.“ (292)
↑ 3.3.3 Ein Seitenblick auf das Tabu-Thema „Regenbogenfamilien“
Ein Tabu-Thema spricht Stephanie Gerlach in ihrem Aufsatz über die sogenannten „Regenbogenfamilien“ an: gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern.
„Mütter oder Väter in Begleitung von Kindern werden immer für heterosexuell gehalten. Lesbische und schwule Eltern sind über ihre Kinder sehr viel mit anderen, zumeist heterosexuellen Familien im Kontakt. Ohne Coming out kommt es nach kurzer Zeit zu Irritationen. Deshalb haben lesbische Mütter und schwule Väter die undankbare Aufgabe, häufig auf sich aufmerksam machen zu müssen. Da es unwahrscheinlich ist, dass Lesben und Schwule gefragt werden, ob sie ein Paar sind, müssen sie diese Information von sich aus geben. Eine Kindertagesstätte kann nur so offen sein, wie es die Eltern sind.“ (293)
Aus eigener Erfahrung weiß ich, was Gerlach als Problem beschreibt (ohne selber bisher darauf reagiert zu haben):
„Schon im Kindergarten verwenden größere Jungen manchmal das Schimpfwort »schwule Sau«. Meistens wissen sie gar nicht, was dieser Ausdruck bedeutet. In der Regel gehen Fachkräfte darauf nicht weiter ein. Ignorieren oder Verbieten ist die gängige Strategie. Doch Erzieherinnen und Erzieher müssen in dieser Situation reagieren und den Kindern erklären, was diese Worte bedeuten, dass sie als Schimpfworte nicht akzeptabel sind und dass es da eigentlich um Liebe und Sich-Mögen geht. Wo die Liebe hinfällt, das wissen wir alle nicht vorher. Und warum die einen so leben wollen und die anderen anders, darauf gibt es nicht wirklich eine Antwort. Nur vielleicht eine: Lesben und Schwule hat es schon immer und überall gegeben. Reagiert eine Erzieherin nicht, erleben Kinder aus Regenbogenfamilien, dass die Begriffe, mit denen sie selbstverständlich aufwachsen, in ein negatives Licht geraten, peinlich sind oder gar, dass etwas mit ihrer Familie nicht stimmt. Die Kita sollte aber ein Ort sein, an dem die Kinder ihren Stolz auf ihre Familie pflegen können. Vielleicht sind Lebensformen und Familienformen ein Kernthema, worüber mit den Kindern immer wieder gesprochen wird. Nun könnte das Thema um neue Inhalte erweitert werden. Jedes Kind hat ein Recht darauf, mit seiner Realität im Kindergartenalltag vorzukommen. Dies ist auch ein Ausdruck von Schutz und Respekt.“ (294)
In wissenschaftlichen Untersuchungen wird übrigens „den Kindern von lesbischen und schwulen Eltern eine bemerkenswerte psychische Stärke“ bescheinigt.
„So zeigt eine Studie…, dass die Kinder von lesbischen Müttern zwar höherem sozialen Stress (Hänseleien etc.) ausgesetzt sind als Kinder einer Vergleichsgruppe, zu Hause aber offensichtlich so gestärkt werden, dass sie diesem adäquat begegnen und über eine größere allgemeine Zufriedenheit verfügen als die Kinder der Vergleichsgruppe.“ (295)
„Für kleine Kinder, die in Regenbogenfamilien hineingeboren werden, ist ihre Familie Normalität. Sie wissen in der Regel, dass es viele verschiedene Familien- und Lebensformen gibt und sie selbst mit zwei Mamas oder (seltener) mit zwei Papas aufwachsen.
… Wichtig ist, dass das Kind auf Fragen nach seiner Familie adäquat antworten kann, d. h, dass es von den Eltern angemessene Worte für seine Familie an die Hand bekommt. Dazu ist größtmögliche Offenheit innerhalb der Familie eine Grundvoraussetzung. Ein Kind will und muss seine Entstehungsgeschichte kennen (dürfen). Zentral ist dabei, dass das Kind heute bei zwei Mamas oder zwei Papas lebt, die sich ein Kind gewünscht haben.
Auch die Frage nach männlichen Rollenvorbildern in lesbischen Familien wird gerne gestellt und wurde bereits häufig untersucht. Dabei haben Forscherinnen und Forscher festgestellt, dass sich lesbische Mütter stärker um Kontakt zu männlichen Bezugspersonen für ihre Kinder kümmern als alleinerziehende heterosexuelle Mütter… Im Übrigen suchen sich alle Kinder Vertreterinnen und Vertreter beider Geschlechter als Rollenvorbilder bevorzugt außerhalb der Familie.“ (296)
↑ 3.4 Ein Seitenblick auf die Integration von Menschen mit Behinderung (297)
Jetzt folgt ein noch ausführlicherer Exkurs über die Integration bzw. Inklusion von Menschen mit Behinderung, da ich im „Handbuch Integrative Religionspädagogik“, das ich eigentlich nur wegen des Beitrages von Rabeya Müller aus der Gießener Uni-Bibliothek entliehen hatte, auch in anderen Aufsätzen faszinierende Einsichten und wertvolle Querverbindungen zur Thematik meines Studienurlaubs fand.
Ulrich Bach macht darauf aufmerksam, wie sehr auf dem Weg zu einer Inklusion von Menschen mit Behinderung auch in kirchlichen Kreisen noch umgedacht werden muss:
„Ich denke an den dritten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses (vom Heiligen Geist und der Kirche), den wir meistens so auslegen, dass behinderte Menschen nur bei den Aufgaben der Kirche auftauchen (also als Objekte gelten), nicht aber als Subjekte: Bei der Mission heißt das, ihnen muss gepredigt werden; bei der Diakonie, ihnen muss geholfen werden. Der Gedanke, dass sie auch an die übrige Kirche eine Botschaft auszurichten hätten, dass eine Pflegerin im Krankenhaus durch den Patienten Diakonie erfahren könnte, auf solche Gedanken kommen wir nicht.“ (298)
Er fordert „dringend eine europäische Befreiungstheologie“ (299),
„um die Knechtungen auf beiden Seiten anzugehen: Nicht nur die Behinderten sind geknechtet (etwa durch die gesellschaftliche und kirchliche Diskriminierung), sondern auch die Nichtbehinderten, die in ihrer Angst und Unbeholfenheit Sätze sagen (müssen?) wie: Ich darf gar nicht … daran denken, mal zu verunglücken…, hilfeabhängig zu werden… Gemeinsam trainiert werden müsste eine Freiheit, die man so andeuten kann: Ich bin kerngesund – ja und? Ich bin taubstumm – ja und? Paulus beschrieb diese Freiheit so: Ich kann Überfluss haben und kann Mangel leiden; ich kann das alles durch Christus, der mich das können lässt (Phil 4, 12f.).“ (300)
Eine »Theologie nach Hadamar« soll es ermöglichen, eine neue Lebenshaltung in folgendem Sinne einzuüben:
„»Du bist unendlich wertvoll, weil Gott in Christus unwiderruflich ›ja‹ zu dir sagt«: Dieser Satz ist aufhelfende Medizin für denjenigen, der dachte, durch Blindheit oder Anfall-Leiden habe er eigentlich keinen »Wert«; ebenso ist derselbe Satz Krampf lösende Medizin für den, der meinte, er müsse durch Gesund-Bleiben und Höchstleistungen ständig den »Wert« seines Lebens erst selber besorgen. Dieser Satz ist also für beide ein therapeutisches Kontra.“ (301)
Aus islamischer Sicht betrachtet Rabeya Müller das Thema „Behinderung und Integration“. Sie stellt einleitend fest:
„In islamischen Gemeinschaften wird eine Behinderung als gottgegebener Sachverhalt nicht im Sinne von Strafe, sondern im Sinne von Prüfung verstanden. … Fest steht, dass behinderte Menschen in islamischen Familien ganz selbstverständlich leben. Ihrer Integration in die alltäglichen gesellschaftlichen Abläufe steht ideologisch und auch praktisch gesehen nichts im Wege.“ (302)
Auf jeden Fall ergibt sich
„für die »Starken« in der Gesellschaft ein sozialer Auftrag, für die »Schwächeren« mitzukämpfen und für sie soziale Leistungen zu erbringen. »Und was ist mit euch, dass ihr nicht für Allahs Sache kämpft und für die der Schwachen – Männer, Frauen und Kinder -, die sagen: ›Unser Herr, führe uns heraus aus dieser Stadt, deren Bewohner ungerecht sind, und gib uns von Dir einen Beschützer, und gib uns von Dir einen Helfer‹?« (Qur‛ān 4:75).“
Und Müller ergänzt:
„Behinderte und kranke Menschen genießen in islamischen Gemeinschaften manchmal auch geradezu privilegierte Stellungen; so kommt es eben dem vermeintlich Schwachen zu, bei Gott für die anderen zu bitten. Dieser »Fürbitte« wird in der Regel große Bedeutung beigemessen, und sie stellt eine Obliegenheit in dem sonst so passiv erscheinenden Dasein eines Behinderten dar.“ (303)
Natürlich geht Rabeya Müller auch auf Probleme ein, zu denen es durch die Umbruchsituation in einer Migrationsgesellschaft kommt, und insbesondere auf die Frage der „Förderung der Eigeninitiative“ eines behinderten Familienmitgliedes:
„Das lässt sich unter Berufung auf qur‛ānische Prinzipien sehr gut bewerkstelligen, z. B. dass dem Menschen nichts abverlangt wird, was er nicht kann, jedoch was er kann, das wird von ihm erwartet. Somit sind fördernde Maßnahmen auch fordernde Maßnahmen. …
Im Qur‛ān heißt es: »Von keiner Seele soll etwas gefordert werden über das hinaus, was sie zu leisten vermag« (2:233). Wer in der Lage ist, mit MuslimInnen qur‛ānisch zu argumentieren und z. B. diesen Vers, dass keiner Seele etwas über ihr Leistungsvermögen hinaus abverlangt werden sollte, als Rehabilitationsleitsatz einzusetzen, kann auf der anderen Seite durchaus erwarten, dass alle Maßnahmen, die diese Seele zu leisten vermag, ihr abverlangt werden dürfen.“ (304)
In seinem Aufsatz „Hat Hiob eine Nachricht? Die Vernunft und die Unvernunft des Leidens“ unterstreicht Fulbert Steffensky provokativ „Das Recht der Kranken auf Krankheit“ (305):
„Man kann Kranke überlasten, indem man ihnen die Schutzräume nimmt, in denen sie in Gelassenheit krank sein können. Integration kann nicht heißen, einen Kranken als gesund anzusehen oder einen Behinderten als unbehindert und einem Kranken zuzumuten, was man einem Gesunden zumutet. … Könnte es nicht auch ein Stück geheimer Gewalt sein, dem Kranken seine Krankheit nicht zu lassen, sich als Gesunder mit seiner Krankheit nicht abfinden zu können? Ich sage dies übrigens auch als Vater einer epileptischen Tochter, die lange unter den Gesundheitserwartungen ihrer Familie, der Ärzte und der besten ihrer Betreuer gelitten hat. Man muss aufhören können zu siegen. Man muss aufhören können, die Krankheit und die Behinderung unter allen Umständen zu bezwingen. Es gibt Krankheiten und Beeinträchtigungen, die zu einem Menschen gehören. Es gibt aber keine Krankheit, die seine Würde als Mensch beeinträchtigt.
Integrationszwänge sind aber nicht gerade die Hauptgefahr in unserer Gesellschaft. Beim Rückgang des gesellschaftlichen Reichtums ist die Hauptgefahr sicher, dass Krankheit und Behinderung hauptsächlich unter Gesichtspunkten ökonomischer Rationalität wahrgenommen werden.“
Von daher richtet Steffensky eine Mahnung an
„unsere Kirchen. Ob sie Stolz und Stimme gewinnen und wieder bewohnbar werden, das liegt daran, wen sie im Auge haben und von wem her sie denken; an wen die Kirchen denken, wenn sie ihre Gebäude bauen, ihre Programme planen, ihre Predigten halten, ihre Theologie treiben, ihre Presbyterien besetzen. Denken die Kirchen an die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen? Haben sie den Blick Jesu geerbt, den Blick auf die Mühseligen, die Beladenen und die, die keine Lobby haben? Ich bin stolz darauf, zu einer Kirche zu gehören, die weniger aus Steinen gebaut ist als aus Geschichten von der Würde der Geringen und der Kleinen; aus Geschichten von der Heilung und der Bergung des Lebens.“ (306)
Seine Anfragen werden letztlich zu einem Plädoyer gegen „Ganzheitszwänge“ (307) und zu einer Anleitung für jeden und jede, sich auf sich selbst zu besinnen:
„Zu wirklicher Souveränität gehört, nicht in Panik zu geraten, wo man sich selber als Fragment erkennt. Diese Souveränität macht es möglich, das Fragmentarische, Unvollendete und Defiziente derer zu ertragen, mit denen wir umgehen.“
Damit unterstreicht er Gedanken, die ich bei John M. Hull und Henning Luther gefunden habe (und auf die ich in Kapitel 6.5 und 6.6 näher eingehen werde), aus einer anderen Perspektive.
„Es gibt Leiden, das durch überhöhte Erwartungen entsteht, durch die Erwartung, dass die eigene Ehe vollkommen sei; dass der Partner einen vollkommen erfülle; dass der Beruf einen völlig ausfülle; dass uns die Erziehung der Kinder vollkommen gelingt. So ist das Leben nicht. Die meisten Ehen gelingen halb, und das ist viel. Meistens ist man nur ein halber guter Vater, eine halbe gute Lehrerin, ein halber glücklicher Mensch, und das ist viel. Gegen den Totalitätsterror möchte ich die gelungene Halbheit loben. Die Süße und die Schönheit des Lebens liegt nicht am Ende, im vollkommenen Gelingen und in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht nur in dem Sinn, dass wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt im Leben selber, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, in der begrenzten Ausgefülltheit. Hier ist uns nicht versprochen, alles zu sein. Souverän wäre es, die Güte des Lebens anzunehmen und zu genießen, die man jetzt schon haben kann, und die Halbheit nicht zu verachten, nur weil die Ganzheit noch nicht möglich ist. Souverän wäre es, den Durst nach dem ganzen Leben nicht zu verlieren. Wenn man in dieser Weise der Endlichkeit fähig wäre, dann würde beschädigtes Leben nicht so maßlos irritieren.“ (308)
Dorothee Wilhelm macht aufmerksam auf den Blick derer (vgl. dazu auch Kapitel 2.4.3!),
„die sich selber als »normal« abbilden und von dort aus die anderen als abweichend von ihrem Maßstab betrachten, gemessen nach dem Grad der Abweichung von ihrer Norm. Die Abweichung wird dabei auf den Körpern der anderen abgebildet: Man sieht auf den ersten Blick, ob jemand anders ist, weiblich, fremd, behindert, und glaubt, ohne ein Wort gewechselt zu haben, »den Plan im Sack« zu haben über das Objekt des Blickes.“
Zugleich erhebt sie im Namen einer bestimmten biblischen Überlieferung (dazu siehe auch Kapitel 9.6) Einspruch gegen diesen Blick:
„In der jüdischen und durch sie in der christlichen Tradition gibt es einen kraftvollen Versuch, die verletzlichen wirklichen Menschen vor dieser Macht der Bilder zu schützen: Es ist das Bilderverbot.
… Wir haben kein Recht, Frauen, Behinderte, Schwarze, Lesben und Schwule oder andere scheinbar von der herrschenden Normalität Abweichende gemäß unserem Bild von ihnen zu behandeln. Wir haben kein Recht, sie auf das eine Merkmal zu reduzieren, das von unseren Vorstellungen von »Normalität« abweicht. Das ist ein Verstoß gegen das zweite Gebot [das Bilderverbot]. Wer andere zu Fremden macht und dann über sie verfügt, welches denn ihre Lebensmöglichkeiten sein dürfen, gerät auch unter den Fluch: Verflucht sei, wer das Recht der Fremden beugt.“ (309)
Wilhelm weist aber auch auf eine fragwürdige Seite der biblischen Wundergeschichten hin, in denen genau dieser Verstoß gegen das Bilderverbot praktiziert wird:
„Der abweichende Körper wird in der Bibel qua Wunderheilung ein »normaler« Körper, das Auge ist nicht länger irritiert vom Anblick der Abweichenden. Wessen Auge? Nicht das derer, die als abweichend abgebildet werden. Es geht vielmehr um die Sehgewohnheiten der so genannt »Normalen«, d. h. derer, die der (welcher?) Norm entsprechen. Zu dieser Sehgewohnheit gehört, jede Abweichung vom körperlichen Status der »Normalität« mit Leiden gleichzusetzen. Auf die Heilungsgeschichten übersetzt, bedeutet das, dass die »Krüppel«, »Lahmen«, »Blinden«, »Tauben«, »Stummen« per Wunder zum Status der »Normalen« emporgeheilt werden, somit ihr Leiden beendet ist, weil sie endlich so sein können wie die anderen.“ (310)
In einem anderen Aufsatz des gleichen Buches geht Jürgen Ebach ebenfalls vom Bilderverbot aus, um ein Verständnis dafür anzubahnen, was die Bibel mit den Visionen aus Jesaja 65 oder Offenbarung 21 meinen mag, in denen eine neue Schöpfung angekündigt wird.
„Wie ein Leben, befreit von Tränen, Tod, Leid, Geschrei und Schmerz, aussehen mag, das zu imaginieren steht unter dem »Bilderverbot«. Und doch können wir uns nicht anders als in Bildern davon eine Vorstellung machen. Meine Vorstellung wäre nicht die, dass im neuen Himmel und auf der neuen Erde alle Menschen »gesund« sind. Denn die »Gesundheit« selbst ist keine Größe, die unverändert Teil der neuen Wirklichkeit sein wird. Die Vorstellung eines Gottesreiches mit lauter jugendlichen, strotzend gesunden, bodygebildeten und schönheitskonkurrenzfähigen Menschen käme mir eher einem Alptraum nahe. Ich mag mir jedenfalls die Welt der Fernsehwerbung nicht als Maßstab des neuen Himmels und der neuen Erde denken. Vielleicht ist ja das Stammeln eines Mose dann als Stammeln Poesie, das Hinken Jakobs als Hinken einzig richtiges Gehen, die Runzeln der alten Sara und die sanften Kuhaugen der Lea – nichts als Schönheit.“ (311)
Auch Ebach beschäftigt sich mit den biblischen Wundergeschichten und betont gleich zu Beginn, dass nicht überall Heilungswunder geschehen, wo man vielleicht welche erwarten würde. Zum Beispiel wird von keiner „Wunderheilung“ berichtet, „die den Mose zum großen Rhetor macht“ (312). Gott macht Mose zum Anführer der Befreiung des Volkes Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten, obwohl er nur schwerfällig reden kann; statt ihn von seiner Redehemmung zu befreien, sagt Gott zu ihm: „Wer hat dem Menschen einen Mund gegeben, oder wer die Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Bin nicht ich es, Adonaj?!“ (313) Wenn Gott aber nicht nur die Menschen gemacht hat, die sich als normal definieren, folgt daraus:
„»Bild Gottes« ist der Mensch – kein bestimmter Mensch und keine bestimmte Gruppe von Menschen, weder die Angehörigen einer bestimmten Hautfarbe noch eines Volkes noch eines Geschlechts noch eines religiösen oder politischen Status oder einer körperlichen oder geistigen Verfassung. Es gibt – auf welchen Ebenen auch immer – kein weniger und kein mehr Menschsein.“ (314)
„Da gibt es nicht die Starken, Autarken und Gesunden, die ihr Sosein Gott verdanken, und dagegen die weniger Starken, auf die Hilfe anderer Angewiesenen und womöglich chronisch Kranken und Behinderten, die ihr Sosein anderen Mächten und Ursachen verdanken, welche Mächte und Ursachen es auch sein mögen.“ (315)
Davon ausgehend behandelt Jürgen Ebach die von Jesus berichteten Wunderheilungen, die mich im Zusammenhang mit dem Thema meines Studienurlaubs auch deshalb interessieren, weil sie zu denjenigen Einzelheiten aus dem Wirken Jesu gehören, die auch im Koran erwähnt werden (316). Verschiedene Verstehenslinien erwägt Ebach, verwirft sie oder gewichtet sie in neuer Weise. Weckt Jesus die Selbstheilungskräfte der Menschen? Heilt Gott nur diejenigen, die seine Wunderkraft annehmen? Aber
„wenn es auf meinen Glauben, meine Zuversicht ankommt, habe ich dann, wenn ich oder mein Kind krank oder behindert bleiben, nicht genug geglaubt, keine zureichende Zuversicht gehabt?“ (317)
Wenn auf der anderen Seite der allmächtige Gott für alles verantwortlich ist, können wir nicht ausweichen vor der Theodizee-Frage:
„Wie kann Gott das zulassen, wie kann Gott das tun? »Und wenn nicht er, wer dann?« (Hiob 9, 24) Die Aufgabe der Theologie ist es, an solchem Fragen festzuhalten, daran als Frage an Gott und Klage vor Gott, ja Anklage Gottes festzuhalten, Fragen gegen die Antworten zu stellen und sich nicht etwa selbst zur Antwortinstanz zu erheben.“ (318)
Auch auf den Zusammenhang von Schuld und Beschädigungen des Lebens geht Ebach in differenzierter Weise ein:
„Nicht der Kranke, nicht die Behinderte ist »schuld«, aber es kann sehr wohl eine Schuld der Gesellschaft geben, eine z. B., die definiert, wer krank und behindert sei und wie mit ihnen umzugehen sei. Die Abschiebung in ein so genanntes »Landeskrankenhaus« jedenfalls lässt die Frage nach dem diesem Wort innewohnenden Genitiv stellen: Es ist sehr wohl auch die Krankheit des Landes, die da zum Ausdruck kommt. Zu den Gottheiten, denen Opfer gebracht werden, gehört die Göttin »Gesundheit« selbst. Hier wäre an die Krankheitserscheinungen zu denken, die sich dem Diktat von Fitness, Gesundheit, Schönheit verdanken. Die Entdeckung Luthers, dass ich vor einer Norm umso mehr versage, je mehr ich ihr gerecht werden will, hat (bei allen zu betonenden Unterschieden zwischen Mentalitätsstrukturen des Spätmittelalters und der Gegenwart) in dramatischen Essstörungen ihr heute überaus aktuelles Geltungsfeld. Hier etwa wäre eine gegenwärtige Debatte über die »Rechtfertigungslehre« zu führen, statt treulich-verbissen die Formulierungen des 16. Jahrhunderts zu reformulieren oder umgekehrt zu bekunden, über diese alten Fragen sollte man doch heute in den Kirchen nicht mehr streiten.“ (319)
Mit Hilfe zweier Wortspiele erfindet Ebach schließlich einen ganz neuen Blick auf manche der biblischen Wundergeschichten.
„Als typische Reaktion auf ein Wunder Jesu erfahren wir in vielen Fällen nicht etwa, die Umstehenden seien in Freude ausgebrochen, sondern sie seien entsetzt gewesen. Warum Entsetzen statt Jubel, Verstörung statt Freude – darüber etwa, dass da ein Mensch gehen kann? Das Entsetzen ist Reaktion auf eine Machterfahrung, aber es hat womöglich noch einen anderen Grund, auf den man kommt, wenn man an eine alte Bedeutung denkt, die das Wort »Entsetzen« haben kann. Wenn eine Stadt belagert war, suchte man sie zu entsetzen, d. h. den Einschließungsring aufzubrechen und die Belagerer zu vertreiben. Ent-Setzen ist in diesem Sinn Gegenwort zu Besetzung, Besatzung. Und so ist auch das Entsetzt-Sein derer, die ein Wunder Jesu erleben, das Aufbrechen eines Besetzt-Seins, des Besetzt-Seins von der Vorstellung, was nun einmal so sei, könne sich nicht ändern.“ (320)
Dieses Ent-Setzen kann nun aber tatsächlich auch das Gefühl des Entsetzens hervorrufen, denn:
„Es ist viel mehr möglich, als ich für möglich hielt – das kann eine schöne Erfahrung sein; es kann aber das noch härter machen, was ist – und was weiterhin so ist, obwohl oder gerade weil es nicht mehr »nun einmal« so ist. Wo wunderbare Änderung möglich wird, ist das Ertragen des noch Unveränderten umso schwerer. Ich habe deshalb einmal vorgeschlagen, das Wort »Wunder« auch als Komparativ von »wund« zu lesen.“
Letzten Endes gehören für Ebach die
„Wunder Jesu (nicht nur die Heilungswunder) … zusammen mit den Gleichnissen zu den Formen, in denen jetzt schon vom Reich Gottes erzählt werden kann. … Im Reich Gottes werden die Lasten von Armut und Krankheit, Behinderung und Demütigung, Versklavung und Leid nicht mehr sein. Diese Hoffnung zu teilen, sie in der Behutsamkeit, die das Bilderverbot auferlegt, zu erzählen, verheißt Befreiung für alle, auch für die Starken und Gesunden. Denn ihre Stärke und Gesundheit hat mit der Fülle des Lebens im Gottesreich ebenso wenig zu tun wie die Armut und Behinderung von Menschen. Erst wenn die Botschaft vom Reich Gottes für alle als das ganz Andere aufleuchtet, kann sie auch den Kranken und Behinderten gesagt sein, ohne dass ihnen auf diese Weise im Blick auf ihr gegenwärtiges Leben verächtlich die Notwendigkeit eines »Trostpreises« zuerkannt wird.“ (321)
Ans Ende seiner „kleinen Beobachtungen und Überlegungen zu einem großen und allemal nicht zu »bewältigenden« Thema“ stellt Ebach die Einsicht:
„Das eigene Leben nicht ohne fremde Hilfe führen zu können – eben das ist im Lichte biblischer Erinnerungen ganz gewiss nicht das Gegenteil eines erfüllten, eines menschlichen Lebens.“
Und er verdeutlicht sie abschließend mit einer chassidischen Geschichte, die ich gern auch einmal den Kindern in unserem Kindergarten erzählen möchte:
„Ein chassidischer Frommer fragte einmal den Rabbi Bunam nach einer Schriftstelle, die er nicht verstünde. Es war der Fluch über die Paradiesschlange, die, weil sie die Menschen dazu verführte, Gott gleich sein zu wollen, fortan auf dem Boden kriechen und Erdstaub fressen soll, wie es in 1 Mose 3 zu lesen ist. Das sei doch keine Strafe, sagte der Mann, das sei doch eher ein Segen, denn wenn die Schlange Erdstaub fressen solle, dann sei sie doch das einzige Lebewesen, das immer genug zu essen habe. »Ja«, erwiderte der Rabbi Bunam, »sie wird nie um etwas bitten müssen. Das ist ihre Strafe.«“ (322)
Nancy L. Eiesland beschreibt ihre persönliche „Begegnung mit dem behinderten Gott“, die sie dazu führte, in ihrem Buch »The Disabled God« eine „Befreiungstheologie der Behinderung“ zu entwerfen.
„Der Urgrund christlicher Theologie ist die Auferstehung Jesu Christi. Dennoch wird der Auferstandene selten erkannt als Gottheit, deren Hände, Füße und Seite die Zeichen deutlicher körperlicher Versehrtheit tragen. Der auferstandene Christus der christlichen Tradition ist ein behinderter Gott. … Christliche Theologie, insofern sie leibhaftige Theologie ist oder sogar Theologie der Inkarnation, ruft dazu auf, für Unvorhersehbarkeiten, Sterblichkeit und die Konkretheit von Schöpfung und Leiden einzustehen.“ (323)
Dieser Beitrag erinnerte mich an den „Offenen Brief eines blinden Jüngers an einen sehenden Heiland“ (324), in dem John M. Hull engagiert und differenziert Jesus auf seinen Umgang mit blinden Menschen und ihrer Blindheit anspricht.
Jesus behandelt den blinden Bartimäus mit Respekt (325), aber einen blinden Jünger gab es nicht im Kreis seiner engsten Vertrauten (326):
„Du akzeptiertest den Dienst und die Freundschaft von Frauen, sogar von welchen mit dunkler Vergangenheit, aber blinde Menschen mussten erst sehend werden, bevor sie dir nachfolgen konnten.“ (327)
Im Blick auf Jesu Wunderheilungen entwickelt Hull ähnliche Gedankengänge wie Dorothee Wilhelm und Jürgen Ebach, aber vor allem hält er Jesus vor, dass auch für ihn ganz selbstverständlich Blindheit eine Metapher für Sünde ist, insbesondere für „Unwissenheit, Dummheit und Abgestumpftheit“ (328). Von vielem, was Jesus über Licht und Finsternis, über Blindheit und Blinde sagt, fühlt er sich „durcheinander, nicht nur verletzt und verwirrt, sondern gekränkt“ (329). Besonders ärgert ihn das Gleichnis vom blinden Blindenführer:
„‚Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in eine Grube fallen?‛ (Lk. 6, 39) Lukas führt diesen Kommentar als ein Gleichnis ein, aber das Gleichnis bezieht seine Kraft aus einer echt unter Sehenden vertretenen Ansicht über das Verhalten von Blinden. Du, mein Herr, sollst diese übliche Ansicht geteilt haben, aber sie sagt mehr über die Annahmen und Vorurteile von Sehenden als über das tatsächliche Verhalten von Blinden. Blinde sind angewiesen auf Vertrautheit. Wer als Blinder mit einer bestimmten Strecke vertraut war, hätte einem blinden Fremden angeboten, ihn auf diesem Weg zu führen. Ich selbst habe oft blinde Menschen geführt, und umgekehrt wurde ich geführt. Wir sind nie in Gräben gefallen, niemals auf der Straße überfahren worden, niemals die Treppe heruntergefallen, allerdings muss ich einen Zusammenstoß mit einem Rosenstrauch zugeben. Wenn ich von einer sehenden Person geführt werde, mache ich manchmal schlechte Erfahrungen. Ich gehe durch ein Kaufhaus, als plötzlich der Boden unter mir weggleitet und ich fast mein Gleichgewicht verliere. ‚Entschuldigung‛, sagt mein sehender Freund. ‚Ich vergaß dir zu sagen, dass wir die Rolltreppe runterfahren.‛“ (330)
Aber dann liest John Hull die Stelle neu, als Jesus nach seiner Verhaftung die Augen verbunden werden und er angespuckt, geschlagen und verspottet wird (Mk. 14, 65 und Lk. 22, 63-65).
„In diesen Augenblicken einer faktischen Blindheit, hast du da angefangen, Blindheit von innen zu erkennen? Eigenartig, meine Entrüstung stirbt langsam ab. Meine Fragen sind zum Schweigen gebracht. Du bist ein Partner in meiner Welt geworden, einer, der mein Schicksal teilt, mein blinder Bruder.“ (331)
Und er liest in der Kreuzigungsgeschichte von der
„Finsternis über dem ganzen Land. In diesem Augenblick hast du geschrien: ‚Mein Gott, warum hast du mich verlassen?‛ (Mk. 15, 34) Hast du erkannt, in deiner Qual und Desorientierheit, dass das eine Sonnenfinsternis war? Oder hast du gedacht, dass sie dir wieder die Augen verbunden haben? Oder dass du vielleicht tatsächlich das Augenlicht verloren hast? Hast du dich vielleicht deshalb von Gott verlassen gefühlt, dem Gott des Lichtes, dem Gott der Sehenden? Ich staune einfach nur, dass nach diesen Erfahrungen deine Haltung gegenüber der Blindheit irgendwie anders ist. Auf dem Weg nach Emmaus werden die Augen deiner beiden Jünger ‚gehalten‛, so dass sie dich nicht erkennen konnten (Lk. 24, 16). Du gingst auf der Straße mit zwei Jüngern, die faktisch blind waren. Erst als du das Brot brachst, wurden ihre Augen geöffnet, so dass sie dich erkennen konnten, und dann verschwandest du aus ihrem Blick (Lk. 24, 31). Wieder wurden sie blind, sofern es dich betraf, aber jetzt ist es ein blindes Vertrauen, nicht mehr ein misslungenes Erkennen. Alles, was mit ‚Sehen‛ zu tun hat, ist paradoxer geworden.“ (332)
Im Anschluss an seinen Offenen Brief an Jesus überlegt John Hull, welche Implikationen seine Überlegungen für den Unterricht mit Blinden und Sehenden haben.
„Wenn Sehende lernen können, sich an die Bedürfnisse von Blinden anzupassen, ohne sie zu bevormunden, und wenn Blinde lernen können, Sehende zu akzeptieren, ohne sie zu manipulieren, wird die neue Beziehung einer wechselseitigen Annahme von Blinden und Sehenden flüsternd die Utopie einer neuen Welt ankündigen.“ (333)
Schließlich entwirft John Hull in Analogie und auch im Kontrast zu feministischen Theologien oder „black theologies“ eine „Theologie der Blindheit“, die nicht auf eine Beschreibung der Defizite des Blindseins hinausläuft, sondern auf „konstruktive“ Ziele:
„Sie wird vorbringen, dass Blinde gerade in ihrer Blindheit das Bild Gottes widerspiegeln. Sie wird zeigen, dass die Metapher der Blindheit auf positive Weise die wesentlichen Merkmale des Glaubenslebens andeutet. Von einer Theologie der Blindheit können wir praktische Hinweise für das soziale und politische Leben ableiten. Diese könnten Methoden einschließen wie die, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, oder sich auf die konkreten Besonderheiten eines ansonsten überwältigend abstrakten Problems zu konzentrieren. Eine Theologie der Blindheit – wie jede Theologie einer Behinderung – stellt eine Herausforderung dar für vorherrschende Konzeptionen über das, was normal ist. Die traditionelle Sicht ist, dass, wenn das Reich Gottes kommt, die Augen der Blinden geöffnet, die Ohren der Tauben aufgemacht und die Lahmen springen werden wie der Hirsch. Eine Theologie der Blindheit wird zeigen, dass – anstatt sich Utopia als eine Annäherung an ein einziges Bild von Normalität vorzustellen – unsere Anschauungen von Normalität eine umfangreichere Bandbreite von akzeptierter Verschiedenheit umfassen müssen. Normalität muss inklusiv werden. Das wird uns zu einer Kritik anderer Formen von Exklusion führen, einschließlich der mächtigsten von allen, der Exklusion der Armen durch die Reichen. So enthält auf die eine oder andere Weise eine Theologie der Blindheit eine utopische Verheißung universaler Befreiung.“ (334)
Die Gedanken von John M. Hull haben mich sehr berührt. Er bringt scheinbar weit entfernt voneinander liegende Probleme wie Blindheit oder ethnische Diskriminierung oder gemeinsame Religions-Bildung für Kinder verschiedener Religionszugehörigkeit auf einen gemeinsamen Punkt, und ich werde ihn in meinen Ausführungen noch mehrfach zu Wort kommen lassen.
Zurück zu einem letzten Beitrag im „Handbuch Integrative Religionspädagogik“ von Daniela Kobelt Neuhaus über die „Integration in evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder“. Sie hebt im Blick auf behinderte Kinder Gesichtspunkte hervor, die auch auf das interreligiöse Zusammenleben der Kinder zutreffen:
„Unter integrationspädagogischem Blickwinkel lebt eine funktionsfähige Kindergemeinschaft sozusagen von der Unterschiedlichkeit der Kinder. Je mehr wir über die Unterschiedlichkeit und die besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern Bescheid wissen, desto leichter fällt es, Erziehung, Bildung und Betreuung an den Bedürfnissen aller auszurichten. Unterstützung des Wohls aller Kinder ist die zentrale Absicht von Integrationspädagogik.“
Wegweisend sind folgende Überlegungen zum evangelischen Profil eines Kindergartens:
„Evangelisch kann nicht gemessen werden an der Häufigkeit des Betens oder an der Anzahl der biblischen Geschichten, die Kindern erzählt werden. Es geht auch nicht darum, ob ErzieherInnen fromm sind oder nicht. Evangelisch bedeutet jedoch, dass auch Erwachsene bereit sind, sich mit Religion auseinander zu setzen. Sie müssen keine fertigen Antworten haben auf Fragen nach Gott und der Welt – aber sie müssen bereit sein, den Dialog aufzunehmen und mit den Kindern nach Gott fragen zu lernen. Träger von evangelischen Einrichtungen haben sehr wohl dafür zu sorgen, dass das christliche Grundverständnis in der gelebten Konzeption der Einrichtung sichtbar wird. Dazu gehört wesentlich die in der Bibel und im Leben Christi begründete Gemeinschaft der Verschiedenen.“ (335)
↑ Anmerkungen
(206) An den Satz „Der lebt von der Fürsorge“ kann ich mich aus meiner Kindheit noch erinnern; gemeint waren in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, vor allem Bewohner eines sogenannten „Barackenviertels“ in der Nachbarschaft der neu errichteten Siedlung für Heimatvertriebene, zu der auch mein Elternhaus gehörte.
(207) Sie stellte mir ihre Gedanken in einer Email zur Verfügung und möchte ungenannt bleiben.
(208) Terkessidis, Interkultur, S. 10.
(209) Hinzu kommt, dass die Einsicht von Lefringhausen, S. 62, beherzigt werden muss: „Integration ist keine Einbahnstraße, denn auch die Mehrheit muss sich neu integrieren, denn die Gesellschaft, von der sie herkommt und in der sie zu leben glaubt, gibt es so nicht mehr, weil sie sich ethnisch und kulturell verschoben hat. Neu zu deuten ist also auch das Eigene, nicht nur das Fremde.“
(210) Vgl. den von Anke Krause, S. 92, zitierten kuriosen Dialog mit einem sechsjährigen Mädchen: „»Woher kommst du?« »Aus Vietnam!« »Wie alt bis du?« »Sechs Jahre alt.« »Wie lange bist du schon hier?« »Zehn Jahre!«“
Sie erläutert, dass Kinder, bevor sie „den abstrakten Begriff von ethnischer und nationaler Zugehörigkeit entwickelt haben können…, … bereits mit ethnischen und nationalen Bestimmungen [operieren], da sie früh darauf gestoßen werden: Sie erleben, dass bestimmte äußere Merkmale – Hautfarbe, Haarstruktur, Augenform – in der Frage »Woher kommst du?« münden und nicht nur mit der augenblicklichen Standortbestimmung ihrer eigenen Person, sondern dem Hintergrund ihrer ganzen Herkunftsfamilie »erklärt« werden sollen. …
Mitunter nehmen solche Dialoge einen bizarren Verlauf…: Das Alter des gefragten Kindes (sechs Jahre) ist kürzer als die Aufenthaltsdauer der Eltern (zehn Jahre) in Deutschland. Und darüber informiert das Kind die Fragenden, denn es hat offenbar verstanden, dass die Frage »Woher kommst du?« auf den Herkunftsort der Eltern zielt.“
(211) Terkessidis, Rassismusforschung, S. 70, kritisiert wissenschaftliche Untersuchungen einer „Vorurteilsforschung“, die den „Rassismus zum Problem von vereinzelten, verirrten Individuen“ machen. Ebd., S. 75: „Zweifellos würde in solchen Untersuchungen niemand auf die Idee kommen, die von Einheimischen an MigrantInnen regelmäßig gestellte Frage nach der Herkunft – ‚Woher kommst du?‛ – als Bestandteil des rassistischen Dispositivs zu bezeichnen. Freilich zeigen die Erzählungen der MigrantInnen, dass diese Frage von ‚Ausländern‛ in der Bundesrepublik häufig als Identitätsausweis verstanden wird, der die betreffende Person an einen anderen Ort im Ausland verweist und als nicht-zugehörig kennzeichnet, wodurch immer wieder die Gemeinschaft der Deutschen definiert und gegenüber Anderen verschlossen wird.“ Diese Art von Rassismus, durch die bestimmte Menschen auf Grund bestimmter an ihnen oder ihrer Kultur als „anders“ wahrgenommener bzw. zugeschriebener Eigenschaften ausgegrenzt werden, kann offenbar völlig absichtslos und unbewusst ablaufen.
(212) Viernickel, Völkel, Focali, S. 17.
(213) Mecheril, Migrationspädagogik, S. 66:
„Ethnizität ist ein modernes Vergemeinschaftungsprinzip.
Ethnizität drückt eine Art von Zugehörigkeit zu Gruppen aus, die durch gemeinsame Praxen und Vorstellungen (etwa einer gemeinsamen Geschichte oder eines gemeinsamen Ursprungs) entstehen. Ethnische Gruppen gibt es also nicht an sich oder als »natürliche« Zusammenhänge. Die ethnische Unterscheidungsweise wird vielmehr in bestimmten historisch-gesellschaftlichen Bedingungen eingesetzt. Der Übergang vormoderner, im Wesentlichen religiös bestimmter Ordnungen zu jenen säkularen Formationen der Moderne ist auch deshalb von ethnischen und nationalen Mustern der Identifikation getragen, weil diese das Zerbrechen religiöser Gewissheiten kompensieren“.
Dabei verweist er auf Nassehi, Ethnizität.
(214) Messerschmidt, S. 220: „Die kulturalistischen Strategien machen aus dem Fremden einen entindividualisierten anderen, der nur noch Repräsentant (s)einer fremden Kultur ist. Es kommt zu einer Typisierung des Fremden durch Homogenisierung. Dem Fremden wird die Individualität verweigert. Er darf also genau das nicht sein, was in der modernen Leistungsgesellschaft als oberster Wert hochgehalten wird.“
(215) Mecheril, Migrationspädagogik, S. 113.
(222) Ebd., S. 129, wo er sich auf Kleiber/Wehner bezieht.
(226) Als Beispiel zitiere ich den Schluss-Satz Mecheril, Unreinheit, S. 101: „Das Krächzen der Anderen antwortet dem Krächzen der Nicht-Anderen; das Krächzen der Nicht-Anderen antwortet dem Krächzen der Nicht-Nicht-Anderen. In dieser Kakophonie des Irdischen glaubt niemand ernsthaft an Verständigung, obschon niemand die Orientierung daran aufgibt.“
(228) Melter, S. 27, unter Bezug auf Mecheril, Zugehörigkeitsmanagement.
(229) Räthzel, S. 212. Sie zitiert an dieser Stelle Salman Rushdie: „The Satanic Verses celebrate hybridity, impurity, intermingling, the transformation that comes of new and unexpected combinations of human beings, cultures, ideas, politics, movies, songs. It rejoices in mongrelization and fears the absolutism of the pure. Mélange, hotch-potch, a bit of this and that, is how newness enters the world. It is the great possibility that mass migration gives the world and I have tried to embrace it. The Satanic Verses is for change-by-fusion, change-by-cojoining. It is a love-song to our mongrel selves“.
(230) Badawia, Dritte Stuhl, S. 146.
(233) Feindt/Spenn, S. 189.
(236) Messerschmidt, S. 225.
(237) Die Fortbildung fand am 26. Oktober 2011 in der Evangelischen Lukasgemeinde Gießen zum Thema: „Kinder brauchen keine Dogmen. Umgang mit religiöser Vielfalt in der Kita“ statt, und es nahmen auch zwei Pfarrer und eine Gemeindepädagogin teil.
(238) Belinga Belinga, S. 1.
(240) Ebd. S. 4 (Beilage: Schaubild Individualismus und Kollektivismus).
(242) Den Namen des Projekts steuerte ein fünfeinhalbjähriger Junge mit dieser Frage bei (Hasan, S. 10 und 44).
(248) Viernickel/Völkel/Focali, S. 11ff.
(258) Ebd., S. 86. Vgl. das Handbuch von Arslanoğlu/Engin/Leue/Walter, S. 4, zum „Sprachförderkoffer“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
(260) In diesem Abschnitt mit drei Unterabschnitten stelle ich Beiträge aus dem Handbuch Kinderwelten vor; außerdem gehe ich zum Thema Rassismus auf ein Buch von Heidi Rösch und zum Thema Mehrsprachigkeit auf zwei Aufsätze von Peter Auer und Nermi Uygur ein.
(261) Derman-Sparks, S. 240f.
(262) Wagner, Vielfalt, S. 208, nach Gaine/Keulen, S. 11f.
(264) Schallenberg-Diekmann, S. 220, auch Anm. 1.
(267) Dommel, Diskriminierungsgrund, S. 148.
(271) Boldaz-Hahn, S. 104f.
(278) Wagner, Sprachen, S. 121, mit Bezug auf Phillipson.
(279) Ebd., S. 120. Die Zitate bzw. Ergebnisse stammen aus Deutsches Jugendinstitut, S. 101 bzw. 83ff.
(291) Ebd., S. 189. Vgl. auch den Artikel von Schiereis über den besuchsweisen Einsatz türkischer Erzieherinnen in bayrischen Kindergärten in den 90er Jahren.
(292) Hasan, S. 8. Vgl. zu diesem Thema das Kapitel 8.6.
(293) Gerlach, Sexuelle Orientierung, S. 179.
(295) Ebd., S. 175, mit Bezug auf eine Studie von Patterson.
(296) Ebd., S. 176f., mit Bezug auf Forschungen von Dunne.
(297) Dieser Abschnitt bezieht sich auf Beiträge aus dem Handbuch Integrative Religionspädagogik und einen Offenen Brief von John M. Hull an Jesus Christus.
(299) Ebd., S. 115, mit Bezug auf seinen Aufsatz Bach, Befreiung.
(302) Müller, Behinderung, S. 184.
(305) Steffensky, S. 124.
(313) 2. Mose 4, 11, übersetzt von Ebach ebd., S. 98. Mit „Adonaj“ = „mein Herr“ übersetzt Ebach den „Eigennamen JHWH…, von dem niemand weiß, wie er zu lesen oder zu sprechen wäre und den ich im Respekt vor der jüdischen Tradition mit der allein Gott vorbehaltenen Anrede Adonaj wiedergebe“.
(316) Sure 3, 49: „… ich heile den Blinden und den Aussätzigen, schenke den Toten Leben – mit Gottes Erlaubnis“ und Sure 5, 110: „… als du mit meiner Erlaubnis den Blinden und den Aussätzigen heiltest und die Toten herausbrachtest mit meiner Erlaubnis“ (nach [K] Zirker, Koran).
(324) Hull, Open Letter (Seitenangaben sind im Folgenden nicht möglich, da ich nur auf den Online-Text zugreifen kann).
(325) Ebd.: „A beautiful example of the tact and respect which you showed to blind people may be found in the story of the blind beggar, Bartimaeus. When he came to you, you did not assume that he wanted his sight restored but you asked him ‚what do you want me to do for you?‛ (Mk. 10:51). Now, a modern blind person would have replied ‚get me on a good training course where I can search the internet with voice synthesisers‛ but although Bartimaeus was not in a position to make this reply, it was at least nice to be asked.“
(326) Ebd.: „On an individual basis you are sensitive and tactful towards blind people, and while acknowledging their condition of economic deprivation, you insist upon their inclusion. Nevertheless, you did not include a blind person in your closest circle. In your presence blind people felt the hope and discovered the reality of the restoration of sight but you did not offer to blind people courage and acceptance in their blindness. You would have led me by the hand out of blindness but you would not have been my companion during my blindness.“
(327) Ebd.: „You accepted the ministry and friendship of women, even those who had a shady past, but blind people had to become sighted before they could follow you.“
(328) Ebd.: „the metaphorical use of blindness to suggest ignorance, stupidity and insensitivity.“
(329) Ebd.: „I am confused, Lord. I am not only hurt and puzzled; I am offended.“
(330) Ebd.: „’Can a blind person lead a blind person? Will they not both fall into a pit?’ (Lk. 6:39). Luke introduces this comment as being a parable, but the parable would have derived its force from the fact that it was a genuine belief held amongst sighted people about the behaviour of blind people. You, my Lord, are described as participating in this general belief, but this says more about the assumptions and the prejudices of sighted people than about the actual behaviour of those who are blind. Blind people depend upon familiarity. A blind person who was familiar with a certain route would offer to lead a blind stranger along that way. I have myself led blind people many times, and have in turn been led. We have never fallen into ditches, been run over on the road, or fallen down stairs, although I admit to an occasional confrontation with a rose bush. It is when I am being led by a sighted person that I sometimes have bad experiences. As I am walking through a department store the floor suddenly slides away from me and I almost lose my balance. ‘Sorry’, my sighted friend says. ‘I forgot to tell you that we are going down on the escalator’.
(331) Ebd.: „In these moments of de facto blindness, did you begin to know blindness from the inside? Did those words come back to you – ‚blind fools‘? Now you yourself are treated like a blind fool. Strangely, my indignation begins to die away. My questions are silenced. You have become a partner in my world, one who shares my condition, my blind brother.“
(332) Ebd.: „Later in the same day, they crucified you. From about mid-day, there was darkness over all the land. It was then that you cried out „My God, why have you forsaken me?“ (Mk. 15:34). In your agony and confusion, did you realise that there was an eclipse of the sun? Or did you think that once again they had blindfolded you? Or that perhaps you had indeed lost the power of sight? Was that perhaps why you felt forsaken by God, the God of light, the sighted people’s God? I cannot help wondering whether, after these experiences, your attitude to blindness is somehow different. On the road to Emmaus, the eyes of your two disciples were constrained, so that they were not able to recognise you (Lk. 24:16). You walked the road with two disciples who were in effect blind. Only when you broke the bread, were their eyes opened so that they could recognise you, and then you vanished from their sight (Lk. 24:31). Again, they became blind as far as you were concerned, but now it is the blindness of recognition, no longer the blindness of a failure to recognise. Sight has become more paradoxical.“
(333) Ebd.: „If sighted people can learn to adapt to the needs of blind people without patronising them, and if blind people can learn to accept sighted people without manipulating them, the new relationship of mutual acceptance between blind and sighted will have become a utopian whisper of a new world.“
(334) Ebd.: „Next, a theology of blindness will be constructive. It will propose that blind people reflect the image of God in their very blindness. It will show that the metaphor of blindness suggests in a positive way the essential characteristics of the life of faith. From a theology of blindness we can derive practical suggestions about social and political life. These might include the techniques of taking one step at a time, and concentrating on the concrete particularities of an otherwise overwhelmingly abstract problem. A theology of blindness like any theology of disability will challenge prevailing concepts about what is normal. The traditional view is that when the Kingdom of God comes, the eyes of the blind will be opened, the ears of the deaf will be unstopped, and the lame person will jump like a deer. A theology of blindness will show that instead of contemplating utopia in terms of a convergence upon a single image of normality, what we must converge upon is a wider acceptance of varieties as being normal. Normality must become inclusive. This will lead us into a critique of other forms of exclusion, including the most powerful of all, the exclusion of the poor by the rich. In some such way, a theology of blindness will offer a utopian promise of universal liberation.“‛
(335) Kobelt Neuhaus, S. 282.
