Im sechsten Kapitel des Buches bewegt sich Pfarrer Helmut Schütz im Raum der Interreligion, in dem man nicht seine religiöse Identität verliert, sondern Wärme, innere Kraft und Einfühlsamkeit gewinnt. Er setzt sich mit religiösen Zugängen zum Fremden auseinander, mit empirischer Forschung und Konzeptionen von religiöser Pluralität und evangelischem Profil im Kindergarten.
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
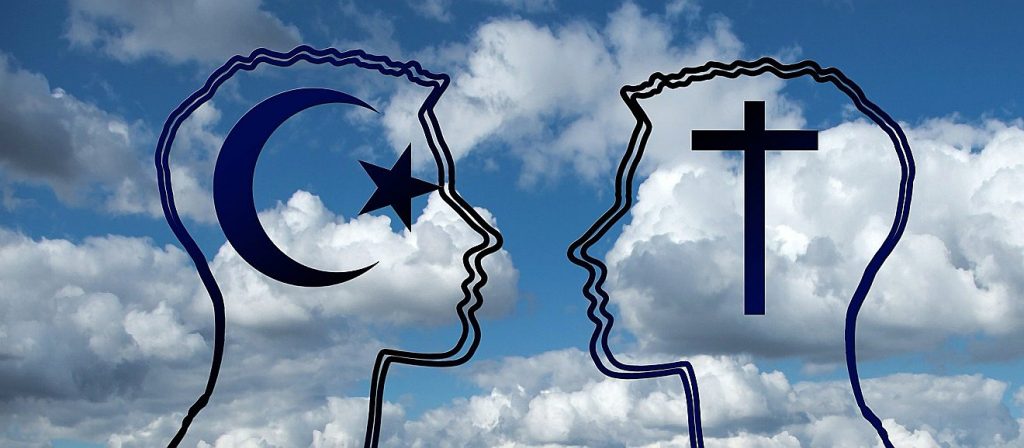
Inhalt dieses Kapitels
6.0 Religiöse Identität inmitten multireligiöser Vielfalt
6.1 Religiöse Zugänge zum Anderen und zum Fremden
6.1.1 Von der Begegnung mit dem Fremden zur Konvivenz
6.1.2 Der verborgene Gott und das Verstehen der Fremden
6.1.3 Interkulturelles Lernen aus islamischer Sicht
6.2 Empirische Forschung über Religion und Interreligiosität im Kindergarten
6.2.1 Eine ökumenische Pilotstudie zu interreligiöser Bildung in der Praxis
6.2.2 Eva Hoffmanns empirische Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt
6.3 Umgang mit religiöser Pluralität im Kindergarten
6.3.1 Friedrich Schweitzer: Suche nach einem kombinierten Modell
6.3.2 Frieder Harz: Interreligiöse Mogelpackung aus Beheimatungs- und Gastmodell
6.3.3 Matthias Hugoth: Versuch der Beheimatung aller Kinder in ihrer jeweiligen Religion
6.4 „Evangelisches Profil“ nach Frieder Harz
6.4.1 Vier Leitgedanken religiöser Erziehung im evangelischen Kindergarten
6.4.2 Betonung der Unterscheidung „meine Religion“ – „deine Religion“
6.4.3 Erziehungspartnerschaft und Werteerziehung mit Ausblendungen und Abwehr
6.5 John M. Hull: Christliche Identität der Absolutheit oder der Ganzheit
6.6 Henning Luther: Fragmentarische Ich-Identität
↑ 6.0 Religiöse Identität inmitten multireligiöser Vielfalt
Bei der Betrachtung der verschiedenen Konzepte zur Religionspädagogik ist der Bereich der interreligiösen Begegnung schon mehr oder weniger zentral angesprochen worden. Trotzdem will ich mich in einem eigenen Kapitel noch einmal besonders auf dieses Themenfeld konzentrieren, und zwar von verschiedenen Blickwinkeln aus. Es geht um grundsätzliche Fragen zur Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden im religiösen Bereich, es geht um Forschungsergebnisse zum interreligiösen Lernen im Kindergarten, es geht um Modelle des Umgangs mit religiöser Pluralität im Kindergarten und schließlich geht es um die Frage, wie die eigene religiöse Identität inmitten der multireligiösen Vielfalt bewahrt werden kann.
In der Überschrift habe ich analog zum oben verwendeten Begriff „Interkultur“ den bislang ebenfalls ungebräuchlichen Begriff „Interreligion“ verwendet, um den gedanklichen Raum zu bezeichnen, in dem verschiedene Religionen miteinander in Beziehung treten, zumal die Begriffe „interkulturell“ und „interreligiös“ oft in einem Atemzug genannt werden. Im Raum der Interreligion begegnen sich Menschen verschiedener Religionszugehörigkeit; darin bewegen sich aber auch einzelne Menschen, die religiös „zwischen den Stühlen sitzen“, zum Beispiel, weil ihre Eltern unterschiedlicher religiöser Herkunft sind.
Als Einwand könnte vorgebracht werden, dass man zwar von Interkultur im Singular reden könne, da auch Kultur ein allen Menschen gleichermaßen zukommendes, wenn auch unterschiedlich geprägtes Element sei, in dem sie sich bewegen wie Fische im Wasser, während es Religion immer nur im Plural gebe, die nicht miteinander vermischt werden dürfen, wenn es nicht zu synkretistischen Missbildungen kommen solle.
Ich finde aber, dass die eigene christliche Identität, die geklärt werden muss, wenn man sich auf interreligiöse Zusammenarbeit und auf die Trägerschaft einer multireligiösen Kita einlässt, durchaus erhalten und sogar gestärkt werden kann, wenn man sich auf die Herausforderungen und Chancen im Raum der Interreligion – vom eigenen Glauben getragen – offen einlässt.
↑ 6.1 Religiöse Zugänge zum Anderen und zum Fremden
Zunächst setze ich mich mit theologischen Ansätzen auseinander, denen es um das Problem des Verstehens in interkulturell-interreligiösen Zusammenhängen geht. Diese Thematik überschneidet sich mit den Anliegen des Kapitels 3 zur Interkultur, sowohl in den Ausführungen eines islamischen Religionspädagogen (6.1.3) als auch der beiden christlichen Missionswissenschaftler (6.1.1 und 6.1.2). Letzteren geht es darum, in der Begegnung mit fremden Kulturen neue Ausdrucksformen für die christliche Botschaft zu finden. Versteht man Mission nicht als eine machtvolle Überwältigung oder Vereinnahmung von Menschen anderer Religionszugehörigkeit, sondern als ein zur-Sprache-Bringen der zentralen Anliegen der eigenen Religion im respektvollen Dialog mit Anders-Glaubenden, dann können die folgenden Überlegungen auch als sinnvolle Einführung in den Raum der Interreligion dienen.
↑ 6.1.1 Von der Begegnung mit dem Fremden zur Konvivenz
In der Einleitung zu einem Sammelband mit „Plädoyers für eine interkulturelle Hermeneutik“ unter dem Titel „Die Begegnung mit dem Anderen“ schreiben Theodor Sundermeier und Werner Ustorf bereits im Jahr 1991:
„Wir stehen heute vor nichts Geringerem als der Aufgabe, einen neuen Weg der Begegnung mit dem anderen Menschen, dem Fremden zu suchen. Es muss eine Begegnung sein, die den anderen in seinem Subjektsein, in seiner kulturellen und religiösen Identität und Eingebundenheit anerkennt und zugleich eine Gemeinsamkeit eröffnet, in der Dialog und gemeinsames Leben möglich sind, in der Differenz und Identität in gleicher Weise ihr Recht haben.“ (536)
Folgt man Theodor Sundermeier, mag das im Kapitel 3.1.1 von Paul Mecheril beschriebene Problem des vereinnahmenden Erkennens auch damit zu tun haben, dass
„es sich in der abendländischen Hermeneutik … immer um das Verstehen meiner selbst handelt. Es geht nicht um das Verstehen des anderen Menschen, des fremden Textes, sondern um ein neues Michverstehen, ausgelöst durch die Begegnung mit dem Text. Der Andere, das Fremde, ist schon bei Hegel nur Umweg zum Selbst… Das verstehende Gespräch ist dann letztlich Selbstgespräch.“ (537)
Sundermeier hält dagegen:
„Verstehen muss im Aushalten des Fremden, Anderen geschehen, oder es findet gar nicht statt. Es ist schlicht falsch und führt nicht weiter, wenn bei der Darstellung einer fremden Kultur die Hörer immer schon den Vergleich zur Hand haben und die Einebnung mit dem Satz beginnt: »Das haben wir bei uns auch.«“
Der jüdisch-christlichen Tradition können andere Impulse entnommen werden; für die Bibel gilt:
„Erkenntnis gibt es überhaupt nur, weil es den anderen gibt. Er ermöglicht Erkenntnis und konstituiert damit letztlich auch mich selbst. Paulus jedenfalls sieht es so, wenn er ganz in der Tradition des AT das Erkanntwerden durch den anderen, und das heißt dem An-Erkanntwerden, absolute Priorität zugesteht und als den Ermöglichungsgrund von Erkenntnis überhaupt ansieht: Dann werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin!“ (538)
Sundermeier greift auf Erkenntnisse des „der jüdischen Tradition verpflichtete[n] Philosoph[en] Emmanuel Lévinas“ zurück (539), wenn er schreibt:
„Indem… der Andere mein Ich in seinem Existenzrecht konstituiert, wird gerechtfertigtes Dasein möglich. Doch das ist kein individuelles Ich mehr, das für sich existiert, sondern im Zusprechen wird Gemeinschaft konstituiert. … Nicht zufällig spricht Lévinas vom Antlitz des Anderen, das hervorleuchtet, und von der Spur, die unsere Zeit durchkreuzt und Zeiterfahrung in neuer Form ermöglicht.“ (540)
Aus dieser Vorstellung eines Verstehens, das es nur dort gibt, wo man in einer Gemeinschaft miteinander lebt, entwickelt Sundermeier seine Vorstellung von dem, was er „Konvivenz“ (541) nennt:
„»Weil wir sind, bin ich«, heißt das afrikanische Grundmodell der Erfahrung des Anderen. Die Konvivenz ist Ermöglichungsgrund des Lebens des einzelnen. Sie ist der Freiheitsraum gegeben zum Lernen, Lehren, Feiern, kurz, zum geschwisterlichen Leben im Frieden. Dieses Leben, das Wollen zum andem hin, das Streben nach Verstehen und Erkenntnis stammt aus der Lebensbejahung, aus dem Wissen des verdankten Lebens, aus der Erfahrung, bejaht und angenommen zu sein. In theologischer Sprache: aus dem Glauben an den Schöpfer allen Lebens und der Welt.
Wir halten fest: Die Notwendigkeit einer Hermeneutik interkulturellen Verstehens ist nicht geboren aus dem Streben nach mehr Wissen, nach Exotik, aus dem Bewusstsein heraus, dass wir mit unserem Wissen allein die gegenwärtigen Weltprobleme nicht bewältigen können. Nicht Defiziterfahrungen begründen also eine Hermeneutik, sondern die Erfahrung gemeinsamen Lebens. Im Aufleuchten des Antlitzes des anderen gewinnt mein Leben Lebensraum, Bejahung und Recht. Im Verstehen des anderen wird mein Leben aus seiner Egozentrik und seinem Solipsismus herausgerissen. Dabei wird im Verstehen der andere nicht zu mir hin assimiliert – ein Antlitz kann ich nicht assimilieren, sondern nur hinnehmen und akzeptieren. In der Andersheit erfahre ich, was Dasein, Leben und Freiheit ist. Damit wird das Verstehen zur fundamentalen, allem Handeln vorangehenden Aufgabe.“ (542)
Wichtig ist dabei,
„dass die Hermeneutik einer interkulturellen Begegnung nicht auf Harmonie aus ist. Sie ist Begegnung mit dem Fremden. Das muss in dieser Härte auch durchgehalten werden. Es ist falsch, das Fremde im Verstehen vorschnell zu sich hin interpretieren zu wollen, es in das eigene Selbstverständnis zu inkorporieren und damit aus dem Gegenüber ein je Eigenes zu machen, wie es in verschiedener Form in der bisherigen Hermeneutik der Fall war. … Erst wenn wir das in seiner Tiefe wahrnehmen, verstehen wir auch, warum es so befremdlich ist, dass Jesus sich mit dem Fremden identifiziert, warum wir uns dagegen wehren, im Begriff und Antlitz des anderen das Verweisende, den einen Anderen wahrzunehmen.“ (543)
↑ 6.1.2 Der verborgene Gott und das Verstehen der Fremden
Henning Wrogemann findet in der Theologie Jürgen Moltmanns „Anknüpfungspunkte für eine interkulturelle Hermeneutik“, geht aber auch über ihn hinaus, indem er nicht nur die Frage stellen will, „wie Fremde in unsere Gemeinschaft integriert werden können“, sondern Wege sucht, um „die Gemeinschaft der Fremden“ theologisch zu verstehen und zu akzeptieren:
„Theologisches Verstehen des Fremden kann nur dann radikal gedacht werden, wenn die Alterität des Fremden ein Pendant im eigenen Gottesbegriff hat“ (544),
wenn es also in Gott selbst etwas gibt, das so anders ist, dass wir es von unseren eigenen Glaubensvorstellungen nicht erfassen können. Zu diesem Zweck greift er auf die lutherische „Lehre von der absconditas dei“, also von der Verborgenheit Gottes zurück.
„Wenn nämlich Gott als der sendende geglaubt, in der Begegnung mit der Welt jedoch der fremde Gott bleibt, dann ist dem Versuch des Menschen, den Fremden nach dem »Bilde« seines Gottes wahrzunehmen, gewehrt. …
Auf das Verstehen des Fremden angewendet ist zu folgern: Nur wo in der Begegnung mit dem Fremden Gottes radikale Verborgenheit geglaubt werden kann…, weist der Glaube in eine hermeneutische Situation ein, die ein zureichendes Maß an Offenheit zulässt. …
Ein wirkliches Verstehen des Fremden setzt … voraus, dass die Kraft des Negativen ausgehalten wird… Der Weg zum Fremden unter dem Aspekt von Handlung oder Bedürftigkeit reicht dazu nicht aus. Auch der »Feind«, der drohende, der mich in meiner Identität verneint, muss in den Horizont der Verstehensbemühungen rücken. Vielleicht könnte ein Verständnis der Verborgenheit Gottes weiterhelfen, das Gott zutraut, sich aus Liebe zu verbergen, um sich von seiner Gemeinde im Fremden als Fremden finden zu lassen.“ (545)
↑ 6.1.3 Interkulturelles Lernen aus islamischer Sicht
Kurz gehe ich auf Überlegungen des islamischen Religionspädagogen Harry Harun Behr ein, der im „Handbuch Friedenserziehung“ aus islamischer Perspektive auch den Kulturbegriff und das interreligiöse Lernen beleuchtet. Er wählt den koranischen Begriff der „Achtsamkeit“ (ihsān) als anzustrebende Fähigkeit und Haltung für ein gelingendes Miteinander im Rahmen einer kompliziert gewordenen schulkulturellen Lage:
„Achtung ließe sich für die islamische Religionspädagogik wie auch für eine pädagogisch verantwortungsvolle Pflege der Schulkultur vielleicht als subjektives Handlungsmotiv bezeichnen, hinter dem Achtsamkeit als Fähigkeit (wahrnehmen können) und als Haltung (wahrnehmen wollen) stehen muss“ (546).
Zum Kulturbegriff schreibt Behr:
„Kultur, verstanden als Hort konsensualer Gepflogenheiten, beruht auf nicht mehr bewussten, da überlieferten und durch persönlichen Lebensbezug internalisierten Werte- und Ordnungssystemen. Sie kann sich der kognitiven Erfassung entziehen. Das betrifft auch die in ethischer Hinsicht kritischen Elemente von Kultur, die eventuell einer Neubewertung und damit der kognitiven Rekapitulation bedürfen; diese kann nur dadurch geleistet werden, dass Handlungsweisen, die als Kultur identifiziert werden, nach ihren Motiven und Wirkungen befragt werden. Dazu müssen sie wieder aktiv wahrgenommen und ins denkende Bewusstsein zurückgeholt werden (Achtsamkeit). Güte der Achtsamkeit liegt nicht in ihrer objektiv beschreibbaren Sittlichkeit oder Tugendhaftigkeit begründet, sondern im Grad der Willentlichkeit, Zielgerichtetheit und Bewusstheit als theologisch maßgebliche spirituelle Wertkriterien achtsamen Handelns (Achtung).“ (547)
Behrs Blick auf interkulturell-interreligiöses Lernen mit seinem Interesse an der Veränderung von Perspektiven der Wahrnehmung und dem Hin- und Herspringen zwischen sich veränderndenden Standpunkten erinnert mehr an Mecheril als an Sundermeier und Wrogemann:
„Interkulturelles Lernen, das heute auch mit Blick auf den Islam in Deutschland nicht selten synonym genannt wird mit interreligiösem Lernen, beruht weder auf der Wahrnehmung und Beschreibung von kulturellen oder theologischen Beständen noch allein auf den Imperativen der Achtung, sondern auf den Kommunikationsprozessen, die die hier beschriebene Form von Bewusstmachung ermöglichen. Dabei geht es weniger um die Wahrnehmung des Fremden von der eigenen Warte aus, sondern um die Revision des jeweils Eigenen zufolge veränderter Perspektiven. Für die Didaktik des Schullebens bedeutet das die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit und der Befähigung, veränderte Standpunkte einnehmen zu können.“ (548)
↑ 6.2 Empirische Forschung über Religion und Interreligiosität im Kindergarten
Zur tatsächlich gelebten interreligiösen Praxis in deutschen Kindergärten ist bisher vergleichsweise wenig geforscht worden. Während meines Studienurlaubs sind mir zwei Untersuchungen aufgefallen, die erst vor kurzem veröffentlicht wurden.
↑ 6.2.1 Eine ökumenische Pilotstudie zu interreligiöser Bildung in der Praxis
Die beiden evangelischen und katholischen Tübinger Religionspädagogen Friedrich Schweitzer und Albert Biesinger initiierten eine Pilotstudie in konfessionell und nicht-konfessionell getragenen Kindertagesstätten in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim/ Ludwigshafen, Stuttgart, Aachen und Dresden, deren Ergebnisse im 2008 erschienenen Buch „Mein Gott – Dein Gott“ veröffentlicht wurden.
„Im qualitativen Teil des Projekts haben wir 37 Interviews durchgeführt und ausgewertet…
Im quantitativen Teil … erarbeiteten wir … einen vierseitigen Fragebogen… Sein inhaltlicher Schwerpunkt ist die interreligiöse Bildung. Den Fragebogen versandten wir 1698mal an Kindertagesstätten in den genannten sieben Städten. 364 ausgefüllte Fragebogen wurden zurückgesandt und von uns ausgewertet. Damit haben wir einen Rücklauf von 21,4 Prozent, was ein zufriedenstellendes Ergebnis für eine Fragebogenstudie ohne Direktkontakt ist.“ (549)
Gefragt wurde inhaltlich nicht nur nach interreligiöser Bildung und danach, ob christliche oder muslimische Bildungsinhalte in der Kita vorkommen, sondern auch,
„ob eine grundsätzliche Offenheit für religiöse Bildung in den Einrichtungen vorhanden ist und ob religiöse Bildung von den Kindertagesstätten in allgemeiner Form unterstützt wird – unter Absehung von bestimmten Religionen oder Konfessionen“ (550).
Wie unterschiedlich in Kindergärten mit dem interreligiösen Miteinander umgegangen wird, zeigte sich in der qualitativen Befragung vor allem am Beispiel der „Feste mit religiösem Ursprung“. Manche von ihnen werden „gar nicht gefeiert“, was „besonders bei islamischen Festen“ der Fall ist. Oder man feiert Feste „mit bewusstem Ausklammern des religiösen Aspekts…: das Osterfest wird zum Frühlingsfest, das St. Martinsfest zum Lichterfest.“ Wenn religiöse Feste „unter Aufnahme des religiösen Ursprungs“ gefeiert werden, wird nicht in allen Einrichtungen „die Anwesenheit der Kinder mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund bei der Feier deutlich reflektiert“. Oder man feiert „Feste mit religiösem Ursprung auf einer allgemein-religiösen Ebene, sozusagen oberhalb oder jenseits der konkreten einzelnen Religion“ (551).
Interessant waren besonders folgende Ergebnisse der quantitativen Befragung: Im Durchschnitt besuchen etwa 55/42 Prozent christliche, 18/27 Prozent muslimische und 20/18 Prozent konfessionslose Kinder die genannten Kindergärten, dabei bezieht sich die erste Prozentzahl auf die konfessionellen, die zweite auf die nicht-konfessionellen Kindergärten; der Rest, jeweils unter 5 Prozent, entfiel auf Kinder anderer Religionszugehörigkeit (552). Eine „allgemeine Unterstützung der religiösen Bildung“ findet „viel“ bis „sehr viel“ in 74 Prozent und „mittelmäßig“ in 22 Prozent der konfessionellen Kindergärten statt, in nicht-konfessionellen Einrichtungen immerhin noch 10 Prozent „viel“ bis „sehr viel“ und 41 Prozent im Mittelmaß (553). Prinzipiell ist also eine Mehrheit der befragten Erzieherinnen durchaus offen für religiöse Bildung im Kindergarten. Dass 97 Prozent der kirchlichen Kitas „ihren christlichen Bildungsauftrag, zumindest nach ihren eigenen Aussagen, sehr ernst“ nehmen, verwundert ebensowenig wie die Tatsache, dass in „rund 84 Prozent der nicht-konfessionellen Einrichtungen … »kaum« bis »wenig« christliche Bildung“ stattfindet. Allerdings: „In 16 von 100 befragten städtischen Einrichtungen wird das Christentum inhaltlich aufgenommen“, in drei Prozent sogar „viel“ bis „sehr viel“ (554).
Alarmierend sind die Zahlen für den Bereich der islamischen und der interreligiösen Bildung.
„Bei der Berücksichtigung der islamischen Bildung gibt es kaum Unterschiede zwischen konfessionellen und nicht-konfessionellen Einrichtungen. Bei den konfessionellen Einrichtungen sind es 75 Prozent, die die islamische Bildung »kaum« berücksichtigen, und 18 Prozent, die sie »wenig« berücksichtigen. D. h. 93 Prozent der konfessionellen Einrichtungen lassen diese Thematik außen vor und bei den nichtkonfessionellen Einrichtungen sind es 91 Prozent.“
Das bedeutet im Klartext:
„Die rund 5 000 muslimischen Kinder…, die in den von uns befragten Einrichtungen betreut werden, erhalten so gut wie keine religiöse Begleitung. Das Verständnis ihrer Religion wird fast nicht gefördert. Zugleich erhalten die in der gleichen Einrichtung anwesenden christlichen Kinder und die Kinder ohne Bekenntnis ebenfalls nur wenige Informationen über den Islam.“ (555)
Ähnliches gilt für die interreligiöse Bildung: Sie findet in
„71 Prozent der konfessionellen Einrichtungen … »kaum« bis »wenig« Berücksichtigung… In den nicht-konfessionellen Einrichtungen liegt diese Zahl bei »91 Prozent«… Diese Zahlen zeigen, dass im Bereich der interreligiösen Bildung ein besonderer Handlungsbedarf besteht.“ (556)
Die Autoren ziehen aus diesen Ergebnissen mit Recht den Schluss:
„Offenbar beginnen die in Deutschland ungelösten Probleme der gesellschaftlichen Integration bereits in der Kindheit. Das öffentliche Bewusstsein dafür ist allerdings noch wenig ausgeprägt.
… Kinder haben ein Recht auf Religion und religiöse Begleitung, so wie sich dies auch viele Eltern wünschen, nicht zuletzt auch Eltern mit islamischer Religionszugehörigkeit. … Es ist Zeit, dass wir uns den Herausforderungen interreligiöser Bildung stellen.“ (557)
↑ 6.2.2 Eva Hoffmanns empirische Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt
Eva Hoffmann veröffentlichte 2009 unter dem Titel „Interreligiöses Lernen im Kindergarten?“ eine „empirische Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt in Diskussionen mit Kindern zum Thema Tod“.
Lesenswert ist dieses Buch nicht nur wegen ihrer eigenen Forschungsergebnisse, sondern auch, weil sie sich intensiv „mit dem Religionsbegriff und der so genannten Theologie der Religionen aus christlicher Sicht“ (558) befasst und auch die „beiden gegenwärtigen Konzepte zum interreligiösen Lernen im Kindergarten, die bislang von evangelischer (insbesondere von Harz) und katholischer (hauptsächlich von Hugoth) Seite vorgelegt wurden“ kritisch analysiert (559).
Ihre eigene wissenschaftliche Studie führte sie mit Hilfe des „Gruppendiskussionsverfahrens und der Dokumentarischen Methode“ in vier evangelischen Kindergärten einer nordrhein- westfälischen Großstadt durch (560). Sie befragte jeweils Mini-Gruppen von drei Kindern und nahm dabei eine Handpuppe zu Hilfe, um zu vermeiden, dass die Kinder in der Diskussion
„die Position der bzw. des an dem Gespräch beteiligten Erwachsenen einnehmen… In einem Puppenspiel lässt sich dies gut vermeiden, weil die bzw. der erwachsene Gesprächspartnerin bzw. -partner über die Puppe in der Regel als gleichberechtigt wahrgenommen wird.“ (561)
Als Ergebnis formulierte Eva Hoffmann „vor dem Hintergrund anderer empirischer Studien und ihren theoretischen Implikationen“ über das interreligiöse Lernen von Kindergartenkindern folgende „Thesen:
• Der Vielfalt von individuellen Vorstellungen wird mit Gelassenheit begegnet.
• Bezüge zu religiösen Glaubenstraditionen werden nicht explizit hergestellt.
• Den eigenen, individuellen religiösen Vorstellungen wird besondere Geltung verliehen.
• Differenzen werden wahrgenommen, ausgehalten, aber nicht besonders hervorgehoben.
• Gerne wird ein ‚kleiner gemeinsamer Nenner‛ gefunden.
• Bemühungen um eine ‚gemeinsame‛ Theologie oder ‚new theologies‛ zeigen sich aber nicht.
• In der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Studie ereignen sich keine Szenen xenophobischer Angst oder Furcht. Es zeigt sich vielmehr eine für die Überlegungen anderer Kinder offene Haltung.
• Einige Diskussionsbeiträge zeigen Merkmale eines explizit multireligiösen Stils interreligiöser Verhandlung auf …
• … andere Diskussionsbeiträge können mit dem implizit multireligiösen Stil interreligiöser Verhandlung in Verbindung gebracht werden.“ (562)
↑ 6.3 Umgang mit religiöser Pluralität im Kindergarten
Einen genaueren Blick werfe ich nun auf die Vorstellungen zum Bereich „Interreligion“, die christliche Religionspädagogen in den Konzeptionen für Kitas in kirchlicher Trägerschaft entworfen haben.
Sowohl im katholischen religionssensiblen wie im evangelischen dimensionalen Ansatz gibt es Unklarheiten über den Umgang mit religiöser Pluralität sowie Platz und Rolle der nichtchristlichen Kinder im Kindergarten.
↑ 6.3.1 Friedrich Schweitzer: Suche nach einem kombinierten Modell
Friedrich Schweitzer beschreibt „drei gegensätzliche Modelle“, um dieses Problem zu lösen:
„Das Beheimatungsmodell, das einen religiös einheitlichen (»homogenen«) Kindergarten verlangt; das Begegnungsmodell, das die im Kindergarten vorhandenen Unterschiede nicht aufheben, sondern als Lernanlässe im Sinne eines interreligiösen Lernens nutzen will, und ein multireligiöses Modell, das eine einheitliche religiöse Erziehung für alle – unter Aufnahme verschiedener Konfessionen und Religionen – anstrebt. Alle drei Modelle haben etwas Richtiges an sich, aber alle drei sind unseres Erachtens dann abzulehnen, wenn sie einseitig vertreten werden. Wir brauchen deshalb ein viertes Modell oder, vorsichtiger, einen Weg, der eine Kombination von Beheimatung und Begegnung erlaubt.“ (563)
Gegen das Beheimatungsmodell spricht
„die Tatsache, dass Kinder heute auch in Deutschland nirgends mehr in einer einheitlich geprägten Umwelt aufwachsen. … Der religiös einheitliche Kindergarten wäre Ausdruck einer künstlichen Einheitlichkeit, die praktisch nicht realisierbar und die bildungstheoretisch … auch nicht wirklich zu wünschen wäre. Bildung setzt Unterschiede und Wahlmöglichkeiten voraus. Im übrigen wird die Bedeutung von Religion im Kindergarten für eine Beheimatung des Kindes leicht überschätzt: Die im Kindergarten mögliche religiöse Erziehung kann bestenfalls beitragen zu einer religiösen Beheimatung – sie allein gewährleisten, gar ohne Unterstützung durch Elternhaus und Gesellschaft, das kann sie gewiss nicht.“
Das Begegnungsmodell beruht ebenfalls auf Voraussetzungen, die in einer Situation wie heute nicht mehr gegeben sind,
„in der die meisten Kinder kaum eine eigene religiöse Prägung in den Kindergarten mitbringen.“
Das multireligiöse Modell, das „alle Kinder mit Elementen der verschiedenen Religionen … vertraut machen“ will, lehnt Schweitzer ebenfalls ab, wenn
„dabei die Unterschiede zwischen den Religionen für die Kinder in den Hintergrund treten sollen, weil alle bei allem in gleicher Weise mitmachen sollen“.
Ein solches Modell nimmt außerdem
„trotz der beabsichtigten religiösen Toleranz erstaunlich wenig Rücksicht auf die Glaubensüberzeugungen der Kinder und Eltern. Nicht jeder Christ kann ein islamisches Fest gläubig mitfeiern, und umgekehrt gilt wohl dasselbe.“
Er geht außerdem davon aus, dass Kindergartenkinder noch keine „Zuordnungen zu abstrakten Größen“ im Sinne verschiedener Religionszugehörigkeiten vornehmen können, „ihre Zugehörigkeitsgefühle sind stark von den Beziehungen zu Eltern oder anderen Erwachsenen abhängig.“ (564)
Schweitzer empfiehlt daher angesichts eines Mangels
„an Erfahrungen, aber auch an gesicherten empirischen und theoretischen Erkenntnissen in Psychologie und Religionspädagogik, auf die sich die Entscheidung für ein bestimmtes Modell stützen könnte…, angesichts der jeweiligen Voraussetzungen und Gegebenheiten in jeder einzelnen Einrichtung nach angemessenen Wegen zu suchen. Die in den drei genannten Modellen jeweils enthaltenen richtigen Einsichten können dabei aufgenommen und miteinander verbunden werden – etwa als bewegliche Kombination von Beheimatung und Begegnung, die im Horizont multireligiöser Bildung auszulegen ist.“ (565)
↑ 6.3.2 Frieder Harz: Interreligiöse Mogelpackung aus Beheimatungs- und Gastmodell
Frieder Harz entwickelte aus diesen Modellen ein kombiniertes Beheimatungs- und Gastmodell mit eindeutigem Vorrang für das evangelische Profil vor der interreligiösen Begegnung (566). In seinem Aufsatz „Interkulturelles und interreligiöses Lernen in Kindertagesstätten“ begründet er diese Entscheidung von folgender Grundthese aus:
„Vor allem die monotheistischen Religionen vertreten mit dem Glauben an den einen Gott einen Wahrheitsanspruch, der andere religiöse Vorstellungen und Glaubenspraxis ausschließt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Ansätze interreligiöser Erziehung und Bildung.“ (567)
Eigentlich wäre ein Beheimatungsmodell wünschenswert, das er den „Ansatz des primär monoreligiösen Lernens“ nennt. „Religiöse Identität“ von Kindern bildet sich nämlich „sinnvollerweise in der Auseinandersetzung mit der Religion, der man sich zugehörig fühlt, und mit Personen, die sie repräsentieren“ heraus.
„Daraus ergibt sich die religionspädagogische Aufgabe, ganz gezielt solcher Zugehörigkeit und der Förderung der Verwurzelung in ihr erste Priorität zu geben. Je weniger Kinder vom Elternhaus her durch entsprechende religiöse Sozialisation eine tragfähige religiöse Identität vermittelt bekommen, umso mehr ist es Aufgabe von Kindertagesstätte und Schule, zur Ausbildung solcher Identität zu verhelfen – zumal sehr viele Eltern daran interessiert sind, dass die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen dies leisten.“
Trotzdem lehnt Harz wie Schweitzer dieses Modell „erst Verwurzelung, dann Öffnung“ ab, denn:
„Dieses Konzept aber ignoriert die Realität, die genau gegenläufig strukturiert ist: In der konfessionellen Kindertagesstätte ist religiöse Vielfalt weithin im täglichen Miteinander lebendig, während dann später im konfessionellen Religionsunterricht die Kinder getrennt nach ihrer Konfession bzw. Religion unterrichtet werden.“
Deutlich sagt Harz an die Adresse von kirchlichen Einrichtungen, die jede „Verunsicherung durch die Präsenz und Thematisierung anderer religiöser Traditionen“ vermeiden wollen: „Das christliche Profil der Einrichtung darf nicht dazu herhalten, die Präsenz von Kindern und Eltern anderer Religionen einfach zu ignorieren.“ (568)
Auch den „Ansatz des multireligiösen Lernens“ lehnt Harz mit ähnlichen Argumenten wie Schweitzer ab. Er fügt hinzu:
„Dieser Ansatz passt gut zu der heute weitverbreiteten Einsicht, man könne sich aus dem Angebot der unterschiedlichen Religionen sein eigenes »religiöses Menü« zusammenstellen: christliche Feste, Seelenerkundung bei einem indischen Guru, keltische Sonnwendfeier usw. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Patchwork-Religiosität, die sich das Individuum selbst »zusammenbastelt«. Religion braucht aber die Bindung an geschichtliches Gewordensein, das seine Kontinuität ausmacht. Aus der Orientierung an verpflichtenden Quellen wächst dann auch die Kraft zu nötigen Veränderungen. Wo Glaube primär das Ergebnis eigener Zusammenstellung aus verschiedenen Traditionen ist, wird er zur individuellen Schöpfung und verliert die Bindung an das außer einem selbst Liegende. Vordergründig scheint dieser multireligiöse Ansatz dem Kind als Subjekt seines Lernens zu entsprechen. Kindliches Entdecken und Erkunden richtet sich aber auf die Umwelt in ihren gegebenen Strukturen, und dazu gehören in religiöser Hinsicht die Religionen mit ihren je spezifischen, nicht austauschbaren Überlieferungen.“
Harz fürchtet vor allem „die ungeordnete religiöse Vielfalt“, die – so der Verdacht, den er äußert –
„mit multireligiöser Erziehung gefördert wird. Was bei diesem Ansatz zu kurz kommt, ist der Erwerb religiöser Identität. Wie soll man in all der Vielfalt erkennen und erleben können, dass jede Religion ihre eigene Mitte hat, aus der heraus erst ihre Lehren, Haltungen und Verhaltensweisen verständlich werden? Wie sollen Kinder zu dieser Mitte vorstoßen, Zugehörigkeit zum Eigenen entwickeln können?“ (569)
Im Unterschied zu Schweitzer nennt Harz als drittes Modell nicht ein Begegnungsmodell, das von der unrealistischen Voraussetzung ausgeht, dass die Kinder bereits mit einer fest ausgebildeten religiösen Beheimatung in den Kindergarten kommen, vor der aus die anderen Religionen begegnen können, sondern einen „Ansatz des interreligiösen Lernens“, in dem gleichzeitig „Beheimatung und Öffnung“ gefördert wird.
„Er zielt darauf, im zunehmenden Bewusstmachen der Unterscheidung von Eigenem und Fremdem die Fähigkeit des Dialogs mit dem Anderen zu entwickeln. Dazu gehört sowohl das Entdecken religiöser Heimat als auch das Einüben von Umgangsweisen mit Fremdem. Es geht also um die schwierige Aufgabe, Beheimatung in einer eigenen religiösen Tradition und das Geltenlassen des Anderen und Fremden gleichermaßen anzustreben. Mit dem Heimischwerden im eigenen Traditionszusammenhang gilt es gleichzeitig in den verständnisvollen Umgang mit fremder Religion und Religiosität einzuüben. Religion begegnet in solcher Weise von Anfang an standortbezogen, sofern es um religiöse Verwurzelung geht, und sie erscheint plural, sofern Fremdes in seiner Andersartigkeit zu achten ist. Ziel ist der tolerante Umgang mit dem Anderen.“
Um den von ihm favorisierten Ansatz zu erläutern, wählt Harz die Metapher des religiösen Hauses:
„Es gilt also zum einen, das Erleben von religiöser Zugehörigkeit zu fördern. Kinder sollen entdecken, was alles im eigenen religiösen »Haus« zusammengehört und von Traditionen geprägt ist, die nicht einfach austauschbar sind.
Das Kennenlernen des eigenen Glaubens wird zum anderen begleitet vom gleichzeitigen Wahrnehmen der religiös anderen, von Interesse an deren religiösen Heimat, samt Besuchen dort. Kinder lernen so auch, mit den anderen und ihren Gewohnheiten mitzudenken. Dazu gehört natürlich auch das Entdecken von Gemeinsamkeiten und deren Pflege. So erfahren sie, dass Religion ein Gefüge von Überzeugungen, Wissen, Einstellungen, Verhaltensweisen ist, das sich von anderen unterscheidet, das man nicht nach Lust und Laune wechselt; sie lernen, dass sie Christen oder Muslime sind, und zugleich, dass beides gut nebeneinander bestehen kann.“
Weiter bezieht Harz seine Metapher des Hauses bzw. der Wohnung auf alle drei von ihm genannten Modelle:
„Die vorgestellten drei Ansätze lassen sich auch mit dem Bild der Wohnung anschaulich machen: das eine ist die abgeschlossene Wohnung; Besuche in anderen Wohnungen werden zunächst vermieden. Das andere ist die Großraumwohnung, in der man sich selbst sein Eckchen sucht und herrichtet. Zum interreligiösen Lernen passt das Bild der einladenden Wohnungen. Die Einzelwohnung verkörpert das Eigene, das, was einem in dem Kreis der hier Lebenden lieb und wert ist. Aber jede Wohnung hat ihre Tür nach draußen. Dort eröffnen sich die Möglichkeiten der Begegnung. Und man kann sich gegenseitig in die Wohnungen einladen. Ziel ist weder die Vereinheitlichung aller Wohnungen oder die Abschaffung der Türen, noch die verriegelte Tür, sondern das Wechselspiel von Hinausgehen und Heimkommen, von Bindung ans Eigene und Aufbruch zum anderen.“ (570)
So weit, so gut. Aber die Konsequenz dieses Ansatzes in einer evangelischen Einrichtung ist nun, dass nur die christlichen Kinder sich wirklich wie in einer eigenen Wohnung zu Hause fühlen können:
„Christliche Kinder finden in der Kindertagesstätte in kirchlicher Trägerschaft ein religiöses Zuhause, in einer christlich orientierten religiösen Erziehung, in biblischen Geschichten, Liedern, Gebeten, Feiern des Kirchenjahres, vielleicht auch Gottesdiensten, die sie mitgestalten. Religiös anders Verwurzelte sind genauso Mitglieder der Einrichtung – hier trifft das Bild der verschiedenen Wohnungen nicht mehr. Aber in religiösen Vollzügen sind sie in einer anderen Rolle: nämlich derjenigen, die an christlichen Glaubensvollzügen als religiöse Gäste teilzunehmen eingeladen sind. Es gilt dabei einen Stil zu entwickeln, der den Anschein der Vereinnahmung von vornherein ausschließt. Gästen wird freundlich erklärt, was geschieht, und sie können ihr Verständnis artikulieren. Dazu gehört auch, dass Rückzug als etwas Selbstverständliches verstanden wird. Es bleibt immer der Entscheidungsfreiheit der Gäste überlassen, wie weit sie sich einbringen und mitmachen wollen. Warum müssen denn alle beten oder sich alle um die Erzählkerze zur biblischen Geschichte scharen? Und das gilt analog, wenn türkische Eltern ihre Kinder nicht zu einer christlichen Feier in den Kindergarten bringen wollen. Besuche bei der anderen Religion, z. B. in der Moschee, sind dann Gelegenheit zum Rollenwechsel. Hier können sich die muslimischen Kinder zu Hause und als religiöse »Gastgeber« fühlen.“ (571)
Harz selbst verweist darauf, dass seine Metapher von den Wohnungen an einer Stelle nicht mehr stimmt. Es sind eben nicht nur die christlichen Kinder in der Kita zu Hause und die anderen nicht. Aber dann ist das ganze Modell nicht stimmig! Es kann nicht angehen, dass eine Vielzahl von Kindern in der Kita ihre religiöse Identität nur als Dauergäste wahrnehmen dürfen (vergleichbar den sogenannten „Gastarbeitern“ der ersten Einwanderergeneration in Bundesdeutschland seit den 60er Jahren). Ich weiß, wie gerne Kinder Geschichten hören und Lieder singen; sollen dabei – immer wenn christliche Inhalte, Rituale und Feiern mit im Spiel sind – alle muslimischen und buddhistischen Kinder außen vor bleiben und vielleicht auch noch alle Kinder aus Familien ohne konfessionelle Bindung?
Wenn Frieder Harz das von ihm favorisierte Modell „Ansatz des interreligiösen Lernens“ nennt, kommt mir das wie eine Mogelpackung vor, in der nicht drinsteckt, was draufsteht. „Beheimatung und Öffnung“ ist ja nur für christliche Kinder erreichbar – Beheimatung im eigenen Glauben und Öffnung für Kinder anderen Glaubens im Sinne von Toleranz und der gelegentlichen Teilnahme an interreligiösen Projekten. Umgekehrt ist das, wie er selbst – auch in anderen Veröffentlichungen – betont, nicht möglich. Zwar dürfen gelegentlich auch die Rollen gewechselt werden:
„Christen sind bei Muslimen eingeladen, dort als religiöse Gäste dabei zu sein. Dazu kann auch gehören, dass diese Einladung in den Räumen der Kindertagesstätte stattfindet.“
Aber im Normalfall bleiben nichtchristliche Kinder Gäste bei christlichen Vollzügen im Kindergarten, wenn sie sich für sie öffnen wollen:
„Gästen wird freundlich erklärt, was geschieht, und sie können ihr Verständnis artikulieren. Dazu gehört auch, dass Rückzug als etwas Selbstverständliches verstanden wird. … Das Wecken von Verständnis ist da viel qualitätvoller als das Verdecken oder Vertuschen der unüberbrückbaren Gegensätze.“
Interessant ist, wie er in diesem Zusammenhang die Aufgaben des Erziehungspersonals, speziell auch von muslimischen Erzieherinnen beschreibt:
„Interreligiöse Kompetenz meint hier einen verständnisvollen, liebevollen Umgang mit bestehenden Grenzen, um das Zusammenleben in Andersartigkeit. …
Muslimische Erzieherinnen könnten sich in solch einem Konzept im evangelischen Kindergarten in der interreligiösen Erziehung der wichtigen Aufgabe widmen, muslimischen Kindern dabei zu helfen, mit ihrem religiösen Gaststatus so gut wie möglich zurecht zu kommen. Sie sind dann Vorbild dafür, wie man bewusst als Muslim/in in einem evangelischen Kindergarten leben kann.“
Aber könnte muslimisches Erziehungspersonal nicht auch dazu beitragen, dass sich muslimische Kinder im Kindergarten heimischer fühlen können?
Frieder Harz weiß selber, dass sein Konzept problematisch ist:
„Dieses Konzept bevorzugt offensichtlich christliche Kinder. Aber was wäre die Alternative?
– Ein Verzicht auf religiöse Erziehung bzw. auf alles, was auf Unterschiede zwischen den Religionen weist?
– Ein Nebeneinander verschiedener religiöser Angebote, zu denen Repräsentanten der beteiligten Religionen eingeladen werden?
– Errichtung islamischer Kindergärten für muslimische Kinder?
– Abwechselnd verschiedene religiöse Angebote, an denen jeweils alle Kinder teilnehmen?
Angesichts dieser Alternativen und ihrer Nachteile erscheint das vertretene Konzept wohl noch am günstigsten zu sein. Besondere Klärungen aber sind erforderlich, wenn z. B. in einem evangelischen Kindergarten die muslimischen Kinder die deutliche Mehrheit bilden.“ (572)
Wenn das Konzept von Harz wirklich konsequent so in evangelischen Kindertagesstätten durchgeführt würde, könnte es für bewusst muslimische Eltern wirklich eher eine Alternative sein, sich einen Kindergarten mit islamischem Profil zu wünschen, in dem die Kinder in das Gebetsleben und in muslimische Grundregeln des Zusammenlebens eingeführt würden, Geschichten aus Koran und Hadith erzählt bekommen und vielleicht auch schon anfangen, etwas aus dem Koran auswendig zu lernen (573).
Aber damit wäre die Chance vertan, das Zusammenleben mit Kindern anderer Herkunft und anderen Glaubens von Anfang an einzuüben, die zur Zeit in den meisten Kindergärten besteht.
Die erforderlichen Klärungen im letztgenannten Fall bleibt Harz völlig schuldig. Ein Beheimatungsversuch weniger christlicher Kinder im Umfeld einer benachteiligten Mehrheit würde möglicherweise dazu führen, was in einzelnen Klassen der Grundschule, auf die ich von meinem Fenster aus blicke, bereits jetzt gelegentlich vorkommt: dass nämlich das Gefühl der Ausgrenzung die Mehrheit in der Schulklasse dazu führt, ihre zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber der in ihren Augen privilegierten Minderheit durch umgekehrte Diskriminierung auszuspielen, so dass sich deutsche Kinder ohne Migrationshintergrund im eigenen Land als Fremde fühlen.
Eigentlich ist unverständlich, weshalb Frieder Harz nicht größere Anstrengungen unternimmt, um der Benachteiligung der nichtchristlichen Kinder im Rahmen seines Gastmodells entgegenzuwirken. Er findet selber in biblischen Geschichten Anregungen, um religiöse und ethnische Grenzen zu überwinden, lässt aber im Erzählkreis bestehende religiöse Grenzen unangetastet, indem seine Erzählvorschläge nur aus der christlich(-jüdisch)en Tradition schöpfen:
„Der Mann aus Samaria hat die beiden Vorangegangenen wohl gesehen, die am Überfallenen vorbeigingen. Und das waren schließlich Volksgenossen und religiöse Amtsinhaber noch dazu. Da könnte er als Ausländer sagen: ‚Mir hilft auch keiner von denen! Warum gerade ich?‛ Hier geht es um die Selbstständigkeit, die Herausforderung der Empathie für sich anzunehmen, die eigenen Konsequenzen und Schlüsse zu ziehen.
… Bereitschaft zur Empathie wird oft durch negative Einschätzungen anderer blockiert. Da verlangt der Perspektivenwechsel einen besonders großen Sprung zum anderen hin. Geschichten der Bibel können dazu gute Anregungen geben. Als Jesu Begleiter dem Hauptmann von Kapernaum begegnen (Mt 8,5ff.), da sehen sie ihn vermutlich zuerst als Ungläubigen, Heiden, Soldaten der verhassten Besatzungsmacht. Warum soll Jesus gerade ihm helfen?“ (574)
Eine weitere biblische Geschichte, die Harz erwähnt, könnte kirchlichen Trägern einer Kindertagesstätte vor Augen halten, was zur Verantwortung für ein dauerhaft friedliches Zusammenleben gehören kann (oder, wenn das vor Ort nicht gelingt, wenigstens für eine im Frieden vollzogene Trennung), nämlich der Verzicht auf Vorteile, die aus einer „Dominanzstruktur“ resultieren:
„Dann steht Abraham auf, geht hin und her und sagt: ‚Lot, ich erkenne deine Entscheidung und deine Gründe dafür an. Zieh in das gute Land. Freilich wäre mir auch das gute Grasland lieber. Aber bis zum heutigen Tag habe ich als Chef auch Verantwortung dafür, dass es uns allen gut geht. Ich möchte, dass wir im Frieden auseinandergehen können.‛ “ (575)
Abraham hätte als der Patriarch seinen eigenen Vorteil durchsetzen können, verzichtet aber um des Friedens willen auf Vorteile. Wir als (immer noch mit sehr viel Geld, Einfluss und Macht gesegneten) Großkirchen in Deutschland gehören zur dominanten Kultur in unserem Land und können ebenfalls Vorteile genießen oder um des interreligiösen Friedens willen in Frage stellen – unter den Bedingungen heutiger Globalisierung allerdings nicht, um „friedlich auseinanderzugehen“, sondern um ein friedliches Miteinanderleben einzuüben.
↑ 6.3.3 Matthias Hugoth: Versuch der Beheimatung aller Kinder in ihrer jeweiligen Religion
Auch der katholische Religionspädagoge Matthias Hugoth setzt sich in seinem Buch „Fremde Religionen – fremde Kinder?“ mit den verschiedenen Ansätzen interreligiösen Lernen auseinander.
Den „monoreligiösen Ansatz“ lehnt er wie seine evangelischen Kollegen ab, aber in seiner Begründung zeigt sich, dass er das, was Harz als „interreligiösen Ansatz“ definiert und empfiehlt, ebenfalls unter die Rubrik „monoreligiös“ einsortieren würde, weil ihm zufolge
„die Vermittlung der zentralen Lehren einer bestimmten Religion dominierte und die anderen Religionen lediglich zum Vergleich herangezogen wurden. Er ließ den nicht-christlichen Kindern nur die Alternative, sich anzupassen und mitzumachen oder sich während der Zeit, in der christlich-religiöse Erziehung praktiziert wurde, zurückzuziehen.“
Den multireligiösen Ansatz beschreibt Hugoth neutral als den Versuch, eher die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede der „in der Einrichtung vertretenen Religionen“ zu betonen und
„auf der Basis der entdeckten Gemeinsamkeiten das Alltagsleben miteinander zu gestalten. … Er geht von dem aus, was die Religionen an Zuspruch, Ermutigung, ethischen Orientierungen und Sinnvorgaben beinhalten. Auf die Kinder in der Tageseinrichtung bezogen heißt das, ihnen zu helfen, ansetzend bei ihren Alltagserfahrungen, ihren Fragen und Bedürfnissen, jeweils in ihrer Religion Antworten und Anhaltspunkte zu finden. So werden sie mit ihrer Religion vertraut, so ist es ihnen möglich, eine eigene religiöse Identität zu entwickeln.“
Auch Hugoth bevorzugt jedoch den „den interreligiösen Ansatz“, der für ihn lediglich eine Weiterentwicklung des multireligiösen Ansatzes darstellt.
„Wenn Kinder mit verschiedenen Religionen bekannt gemacht werden, vergleichen sie diese mit ihrer eigenen Religion. Das Austauschen, Anteilnehmen, Mitmachen und – wo es möglich ist – das Herausbilden gemeinsamer religiöser Vollzugsformen entspricht dem interreligiösen Ansatz. Er zielt darauf, mit der eigenen Religion vertraut zu werden, zugleich aber in einen Austausch mit denen zu treten, die einer anderen Religion angehören. So wird Begegnung möglich, die im vergleichenden Miteinander die eigenen religiösen Ansichten und Lebensformen vertiefen, zugleich aber auch den Horizont erweitern kann. Das Finden von Gemeinsamkeiten bei gleichzeitigem Gewahrwerden der Eigenheiten und spezifischen Merkmale der Religion, in der man zu Hause ist, kann neue Formen von Beziehung und Gemeinschaft hervorbringen und die Menschen, die sich auf diesen Prozess einlassen, bereichern.“ (576)
Mir scheint, dass dieser Ansatz wirklich „interreligiös“ in dem Sinne ist, dass wenigstens von der Absicht her die verschiedenen Traditionen der Kinder gleichwertig aufgegriffen werden. Als Beispiele für gemeinsame Aktionen führt Hugoth an:
„das gemeinsame Beten und Singen von Texten und Liedern, die aus einer der Religionen stammen, denen ein Kind oder mehrere Kinder angehören, und die auch von andersgläubigen Kindern mitgebetet und mitgesungen werden können. … das gemeinsame Anschauen und Besprechen von Bildern oder Filmen mit Inhalten, von denen sich Bezüge zu einer Religion herstellen lassen. … das Vorbereiten und das Durchführen eines Festes, Aktionen wie Ausflüge in die Natur, Säuberung eines Waldstücks, das Füttern von Tieren in Gehegen, wobei das Thema ‚Schöpfung‛ eingebracht werden kann.“ (577)
Außerdem empfiehlt er
„Methoden und Arbeitsweisen…, die dazu führen, dass die Kinder mit den Symbolen, Riten, Bräuchen und Festen, mit den Gebeten und Liedern der Religionen bekannt werden. Zum anderen sind solche Methoden angebracht, die das Benutzen, Anwenden, gemeinsame Gestalten und Feiern ermöglichen. Das heißt konkret: Zum Bekanntmachen von Symbolen, Riten, Bräuchen usw. bieten sich an: der Besuch in einer Kirche und in einer Moschee, das Anfassen von Gegenständen (Altar, Taufbrunnen, Heiligenfiguren, Rosenkranz, muslimische Gebetskette), das Beschreiben und Erklären der Dinge anhand von Geschichten, Bildern oder Filmen (dies kann durch die Erzieher/-innen erfolgen oder durch Eltern, die der jeweils vorzustellenden Religion angehören), das gemeinsame Verwenden von Symbolen und das Praktizieren von Riten – beispielsweise wenn die Kinder beim Beten den Körper einbeziehen durch das Heben der Hände oder durch andere Gesten –, schließlich das gemeinsame Vortragen von Gebetstexten und das Singen von Liedern. All dies bewirkt, dass etwas von einer Religion und das Verbindende zwischen den Religionen erfahrbar wird.“ (578)
Aber auch das „Unterscheidende des eigenen Glaubens“ soll in den Blick kommen:
„An Methoden und Arbeitsweisen dürften solche in Frage kommen, die dazu führen, dass die Kinder mit unterschiedlichen Religionen bekannt werden – Erzählungen, Bilder, Symbole, Spiele und szenische Darstellungen, der Besuch einer Kirche, einer Moschee. Zum anderen sollen ihnen Möglichkeiten aufgezeigt werden, einzelne Aspekte der Religionen miteinander zu vergleichen – beispielsweise im Gespräch in der Gruppe, durch das Anschauen der Bücher, in denen die heiligen Schriften der Religionen enthalten sind (Bibel, Koran, Thora), durch die Beschäftigung mit maßgeblichen Gestalten der Religionen (Jesus, Mohammed, Buddha) anhand von Geschichten und Bildern. Bei diesen Zugangsweisen sollen die Kinder affektiv angesprochen und so dazu animiert werden, sich emotional in Beziehungen zu den einzelnen Gegenstandsbereichen und Personen zu setzen. Mit Methoden der ganzheitlichen Arbeit kann erreicht werden, dass die Kinder vor allem einen intensiveren Bezug zu ihrer eigenen Religion aufbauen und erleben, worin die Zugehörigkeit zu ihr erfahrbar wird. Das kann zur Festigung ihrer religiösen Identität führen.“ (579)
Sehr klar arbeitet Matthias Hugoth den Begriff der „Fremdheitskompetenz“ als „Schlüsselbefähigung für interkulturelle und interreligiöse Erziehung“ heraus.
„Fremdheitskompetenz setzt damit an, dass sich der Einzelne über die Herkunft, Kultur, Religion, Traditionen, Familienstrukturen und Lebensgewohnheiten von Zugezogenen kundig macht. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um interkulturelle und interreligiöse Beziehungen aufzubauen. Dabei sollte dieses Wissen sich nicht auf eine Addition von Befunden und Daten beschränken. Zu einer Beschäftigung mit der Kultur, Sprache, Religion und Lebensart des anderen sollte möglichst auch eine Begegnung mit ihm hinzukommen. Dann wird es auch leichter sein, ihm die Freiheit zuzugestehen, anders zu sein und seine kulturelle Identität zu bewahren.
Zum Erwerb von Fremdheitskompetenz ist aber auch eine differenzierte Selbstbeobachtung und -reflexion notwendig. Von zentraler Bedeutung ist dabei das Erkennen der eigenen Vorlieben und Vorurteile und der oft unbewusst erworbenen Deutungs-, Integrations- und Ausgrenzungsmuster. Wichtig ist ebenso die Reflexion der Wertmaßstäbe, nach denen man andere Menschen beurteilt, und der Normen, die für die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen maßgeblich sind.“ (580)
Zwar geht auch Hugoth davon aus, dass
„vor allem Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft klar zu ihrem Auftrag stehen, den Kindern in erster Linie die Welt der christlichen Religion vertraut zu machen“.
Aber er traut und mutet ihnen gleichzeitig zu, dass sie
„auf eine Balance zwischen Offenheit, Toleranz und dem Einbeziehen nichtchristlicher religiöser Vorstellungen und Handlungsformen auf der einen und der Praxis christlich ausgerichteter religiöser Erziehung auf der anderen Seite achten.“ (581)
Erwägenswert sind auch Hugoths Vorschläge zur Einbeziehung der Kirchengemeinde in die interreligiöse Arbeit.
„Bei kirchlichen Kindertageseinrichtungen können Helferkreise und Initiativen in der Gemeinde, vor allem Pastoralteams, dazu beitragen, dass ihre interreligiöse Arbeit akzeptiert und wertgeschätzt wird. Wenn beispielsweise auch die Familien der Migrantenkinder zum aktiven Mitwirken bei Pfarrfesten eingeladen werden, wenn in Pfarrbriefen und Gemeindenachrichten auch die religiösen Feste der in der Gemeinde vertretenen Religionen Beachtung finden, wenn die Beziehung zwischen den Religionen Thema in Gottesdiensten und bei der Bildungsarbeit in der Gemeinde werden und wenn bei der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde auch Kinder aus Migrantenfamilien mit der Zugehörigkeit zu einer anderen Religion mitmachen können.“ (582)
↑ 6.4 „Evangelisches Profil“ nach Frieder Harz
Im Vergleich zur katholischen Position von Matthias Hugoth wurde schon deutlich, dass der evangelische Religionspädagoge Frieder Harz trotz seiner Bemühung um multikulturelle und interreligiöse Offenheit zu kritischen Fragen Anlass gibt.
Sein Anliegen, das eigene Profil einer von der evangelischen Kirche getragenen Kindertageseinrichtung so klar wie möglich herauszuarbeiten, ist gleichwohl berechtigt, denn an verschiedene Träger werden unterschiedliche Erwartungen gerichtet, und im Raum der Interreligion ist für die Identität vieler eigenständiger Religionen Platz.
Daher ist es sinnvoll und wichtig, sich gerade mit Frieder Harz auseinanderzusetzen, dessen Stimme in der evangelischen Religionspädagogik von einiger Bedeutung ist, denn er war nicht nur an der Ausformung des dimensionalen Ansatzes beteiligt, sondern verfasste auch eine Reihe eigener Handbücher und Leitlinien zum „evangelischen Profil“ in kirchlich getragenen Kindertageseinrichtungen.
↑ 6.4.1 Vier Leitgedanken religiöser Erziehung im evangelischen Kindergarten
In einem Skript mit dem Titel „Was ist das Evangelische an unserer Kindertagesstätte?“ nennt Frieder Harz „vier Leitgedanken für eine religiöse Erziehung, für das religiöse Profil eines evangelischen Kindergartens:
a) Für Religiosität in einem weiten Sinne aufmerksam sein
b) Mit christlicher Überlieferung so umgehen, dass sie zu den Beteiligten und ihren Lebenserfahrungen passt
c) Unterschiedliche religiöse Verwurzelung nicht ausklammern, sondern mit ihr kompetent umgehen
d) Sich als Teil der Gemeinde verstehen und daraus Impulse für die eigene Arbeit gewinnen“ (583).
Zunächst fällt auf, dass für Harz anscheinend „evangelisches“ und „christliches“ Profil nahezu identisch sind. Ich habe jedenfalls in seinen Veröffentlichungen keine Differenzierungen gefunden, die sich auf eine Abgrenzung zu katholischen Ansätzen beziehen. Von vornherein steht also die Beschreibung der eigenen christlichen Identität in einem Gegenüber zu allgemeiner Religiosität und anderer religiöser Verwurzelung.
Aus den genannten vier Punkten ergibt sich die Frage, auf welche Weise die Betonung des Christlichen (b) und des Kindergartens als Teil der Gemeinde (d) in Beziehung gesetzt wird zur Aufmerksamkeit auf allgemeine Religiosität (a) und zum kompetenten Umgang mit unterschiedlicher bis hin zu nicht vorhandener religiöser Verwurzelung (d).
Harz weiß zum Beispiel, dass „in der Kindertagesstätte bei allen christlichen Inhalten mitzudenken ist, was dies für muslimische Kinder und Eltern bedeutet“ (584). Ich habe aber Zweifel, ob seine eigene Profilentwicklung diesem Anspruch an allen Stellen genügt.
Nach Frieder Harz gehört Religion in allgemeinem Sinn „zum Bildungsgeschehen“ in jeder Kindertagesstätte.
„Worin besteht dann das Besondere solch einer kirchlichen Einrichtung? In ihr werden die religiösen Aspekte in erster Linie von den christlichen Traditionen her entfaltet. … Die grundlegenden Elemente religiöser Bildung bleiben verpflichtend, aber in den Konkretionen wird die Zugehörigkeit der Einrichtung zur evangelischen Gemeinde bestimmend.“ (585)
Damit kann zwar „christliche Erziehung in der evangelischen Kindertagesstätte nicht die Verwurzelung von Kindern aus nicht christlichen Religionen in ihrem Glauben fördern“, aber ihnen sollten dennoch
„vor allem zwei Botschaften zugänglich werden: Sie gehören zum Kreis der Kinder dazu, werden nicht beiseitegenommen (sofern das die Eltern bei bestimmten Vollzügen wie Gottesdiensten nicht fordern). Sie werden zugleich in ihrer anderen religiösen Herkunft beachtet. Bei passenden Gelegenheiten wird dies deutlich gesagt und allen Kindern als etwas Normales, Selbstverständliches bewusst. … Andersartigkeit wird nie abgewertet, sondern als Anlass zum Erkunden wahrgenommen. Ziel der religiösen Erziehung und Bildung in der evangelischen Kindertagesstätte ist damit auch, dass die Kinder ein Wahrnehmen religiöser Unterschiede pflegen, das ohne Vorurteile, Diskriminierungen und Etikettierungen auskommt. Christliche Kinder sollen in der Verwurzelung im Eigenen zugleich religiöse Unterschiedlichkeit in den Blick nehmen, die Anreize zur Neugierde und Entdeckungen im Terrain der Religionen der anderen bietet. Nicht christliche Kinder sollen erfahren, dass ihre andere religiöse Bindung Beachtung, Respekt und Wertschätzung findet, dass sie ihre Zugehörigkeit zur Kindertagesstätte und zur Gruppe in keiner Weise beeinträchtigt.“ (586)
↑ 6.4.2 Betonung der Unterscheidung „meine Religion“ – „deine Religion“
Wichtig ist es für Harz, dass die Kinder „zwischen ‚meiner‛ und ‚deiner‛ Religion zu unterscheiden lernen, die bewusste Zugehörigkeit zum Eigenen mit der Wertschätzung des Anderen verbinden können“, und das geht seiner Überzeugung nach nur, wenn die Kinder am konkreten religiösen Geschehen im Kindergarten in „unterschiedlichen Rollen“ teilnehmen, was bereits im Abschnitt 6.3.2 deutlich wurde.
„Das eine ist die Rolle der religiösen Gastgeber. Sie feiern ihr Fest, vollziehen ihre Rituale, tauchen in die ästhetische Gestaltung ihrer Überlieferungen ein. Das andere ist die Rolle der religiösen Gäste. Sie sind eingeladen, etwas mitzufeiern, das nicht ihr Eigenes ist. Diese Distanz zum religiös Anderen wird nicht einfach ignoriert und überdeckt, bleibt nicht im Unklaren, sondern wird deutlich benannt: ‚Wir hören eine Geschichte aus der Bibel, dem Buch der Christen. Es ist eine interessante Geschichte für uns alle.‛ Muslime werden zum Mitfeiern des christlichen Weihnachtsfests eingeladen – als Gäste, die dabei herzlich willkommen sind. Umgekehrt werden christliche Kinder als Gäste beim Besuch der Moschee begrüßt. Die Rolle des religiösen Gasts erlaubt innere Distanz in der Neugier am Anderen als dem Fremden wie auch äußere Distanz in der Freiheit, selbst entscheiden zu können, wobei man mitmachen möchte und wobei nicht.“ (587)
Die Unterscheidung von „Wir“ und „Nicht-Wir“, von „meiner Religion“ und „deiner Religion“ ist Harz sehr wichtig. Zwar ist
„in den verschiedenen Bereichen religiöser Erkundungen auch die jeweilige Vielfalt in den Blick zu nehmen…
Zu den religiösen Ritualen an den Lebensübergängen gehören dann auch das islamische Beschneidungsfest; zu den religiös bedeutsamen Gegenständen auch die Moschee, der Gebetsteppich, die Gebetskette; zu den Festen auch andere Festkreise, in denen Kinder der Einrichtung zu Hause sind; zur Beschäftigung mit der Bibel auch Geschichten von Religionsgründern, Koranausgaben in arabischer Schrift“.
Das darf aber Harz zufolge nur geschehen „jeweils in den ordnenden Differenzierungen nach der Zugehörigkeit, die vor einem bloßen Nebeneinander oder gar Durcheinander in der religiösen Vorstellungswelt schützt“ (588). Denn:
„Mit der Zugehörigkeit zur einen Religionsgemeinschaft ist zugleich die Nicht-Zugehörigkeit zu einer anderen verbunden. Man kann nicht zugleich in der evangelischen und in der katholischen Kirche Mitglied sein, nicht zugleich Christ und Moslem. Das spricht dafür, Kindern die Unterscheidung zwischen den Religionen zugänglich zu machen. Sie soll ihnen dabei helfen, sich ihrer eigenen, das heißt von den Eltern bestimmten religiösen Zugehörigkeit und Identität bewusst zu werden.
Damit ergibt sich zugleich, dass Wissen über religiöse Traditionen immer in Verbindung mit Personen begegnen sollte, die sich solchen Traditionen verpflichtet fühlen. Das sind in erster Linie die eigenen Eltern und Verwandten und der den Kindern zugängliche Schatz an familiären religiösen Traditionen – in der Unterschiedlichkeit der religiösen Beheimatungen der Kinder. Dazu gehört auch die jeweils unterschiedliche Nähe und Ferne, die Familien gegenüber den religiösen Institutionen pflegen. Verschiedenartigkeit zeigt auch die religiöse Praxis in konfessions- und religionsübergreifenden Ehen und Familien, samt den Eltern, die sich keiner religiösen Überlieferung zugehörig fühlen.“ (589)
Hier ist zunächst kritisch anzumerken, dass die von Harz selbst angesprochenen innerfamiliären religiösen Unterschiede die Vorstellung einer räumlich zu verstehenden absoluten Unvereinbarkeit verschiedener religiöser Welten zumindest in Frage stellen.
Außerdem kann man sich mit Eva Hoffmann auf Grund der Ergebnisse ihres Forschungsprojekts über interreligiöses Lernen im Kindergarten fragen, was im Blick auf Kindergartenkinder eigentlich mit dem „Ausdruck ‚eigene Religion‛ gemeint“ sein soll:
„Weist ein Kind bereits eine eigene Religion auf, wenn es z. B. eine höchst individuell formulierte Antwort auf die Frage nach dem Jenseits gibt…? … [Oder g]ilt ein Kind … erst dann als ‚Inhaber‛ einer eigenen Religion, wenn es konventionelle Prämissen der Religionsgemeinschaft kennt, der es ‚offiziell‛ angehört[?] … Dazu weisen die meisten Beiträge der Kinder viel zu wenige deutliche Bezüge zu einer Glaubenstradition auf. Und selbst wenn sich in ihren Äußerungen religiöse Orientierungen zeigen, sind diese nicht unbedingt den konventionellen Ansichten der jeweiligen Religionsgemeinschaft der Kinder entsprechend. Der hinduistische Bharat … beschreibt z. B. eine Himmelsvorstellung, die in dieser Form nicht in der hinduistischen Glaubenstradition verfolgt wird.“ (590)
Kinder scheinen also kein großes Problem damit zu haben, Vorstellungen verschiedener Religionen miteinander zu vermischen, und empfinden dabei offenbar „kein subjektives Gefühl der Verwirrung“, wie John M. Hull in seinem Buch „Mishmash“ (siehe Kapitel 6.5) kritisch gegen die panische Angst Erwachsener vor Religionsvermischung anmerkt.
„Die Furcht auf der Seite der Erwachsenen ist, dass die Kinder nicht in die emotionalen und kognitiven Grenzen einer bestimmten Tradition hineinsozialisiert werden“,
denn
„die ozeanische Empfänglichkeit des kleinen Kindes muss auf kulturell akzeptable Weise umgestaltet werden“ (591).
Auf jeden Fall ergibt sich bei Harz im Blick auf die „religiösen Beheimatungen der Kinder“ das Problem einer Asymmetrie: Einerseits setzt er voraus, dass die Kinder einen „Schatz an familiären religiösen Traditionen“ aus ihren jeweiligen unterschiedlich geprägten Familien mitbringen (592), findet es aber andererseits „angesichts des weithin beobachteten Traditionsabbruchs in der jungen Generation … besonders wichtig“, dass „Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft … Kindern sowie Eltern das Heimischwerden im christlichen Glauben, das Vertrautwerden mit der Welt der christlichen Überlieferung an[bieten]“ (593).
Was Christa Dommel kritisch zu ähnlichen Zielsetzungen von Friedrich Schweitzer äußert, trifft auch auf Frieder Harz zu:
„die öffentlichen Bildungseinrichtungen werden von ihm als Ort beansprucht, an dem religiöse Erfahrungen in der Kindheit gemacht werden können und sollen, da sie sonst kaum noch stattfinden.“ (594)
Dass der immerhin zu mindestens 85 Prozent aus staatlichen Mitteln betriebene Kindergarten in evangelischer Trägerschaft tatsächlich sozusagen die Sandsäcke bereitstellen soll, um Löcher im Deich der abbrechenden kirchlichen Tradition zu stopfen, stellt Harz auch dort fest, wo er das Zusammenwirken von Kita und christlicher Gemeinde beschreibt:
„Die Aufgaben von Kirchengemeinde und Kindertagesstätte sind aufeinander bezogen. In der Kindertagesstätte wird die christliche Gemeinde ihrem Auftrag gegenüber Kindern und deren Familien gerecht. Sie nimmt zum einen ihre öffentliche Mitverantwortung für ein Bildungsgeschehen wahr, das der biblisch-christlichen Sicht des Menschen und vor allem der Kinder entspricht. Und sie hat zum andern in der Kindertagesstätte einen Ort, an dem Glaube in den alltäglichen Bezügen erfahren und gelebt werden kann, an dem Kinder und Eltern christlichen Glauben kennenlernen und er ihnen zu einer religiösen Heimat werden kann. Ohne diesen Ort ist es viel schwieriger, Kindern und Eltern die Bedeutung des christlichen Glaubens zu erschließen und so mitzuhelfen, dass Eltern das in der Taufe gegebene Versprechen auch einlösen können.“ (595)
Das ist alles durchaus vertretbar – unter der Voraussetzung, dass wirklich mitbedacht wird, welcher Platz den nichtchristlichen Kindern und Eltern in einem solchen Konzept zukommt.
In weiten Teilen des Bildungskonzepts von Frieder Harz wird jedoch die Vermittlung biblischer Geschichten, der Vollzug christlicher Rituale und das Feiern christlicher Feste so breit und ohne Bezug auf interreligiöse Bezüge entfaltet, dass der Eindruck entsteht: Wenn nichtchristliche Kinder nicht ausgeschlossen sein wollen von einem großen Teil der Erzählrunden, Projekte und Feiern im Kindergarten, müssen sie sehr oft dazu bereit sein, nur in der Rolle des Gastes an christlich geprägtem Leben teilzunehmen, zumal Harz auch davon abrät,
„als christliche Erzieherin / christlicher Erzieher Texte aus dem Koran nachzuerzählen – das könnte als Missachtung des nötigen Respekts gegenüber dem Wortlaut des Korans ausgelegt werden. Am besten ist es, Begegnungen mit dem Koran korankundigen Muslimen zu übertragen und dabei auch deutlich zu machen, dass der Koran das Buch der Muslime ist.“ (596)
So kommt Interreligiösität eher am Rande als besonderes Projekt in der Kita vor, wenn Mitglieder einer Moscheegemeinde sich zu einer Kooperation bereit erklären oder wenn Eltern Elemente von Festen einer anderen Religion in die Kita einbringen.
↑ 6.4.3 Erziehungspartnerschaft und Werteerziehung mit Ausblendungen und Abwehr
Beim Thema der „Erziehungspartnerschaft“ mit Eltern wird besonders deutlich, dass Harz bei vielen allgemeinen Aussagen über die Elternarbeit nur bestimmte Eltern vor Augen hat. Wenn er fragt:
„Wie wird die Erziehungspartnerschaft konkret gestaltet? Welche Möglichkeit haben interessierte Eltern, am Geschehen in der Kindertagesstätte Anteil zu nehmen, sich einzubringen und zu beteiligen?“ (597),
setzt er eine Komm- Struktur voraus; erfahrungsgemäß scheinen Eltern, die nicht der dominanten Kultur (Mittelschicht, christlich-westlich geprägt) angehören, weniger „interessiert“ am Kita-Geschehen zu sein, was möglicherweise mehr an strukturellen Hindernissen liegt (Sprachbarriere, kulturell-religiöse Schwellenangst usw.) als an wirklichem Desinteresse. Er möchte
„Eltern gerne mit hineinnehmen in lebendiges Nacherzählen biblischer Geschichten und in das Nachdenken darüber, was Geschichten zu ‚heilsamen‛ Erzählungen für Kinder macht“
und fragt in zwei Randbemerkungen
„Wie können Eltern die Intentionen der christlichen Sicht des Menschen an sich selbst spüren?“
sowie
„Wie können Eltern möglichst echt erleben, was christlichen Glauben kennzeichnet?“ (598),
womit alle Eltern definitiv christlich vereinnahmt werden. Auch wenn er feststellt:
„viele Eltern … fühlen sich unsicher und hilflos angesichts der Aufgabe, selbst ihre Kinder religiös zu erziehen. Sie delegieren diesen Bereich von Erziehung und Bildung an die Institution Kindertagesstätte und fühlen sich damit entlastet“ (599),
denkt er damit an religiös indifferente bis verunsicherte Eltern aus christlicher Tradition, während Eltern, die in anderen religiösen Traditionen verwurzelt sind, nur am Rande erwähnt werden. Sie scheinen nur zusätzlich, sozusagen als Vertreter des interkulturell-interreligiösen Themas, im Blick zu sein, und nicht zur „normalen“ Elternschaft selbstverständlich dazuzugehören.
„Was liegt näher, als Eltern so oft wie möglich in die kleinen oder größeren Projekte des religiösen Lernens mit einzubeziehen? Kinder bringen von zu Hause Zeugnisse religiöser Familientradition mit, von Tauffotos und -urkunden bis zur Familienbibel, von Berichten der Eltern und Großeltern bis zu Postkarten von interessanten Kirchen. Eltern werden zum Besuch von Kirche und Moschee mit eingeladen.“ (600)
Dabei wäre es gerade an dieser Stelle so einfach gewesen, über das Projekt Moschee-Besuch hinaus auch auf Zeugnisse muslimischer oder buddhistische Familientradition einzugehen, die Kinder von zu Hause in die Kita mitbringen könnten.
Die Art, wie Frieder Harz „Elternbildung“ im Rahmen von Gesprächen über Erziehung beschreibt, macht ein weiteres Problem deutlich. Sie kann
„verdeutlichen, wie aus der Perspektive des christlichen Glaubens heraus ethische Bildung geschieht“,
ist also christlich ausgerichtet, enthält dann aber auch „Beiträge aus anderen Religionen“; sie
„machen religiöse Gemeinsamkeiten in den höchsten Werten sichtbar – auch wahrgenommenen fundamentalistischen Verengungen und Verkehrungen zum Trotz.“ (601)
Diese Abwehr nicht gewünschter Ausprägungen von Religion geschieht nicht im Rahmen einer bewussten Auseinandersetzung mit problematischen Seiten in jeder Religion, auch der christlichen, sondern nur im kulturalistischen Blick auf als „anders“ definierte Religionen.
Auch im Zusammenhang mit der „Werteerziehung“ sieht Frieder Harz die Ursachen für Konflikte
„zwischen allgemein gültigen Werten, die für ein geordnetes Zusammenleben unverzichtbar sind, und kulturellen bzw. religiösen Traditionen, die in den Familien bzw. privaten Beziehungen gelebt werden“,
vorwiegend im islamischen Umfeld. Mehrfach führt er als konkretes Beispiel an, dass
„Ali in der Kindertagesstätte genauso aufräumen und helfen muss wie seine Schwester Fatima“,
und dass es gilt,
„gegenüber religiösen Traditionen, die mit Drohungen verbunden sind, das religionspädagogische Konzept einer auf Eigenverantwortung zielenden Wertebildung bewusst festzuhalten“ (602).
Das klingt so, als ob nicht auch in deutschen Familien ohne Migrationshintergrund und mit christlichen Wurzeln eine Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen oder eine Erziehung mit Drohungen oder gar Gewalt vorkommen könnte. Und umgekehrt, als ob es nicht möglich sei, die Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen auch innerislamisch zu begründen.
Der von Harz vertretene Standpunkt scheint auch damit zusammenzuhängen, dass er die bundesdeutsche Verfassungswirklichkeit sehr eng mit der christlichen Tradition verknüpft sieht, denn er behauptet:
„Aus der christlichen Ethik haben sich die Natur- und Menschenrechte entwickelt, die solche allgemeine und unwiderrufliche Geltung beanspruchen.“ (603)
Dabei blendet er aus, dass die Menschenrechte sich erstens auch aus Traditionen der Antike speisen, die zum Teil erst durch islamische Philosophen dem mittelalterlichen Abendland bekannt gemacht wurden, dass sie sich zweitens erst gegen kirchlichen Widerstand durchsetzen konnten und dass sich nicht nur Christen, sondern auch Muslime
„aus genuin religiöser Motivation zum Einsatz für die Menschenrechte aufgerufen fühlen [können], in denen die Würde des Menschen politisch-rechtliche Anerkennung und Schutz findet.“ (604)
Insgesamt hat die evangelische Profilbildung durch Frieder Harz mich nicht überzeugen können. In der mangelnden Aufmerksamkeit und Einfühlsamkeit für nichtchristliche Kinder und Familien mit ihren berechtigten Anliegen kommt nach meinem Empfinden auch ein Mangel an Souveränität im Umgang mit dem eigenen Glauben zum Ausdruck. Harz scheint von der Angst geleitet zu sein, die christliche Tradition werde in der deutschen Gesellschaft immer weiter zurückgedrängt und dürfe daher zum Beispiel nicht ohne Not auf die Bevorzugung christlicher Familien im Kindergarten verzichten.
↑ 6.5 John M. Hull: Christliche Identität der Absolutheit oder der Ganzheit
Der englische Religionspädagoge John M. Hull vertritt im Gegensatz zu Frieder Harz einen multireligiösen Ansatz in der frühkindlichen und schulischen Religions-Bildung. Die Gegner dieses Ansatzes verwendeten in der politischen Auseinandersetzung ähnliche Argumente wie Harz, indem sie vor einer drohenden Religionsvermischung warnten. Das wiederum veranlasste John Hull dazu, in dem kleinen Büchlein „Mishmash“ (605) den Gebrauch der in diesem Zusammenhang verwendeten Metaphern wie „Mischmasch“, „Eintopf“, „Einheitssoße“ etc. zu analysieren, die das Gefühl einer ekelhaften oder Übelkeit erregenden Zusammenstellung beschreiben bzw. heraufbeschwören.
Die beiden Schlusskapitel dieses Buches, aus denen ich, da es nicht auf Deutsch vorliegt (***), noch mehr als sonst zitieren werde, enthalten faszinierende Einsichten über den Aufbau von religiöser Identität und über die Frage, wie weit wir (und speziell Kindergartenkinder) Anteil an einer anderen Religion nehmen können, ohne unsere eigene Identität zu verlieren.
Unter Rückgriff auf den Psychologen Erik H. Erikson unterscheidet Hull „zwischen zwei Arten von Identität: der Identität der Totalität und derjenigen der Ganzheit“ (606). Ich werde „totality“ manchmal auch mit „Absolutheit“ übersetzen, und das Verb „to totalise“ mit „absolut setzen“, wenn ich es nicht mit „totalisieren“ einfach eindeutsche.
„Totalisierende Identität wird hergestellt, indem ich ausschließe. Ich kenne mich selbst als Europäer genau darum, weil ich kein Afrikaner bin, als Mann genau darum, weil ich keine Frau bin, als Erwachsener genau darum, weil ich kein Kind mehr bin. Entscheidend für eine totalisierende Identitätsgestaltung ist es, Grenzen zu schaffen. Innerhalb dieser Grenze bin ich ich selbst, jenseits der Grenze ist etwas anderes, etwas von mir Verschiedenes, das nicht ich bin. Auf der andereren Seite wirkt die Identität, die durch Ganzheit charakterisiert ist, indem ich einschließe. Obwohl ich Europäer bin, bin ich außerdem ein Mensch und gehöre zusammen mit dem Afrikaner. Obwohl ich männlich bin, ist mir meine Weiblichkeit bewusst. Indem ich erwachsen bin, ist immer noch Kindlichkeit in mir. Ich bin nicht nur das eine; ich bin auch das andere.“ (607)
Beide Arten der Herstellung von Identität haben ihr Recht, auch in der religiösen Erziehung von Kindern, aber
„die Metaphern von vermischtem und ekelhaftem Essen werden benutzt, um diejenigen in Verruf zu bringen, die davon überzeugt sind, dass Identität sowohl durch Ausschließung als auch durch Einbeziehung weiterentwickelt werden kann.“ (608)
John Hull unternimmt einen aufschlussreichen Versuch, dieses religiöse Ausschlussbedürfnis zu verstehen (609). Es geht zentral um „Reinheit“, die nur aufrechterhalten werden kann, indem sie von „Unreinheit“ unterschieden wird.
„Reinheit ist innen, Unreinheit ist außen. Die Unterscheidung zwischen Reinheit und Unreinheit wird also räumlich definiert. Wenn das, was jenseits der Grenze liegt, nach innen herüberkommen sollte, wäre es fehl am Platz. Seine Charakteristika könnten genau die gleichen sein, aber sein Ort hätte sich verändert, und das würde genügen, um es in Schmutz zu verwandeln.“ (610)
„Schmutz ist Materie, die sich an der falschen Stelle befindet. Gartengeräte gehören nicht in den Kleiderschrank, und selbst blank polierte Stiefel werden nicht zusammen mit dem Essgeschirr aufbewahrt. Benutztes Geschirr ist definitionsgemäß schmutzig, bevor es gespült wird, aber es ist schmutziger, es im Wohnzimmer herumliegen zu lassen, als es neben der Spüle in der Küche aufzustapeln. Schmutz ist eine besondere Form von Unordnung. Bücher können unordentlich auf einem Bücherregal stehen, aber wenn dazwischen Milchflaschen, Glühbirnen und Autoersatzteilen liegen, würden viele Leute das nicht nur unaufgeräumt, sondern schlampig finden. Wer Dreck oder Erde an den Händen hat, ist schmutzig, aber Dreck im Garten ist nicht schmutzig, und niemand hat ein Problem damit, bei der Gartenarbeit schmutzige Hände zu haben. Aber mit dem Eintritt in das Haus werden die Hände schmutzig.“ (611)
Das Konzept von Reinheit und Unreinheit kann sich auch auf schmutzige Gedanken beziehen, und besonderes Augenmerk verdient der Körper mit der Haut als Grenze zwischen Innen und Außen und den Körperöffnungen, durch die Übertragungen zwischen Innen und Außen stattfinden.
„Wenn wir die Symbolik des Körpers benutzen und insbesondere die Symbolik von Essen und Nahrung, können damit unsere tiefsten Befürchtungen und Ängste im Blick auf die Gesellschaft ausgedrückt werden.“ (612)
Hull erinnert an einen Leserbrief, in dem der „multireligiöse Mischmasch“ als Bedrohung empfunden wurde.
„Wenn diese Grenzen überschritten werden, ist sowohl die Reinheit des Essens als auch des Glaubens bedroht.“ (613)
Die Ursprünge des Konzepts von Reinheit und Unreinheit verfolgt Hull bis in die Bibel.
„]„Die Speisevorschriften für Adam und Eva und für die Familie Noahs bezogen sich im Prinzip auf eine ungeteilte Menschheit. Der Bund mit Mose jedoch wurde nur mit dem Volk Israel geschlossen.“ (614)
„Sofort finden wir, dass mit einer geteilten Menschheit eine geteilte Ernährung einhergeht. Kulturelle und religiöse Unterscheidungen werden in Ernährungsunterschieden ausgedrückt. …
‚… Ihr sollt mir heilig sein; denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret.‛ (3. Mose 20, 26) Das Konzept des Mischmasch wäre nicht möglich ohne das Konzept von klaren Unterscheidungen in der Ernährung und ohne Regeln für ihre Zubereitung in der Küche. Unterscheidungen dieser Art scheinen jedoch nur aufzutreten, wenn eine Notwendigkeit besteht, Unterschiede zwischen Völkern zu bekräftigen.“ (615)
Ich füge Gedanken von Ton Veerkamp ein, um verständlich zu machen, warum Israel sich in bestimmten Phasen seiner Geschichte auf besonders „totalisierende“ Weise von den Völkern abgrenzte. Ihm zufolge nutzte Nehemia nach der Rückkehr der nach Babylon verschleppten Judäer unter der neuen persischen Oberhoheit die Chance, in Judäa eine „Thorarepublik“ aufzubauen.
„Er hat das Gemeinwesen im Rahmen einer beschränkten, aber realen Autonomie auf die Basis jener Thora gestellt, die das Maximum an Egalität verlangt, das unter den gegebenen Bedingungen beschränkter Autonomie möglich war.“ (616)
In dieser Situation hat der Priester und Schriftgelehrte ‛Esra
„die Abkapselung des Volkes betrieben, weil er wohl der Ansicht war, daß die Sonderverfassung Judäas keine Generation standhalten würde, wenn das Volk sich mit den Nachbarvölkern vermischte. Nechemja hatte ähnliche Bedenken. Die Hälfte der Kinder konnte ja nicht mehr jehudisch reden, sondern redete aschdodisch oder die Sprache anderer Völker (Neh 13,24).“ (617)
Diese Thorarepublik steht und fällt mit dem Gott, der das Volk aus Ägypten befreit hat und der allein anzubeten ist.
„Das erste Gebot ist kein Ausdruck religiöser Intoleranz, sondern der praktischen Unvereinbarkeit gesellschaftlicher Zustände“; Israel kann entweder den altorientalischen Göttern folgen, mit denen die Ausbeutung der Schwachen gerechtfertigt und gestützt wurde, oder dem Gott treu bleiben, der sein Volk aus der Sklaverei befreite und dem der „Bruder, der tief unten ist“, heilig ist (618).
Spätestens in einer Zeit wie der unseren ist jedoch eine solche Form der abgrenzenden „totalisierenden“ Identitätssuche nicht mehr angemessen, um in der globalisierten Welt auf menschliche und gerechte Weise im Frieden miteinander zu leben. Nach John Hull beschritt bereits Jesus neue Wege. In einer Welt, die seit Alexander dem Großen zunächst einem hellenistischen, dann römischen Globalisierungsprozess unterworfen war und in denen es Völkern wie Religionsgemeinschaften unmöglich war, völlig unabhängig voneinander zu existieren und jegliche Berührung miteinander zu vermeiden, brach Jesus
„die Gesetze der Reinheit, indem er mit denen aß, die rituell unrein und sozial inakzeptabel waren (Mk. 2, 15f.). … Er riss die Grenzen nieder, die heilige Zeit von weltlicher Zeit trennten (Mk. 2, 23ff.) In all dem war er sich vollkommen bewusst, dass er einen radikalen Bruch mit der Welt der alten heiligen Ordnungen eröffnete. Das brandneue Material konnte das alte Gewand nicht flicken. Der neue Wein hätte die alten Weinflaschen nur gesprengt. (Mk 2, 21f.) Es ist gleichermaßen bemerkenswert, dass er die Grenzen der natürlichen Familie niederriss, indem er die Bluts- und Verwandtschaftsbande durch eine weltweite Gemeinschaft all derer ersetzte, die sich Gott zugehörig fühlten. … Dazu passt, dass er eine Seligpreisung zurückweist, die sich auf die Quelle seiner Ernährung als Säugling bezog. »Eine Frau in der Menge erhob ihre Stimme und sagte zu ihm: ‚Selig ist der Leib, der dich gebar, und die Brüste, die dich gesäugt haben.‛ Er erwiderte: ‚Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren.‛« Diese Zurückweisung der gefühlsmäßigen Überbetonung der Säuglingsnahrung weckt sowohl buchstäbliche als auch metaphorische Assoziationen, und es ist wieder höchst bedeutsam, dass die Essensmetapher durch ein universales Prinzip ersetzt wird. Grenzen von Stamm, Nation oder Volk werden prinzipiell zerschlagen. (Vgl. Lk 4, 25-27)“ (619)
Besonders die in der Apostelgeschichte (10, 10ff.) dargestellte Vision des Petrus, der von einer Stimme aus dem Himmel genötigt wird, „alle Arten von Tieren und Reptilien und Vögeln des Himmels“ zu essen, ist von entscheidender Bedeutung für die christliche Urgemeinde:
„Das Tuch war in der Tat voll von abscheulichem Mischmasch, durch den Glaubensreinheit des Petrus verwässert zu werden drohte, Dinge, die sorgfältig voneinander getrennt gehalten wurden, lagen hier zusammenhanglos durcheinandergewürfelt, ein wahrer Rührschüssel-Angriff auf Gottes Gebote war im Begriff, in seinen Magen zu wandern. Als die himmlische Stimme ihn aufforderte, diesen Eintopf zu essen, schreckte Petrus zurück wie ein moderner Abgeordneter vor einem Vereinbarten Lehrplan [multireligiöse Bildung betreffend] und protestierend fromm: ‚Nein, Herr; denn ich habe niemals irgendetwas gegessen, dass gemein oder unrein gewesen wäre.‛ (V. 14) Aber die Stimme sagte: ‚Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht gemein.‛ Von nun an konnte Heiligkeit nicht durch die Einhaltung, sondern durch die Überwindung von Unterschieden gefunden werden. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Missachtung der reinen und säuberlichen Trennung auf Jesus selbst zurückgeht.“ (620)
„Jesus und seine Jünger wurden von denen, die darauf versessen waren, ein religiöses Einordnungssystem rein zu halten, für ihre Nachlässigkeit kritisiert. Umgekehrt bot Jesus eine neue Sicht religiöser Identität an, und zwar eine, die nicht bedroht ist durch Ansteckung oder Verunreinigung von außen, sondern die aufrechterhalten wird durch die Absichten des Herzens, indem diese das Zusammenleben der Menschen beeinflussen. ‚Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, und kommt heraus in die Grube.‛ Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: ‚Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein; denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Mißgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein.‛ (Mk 7, 18-23) (621)
Nach Mary Douglas, auf die sich Hull an dieser Stelle noch einmal bezieht,
„kann das, was nicht am Platz ist, das System der Reinheit stören und daher als Schmutz betrachtet werden. Was nicht am Platz ist, kann aber auch maßgebliche Vorstellungen herausfordern und auf diese Weise eine Quelle der Erneuerung und Umgestaltung sein. Was sich aus Einengungen herausbewegt, kann zu einer segensreichen Verschmelzung von Gegensätzen führen, zu einer Überwindung alter Widersprüche in einer neuen Ordnung. Beide Tendenzen sind in der Religion zu finden: die Tendenz zu trennen und die Tendenz zu vereinigen… Salz ist schmutzig, wenn es auf den Boden oder über die Kleidung geschüttet wird, aber wenn man es vernünftig beim Kochen benutzt, erhält man mehr Lebensqualität und Geschmack.“ (622)
„Die frühe christliche Bewegung konzentrierte sich auf ein gemeinsames Mahl als Symbol für das neue Königreich, das neue Menschsein“, und für Paulus waren damit alle Unterscheidungen zwischen „Griechen und Juden, Beschnittenen und Unbeschnittenen, Barbaren, Skythen, Sklaven und Freien“ hinfällig (Kol. 3, 10f.) (623).
Für John Hull ist das Grund genug, Kindern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit gemeinsam in Religion zu unterrichten, und er fragt:
„Ist es auf Grund der neutestamentlichen Lehre vom neuen Menschsein gerechtfertigt, Unterschiede zwischen Religionen zu missachten? Hier ist nicht der Platz, um in eine ausführliche Diskussion einer christlichen Theologie der Weltreligionen einzutreten, aber es sei nebenbei bemerkt, dass in der Theologie des Paulus vom neuen Volk religiöse Unterschiede klar überwunden wurden. Die Beschneidung war das grundlegende Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Die Unterscheidung zwischen Jüdisch und Griechisch war nicht nur eine kulturelle, sondern ganz offensichtlich eine religiöse Unterscheidung. Heute besteht tatsächlich die Gefahr, dass Christen, die ihre Identität auf Grund unreifer Vorstellungen vom christlichen Glauben als bedroht empfinden, sich selbst als eine Art neuen Volksstamm betrachten, der unterschieden werden muss von anderen Stämmen, anderen religiösen Weltkulturen, genau wie einige der Juden im ersten Jahrhundert genau zwischen sich und den Heiden unterschieden.“ (624)
Der Ausdruck „tribe“ und „tribalise“, den Hull hier verwendet, ist schwer ins Deutsche zu übersetzen, vor allem in der abstrahierenden Form der „Tribalisierung“. Wörtlich meint „tribe“ einen in der Regel kleinen Volksstamm; mit „Tribalisierung“ nimmt er ein christliches Selbstverständnis aufs Korn, das sich als das wahre Gottesvolk von anderen Menschen abgrenzt, die ungläubig sind oder einer unwahren Religion angehören. In einer späteren Veröffentlichung spricht er im Zusammenhang mit solchen (Miss-)Verständnissen von Religion auch von „Religionismus“ oder „Pseudo-Artenbildung“ (625).
„Die ganze Bibel hindurch gibt es einen Kampf zwischen Israel für die Israeliten und Israel als ein Licht, um die Heiden zu erleuchten, zwischen Gott als dem Herrn von Israel und Gott als dem Herrn aller Völker. Genau so ist es mit dem Christentum: es gibt eine Möglichkeit, sich als ‚Stamm‛ zu verstehen (Tribalisierung), bei der die religiöse Unterscheidung betont wird, und eine Möglichkeit, sich als „weltoffen“ zu verstehen (Universalisierung), bei der das Reich Gottes betont wird. Was Jesus begründet hat, war nicht eine neue Religion, sondern ein neues Menschsein. Diese Einsicht inspiriert die Beschreibung der neuen kirchlichen Gemeinschaft, in der die alten ethnischen und religiösen Unterscheidungen niedergerissen worden sind. ‚Denn Er ist unser Friede, der aus beiden [d. h. aus Juden und Heiden] eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe…‛ (Eph. 2, 14f.) Dieses Prinzip ergibt sich nicht nur aus dem gemeinsamen Abendmahl, sondern auch aus der gemeinsamen Taufe. ‚Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.‛ (Gal. 3, 27f.) Die abschließende Wendung ‚allesamt einer in Christus Jesus‛ sollte nicht entlang einer totalisierenden Identität, durch Ausschluss, sondern vielmehr durch Einschließung, entlang einer Identität der Ganzheit, verstanden werden. Klarer wird das durch die unmittelbar folgenden Worte. ‚Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.‛ (Gal. 3, 29) Heißt das, dass alle Christen nun in die physische Abstammung Abrahams einbezogen [tribalisiert] worden, also wörtlich genommen Juden sind? Vielmehr benutzt Paulus den Ausdruck ‚Abrahams Kinder‛ in übertragenem oder geistlichem Sinne, da sowohl Christen als auch Juden ‚nach der Verheißung Erben‛ sind. Die Verheißung ist die universale Verheißung für die ganze Welt. Wir sehen nun, dass das neue Menschsein in Christus Jesus nach dem Metaphorischen und Spirituellen in allen Worten religiöser Traditionen sucht und sich nicht in die Unterscheidungen zwischen Christentum und Judentum vertieft. Ich sage nicht, dass eine Diskussion dieser gegenwärtigen Unterscheidungen jetzt kein legitimer Teil eines interreligiösen Dialogs ist. Ich behaupte jedoch, dass die biblische Vision sowohl Israel als auch die Christenheit als Volksstämme oder ideologische Blöcke transzendiert und eine neue weltweite Gemeinschaft ankündigt. Diese Einsicht kann sowohl in der Tora und den Propheten wie auch im Neuen Testament gefunden werden.“ (626)
Was John Hull im Blick auf „einen christlichen Ansatz für den Religionsunterricht in England heute“ diskutiert, ist auch eine Anregung für die Religions-Bildung in deutschen Kindergärten:
„Wir können unterscheiden zwischen einem absolut christlichen Ansatz und einem ganzheitlich christlichen Ansatz. Der total christliche Ansatz begünstigt, was ich anderswo als ‚ideologische Einfriedung‛ bezeichnet habe… Er blendet aus dem Bildungsplan und wenn möglich aus der gesamten sozialen Welt des Kindes alles aus, was ausdrücklich von der christlichen Religion verschieden ist.“ (627)
Daneben können dann andere ebenso absolut-setzende Ansätze einer muslimischen oder jüdischen religiösen Erziehung gestellt werden.
„Das merkwürdige Paradox bei diesem Ansatz ist, dass es beim Nebeneinanderstellen mehrerer Absolutheiten … unmöglich ist, sich nicht zu fragen, welche der Religionen denn nun wirklich den Anforderungen der Absolutheit genügt.“ (628)
Das heißt: gerade der totalisierende Ansatz der getrennten Religionserziehung führt dazu, dass die absolut gesetzten Religionen sich gegenseitig relativieren.
„Es gehört zur gesunden Ökologie des menschlichen Geistes, dass getrennte Dinge in ihrer Getrenntheit vergleichbar werden, während eingegliederte Dinge eine harmonische Einzigartigkeit hervorbringen.“ (629)
Der getrennte Unterricht führt nach Hull notwendig zu einer Art „Vermarktungsansatz“, zu einer Konkurrenz zwischen „unterschiedlichen Markenzeichen von Religion, die aus Image- und Loyalitätsgründen voneinander getrennt bleiben müssen“. Aber „wenn Gemeinschaften strikt voneinander getrennt leben, werden sie irgendwann damit enden, sich gegenseitig aufzufressen.“ (630) Es geschieht eben nicht von selbst, dass Religionen, die sich voneinander abschotten, automatisch eine Haltung der Toleranz gegenüber anderen Religionen hervorbringen, schon deshalb nicht, weil
„in eine Reihe von Religionsgemeinschaften theologische Verteidigungen gegeneinander eingebaut sind. Um seine Identität in der Trennung vom Judentum zu erringen, musste das Christentum eine totalisierende Phase durchlaufen. Wir erinnern uns an Erikson: In der Entwicklung von Identität können Perioden der Absolutsetzung und Perioden der Ganzheit miteinander abwechseln. Die ersten Christen fanden es notwendig, sich polemisch gegen das Judentum zu wenden, um zu bekräftigen, warum sie keine Juden waren. Jeder, der das Johannesevangelium mit seinen abfälligen Bemerkungen über die Juden liest, wird das bemerken. In ähnlicher Weise musste sich der Islam vom Christentum abgrenzen, und eine Polemik gegen Christentum und Judentum ist in sein Selbstverständnis eingebaut. Es ist sicher möglich, religiöse Traditionen auf intoleranten und ausschließenden Wegen zu interpretieren, aber in einer Gesellschaft wie unserer, in der die Schaffung von Toleranz und Verständnis als ein wichtiges soziales Ziel eingestuft werden muss, scheint es nicht weise zu sein, dieses Risiko einzugehen.“ (631)
Abschließend erläutert John Hull in wenigen Sätzen den Ansatz einer Religions-Bildung für Kinder auf der Basis einer ganzheitlich verstandenen christlichen Identität:
„Während der Ansatz, den wir als total beschrieben haben, wesentlich auf der Erfahrung des Christentums als einer absoluten Religion neben anderen absoluten Religionen basiert, würde der Ansatz eines ganzheitlich christlichen Bildungsplans nicht aus dem Christentum als einer der Weltreligionen entspringen, sondern aus der Lehre Jesu vom Reich Gottes und aus der Lehre des Paulus über das neue Menschsein. Die gegenwärtigen religiösen Traditionen, in ihrer vorfindlichen konkreten Form, werden sehr ernst genommen, da sie Teil der Geschichte sind, die die Welt prägt. Sie müssen in der vollen Schönheit ihrer Heiligkeit betrachtet werden, ohne Oberflächlichkeit und ohne gehässige Vergleiche, aber auch ohne Furcht vor Ansteckung. Kinder mit ihrem jeweiligen Glauben leben und lernen Seite an Seite. Loyalität gegenüber dem eigenen Glauben ist nicht unvereinbar mit einem verständnisvollen Einblick in den Glauben anderer, und das ist für Kinder so wahr wie für Erwachsene. Auf diese Weise kann Religions-Bildung ihre Rolle beim Aufbau einer neuen Erde spielen.“ (632)
Sehr spannend und anregend finde ich das Konzept von Heiligkeit, das John Hull auf Grund der Unterscheidung beider Arten von religiöser Identität entwickelt:
„Diejenigen, die Angst haben vor Mischmasch, sind zutiefst respektvoll anderen Religionen gegenüber. Jeder Glaube soll seine Reinheit und Integrität bewahren. (…) Ich bin heilig, sagt die Anti-Mischmasch-Argumentation, und Du bist heilig, aber der Boden zwischen uns ist unheiliger Boden, und wir werden uns gegenseitig vergiften, wenn wir uns treffen, weil sich dadurch das Blut schädlicherweise mischt. Die andere Haltung, die wir nun erkunden wollen, nimmt den gegensätzlichen Standpunkt ein. Für mich selbst, schlägt sie vor, bin ich nicht besonders heilig, und vielleicht bist du für dich selbst auch nicht wunderbar heilig, aber der Raum zwischen uns ist heilig. Die trennende Grenze soll heiliger Boden werden, gemeinsamer Grund, Gegenseitigkeit von Resonanz und Verantwortung, die uns wahrhaft menschlich macht. Heiligkeit wird entdeckt durch Begegnung.“ (633)
So wie Hull hier den „heiligen Boden zwischen uns“ beschreibt, habe ich übrigens die Atmosphäre erlebt, als am 26. Oktober 2011 in der Fortbildung mit Jean-Félix Belinga Belinga 30 Erzieherinnen, eine Gemeindepädagogin und zwei Pfarrer die „Säulen“ ihres individuell christlichen (bzw. in einem Fall muslimischen) Glaubens auf Kärtchen in der Mitte ausbreiteten und so vor aller Augen ein beeindruckendes Bild der Glaubensvielfalt entstand (634).
In seinem Aufsatz über „Religionismus“ macht Hull deutlich, dass aus seinem Konzept nicht die Vermischung aller Religionen folgt (635).
„Es gibt zwar keine harten, starren Grenzen zwischen Religionen, aber ich sehe auch keinen Synkretismus voraus. Im Gegenteil, wenn jede Religion ihrer eigenen Berufung folgt, werden die verschiedenen Eigenheiten jeder einzelnen von ihnen noch klarer hervortreten. Besonderheit und Klarheit bedeutet nicht Rivalität und Konkurrenz. Religionen müssen warme und starke Herzen haben, aber dünne und empfindsame Haut. Aus einer christlichen Perspektive ist alles unser, ob Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder Zukünftiges (1. Korintherbrief 3,22), ob Pluralismus oder Postmoderne, alle Dinge sind unser. Wir sollen in ihnen und durch sie leben, durch die Kraft des Geistes, und sie verwandeln und sie und uns disziplinieren im Hinblick auf den Auftrag Gottes für das Leben. ‚Unser‛ meint nicht ‚unser als Christen‛, sondern vielmehr ‚unser als Menschen‛. Nicht nur sind alle Dinge unser, sondern wir sind Christi, und Christus ist Gottes (1. Korintherbrief 3,23), und wenn das Ende kommt, wird Christus das Reich Gott überlassen, und Gott wird alles in allem sein (1. Korintherbrief 15,28).“ (636)
Selbst die „Lehre von der Heiligen Dreieinigkeit“ sieht Hull als
„die kirchliche Art, Jesus zu relativieren, der so kein Idol werden kann, denn Gott ist Vater und Sohn, und die Dreieinigkeit selbst kann kein Götzenbild werden, oder besser: unser Verständnis von Dreieinigkeit kann kein Götzenbild werden, denn die Dreieinigkeit ist eine zukünftige Dreieinigkeit – eine, die war und ist und kommen wird.“ (637)
Wer nun einwenden möchte, dass das alles aus christlicher Sicht formuliert ist, lasse sich von John Hull gesagt sein, dass er sich dessen selber bewusst ist.
„Mein Vorschlag über das Überwinden von religiösem Fanatismus durch kontinuierliche, selbst-überschreitende Relativierung muss selbst kontinuierlich transzendiert werden, mit wachsender Einsicht, und mit einem Glauben, der immer weitergeht, weg vom Fanatismus und näher zur Repräsentation des Letztgültigen.“ (638)
Außerdem betont Hull:
„Eine ähnliche Logik der Selbstüberschreitung ist wahrscheinlich in allen hochentwickelten Religionen zu finden. Im Islam zum Beispiel impliziert die Bekräftigung ‚Gott ist groß‛, dass Gott größer ist als unsere Gedanken von Gott, oder auch größer als unser Gehorsam gegenüber Gott, wie wir ihn gegenwärtig verstehen. Das Konzept der Einheit Gottes, das im Islam zentral ist, deutet wohl etwas Ähnliches an. Die Verwirklichung der Einheit ist ein andauernder Prozess. Ob diese Überlegungen dem Wesen des Islam entsprechen, kann ich nicht sagen, aber soviel ist klar: Ein religiöser Glaube, der kein Konzept der Selbsttranszendenz hat oder entwickeln kann, in dem er sich selbst im Namen seines eigenen Auftrags relativiert, muss zwangsläufig zum Fetisch und Götzenbild werden. Dann wird die Besonderheit einer Religion absolut, und der Weg zu Fanatismus und Terror ist frei.“ (639)
↑ 6.6 Henning Luther: Fragmentarische Ich-Identität
Beim Nachdenken über das christliche Profil einer von der evangelischen Kirche getragenen öffentlichen Bildungseinrichtung wie einem Kinder- und Familienzentrum fiel mir ein Aufsatz von Henning Luther ein, den ich vor langer Zeit in der Zeitschrift „Theologia Practica“ gelesen und der mich schon damals beeindruckt hatte. In der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Identität im Rahmen von Bildungsprozessen kommt Luther zu der Einsicht, dass unsere Identität immer fragmentarisch bleibt, was er nicht nur negativ im Sinne von bruchstückhaft, sondern auch positiv im Sinne des Stückwerks versteht. Keine Persönlichkeit ist jemals sozusagen fertig entwickelt, kein Bildungsprozess ist wirklich abschließbar. Und zuletzt:
„Die nicht vorhersehbare und planbare Endlichkeit des Lebens, die jeder Tod markiert, lässt Leben immer zum Bruchstück werden.“ (640)
Eine „fragmentarische Ich-Identität“ ist geradezu konstitutiv für ein zu Trauer, Hoffnung und Liebe fähiges Menschsein. „Eine als erreichbar gedachte Ich-Identität“ wäre nämlich „auf die Abschottung gegenüber dem/den Anderen angewiesen, dem das Ich nur als derselbe fremdbleibend gegenübertritt, ohne die Begegnung mit dem Anderen als Veränderung zu verstehen; volle Identität wäre nur bei Verzicht auf – empathetische, den anderen als Anderen ernstnehmende – Liebe möglich.“ (641) Anteilnehmen an der Fremdheit des anderen ist also die Voraussetzung, um selber Mensch zu werden und zu bleiben.
Spannend finde ich es nun, wie Henning Luther im Rahmen seines fragmentarischen Identitäts-Konzepts das Besondere des christlichen Glaubens beschreibt: „Das eigentümlich Christliche scheint mir nun darin zu liegen, davor zu bewahren, die prinzipielle Fragmentarität von Ich-Identität zu leugnen oder zu verdrängen. Glauben hieße dann, als Fragment zu leben und leben zu können.“
Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel beschreiben, was Sünde im christlichen Verständnis ist: Sünde ist „nicht Selbstverwirklichung oder Identitätsentwicklung als solche“, sondern „Sünde ist vielmehr das Aus-Sein auf vollständige und dauerhafte Ich-Identität, das die Bedingungen von Fragmentarität nicht zu akzeptieren bereit ist.“ Würden wir „uns nicht mehr als Fragmente … verstehen, die auf ein Ganzes nur verweisen, sondern uns bereits als vollständiges Ganzes … nehmen“, wollten wir so sein wie Gott. Dieses Verständnis entlastet nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen von unserem Zwang, perfekt sein zu müssen. Und der vom Apostel Paulus erprobte „Ruhmverzicht wäre Verzicht auf erschlichene Ganzheit. … Erst wenn wir uns als Fragmente verstehen, erkennen wir unser Angewiesensein auf Vollendung, auf Ergänzung an. Und erst und nur wenn wir aus diesem Verwiesensein unserer fragmentarischen Existenz leben, sind wir gerechtfertigt, nicht aber, wenn wir bereits versuchen, ganz zu sein.“ (642)
Vor allem kann Henning Luthers fragmentarisches Konzept christlicher Identität uns davor bewahren, als Christen uns unbedingt gegenüber anderen Religionen oder Weltanschauungen durchsetzen zu müssen. Nach unserem christlichen Glauben siegt Jesus, indem er scheinbar unterliegt, ist er der Sohn Gottes, indem er ganz und gar unser zerbrechliches Menschsein annimmt und als wahrer Mensch dem Ebenbild Gottes entspricht.
„Wenn mit dem Christusglauben Jesus als der exemplarische Mensch verstanden werden kann, dann ist auch und vor allem die Fragmentarität seines Lebens exemplarisch. Exemplarisch ist das Leben Jesu vor allem durch seinen Tod. Durch die gewaltsame Kreuzigung ist Jesu Leben konstitutiv als fragmentarisches zu sehen. Der Auferstehungsglaube revoziert dies nicht. Insofern im Auferstandenen der Gekreuzigte geglaubt wird, ist vielmehr der üblichen Sicht widersprochen, die die Kreuzigung, die Fragmentarität als Katastrophe, als Sinnlosigkeit interpretiert…
Im Glauben an Kreuz und Auferstehung erweist sich, dass Jesus nicht insofern exemplarischer Mensch ist, als er eine gelungene Ich-Identität vorgelebt hätte, gleichsam ein Held der Ich-Identität wäre, sondern insofern exemplarischer Mensch, als in seinem Leben und Tod das Annehmen von Fragmentarität exemplarisch verwirklicht und ermöglicht ist.“ (643)
Henning Luther zieht aus seinem fragmentarischen Identitätskonzept auch Schlussfolgerungen für die Religionspädagogik.
„Heißt Fragmentarität Verzicht auf Bildung?
Ich meine keineswegs. Gerade der über sich hinaus, auf andere und auf Zukunft verweisende Charakter des Fragments setzt Bildungsprozesse frei.
Allerdings ohne je an ein positiv fixierbares Ziel zu gelangen. Daher muss der Identitätsgedanke denn auch anders ins Spiel kommen denn als die Formulierung einer abschließenden Zielangabe. „]Das Identitätskonzept kann prinzipiell nur kritische Funktion besitzen.“ (644)
Was Luther insbesondere für den Konfirmandenunterricht formuliert, würde ich auch auf die Früherziehung im Kindergarten anwenden:
„Es kann m. E. nicht darum gehen, dass die Konfirmanden hier in erster Linie lernen, sich als Kirchenmitglieder oder als Christen zu identifizieren. Vielmehr sollte auch und gerade das spezifisch Christliche im Konfirmandenunterricht darin zur Geltung kommen, dass die einzelnen Jugendlichen vom Druck zur Identifizierung, vom Entscheidungsdruck und vom Zwang zur Festlegung befreit werden und zur Suche, zum Experimentieren ermutigt werden… Nur so kann der späteren Erstarrung zu einer konventionalisierten Identitätsform vorgebeugt werden, auch der Gefahr einer bloß konventionellen Einstellung zur Kirche, sei es eine desinteressiert-ablehnende Haltung, sei es eine bloß äußerlich-bleibende, ritualisierte Form von Kirchenzugehörigkeit.“ (645)
Wie viel mehr gilt das für die Situation im Kindergarten, in der die Kinder keine homogen-christliche Gruppe bilden, sondern von vornherein im Zusammenleben mit Kindern unterschiedlichster Herkunft und Religion erfahren, dass jedes Kind auf seine Weise entscheidet, ob und wie es das annimmt, was es von zu Hause mitbringt oder was ihm von verschiedenen Seiten im Kindergarten entgegengebracht wird.
↑ Anmerkungen
(536) Sundermeier/Ustorf, S. 9.
(537) Sundermeier, Hermeneutik, S. 17.
(539) Ebd., S. 18 unter Bezug auf Lévinas.
(541) Vgl. Molthagen: „Der Begriff ‚Konvivenz‛ stammt aus Lateinamerika und bezeichnet dort eine Form der auf Gegenseitigkeit beruhenden Nachbarschaftshilfe in eher dörflichen Strukturen.
Heute wird dieser Begriff beispielsweise von postevangelikalen Christen im Zusammenhang mit der christlichen Mission in der Postmoderne verwendet.
Konvivenz, nachbarschaftliches Leben, bedeutet:
1. Einander helfen
2. Voneinander lernen
3. Miteinander feiern
Die Konvivenz ist in der Trinität Gottes verankert. Der drei-einige Gott hat in sich selbst Gemeinschaft. Und der Mensch, der ja nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, soll ebenfalls in Gemeinschaft leben – in Gemeinschaft mit Gott und in Gemeinschaft miteinander, ein jeder in Friedem mit seinem Nachbarn.
Wo die Gemeinschaft zerbricht, da herrscht die Sünde.“
(542) Sundermeier, Hermeneutik, S. 19f.
(545) Ebd., S. 221f., unter Bezug auf Sundermeier, Hermeneutik.
(546) Behr, Friedenserziehung, S. 240.
(547) Ebd. 241. Wohl durch ein Versehen fehlt hier der Hinweis auf das mit „Achtsamkeit“ übersetzte arabische Wort „ihsān“, vgl. Behr, Bildungsziele, S. 31. Vgl. Uygun-Altunbas, S. 8: „Achtsamkeit (arab. ihsān: Leben und Handeln im Bewusstsein, dass Gott Mitwisser ist; Ansatz der islamischen Lehre vom Gewissen)“, siehe Kapitel 5.3, 3. Absatz.
(548) Behr, Friedenserziehung, S. 241.
(549) Biesinger/Schweitzer/Edelbrock, S. 18.
(551) Edelbrock/Patak/Schweitzer/Biesinger, S. 165f.
(552) Biesinger/Schweitzer/Edelbrock, Text und Grafik auf S. 21.
(553) Ebd., Text und Grafik auf S. 23.
(554) Ebd., Text und Grafik auf S. 24.
(555) Ebd., Text auf S. 25, Grafik auf S. 24.
(556) Ebd., Text auf S. 26, Grafik auf S. 25. Im Zitat habe ich einen Fehler berichtigt, da im Text versehentlich auch bei der 71-Prozent-Zahl von „nicht-konfessionellen“ Einrichtungen die Rede war.
(558) Auf dieses Thema gehe ich hier gar nicht und später nur am Rande ein, indem ich in den Kapiteln 8.4 und 10.3 auf Gedanken von Reinhold Bernhardt zurückgreife. Lesenswert fand ich besonders: Bernhardt, Theologische Grundlagen und Bernhardt, Pluralistische Theologie.
(560) Ebd., S. 122f. Wissenschaftstheoretisch greift sie auf Ralf Bohnsack zurück, dessen Methoden wiederum „einen an [Karl] Mannheim orientierten wissenssoziologischen Hintergrund“ voraussetzen.
(561) Ebd., S. 131, unter Bezug auf Konrad, S. 7 und 10. Vgl. auch Kapitel 9.1.4.
(563) Schweitzer, Nachdenken, S. 106.
(564) Ebd., S. 106f. Vgl. aber Kapitel 4.2.4 zur Abstraktionsfähigkeit von Kindern.
(566) Auf sein Konzept einer evangelischen Profilierung in der Kindertagesstättenarbeit gehe ich im Abschnitt 6.4 ausführlicher ein.
(567) Harz, Lernen, S. 97.
(571) Ebd., S. 100f. (Hervorhebung von mir, H. S.).
(572) Harz, Skript, S. 13f.
(573) Eine arabisch-stämmige Muslimin äußerte mir gegenüber, dass sie sich eine solche Heranführung an den eigenen Glauben für ihre Kinder gewünscht hätte.
Vgl. Thiersch, S. 63: „Viele muslimische Eltern wünschen sich auch einen islamischen Kindergarten, in dem die gesamte Kindergartenerziehung in der Atmosphäre und unter dem Primat der islamischen Religion gestaltet wird. Es gibt in Deutschland einige solcher Kindergärten, in manchen Orten werden dagegen Einrichtungen in islamischer Trägerschaft wegen der Gefahr der Segregation abgelehnt. Ob islamische Kindereinrichtungen akzeptiert werden, ist primär eine gesellschaftspolitische Frage, auf die ich mich hier nicht einlassen möchte.“
(574) Harz, Bildung, S. 73f.
(583) Harz, Skript, S. 8.
(584) Harz, Bildung, S. 132f., wo er diesen Leitgedanken im Zusammenhang mit Überlegungen zum Unterschied zwischen der Situation im Kindergarten und im schulischen Religionsunterricht formuliert: „Andere Bedingungen als in der Kindertagesstätte sind im Religionsunterricht beim Kennenlernen von und Umgang mit religiöser Vielfalt gegeben. In der Kindertagesstätte geschieht interreligiöse Bildung im Wahrnehmen anderer Verhaltensweisen von Eltern und Kindern und deren Verstehen-Lernen… Im Religionsunterricht sind die Kinder nach religiöser Zugehörigkeit getrennt. Unterrichtsvorschläge versuchen den hier versperrten unmittelbaren Erfahrungsweg durch Einladungen muslimischer Schülerinnen und Schüler sowie erwachsener Repräsentanten des Islams, durch Besuche in der Moschee oder aus muslimischen Familien ausgeliehene Gegenstände der Frömmigkeitspraxis auszugleichen. Der Zugang zur anderen Religion erfolgt im Religionsunterricht also im Wesentlichen anders als in der Kindertagesstätte. Sie begegnet als Unterrichtsinhalt, vermittelt durch unterrichtliche Medien. Und während in der Kindertagesstätte bei allen christlichen Inhalten mitzudenken ist, was dies für muslimische Kinder und Eltern bedeutet, ist in der Schule der Unterrichtsinhalt ‚Islam‛ eher einer neben vielen anderen.“
(585) Harz, Religiöse Bildung, S. 13.
(587) Harz, Bildung, S. 57f.
(591) Hull, Mishmash, S. 27: „The oceanic receptivity of the young child must be formed into a set of culturally acceptable preferences. The fear that children will be confused does not mean that children will subjectively experience a sense of confusion, since as we have seen young children quite happily eat all kinds of unorthodox combinations. The fear on the part of the adult is that the children will fail to be socialised into the emotional and cognitive boundaries of a tradition.“
(592) Harz, Bildung, S. 53.
(594) Dommel, Religions-Bildung, S. 163, formuliert diesen Satz im Blick auf Schweitzers Verteidigung eines schulischen Religionsunterrichts in konfessioneller Verantwortung, dessen „Organisationsform“ er mit dem Sprachenlernen in der Schule vergleicht: „Fremdsprachenunterricht in der Schule werde nicht in der Form einer Metatheorie der vergleichenden Sprachforschung, sondern als Latein-, Englisch-, Französisch- oder Spanischunterricht erteilt und betrieben. Ebenso könne auch Religionsunterricht nicht in der Form einer vergleichenden Religionskunde und -wissenschaft erteilt werden. [zitiert nach Schweitzer, Pädagogik, S. 115] – Gleichzeitig verwahrt sich Schweitzer gegen logische Schlussfolgerungen aus eben derselben Analogie, die Kindern nach dem Erlernen der ‚muttersprachlichen‛ Religion auch andere religiöse ‚Sprachen‛ zugänglich machen wollen…, mit dem Hinweis auf die s. E. fehlende religiöse Sozialisation in Familie und Gesellschaft.“ Vgl. Schweitzer, Nachdenken, S. 104: „Man kann auch sagen, dass die Wahrnehmung religiöser Erziehungsaufgaben im Kindergarten umso wichtiger wird, je weniger die religiöse Erziehung in Familie und Gesellschaft gesichert ist.“
(595) Harz, Bildung, S. 91.
(596) Harz, Biblische Geschichten, S. 43, in einer Randbemerkung zur Erwähnung von „Gemeinsamkeiten … in Bibel und Koran“.
(597) Harz, Bildung, S. 116.
(602) Harz, Werte, S. 76.
So auch Harz, Bildung, S. 50: „Schwieriger wird es, wenn solche religiös-kulturellen Traditionen im Zusammenleben aufeinanderprallen und zu Widersprüchen und Ungerechtigkeit führen: Wenn solche Regeln etwa die Bevorzugung von Jungen gegenüber den Mädchen oder Erziehungsgrundsätze vorsehen, die mit Angst vor Strafen operieren. Erziehung und Bildung im öffentlichen Raum folgen hier den von der Gesetzgebung formulierten Grundrechten und -pflichten sowie ihren Konsequenzen für das Bildungsgeschehen.
Im privaten Raum der Familienerziehung bleibt der Spielraum für unterschiedliche religiös-kulturelle Traditionen demgegenüber viel größer. Kinder lernen so auch, dass in unterschiedlichen Lebensräumen unterschiedliches Verhalten geboten beziehungsweise erlaubt sein kann: dass etwa Ali, der zu Hause manche häuslichen Aufgaben seinen Schwestern überlassen darf, in der Kindertagesstätte in gleicher Weise wie alle anderen sich am Aufräumen zu beteiligen hat; dass in der Kindertagesstätte nicht mit dem strafenden Gott gedroht wird.“
(603) Harz, Bildung, S. 47.
(604) Bielefeldt, Menschenrechte, S. 55: „Für viele Muslime lassen sich die Konflikte zwischen Scharia und Menschenrechte im Geiste des Koran durchaus produktiv bewältigen, z. B. durch eine Koranlektüre, die eher auf die generelle Zielsetzung als auf den Buchstaben der Schrift abstellt.“ Siehe auch Kapitel 2.2.2.
(605) Dommel, Mischmasch, erster Absatz und Anm. 1: „Mischmasch – so nennen Kritiker abwertend den englischen pädagogischen Ansatz, allen Kindern, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, gemeinsam Religionsunterricht zu erteilen.“ Der Titel des Buches von John M. Hull „greift die polemische Bildersprache der Gegner des multireligiösen Religionsunterrichts auf und untersucht die in der Debatte häufig gebrauchten Essens-Metaphern (‚Eintopf‛, ‚Einheitssoße‛, ‚Cocktail‛) und ihre emotionalen und kulturellen Hintergründe.“
(***) Inzwischen doch, da ich es selbst übersetzt habe und hier auf der Bibelwelt veröffentlichen durfte.
(606) Hull, Mishmash, S. 31: „Erikson distinguished between two types of identity: the identity of totality, and that of wholeness“. Hull bezieht sich dabei auf Erikson, Identity, S. 80-89, und Erikson, Life, S. 175ff.
(607) Ebd.: „Totalising identity is formed through exclusion. I know myself as a European precisely because I am not African, as a man just because I am not a woman, as an adult just because I am no longer a child. Central to totalising identity formation is the creation of boundaries. It is within this boundary that I am myself; beyond the boundary is something else, something different which is not me. On the other hand, the identity which is characterised by wholeness operates through inclusion. Although a European I am also human and therefore I include the African. Although male, I am conscious of my femininity. As an adult, childhood is still within me. I am not only this; I am that.“
(608) Ebd., S. 32: „The metaphors of mixed and distasteful food are being used to discredit those who believe that identity may be advanced both through exclusion and inclusion.“
(609) Dabei bezieht er sich auch auf Gedanken von Douglas, Purity and Danger.
(610) Hull, Mishmash, S. 32: „In order to understand this need to attack and discredit we must investigate the character of religious exclusivity. The central concept here is that of purity. In order to maintain purity it is necessary to distinguish it from impurity. As we have said, it is characteristic of the totalising identity to achieve coherence through drawing a line between what one is and what one is not. Purity is inside, impurity is outside. The distinction between purity and impurity is thus a matter of region or place. If that which is beyond the boundary should cross over and come inside, it would be out of place. Its characteristics might all be the same, but its location would have changed, and that would be enough to make it dirt.“
(611) Ebd.: „Dirt is matter out of place. Gardening tools are not kept in the wardrobe nor are boots, even when brightly polished, kept with the cups and saucers. Cooking utensils are by definition dirty before they are washed, but it is dirtier to leave them lying around in the living room than to stack them up beside the sink in the kitchen. Dirtiness is a certain kind of untidiness. Books can be untidy on a bookcase, but when the books are mixed with milk bottles, light bulbs and spare parts for the car, many people would feel this is not merely untidy but messy. To have soil or earth on ones hands is to be dirty, but soil in the garden is not dirty, and one wouldn‛t bother about having dirty hands whilst doing the gardening. It is only when you come inside the house that your hands become dirty.“
(612) Ebd., S. 33: „When we use the symbolism of the body, and particularly the symbolism of eating and of food, our deepest fears and anxieties about society may be expressed.“
(613) Ebd.: „‛Children of all faiths are cheated by this multi-faith mish-mash…‛ …
When these borders are crossed, the purity of both food and faith is threatened.“
(614) Ebd., S. 34: „The dietary covenants made with Adam and Eve, and with the family of Noah were, in principle, with an undivided humanity. The covenant made with Moses, however, was with the people of Israel only.“
(615) Ebd., S. 35: „Immediately we find that with a divided humanity comes a divided diet. Distinctions of culture and religion are expressed in food distinctions. ‛I am the Lord your God, who have separated you from the peoples. You shall therefore make a distinction between the clean beast and the unclean, and between the unclean bird and the clean; you shall not make yourselves abominable by beast or by bird or by anything with which the ground teems which I have set apart for you to hold unclean. You shall be holy to me; for I the Lord am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine.‛ (Lev. 20:24b-26.) The concept of mishmash would not be possible without the concept of clear distinctions between types of food, and norms about how they are to be presented in a cuisine. Distinctions of this type, however, seem to appear only when there is a need to reinforce distinctions between races.“
(616) Veerkamp, S. 81, Hervorhebungen von mir entfernt (H. S.).
(619) Hull, Mishmash, S. 39: „He broke the laws of purity by eating with those who were ritually unclean and socially unacceptable (Mk. 2:15f). … He broke down the borders which divided sacred time from the secular (Mk. 2:23ff). In all of this he was perfectly well aware that he was introducing a radical break with the world of the old sacred classifications. The brand new material could not be used to patch up the old garment. The new wine would only split the old wine bottles (Mk. 2:21f). It is equally remarkable that he broke down the borders of the natural family by replacing the ties of blood and kinship with a universal fellowship of all those who responded to God. … lt is consistent with this that he rejects a blessing upon the source of his infantile nourishment. ‛A woman in the crowd raised her voice and said to him, ‹Blessed is the womb that bore you and the breasts that you sucked.›‛ He replied, ‛Blessed rather are those who hear the word of God and keep it.‛ (Luke 11:27ff.) This rejection of the emotional intensity of infantile food has both literal and metaphorical associations, and it is again highly significant that the food metaphor is replaced by a universal principle. Boundaries of tribe, nation and race are, in principle, shattered (compare Luke 4:25-27).“
(620) Ebd., S. 38f.: „Peter ‛fell into a trance and saw the heaven opened, and something descending, like a great sheet, let down by four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air.‛ (Acts 10:10ff.) The sheet was indeed full of a horrifying mishmash, in which the purity of Peter‛s faith was threatened with dilution, things held carefully apart were now trivialised into a mere relativity, a veritable mixing bowl approach to God‛s commandments was about to be thrust down his throat. When the heavenly voice invited him to eat this hotchpotch, Peter shrank back like a modern legislator confronted by an agreed syllabus, piously protesting ‛No, Lord; for I have never eaten anything that is common or unclean.‛ (v.14.) But the voice said, ‛What God has cleansed, you must not call common.‛
From now on, holiness was not to be found in observing distinctions, but in overcoming them. There is no doubt that this disregard for purity of separation goes back to Jesus himself.“
(621) Ebd., S. 39: „Jesus and his disciples were criticised for their laxity by those who were keen to emphasise the purity of the system of classifications. In reply, Jesus offered a new view of religious identity, one which is not threatened by contagion or contamination from the outside but one which is sustained by the intentions of the heart as these affect actions in relations between people. ‛Do you not see that whatever goes into someone from outside cannot defile them, since it enters not the heart but the stomach, and so passes on?‛ Thus he declared all foods clean. And he said ‛What comes out is what defiles someone. For from within, out of someone‛s heart, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile you.‛ (Mk. 7:18-23)“ [Hull schreibt versehentlich Mk. 15 statt 7].
(622) Ebd., S. 40: „That which is out of place can frustrate the system of purity and can thus be regarded as dirt. That which is out of place can also challenge prevailing conceptions and can thus be a source of renewal and transfiguration. When things move out of their restricted places, there may be a blissful fusion of opposites, a transcending of the old contrary things in a new order. Both these tendencies are found in religion: the tendency to separate and the tendency to unite [zitiert nach Douglas, Purity and Danger, S. 10]. Salt is dirty when thrown on the floor or over the clothes, but when used wisely in cooking it adds life and flavour.“
(623) Ebd.: „It is thus significant that the early Christian movement focussed around a common meal, which was symbolic of the new kingdom, the new humanity. This new people has ‛put on the new nature, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there cannot be Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free person, but Christ is all, and in all.‛ (Col. 3:10f.)“
(624) Ebd.: „Does the New Testament teaching about the new humanity justify us in disregarding distinctions between religions? This is not the place to enter into a full discussion of a Christian theology towards the religions of the world, but it can be pointed out in passing that religious distinctions were clearly transcended in the Pauline theology of the new people. The distinction between circumcision and uncircumcision was a religious distinction. Circumcision was the fundamental sign of the covenant between God and Israel. The distinction between Jew and Greek was not only a cultural but very evidently a religious distinction. There is a real danger that Christians today, experiencing identity threat through immature conceptions of Christian faith, will think of themselves as a new tribe, distinguishing themselves from other tribes, other world religious cultures, just as some of the first century Jews distinguished between themselves and the Gentiles.“
(625) Hull, Religionen, S. 70: „Wenn negative Bilder der Religion anderer benutzt werden, um die bedrohte Identität von religiösen Individuen oder Gruppen zu stärken, können wir sagen, dass Religion zu Religionismus wurde [diesen Begriff hatte er bereits in Hull, Religionism, S. 335-350, und Hull, Religious Education, S. 75-85, erläutert]. Erikson kombinierte seine psychologische Erkenntnis mit seinem Verständnis von Ethologie, indem er von Pseudo-Artenbildung sprach [diesen Begriff findet Hull bei Erikson, Identity, Ende des 1. Kapitels, und Erikson, Gandhi’s Truth, S. 400 und 432]. Angesichts einer Bedrohung grenzt sich der Stamm nach außen hin ab, gruppiert sich um die symbolischen Zentren von Identität und Macht und wird eine Spezies innerhalb seiner Spezies. Menschen aus anderen Kulturen und Stämmen werden behandelt, als gehörten sie tatsächlich einer anderen Spezies an: sie haben nicht einmal unsere biologische Natur, sie teilen nicht dieselbe Art von Geist oder Seele mit uns.“
(626) Hull, Mishmash, S. 40f.: „Throughout the Bible there is a struggle between Israel for the Israelites and Israel as a light to enlighten the Gentiles, between God as the Lord of Israel and God as the Lord of all peoples. So it is with Christianity: there is a tribalising option which emphasises religious distinction and there is a universalising option which emphasises the Kingdom of God. What Jesus inaugurated was not a new religion but a new humanity. lt is this insight which inspires the description of the new ecclesial community in which the old racial and religious distinctions have been broken down. ‛For he is our peace, who has made us both [i.e. Jews and Gentiles] one, and has broken down the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law of commandments and ordinances, that he might create in himself one new humanity in place of the two …‛ (Eph. 2:14f.) This principle flows not only from the common eucharistic meal, but from the common baptism as well. ‛For as many of you as were baptised into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.‛ (Gal. 3:27f.) The closing expression ‛all one in Christ Jesus‛ should not be interpreted along the lines of totalistic identity, by exclusion, but rather through inclusion, along the lines of an identity of wholeness. This is made clearer by the words which immediately follow. ‛And if you are Christ‛s, then you are Abraham‛s offspring, heirs according to promise.‛ (Gal. 3:29.) Does this mean that all Christians have now become tribalised into the physical descent of Abraham and are thus literally Jews? Rather, Paul is using the expression ‛Abraham‛s offspring‛ metaphorically or spiritually, since both Christians and Jews are ‛heirs according to promise‛. The promise is the universal promise to all people. We see then that the new humanity in Christ Jesus looks for the metaphorical or the spiritual in all literal, religious traditions, and does not become engrossed in the distinctions between Christianity and Judaism. I am not saying that discussion of these contemporary distinctions is not a legitimate part of inter-faith dialogue now. I do maintain, however, that the biblical vision transcends both Israel and Christianity considered as tribes or races, as ideological blocks, and prefigures a new, world-wide community. This insight is found in the Torah and the Prophets as well as in the New Testament.“
(627) Ebd., S. 41f.: „In conclusion, let us discuss a Christian approach to the teaching of religious education in Britain today. We may distinguish between a totally Christian approach and a wholly Christian approach. The totally Christian approach will promote what I have elsewhere described as ‛ideological enclosure‛ [hier greift er auf Hull, Christian Adults, Kapitel 1, und Hull, State Schools, zurück]. It will screen out from the curriculum and, if possible, from the entire social world of the child, anything which is explicitly other than from the Christian religion.“
(628) Ebd., S. 42: „The curious paradox about this approach is that by placing one totality in the same curriculum as another (as would apparently happen in county schools where significant groups of pupils from various religions were present) it is impossible to avoid the implication that some religion or other must fill the totality slot.“ Die letzte englische Wendung lässt sich kaum ins Deutsche übertragen. Wörtlicher übersetzt: „man kann nicht die Schlussfolgerung vermeiden, dass die Münze der Absolutheit der einen oder anderen Religion in den Einwurfschlitz der Absolutheit passt.“
(629) Ebd.: „It is part of the healthy ecology of the human mind, that things which are separated become comparable in their separateness, whereas things which are integrated yield harmonious uniqueness.“
(630) Ebd.: „This is because the totality approach, although it appears to run along parallel and separate lines is intrinsically competitive. It is, in the end, a marketing approach. The different brand labels must remain unique and separate for purposes of image and loyalty, and no contamination of other brand labels must mar this. The very process, however, makes it abundantly clear that there are various brand loyalties on the market. The separateness and the distinctiveness supposes a relationship which, precisely because it refuses to enter into dialogue, is bound to enter into competition. As in the apartheid politics of South Africa, so in the totality approach to the religious education curriculum in Britain: when communities are rigidly separated they end up by devouring each other.“
(631) Ebd., S. 43: „The truth is that built into a number of religions are theological defences against each other. In order to achieve its identity in separation from Judaism, Christianity had to pass through a totalising stage. We remember Erikson‛s emphasis that periods of totality and periods of wholeness may alternate in the development of identity. The early Christians found it necessary to engage in a polemic against Judaism in order to establish their reasons for not being Jews. Anyone who reads the Gospel of John with its disparaging references to the Jews will notice this feature. In a somewhat similar manner, Islam had to distinguish itself from Christianity, and a polemic against both Christianity and Judaism is built into its self understanding. It is certainly possible to interpret religious traditions in intolerant and exclusivist ways, but in a society like ours where the creation of tolerance and understanding must be rated as an important social goal it seems unwise to take the risk.“
(632) Ebd.: „If the approach which we have described as total is essentially based upon the experience of Christianity as an absolute religion side by side with other absolute religions, the approach to a wholly Christian curriculum would spring not from Christianity as one of the religions of the world but from the Kingdom of God teaching of Jesus and from the teaching of Paul about the new humanity. The actual religious traditions, in their present concrete form, are taken with full seriousness, since they are part of the history which shapes the world. They are to be treated in the full beauty of their holiness, without trivialisation and without invidious comparison, but there will be no fear of contagion. Children and their faiths will live and learn side by side. Loyalty to one‛s own faith is not inconsistent with a sympathetic insight into the faiths of others, and this is as true for children as for adults. And thus religious education will play its part in the building up of a new earth.“
(633) Ebd., S. 38: „The time has come, in this final chapter, to contrast the world from which the fears of mishmash spring with another world. When Jesus said, ‛This is my blood of the new covenant shed for many for the forgiveness of sins. Drink ye all of it,‛ his disciples all drank from a common cup. Has not God ‛made of one blood all peoples to dwell on the face of the earth?‛ (Acts 17:26 AV.) Those who have a fear of mishmash are deeply respectful of the faith of others. Each faith is to preserve its purity, its integrity. Each religion is a kind of separate classification. I am holy, says the anti-mishmash argument, and you are holy, but the ground between us is unholy and we will contaminate each other through a harmful mingling of blood if we should meet. The other approach, the one which we shall now explore, takes the opposite point of view. In myself, it suggests, I am not particularly holy, and perhaps in yourself you are not wonderfully holy, but the ground between us is holy. The boundary which separates shall become the holy ground, the common ground, the mutuality of response and responsibility which makes us truly human. Holiness is discovered through encounter.“ Diese Übersetzung teilweise nach Dommel, Mischmasch.
(635) Vgl. hierzu auch das Beispiel, das Nipkow, S. 374, zum „Prinzip der Wahrhaftigkeit“ und dem „Bildungsziel einer starken, aktiven Toleranz“ aus dem Bereich des Islam unter Bezug auf Talbi, S. 153 und 155, anführt: „Der tunesische Dialogtheologe M. Talbi will die »Pflicht des Apostolats«, d. h. die glaubensbezogene Stellungnahme, auf keinen Fall dem »Dialog« aufopfern. Er ist davon überzeugt, dass das konfessorische Zeugnis »sich vereinen lässt mit dem Respekt vor dem anderen Menschen und den anderen Konfessionen«, allerdings unter zwei Bedingungen. Es hat erstens »ohne Polemik« zu erfolgen, ohne »eine neue Form des Proselytismus …, als Mittel, die Überzeugungen des anderen zu untergraben und seinen Zusammenbruch oder seine Übergabe herbeizuführen …«. Zweitens taugt zum religiösen Dialog nicht der »Kompromiss«. »Niemand, Gläubiger oder Atheist, darf mit seinem Glauben oder seinen Ideen mogeln.« Dialog und interreligiöses Lernen setzen »totale Aufrichtigkeit voraus«…“
(636) Hull, Religionen, 78f. Die Hervorhebung im Text stammt von mir, Helmut Schütz.
(637) Ebd., S. 79, unter Bezug auf Hull, Holy Trinity.
(639) Ebd., S. 79f., unter Bezug auf Bibac.
(640) Luther, Fragment, S. 324.
(645) Ebd., S. 335. Ähnlichkeiten zur Henning Luthers Ansatz sind mir übrigens beim muslimischen Religionspädagogen Abdullah Sahin aufgefallen; vgl. Dommel, Religions-Bildung, S. 225: „Sahins Interpretation postmoderner Theorien entdeckt – entgegen deren Image als nihilistischer Verweigerung von ‚Sinn‛ – bei den muslimischen Jugendkulturen aktive Sinnkonstruktion gerade innerhalb des Fragmentarischen, Unvollständigen und Defizitären, das die gesellschaftliche Außenseiterposition ihnen aufzwingt. Das religiöse Selbstverständnis, Geschöpf Gottes zu sein, steht für Sahin nicht im Widerspruch, sondern im Gegenteil im Einklang mit der menschlichen Grunderfahrung der Unvollständigkeit und ist ein Beleg für den ‚fundamental educational character of human existence‛…: ‚Though incompleteness sounds like a deficiency, in fact it is, alongside self‛s self-overcoming capacity, one of the sources for human maturation.‛“ Dommel zitiert hier einen Beitrag von Nick Peim über Abdullah Sahin, der im Internet veröffentlicht war, aber inzwischen nicht mehr verfügbar ist.
