Ein Buch von Walter-Jörg Langbein regt dazu an, sich mit Irrtümern auseinanderzusetzen, die angeblich oder wirklich im Neuen Testament vorhanden oder aber ihm als Bibelkritiker unterlaufen sind. Jesus verkörpert jedenfalls auch als Mensch, der irren konnte, die wahre Menschlichkeit, nach der Gott uns alle zu seinem Ebenbild der Liebe erschuf, ist er doch wahrer Gott UND wahrer Mensch zugleich!
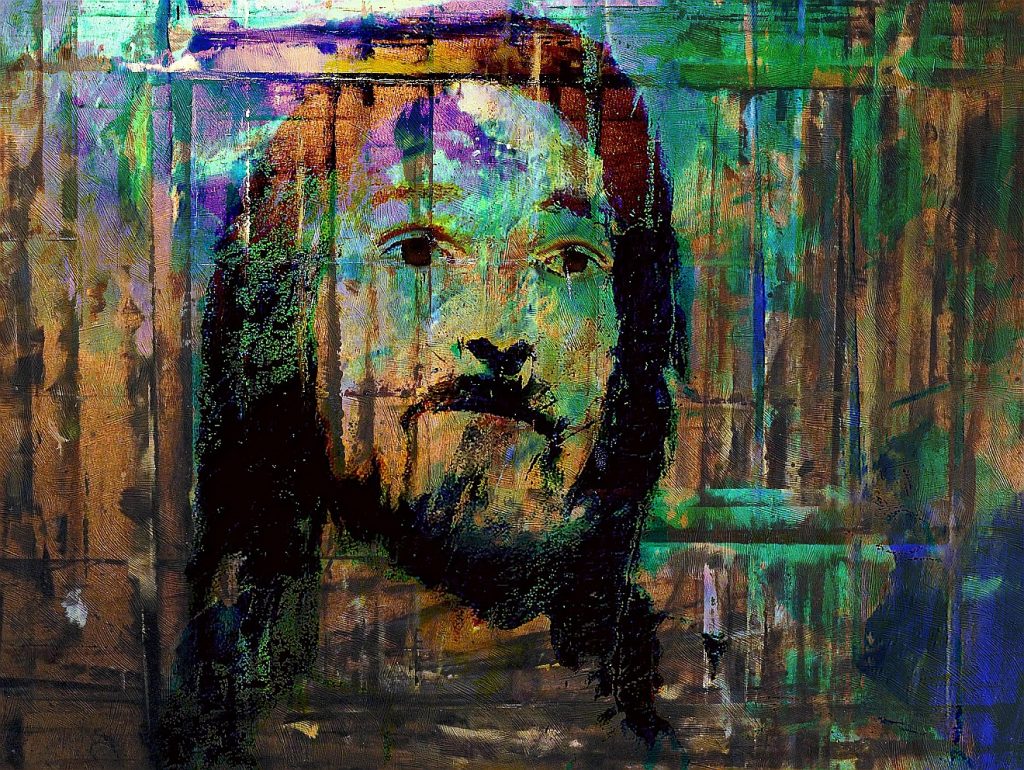
Inhaltsverzeichnis
Nicht nur Jesus durfte Gott „Vater“ nennen
Jesus feierte kein christliches Abendmahl
Irrte sich Jesus über den Zeitpunkt der Apokalypse?
Die „Armen im Geist“ – ganz und gar durch Armut gezeichnet!
Astrologische Berater bringen Jesus königlichen Tribut
Faszinierende Vielfalt von Bildern der Himmelfahrt Jesu
Der Auferstehungsglaube ist nur in Bildern auszudrücken
Jesus forderte nicht wirklich, sich ein Auge auszureißen
War Jesus hässlich? Niemand weiß, wie er aussah!
Bergpredigt oder Feldrede: Jesu Lehre in der Autorität des Mose
Zur Symbolik der Zwölfzahl und einiger Namen der Jünger Jesu
Jesu paradoxes Lob eines betrügerischen Verwalters
Wie Matthäus in genialer Weise auf prophetische Texte anspielt
Konnte Jesus voraussehen, ob Christen verfolgt und Jünger mit Reichtum belohnt wurden?
Es ist unwichtig, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat
Wer dem Messias dient, dient dem, der zum Diener wird
Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea
Alttestamentliche „Vorlagen“ für die Erzählung von Jesus am Kreuz
Dachte Jesus bei Markus über die Ehescheidung wie ein Römer?
Gingen jüdische Männer wirklich nicht zum Markt?
Irrte Jesus über die Wiederkunft Elias in Johannes dem Täufer?
Erscheinungen des Auferstandenen vor den Augen des Glaubens
Jesus lag die wahre Erfüllung des Sabbatgebots am Herzen
Der verfluchte Feigenbaum und Jesu symbolhafte Sprache
Wann wurden Apostel ausgesandt – wann Petrus „Fels“ genannt?
Jesus als Verkörperung Israels muss aus Ägypten gerufen werden
Warum beschimpfte man Jesus als Fresser und Weinsäufer?
Jesus reiste nicht von Galiläa nach Galiläa – er startete in Judäa
Gott erhört alle Gebete, ist aber kein Wunscherfüllungsautomat
Müssen alle Gebote der Bibel befolgt werden?
Hatte Jesus Geschwister oder blieb Maria für immer Jungfrau?
Jesu Abschied von den Jüngern – nicht nur im Garten Gethsemane
Was heißt „in den Himmel kommen“ und wie schafft man das?
Manipulierte Bibelübersetzungen aus dogmatischen Gründen?
Kann sich die Zwei-Reiche-Lehre Luthers auf Jesus berufen?
Nicht nur das Wort vom „Hand-Abhacken“ ist bildlich zu verstehen
War Jesus ein Obdachloser oder ein Hausbesitzer?
Himmelfahrt – ein Bild für unterschiedliche Glaubenserfahrungen
Abwegige Zweifel an Jesu Hinrichtung am römischen Kreuz
„Ich aber sage euch“: Zustimmung, nicht Widerspruch
„Ich will: Sei rein!“ Hat Jesus das tatsächlich zu einem Aussätzigen gesagt?
Matthäus stellt Jesus in eine Beziehung zu „Immanuel“
Steckt in Jesu Lob des Israeliten Nathanael ein versteckter Tadel?
Jesus unternahm keine schamanischen Jenseitsreisen
Wurden Prophezeiungen des Jeremia gegen Jesus vertuscht?
Josef von Arimathäa, Jesu Grab und der „Gottesknecht“ Jesajas
Judas: Widersprüche um seinen Tod
Wie zentral ist die christliche Lehre von der Jungfrauengeburt?
Erst spät entstanden die kanonischen Evangelien, noch später die Apokryphen
Bezeichnete sich Jesus als König der Juden – oder nicht?
Wer war verantwortlich für Jesu Kreuzigung?
Jesus – in Bethlehem geboren – in Nazareth aufgewachsen?
Warum wurde Jesus in Solidarität mit „Räubern“ gekreuzigt?
Die Lücken im Lebenslauf Jesu können nicht gefüllt werden
Glaube und Hoffnung auf Gott bewirken Heilung, nicht Magie
Ist „Mammon“ der Gott des Geldes oder die Göttin „Mamre“?
Bezeichnete sich schon Jesus als der kommende Menschensohn?
Wem galt Jesu Missionsbefehl – Juden? Heiden? Samaritanern?
Worauf im AT spielt Matthäus mit dem Wort „Nazoräer“ an?
Nachfolger: Größere Wunder als Jesus?
Die Nächstenliebe war kein „neues Gebot“ Jesu
Saß Jesus im Glashaus und hielt sich nicht an eigene Verbote?
Nathan: Ein klarer Irrtum bei Lukas
Sollten Jesu Wunder geheim bleiben oder offenbar werden?
Jesus oder Barabbas – von der Menschenverachtung des Pilatus
Wie beurteilte Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte?
Missionarische Propaganda stellt Jesus als Herrn der Tiere dar
Prophezeiungen deuten Jesus vom Alten Testament her
Historisch gesehen gab es keinen Prozess Jesu vor jüdischen Richtern
Außerbiblische Quellen schweigen über den historischen Jesus
Reaktionen auf Johannes den Täufer und auf Jesus
Wollte Jesus eine Reform des Judentums – oder die Apokalypse?
Spannende Fragen zum Reinigungsritual der Maria
Von Jesajas Rute oder Reis zur Rose im Weihnachtslied
Von Schwertern und Pflugscharen und Jesu Aufforderung, ein Schwert zu kaufen
Das „göttliche Passiv“ im Aramäischen und Hebräischen – und auch im biblischen Griechisch
Senfkorn und Senfstrauch – war Jesus im Irrtum über ihre Größe?
Warum wird Sepphoris in der Bibel „verschwiegen“?
Wollte Jesus durch Milde gegenüber der Ehebrecherin sein eigenes Leben retten?
Wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft – oder nicht?
Tempelzerstörung: Ist Jesus eine Kopie des Messias Menachem?
Wann wurde Jesus gekreuzigt – und wann starb er wirklich?
Wie sollen Tote Tote begraben – Abschreibfehler oder Bildwort?
„Umkehr“ meint Umkehr zu Gott, nicht den Übertritt zu einer neuen Religion
War Jesus als Davidssohn ein Messias, der auf einen Umsturz bedacht war?
Wie viele Versionen des Vaterunser gibt es in der Bibel?
Dürfen wir Gott bitten: „… und führe uns nicht in Versuchung“?
In den Evangelien werden nicht „die“ Juden verflucht
Zum wiederholten Male: Wer ist verantwortlich für Jesu Tod?
Viele Fragen um den Verrat des Judas – fand er überhaupt statt?
War Johannes der Täufer als Vorbote Jesu der wiedergekehrte Elia?
Wunder: Wie viele Blinde heilte Jesus?
Gott wollte, dass Jesus den Versuchungen des Satans standhielt
Jesus war Messias = Christus = Gesalbter und Menschensohn
Jesus hieß eigentlich Jeschua oder Jehoschua – aber mit Ypsilon schrieb man ihn nicht
Stammt der biblische Satan aus der Religion Zarathustras?
Jesus liefert keine Beweise – aber „Zeichen“ für Vertrauende
Josef und Jesus waren Handwerker – nicht Zimmerleute im heutigen Sinn
Der katholische Priester-Zölibat geht nicht auf Jesus zurück
Zwölf Jünger Jesu – wer irrte sich über ihre Zahl und über die Zugehörigkeit zu ihrem Kreis?
Nachwort: Wie Martin Luther alle Ästlein des mächtigen Baumes der Bibel abklopfen!
↑ Sehr geehrter Herr Langbein,
nachdem Sie meine Besprechung Ihres Buches über die biblischen Irrtümer beider Testamente per Mail als wohltuend sachlich empfunden haben, habe ich auch Ihrem Buch „Lexikon der Irrtümer des Neuen Testaments. Von A wie Apokalypse bis Z wie Zölibat“ (München 2007) eine Menge Anregungen zum Nachdenken entnommen. Ja, Sie haben mich durch Ihre Kritik an der Art, wie Matthäus im 27. Kapitel die Propheten des Alten Testaments zitiert, sogar dazu inspiriert, eine Predigt zum Volkstrauertag 2019 genau mit diesem Text zum Thema „Die Reue des Judas und der Töpferacker“ zu halten.
Als Ziel formulieren Sie für Ihr Buch zum Neuen Testament (S. 16) (1)
„die Annäherung an den realen Jesus, sein Leben und Sterben. Wer Irrtümer des ‚Neuen Testaments‘ nicht wahrhaben will, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, am wirklichen Jesus gar nicht interessiert zu sein.“
Eine solche Zielsetzung kann allerdings dazu verführen, dass man nun umgekehrt herauszubekommen versucht, was der historische Jesus denn nun genau getan oder gesagt hat und ob alles, was von ihm berichtet wird, von der Empfängnis bis zu seiner Himmelfahrt, auch tatsächlich so geschehen ist. Sie wissen aber selber, dass die Suche nach dem „historischen Jesus“ bisher nahezu erfolglos geblieben ist; auf Grund der Bibel verfügen wir lediglich über Erinnerungen an Jesus, die vom Vertrauen auf ihn als den Messias Israels und Sohn Gottes geprägt sind.
Insofern greift Ihre Kritik an Irrtümern im Neuen Testament überall dort zu kurz, wo sie lediglich auf folgende Argumentation hinausläuft (S. 15):
„Wenn ein und derselbe Sachverhalt in zwei einander widersprechenden Versionen erzählt wird, kann nur eine stimmen. Die andere muss dann ein klarer Irrtum sein.“
Diese Schlussfolgerung ist schon deswegen falsch, weil möglicherweise sogar beide Versionen nicht den historischen Tatsachen entsprechen. Beide können in meinen Augen trotzdem wahr sein, wenn die jeweiligen Autoren ihr Vertrauen auf Jesus Christus mit ihren unterschiedlichen Mitteln so ausdrücken, dass es auch in den Angesprochenen wiederum Glauben zu wecken vermag.
Verdienstvollerweise legen Sie mit Ihrem Buch allerdings den Finger auf eine anscheinend immer noch offene Wunde, nämlich auf das Versäumnis, dass viele Pfarrer das, was sie selbst über die Bibel als Werk menschlicher Autoren wissen (in deren Wort das Wort Gottes gleichsam „verpackt“ ist), ihren Gemeindemitgliedern zu wenig zugemutet haben. Seit mehreren Jahrhunderten wird die Bibel historisch-kritisch erforscht, und immer noch gibt es einen Markt für Enthüllungsbücher wie Ihres, die interessierten Laien die Augen dafür öffnen wollen, dass die Bibel nicht nur historische und naturwissenschaftliche Fakten enthält.
Ihr Buch habe ich nun sozusagen als Sprungbrett benutzt, um Ihren kritischen Bemerkungen meine Interpretationen der neutestamentlichen Texte hinzuzufügen. Dabei korrigiere ich auch wieder Irrtümer, die Ihnen beim Aufspüren von Irrtümern unterlaufen sind; hauptsächlich geht es mir aber darum, den Sinn der einen oder anderen biblischen Geschichte herauszustellen – trotz der in ihr eventuell enthaltenen Irrtümer oder Widersprüche.
Ja, es stimmt, dass die von den Evangelisten überlieferten Erinnerungen an Jesus sich in vielen Punkten widersprechen. Ja, es ist für mich als evangelischem Pfarrer nichts Neues, dass wir vom historischen Jesus so gut wie nichts verlässlich wissen. Dennoch bleiben die Glaubenszeugnisse der Evangelisten gerade in ihrer Vielfalt wertvoll. Ich finde es spannend, herauszufinden, welche Ziele Matthäus mit seiner eigenwilligen Art, das Alte Testament zu zitieren, verfolgt, oder zu welchem Zweck Lukas von der Himmelfahrt zwei Mal ganz unterschiedlich erzählt. Warum es von wesentlichen Ereignissen, Taten und Lehren Jesu bis zu vier verschiedene Erzähl-Versionen gibt – das wird die wichtigste Leitfrage in meiner Besprechung Ihres Buches sein.
↑ Nicht nur Jesus durfte Gott „Vater“ nennen
Zum Stichwort (S. 17) A wie Abba prangern Sie mit Recht die Tendenz zahlreicher christlicher Theologen an, um jeden Preis Unterschiede zwischen Jesus und den Juden herauszustellen, und zwar sogar dort, wo tatsächlich keine bestehen.
Den Theologen Joachim Jeremias und Eduard Schweizer weisen Sie nach, dass diese zu Unrecht behaupten, „das typische Kennzeichen für die besondere Beziehung Jesu“ zu Gott sei „die Anrede ‚Abba‘.“
Denn erstens „gibt [es] im ganzen ‚Neuen Testament‘ nur eine einzige Stelle, die belegt, dass Jesus eben diesen Terminus verwendet hat“, nämlich Markus 14,36 (daneben verwendet nur Paulus denselben Ausdruck an zwei Stellen: Römer 8,15 und Galater 4,6).
Und zweitens belegen Sie (S. 18f.) mit Stellen in jüdischen Schrifttum vom Buch Jesus Sirach bis zum Talmud, dass Juden ganz selbstverständlich Gott als Vater anreden, und zwar unter anderem auch mit dem Wort „Abba“.
Hinter dem Versuch, Jesus eine innigere Vertrautheit mit Gott zuzusprechen, wie sie in dem Ausdruck „Abba“ ausgedrückt zu werden scheint und wie sie angeblich nur Jesus als dem „eingeborenen Sohn Gottes“ zukommt, steckt leider eine immer noch nicht ausgerottete antijudaistische Tendenz christlicher Theologie.
Ergänzend möchte ich Ihren Belegstellen für die Anrede Gottes als Vater im Judentum noch folgende hinzufügen:
Schon in der Tora heißt es im 5. Buch Mose 32,6:
Dankst du so dem HERRN, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist‘s nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat?
Auch die Bücher der Propheten enthalten das Bekenntnis zu Gott, dem Vater (Jesaja 64,7):
Aber nun, HERR, du bist doch unser Vater! Wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände Werk.
Ebenso wird Gott in Psalm 68,6 bezeichnet:
Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Und in Psalm 89,21.27-28 sagt Gott von König David:
Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. … Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils.
Schließlich betet auch Tobit im gleichnamigen apokryphen jüdischen Buch (13,4) zu Gott, dem Vater:
er ist unser Gott; er ist unser Vater und er ist Gott in alle Ewigkeit!
Durch Ihre Anregung, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, bin ich außerdem darauf aufmerksam geworden, dass im apokryphen Buch der „Weisheit Salomos“ sich Frevler über einen Gerechten lustig machen, der (2,16)
damit prahlt, dass Gott sein Vater sei.
Den wollen sie in niederträchtiger Weise auf die Probe stellen (Weisheit 2,17-20):
So lasst doch sehen, ob sein Wort wahr ist, und prüfen, was bei seinem Ende geschehen wird. Ist der Gerechte Gottes Sohn, so wird er ihm helfen und ihn erretten aus der Hand der Widersacher. Durch Schmach und Qual wollen wir ihn auf die Probe stellen, damit wir sehen, wie es mit seiner Sanftmut steht, und prüfen, wie geduldig er ist. Wir wollen ihn zu schändlichem Tod verurteilen, denn er selbst sagt ja, es werde ihm Rettung zuteil.
Auf genau diese Stelle spielt Matthäus 27,43 in der Passionsgeschichte Jesu an; der Evangelist benutzt sie offenbar, um die schändliche Art und Weise, mit der Jesus gedemütigt und ums Lebens gebracht worden ist, vom Alten Testament her zu deuten. Er entspricht dem Bild eines jüdischen Gerechten, der Gott als seinen Vater anruft und den man spöttisch als „Gottes Sohn“ lächerlich zu machen versucht.
↑ Jesus feierte kein christliches Abendmahl
Auch zu (S. 19) A wie Abendmahl kann ich Ihnen nur zustimmen: Das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, sah sicherlich nicht so aus, wie wir Christen das heutzutage in unseren Kirchen feiern. Sie schreiben mit Recht über die Darstellungen des Abendmahls in den Evangelien (S. 22):
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Beschreibung von Jesu letztem Abendmahl unhistorisch.
Sie ist kein Beleg für reales Handeln Jesu. Sie ist die von der jungen Christengemeinschaft Jesus in den Mund gelegte Autorisierung des die christlichen Gemeinschaften einigenden Abendmahls, das es aber zur Zeit Jesu so nicht gegeben hat. Was auch immer Jesus mit seinen Jüngern gefeiert haben mag: Ein christliches Abendmahl war es nicht.“
Selbstverständlich feierte Jesus als Jude, der er war, das Passah nach normalem jüdischen Ritus. Daher halte ich es gar nicht wie Sie (S. 21) für „seltsam“, dass auf „typische Riten nicht eingegangen wird“. Wozu hätten die Evangelisten im Einzelnen schildern sollen, was sie zumindest bei den meisten ihrer Leser „als selbstverständlich bekannt“ voraussetzen konnten? Immerhin weisen sie mit ihrer tatsächlich nicht belanglosen Bemerkung, der Raum sei (Markus 14,15 / Lukas 22,12) „mit Polstern versehen“, indirekt auf die Vorschrift hin (S. 20), dass „das jüdische Passahmahl ‚bequem und angelehnt‘ zelebriert werden“ musste.
Ob man (S. 19f.) von Irrtümern der Übersetzer sprechen kann, wenn diese nicht deutlich werden lassen, dass Jesus den Raum für das Passahmahl und seine Lage im Obergeschoss vorher schon kannte bzw. ihn bereits mehrfach genutzt hatte oder sogar sein Besitzer war – das bezweifle ich doch stark. Wenn Jesus seine Jünger fragen lässt (Markus 14,14): „Wo ist die Herberge für mich“ (Lutherübersetzung) oder „Wo ist mein Gastzimmer“, dann wird doch vorausgesetzt, dass er den Raum eben noch nicht kennt. Vor allem ist auf der Erzählebene der Evangelisten klar, dass Jesus keinerlei Immobilien besitzt, sondern darauf angewiesen ist, dass Männer oder Frauen, die ihn unterstützen wollen, ihm Obdach gewähren und eben hier einen Versammlungsraum zur Verfügung stellen.
Wichtiger ist, dass Markus vermutlich eine alttestamentliche Stelle in 1. Samuel 10,1-8 in Erinnerung rufen will, wo der Prophet Samuel dem zum König gesalbten Saul verschiedene Begegnungen mit zwei oder mehr Männern voraussagt, die seine gottgewollte Berufung bestätigen. Insofern wäre es geradezu eine Banalisierung der Geschichte, wenn man das Vorauswissen Jesu, dass sich der gewünschte Saal im Obergeschoss befindet, auf eine simple vorherige Kenntnis zurückführte.
Offen bleiben muss, ob im Zusammenhang mit diesem Passahfest bereits Jesus selbst oder erst nachträglich diejenigen, die auf ihn als Messias vertrauen, den Vergleich von Brot und Kelch mit dem Leib und Blut Jesu vorgenommen haben. Wir Christen tun jedenfalls gut daran, unser christliches Abendmahl nicht als etwas völlig Neues und Eigenständiges zu begreifen, sondern als ein Fest, das nur verstanden werden kann, wenn es an die Befreiung aus Sklaverei und an die Einübung einer Disziplin der Freiheit im jüdischen Passahfest erinnert. Indem die Evangelisten Jesu Schicksal in das Passahgeschehen sozusagen hineinschreiben, machen sie deutlich, dass Befreiung unter den Bedingungen der globalen römischen Herrschaft nicht durch gewaltsamen Aufstand, sondern nur durch das Tun des Willens Gottes bis hin zum sich selbst opfernden Leiden erreicht werden kann.
Jedenfalls haben Sie vermutlich Recht damit, dass die so genannten Einsetzungsworte des Abendmahls (von „Einführungsworten“, wie Sie sie auf S. 21 nennen, redet zumindest in der evangelischen Kirche niemand) nicht wortwörtlich auf Jesus zurückgehen.
Allerdings sind die Evangelisten Markus und Matthäus, denen zufolge Jesus vom „Blut des Bundes“ spricht (Markus 14,24 und Matthäus 26,28), in dieser Ausdruckweise trotzdem jüdischer, als Sie denken, erinnern sie doch an das „Blut des Bundes“, mit dem Mose in 2. Mose 24,8 das Volk Israel besprengt hat. Von dieser Stelle im Alten Testament her ist also auch die Blutsymbolik im christlichen Abendmahl zu deuten. In meinen Gottesdiensten Abendessen mit Gott und Wird Gott unser Blutsbruder? habe ich versucht, das zu tun.
Auf weitere Fragen zum Abendmahl bin ich in meinen Bemerkungen zu Ihrem anderen Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer“ unter dem Stichwort Abendmahl – Widersprüche und eine mögliche ErklärungVom Passafest zum Abendmahl eingegangen.
↑ Irrte sich Jesus über den Zeitpunkt der Apokalypse?
Zum Thema (S. 22) A wie Apokalypse schreiben Sie richtig, dass das Wort ursprünglich nicht „Weltuntergang“, sondern „Offenbarung“ bedeutet. Dann verallgemeinern Sie allerdings wieder sehr, wenn Sie die Apokalypse „nach christlicher Überzeugung“ mit dem „Ende der Zeit“ gleichsetzen, das mit der „Aburteilung“ der Sünder einhergeht, während fromme Menschen „optimistisch einem milden Urteil“ entgegen sehen dürfen. So formuliert, erzeugt apokalyptische Vorausschau tatsächlich Angst – und Freude nur bei denen, die sich als die Frommen und Guten zu fühlen berechtigt sehen.
Allerdings hatte ursprünglich das apokalyptische Denken tatsächlich einen anderen Kontext, nämlich die politische Ohnmacht derer, die Freiheit und Gerechtigkeit in einem von der Tora geregelten jüdischen Gemeinwesen erträumt hatten und dieses nun vom Himmel her erhofften. Selbst konnte man nichts tun, um Befreiung zu erreichen, nur Gott selber hatte die Macht, um sie mit einem Schlage herbeizuführen. Apokalyptiker enthüllten also die Wahrheit über die für in Elend und Unterdrückung lebende Menschen positive Zukunft, die nur für die gottfeindlichen Mächte einen furchtbaren Weltuntergang bedeutete.
Auch von Jesus werden apokalyptische Worte überliefert, so zum Beispiel in Markus 13, und er scheint davon überzeugt zu sein, dass die von ihm angekündigten Ereignisse schon in naher Zukunft geschehen werden (Markus 13,30):
Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.
Daraus folgt Ihrer Meinung nach (S. 24):
„Jesus sah das apokalyptische Ende nicht in ferner Zukunft hereinbrechen. Seiner Ansicht nach stand es unmittelbar bevor.“
Gegen eine derartige Einschätzung wendet sich Ihnen zufolge etwa
„Timothy Weber, ein fundamentalistischer US-Theologe… Er bietet gleich zwei Interpretationen des Wortes ‚Geschlecht‘ an, die jeden Gedanken an einen möglichen Irrtum vertreiben sollen (2):
Entweder der Schreiber des Evangeliums nach Markus meinte das ‚jüdische Geschlecht‘ oder ‚das menschliche Geschlecht‘. Demnach will Jesus entweder sagen, dass dann, wenn die Endzeit anbrechen wird, entweder das jüdische (Version A) oder das menschliche Geschlecht (Version B) noch existieren werden. Sollte eine dieser beiden Deutungen zutreffen, dann wäre das Jesus-Wort gerettet.“
Ihre Kritik an solchen Versuchen, einen Irrtum Jesu über den Zeitpunkt der Apokalypse auszuschließen, kann ich nur unterstreichen. Zwar kann das griechische Wort genea (wörtlich = „Geburt“) tatsächlich beides bedeuten: „Generation“ (die Menschen, die zu einer bestimmten Zeit leben) oder als auch „Geschlecht“ (also die Nachkommenschaft etwa Adams oder Abrahams im Sinne von „Menschheit“ oder „Israel“); aber welchen Sinn sollte es machen, wenn Jesus die Menschen seiner Zeit mit dem Hinweis darauf trösten wollte, dass spätestens mit dem Untergang des Volkes Israel oder der ganzen Menschheit in einer fernen Zukunft der Menschensohn kommen werde? Der Tonfall des Satzes legt ja gerade nahe, dass es nicht mehr so lange dauern wird.
Allerdings ist zu bedenken, dass der Evangelist Markus unmittelbar nach dem eben zitierten Wort Jesu ein anderes ergänzt, das jede Berechnung über die Zeit der Apokalypse ausschließt (Markus 13,32-33):
Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Damit räumt Jesus nach Markus nicht nur ein, dass auch er als Mensch sich über den Zeitpunkt des Anbrechens der Herrschaft Gottes irren kann. Auch die Spekulationen Timothy Webers stehen diesen Versen zufolge im Widerspruch zu seiner eigenen Frömmigkeit, denn er tut ja letztlich nichts anderes, als Berechnungen über die Zeit der Apokalypse anzustellen.
Herausfordernd sind für mich Ihre abschließenden Fragen zu diesem Kapitel (S. 25):
„Bleibt eine Frage: War der historische Jesus vom unmittelbar bevorstehenden Ende der Welt überzeugt? Sind die Worte über die Apokalypse echt? Hat Jesus wirklich gesagt, was ihm unterstellt wird? Oder wurden die teilweise schrecklichen Zukunftsbilder von den ersten Missionaren der sehr frühen, jungen christlichen Kirche als Argument für einen Beitritt zur Gemeinschaft erfunden? Wollte man Anhänger mit ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ werben nach dem Motto: ‚Schließe dich unserer Gemeinschaft an, dann stehst du auf der richtigen Seite, wenn die Apokalypse Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet.‘“
Wie ich bereits sagte, können wir nicht sagen, ob der historische Jesus tatsächlich vom baldigen Ende der Welt überzeugt war – genauer gesagt: Ob er glaubte, dass die Unrechtsherrschaft des Römischen Weltreichs schon innerhalb einer Generation durch die Friedensherrschaft des Menschensohns abgelöst werden würde.
Vermutlich kannte der Evangelist Markus aber Worte, die die junge Christenheit auf Jesus zurückführten und die vom baldigen Kommen des Menschensohnes handelten. Da er diesen Worten aber das andere Jesuswort vom geheimen Zeitpunkt der Wiederkunft zur Seite stellte, scheint er (der sein Evangelium unter dem Eindruck des Jüdischen Krieges schrieb, der zur Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. führte) recht realistisch die Hoffnung auf ein sehr rasches Wiederkommen Jesu nicht mehr unbedingt zu teilen.
Keineswegs darf man aber bereits Markus eine Angstmacherei im Dienste der Nötigung zum christlichen Glauben vorwerfen, wie sie später im Christentum immer wieder einmal um sich gegriffen hat und die entschieden abzulehnen ist.
Im Blick auf solche Versuche, die Bibel wortwörtlich zu nehmen und zugleich im Sinne ideologischer Propaganda umzuinterpretieren, schreiben Sie mit Recht (S. 25):
„Man tut Jesus keinen Gefallen, wenn man seine apokalyptischen Visionen durch falsche Übersetzungen zu retten versucht.“
Trotzdem behalten die apokalyptischen Bilder der Bibel ihren Sinn, wenn man sie einerseits als mahnenden Hinweis auf verhängnisvolle von Menschen herbeigeführte Katastrophen versteht und andererseits selbst in Katastrophen den barmherzigen Gott insofern am Werk sieht, dass er diejenigen nicht allein lässt, die nicht aufhören, menschlich zu denken, zu fühlen und zu handeln.
↑ Die „Armen im Geist“ – ganz und gar durch Armut gezeichnet!
Zum (S. 25) Stichwort A wie arm fragen Sie sich, auf welche Art von Armut Jesus sich in seiner ersten Seligpreisung bezieht. Ist es materielle Armut, also Mangel an Geld und Besitztümern? Oder meint Jesus geistige Armut im Sinne von Dummheit? Oder werden, „wie häufig übersetzt wird, die geistlich Armen … mit dem ‚Himmelreich‘ belohnt?“ Sie wollen dieses Problem durch einen „Blick in die erhaltene ursprünglichere Fassung, also die in Aramäisch, der Sprache Jesu“ lösen und behaupten (S. 25f.),
„Jesus hat das Wort ‚rokha‘ benutzt: ‚Selig sind die, die arm an Hochmut sind, ihnen gehört das Himmelreich.‘ Es sind also weder die Dummen noch die geistlich (theologisch?) Armen, die in den Himmel kommen, sondern die Bescheidenen, die Demütigen! Der wirkliche Sinn des Jesus-Wortes geht also durch eine falsche Übertragung, vom ursprünglichen Aramäischen ins Griechische und dann ins Deutsche, verloren.“ (3)
Allerdings verkennen Sie dabei (wie bereits an mehreren Stellen in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ (4), dass uns ein aramäischer oder hebräischer Urtext des Markusevangeliums gar nicht vorliegt, so dass lediglich Rückschlüsse aus den späteren aramäischen Rückübersetzungen der Bibel aus dem Griechischen gezogen werden können.
Gegen Ihre eigene Auslegung wenden Sie übrigens richtig ein (S. 26), dass in Lukas 6,20 dann doch einfach nur „die Armen“ selig gepriesen werden, und lassen offen, wer „nun in den Himmel“ kommt: „die Demütigen und Bescheidenen“ wie bei Matthäus oder „die Armen, im Gegensatz zu den Reichen“, wie bei Lukas.
Wieder wissen wir tatsächlich nicht, ob und in welchem Sinn der historische Jesus diesen Satz ausgesprochen hat. Sicher ist nur, dass er nicht wie die späteren Christen daran gedacht hat, dass die von ihm selig Gepriesenen in dem Sinne „in den Himmel kommen“, dass sie nach ihrem Tode ein besseres Leben im Jenseits erhalten. Das Himmelreich, besser übersetzt: das Königtum Gottes, ist für Jesus und seine Zeitgenossen ein Leben auf dieser Erde unter der befreienden und gerechten Herrschaft Gottes. Im Abschnitt zu A wie Apokalypse haben Sie ja selbst darauf hingewiesen, dass Jesus vermutlich den Anbruch dieser Herrschaft schon in naher Zukunft erwartet hat.
Was meint aber nun Jesus nach den Evangelisten Lukas bzw. Matthäus mit der Seligpreisung der Armen?
Indem Lukas die Worte tō pneumati (= „des Geistes“, „im Geist“) weglässt, betont er die politische Dimension des Königtums Gottes, die den materiell Armen zukommen lässt, was sie brauchen.
Sinn macht aber auch die Version des Matthäus mit den „geistlich Armen“, indem Jesus die Glückseligkeit gerade den Menschen zusagt, die mit dem Glauben Schwierigkeiten haben, weil Glaube immer ein geschenkter Glaube ist. Die aramäische Version „arm an Hochmut“ könnte man als freie Übertragung dieser Version begreifen.
Lediglich die Übersetzung mit „geistig arm“ im Sinne von Dummheit ist schlicht falsch, da es beim griechischen Wort pneuma nicht um die geistigen Fähigkeiten des Menschen geht, sondern um das Bedeutungsfeld „Wind, Atem, Seele, Spiritualität, göttlicher Geist“.
Ton Veerkamp (5) umschreibt in seiner Übersetzung des Matthäusevangeliums hoi ptōchoi tō pneumati mit den Worten „die, die ganz und gar durch Armut gezeichnet sind“, und weist darauf hin, dass das Wort ptōchos in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel für die Worte ˁANI = „gebeugt“ oder DaL = „verarmt, landlos“ verwendet wird: (6)
„Jes 57,15 sagt, daß der Gott Israels, der Erhabene und Heilige, bei den Zertretenen und bei den Geisterniedrigten wohnt …, also bei Menschen, die in ihrer Totalität erniedrigt, ganz und gar durch Erniedrigung (bzw. durch Armut) gezeichnet sind.“
Wenn wir uns vor Augen führen, dass Matthäus in seinem Evangelium sehr häufig Worte aus der jüdischen Bibel ins Gedächtnis ruft, kann auf diese Weise am besten erklärt werden, warum er anders als Lukas von den „im Geist“ Armen spricht – nämlich gerade nicht, um den politisch/sozialen Hintergrund des Jesuswortes abzuschwächen, sondern ihn (für diejenigen, die zwischen den Zeilen zu lesen verstehen) noch deutlicher zu betonen.
↑ Astrologische Berater bringen Jesus königlichen Tribut
Zu (S. 26) A wie Astrologie weisen Sie wie bereits in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ (7) darauf hin, dass die Angaben des Evangelisten Matthäus (2,2) über die aus dem Osten kommenden Magier einen „offensichtlichen Fehler“ enthalten. Da „für die Astrologen im persischen Raum … das Heilige Land im Westen“ lag, können sie „einen Stern über dem ‚Heiligen Land‘ … nur im Westen, nicht aber im Osten gesehen haben.“
Die nahe liegende Erklärung (S. 27), dass die Astrologen sich darauf beziehen, dass sie selbst sich „zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung“ im Osten aufgehalten haben, tun Sie als „fadenscheinig“ ab, da man bei „der Beschreibung eines Sterns … nicht den Platz des Beobachters, sondern den Platz des Sterns am Himmel“ nennt. Aber da Matthäus selbst kein Astrologe ist und auch keine genaueren Angaben über den Platz des Sterns am Himmel macht, außer dass er irgendwann (Matthäus 2,9) „über dem Ort stand, wo das Kindlein war“, ist diese Argumentation nicht unbedingt stichhaltig.
Dann aber besinnen Sie sich neu und kommen bei einem Blick in den griechischen Text darauf, dass nicht Matthäus sich geirrt hat, sondern seine Übersetzer. Denn der Ausdruck en anatolē (nicht „en anatola“, wie Sie schreiben) sei „ein Fachausdruck aus der Astrologie“ und bedeute „korrekt übersetzt“:
„‚Wir haben einen Stern im (heliakischen) Aufgang gesehen.‘ Das bedeutet: Die Beobachtung erfolgte kurz vor Sonnenaufgang. Dieses unscheinbare Detail, das einem Irrtum des Übersetzers zum Opfer fiel, belegt: Es geht bei dem Bibelvers tatsächlich um Astrologisches.“
Inzwischen scheint sich die neue Lutherbibel von 2017 mit ihrer Übersetzung „Wir haben seinen Stern aufgehen sehen“ in einer ähnlichen Richtung bewegt zu haben wie Sie.
Dann wiederholen Sie Ihre Behauptung aus dem „Lexikon der biblischen Irrtümer“:
„Einzelne Sterne sind allerdings für Astrologen völlig uninteressant. Wenn ein Geschehnis am Himmel persische ‚magoi‘ ins ‚Heilige Land‘ lockte, dann kann es sich nur um eine Planetenkonstellation gehandelt haben.“
Der Nicht-Astrologe Matthäus hat sich offensichtlich nicht dafür interessiert, ob der „Stern“ der Magier nun ein einzelner Stern, ein Komet oder eine Planetenkonjunktion gewesen sein mochte; an anderer Stelle habe ich schon darauf hingewiesen, dass es auch einen Gelehrten gibt, der den Stern von Bethlehem als eine Supernova identifiziert und mit ihrer Hilfe die Geburt Jesu genau zu datieren beansprucht (8). Wahrscheinlicher ist aber, dass Matthäus lediglich ihm bekannte Erzählungen von Himmelserscheinungen aufgreift, um mit ihrer Hilfe die Geburt des Messias Jesus von Anfang an in einen weltweiten Zusammenhang einzubetten.
Dass (S. 28) viele Bibelübersetzungen in Matthäus 2,2 die Magier nach dem „neugeborenen“ König der Juden fragen lassen, stilisieren Sie insofern zu einem Irrtum hoch, als Jesus zum Zeitpunkt der Ankunft der Magier nach Matthäus 2,9.11 durchaus schon ein paidion, also ein Kleinkind, ist, während er in Lukas 2,12 als brephos = Säugling bezeichnet wird (9). Das finde ich reichlich spitzfindig, zumal ja auf der Erzählebene des Matthäusevangeliums die Reise der Magier einige Zeit in Anspruch genommen haben muss und Herodes alle unter zweijährigen Knaben töten lässt. Den genauen Zeitpunkt der Geburt kann man daher aus den Angaben des Matthäus ohnehin auf keine Weise herauslesen.
Richtig ist, dass bei Matthäus einfach ho techtheis basileus steht, aber im Deutschen kann man das nicht gut einfach mit „der geborene König“ übersetzen. Die Elberfelder Bibel von 2006 löst das Problem mit der Umschreibung: „Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist?“ Aber auch, wenn „neugeborener König“ übersetzt wird, kann jeder Leser aus dem Zusammenhang schließen, dass das Kind nicht gerade erst ein paar Tage alt ist.
Schließlich fragen Sie sich (S. 29), warum die Magier des Matthäusevangeliums in der späteren „Überlieferung zu drei ‚Königen‘“ wurden:
„Geschah dies bewusst, um die anrüchige Astrologie aus der ‚Heiligen Schrift‘ zu tilgen? Oder wollte man die Bedeutung Jesu schon als Kind besonders unterstreichen? Stilisierte man Jesus zum bedeutsamen Messias hoch, der schon bald nach der Geburt von Königen angebetet wurde?“
Die in Ihren Fragen enthaltene abwertende Tendenz lässt sich weder klar bestätigen noch widerlegen. Es mag sein, dass man in der späteren Kirche lieber von Königen als von Magiern oder Astrologen sprach, da Zauberei und Astrologie ja bereits im Alten Testament als Widerspruch zum Glauben an den Einen Gott verurteilt wurde.
Es mag aber auch sein, dass bereits Matthäus in seiner Erzählung von den wahrhaft königlichen Geschenken (2,11) an die Worte aus Psalm 72,10-12 denkt, wo es heißt:
Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.
Ob man in diesem Zusammenhang von einer Hochstilisierung Jesu zum Messias reden sollte? Sicherlich verstand Matthäus Jesus als Messias. Ton Veerkamp spricht in seiner Übersetzung des Matthäusevangeliums (10) sogar davon, dass „astrologische Berater … der Könige in Mesopotamien … dem messianischen König den Tribut [bringen], auf den er Anspruch hatte“. So pointiert versteht Matthäus vermutlich wirklich die dōra der Magier und nicht einfach als „Geburtstagsgeschenke“. Aber es handelt sich um einen König, der für die Armen und Elenden Partei ergreift, und Matthäus weiß natürlich schon am Beginn seines Evangeliums, dass ein König, der mit einem solchen Ziel im Römischen Weltreich geboren wird, keine Chance hat, buchstäblich von den real existierenden Königreichen Tribut einzufordern. Ihm geht es um einen Messias, der leiden und sterben wird, indem er für das Königtum Gottes – also für die Herrschaft seiner Tora der Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen – eintritt.
↑ Faszinierende Vielfalt von Bildern der Himmelfahrt Jesu
Unter dem Stichwort (S. 29) A wie Auferstehung beschäftigen Sie sich ausführlich mit der Frage, wann und wo genau nach Jesu Auferstehung seine Himmelfahrt stattfand. Denn darüber gibt es nicht nur bei den verschiedenen Evangelisten unterschiedliche Angaben, sondern sogar bei ein und demselben Autoren Lukas gleich zwei sehr verschiedene Erzähl-Versionen. Offenbar finden die biblischen Autoren die von Ihnen kritisierten Zeit- und Ortsangaben ausgesprochen unwichtig; sie interessieren sich nur für die Frage, was denn die Himmelfahrt für den Glauben bedeutet.
Wieder einmal reiten Sie also auf der Ebene der historischen Tatsachen auf offensichtlichen Widersprüchen herum und stellen schließlich fest (S. 31):
„Die Zeugenaussagen sind nach heutigem Verständnis alles andere als verlässlich. Einig sind sie sich nur darüber, dass Jesus im Himmel entschwand, nicht aber darin, wann und wo das geschah.“
Genau so ist es – wenn man missversteht, um welche Art von „Zeugenschaft“ es hier geht. Die Evangelisten sind Glaubenszeugen, nicht Augenzeugen für ein Gerichtsverfahren oder eine historische Reportage. Selbst das einzige, worin sich die Evangelisten Ihrer Ansicht nach einig sind, bleibt auf der Ebene der Tatsachen letztlich unerklärbar: Wo ist denn dieser Himmel, in dem Jesus entschwand? Der Weltraum? Das Jenseits? Es ist bildhafte Redeweise, die hier für Glaubenswahrheiten verwendet wird.
Im Gegensatz zu Ihnen bin ich fasziniert von der Vielfalt an Perspektiven, unter denen die Evangelisten so unterschiedlich davon erzählen, dass das demütigende Ende Jesu am Kreuz in ihren Augen – Augen, die ihnen im Vertrauen auf den Gott Israels und seinen Messias Jesus geöffnet wurden – dann eben doch kein Scheitern war. Der erste, der unter dem Eindruck der verheerenden Zerstörung Jerusalems um das Jahr 70. n. Chr. eine Erzählung von Kreuz und Auferstehung Jesu schrieb, war Markus. Er weiß noch nichts von Himmelfahrt, schickt seine Leser zurück nach Galiläa, um die verstörenden Erfahrungen des Jüdischen Krieges im Nachsinnen über die Worte und Taten des Messias zu verarbeiten und aus ihnen (wenn überhaupt!) neue Hoffnung zu gewinnen.
Lukas kennt das abrupte Ende des Markusevangeliums in Markus 16,1-8. Es erscheint ihm wohl unbefriedigend. Ob ihm weitere Erzählungen von Wegbegleitern Jesu als „Augenzeugenberichte“ zur Verfügung stehen, ist nicht zu klären. Was er ergänzend erzählt, hat einen jeweils unterschiedlich akzentuierten Sinn.
In Lukas 24 geht es um die Deutung von Tod und Auferstehung Jesu aus den Heiligen Schriften und um das Bleiben der zurückbleibenden Jünger in Jerusalem, wo sie für die Sendung zu den Völkern Kraft aus der Höhe empfangen sollen.
In der Apostelgeschichte greift Lukas alle diese Gesichtspunkte auf, fügt aber weitere Einzelheiten hinzu:
- 40 Tage Wartezeit (vielleicht als Erinnerung an die 40jährige Wüstenwanderung Israels),
- die Gleichsetzung der Kraft aus der Höhe mit dem Heiligen Geist in Überbietung der Johannestaufe,
- die Einschränkung des Wissens über Zeit und Stunde des Kommens des Reiches Gottes (die bei den anderen Synoptikern – Markus 13,32 und Matthäus 24,36 – schon im Zusammenhang der apokalyptischen Rede Jesu erwähnt wird),
- die Nennung des Ortes (Obergemach), wo sich die Jünger wartend und betend aufhalten,
- die Nachwahl des Matthias für den Verräter Judas, durch die die volle Zwölfzahl der Apostel, die an die zwölf Stämme Israels erinnert, wiederhergestellt wird.
Es würde zu weit führen, hier alles aufzuzählen, worauf Lukas damit anspielt und woran er erinnert. Wie die anderen neutestamentlichen Autoren bettet er von seinem Glauben an den Messias Jesus her alles, was er von Glaubenszeugen über Jesus und seine Nachfolger erfahren hat, in die überlieferte Glaubenswelt der jüdischen Bibel ein.
↑ Der Auferstehungsglaube ist nur in Bildern auszudrücken
Am Ende des Abschnitt über A wie Auferstehung kommen Sie dann doch noch (S. 32) auf die Auferstehung selbst zu sprechen und zitieren zwei Theologen, die völlig entgegengesetzte Auffassungen darüber vertreten, ob die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis war.
Ob es überhaupt stimmt, dass Heinz Zahrnt die Auferstehung als historisch nachweisbares Faktum versteht, lasse ich einmal dahingestellt sein; für die Art, wie er an die Auferstehung glaubt und was sie für ihn bedeutet, scheinen Sie sich ohnehin nicht zu interessieren.
Gerd Lüdemann auf der anderen Seite gefällt sich gerne darin, mit Hilfe der historischen Bibelkritik sämtliche christlichen Dogmen ins Lächerliche zu ziehen; er hat sich längst vom christlichen Glauben verabschiedet (11).
Dabei kann ich ihm von der Faktenlage her durchaus insofern zustimmen, dass es keine Auferstehung „im wörtlichen Sinne“ gegeben hat, sondern „der Leichnam Jesu … jedenfalls nicht entwichen, sondern verwest“ ist.
Aber seine Schlussfolgerung (S. 33), dass Jesu Auferstehung demzufolge „nur ein frommer Wunsch war“, teile ich dennoch nicht, weil das Vertrauen auf den Auferstandenen in den ersten Christen auf eine Art und Weise gewachsen ist, die mit den Mitteln von Beweis oder Falsifikation nicht zu erfassen ist. Tatsache ist, dass sich ihr Glaube an die Auferstehung ihres Herrn und Messias Jesus als so mächtig und tragfähig erwiesen hat, dass sie eine beeindruckende Solidaritätsgemeinschaft aufbauen und harte Verfolgungen durchstehen konnten. Natürlich ist das nur für den Glaubenden ein Erweis der Wahrheit des Glaubens; beweisen kann man in Sachen religiöser Wahrheit nichts.
Für mich steht jedenfalls fest, dass man von allen Wahrheiten des Glaubens nur in Bildern bzw. in der Form des Mythos reden kann; das ist ein weiterer Grund für die Vielfalt der Ausdrucksweisen über alle entscheidenden Stationen im Leben, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu.
Abschließend fragen Sie zum
„Themenkomplex ‚Auferstehung und Irrtum‘ …[:] Wo irrt die Bibel? Sie bietet Widersprüche. Wenn die eine Aussage richtig ist, muss die dazu widersprüchliche irrig sein. Wo irren die Theologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, der Wahrheit der ‚Heiligen Schrift‘ auf den Grund zu gehen? Wo beginnt ‚Wissen‘ und wo endet ‚Glaube‘?“
Damit unterstellen Sie wieder, dass es hier um „richtig-falsch“-Widersprüche auf der Ebene historischer Geschehnisse gehe. Aber auf dieser Ebene kann die Frage nach der Wahrheit nur zu absurden Antworten führen. Im Grunde muss die Frage eher umgekehrt gestellt werden: „Wo endet Wissen und wo beginnt Glaube?“, bzw. genauer: Wo bleibt unser historisches Wissen notwendigerweise begrenzt? und: Woraus, was viel wichtiger ist, gewinnt unser Glaube seinen Sinn und seine Kraft?
↑ Jesus forderte nicht wirklich, sich ein Auge auszureißen
Was Sie (S. 33ff.) unter dem Stichwort A wie Auge ausreißen zu bildlich gemeinten Ausdrucksweisen Jesu ausführen, kann ich zur Lektüre nur empfehlen. Ihrem Fazit ist zuzustimmen (S. 35):
„Jesus forderte also nicht dazu auf, sich ‚böse Augen‘ auszureißen, sondern negative Verhaltensweisen aufzugeben.“
↑ War Jesus hässlich? Niemand weiß, wie er aussah!
Zum (S. 35) Stichwort A wie Aussehen fragen Sie sich ausführlich, wie Jesus wohl ausgesehen haben mag, obwohl Sie wissen, dass das Neue Testament „so gut wie keine Aussagen über das Aussehen Jesu“ enthält. Nur im Johannesevangelium (8,57) finden Sie
„eine vage Altersangabe: ‚Du bist noch keine 50 Jahre alt …‘, sagen einige Juden im Gespräch mit Jesus.“
An anderer Stelle meinen Sie über das Neue Testament (S. 37):
„Wir erfahren nur, dass ihn jüdische Kritiker einmal für einen Mann in den Dreißigern hielten.“
Damit irren Sie allerdings; eine solche Altersangabe stammt nicht von jüdischen Kritikern, sondern vom Evangelisten Lukas (3,23):
Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt…
Spekulationen darüber, ob Jesus hässlich war, müssen schon daran scheitern, dass jedes Urteil über Schönheit oder Hässlichkeit im Auge des Betrachters liegt. Im Neuen Testament wird nur zwei Mal ein Mensch als „schön“ beschrieben, und auch das nur in zwei Zitaten aus 2. Mose 2,2, wo der neugeborene Mose als „schön“ bezeichnet wird (Apostelgeschichte 7,20 und Hebräer 11,23). Im Alten Testament werden vor allem Frauen „schön“ genannt, aber auch (1. Mose 39,6 / 1. Samuel 9,2 / 16,12.18 / 17,42 / 2. Samuel 14,25) die Männer Josef, Saul, David und Absalom. Als Leitmotiv zum Umgang mit Schönheit und Hässlichkeit mag ein Wort aus Sirach 11,2 gedient haben:
Du sollst niemand rühmen um seiner Schönheit willen noch jemand verachten, weil er hässlich aussieht.
Warum der Kirchenlehrer Tertullian Jesu Hässlichkeit erwogen haben mag, beantworten Sie selbst völlig korrekt (S. 37): Er bezieht nämlich die Prophezeiung in Jesaja 52,14 auf Jesus, in der davon die Rede ist, dass die Gestalt des so genannten Gottesknechts „hässlicher war als die anderer Leute“. Das mag insofern Sinn machen, als der Gottesknecht bei Jesaja nicht von Natur aus hässlich ist, sondern durch Leiden oder Folter entstellt wurde; und genau eine solche Entstellung seiner natürlichen Unversehrtheit kann man auch bei Jesus annehmen, der an seinem Todestag mit Geißeln, Dornenkrone und Kreuz grausam gefoltert wurde. In diesem Zusammenhang schreiben Sie mit Recht über Tertullian:
„Wie hässlich auch Jesus gewesen sein mag, er wird immer sein Christus bleiben. … Er glaubt an den rettenden Messias, wie hässlich er auch körperlich gewesen sein mag.“
Das ist insofern richtig, als Rettung und Hilfe hängen nicht von äußerer Schönheit abhängen. Allerdings erfahren wir auch durch Tertullian rein gar nichts über das tatsächliche Aussehen von Jesus – und ebenso wenig aus allen späteren Bildern, die man sich von Jesus gemacht hat.
Auch eine abschließende Frage beantworten Sie genau in meinem Sinne (S. 40):
„Warum aber schweigen die Evangelien über Jesu Aussehen? Vermutlich weil es ihnen nicht wichtig war. Der Mensch Jesus in seinem äußeren Erscheinungsbild interessierte nicht. Von Bedeutung war nur Jesu Botschaft. Sie sollte im Zentrum stehen. Nichts sollte von ihr ablenken.“
↑ Bergpredigt oder Feldrede: Jesu Lehre in der Autorität des Mose
Zum (S. 40) Stichwort B wie Bergpredigt stellen Sie die Frage: „Wo fand die so genannte Bergpredigt statt?“ Nach Matthäus natürlich auf einem Berg – aber (S. 41) bei Lukas findet sie „im ebenen Flachland“ statt. Und wieder meinen Sie:
„Einer der beiden Evangelisten muss sich irren. Wer mag es sein? Das lässt sich nicht mehr feststellen!“
In diesem kurzen Abschnitt irren aber wieder einmal Sie in mehrfacher Hinsicht.
Zunächst einmal hat Jesus weder die so genannte „Bergpredigt“ in Matthäus 6-7 noch die so genannte „Feldrede“ in Lukas 6,17-49 in genau dieser Form gehalten. Beide Reden sind vielmehr Zusammenstellungen einzelner Worte Jesu, die zuvor getrennt voneinander – mündlich oder schriftlich – überliefert worden waren. Insofern baut die Fassung des Lukas auch nicht unbedingt als eine „komprimierte Fassung, so wie es heute gekürzte Versionen von dickleibigen Romanen bei ‚Reader‘s Digest‘ gibt“, auf Matthäus auf, sondern Lukas mag schlicht und einfach weniger aus der beiden vorliegenden Überlieferung ausgewählt haben.
Es gibt also gar keine zwei Bergpredigten. Die Frage ist allerdings, warum die beiden Evangelisten ihre jeweils unterschiedlich zusammengestellte Jesusrede an verschiedenen Orten stattfinden lassen. Zur Absicht des Matthäus haben Sie folgende Idee:
„Bei Matthäus sah sich Jesus anscheinend von den zahlreichen Anhängern, die seinen Worten lauschen wollten, zu sehr bedrängt. Er zog sich auf die Anhöhe eines Berges zurück, um von dort zu den Menschen zu sprechen.“
Im Matthäusevangelium spielt allerdings die Bedrängung Jesu durch eine Menschenmenge nirgends eine Rolle, weder an dieser noch an anderen Stellen, während umgekehrt gerade bei Lukas (5,1; 8,42.45; 11,29) oder auch bei Markus (3,9; 5,24.31) mehrfach davon die Rede ist. Nach Lukas 5,1-3 lehrt Jesus die Menge daher einmal von einem Boot aus.
Dass sich Jesus nach Matthäus auf einem Berg hinsetzt und lehrt, hat einen anderen Grund. Immer wieder bezieht gerade dieser Evangelist ja alles, was mit Jesus geschieht und was er sagt und tut, auf die jüdische Bibel zurück. Er will ausdrücken: In der gleichen Weise, wie Mose auf dem Berg Sinai die Gebote Gottes bekam, die in die Freiheit führen, so legt Jesus diese Worte nun in einer neuen Situation mit der gleichen Autorität wie Mose aus.
Interessant ist, dass auch Lukas durchaus um die Symbolhaftigkeit des Gottesberges weiß. Indem er (Lukas 6,12) vom Gebet Jesu auf einem Berg erzählt, erinnert er ebenfalls an den Aufenthalt des Mose auf dem Sinai und dessen Gespräch mit Gott. Aber Lukas scheint gedacht zu haben: So wie Mose dem Volk Israel ja nicht oben auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote gegeben hat, so muss auch Jesus in die Ebene heruntersteigen, um den Mühseligen und Beladenen die Barmherzigkeit des Vaters nahezubringen. Dass Lukas Jesus (Lukas 6,17) „auf einen ebenen Ort“ treten lässt, um Menschen zu heilen und seine Rede zu halten, habe ich in einem Gottesdienst auch einmal mit dem Gedanken verbunden, dass Gott nach Jesaja 42,16 „das Höckerige zur Ebene macht“.
↑ Zur Symbolik der Zwölfzahl und einiger Namen der Jünger Jesu
Zum Thema (S. 42) B wie Berufung regen Sie sich über Irrtümer und Ungereimtheiten auf, weil alle vier Evangelien von der Berufung der Jünger Jesu auf sehr unterschiedliche Weise berichten. Aber was sollen sie machen, wenn sie über die Fakten der Jüngerberufung einfach nichts Genaues wissen? Aus der Rückschau entwerfen sie verschiedene Szenarien über die Art und Weise, wie sie sich die Berufung von Jüngern vorstellen. Ob sie dabei auch auf die eine oder andere mündliche Überlieferung zurückgreifen, ist nicht auszuschließen. Aber was historisch tatsächlich passiert ist, lässt sich nicht genau rekonstruieren.
Worum geht es den Evangelisten? Sie stellen ihren Lesern Bilder vor Augen, in denen sie möglicherweise ihre eigene Art wiederfinden, in der sie selber zur Nachfolge Jesu gekommen sind. Der eine fühlt sich von Jesus angesprochen – und folgt seinem Ruf. Der andere macht mit Jesus wunderbare Erfahrungen, fühlt sich dadurch innerlich verwandelt („von nun an wirst du Menschen fangen“), und folgt ihm deswegen nach. Der dritte hat bereits zu einem Kreis wie dem der Johannesjünger gehört und kommt dadurch in Kontakt mit der Gemeinde Jesu.
Auch die widersprüchliche Namensgebung für die zwölf Jünger in den verschiedenen Evangelien, auf die Sie auf S. 43ff. hinweisen, hat weniger mit historischen Irrtümern zu tun als damit, dass alle Evangelisten von einer symbolischen Zwölfzahl der Apostel ausgehen, die damit zusammenhängt, dass sie Jesus als Messias für das ganze Israel der zwölf Stämme bekennen. Von daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass es historisch tatsächlich überhaupt diese klar abgegrenzte Zahl von Hauptjüngern gegeben hat.
Bezeichnend dafür ist, dass Johannes „die Zwölf“ nur als Sammelbegriff kennt (Joh. 6,67.79f. und 20,24), ohne dass er jemals alle Namen aus den Synoptikern aufzählt. Stattdessen nennt er auch andere Namen (Johannes 1,45-50) wie Nathanael oder (Johannes 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20) den „Jünger, den Jesus liebte“
Auch die Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas überliefern uns daher verständlicherweise keine genau identische Apostelliste. Manchmal vermitteln gerade die Unterschiede der angegebenen Namen einen spannenden Einblick in das Denken des jeweiligen Evangelisten, nämlich dort, wo es um symbolische Bedeutungen geht, die sich manchmal nur demjenigen erschließen, der über hebräische oder aramäische Sprachkenntnisse verfügt (12).
Wenn etwa (Markus 2,13-14) Jesus unmittelbar, nachdem er das Volk gelehrt hat, einen „Levi, den Sohn des Alphaios, am Zoll sitzen sieht“ und in seine Nachfolge ruft, dann klingt für Sprachkenner im Wort „Alphaios“ das hebräische ˀALaPh an, welches je nach seiner grammatikalischen Form „lernen“ oder „lehren“ bedeuten kann. Dazu schreibt der Theologe Andreas Bedenbender (13):
„Zuständig für die Lehre in Israel waren aber vor allem die Leviten. Somit trägt die Angabe ‚Sohn des Alphaios‘ zur subtilen Ironie der Darstellung bei: Jesus hat eben noch die Menge gelehrt und muß nun einen an sich zum Lehren prädestinierten Levi, der nur leider völlig von seinem Weg abgekommen ist, zur Sache rufen.“
Dass der Evangelist Matthäus (9,9) aus diesem Alphäus-Sohn Levi einen Menschen macht, „der Matthaios genannt wurde“, bestätigt Bedenbenders Argumentation, denn in diesem Namen klingt das griechische Wort mathētēs = „Schüler“ an, und das dem zu Grunde liegende Wort manthanein = „lernen“ war zur griechischen Übersetzung von ˀALaPh = „lernen“ verwendet worden (so in Sprüche 22,25). Dazu weiter Bedenbender auf derselben Seite:
„Darum übertrug er die Anspielung in die griechische Sprache und wertete sie zugleich auf. Bei ihm geht es nicht um das Lehramt der Leviten, sondern um die Möglichkeit eines jeden Menschen, zum ‚Lehrling‘, zum Jünger Jesu zu werden. So schließt sein Text ja auch mit der Aufforderung Jesu, alle Völker zu solchen ‚Lehrlingen‘ zu machen (mathēteusate panta ta ethnē; 28,19). … [So gilt für den Evangelisten Matthäus,] daß noch im letzten römischen Zöllner ein potentieller Jünger zu sehen ist – im Matthaios ein mathētēs.“
So gesehen hat der Autor des Matthäusevangeliums vielleicht sogar ganz bewusst sein Werk unter dem symbolischen Namen dieses mathētēs Matthaios verbreitet, eines beispielhaft „belehrten Jüngers“, der durch Jesus vom Abweg einer Existenz als Zöllner in seine Nachfolge gerufen worden war.
Andreas Bedenbender (14) erklärt auch die Veränderung, „die Lukas in der Liste der zwölf Apostel vornahm“, indem er „den Apostel Thaddaios … in Lk. 6,16 und noch einmal in Apg 1,13 durch einen ‚Judas, Sohn des Jakobus‘“ ersetzt. So schwächt er die antijüdische Tendenz der von ihm aufgegriffenen Tradition ab, in der Judas (15) Iskariot als „Inbegriff des jüdischen Volkes … seinen Herrn verrät“:
„Auch wenn der Verräter ein Judas (Jude?) gewesen sein mag; der ‚wahre Jakob‘ bzw. der wahre Jakobssohn Judas war er eben nicht.“
↑ Jesu paradoxes Lob eines betrügerischen Verwalters
Unter dem Stichwort (S. 45) B wie Betrug reagieren Sie empört über ein Gleichnis (Lukas 16,1-13), in dem Jesus einen betrügerischen Verwalter lobt (16,8), „weil er klug gehandelt hatte“.
Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen (S. 47) nehmen Sie an, es habe von dem Werk des Evangelisten Lukas eine Urfassung „in aramäischer oder hebräischer Sprache“ gegeben, da „die Juden zu Jesu Lebzeiten … nicht Griechisch, sondern das dem Hebräischen nah verwandte Aramäisch“ sprachen. Sie meinen,
„dass es Mitschriften der wichtigsten Worte Jesu gab. Schließlich wollten die, die ihn leibhaftig erleben durften, seine Worte mit anderen teilen, die Jesus allenfalls vom Hörensagen kannten. … Mitschriften entstanden, zirkulierten. Solchen Quellen [Lukas 1,1-4] will der Verfasser des Evangeliums nachgegangen sein, um sie zu prüfen und dann in eigener Version schriftlich festzuhalten.“
Aber solche aramäischen Mitschriften der Worte Jesu sind durch nichts belegt. Lukas bezieht sich auf Texte wie das (griechische) Markus- oder Matthäusevangelium und auf Sammlungen von zunächst mündlich weitergegebenen Worten Jesu – ursprünglich sicher in aramäischer Sprache, aber irgendwann ins Griechische übersetzt, lange vor der Niederschrift seines Evangeliums.
Wie dem auch sei: Sie ziehen von der ursprünglich aramäischen Sprache Jesu her den Schluss, dass Jesus in Wirklichkeit gar nicht den Betrüger gelobt hat. Dieser Eindruck sei nur durch eine falsche Übesetzung aus dem Aramäischen oder Hebräischen ins Griechische entstanden. Denn das hebräische Wort BaRaKh = „segnen“, „loben“ ist gelegentlich auch mit „verfluchen“ zu übersetzen und das Wort ˁARUM hat nicht nur die Bedeutung „klug“, sondern auch „listig“ oder „verschlagen“. Unter Berufung auf „Professor Pinchas Lapide (16), jüdischer Theologe, Religionswissenschaftler und Neutestamentler“ entscheiden Sie sich daher dafür, die Pointe des Gleichnisses auf den Kopf zu stellen, indem Sie Lukas 16,8 folgendermaßen übersetzen:
„Und Jesus verfluchte den ungerechten Verwalter, weil er hinterlistig gehandelt hatte.“
So richtig Ihre Bemerkungen über die beiden hebräischen Wörter sind – für das Gleichnis Jesu ist diese Lösung zu glatt und platt. Sie macht aus der Geschichte eine moralisch allzu korrekte Banalität. Natürlich ist ein Betrüger tadelnswert – was denn sonst? Eine solche Selbstverständlichkeit passt nicht zur provokativen Gleichnisschmiedekunst Jesu. Ja, ich nehme sogar an: Wenn wir Spuren des historischen Jesus suchen, dann finden wir sie am ehesten in solchen anstößigen Stellen seiner Parabeln und Rätselreden (17).
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang die Einsichten des Historikers Wilhelm Kaltenstadler (18) über die Zwischenstellung eines Verwalters im römischen Wirtschaftswesen:
„Der Verwalter hat es als Führer schwerer als der Gutsherr. Er steht zwischen dominus und Untergebenen, wird von ‚oben‘ und ‚unten‘ kontrolliert und muss es beiden Seiten rechtmachen.“
Ist es nicht vorstellbar, dass Jesus für einen solchen Verwalter mehr Sympathie aufbringt als für den Großgrundbesitzer, der sich nur selten auf seinen Besitztümern aufhält und von der jüdischen Tora her für ein ungerechtes Wirtschaftssystem steht?
Die Neutestamentlerin Luise Schottroff (19) hat das Gleichnis sozialgeschichtlich ausgelegt und unter vielem anderen darauf hingewiesen (S. 209f.), dass die hier angeführten großen Mengen einzelner Produkte auf einen im Römischen Weltreich bereits üblichen „Warenterminhandel“ hindeuten, bei dem Großhändler von Preisschwankungen profitieren. Dass (S. 210) Rom in urchristlichen Kreisen „als Welthandelszentrum hart kritisiert“ wird, geht auch aus Offenbarung 18 hervor. Gelobt wird der Verwalter von Jesus in paradoxer Weise, weil er innerhalb dieser kapitalistischen Löwenhöhle mit Hilfe schmutzigen Geldes (S. 211)
„– unfreiwillig – eine für christliche Gemeinden gangbare Praxis vormacht: Geld zu benutzen, um Freundschaften aufzubauen – in diesem Leben und im kommenden Leben“.
↑ Wie Matthäus in genialer Weise auf prophetische Texte anspielt
Am Beginn Ihrer Ausführungen (S. 48) zu B wie Blutacker wiederholen Sie Ihre haltlose Unterstellung (20), der Evangelist Matthäus könne „nicht viel über die religiöse Welt der Juden gewusst haben“, da er 27,3 über den Verräter Judas schreibt: „Es reute ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohen Priestern und Ältesten zurück.“ Sie behaupten nämlich: „Hohepriester gab es aber niemals mehrere, sondern nur einen.“ Aber hier sind Sie es, der sich irrt. Denn archiereis im Plural bedeutet schlicht „Oberpriester“; sie bildeten die Priesteraristokratie, die zum Beispiel auch im Synhedrion, dem Hohen Rat, vertreten war. Das Wort to archiereōs im Singular und mit bestimmtem Artikel dagegen meint hingegen in der Regel den amtierenden Hohenpriester, der das religiöse Oberhaupt der Juden darstellte und als Vorsitzender des Synhedrions auch erheblichen politischen Einfluss ausübte.
Das eigentliche Problem des Bibelabschnitts Matthäus 27,3-10 sehen Sie aber darin, dass der Evangelist den Kauf des Töpferackers mit den 30 Silberlingen des Judas durch die Hohenpriester als Erfüllung eines Wortes des Propheten Jeremia begreift:
„Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten und haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat.“
Dieses Wort steht aber so nirgends im Buch Jeremia. Allenfalls kann man die 30 Silberlinge, die in den Tempel geworfen werden, auf „den Lohn für einen Schäfer“ in Sacharja 11,12-13 beziehen. Hat also Matthäus irrtümlich den falschen Propheten zitiert oder sogar die Prophezeiung frei erfunden?
Mit einer solchen Annahme unterschätzen Sie sowohl die Bibelkenntnis als auch die theologische Genialität des Evangelisten, der es nämlich versteht, durch wenige Andeutungen ganze Landschaften biblischer Texthintergründe aufzurufen, um dem bibelkundigen Leser zwischen den Zeilen weitaus mehr mitzuteilen, als seine oft knappen Formulierungen den unkundigen Leser vermuten lassen (21).
Zunächst einmal geht es beim Propheten Sacharja nicht einfach um einen Schäferlohn. Der dort erwähnte Hirte ist vielmehr ein Führer des Volkes Israel, der seine Beauftragung durch Gott in einer völlig verfahrenen politischen Lage aufgibt, weil die 11,7 als „Schlachtschafe“ bezeichneten Israeliten ihn 11,8 „nicht mehr wollten“.
Die (S. 48f.) „Ähnlichkeiten mit dem Text bei Matthäus“ gehen weiterhin, anders als Sie meinen, durchaus darüber hinaus, dass der Mann „das Geld in den Tempel“ wirft. Er tut es nämlich, weil Gott selbst den Lohn für den von ihm beauftragten Hirten für beleidigend gering hält. Matthäus mag andeuten wollen: Schon im Alten Testament wurde vorausgesehen, dass der Gute Hirte Jesus den Verantwortlichen seines Volkes nur 30 Silberlinge wert sein wird (22). Mit seiner umständlichen Formulierung vom „Schätzpreis für den Eingeschätzten, der eingeschätzt wurde durch einige von den Israeliten“, greift er sogar sehr deutlich die mangelnde Wertschätzung dieses Hirten auf, nicht ohne anzudeuten, dass nicht das ganze Volk Israel, sondern nur einige von ihnen, nämlich die hier als Hohepriester und Älteste bezeichnete Führungsschicht, Jesus so behandeln, als sei er nichts wert.
Damit aber nicht genug der Andeutungen, die Matthäus aus dem Sacharja-Text aufgreift. In den Tempel soll das Silber geworfen werden: zum Einschmelzen im Tempelschatz, für die Kollekte. „Wirf sie dem Schmelzer hin“, übersetzt Luther, wörtlich steht da im Hebräischen: „Wirf sie dem Töpfer hin“.
Dieses Stichwort, das Matthäus mit dem „Acker des Töpfers“ wörtlich aufgreift, dient dem Evangelisten nun dazu, mit Hilfe der Erwähnung Jeremias gleich drei verschiedene Kapitel dieses großen Propheten aufzurufen, mit Hilfe derer er seine Erzählung von der Reue und vom Ende des Judas in die politische Geschichte Israels hineinschreibt. Dabei geht es ihm nicht darum, Voraussagen als wortwörtlich erfüllte Hellseherei zu erweisen. Er will alte Mahnungen und Hoffnungszusagen hörbar werden lassen, die ihre Aktualität auch nach Jahrhunderten nicht verloren haben.
Mit der Erinnerung an den einzigen Kaufvertrag für einen Acker im Alten Testament in Jeremia 32 ruft Matthäus tatsächlich auch das hoffnungsvolle Wort 32,15 ins Gedächtnis:
Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande,
auch wenn es bei diesem Kauf nur um 17, nicht um 30 Silberlinge ging. Aber was soll (S. 49) der „Blutacker des Matthäus“ mit diesem „Symbol der Hoffnung“ zu tun haben? Ganz einfach – bei Matthäus (27,7) soll dieser Blutacker ja als Friedhof für Fremde dienen; die Hohenpriester dienen also ungewollt dem in Matthäus 28,19-20 vom auferstandenen Jesus proklamierten Ziel, dass die Wegweisung Gottes auch den nichtisraelitischen Völkern zu Gute kommen soll. Außerdem mag Matthäus seinen Lesern ans Herz legen wollen: Trotz der Strafen, die Gottes Volk immer wieder treffen, gibt es Hoffnung; Gott gibt sein Volk Israel niemals auf!
Dem in Anm. 21 erwähnten Daniel Meister verdanke ich den Hinweis, dass Matthäus mit seiner Erwähnung des Töpfers sogar noch zwei weitere Jeremia-Stellen aufruft.
Nach Jeremia 18 geht der Prophet in das Haus des Töpfers und empfängt dort von Gott das Wort (V. 6):
Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? … Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel.
Und wenn das Volk Gottes nicht bereit ist, umzukehren (V. 11),
ein jeder von seinem bösen Wege,
kann Gott sein Volk auch strafen. Im Blick auf Menschen, die nicht umkehren und bereuen wie Judas, sondern am Unrecht festhalten wie die Hohenpriester, mag Matthäus das Wort aus Jeremia 18, 12 im Sinn haben:
Aber sie werden sprechen: Daraus wird nichts! Wir wollen unsern eigenen Plänen folgen und jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens handeln.
Aber nicht genug damit. In Jeremia 19 soll der Prophet (19, 1-2) im Auftrag Gottes „einen irdenen Krug vom Töpfer“ kaufen und „etliche von den Ältesten des Volks und von den Ältesten der Priester“ ins „Tal Ben-Hinnom“ in Jerusalem mitnehmen. Dieses Tal heißt auf Hebräisch GeJˀ HiNNoM – und nicht zufällig kommt daher das griechische Wort gehenna, zu Deutsch: „Hölle“. Das Tal GeJˀ HiNNoM war nämlich berüchtigt für Kinderopfer, die man Gott früher hier dargebracht hatte. Hier hält Jeremia den politisch Verantwortlichen eine Strafpredigt (19, 4.5.8.10-11), weil, wie Gott selber sagt,
sie mich verlassen und diese Stätte missbraucht und dort andern Göttern geopfert haben … und weil sie die Stätte voll unschuldigen Blutes gemacht … haben, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen, was ich weder geboten noch geredet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. … Und ich will diese Stadt zum Entsetzen und zum Spott machen, dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und spotten über alle ihre Plagen. … Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sagen: So spricht der HERR Zebaoth: Wie man eines Töpfers Gefäß zerbricht, dass es nicht wieder ganz werden kann, so will ich dies Volk und diese Stadt zerbrechen.
Ich denke, Matthäus spielt, indem er auf Jeremia hindeutet, besonders auch auf dieses Wort vom zerbrochenen Krug des Töpfers im Tal der Hölle Jerusalems an. Matthäus schrieb sein Evangelium ja nach dem Jüdischen Krieg und wusste, dass im Jahr 70 n. Chr. Jerusalem und sein Tempel genau wie damals zur Zeit Jeremias wieder zerstört werden würde.
Wahrscheinlich sah er in Judas einen Gesinnungsgenossen der Revolutionäre, die im Aufstand gegen die Römer das Reich des Messias mit Gewalt herbeiführen wollten und gerade so für den Untergang Jerusalems mitverantwortlich wurden. Immerhin trug Judas den Beinamen „Iskariot“, was an die Sicarier erinnerte, die sich mit dem Dolch im Gewand im Stadtgewühl an Menschen heranmachten, die sie für Feinde des jüdischen Volkes hielten und sie erstachen. Matthäus mag sagen wollen: Verblendete Menschen wie Judas mögen aus Liebe zu ihrem Volk gehandelt haben, Judas mag aus Liebe zu Jesus den Weg der Gewalt beschritten haben, aber es war ein falscher Weg, der Jesus den Tod und Israel die Zerstörung Jerusalems einbrachte.
Und wenn Matthäus an das unschuldige Blut der im Tal GeJˀ HiNNoM geopferten Kinder erinnert, denkt er wohl auch an die Kinder, die in jedem Krieg zu Opfern werden.
Matthäus schiebt in die Geschichte vom Leiden Jesu Christi nur ganz knapp die Erzählung von Judas ein, als Zwischenspiel. Mit wenigen Andeutungen zeigt er, wie die Welt aussieht, in die Jesus als Befreier und Retter hereingekommen ist. In Jesus leidet Gott unter der Gewalt von Menschen wie den hier geschilderten priesterlichen Machtpolitikern. In Jesus teilt Gott das Schicksal seines Volkes Israel und aller Menschenkinder, deren Blut unschuldig vergossen wird. In Jesus nimmt Gott sogar die Schuld aller Menschen auf sich, seiner Feinde, seines eigenes Volkes, seiner Freunde und sogar des Judas. Mit seinem Verzicht auf Gewalt, seiner Vergebung für Reumütige, mit seinem Tod am Kreuz ist Jesus die Hoffnung für alle, die zur Umkehr bereit sind (23).
Ganz Unrecht haben Sie nicht, wenn Sie abschließend über Matthäus schreiben (S. 50):
„Von Wunschdenken geleitet, findet er Prophetenworte, die nur der Glaubende zu sehen vermag. Sehen heißt nicht glauben, glauben heißt sehen – und wenn es Prophezeiungen sind.“
Ich hoffe allerdings, dass deutlich geworden ist: Matthäus saugt sich die von ihm im Glauben gesehenen Zusammenhänge nicht einfach aus den Fingern – er stellt vielmehr seine Verkündigung des Messias Jesus bewusst und zu Recht in einen lebendigen Bezug zur Prophetie der jüdischen Bibel.
↑ Konnte Jesus voraussehen, ob Christen verfolgt und Jünger mit Reichtum belohnt wurden?
Unter (S. 50) C wie Christenverfolgungen fragen Sie, ob Jesus die „teilweise exzessiven Christenverfolgungen durch römische Kaiser … vorhergesagt“ hat, und am Ende ziehen Sie das Fazit (S. 52):
„Jesus sagte nicht die über Jahrhunderte immer wieder aufwallenden Fälle teilweise gelenkter Massenhysterie der allgemeinen Christenverfolgungen vorher. Was die Prognosen für seine treue Jüngerschaft angeht, so erfüllten sie sich nicht: Keiner der Jünger der ‚ersten Stunde‘ wurde wie Jesu prophezeit verfolgt und materiell belohnt.“
Dazu ist zu sagen:
Jesus wusste wirklich nichts von Christen und ihren Verfolgungen in den kommenden Jahrhunderten. Als wahrer konkreter jüdischer Mensch, der apokaplyptisch dachte, wie Sie richtig sagen, konnte er gar nicht mit einer so lange andauernden Zukunft des Römischen Reiches rechnen.
Allerdings konnte Jesus durchaus mit Recht annehmen, dass seinen Jüngern, die er ansprach, genau wie ihm Verfolgung drohte. Das trat ja auch tatsächlich ein: Stephanus und Jakobus starben als Märtyrer, Petrus und Paulus kamen ins Gefängnis, wurden wahrscheinlich auch hingerichtet.
Das Verheißungswort Markus 10,29-30 zielt keineswegs darauf ab (S. 52), dass die Jünger trotz der Verfolgungen „in materiellem Reichtum schwelgen“:
Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben.
Gemeint ist vielmehr, ganz im Sinne des Jesuswortes in Markus 3,33-34, dass diejenigen, die sich ihrer leiblichen Familienmitglieder entfremden oder ihr Eigentum verlieren, in ihren Glaubensgeschwistern eine neue Familie gewinnen. Und nach Apostelgeschichte 4,34-35 teilte die Glaubensgemeinschaft alles, was jeder besaß, solidarisch miteinander.
Ob allerdings diese Jesusworte tatsächlich auf den historischen Jesus zurückgehen, kann natürlich nicht bewiesen werden; sie verlieren aber ihren Sinn nicht, wenn sie erst im Laufe der Zeit unter den Jesusnachfolgern geprägt wurden.
↑ Es ist unwichtig, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat
Zum Stichwort (S. 52) C wie Chronologie versuchen Sie wieder einmal historische Details der Biographie Jesu herauszubekommen, insbesondere, wie lange eigentlich Jesus öffentlich wirkte.
Zu diesem Zweck gehen Sie zunächst darauf ein, dass die drei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas einen ähnlichen Aufbau und einen großen gemeinsamen Grundbestand an Texten aufweisen; sie werden „Synoptiker“ genannt, weil man sie in einer „Zusammenschau“ gut nebeneinander lesen kann.
In der wissenschaftlichen Theologie hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Matthäus und Lukas das Markusevangelium (möglicherweise in einer etwas älteren Vorläuferversion) als Vorlage genutzt haben; umstritten ist nach wie vor die Existenz einer Spruchquelle Q, aus der Matthäus und Lukas diejenigen Jesusworte geschöpft haben sollen, die in ihren Werken übereinstimmen, aber nicht bei Markus vorkommen.
Für die öffentliche Wirksamkeit Jesu legt Ihnen zufolge die „Berichterstattung“ der drei Synoptiker „anderthalb Jahre“ nahe, während Jesus „nach dem Evangelium nach Johannes drei oder vier Passahfeste“ erlebte (24), also „nach Johannes mindestens zwei oder drei Jahre öffentlich auftrat.“ Allerdings legt kein Evangelist eine „Berichterstattung“ im Sinne einer heutigen Reportage oder Biographie vor; niemand von ihnen hat ein Interesse an präziser Chronologie.
Markus und den anderen Synoptikern geht es um die Bewältigung des Jüdischen Krieges und der Tempelzerstörung im Jahr 70 n. Chr., die sie unter Rückgriff auf die Passion und Kreuzigung Jesu interpretieren. Sie stellen, so Ton Veerkamp (25), Jesu öffentlichen Lebensweg als „Zug von Galiläa nach Jerusalem“ dar, entsprechend dem Weg, den die römischen Legionen bei ihrer Niederschlagung des jüdischen Aufstandes eingeschlagen haben.
Johannes orientiert sein Evangelium stattdessen am jüdischen Festkalender; für ihn muss der
„Messias … immer öffentlich da sein, wo ganz Israel zusammenkommt, auf den großen Festen des judäischen Volkes: Pesach, Sukkot (Laubhüttenfest) und Chanukka.“
Das heißt: Inhaltliche, theologisch-politische Gründe stehen bei der Gestaltung der Evangelien im Vordergrund. Wie viele Passahfeste Jesus tatsächlich während seiner öffentlichen Wirksamkeit erlebt hat, kann niemand sagen. Die Auffassung der Synoptiker, dass man wohl schon relativ rasch mit ihm kurzen Prozess gemacht hat, ist wahrscheinlicher. Aber Genaues wussten alle Evangelisten selber nicht. Wenn Sie (S. 53) „wichtige Geschehnisse“ erwähnen, „von denen man annehmen möchte, dass sie Jesu Biographen bestens bekannt waren“, muss ich entgegnen, dass die Evangelisten eben keine Biographen in unserem Sinne waren, sondern Glaubenszeugen, die nach der Katastrophe von 70 n. Chr. sich ihres Glaubens an den Messias Jesus neu zu vergewissern suchten.
↑ Wer dem Messias dient, dient dem, der zum Diener wird
Zum Stichwort (S. 54) D wie Diener weisen Sie auf den Widerspruch hin (S. 55), dass einerseits das Alte Testament „einen herrschenden Messias“ prophezeit, „der keineswegs selbst dient, sondern dem vielmehr gedient wird. Selbst ‚alle Könige‘ werfen sich ihm zu Füßen“, wie es im Buch Daniel 7,14.27 und im Psalm 72,11 nachzulesen ist. Andererseits (S. 54) sieht Jesus sich selbst „als Messias“ in der Rolle eines Dieners (Matthäus 20,28; vgl. Markus 10,45 und Lukas 22,27):
„Des Menschensohn ist (aber) nicht gekommen, auf dass er sich bedienen lasse, sondern damit er selbst diene und gebe sein Leben hin zur Erlösung für Viele.“
Wenn aber der Messias den Namen des Gottes verkörpert, der Freiheit und Gerechtigkeit schenkt, statt zu unterdrücken, dann besteht kein Widerspruch mehr: Die Unterdrückerkönige verlieren den Anspruch auf ihre Macht, sollte sich also Jesus zu Füßen werfen, während umgekehrt Jesus zu dienen bedeuten würde, dass einer dem anderen dient, dass Herrschaft von Menschen über Menschen ihren Schrecken verliert. Bereits im Buch Daniel deutet der Name des Menschensohnes (= einer wie ein Mensch) auf die Ablösung bestialischer Tyranneien durch eine Regierungsform mit menschlichem Gesicht hin.
Eigentlich hatte ich gedacht, dass Sie unter dem Stichwort D wie Diener auf andere Bibelstellen Bezug nehmen würden, zum Beispiel auf Markus 1,13 und Matthäus 4,11: Dort heißt es, dass Jesus von Engeln bedient wird. In Markus 1,29, Matthäus 8,15 und Lukas 4,39 bedient ihn die Schwiegermutter des Petrus; in Lukas 8,3 ist von Frauen die Rede, die Jesus mit ihrer Habe dienen; in Lukas 10,40 dient ihm Marta. Johannes 12,25 spricht Jesus vom Dienst seiner Nachfolger für ihn. An diesen Stellen sieht man, dass es auch beim Thema „Dienen“ nicht um eine kleinkrämerische wortwörtliche Auslegung bestimmter Worte geht, sondern um die Tendenz, dass der Messias Jesus ein solidarisches Füreinander-Da-Sein der Menschen im Sinn hat.
↑ Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea
Zum (S. 56) Stichwort D wie Drei kritisieren Sie bei „aller Sympathie für kritische Theologie-Wissenschaft“ die Haltung mancher Bibelexegeten, die davon ausgehen:
„Wenn sich eine Prognose Jesu über seinen Tod erfüllte, dann handelt es sich um eine nachträgliche Erfindung der frühen Gemeinde.“
Sie haben Recht – Zweifel sind erlaubt, aber den Zweifel zu dogmatisieren, schießt über das Ziel hinaus (S. 56f.):
„Wer behauptet, ein erfülltes Jesus-Wort müsse also erfunden sein, weil es sich bewahrheitet habe, verlässt den Boden der Wissenschaftlichkeit. … Diese ‚wissenschaftliche‘ Haltung ist genauso naiv wie die Behauptung, Jesus sei ein echter Prophet gewesen, denn schließlich stehe das ja so in der Bibel. Auf beiden Seiten werden Glaubenssätze vorgetragen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur: Man darf eine Glaubens-Vermutung nicht für eine wissenschaftliche Tatsache ausgeben.“
Konkret versuchen Sie allerdings doch (S. 57) exakt nachzuweisen, ob Jesus mit seiner Aussage „über die Dauer, die er begraben in der Erde ruhen wird“ Recht behalten hat (Matthäus 12,40):
Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein.
Sie kommen zu dem Schluss,
„Jesus müsste am vierten Tage auferstanden sein, wenn er davor drei Tage im Leib der Erde geruht haben soll, so wie Jona drei Tage lang im Magen des Wals verbrachte.“
Und die Versuche von biblizistischen Theologen, diesen Widerspruch zu harmonisieren, sind – wie Sie mit Recht annehmen – zum Scheitern verurteilt.
Gleason L. Archer (26) mag zwar damit Recht haben, dass bei der bildlichen Redeweise von der Auferstehung in drei Tagen „auch ‚angebrochene‘ Tage als ‚Tage‘“ gezählt werden. Aber Matthäus zitiert nun einmal wirklich wörtlich Jona 2,1 mit dem Wortlaut „drei Tage und drei Nächte“, und er schert sich nicht darum, dass er damit dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse, wie er sie selbst in Matthäus 27 und 28 darstellt, widerspricht.
Regelrecht absurd ist die Lösung, die der „sehr konservative, ja fundamentalistische Theologe Dr. M. R. DeHaan (1891-1965) (27)“ angeboten hat (S. 58f.), nämlich „dass Christus am Mittwoch gekreuzigt wurde und auferstand gleich nach Sonnenuntergang der Samstagnacht … In keiner anderen Weise kann Rechenschaft abgelegt werden für drei Tage und drei Nächte.“
Widersprüchlich argumentieren Sie im Blick auf den Symbolgehalt der Zahl Drei. Einerseits betonen Sie (S. 59f.):
„Drei hat für den hebräischen Zahlenkundigen eine ganz besondere Bedeutung. Sie ist die vermutlich wichtigste Vollkommenheitszahl. Drei Tage lang war Jona im Riesenfisch, auf diese Weise vollkommen geschützt von Gott. Nur so überlebte er eine Situation, die eigentlich den sicheren Tod hätte bringen müssen. Denn schließlich wurde er bei einem schlimmen Sturm auf hoher See von den Seeleuten in die Fluten geworfen.
Diese drei Tage stehen für den Zahlenkundigen im konkreten Fall für die Vollkommenheit der Schöpfung, die sich in dieser kleinen Drei offenbart.“
Auf der anderen Seite glauben Sie dem „Handbuch der Bibelkunde“ (28) ohne Weiteres, dass man von „dieser symbolischen Bedeutung … offensichtlich zu Jesu Lebzeiten abgerückt“ ist (S. 60):
„Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass in der Zeit Jesu das Jonasbuch wortwörtlich genommen wurde; somit hat wohl auch Jesus es wortwörtlich genommen. Jedenfalls bezieht sich das ‚Neue Testament‘ mehrmals darauf im Sinne eines solchen Verständnisses.“
Worauf stützt sich diese Zweifellosigkeit? Eine symbolische Verwendung liegt auch für Jesus und die ersten Christen viel näher, zumal sie sicher den Bibelvers Hosea 6,2 kannten, in dem der Prophet eine typisch hebräische Art des Spiels mit verschiedenen Zahlenangaben aus der Tradition der jüdischen Weisheit zitiert:
Er (JHWH) macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben.
Deutlicher könnte nicht ausgedrückt werden, dass es eben nicht um ganz präzise Zeitangaben geht, sondern um die Erinnerung an Gottes bewahrende Hilfe in ganz unterschiedlichen Situationen der Vergangenheit Israels (29).
Letzten Endes zweifeln Sie dann doch die Forderung dieses Werks der Bibelkunde an (S. 60),
„dass sich Jesus irren musste, weil sich seine Zeitgenossen irrten. Nur so konnte der göttliche Jesus zum menschlichen Jesus werden. Diese Vermenschlichung Jesu geht dann eben so weit, dass er falsche, ja unmögliche Dinge für richtig hält: Kein Wal oder sonstiger Großfisch kann einen lebenden Menschen im ganzen Stück so verschlucken, dass er unverletzt bleibt und drei Tage und Nächte im Fischleib überlebt. Das ist nach den Gesetzen der Natur schlicht unmöglich!“
Einigen wir uns darauf: Wir wissen einfach nicht, was Jesus für möglich hielt und was nicht. Zur Frage, ob Wale Menschen das Leben retten können, hat Vitus Dröscher allerdings interessante Gesichtspunkte beigesteuert, auf die ich andernorts hinweise (30).
↑ Alttestamentliche „Vorlagen“ für die Erzählung von Jesus am Kreuz
Unter dem Stichwort (S. 61) D wie Duplizität beschäftigen Sie sich mit Ähnlichkeiten in der Geschichte des alttestamentlichen Josef und des neutestamentlichen Jesus. Als Josef in Ägypten unschuldig im Gefängnis sitzt, deutet er zwei Mitgefangenen ihre Träume. Der eine (1. Mose 40,19), ein Bäcker, wird in drei Tagen hingerichtet werden, der Pharao wird ihn „an ein Holz hängen“. Dem anderen sagt Josef (1. Mose 40,13) die Wiedereinsetzung in seine Stellung als Mundschenk des Pharao voraus. Motive aus dieser Erzählung finden Sie in der Passionsgeschichte des Lukas wieder (S. 62):
„Schon die Ankündigung ‚In noch drei Tagen wird er, der Pharao, haben deinen Kopf von dir und er wird ihn hängen ans Kreuz‘ weist deutlich auf die Kreuzigung Jesu hin. ‚Gedenke meiner, wenn es dir wohl ergeht, und tu Barmherzigkeit an mir!‘ [1. Mose 40,14] bittet Josef den Mundschenk. Jesus wird zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Der eine verspottet ihn, der andere ‚sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!‘ [Lukas 23,42] Jesus soll sozusagen beim himmlischen Vater ein gutes Wort für den reuigen Sünder einlegen, so wie der Mundschenk sich für Josef einsetzen soll.“
Mit Recht sagen Sie im Blick auf solche Entsprechungen: „Was geschah wirklich in den letzten Minuten Jesu am Kreuz? Wir wissen es nicht.“ Ein kleiner Irrtum unterläuft Ihnen allerdings (vielleicht weil Sie in diesem Zusammenhang auch einen Kommentar zum Johannesevangelium erwähnen), wenn Sie schreiben, „dass der Text des nach Johannes benannten Evangeliums die Szene von Josef im Kerker des Pharao als Vorlage mit einarbeitete“. In Wirklichkeit erwähnt nur Lukas (den Sie zuvor ja auch richtig zitieren) die Bitte des mit ihm gekreuzigten Aufständischen (den Sie hier – trotz ihrer an anderer Stelle gegen eine solche Bezeichnung plädierenden Ausführungen – „Verbrecher“ nennen) um Fürsprache im Reich der Himmel.
Aber grundsätzlich stimme ich Ihrer folgenden Einschätzung zu:
„Schriften des ‚Alten Testaments‘ wurden von den Verfassern des ‚Neuen Testaments‘ wie Versatzstücke verwendet. Sie verfuhren dabei so wie ein Künstler, der sich aus verschiedenen alten Mosaikbildern da und dort einzelne Steine herausnimmt. Sie werden dann zu einem neuen Bild zusammengefügt. Man muss schon einigen detektivischen Spürsinn aufbringen, um zu erkennen, von wo was weggenommen wurde.“
Der Ausdruck „Versatzstücke“ klingt in meinen Augen allerdings zu sehr nach willkürlicher Beliebigkeit. Tatsächlich standen die Evangelisten in einem derart lebendigen Austausch mit dem Geist ihrer jüdischen Bibel, dass sie die dort ausgedrückte Wahrheit über den Willen des Einen Gottes und den Weg des Volkes Israel im Hintergrund ihrer Erzählung vom Messias Jesus aufscheinen lassen wollten.
Leider wurde dieses Anliegen in der neu entstehenden christlichen Kirche aber schon bald durch eine antijüdische Tendenz ersetzt, die das Alte Testament als bloße Vorstufe des Neuen verstand und alttestamentliche Aussagen nur noch als im Grunde platte hellseherische Prophezeiung auf Jesus Christus gelten ließ. Erst nach der Shoa, dem Völkermord an Millionen von Juden im 20. Jahrhundert, besinnen sich Teile der christlichen Kirche wieder auf die eben skizzierte sinnvolle Art und Weise, das Neue Testament von der jüdischen Bibel als ihrem Fundament her zu begreifen.
Zurück zur Kreuzigung Jesu: Die Verspottung Jesu durch Vorübergehende, Oberpriester, Schriftgelehrte und sogar die mit ihm gekreuzigten lēstai = „Räuber“ bzw. „Terroristen“ in Matthäus 27,39-44 bringen Sie (S. 62f.) mit Psalm 22,8-9 in Verbindung. Noch genauer stimmt mit Matthäus 27,43 allerdings eine Stelle aus dem apokryphen Buch des Weisheit Salomos 2,12-20 überein, die dem Evangelisten wahrscheinlich als Vorlage dieses Teils der Kreuzeserzählung gedient hat, um Jesu Tod als den Tod eines jüdischen Gerechten herauszustellen (31).
Recht haben Sie mit Ihrem abschließenden Satz (S. 63):
„Der ‚wissenschaftlich‘ arbeitende Theologe mag sich dem Gläubigen überlegen fühlen. Wenn er aber ehrlich ist, so muss er zugeben, dass auch er letztlich nicht wirklich weiß, sondern auch ‚nur‘ glaubt.“
Und die Verantwortung des Theologen besteht vor allem darin, es dem Glaubenden zu ermöglichen, über die Grundlagen seines Glaubens nachzudenken, die eben nicht darin bestehen, dass die Bibel wortwörtlich wahr ist, sondern dass im menschlichen Wort der Bibel die Wahrheit der Wegweisung des Einen Gottes Israels und seines Messias Jesus demjenigen offenbar werden kann, der sich vom Geist Gottes anrühren, leiten und verwandeln lässt.
↑ Dachte Jesus bei Markus über die Ehescheidung wie ein Römer?
Zum Thema (S. 63) E wie Ehescheidung haben Sie mir eine harte Nuss zu knacken gegeben. Sie behaupten nämlich, dass Jesus als Jude keineswegs folgenden Satz in Markus 10,12 gesagt haben könnte (so übersetzt nach der katholischen Einheitsübersetzung):
Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen Mann heiratet.
Auch wenn Sie es sympatisch finden, dass Jesus in dieser Frage „die Gleichberechtigung“ von Mann und Frau vertritt, ist dieser Satz in Ihren Augen (S. 64)
„schlicht und ergreifend unsinnig. Der beschriebene Fall konnte zu Jesu Zeiten nach jüdischem Recht gar nicht eintreten. Eine jüdische Frau war gar nicht in der Position, ihren Mann aus der Ehe zu entlassen. Sich vom Partner zu trennen, das war nur dem Mann vorbehalten. Nach wie vor galt das mosaische Recht: Nur ein Mann konnte sich von seiner Frau scheiden lassen. Die Formalität war einfach: Er musste nur einen Scheidebrief ausstellen, schon war er seine Frau los.“ [5. Mose 24,1]
Ihre Schlussfolgerung lautet:
„Die von Jesus beschriebene juristische Möglichkeit der Frau, ‚ihren Mann aus der Ehe zu entlassen‘, hatte die Jüdin nicht, wohl aber die Römerin. Da Jesus ganz sicher mit jüdischen Rechtsfragen nach mosaischen Vorschriften bestens vertraut war, kann der zugeschriebene Satz gar nicht von Jesus stammen.
Er wurde von einem Menschen geschrieben, der keine Ahnung von jüdischem Recht hatte. Jüdische Lebensweise und jüdische Denkungsart waren ihm fremd.“
Sollte das aber stimmen, dann würde meine ganze Einschätzung von Markus als durch und durch jüdisch geprägtem Autor ins Wanken geraten. Ich gestehe zu, dass der Verfasser des Markusevangeliums (S. 65) „nicht in Jesu Umfeld gelebt“ hat, also ihm persönlich nicht begegnet ist. Aber stammt er wirklich „aus römischem Umfeld“ oder wurde sein „Evangelium römerfreundlich bearbeitet“, wie Sie annehmen?
Andreas Bedenbender, den ich bereits mehrfach als fachkundigen Experten für Markus zitiert habe, war so freundlich, mich per Mail auf einen Kommentar zum Markusevangelium der amerikanischen Neutestamentlerin Adela Yarbro Collins (32) aufmerksam zu machen, in dem die Frage, ob jüdische Frauen zur Zeit Jesu sich von ihren Männern scheiden lassen konnten, sehr viel umsichtiger diskutiert und vor allem in ihrer Komplexität ernstgenommen wird. Dazu folgende Gesichtspunkte:
- Wie Yarbro Collins schreibt (S. 459f.), konnten Frauen schon im 5. Jahrhundert v. Chr. in der jüdischen Militärkolonie auf der Nilinsel Elephantine die Scheidung betreiben, wenn ihr Mann seine Verpflichtungen ihr gegenüber nicht erfüllte.
- Weiterhin (S. 463) kritisiert Josephus an Salome, der Schwester von Herodes dem Großen, dass sie sich von ihrem Mann geschieden habe. Das war gegen die Tora (wie Josephus sie verstand), aber so etwas eben kam vor. (Wie viele Katholiken haben schon vor dem 2. Vaticanum Evangelische geheiratet und wurden, weil sie nicht die Erziehung der Kinder im katholischen Glauben versprachen, von ihrer Kirche exkommuniziert! Zwischen dem Wortlaut der Gesetzesbestimmungen und der tatsächlichen Praxis klafft oft ein tiefer Graben.)
- Außerdem (S. 463f.) wurde in den 1950er Jahren ein aramäischer Scheidungsvertrag aus dem Jahr 135 n. Chr. im Gebiet des damaligen Judäa gefunden, der darauf hindeutet, „that a woman in the first half of the second century could and did initiate a divorce from her husband“. Es gab also durchaus den dokumentierten Fall, dass eine jüdische Frau die Scheidung von ihrem Ehemann einreichte.
- Markus (S. 470) verwendet für die Scheidung, die von der Frau ausgeht, dasselbe Verbum wie bei der Scheidung, die vom Mann ausgeht, nämlich jeweils apolyein. Das passt gerade nicht zum römischen Sprachgebrauch, denn hier wurde in diesen beiden Fällen in der Regel terminologisch unterschieden. Beim Mann hieß es repudiare = „zurückweisen“, bei der Frau divertere/divortere = „auseinandergehen“. Im Grunde ist also im römischen Recht ein ähnliches Gefälle vorausgesetzt wie im 5. Buch Mose 24,1: der Mann kann die Frau wegschicken, die Frau kann bei Zerrüttung einer Ehe aber immerhin auch eine Scheidung erwirken. Markus nimmt das zwischen Mann und Frau differenzierende römische Juristen-Latein seiner Zeit also gerade nicht auf. Das mag zwar daran liegen, dass er sich als Nichtjurist in diesen Feinheiten gar nicht auskennt. Aber vielleicht will er auch bewusst betonen, dass Jesus den Frauen zwar nicht das Recht auf Scheidung zubilligt, aber gleichermaßen die Männer in die Pflicht nimmt, ihre Frauen nicht einfach wegzuschicken, was für sie eine besondere soziale Härte darstellt. Auf jeden Fall scheint die christlich-jüdische Gemeinschaft, zu der Markus gehört und an die er sich wendet, Wert darauf zu legen, dass der Wille Gottes für Mann und Frau in gleicher Weise bindend ist – also Gleichheit eher im Blick auf die Pflichten als auf die Rechte, aber jedenfalls auf die gleiche Würde vor Gott.
- Schließlich (S. 459) erwähnt der Apostel Paulus bereits in den 50er Jahren des 1. Jahrhunderts in 1. Korinther 7,10-11 ein Gebot Jesu, „dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden [chōrizō: „trennen“] lassen soll … und dass der Mann seine Frau nicht fortschicken [aphiēmi = „gehen lassen“] soll. In den Versen 12 und 13 verwendet er dasselbe Wort aphiēmi für beide Geschlechter. Also war ein solches Jesuswort bereits lange vor Markus im Umlauf, und es ist durchaus möglich, dass es auf Jesus selbst zurückgeht (obwohl das nicht bewiesen werden kann). Paulus als römischer Bürger, der zugleich aber in der jüdischen Tradition fest verwurzelt war, mag sich in den juristischen Sprachgebräuchen beider Kulturen ein wenig auskennen, so dass er sowohl auf die römische Unterscheidung zwischen dem Verfahren bei Mann und Frau zurückgreifen als auch für beide den jüdischen Begriff des Entlassens aus der Ehe verwenden kann.
- Andreas Bedenbender weist außerdem in seiner persönlichen Mitteilung an mich darauf hin, dass es ja im 1. Jahrhundert auch Mischehen gab. Zum Beispiel hören wir zu Beginn von Apostelgeschichte 16 von Titus, der der Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters war. Wir wissen nicht, wie die Ehe der Eltern des Titus geschlossen wurde, aber wenn es nach griechischen Recht war (Titus war nicht beschnitten!), dann hatte die Frau wohl auch die Möglichkeit zur Scheidung.
Dafür, dass dem Autor des Markusevangeliums die jüdische Gesetzgebung und Praxis der Ehescheidung seiner Zeit fremd sei, spricht jedenfalls überhaupt nichts, zumal wenn man von Paulus weiß, dass man traditionsbewusster Jude sein kann und zugleich die römische Staatsbürgerschaft innehat.
↑ Gingen jüdische Männer wirklich nicht zum Markt?
Ihr weiteres Beispiel, mit dem Sie unter E wie Ehescheidung zu belegen versuchen, dass Markus vom jüdischen Leben keine Ahnung hat, ist ebenfalls nicht beweiskräftig. Es geht um Markus 7,3-4 (S. 64):
„Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, es sei denn, sie haben sich vorher die Hände mit einer Hand voll Wasser gewaschen und halten so die Satzungen der Ältesten ein. Und wenn sie vom Markt heimkommen, so essen sie nicht, es sei denn, sie waschen sich.“
Aus diesem Vers ziehen Sie sehr weitreichende Schlüsse, indem Sie zunächst behaupten, dass hier nur von Männern die Rede sei. Nun geht aus dem griechischen Text das Geschlecht der betreffenden Personen aber gar nicht eindeutig hervor; die männliche Pluralform kann auch Frauen einschließen. Aber nehmen wir einmal an, es sei wirklich nur von Männern die Rede. Dann sei es unmöglich, dass (S. 65) „diese männlichen Juden … vom Markt heimkehrend erst einmal die Hände gewaschen“ haben, wie Markus behauptet,
„bevor sie sich zum Essen niedersetzten. Über solch eine Behauptung hätte man in jüdischen Kreisen zur Zeit Jesu nur den Kopf geschüttelt. Männer gingen nicht zum Markt. Deshalb kamen sie auch gar nicht in die Verlegenheit, sich nach Einkauf auf dem Markt vor dem Essen die Hände zu waschen.“
Das ist aber nun wirklich ein absolut abwegiger und durch nichts zu belegender Einwand. Denn der Marktplatz, griechisch agora, wird in der Bibel nirgends als Wochenmarkt erwähnt, auf dem Frauen einkaufen gehen. Zwar zählt der Prophet Hesekiel (27,12.14.16.19.22) in einer Klage über die Handelsstadt Tyrus viele Waren auf, die „auf deine Märkte gebracht“ werden, aber wie vielfältig eine agora genutzt wurde, zeigen zum Beispiel die Stellen in Matthäus 11,16 bzw. Lukas 7,32, wo Jesus spielenden Kindern auf dem Markt zusieht. Und gerade im Neuen Testament wird der Markt überwiegend als Versammlungsort von Männern beschrieben, die sich am öffentlichen Leben beteiligen:
- Matthäus 20,3 beschreibt arbeitssuchende Männer, die auf dem Markt herumstehen.
- In Matthäus 23,7, Markus 12,38 und Lukas 11,43 bzw. 20,46 wollen Schriftgelehrte und Pharisäer gerne auf dem Markt gegrüßt werden.
- Nach Markus 6,56 bringt man auf dem Marktplatz Kranke zu Jesus, damit er sie heilt.
- In Apostelgeschichte 16,19 schließlich wird auf dem Markt von Männern Gericht gehalten.
- Nach Apostelschichte 17,17 hält Paulus auf dem Marktplatz von Athen Volksreden vor griechischen Philosophen.
Um nachzuweisen, dass das Markusevangelium von einem nichtjüdischen Autor stammt, müssten Sie also andere Argumente beibringen als einen in diesem Zusammenhang unerheblichen Hinweis auf Männer, die auf dem Markt keine Einkäufe tätigten.
↑ Irrte Jesus über die Wiederkunft Elias in Johannes dem Täufer?
Ihren Abschnitt (S. 65) unter E wie Elia beenden Sie (S. 68) mit der richtigen Einsicht:
„Viele biblische Schriften des ‚Neuen Testaments‘ sind keine Werke der Geschichtsschreibung. Sie sind vielmehr Zeugnis vom Glauben und von der Hoffnung der Menschen.“
Trotzdem konzentrieren Sie sich zuvor weniger auf den Sinn der neutestamentlichen Aussagen über Jesus und Elia als eben darauf, ob sie historische Irrtümer enthalten. Sie wiederholen (S. 65), dass Jesus irrtümlicherweise das unmittelbar bevorstehende Weltende ankündigte (33) und „von sich behauptete, kein Mensch vor ihm sei zum Himmel aufgefahren“ (34).
Den Hinweis auf einen weiteren Irrtum Jesu fügen Sie hinzu. Sie beziehen ihn darauf, dass man zur Zeit Jesu auf die Wiederkunft des Propheten Elia hoffte (S. 66):
„Nach Überzeugung wahrscheinlich einer Mehrheit der Juden zu Jesu Lebzeiten war es dringend erforderlich, dass zunächst Elia und dann der Messias zurück ins Heilige Land kämen, um die als frevlerisch empfundene römische Herrschaft zu vertreiben. Herbeigesehnt wurde Elia als starker Mann, der das Volk zum wahren Glauben zurückführen würde. Jesus war nun davon überzeugt: Elia ist längst wieder auf Erden gewesen. Man hat ihn nur nicht erkannt, gepeinigt und hingerichtet.
Jesus irrte allerdings: Denn Johannes war es ja eben aus Sicht eines gläubigen Juden nicht gelungen, ‚alles zurechtzubringen‘. Es gab keinerlei Erneuerung im Glauben, kein Erstarken der jüdisch-religiösen Kräfte: weder zu Lebzeiten von Johannes noch danach zu Lebzeiten Jesu und auch nicht nach Jesu Kreuzigung. 73 n. Chr. erloschen die noch einmal aufkeimenden Hoffnungen auf die Wiederkehr von Elia und Jesus.“
Allerdings, so meinen Sie unter Berufung auf den Theologen Gerd Lüdemann, könnte die Aussage Jesu über Elia ihm auch nachträglich in den Mund gelegt worden sein (S. 68), „um die nach Jesu Tod langsam schwächer werdende Hoffnung auf das bald beginnende Ende zu stärken“. Denn immerhin, so schreiben Sie:
„Man kann sich kaum vorstellen, wie verzweifelt die Christen der ersten Generationen gewesen sein müssen, als das erwartete Weltende ausblieb. Umso erstaunlicher ist es, dass dennoch die christliche Gemeinde wuchs.“
Das Markusevangelium wird um die Zeit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels geschrieben, um genau diese Verzweiflung zu bewältigen. Auch viele Jesusnachfolger können es zunächst nicht fassen, dass an Stelle der Wiederkunft des siegreichen Menschensohns Jesus durch den Sieg der Römer im Jüdischen Krieg jede jüdische Hoffnung auf ein Friedensreich in weite Ferne gerückt ist.
Nach Andreas Bedenbender (35) könnte Markus die überlieferte Sicht des Propheten Elia bewusst verändert haben, um deutlich zu machen, dass gerade der gewalttätige Aufruhr der Zeloten gegen die Römer, der sich an einem starken Elia orientierte, zum Untergang Jerusalems und des Tempels geführt hat. Er teilt zwar
„mit den Zeloten die Hochschätzung des Propheten Elia. Damit endet die Gemeinsamkeit aber auch schon. Während die Zeloten sich selbst in der Nachfolge des Gottesmannes aus Tischbe sahen, wird dieser von Markus mit Johannes dem Täufer identifiziert und somit als Vorläufer Jesu verstanden… Am markinischen Johannes wird deutlich: Wenn die Zeloten Elias Wiederkunft mit Mord und Gewalttat vorbereiten wollen, dann lesen sie ihre Bibel falsch. … Für das Mk-Ev ist Elia nicht der Elia vom Karmel, der die vierhundertfünfzig Propheten Baals tötet, er ist der Elia, der in die Wüste flieht, der machtlose Bußprediger.“
Insofern haben Sie auch darin Recht, dass wir nicht wissen, was der historische Jesus über Elia gesagt hat. Aber dass er kein Zelot war, dürfte ziemlich sicher sein, so dass es durchaus Sinn macht, wenn die Evangelisten seinen Vorläufer Johannes eben nicht als den erfolgreichen jüdischen Revolutionär stilisieren, sondern als einen Propheten (Markus 9,13), dem nicht nur die Handlanger Roms, sondern auch die Aufrührer gegen Rom „angetan [haben], was sie wollten“, indem sie die Eliasvorstellung für ihre Zwecke manipuliert haben.
↑ Erscheinungen des Auferstandenen vor den Augen des Glaubens
Ausführlich weisen Sie zu (S. 68) E wie Erscheinungen auf die Widersprüche zwischen den Auferstehungserzählungen der Evangelien hin. Einmal unterläuft Ihnen dabei ein kleiner Irrtum (S. 69):
„Nach Johannes zeigte sich Jesu als erstem Menschen noch am Grabe seiner Verehrerin Maria Magdalena. Bei Lukas findet diese erste Begegnung nicht statt. Jesus zeigt sich erstmals den beiden Jüngern von Emmaus.“
Da haben Sie nicht genau hingeschaut: Auch Lukas 24,10 erwähnt Maria Magdalena am Grab, allerdings gemeinsam mit anderen Frauen; nur glauben die Männer den Frauen nicht, was Sie ja auch wissen, da Sie selber Lukas 24,22 zitieren.
Aber wie soll man sich die Erscheinungen Jesu überhaupt vorstellen? Mit dem Begriff (S. 70) „tatsächliche visionäre Erfahrungen“, den Gerd Theißen und Annette Merz (36) auch auf ins Leben Jesu zurückverlegte Erzählungen wie die „Verklärungsgeschichte“ beziehen und der verdeutlicht, „wie Jesus in die himmlische Welt aufgenommen wurde“, können Sie offenbar nichts anfangen, denn Sie stellen die Frage:
„Handelt es sich also um echte, physisch-leibhaftige Begegnungen oder um sich nur im Geist abspielende Visionen?“
Ja, wie sind zunächst einmal die Erzählungen von Begegnungen mit Jesus nach seinem Tod aufzufassen? Viele Christen meinen, Jesus sei tatsächlich körperlich wieder lebendig geworden. Allerdings haben gerade deswegen auch viele von ihnen Schwierigkeiten mit dem Glauben an die Auferstehung.
Theißen und Merz verstehen die Erscheinungen des Auferstandenen sicher im letzteren Sinn – als Visionen, die sich „im Geist“ abspielen. Auch ich denke, dass man über die Wirklichkeit der Auferstehung nur in Bildern reden kann. Problematisch kann dabei das Wörtlein „nur“ sein. Kann denn unsere Begegnung mit Gott anders stattfinden als in unserem menschlichen Geist? Für mich ist eine Schau des Auferstandenen mit den Augen des Glaubens eine tatsächliche Erfahrung und nicht „nur“ Einbildung!
Wenn man nun aber an Jesus als den Auferstandenen glaubt, dann kann man auch von seinem irdischen Leben vor seinem Tod Dinge erzählen, die das Wunder seiner Gottessohnschaft oder seiner Auferstehung bildhaft schildern und ausdeuten, auch wenn sie historisch nicht so geschehen sind. Man erlebte Jesus als den lebendigen Sohn des himmlischen Vaters – und erzählte, wie Jesus schon als Kind als Sohn Gottes angebetet wurde, von Hirten und Magiern. Man „wusste“ im Glauben, dass Gott den Gekreuzigten nicht im Grab verwesen lassen konnte und erzählte Geschichten vom leeren Grab. Man glaubte daran, dass Jesus das Gesetz des Mose und die Prophetie des Elia erfüllt hatte und nunmehr als Weltenrichter zur Rechten Gottes im Himmel saß – und erzählte von seiner Verklärung auf einem Berg in der Gegenwart von Mose und Elia.
Recht gebe ich Ihnen, wenn Sie schreiben (S. 71):
„Vielleicht sollte man das Wundersame einfach ohne für den Laien unverständliche, verklausuliert formulierte Kommentare in seiner Unbegreifbarkeit belassen.
Das aber erfordert eine gewisse menschliche Größe. Wer sich selbst als Maß aller Dinge versteht, der ist nicht in der Lage, staunend das Unbegreifbare als solches anzuerkennen. Man kann auch von christlicher Demut sprechen.“
Die Gratwanderung zwischen der Feststellung tatsächlicher Fakten in der Bibel und ihrer Auflösung in Irrtümer einerseits und des Stehenlassens staunenswerter Wunder andererseits fällt aber auch Ihnen nicht gerade leicht. Ich finde, man darf durchaus seinen Verstand walten lassen, um entscheidende Punkte herauszuarbeiten, an denen das Bestaunen des wahrhaft wunderbaren Geheimnisses beginnt, um niemals aufzuhören.
↑ Jesus lag die wahre Erfüllung des Sabbatgebots am Herzen
Zum Stichwort (S. 71) F wie Feiertag erwähnen Sie kommentarlos, welche Strafe für die Übertretung des jüdischen Sabbatgebotes im 2. Buch Mose 31,14 vorgesehen ist:
„Wer den Sabbat entheiligt, muss mit der Todesstrafe rechnen.“
Allerdings verkennen Sie dabei wie bereits mehrfach in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“, dass die hier verwendete Formel MOTh JuMaTh = „der soll des Todes sterben“ keine rechtsverbindliche Todesstrafe bezeichnet, sondern eine drastische Ermahnung in der religiösen Unterweisung der Tora, die vor allem in den Familien unternommen wurde (37).
Hat nun Jesus, wie es in den Evangelien überliefert ist, mit am Sabbat vollzogenen Heilungen gegen das Sabbatgebot verstoßen? Sie bestreiten das vehement (S. 72f.):
„Man muss von einem Irrtum sprechen! Gegen Jesus wurde ein Vorwurf erhoben, den ihm in Wirklichkeit kein Jude gemacht hätte, weil nämlich Jesus gar kein Gesetz übertrat. Entweder die Anklage wurde gegen besseres Wissen erhoben. Oder die biblischen Autoren, die darüber berichten, hatten keine Ahnung von mosaischem Gesetz im Alltag.“
Diese Aussagen begründen Sie allerdings mit widersprüchlichen Argumenten. Zunächst berufen Sie sich auf Pinchas Lapide (38), der „auf einen möglichen Übersetzungsfehler“ hinweist.
„Er meint: Jesus befahl gar nicht dem geheilten Gelähmten, sein Bett zu ergreifen und wegzuschleppen. Durch einen Lesefehler beim Abschreiben sei aus der Anweisung, den Stock („matte“) zu nehmen … der Befehl geworden, sein Bett („mitta“) zu tragen.“
Tatsächlich unterscheiden sich auch in der hebräischen Sprache die Wörter MaTTäH = „Stab“ und MiTTaH = „Bett“ nur durch ihre Vokale, worauf Sie in einem anderen Zusammenhang bereits in Ihrem Lexikon der biblischen Irrtümer hingewiesen hatten.
Allerdings weisen Sie dieses Argument sofort selber zurück:
„Gegen diese Vermutung spricht die Parallelstelle bei Lukas [5,17-26]. Da wird der Mann, der nicht gehen kann, auf seinem Bett zu Jesus geschafft [Lukas 5,18]. Man wird ihn wohl kaum auf einem Stock transportiert haben. Ließ also Jesus den Genesenen doch sein Bett wegtragen? Hat Jesus also doch gegen das mosaische Gesetz verstoßen? Dabei beteuerte er doch, die mosaischen Vorschriften nicht aufheben, sondern bis aufs Tüpfelchen genau befolgen zu wollen [Matthäus 5,17-18].“
Hier sind Sie sich also unsicher, ob Jesus nicht doch das Sabbatgebot verletzt hat.
Allerdings sind Ihre Alternativen wieder einmal zu simpel. Recht haben Sie darin, dass es im Judentum Ausnahmen von der Sabbatruhe gab, etwa „wenn es um Beistand für Kranke ging“, worauf auch Pinchas Lapide (39) hinweist. Aber ob der historische Jesus bewusst den Sabbat brechen wollte oder als Sabbatbrecher beschuldigt wurde, ist nicht mehr feststellbar.
Auf der Erzählebene der Evangelisten spielt allerdings die Auseinandersetzung über die korrekte Gesetzesauslegung durchaus eine Rolle. Natürlich hatte Jesus nicht die Absicht, die göttliche Wegweisung zu übertreten. Er wollte vielmehr den wahren, tiefen Sinn des Sabbatgebotes zur Geltung bringen und erfüllen.
Darum geht es zum Beispiel, wenn Jesus in Markus 2,27 als jüdischer Rabbi das Sabbatgebot folgendermaßen auslegt:
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
Im darauf folgenden Vers wird allerdings angedeutet, dass nur Jesus als der von Gott gesandte Messias das Recht hat, in neuer Weise über den Sabbat zu bestimmen (Markus 2,28):
So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
Auch im Johannesevangelium bleibt Jesus als jüdischem Lehrer der Tora die Erfüllung des Sabbatgebotes ein Herzensanliegen – so Ton Veerkamp (40) in seinem Kommentar zum Johannesevangelium. Zwar bricht Jesus oberflächlich gesehen in den Augen der jüdischen Autoritäten das Sabbatgebot, aber er weist durch solche Akte eines religiösen Ungehorsams, die ihm durch seinen Vater im Himmel aufgetragen sind, darauf hin, dass im Volk Israel unter den Bedingungen der ungerechten Römischen Weltordnung die Tora insgesamt nicht zu erfüllen ist:
„Schabbat ist erst, wenn alle Werke getan sind, wenn alle Menschen heil sind und sie endlich das sind, was sie sind: Ebenbild Gottes.“
↑ Der verfluchte Feigenbaum und Jesu symbolhafte Sprache
Zum Stichwort (S. 73) F wie Feigenbaum plädieren Sie dafür, „sich um Sinn und Bedeutung eines Bibelwortes zu bemühen“, statt „in allen Texten nur Bestätigungen für die eigene vorgefasste Meinung zu sehen“, was ich ebenso begrüße wie Ihren Satz:
„Wer aber Texte des ‚Neuen Testaments‘ immer als ‚Reportagen‘ wahrnimmt, ohne auf symbolische Bedeutungen zu achten, der irrt sich leicht.“
Andernorts erwecken Sie allerdings oft den Eindruck, als ob Sie die biblischen Erzählungen doch als Reportagen nehmen und ihnen Irrtümer vorwerfen, wenn sie widersprüchliche oder unzutreffende Fakten zu enthalten scheinen.
Hier jedoch wenden Sie sich mit Recht insbesondere dagegen, Jesus – von dem das Neue Testament insgesamt „35 Wunder … vermeldet“, davon „21 … allein bei Markus“ – nur als „Wundermann“ zu betrachten.
Eine „Szene aus Jesu Alltagsleben“ (Markus 11,12-14.20-24 und Matthäus 21,18-19), in der Jesus einen Feigenbaum verflucht, weil er keine einzige Feige trägt, wollen Sie demzufolge nicht „als Beweis für Jesu übernatürliche Kräfte“ lesen und nicht (S. 74) als
„Zurschaustellung übernatürlicher Macht. Es ist vielmehr eine symbolhafte Warnung.
Der Feigenbaum steht als Symbol für Israel. (41) Der Feigenbaum ohne Früchte ist Israel ohne Glauben. Die Verfluchung des Feigenbaumes steht symbolisch verschlüsselt für eine mögliche, düstere Zukunft Israels. Man kann Jesu symbolhaftes Handeln auch in Worte fassen – als Mahnung: ‚Israel, du wirst verdorren, wenn du deinen Glauben an Gott aufgibst!‘“
In dieser Richtung hat Andreas Bedenbender (42) intensiv geforscht und dem Thema „Der Feigenbaum und der Messias“ ein ganzes Heft der Zeitschrift Texte & Kontexte gewidmet. Es würde zu weit führen, hier auf alle Feinheiten dieser Auslegung einzugehen.
↑ Wann wurden Apostel ausgesandt – wann Petrus „Fels“ genannt?
Zum Stichwort (S. 74) F wie Fels verstoßen Sie wieder einmal gegen den von Ihnen selbst aufgestellten Grundsatz, dass man besser nach dem Sinn der von den Evangelisten erzählten Einzelheiten als nach ihrer historischen Richtigkeit fragen sollte.
Im Markusevangelium (3,16) erhält der Jünger Simon bereits bei seiner Berufung von Jesus den Beinamen „Petrus“. Matthäus erzählt davon erst viel später (16,18) und ergänzt die Geschichte durch die ihm offenbar wichtige Beauftragung des Petrus mit der Leitung der urchristlichen Gemeinde. Sie betonen in beiden Fällen ausschließlich, dass die beiden Berichte einander widersprechen und zudem historisch unwahrscheinlich sind.
Zum einen schreiben Sie (S. 75):
„So anrührend die Geschichte klingt, sehr wahrscheinlich ist sie nicht. Denn Jesus sprach Aramäisch und nicht Griechisch. Warum sollte er dann einem Jünger einen griechischen Namen verpassen?“
Dieses Argument ist allerdings nicht stichhaltig. Denn die Evangelisten verwenden für Petrus den griechischen Namen, der ihnen bekannt und geläufig war. Paulus, der einige Jahrzehnte zuvor seinen Galaterbrief schreibt, kennt durchaus noch den aramäischen Namen Kephas, den vielleicht doch schon Jesus dem Petrus verpasst haben mag. Petrus ist ja schlicht die Übersetzung des Namens Kephas, beides heißt Fels (43).
Ob allerdings bereits Jesus den Petrus zum späteren Gemeindeleiter bestimmt hat, ist wirklich unwahrscheinlich. Matthäus kennt ihn als einen der Verantwortlichen in der Jerusalemer Gemeinde und schätzt ihn, der Jesus verleugnet, aber Vergebung erfahren hat, als denjenigen Jünger ein, der die entstehende Kirche am besten im Sinne des Herrn Jesus verantwortlich führen kann.
Weiterhin finden Sie es kurios, dass Matthäus von der Umbenennung des Petrus erst im Kapitel 16,18 berichtet, aber bereits im Kapitel 10,2 unter den Namen der zwölf Apostel auch „Simon, genannt Petrus“ aufzählt. Sie wollen dieses Problem dadurch auflösen, dass Sie die „Episode von Kapitel 10“ in die Zeit nach seiner Auferstehung verlegen (S. 75f.):
„Geschildert wird nicht die Berufung der zwölf Jünger, sondern ihre Aussendung! Es geht nicht darum, dass Jesus, bevor er durch das ‚Heilige Land‘ zieht, seine Jünger um sich schart. Es geht um die Aussendung der Jünger. Jesus erteilt ihnen den Missionsbefehl. Er ordnet, an sein nahendes Ende denkend, an, was sie dann zu tun haben.
Im Evangelium nach Lukas wird diese Instruierung der Jünger, anders als bei Matthäus, zeitlich richtig eingeordnet: Jesus erteilt seinen Jüngern Vollmacht, in seinem Namen und Geist zu handeln. Von der inneren Logik her kann diese Episode nur ans Ende einer Jesus-Biographie gestellt werden.“
Und genau hier widersprechen Sie Ihrer eigenen Vorgabe – Sie gehen von Ihren eigenen Vorstellungen einer reportageartig aufgebauten Biographie aus, die chronologisch angeordnet sein muss, und überlegen nicht, warum etwa Matthäus die von ihm in der Apostelliste vorgefundene Information über die Umbenennung des Simon in Petrus (bzw. Kephas) an späterer Stelle noch einmal wiederholt (wie ich es oben getan habe).
Mit der Aussendungsrede ist es ähnlich. Sie irren übrigens, wenn Sie Lukas eine Ihrer „inneren Logik“ entsprechende Chronologie zuschreiben – auch im Lukasevangelium gibt es bereits in Kapitel 10,1 eine Aussendung der Jünger durch Jesus „in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte“. Beide Evangelisten kennen die Aussendung der Jünger in die Welt am Ende ihres Buches, und beide erwähnen zusätzlich eine Aussendung der Jünger bereits zu Lebzeiten Jesu innerhalb Israels (wobei Jesus nach Matthäus 10,5-6 hierbei die Heiden und Samariter zunächst bewusst ausschließt).
↑ Jesus als Verkörperung Israels muss aus Ägypten gerufen werden
Zum Thema (S. 76) F wie Flucht reduzieren Sie Ihre Ausführungen über die Geburtsgeschichten Jesu in der Bibel erneut darauf, dass Sie sie historisch anzweifeln. Ich kann mich nur wiederholen: Sie selber wollten nach dem Sinn der Erzählungen fragen und sie nicht als Reportagen historischer Ereignisse missverstehen! Letzteres tun Sie aber auch hier wieder – und verkaufen den Evangelisten Matthäus für dumm, weil er angeblich nicht weiß, was eine Prophezeiung ist. Jedenfalls enthält Ihr Fazit (S. 78) keinerlei Hinweis auf irgendetwas Sinnvolles in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus:
„Matthäus lässt Jesus nach Ägypten schaffen, um einem Kindermord zu entgehen, der vermutlich nie stattgefunden hat und um eine angebliche ‚Prophezeiung‘ zu erfüllen, die in Wirklichkeit gar keine war. Die von Matthäus so dramatisch geschilderte Flucht finden die Evangelisten Markus und Johannes zumindest nicht erwähnenswert, während sie nach Lukas definitiv überhaupt nicht stattfand.“
Dass beide Kindheitszyklen, sowohl von Matthäus als auch von Lukas, keine historischen Berichte sind, ist in der historisch-kritischen Erforschung der Evangelien ein alter Hut. Beide sind trotzdem insofern wahr, als sie auf je verschiedene Weise die Herkunft der Person Jesu vom Glauben her deuten. Die Evangelisten haben Jesus als Gottes Sohn erfahren und sehen seine Geburt als die Erfüllung aller Verheißungen des Alten Testaments.
Ob Matthäus die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten selber erfunden hat oder ob er eine in den Gemeinden kursierende Erzählung aufgreift, wissen wir nicht. Auf jeden Fall bezieht Matthäus das, was Hosea 11,1 über den erstgeborenen Sohn Gottes schreibt, auf Jesus, der als der Messias Israels nicht nur aus dem Geist Gottes heraus handelt (also die Liebe Gottes verkörpert), sondern auch die wahre Verkörperung Israels darstellt. Diese theologische Deutung dadurch lächerlich zu machen, dass Hosea selbst keine Zukunftsvorausschau beabsichtigt hat, belegt einmal mehr, dass Sie einfach nicht begreifen, in welcher Weise Matthäus als jüdischer Theologe in und mit seiner jüdischen Bibel gelebt hat und wie er alles, was er von seinem Herrn Jesus Christus gehört und im Glauben an ihn erfahren hat, von der Tora und den Propheten her deutet.
Interessant an beiden Geburtsgeschichten sind die Fragen nach der Bedeutung jedes einzelnen Zuges der Geschichte, zum Beispiel die Parallelen zwischen dem alttestamentlichen Josef gegenüber dem Pharao und dem neutestamentlichen Josef gegenüber Herodes. Der Messias Jesus wird nach Matthäus in eine Welt hineingeboren, in dem man einem Herrscher wie Herodes dem Großen durchaus einen Kindermord zutraut (auch wenn er historisch so nie geschehen ist) (44).
↑ Warum beschimpfte man Jesus als Fresser und Weinsäufer?
Zum Stichwort (S. 78) F wie Fresser fragen Sie sich, wie man Jesus, der doch Johannes dem Täufer nahe stand, als „Fresser und Weinsäufer“ (Matthäus 11,19) verunglimpfen konnte. Hat „Jesus zunächst wie die Essener asketisch“ gelebt und dann „einen wirklich gravierenden Gesinnungswandel“ erfahren? Sah sich Jesus durch seine 40tägige Fastenzeit in der Wüste „dazu veranlasst, das Heil der Erlösung nicht mehr in der Selbstkasteiung zu suchen“, sondern „wieder ein normales Leben mit normaler Kost zu führen?“
Wieder einmal versuchen Sie, nach Art einer historischen Reportage und mit den Mitteln psychologisierender Schlussfolgerungen herauszubekommen, wie sich Jesus biographisch entwickelt hat. Aber nirgends steht auch nur eine Andeutung davon, dass Jesus wie Johannes asketisch gelebt hätte. Und es wäre reichlich banal, den Aufenthalt Jesu in der Wüste als Anlass für die Rückkehr zu „normaler Kost“ zu interpretieren, geht es in dieser Geschichte doch um die Auseinandersetzung Jesu mit den Versuchungen der Macht, die mit dem traditionellen Bild des erwarteten Messias zusammenhängen.
Die überlieferte Beschimpfung Jesu (Matthäus 11,19 und Lukas 7,34) als „Fresser und Weinsäufer“ scheint tatsächlich darauf hinzudeuten, dass man seine Lebensweise eben gerade im Gegensatz zu Johannes dem Täufer als nicht-asketisch wahrnahm.
Es gibt allerdings auch andere Deutungen dieser Bezeichnung. Ethelbert Stauffer (45) weist darauf hin, dass man mit ihr
„im antiken Palästinajudentum einen Menschen [bekämpfte], der aus einer illegitimen Verbindung stammte und durch seinen Lebenswandel und Glaubensstand den Makel seiner Geburt verriet“.
Wer sich darauf einlassen möchte, kann sich mit Jane Schaberg (46) beschäftigen, die im Jahr 1987 neutestamentliche und außerbiblische Texte als Reaktion auf eine mündlich verbreitete Überlieferung interpretierte, Jesus sei ein uneheliches Kind von Maria und entstamme der Beziehung zu einem Mann, der sie während der Verlobungszeit mit Josef vergewaltigt habe. Außerdem verweise ich auf meinen Aufsatz Marie, die reine Magd, den ich zu diesem Thema im Jahr 1998 als Diskussionsanstoß im Deutschen Pfarrerblatt veröffentlicht habe.
Sie fragen sich weiterhin, ob man mit der Beschimpfung Jesu nicht vielleicht auch darauf reagierte, dass er (S. 80) „ein ganzes Gesetzeswerk für ungültig“ erklärte. Denn:
„Nach Jesus wird der Mensch nicht unrein durch Speisen, sondern durch Worte und Taten. Unreine Speise scheidet der Mensch, so Jesus, auf natürlichem Wege wieder aus. Worte vergiften das Herz. Deshalb hob er das umfangreiche Reinheitsgebot auf.“
Andererseits fordert Jesus in Matthäus 5,17-20 die Befolgung aller Gebote der Bibel.
„Damit widerspricht sich Jesus aber in ganz massiver Weise selbst. … Was gilt nun? Sind die Reinheitsgebote durch Jesus aufgehoben? Oder muss jedes, auch das noch so unbedeutsam erscheinende Gesetz befolgt werden? Was bleibt, ist Ratlosigkeit, denn niemand kann zwei Worte Jesu befolgen, die sich gegenseitig vollkommen widersprechen!“
Wieder einmal ist dieser Widerspruch aber vermutlich nicht auf den historischen Jesus selbst zurückzuführen. Seine Kritik an der Praktizierung der Speise- und Reinheitsgebote bewegte sich wahrscheinlich durchaus im Rahmen dessen, was unter jüdischen Rabbinern üblich war.
Ganz in diesem Sinne wird auch in Matthäus 15,10-20 Jesu Kritik an der nur äußerlichen Befolgung der Reinheitsgebote überliefert. Dieser Evangelist teilt allerdings, passend zu dem von ihm überlieferten Satz, dass kein Häkchen am Gesetz dahinfallen soll, offenbar nicht die interpretierende Deutung des Markus (7,19): „Damit erklärte er alle Speisen für rein.“ Demzufolge lässt er sie einfach weg.
Darin spiegelt sich eine urchristliche Auseinandersetzung darüber wider, ob Jesu Kritik auf eine vollständige Aufhebung der Speise- und Reinheitsgebote hinauslaufen sollte. Sie blieb zwischen Juden- und Heidenchristen lange umstritten, was man zum Beispiel den Auseinandersetzungen des Paulus mit Petrus (= Kephas) und Jakobus entnehmen kann, von denen Paulus in Galater 2,11-14 berichtet. Dabei hält sogar Paulus die Gesetze der Tora nach wie vor für bindend, soweit es um Juden geht, will sie aber nicht den Heiden auferlegen, die auf den Messias Jesus vertrauen, und er besteht darauf, dass die Reinheitsgebote nicht zur Aufhebung der Tischgemeinschaft innerhalb der Gemeinde führen dürfen.
↑ Jesus reiste nicht von Galiläa nach Galiläa – er startete in Judäa
Im Abschnitt (S. 80) G wie Galiläa wollen Sie auf einen Irrtum im Matthäusevangelium aufmerksam machen, der in Ihren Augen „offensichtlich“ ist, „wenn man den betreffenden Text sorgsam und Wort für Wort liest.“ Und doch stellt sich bei noch sorgsamerer Lektüre, als Sie sie vorgenommen haben, am Ende heraus, dass doch Sie sich hinsichtlich dieses vermeintlichen Irrtums geirrt haben.
Es geht um die kurze Nachricht in Matthäus 4,12:
„Als er (Jesus) aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa.“
Daraus ziehen Sie völlig richtig den Schluss (S. 81):
„Wo er sich bei Entgegennahme der Kunde auch aufgehalten haben mag, es muss außerhalb von Galiläa gewesen sein. Er hätte ja nicht nach Galiläa hasten können, wenn er sich bereits in Galiläa aufgehalten hätte. Denn dann hätte er in Galiläa bleiben können.“
Nun lautet der unmittelbar darauf folgende Vers Matthäus 4,13:
„Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt.“
Hier liegt Ihrer Meinung nach ein eklatanter Irrtum des Evangelisten vor:
„Jesus befand sich also in Nazareth, seinem angeblichen Heimatort. Kaum erhielt er die Kunde über die Verhaftung des Johannes, da verließ er also Nazareth und ging nach Galiläa. Dies besagt der Text ganz eindeutig.
Demnach lag Nazareth außerhalb des Gebiets von Galiläa. Nur wenn Nazareth nicht zu Galiläa gehörte, konnte und musste sich Jesus von Nazareth nach Galiläa aufmachen. Andernfalls wäre er bereits in Galiläa gewesen und hätte in Galiläa bleiben können. Die geographische Realität war aber eine andere. Der Verfasser der zitierten Verse irrt gewaltig!“
Aber schaut man noch genauer hin, liegt nicht bei Matthäus, sondern in Ihrer Argumentation ein Irrtum vor. Denn abgesehen davon, dass kein Evangelist eine faktengetreue Wiedergabe der geographischen Daten aller Reisen Jesu bieten wollte und konnte, ist dennoch auf der Erzählebene des Matthäus an dieser Stelle alles folgerichtig:
Der Text besagt nämlich keineswegs „ganz eindeutig“, dass Jesus sich schon in Nazareth aufhält, als er von der Verhaftung des Johannes erfährt. Nach der Taufe Jesu durch Johannes, die nach Matthäus 3,1.13 am Jordan in Judäa stattgefunden hat, ist Jesus ja zunächst in die Wüste gegangen und dort vom Satan versucht worden. Wo genau Jesus von der Verhaftung des Johannes hört, wird zwar nicht gesagt, aber nach der Logik der Geschichte ist das noch in der judäischen Wüste gewesen, und von dort aus, also von Judäa, begibt er sich zurück nach Galiläa. Dort angekommen, verlegt er seinen zukünftigen hauptsächlichen Wirkungsort aus seiner Heimatstadt Nazareth nach Kapernaum, zumal vermutlich auch Matthäus weiß, was Jesus in Johannes 4,44 bezeugt, „dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt“ (ähnlich auch in Lukas 4,23). Wo liegt also der Irrtum des Matthäus?
↑ Gott erhört alle Gebete, ist aber kein Wunscherfüllungsautomat
Zum Stichwort (S. 82) G wie Gebet behaupten Sie, dass Jesus in Johannes 14,14
„ein Versprechen [gibt], das nie gehalten wurde…: ‚Worum ihr mich bittet in meinem Namen, das werde ich erfüllen.‘ Der gleiche Vers in etwas anderer Übersetzung: ‚Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.‘ Mit anderen Worten: Jesus gibt da so etwas wie eine ‚Erfüllungsgarantie‘, nach dem Motto ‚Wünsche in Gebeten werden immer erfüllt‘.“
Zunächst einmal werfen Sie mehrere Verse des Johannesevangeliums durcheinander. In 14,14 (genau wie schon einen Vers zuvor) sagt Jesus, dass er selbst für seine Jünger tun wird, um was sie ihn in seinem Namen bitten. Genau genommen geht es hier nicht um ein Gebet, sondern um ein Versprechen eines Freundes an seine Freunde (vgl. Johannes 15,13-15). Erst in Johannes 15,16 und 16,23 geht es dann darum, dass Gott, der Vater, ihnen das geben wird, um das sie ihn in Jesu Namen bitten.
Indem Sie darin eine Wünsch-dir-was-Garantie erblicken, machen Sie jedoch diese Jesusworte lächerlich, denn für jeden wahren Gläubigen und so auch für den Evangelisten Johannes ist Gott kein Wunscherfüllungsautomat. Die Frage ist letzten Endes, wie man sich überhaupt eine Gebetserhörung vorstellt und was es bedeutet, wenn Jesus im Johannesevangelium immer wieder von Bitten und Gebeten „in meinem Namen“ spricht.
Bezeichnend ist, dass Jesus in 16,24 den Jüngern vorhält:
Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen.
Offenbar versteht Johannes dieses Bitten in Jesu Namen als ein vollkommenes Sich-Einlassen auf Gottes Willen, denn in Jesus verkörpert sich der heilige NAME des Gottes Israels, und der Gott mit dem unaussprechlichen Namen JHWH will Freiheit und Gerechtigkeit für sein Volk und für die Menschen aller Völker. Unter den Bedingungen des Römischen Weltreichs führt die Verfolgung dieses Ziels den Messias aber zwangsläufig ans römische Kreuz. Aber warum verkündet Johannes trotzdem den Sieg des Messias? Weil er darauf vertraut, dass Waffengewalt die Liebe und den Frieden Gottes nicht töten kann. Der Tod hat nicht das letzte Wort in einer Welt, in der von Trump und Putin bis hin zu Xi Jinping immer noch so genannte starke Männer die Politik dominieren.
Aber auf eine solche Verstehensebene begeben Sie sich gar nicht erst. Sie verweisen (S. 82f.) auf die „Evangelien nach Matthäus und Markus“, wo auch
„Wünsche, im Gebet vorgetragen, erfüllt werden, aber der erhoffte Erfolg wird vom Betenden selbst abhängig gemacht.
Nur wer wirklich daran glaubt, erhält auch, worum er gebetet hat. Wird ein Gebet nicht erfüllt, dann ist es die Schuld des Hilfesuchenden. Am mangelnden Willen, Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, liegt es dann nicht [Matthäus 21,22; vgl. Markus 11,24]: ‚Um alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr es erhalten.‘
Anders ausgedrückt: Wer daran glaubt, dass er erhält, worum er im Gebet ersucht, der bekommt auch, worum er betet. Die Garantie gilt aber nur, solange keine Zweifel aufkommen. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Gebet erhört wird, dessen Gebet wird auch nicht erhört.“
Diese Argumentation möchte ich durchaus ernst nehmen. Denn in der Tat sind diese Worte der Evangelisten oft leider genau in dem von Ihnen (miss-)verstandenen Sinne aufgegriffen worden. Mit Ihrer Kritik daran haben Sie Recht:
„Gerade wenn Zweifel besonders strikt verboten sind, sind sie geradezu vorprogrammiert. … Und gerade besonders fromme Menschen werden bei Nichterfüllung sich selbst die Schuld geben: ‚Da war mein Glaube eben doch nicht stark genug! Ich habe gezweifelt!‘“
Ja: Menschen ihre Zweifel vorzuhalten und sie deswegen zu verurteilen, dass sie nicht genug Glauben haben, ist perfide. Denn Glaube ist ein unverdientes Geschenk, keine fromme Leistung.
Allerdings möchte ich Ihnen doch widersprechen, was die ursprüngliche Bedeutung der von Ihnen zitierten Worte aus dem Matthäus- und Lukasevangelium betrifft. Die Evangelisten wollen Menschen natürlich zum Glauben ermutigen und die Zuversicht vermitteln, dass Glaube (bildlich gesprochen) Berge versetzen kann (47). Aber zumindest Matthäus weiß auch (28,17), dass es sogar unter den Jüngern, die Jesus in die Welt hinaussendet, Zweifler gibt – und sie werden nicht vom Verkündigungsdienst ausgeschlossen!
In den Evangelien nach Matthäus und Lukas muss man beim Bitten in Jesu Namen außerdem an seine eigene Gethsemane-Bitte denken, die eben nicht buchstäblich erhört wird und die er mit den Worten ergänzt (Lukas 22,42 – ähnlich in Matthäus 26,42):
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
Einerseits kann Gott Gebete auf eine Weise erhören, die dem Beter unmittelbar unbegreiflich ist. Andererseits kann in der Bibel ein Beter sogar Gott die Nichterhörung von Gebeten vorwerfen, wie das Hiob und andere Psalmen tun. Sogar Jesus am Kreuz tut das, indem er nach Markus 15,34 bzw. Matthäus 27,46 Worte aus Psalm 22,1 betet:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Hält man sich vor Augen, was von diesen Betern in der Bibel erzählt wird, dann begreift man, dass zumindest Jesus niemanden niedermacht, der an der Nicht-Erhörung eines Gebets verzweifelt. Er selbst hat dieselbe Erfahrung gemacht – und macht es uns vor, dass man Gott genau diese Verzweiflung entgegenschreien darf!
Zum Schluss des Absatzes versuchen Sie wohl, Ihre Vorwürfe gegenüber Jesus ein wenig abzuschwächen, indem Sie unter Berufung auf Gerd Lüdemann (48) den „Vers über die Wunscherfüllung“ in Markus 11,24 als ein unechtes Jesuswort bezeichnen. Erst die urchristliche Gemeinde habe dieses Wort ersonnen. Interessant finde ich aber, dass Lüdemann das „Wort Jesu über die Stärke des Glaubens“ in Vers 11,23 für echt hält, denn es „stellt die Kraft des charakteristischen Glaubens heraus“. Dort heißt es:
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer!, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird’s ihm geschehen.
Würden Sie diese Ankündigung denn für realistischer halten als Vers 24? (49)
↑ Müssen alle Gebote der Bibel befolgt werden?
Unter dem Stichwort (S. 84) G wie Gebote stellen Sie eine sehr gute Frage: „Müssen alle Vorschriften [der Bibel] befolgt werden?“
Es ist tatsächlich nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, zumal nach Matthäus 5,18-19 keins der Gebote der Tora (also der alttestamentlichen Wegweisung Gottes in den fünf Büchern Mose) aufgelöst werden soll. Andere Schriften des Neuen Testaments legen aber doch eine Aufhebung etwa der jüdischen Reinheits- und Speisegebote nahe (etwa Markus 7,19), und bereits die Propheten Israels haben Recht und Gerechtigkeit für wichiger gehalten als die Durchführung aller kultischen Bestimmungen der Tora. Indem jüdische Rabbiner nach den wichtigsten Geboten fragen (so auch Jesus im Gespräch mit einem Schriftgelehrten (50)), ist auch ihnen bewusst, dass es durchaus wichtigere und weniger wichtige Gebote gibt, die zu erfüllen sind.
Die religiöse Partei der Pharisäer, die nach dem Jüdischen Krieg als einzige maßgebende Kraft im Judentum übrig bleibt, vertritt allerdings die Auffassung, dass man durch die Befolgung zusätzlicher Verordnungen sozusagen einen schützenden „Zaun um die Tora“ legen soll, um die Verbote der Tora vor Übertretung zu bewahren.
Insofern haben Sie nicht Recht, wenn Sie behaupten, dass „eine Fülle von Geboten“ im Alten Testament, die in Ihren Augen „einfach obskur sind“, von niemandem befolgt werden. Doch: orthodoxe Juden tun es bis heute.
Seitdem Paulus allerdings den Glauben an den Gott Israels durch das Vertrauen auf den Messias Jesus auch für die Menschen der Völker öffnet, fühlen sich diese „Heidenchristen“ nicht mehr an das gesamte kultische Gesetz der Tora gebunden. Der erwähnte Vers Markus 7,19, demzufolge Jesus „alle Speisen für rein erklärte“, wird schließlich zum Leitgedanken für die christliche Auslegung der biblischen Gebote. Letzten Endes geht es darum, danach zu fragen, inwiefern die Gebote und Verbote Gottes dem befreienden und Recht schaffenden Willen Gottes für alle Menschen entsprechen. So lange es allerdings noch einflussreiche judenchristliche Strömungen in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche gibt, ist auch innerhalb der Christenheit durchaus umstritten, welche Gebote der jüdischen Tora weiterhin gültig sein sollen.
Worauf wollen nun Sie in Ihrem Kapitel zu den Geboten hinaus? Zunächst (S. 84f.) amüsieren Sie sich über die jüdischen Speisegebote (51), da in ihnen der Irrtum vorkommt, die Fledermaus als Vogel zu klassifizieren, und
„der Verzehr von Tieren untersagt [wird], die es gar nicht gibt [3. Mose 11,20]: ‚Auch alles kleine Getier, das Flügel hat und auf vier Füßen geht, soll euch ein Gräuel sein.‘ … Andere ‚Tiere‘ wiederum, die es ebenfalls nicht gibt, werden trotzdem ausdrücklich als erlaubte Speisen genannt [3. Mose 11,21], zum Beispiel solche, die ‚Flügel und vier Füße haben‘, die ‚auf der Erde hüpfen‘.“
Natürlich kann man den Verfassern der Tora nicht die Unkenntnis neuzeitlicher biologischer Zusammenhänge vorwerfen; der Alttestamentler Erhard S. Gerstenberger (52) macht aber doch deutlich, dass sich in 3. Mose 11 „eine schriftgelehrte Genauigkeit bemerkbar“ macht, die durchaus anatomische Gegebenheiten zu beachten versuchte:
„Es ist ein gewisser Stolz zu spüren: Wir haben die Formel gefunden, die zulässige und verbotene Tiere exakt unterscheidet. Scheinbare Ausnahmen sind leicht auf die Hauptregel zurückzuführen, wenn man diese nur richtig versteht: Paarhufige Wiederkäuer oder wiederkäuende Paarhufer müssen es sein. Hinter dieser Generalformel steckt eine intensive Beschäftigung mit der Anatomie des tierischen Fußes und des Verdauungsprozesses. Die unterlaufenen Fehler – Klippdachs und Hase sind z.B. keine Wiederkäuer! – sind auf falsche Deutung des tierischen Verhaltens zurückzuführen und schmälern nicht unsere Anerkennung.“
Weiterhin finden Sie (S. 85) auch im Neuen Testament
„eine Fülle von Geboten, bei denen man fragen muss: Sind sie wirklich zu befolgen? Einige dieser Gebote werden auch im kirchlichen Bereich nicht mehr beachtet.“
Als Beispiele nennen Sie das Verbot Jesu (Matthäus 23,9):
Ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater: der im Himmel.
Aber was meint dieses Gebot konkret? Soll kein Kind den eigenen Vater mit „Papa“ anreden dürfen? Das gewiss nicht. Ob allerdings das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Recht „Papst“, also „Vater“, genannt werden sollte, das ist zwischen den Konfessionen durchaus umstritten, jedenfalls dann, wenn dieser Papst sozusagen als zusätzlich notwendiger Mittler zwischen Gott und den einzelnen Christen missverstanden werden kann.
Weitere von Ihnen angeführte Beispiele haben damit zu tun, dass bestimmte biblische Gebote von vielen Christen als zeitgebunden betrachtet werden, wie etwa Vorschriften bezüglich der „Haartracht“ der Männer (1. Korinther 11,14), des Rederechts der Frauen in der Gemeinde (1. Korinther 14,34) oder auch (S. 86) der Verpflichtung von Frauen, im Gottesdienst eine Kopfbedeckung zu tragen (1. Korinther 11,4-5). Ob es aber Kriterien für eine solche Zeitbedingtheit gibt (und welche das sein könnten), darüber kann man allerdings mit „Fundamentalisten“, die Wert auf die strikte Einhaltung aller Gebote legen, die sie auf Jesus zurückführen, interessante Streitgespräche führen (53).
Leider stellen Sie auch ein Gebot sozusagen an den Pranger, das für viele Christen – so auch für mich – zu ihren Lieblingsworten Jesu gehört, nämlich seine Aufforderung, den Sorgen keine Macht über das eigene Leben einzuräumen, die ihnen nicht zusteht (Matthäus 6,25):
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als das Essen und ist nicht der Leib mehr als die Kleidung?
Sie nennen dieses Gebot „weltfremd“, weil sowohl
„gläubige Kirchgänger wie bekennende Atheisten … heute einen oftmals harten Kampf [führen], um im Leben zurechtzukommen.“
Aber dieser alltäglich Lebenskampf war gerade zu Jesu Zeit sicher noch härter als in unserer immerhin durch Krankenversicherung und Hartz IV abgefederten Gesellschaft. Jesus sagt seine Worte als Wanderprediger, der die Nächstenliebe seiner Mitmenschen erfährt, indem sie ihm Nahrung und Obdach gewähren. Und er weiß durchaus um die Bedürfnisse der Menschen, denn er sagt im selben Atemzug (Matthäus 6,31-33):
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? … Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.
Die Pointe dieser zentralen Botschaft in der Bergpredigt Jesu ist also, dass praktizierte Gerechtigkeit alle Versorgungsprobleme der Menschheit lösen würde (54).
↑ Hatte Jesus Geschwister oder blieb Maria für immer Jungfrau?
Zum Stichwort (S. 87) G wie Geschwister Jesu gehen Sie zunächst auf „Aussagen über Jesu Mutter Maria“ im Neuen Testament ein. Aus Lukas 1,26-38
„geht eindeutig hervor, dass die Empfängnis ohne irdischen Mann erfolgt, wobei die Jungfräulichkeit Mariens erhalten bleibt.“
Und auch Matthäus 1,18-24 spricht Ihnen zufolge
„ausdrücklich von dem Wunder, dass Maria schwanger wurde und dabei Jungfrau blieb.“
Ganz so eindeutig betonen diese Evangelisten allerdings nicht einmal die „Empfängnis ohne irdischen Mann“. Nach Jane Schaberg (55) können beide mit der Deutung, dass Jesus ein Kind von dem Heiligen Geist ist, auch auf Gerüchte reagiert haben, Jesus sei ein uneheliches Kind gewesen. Wie wenig Wert Matthäus und Lukas darauf gelegt haben, die Jungfrauengeburt besonders zu betonen, geht schon daraus hervor, dass das Wort parthenos = „Jungfrau“ auf Maria bezogen in beiden Evangelien nur in jeweils einem einzigen Vers vorkommt (Matthäus 1,23 und Lukas 1,27).
Interessant ist, dass Matthäus das Wort sogar nirgends im eigenen Text verwendet. Er greift es nur in einem Zitat aus Jesaja 7,14 auf. Wie Sie selbst (S. 88) schreiben, steht dort im hebräischen Text allerdings das Wort ˁALMaH = „junge Frau“, nicht das Wort BeThULaH = „unberührte Jungfrau“. Sicher kann Matthäus aus der griechischen Übersetzung der Bibel das Wort parthenos übernommen haben; aber ich traue dem Matthäus bei seiner oft eigenwilligen Art, auf das Alte Testament zurückzugreifen (56), durchaus zu, dass er auf diese Weise in der Schwebe lassen will, wer der leibliche Vater Jesu war. Wichtig ist ihm, deutlich zu machen: Jesus ist kein Bastard, sondern ein von Gott gewolltes, geheiligtes Kind!
Dass Maria auch nach der Geburt Jesu Jungfrau bleibt, davon ist in keinem Evangelium auch nur andeutungsweise die Rede. Matthäus erwähnt in 1,25 sogar ausdrücklich, dass Josef bis zur Geburt Jesu nicht mit Maria schläft, woraus folgt, dass er es für die Zeit danach eben nicht ausschließt. Beide Evangelisten erwähnen im Übrigen ganz selbstverständlich (Matthäus 12,46-47 sowie 13,55-56 und Lukas 8,19-20) die Existenz von Geschwistern Jesu.
Die Frage, die Sie in der Überschrift dieses Abschnitts aufwerfen (S. 87), ob Jesus „Brüder und Schwestern“ hatte, ist also ganz einfach mit einem glatten Ja zu antworten. Jeder Zweifel daran ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass sich seit dem von Ihnen erwähnten (S. 88) „Protoevangelium des Jakobus“ in der dann entstehenden katholischen Kirche die Tendenz immer mehr verstärkte, die (S. 89) „ewig währende Jungfrauenschaft Mariens“ herauszustellen und sogar zum Dogma zu erheben.
Es ist also nicht so, dass DIE Theologie „sich schwer mit diesen Brüdern und Schwestern Jesu“ tut, sondern lediglich die katholische Dogmatik. Paulus erwähnt (Galater 1,19 und 2,9) ganz selbstverständlich den Herrenbruder Jakobus, und Markus 6,3 zählt vier Brüder Jesu namentlich auf. Ich erspare es mir, auf die vergeblichen Versuche der katholischen Kirche einzugehen, diese Geschwister wegzuinterpretieren.
Immerhin schreibt inzwischen (S. 93) ein katholischer Theologe wie Wolfgang Bienert (57):
„Doch setzt sich neuerdings auch in der katholischen Forschung mehr und mehr die Überzeugung durch, dass eine ‚unvoreingenommene Exegese‘ (Auslegung) nur die Feststellung erlaube, dass (Markus Kapitel 6, Vers 3) die Namen von vier leiblichen Brüdern und die Existenz von leiblichen Schwestern historisch bezeugt sind.“
↑ Jesu Abschied von den Jüngern – nicht nur im Garten Gethsemane
In Ihren Ausführungen (s. 94) über G wie Gethsemane gehen Sie auf Widersprüche in den Erzählungen der Evangelisten von Jesu Gefangennahme im Garten Gethsemane ein. In Ihrem Fazit stellen Sie durchaus richtig fest (S. 96):
„Haben die Verfasser der Evangelien also gelogen? Sie haben geglaubt und schilderten die Gethsemane-Szene so, wie sie nach ihrem Glauben abgelaufen sein muss.“
Genauer gesagt: Die Evangelisten greifen sicher auf überlieferte Erinnerungen an Jesu Gefangennahme zurück, die seiner Kreuzigung vorausging, aber niemand kann sagen, unter welchen Umständen sie historisch genau vor sich gegangen ist. Entscheidend ist für die Evangelisten, dass sie von ihrem Glauben her den Umgang Jesu mit seinem bevorstehenden Schicksal und mit dem Versagen seiner Jünger auf ihre jeweils eigene Weise schildern. Sie betreiben zwar keine dogmatische Systematik, aber auch keine historische Geschichtsschreibung, sondern sie entfalten ihre Theologie als Erzählung des Glaubens.
Indem Sie sich aber wieder vorwiegend auf die Ebene der historischen Geschichte begeben, nehmen Sie zunächst irrtümlich an, dass Johannes sich in den Tatsachen geirrt haben muss, denn als (Johannes 12,27-29) Jesu betrübtes Gebet über sein bevorstehendes Leiden durch eine „Stimme vom Himmel“ her beantwortet wird, missversteht „das Volk, das dabeistand und zuhörte“, diese Stimme als Donner, und Sie fragen sich:
„Welches Volk? War Jesus nicht allein mit seinen Jüngern?
Nach den Evangelisten Matthäus [26,36-46], Markus [14,32-42] und Lukas [22,39-46] war Jesus nur in Begleitung von elf seiner Jünger, Judas fehlte natürlich. Von ‚Volk‘, das dabeistand, kann nicht die Rede sein. Und während sich Jesus nach Johannes entschlossen in sein vorbestimmtes Schicksal fügt, bittet er bei den synoptischen Evangelisten Gott darum, ihm den ‚Kelch‘ bitte zu ersparen.“
Auf den Erzählebenen der Evangelisten bringen Sie hier einiges durcheinander. Denn in Johannes 12 befindet sich Jesus noch lange nicht im Garten seiner Verhaftung (diese schildert Johannes erst in Kapitel 18 (58)), sondern er hält sich (Johannes 12,20ff.) während eines Festes in Jerusalem auf, und außer einigen seiner Jünger sind „einige Griechen“ und anderes Volk in seiner Nähe.
Recht haben Sie darin, dass Johannes die Episode mit dem verzweifelten Gebet Jesu und dem Schlaf der Jünger im Garten Gethsemane weglässt. Er setzt ganz andere Akzente als die synoptischen Evangelien. So ersetzt er in 13,1-30 die Erzählung vom Abendmahl durch die Fußwaschung, fügt in 13,31 – 16,33 lange Abschiedsreden Jesu von seinen Jüngern hinzu und formuliert in 17,1-26 ein ausführliches Gebet Jesu, in dem dieser als Sohn Gottes vor allem seine Einheit mit dem Vater im Himmel herausstellt und bei ihm für diejenigen eintritt, die zu ihm gehören.
Markus, Matthäus und Lukas dagegen betonen mehr Jesu wahre Menschlichkeit im Umgang mit seinem Leiden und auch sein Leiden an der menschlichen Unvollkommenheit seiner Jünger. Zu Letzterem schreiben Sie (S. 96):
„Die Männer, auf die er sich verlassen zu können meinte, haben ihn allein gelassen, als er dringend Beistand gebraucht hätte. Als er sie nötiger als je zuvor in seinem Leben gebraucht hat, schlafen sie selig ein.“
Die Evangelisten meinen aber sicher kein „selig“ unbekümmertes Ruhen. Die Wortwahl in Lukas 22,45 ist auch Ihnen aufgefallen:
Er [Jesus] fand sie schlafend vor Traurigkeit.
So deutet Lukas tatsächlich eine lähmende Trauer (oder vielleicht auch Angst) an, die die Jünger zur Solidarität unfähig macht. Ähnlich sprechen Markus in 14,40 und Matthäus in 26,43 wörtlich davon, dass „ihre Augen beschwert“ waren (so die Elberfelder Bibel 2006; griechisch: katabarynomenoi bzw. bebarēmenoi).
↑ Was heißt „in den Himmel kommen“ und wie schafft man das?
Zum Stichwort (S. 96) G wie Glaube entwickeln Sie zunächst ein sehr einseitiges Bild vom religiösen Glauben. Umstritten ist heute schon die Frage, ob es überhaupt „ein Merkmal des Menschseins“ ist, „religiösen Glauben zu entwickeln“, oder ob es nicht auch Menschen gibt, wie ich bei Hildegard König (59) gelesen habe, die „religiös unmusikalisch“ sind. Die meisten religiös empfindenden Menschen wiederum, die ich kenne, denken nicht in so simplen Kategorien, wie Sie sie umschreiben:
„Dem oft harten und strapaziösen Dasein, so hofft man, folgt im Jenseits eine besserer Welt. Dort wird der Fromme belohnt. Der Böse hingegen erhält dieses Privileg nicht. Er wird bestraft und wandert in die Hölle, wo er schlimme Qualen aushalten muss. Natürlich strebt dann jeder Mensch in den Himmel. Wer möchte schon in der Hölle schmoren?“
Das ist bestenfalls die Karikatur einer Religion, wie sie sicherlich leider oft genug auch zur Machterhaltung religiöser oder weltlicher Führer eingesetzt worden ist. Aber dem eigentlichen Anliegen der Religionen, wie ein wahrhaft menschliches Leben nach angemessenen ethischen Normen möglich ist, durch das man im Frieden mit Gott, mit seinen Mitmenschen mit der Schöpfung und sich selbst leben kann, werden diese salopp hingeworfenen Bemerkungen nicht gerecht.
Abgesehen davon gehören die Bilder von Himmel und Hölle nicht zum Inventar aller Religionen. Es ist ein Missverständnis des Buddhismus, wenn Sie schreiben (S. 97):
„Gute Taten sichern ein gutes Leben nach dem Leben zu.“
Nein, eben nicht. Ein buddhistisch Erleuchteter kennt gerade kein besseres Leben nach dem Tod, sondern sehnt sich nach dem Nirwana als der Beendigung aller leidvollen Kreisläufe des Lebens.
Im Christentum gibt es allerdings tatsächlich die Bilder von Himmel und Hölle, um die Folgen eines Lebens anzudeuten, das dem Willen Gottes entspricht oder eben nicht. Aber schon in der Bibel sind das nicht die einzigen Vorstellungen, die mit einem erfüllten oder Gott wohlgefälligen Leben zusammenhängen.
Das Alte Testament beispielsweise kennt außer einzelnen Stellen in den Prophetenbüchern oder im Blick auf die Himmelfahrt einzelner Menschen wie Henoch oder Elia keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Ein gerechtes Leben (1. Könige 5,5) „unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum“ zu führen und (1. Mose 25,8) „alt und lebenssatt“ zu sterben, ist das Ziel eines aufrechten Israeliten. Und das wissen Sie ja auch, denn Sie zitieren selber Hiob 7,9-10:
Eine Wolke vergeht und fährt dahin: so kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt; er kommt nicht zurück, und seine Stätte kennt ihn nicht mehr.
Für Sie ist allerdings diese skeptische Sichtweise in einer Zeit, in der ein glaubender Israelit seine Zweifel an einem gerechten Gott genau vor diesem Gott zu klagen wagt, nur wieder Anlass, Widersprüche in der Bibel anzuprangern. Gerade diese Vielfalt religiöser Sichtweisen macht aber den Reichtum der Bibel aus!
Seit dem Buch Daniel und den Makkabäerbüchern entwickelt sich auch im Judentum der Glaube an die Auferstehung, den zur Zeit Jesu (Markus 12,18; Matthäus 22,23; Lukas 20,27) bereits die Pharisäer gegen die Sadduzäer vertreten und der im Christentum zu einer zentralen Lehre wird. Heutzutage ist wiederum unter Christen umstritten, ob man unter Auferstehung ein leiblich-körperliches Geschehen zu verstehen hat oder eins von vielen Bildern für das Geheimnis, dass die Menschen mit dem Tod nicht verloren gehen, sondern in der Liebe Gottes aufbewahrt bleiben.
Zurück zur bildlichen Redeweise vom „in den Himmel kommen“, die Jesus in seiner apokalyptischen Denkweise wohl eher diesseitig verstanden hat, nämlich als Zugehörigkeit zum kommenden Friedensreich oder „Königtum Gottes“ und die erst in der späteren Lehre der Kirche sehr vereinseitigt auf eine Jenseitshoffnung reduziert wurde.
Richtig ist, dass es nicht erst in der Reformationszeit Streit darüber gab, welche Rolle der Glaube und das Tun guter Werke bei der Qualifikation für den Himmel spielen. Aber ähnlich wie im letzten Kapitel bei der unterschiedlichen Sichtweise des Abschieds Jesu von seinen Jüngern durch die Synoptiker und Johannes sehe ich auch in den gegensätzlichen Standpunkten von Paulus und Jakobus letztlich Perspektiven, die sich ergänzen, aber nicht ausschließen müssen.
Sicher betont Jakobus 2,20 und 24, „dass der Glaube ohne Werke tot ist“ und „dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein“, und Martin Luther hat den Jakobusbrief wegen dieser Worte im Rang niedriger eingestuft als andere biblische Schriften. Aber es ist ein Missverständnis, dass der Apostel Paulus keinen Wert auf die Erfüllung des Willens Gottes legen würde, sagt er doch in 2. Korinther 5,10 (ähnlich auch in Römer 14,10):
Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse.
Der scheinbar so klare Widerspruch zu Jakobus und auch innerhalb der Paulusbriefe kann dann überwunden werden, wenn man sich klar macht, was es für Paulus bedeutet (Römer 3,20), dass „durch des Gesetzes Werke … kein Mensch vor [Gott] gerecht sein“ kann. Man kann Galater 2,16 so verstehen, dass der Mensch nur „durch den Glauben an Jesus Christus“ dazu fähig wird, barmherzig zu leben und auf diese Weise die Werke des Gesetzes zu erfüllen. Mithin sind auch für Paulus die Taten des Glaubens und der Liebe wesentlich. Aber kein Mensch kann sich durch solche Taten den Himmel verdienen, er kann sich auf sie nichts einbilden, er wäre gar nicht in der Lage dazu, sie zu tun, wenn er nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu befähigt würde.
Merken Sie, wie wenig Sie also (S. 98) mit Ihrem „Schlussfazit“ den tatsächlichen religiösen und ethischen Anliegen der biblischen Autoren gerecht werden? Sie stellen zwar ganz richtig fest:
„Widersprüchlich sind die Aussagen der Bibel, wie man und ob man in den Himmel kommt.“
Aber wie gesagt – genau darin besteht die Herausforderung, aus der Vielfalt der sich oft ergänzenden biblischen Aussagen sinnvolle Lehren für das eigene Leben zu ziehen. Religion und Ethik sind eben nicht so simpel, wie Sie am Anfang dieses Kapitels angenommen haben.
↑ Manipulierte Bibelübersetzungen aus dogmatischen Gründen?
Unter dem Titel (S. 98) G wie Gotteslästerung beschäftigen Sie sich mit angeblich manipulierten Übersetzungen der Bibel, die vertuschen sollen, dass Jesus noch nichts von der Dreieinigkeit wusste. Wie kommen Sie darauf?
Sie zitieren Markus 3,28-29 nach der Lutherbibel von 1912:
„Wahrlich, ich sage euch: ‚Alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Gotteslästerungen, womit sie Gott lästern; wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts.‘“
Dabei betonen Sie, dass Luther korrekt übersetzte. Wieso betonen Sie das gerade hier? Weil in allen anderen Übersetzungen und auch in den neueren Revisionen der Lutherbibel von 1984 und 2017 nur noch von „Lästerungen“ statt von „Gotteslästerung“ die Rede ist, und auf die Lästerung „Gottes“ kommt es Ihnen im Folgenden an. Denn:
„Die Aussage Jesu ist klar: Wie alle Sünden wird auch die der Gotteslästerung vergeben. Ausgenommen aber wird die Lästerung gegen den Heiligen Geist.“
Und diese Ausnahmeregelung (welchen Grund sie auch immer haben mag), ist in Ihren Augen
„unvereinbar … mit der Lehre von der Dreifaltigkeit. Gottvater, Sohn und Heiliger Geist sind demnach eins. Wie kann dann Gotteslästerung vergeben werden, Lästerung gegen den Heiligen Geist aber nicht – wo doch beide ein und derselbe sind? Es gibt nur eine plausible Erklärung: Jesus wusste nichts von der Dreifaltigkeit.“
Wieder einmal irren Sie mit einer so simplen Schlussfolgerung.
Zwar konnte Jesus die von der späteren christlichen Kirche festgelegte Lehre von der Dreieinigkeit Gottes noch nicht kennen. Aber Ihre Schlussfolgerung bleibt trotzdem falsch.
Denn auch, wenn Gottvater, Jesus als Sohn Gottes und der Heilige Geist in biblischen Zeiten noch nicht dogmatisch als eine Einheit in drei göttlichen Personen verstanden wurden, so gehört doch der Geist Gottes schon im Alten Testament untrennbar zu Gott hinzu. Der Heilige Geist ist kein anderes Wesen, schon gar nicht ein anderer Gott, sondern er ist die Kraft, mit der Gott in der Welt wirkt (so sehen ja auch die Evangelisten Matthäus und Lukas den Heiligen Geist bei der Empfängnis Jesu in Maria am Werk). Und indem Jesus den Geist Gottes bei seiner Taufe empfängt, sehen bereits alle Evangelisten den Sohn Gottes dadurch mit dem Vater im Himmel vereinigt, dass die Kraft und die Liebe des Einen Gottes in wahrer Vollkommenheit auf ihn herabkommt.
Zugleich aber verkennen Sie den Sinn der Dreifaltigkeitslehre, wenn Sie übersehen, dass auch aus dieser Perspektive die drei göttlichen Personen nicht einfach identisch werden. Es sind drei unterschiedliche Arten und Weisen, in denen wir Menschen Gott erfahren – Gott als unsichtbaren Vater über uns, Gott im Sohn als Mitmenschen und Bruder neben uns (so wie Gott sich den Menschen als Ebenbild seiner Liebe vorgestellt hat), und Gott als Kraft der Liebe des Geistes, die in uns wirkt und uns verändern kann.
Insofern könnte gerade die Unterscheidung, die Jesus trifft, sogar belegen, dass schon er zwischen Erfahrungsweisen Gottes unterschieden hat, die erst später in der Dreieinigkeitslehre dogmatisch festgeschrieben wurden. Was er allerdings damit gemeint haben kann, dass die Lästerung des Vaters im Himmel und des Sohnes auf Erden vergeben werden kann, aber nicht die Lästerung des Geistes, dieses Problem bleibt schwierig zu lösen. So stellen Sie die Frage (S. 99):
„Wusste Jesus selbst, was man sich unter dem Heiligen Geist vorzustellen hat? Warum wertet er das Delikt als schwerste unverzeihbare Sünde? Das muss merkwürdig erscheinen, da ansonsten der Heilige Geist in den Reden von Jesus so gut wie keine Rolle spielt.“
Aber wieder irren Sie sich im letzten von Ihnen genannten Punkt. In den Evangelien erwähnt Jesus den Heiligen Geist auch noch an anderen Stellen (Markus 12,36 und 13,11; Lukas 11,13; 12,12; Johannes 14,26; 20,22). Es mag zwar sein, dass erst die spätere christliche Gemeinde Jesus all diese Worte in den Mund gelegt hat, aber dadurch wird nicht das Problem gelöst, ob nicht doch ein tieferer Sinn in diesem Wort steckt, ganz gleich, von wem es zuerst formuliert worden ist.
Mir erscheint die folgende Erklärung am plausibelsten: Der Geist ist ja die Art, wie Gott die Menschen berührt, bewegt, verändert. Menschen, die diese verändernde Kraft leugnen, sind möglicherweise „zu“ für Vergebung. Vielleicht will Jesus das andeuten (oder ein späterer Christ tut es in seinem Namen).
Aber noch einmal zurück zur in Ihren Augen angeblich einzig korrekten Lutherübersetzung von Markus 3,28. Sie behaupten (S. 99):
„Der griechische Originaltext spricht eindeutig davon, dass Gotteslästerung vergeben, Lästerung wider den Heiligen Geist hingegen aber unverzeihlich sei. Die gleichen Bibelausgaben, die die Gotteslästerung verschwinden lassen, übersetzen an anderer Stelle korrekt. So sagen an anderer Stelle bei Markus die Schriftgelehrten [2,7]: ‚Was redet dieser so? Er lästert Gott!‘ Und das Evangelium nach Matthäus lässt den Hohen Priester empört seine Kleider zerreißen und ausrufen [26,65]: ‚Er hat Gott gelästert!‘“
Wieder irren Sie. Denn im griechischen Urtext steht an allen drei Stellen, die Sie hier zitieren, lediglich das griechische Verb blasphēmeō bzw. das Substantiv blasphēmia, und zwar ohne Hinzufügung des Wortes Gott. Das hat einen einfachen Grund. Das Wort hatte ohnehin die Grundbedeutung „Gotteslästerung“, es wurde ja sogar als Lehnwort „Blasphemie“ ins Deutsche übernommen. Es kann aber auch für die „Lästerung“ gegen Menschen (etwa in Markus 15,29 gegen Jesus am Kreuz) oder eben auch gegen den Heiligen Geist (wie in Markus 3,29) verwendet werden.
Luther übersetzte das Wort blasphēmeō in Markus 2,28 im Jahr 1545 noch mit „Gott lästern“ (obwohl da nicht ton theon stand), konsequenterweise hätte er dann den folgenden Vers blasphēmēsē eis to pneuma to hagion eigentlich mit „den Heiligen Geist gotteslästern“ übersetzen müssen.
Warum reite ich so auf diesen Feinheiten herum? Weil Sie ja eben aus der ungenauen alten Lutherübersetzung verschwörungstheoretische Schlussfolgerungen ziehen – mit dem Fazit (S. 99):
„Gott ist aus vielen gängigen Übersetzungen getilgt worden. Somit ist der eklatante Widerspruch zur Dreifaltigkeitslehre geschickt aus der Welt geschafft worden.“
Aber wie ich oben gezeigt habe, besteht weder ein Widerspruch des Jesuswortes zur Dreifaltigkeitslehre noch eine bewusste Tilgung Gottes aus Übersetzungen der Bibel.
↑ Kann sich die Zwei-Reiche-Lehre Luthers auf Jesus berufen?
Zum Stichwort (S. 100) G wie Götzendienst beschäftigen Sie sich mit der Verweigerung der Anbetung falscher Götter durch die Juden. Wer als frommer Jude zur Zeit Jesu konsequent war, der musste auch die Zahlung von „Steuern direkt an Rom“ mit Münzen, „die das Abbild des Kaisers trugen“, als Götzendienst empfinden. In diesem Zusammenhang sehen Sie auch mit Recht
„die Frage der Pharisäer an Jesus … [Matthäus 22,17 und Lukas 20,22]: ‚Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahle?‘ Jesu Antwort ist bekannt [Matthäus 22,19-21 und Lukas 20,24-25]. Er ließ sich eine Steuermünze mit dem Abbild des Kaiser geben und fragte: ‚Wessen Bild ist das?‘ Die Antwort lautete: ‚Des Kaisers!‘ Und Jesus erwiderte: ‚So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist!‘“
Sie legen weiterhin dar (S. 102), dass sich Jesus damit „allem Anschein nach geschickt aus der Affäre gezogen“ hat. Und es schien nur konsequent, dass Martin Luther auf diesem Jesuswort seine „Zwei-Reiche-Lehre“ aufbaute, derzufolge (S. 103)
„Obrigkeit und Kirche … zwei separate Welten [waren], zwei ‚Reiche‘. Und der Christ hatte der Obrigkeit zu geben, was der Obrigkeit zustand und der Kirche (Gott!), was der Kirche zustand.“
Aber wird eine solche Interpretation dem ursprünglichen Sinn des Jesuswortes gerecht? Sie zweifeln das an:
„Luthers Zwei-Reiche-Lehre mag sich auf das übersetzte Jesus- Wort stützen, das griechische Original aber fordert genau das Gegenteil. Lesen wir in den Übersetzungen ‚geben‘, so steht stattdessen im griechischen Original ‚apodote‘, zurückgeben! Korrekt übersetzt fordert also Jesus: ‚Gebt dem Kaiser zurück, was dem Kaiser gehört!‘“
Diese Sichtweise wird unterstützt von Andreas Bedenbender (60), der Jesu Antwort so versteht, dass Jesus sich dem römischen Markt und seinen Steuern völlig entzieht. Könnte man das evtl. so in die heutige Zeit übertragen, dass wir uns durch Jesus ermutigen lassen, uns nicht allen Spielregeln des kapitalistischen Marktes so zu unterwerfen, wie das häufig als selbstverständlich angesehen wird?
Einfach ist die Frage allerdings nicht zu beantworten, wie das Wort Jesu in eine Zeit zu übertragen ist, in der seine apokalyptische Naherwartung sich eben nicht erfüllt hat und in der es Staatsordnungen gibt, die differenziert zu beurteilen sind, da sie durchaus Ordnungsfunktionen wahrnehmen, die Gottes Willen entsprechen (für die Sicherheit der Staatsbürger sowie Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, Freiheitsrechte durchzusetzen usw.). Bereits im Neuen Testament setzen sich verschiedene Schriften durchaus unterschiedlich mit diesen Themen auseinander (zum Beispiel Paulus in Römer 13 und der Apokalptiker Johannes in Offenbarung 13).
↑ Nicht nur das Wort vom „Hand-Abhacken“ ist bildlich zu verstehen
Zum Stichwort (S. 104) H wie Hand abhacken weisen Sie zu Recht darauf hin, dass Jesus diesbezügliche Aufforderung in Matthäus 5,30 bildlich gemeint ist. In der aramäischen Muttersprache Jesu (61) hatte der
„Befehl ‚Hacke deine Hand ab von …‘ … im übertragenen Sinn die konkrete spezifische Bedeutung: ‚Stiehl nicht.‘ Gleichzeitig hat das Bild noch eine allgemeinere Bedeutung im Sinne von: ‚Höre auf damit! Lass dies nicht zur schlechten Gewohnheit werden!‘ So lässt sich die Anweisung Jesu übersetzen: ‚Wenn du eine schlechte Angewohnheit hast, so gib sie auf! Es ist besser, man gibt eine einzelne schlechte Angewohnheit auf, als dass man deswegen in die Hölle kommt!‘“
Dieser einleuchtenden Erklärung fügen Sie dann allerdings noch einen fragwürdigen Vergleich mit der jüdischen Bibel an:
„Wenn das ‚Alte Testament‘ die Todesstrafe für Homosexualität fordert [3. Mose 20,13], so ist diese eine heute völlig unakzeptable Forderung. Wenn Jesus vom ‚Hand abhacken‘ spricht, kann damit ein sinnvoller Rat gemeint sein.“
Gerade wenn Sie diese beiden Fälle miteinander in Verbindung bringen, fragen Sie sich leider zu wenig kritisch, ob es nicht auch schon im Alten Testament um eine drastische Ermahnung gegangen ist, die niemals geltendes Recht war geschweige denn jemals in die Tag umgesetzt worden ist (62).
↑ War Jesus ein Obdachloser oder ein Hausbesitzer?
Zum Stichwort (S. 105) H wie Haus fragen Sie sich allen Ernstes, ob Jesus tatsächlich als armer Wanderprediger „mit seinen getreuen Jüngern rastlos von Ort zu Ort“ zog oder (S. 106) ob er nicht doch vielmehr ein „Hausbesitzer“ war. Letztere Vermutung begründen Sie unter Berufung auf den Bibelkritiker C. Dennis McKinsey (63) mit Markus 2,15:
Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus…
Diese Situation interpretieren Sie wie folgt:
„Heißt das, dass Jesus Hausbesitzer war? Die Situation im Zusammenhang: Jesus lehrte eben noch das Volk am See. Dann entdeckt Jesus den Zöllner Levi, der wohl am Straßenrand saß und seiner Arbeit nachging, also Abgaben von Passanten kassierte. Jesus fordert den Zöllner auf, ihm zu folgen. Ohne zu zögern gehorcht der Mann. Wohin geht man? In ein Haus. In wessen Haus? Jesus lädt den Zöllner ein, ihn doch zu begleiten. Da liegt die Vermutung nahe, dass man in das Haus Jesu ging – und nicht in das Haus des Zöllners. Schließlich ist es der Zöllner, der Jesus und seiner Gruppe folgt.“
Diese Vermutungen beruhen aber auf falschen Voraussetzungen.
- Jesu Ruf zur Nachfolge ist keine Einladung, ihn in einem vordergründigen Sinn zu begleiten oder zu Hause zu besuchen, sondern ihm auf seinem Weg als Wanderprediger zu folgen bzw. im übertragenen Sinn nach seinen Lehren zu leben.
- Auf der Erzählebene ist schon die ganze Fragestellung absurd, weil die Evangelisten Jesus ganz selbstverständlich überall als den Wanderprediger schildern, der die Häuser nutzt, die ihm von Unterstützer(inne)n angeboten werden. Selbst wenn manche Formulierungen missverständlich klingen, meinen die Evangelisten natürlich nicht, dass Jesus nur nach außen hin so tut, als sei er ein armer Obdachloser, aber in Wirklichkeit schwelgt er im Reichtum. Darum gehört das hier erwähnte Haus zweifellos dem Zöllner. Andernorts, wo Jesus „im Hause“ ist, ist etwa das Haus der Schwiegermutter des Petrus in Kapernaum gemeint, das wohl zeitweise als sein Hauptwohnsitz dient.
Noch einen weiteren Irrtum des Markus und Lukas meinen Sie aufgespürt zu haben, weil sie den Zöllner Levi nennen, den Matthäus „Matthäus“ nennt (64). Daraus ziehen Sie den Schluss:
„Es wird klar, wie erschreckend wenig über die wichtigsten biographischen Daten Jesu bekannt ist! Eine echte Jesus-Vita fällt da recht kurz aus!“
Genau so ist es. Das war schon das Fazit von Albert Schweitzer (65) gewesen, als er eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung schrieb: Über den historischen Jesus weiß man tatsächlich sehr wenig. Insofern sollte man einfach die Frage, wie der Zöllner wirklich hieß, als belanglos auf sich beruhen lassen.
↑ Himmelfahrt – ein Bild für unterschiedliche Glaubenserfahrungen
Ihren Abschnitt über (S. 107) H wie Himmelfahrt leiten Sie mit dem Satz ein:
„Eine Aussage muss klar und eindeutig sein, damit man sie eindeutig widerlegen kann. Das trifft in besonderem Maße auf Jesu Aussage über seine Himmelfahrt zu.“
So Recht Sie damit haben, so wenig beherzigen Sie Ihre eigene Einsicht. Denn Sie verkennen wieder einmal, wie vielschichtig biblische Aussagen sein können, und Sie gehen wieder einmal selbst in die Irre, weil Sie biblische Aussagen über Himmelsreisen von Menschen oder den Abstieg einer als himmlisch verstandenen Gestalt wie Jesus zur Erde oder ihren Wiederaufstieg zum Himmel als historische Angaben missverstehen und sie außerdem in unzulässiger Weise über einen Kamm scheren.
Um welche biblische Stellen geht es? Sie zitieren Johannes 3,13:
„‚Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist.‘ Übersetzt man den Text aus dem Griechischen, so wird die Aussage Jesu noch deutlicher: ‚Und niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer des Menschen Sohn …‘“
Dieser Aussage Jesu widerspricht es Ihrer Auffassung nach ganz eindeutig, dass nach 1. Mose 5,24 und Hebräer 11,5 bereits Henoch von Gott in den Himmel „weggenommen“ wurde und nach 2. Könige 2,11 auch der Prophet Elia „im Wetter gen Himmel“ fuhr. Daraus ziehen Sie den Schluss:
„Jesu konkrete Aussage über seine Himmelfahrt ist also ganz eindeutig ein Irrtum! Jesus war nicht der Erste!“
Vordergründig ist das zwar richtig, aber jede der drei Himmelfahrten (Henoch, Elia, Jesus) wird in einem jeweils anderen Zusammenhang erzählt und bedeutet demzufolge auch etwas anderes. Hinzu kommt im Neuen Testament, dass der Evangelist Lukas mit seinen zwei unterschiedlichen Himmelfahrtserzählungen noch einmal einen anderen Akzent setzt (nämlich den der Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe: Lukas 24,49 und Apostelgeschichte 1,8) als Johannes an der von Ihnen zitierten Stelle. Folgendes zu Johannes:
- Johannes 3,13 ist definitiv eine theologische Aussage des Evangelisten, die er Jesus in den Mund legt. Also wenn sich hier jemand geirrt hat, dann wäre es nicht der historische Jesus gewesen, sondern Johannes.
- Johannes geht es nicht einfach darum, dass ein sterblicher Mensch wie Henoch „in den Himmel kommt“ oder eine Himmelsreise unternimmt, bei der er Dinge über den Himmel erfährt, sondern dass Jesus als Menschensohn identisch ist mit dem göttlichen logos (= „Wort“, gleichzusetzen mit der hebräischen ChaKMaH = sophia = „Weisheit“), der vom Anbeginn der Schöpfung bei Gott war (vgl. Johannes 1,1 mit Sprüche Salomos 8,22-31 (66)). Dieser Menschensohn ist also eine ursprünglich göttliche Gestalt, die von Gott her aus dem Himmel herabgestiegen und Mensch geworden ist; daher kann Jesus (Johannes 12,30) alle Menschen mit sich hinaufziehen. Das kann man weder von Henoch noch von Elia sagen.
- Die Himmelfahrt Elias ist für Johannes einfach nicht vergleichbar mit dem Abstieg und Aufstieg des Menschensohns vom und in den Himmel, obwohl ihm die Vision der Entrückung Elias in den Himmel bekannt ist. Diese ist ja in 2. Könige 2,9-13 ein Zeichen der Beglaubigung dafür, dass Elisa als Schüler Elias mit dem Geist seines Lehrers beschenkt wird, und in der Geschichte der Begegnung von Maria Magdalena mit dem auferstandenen Jesus spielt Johannes darauf an, ja, er scheint sogar anzudeuten, dass Maria in ähnlicher Weise wie Elisa mit dem Geist Jesu beschenkt werden soll (67).
↑ Abwegige Zweifel an Jesu Hinrichtung am römischen Kreuz
Zum Thema (S. 108) H wie Hinrichtung möchten Sie die Frage klären: „Wie starb Jesus wirklich?“ Sie haben Recht mit Ihrer einleitenden Bemerkung, „dass es so gut wie keine wirklich gesicherte Information über Jesus gibt.“ In diesem Sinne hinterfragen Sie nun auch, „ob Jesus wirklich am Kreuz starb.“
Nun wurde sowohl nach Markus 14,64 als auch nach Matthäus 26,65 Jesus durch den Hohen Rat der Juden wegen Gotteslästerung verurteilt. Daraus hätte (S. 109) gemäß 3. Mose 24,16 Jesu Hinrichtung „durch Steinigung“ folgen müssen. Zusätzlich sah das „mosaische Gesetz“ Ihnen zufolge auch noch vor (5. Mose 21,22), einen solchen „Verbrecher … auch noch öffentlich zur Schau“ zu stellen:
„Wenn jemand eine Sünde begangen hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet, dann hängt man ihn an ein Holz. Aber sein Leichnam soll nicht über Nacht am Holz hängen bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tag begraben.“
Daraus schließen Sie:
„Wäre also Jesus von einem jüdischen Gericht der Gotteslästerei für schuldig befunden worden, dann hätte man ihn zum Tode durch Steinigen verurteilt. Nach Vollstreckung des Urteils hätte man den toten Jesus ans ‚Holz‘ gehängt.“
Dieses „Holz“ hätte einfach ein Baum sein können oder auch ein Pfahl, denn das von den Evangelisten verwendete Wort stauros, das in unseren Übersetzungen mit „Kreuz“ übersetzt wird,
„steht im klassischen Griechisch für einen ‚aufrechten Pfahl‘ oder ‚Pfahl‘“.
Jesus wäre somit also NICHT lebendig an ein römisches Hinrichtungskreuz gehängt worden.
Ihre diesbezüglichen Überlegungen sind allerdings völlig abwegig.
- Wie ich schon an verschiedenen anderen Stellen betont habe (68), war die Drohung „…der soll des Todes sterben“ im Alten Testament kein Bestandteil der Rechtsordnung, sondern eine drastische Ermahnung innerhalb der religiösen Unterweisung der jüdischen Gemeinde oder Familie.
- Ihre Übersetzung von 5. Mose 21,22 ist nicht präzise. Denn im Urtext steht nicht, dass JEDER zum Tode Verurteilte und Getötete an ein Holz gehängt wird („dann hängt man ihn…“), sondern der Akzent liegt auf etwas anderem: WENN ein zum Tode Verurteilter getötet wird und man ihn an ein Holz hängt (ob das oft geschehen ist oder sogar die Regel war, davon steht hier und nirgendwo anders etwas), DANN soll man ihn noch am selben Tag begraben. Es geht also gerade nicht darum, eine möglichst lange abschreckende Zur-Schau-Stellung zu inszenieren, sondern eine wahrscheinlich nicht häufig praktizierte Maßnahme sogar noch zu verkürzen. Aber was hätte es als „Abschreckungsmaßnahme“ bewirken sollen, wenn man Jesu Leichnam zwischen seinem Tod, der etwa um 3 Uhr nachmittags geschehen wäre, und dem Beginn des Sabbats um 7 Uhr gerade mal vier Stunden an einen Pfahl gehängt hätte? Im Übrigen steht nichts davon im biblischen Text.
- Viel wichtiger ist aber, dass Jesu Todesurteil sicher nicht von einem jüdischen Gericht vollstreckt wurde, sondern das Recht dazu hatte zu Jesu Zeit nur der römische Statthalter. Das bestätigen auch alle Evangelien (Matthäus 27,1-2; Markus 15,1; Lukas 23,1-2; Johannes 18,28-29), indem der Hohe Rat Jesus „dem Statthalter Pilatus“ überantwortet. Es geht hier also gar nicht um eine jüdische Steinigung und evtl. ein anschließendes Zur-Schau-Stellen des Leichnams an einem Pfahl (das widerspricht auch auf der Erzählebene wiederum allen Evangelien, denn am Kreuz hängend lebt Jesus noch), sondern es geht um die römische Art der Hinrichtung am Kreuz, die tausendfach praktiziert wurde (wenn auch nicht an einem Kreuz, wie es in den Kirchen dargestellt wird).
- Indem Sie (S. 110) Ihre Vermutung außerdem noch durch das Buch von Francesco Carotta (69) „War Jesus Caesar?“ abzustützen versuchen, begeben Sie sich endgültig in ein argumentatives Abseits (70). Lächerlich ist seine Gleichsetzung Jesu mit dem römischen göttlichen Julius Cäsar, lächerlich sein Argument, man könne das Wort pherousin in Markus 15,22 auch mit „tragen“ übersetzen: „‚Und sie trugen ihn an die Stätte Golgatha.‘ Warum? Carotta ist überzeugt davon, dass Jesus bereits bei seiner Verhaftung getötet wurde. Posthum habe man ihm den Prozess gemacht (71).“
Immerhin ist Ihnen bewusst (S. 110f), dass Ihr
„Gedankenspiel … ein Manko [hat]: Es gibt im ‚Neuen Testament‘ nicht die Spur eines Hinweises auf die Steinigung Jesu durch das Volk. Es sei denn, man interpretiert die grausam-blutige Geißelung Jesu [Matthäus 27,26; Markus 15,15; Lukas 23,16; Johannes 19,1] etwas frei als eben diese Steinigung durch das Volk, das lautstark grölend Jesu Tod verlangte.“
Sie haben ja Recht, dass man nie ein vollständiges Bild von Jesus erhalten wird und dass man noch nicht einmal ansatzweise eine historische Biographie Jesu erstellen kann. Aber die beiden Szenarien, die Sie hier unter Rückgriff auf Carotta zusammenmengen, können keinen Anspruch erheben, ernstgenommen zu werden. Warum nicht?
- Pilatus hätte nie einer jüdischen Steinigung zugestimmt, darauf gibt es keinerlei Hinweis. Seine Art, kurzen Prozess zu machen, war der Befehl an seine Soldaten, Jesus zu kreuzigen.
- Die Geißelung wurde nicht durch Juden, sondern durch die Soldaten des Pilatus durchgeführt.
- Carotta würde auch nie Ihrer Annahme zustimmen, dass Jesus von Juden gesteinigt worden sei und dann erst an einem Pfahl zur Schau gestellt worden ist, denn sein Szenario ist ganz anders. Für ihn ist Jesus ja Cäsar, und sein Tod wurde von Brutus und Co. herbeigeführt. Die in den Evangelien erzählte Kreuzigung deutet er um als das feierliche Begräbnisritual für Julius Cäsar alias Jesus Christus. Wenn Sie sich auf diese Deutung einlassen, können Sie alles andere vergessen, was Sie in Ihrem Buch über die Bibel schreiben.
- Im Übrigen haben die Verfasser der Evangelien keinesfalls die Absicht, Pilatus von seiner Schuld an Jesu Tod reinzuwaschen (72). Ist es nicht sogar schlimmer, einen Menschen zu verurteilen, von dessen Unschuld man überzeugt ist?
- Ein kleiner Druckfehler unterläuft Ihnen an der Stelle, an der Sie Barabbas erwähnen, der an Stelle von Jesus amnestiert wird – Sie machen aus ihm einen Barnabas. Und es spricht nichts dafür, dass an dieser Stelle „Pilatus Jesus zur Steinigung durch das Volk freigegeben haben“ könnte.
↑ „Ich aber sage euch“: Zustimmung, nicht Widerspruch
Zur Formulierung (S. 111) I wie „Ich aber sage euch“ legen Sie völlig richtig dar (S. 112), dass Jesus damit keineswegs „den falschen Ansichten der Schriftgelehrten seine eigenen, wahren und richtigen Ansichten gegenüber“ stellen will. Die (S. 113) griechische Wendung Egō de legō hymin nimmt nämlich tatsächlich die hebräischen Worte WaˀANI ˀOMaR LaKhäM auf, mit denen „jüdische Rabbis ihre Erklärungen vom zu erklärenden Schrifttext“ absetzen:
„Damit sollte verdeutlicht werden: Dies war nun der Text der Schrift. Dazu sage ich nun … Und es folgte die fachkundige Erklärung. Natürlich sollte die Auslegung keine Gegenthese zum Schrifttext aufbauen, vielmehr solle die Erklärung konform mit dem Text gehen. Damit wird klar, dass die Übersetzung ‚Ich aber sage euch …‘ einen Gegensatz konstruiert, ja einen Konflikt aufbaut, der gar nicht existiert.“
Ob Sie die Auffassung des großen Theologen Karl Barth korrekt wiedergeben, indem Sie schreiben (S. 112), dass er „im ‚Ich aber sage euch …‘ auf der einen Seite Widerspruch, auf der anderen Seite Jesu Anspruch auf Anerkennung seiner Autorität“ sieht, und dass sich Jesus mit „seiner Floskel ‚Ich aber sage euch …‘ … als Gegenpol zur jüdischen Gelehrsamkeit“ positioniert, kann ich nicht nachprüfen, da Sie keine entsprechenden Belegstellen aus Werken von Barth angeben.
Recht haben Sie auch mit Ihrem Hinweis darauf, dass Jesus sich ja selbst durchaus als jüdischer Rabbi verstand und anreden ließ und sich somit kaum „als Gegenpart der jüdischen Gelehrsamkeit“ betrachten konnte, sondern als Teilnehmer an einer innerjüdischen rabbinischen Debatte.
Ihr Vorwurf an deutsche Bibelübersetzungen, den Titel „Rabbi“ für Jesus weitestgehend verschwinden zu lassen und ihn durch das unpassende deutsche Wort „Meister“ zu ersetzen, trifft allerdings, soweit ich das überblicken kann, nur in Einzelfällen zu. Die Lutherbibel hat an den vier Stellen Johannes 3,2.26; 9,2; 11,8 bis zur Revision von 1984 tatsächlich das griechische Wort rabbi durch das deutsche „Meister“ ersetzt; an allen anderen Stellen (Johannes 1,38.49; 4,31; 6,25 sowie Markus 9,5; 11,21; 14,45 und Matthäus 26,25.49) übersetzt schon Luther im Jahr 1545 korrekt mit „Rabbi“. Die katholische Einheitsübersetzung sowie die Zürcher und die Elberfelder Bibel übersetzen an allen Stellen korrekt.
Aufschlussreich sind Ihre Bemerkungen (S. 112) über die Stelle Johannes 1,38:
„Sie aber sprachen zu ihm: ‚Rabbi – das ist verdolmetscht Meister – wo bist du zu Hause?‘
Von Verdolmetschung kann eigentlich nicht die Rede sein: Nach heutigem Sprachgebrauch ist ein Meister ein Handwerker mit Meisterbrief oder eine besonders erfolgreiche Fußballmannschaft. Der jüdische Rabbi war ein Schriftgelehrter, der über die mosaischen und anderen Texte des ‚Alten Testaments‘ predigte. Und der Rabbi beantwortete Fragen über das tägliche Leben, unter Berücksichtigung der Texte der ‚Heiligen Schrift‘.“
Hier übersehen Sie, dass in der deutschen Sprache das Wort „Meister“ auch einen „Lehrmeister“, also einen mit Autorität ausgestatteten „Lehrer“ bezeichnen kann – wenngleich diese Ausdrucksweise etwas altertümlich ist. Mit dem Wort „Meister“ wird jedenfalls bei Luther und in vielen anderen deutschen Bibeln das griechische Wort didaskalos übersetzt, das wörtlich „Lehrer“ bedeutet (73) – und genau so, nämlich als „Lehrer“ der Heiligen Schrift, verstanden sich ja eben die jüdischen Rabbiner, wie Sie es auch korrekt beschreiben (abgesehen davon, dass das von Ihnen für ihre Tätigkeit verwendete Wort „predigen“ besser zu einem christlichen Pfarrer passen würde) (74).
↑ „Ich will: Sei rein!“ Hat Jesus das tatsächlich zu einem Aussätzigen gesagt?
Zum Stichwort (S. 114) I wie „Ich will“ versuchen Sie nachzuweisen, dass die in Markus 1,41 (ähnlich Matthäus 8,3 und Lukas 5,13) im Zusammenhang der Heilung eines Aussätzigen verwendete Formulierung „Ich will‘s tun, sei rein!“ bzw. noch knapper im griechischen Urtext: „Ich will, sei rein!“ nicht ursprünglich von Jesus stammen kann.
Wie kommen Sie darauf? Anders als in ähnlichen Zusammenhängen argumentieren Sie nicht mit einer angeblich originalen aramäischen Version der Evangelien, sondern Sie schreiben (S. 115):
„Hilfreich ist es bei solchen Fragen, den griechischen Text ins Hebräische/Aramäische zurückzuübersetzen. Das fast trotzig barsche ‚Ich will, werde rein!‘ dürfte gelautet haben ‚Retzoni hitaher‘. Die hebräischen Texte kannten weder Groß- und Kleinschreibung noch Zwischenräume zwischen den einzelnen Worten. Jesu Ausspruch sah demnach so aus: ‚RETZONIHITAHER‘. Wie würde Jesu Aussage lauten, wenn er zum Ausdruck hätte bringen wollen: ‚Möge es Gott wohlgefällig sein, dass du rein seiest!‘? (75) So: ‚Ratson Jehi Taher‘.
In der zeitgemäßen Urfassung, die keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung kennt und die ohne Trennungen zwischen den einzelnen Worten auskommt, sah dies so aus: ‚RATSONJEHITAHER‘. Die Ähnlichkeit ist verblüffend:
‚RETZONIHITAHER‘ und
‚RATSONJEHITAHER‘.
Die starke Ähnlichkeit legt einen Abschreibfehler mehr als nahe.“
Auf diese Weise wäre klar (S. 116): Jesus als jüdischer Rabbi nimmt selbst „keinerlei Handlung vor“, durch die der Aussätzige geheilt würde:
„Gott ist es also, der heilt, nicht Jesu barscher Wille. … Jesus stellte nur die erfolgte Heilung fest. Dann aber schickte er den Mann zum Priester. Erst der Priester konnte offiziell die Heilung konstatieren. Somit erweist sich Jesus als frommer Jude, der die mosaischen Gesetze streng befolgt [Matthäus 8,4]: ‚Geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat.‘“
Auf der Erzählebene der Evangelisten ist Jesus allerdings der von Gott eingesetzte Messias, der den Namen Gottes verkörpert. Von daher kann er auch selber wie Gott sprechen: „Ich will, sei rein!“ Es muss sich also nicht um einen Abschreibfehler handeln, sondern um den Ausdruck der Überzeugung, dass in Jesus der Wille des barmherzigen Vaters vollkommen am Werk ist.
Trotzdem setzen natürlich auch die Evangelisten voraus, dass die Heilung selbst auf Gott im Himmel zurückgeht, sehen sie doch nichts im Willen des Sohnes im Gegensatz zum Willen des Vaters. Offen muss bleiben, ob der historische Jesus selbst die Formulierung „Ich will – sein rein“ verwendet hat.
↑ Matthäus stellt Jesus in eine Beziehung zu „Immanuel“
Unter dem Stichwort (S. 116) I wie Immanuel beschreiben Sie zu Recht den Zusammenhang des Wortes aus dem Buch Jesaja 7,14: „Siehe die ‚alma‘ ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ Es geht (S. 117) in der Zeit „zwischen 746 und 716 v. Chr.“ um ein
„Zeichen der Hoffnung auf eine gute Zukunft, weshalb das Kind Immanuel heißen soll, zu Deutsch: ‚Gott (ist) mit uns‘ oder etwas freier ‚Gott hilft‘. Es ist unbestreitbar: Jesaja beschreibt eine konkrete Situation aus der Zeit um 750 v. Chr., er prophezeit kein Ereignis der fernen Zukunft.“
Dem Evangelisten Matthäus werfen Sie nun vor, dass er diesen Vers aus dem Zusammenhang reißt „und neu interpretiert“. In Matthäus 1,23 schreibt er nämlich: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und sie wird einen Sohn gebären, und sie wird ihn Immanuel nennen, Gott ist mit uns.“ Auf diese Weise verändert Matthäus nachträglich den Jesajatext und stellt erst so einen „Bezug zu Jesus“ her, obwohl „Jesajas Immanuel … mit Jesus nicht das Geringste zu tun“ hat.
Diesem Befund kann ich sogar zustimmen. Aber trotzdem halte ich es nicht für angemessen, das Vorgehen des Matthäus einfach als einen Haufen von Irrtümern abzuwerten. Sie schreiben:
„Irrtümer treten hier geballt auf:
Jesaja spricht von einer ‚alma‘, einer ‚jungen Frau‘, nicht von einer Jungfrau. Jungfrau heißt ‚betulah‘ im Hebräischen.
Die junge Frau bei Jesaja ist bereits schwanger, sie wird es nicht erst noch werden.
Das Kind der jungen Frau wird, sagt Jesaja, Immanuel heißen, nicht Jehoschua.“
Ich bin mir sicher, dass Matthäus seine Heilige Schrift besser kennt, als Sie denken. Er, dem die Bewahrung der Tora mehr als allen anderen neutestamentlichen Autoren am Herzen liegt (vgl. Matthäus 5,17-19), verfügt über eine große rabbinische Gelehrsamkeit. Wenn er die Bibel eigenwillig interpretiert, dann tut er das nicht aus Unkenntnis, sondern bewusst, um seinen Glauben an Jesus als den Messias Israels zu verdeutlichen. Auch andere jüdische Rabbiner denken ja bei ihrer Schriftauslegung oft durchaus „um die Ecke“.
Richtig ist: Die Interpretation der ˁALMaH als einer BɘThULaH ist eine Umdeutung. Richtig ist auch: Jesaja damals meint keine Frau in ferner Zukunft. Matthäus zeichnet Jesu Geburt und Wirken aber bewusst in die Geschichte Israels und der prophetischen Verheißungen hinein, weil Jesus nicht nur individuelles Seelenheil, sondern gesellschaftliche Befreiung, Gerechtigkeit und Frieden bringt. Ihm ist es wichtig, den Messias mit dem Namen Jesus = JɘHOSchuAˁ = „Befreiung, Hilfe“ auch mit dem ˁIMMaNU ˀEL = „Gott mit uns“ des Jesaja in eins zu setzen (76).
↑ Steckt in Jesu Lob des Israeliten Nathanael ein versteckter Tadel?
Zum Stichwort (S. 117) I wie Israelit nehmen Sie an (S. 118), dass in dem Lob des Nathanael durch Jesus in Johannes 1,47 ein versteckter Tadel an „den Israeliten“ enthalten ist:
Siehe, ein rechter lsraelit, in dem kein Falsch ist.
Dazu schreiben Sie:
„Generationen von Antisemiten interpretierten dieses Wort auf ihre eigene Weise.
Demnach wird Nathanael gelobt: Kein Falsch sei an ihm. Und das, obwohl er ein rechter Israelit war.“
Allerdings verstehe ich nicht, dass Sie in diesem Zusammenhang die Übersetzung von Johannes 1,47 als sinnverfälschend einschätzen:
„Wieder einmal wird deutlich, dass Übersetzungen oft tendenziös verfasst sind. Manche Übersetzer neigen dazu, die persönliche Voreingenommenheit in einen Text hineinzutragen.“
Das mag ja sein, aber in der genannten Übersetzung steht genau so wenig ein einschränkendes „obwohl“ wie im Urtext. Die Voreingenommenheit wird in diesem Fall vom Leser der Übersetzung in den Text hineingetragen, nicht vom Übersetzer.
Wenn Sie allerdings schreiben:
„Nathanael stellt nicht die löbliche Ausnahme, sondern die Regel dar. Der begeisterte Ausruf ist also kein versteckter Tadel an den Israeliten, sondern ganz im Gegenteil ein Lob für Nathanael, den einzelnen, und das Volk, aus dem er stammt“,
dann scheinen Sie umgekehrt zu unterstellen, dass Johannes mit seinem Ausruf ganz bewusst alle Israeliten loben will – und dass man das in einer Übersetzung auch herausstellen müsste.
Hier verwechseln Sie aber die klare Absage an einen menschenverachtenden Antisemitismus mit einem problematischen, weil unkritischen Philosemitismus, der keinerlei konkrete Kritik an Israel oder einzelnen Juden zulassen will. Der Evangelist Johannes äußert ja gerade als jüdischer Anhänger des Messias Jesus auch massive Kritik an bestimmten Teilen des jüdischen Volkes, vor allem seiner politischen Führung, die (Johannes 19,15) den römischen Kaiser an die Stelle des Königs der Juden und damit an die Stelle Gottes gesetzt hat. Antisemitismus liegt ihm natürlich fern, zumal er selbst Jude ist.
Dasselbe gilt für den Apostel Paulus, der in seinem Römerbrief sowohl auf das Versagen von Juden als auch von Heiden hinweist. Seine harten Worte der Kritik (Römer 1,31): „unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig“ beziehen Sie übrigens irrtümlich auf die Juden; in Wirklichkeit spricht Paulus in diesem Kapitel zunächst über die Verirrungen gerade der Nichtjuden, die (Römer 1,20) Gott „an seinen Werken“ erkennen können. Von den Juden, die für ihre Verfehlungen genau so wenig eine Entschuldigung haben, spricht er erst später.
Ein weiterer Irrtum unterläuft Ihnen, wenn Sie im Zusammenhang mit der angeblich harten Kritik des Paulus an den Israeliten auch noch schreiben:
„Wen wundert es da, dass er Thomas ermahnt [Johannes 20,27], ‚nicht ungläubig‘ zu sein.“
Dieser Satz ist in mehrfacher Hinsicht unsinnig:
- Im Johannesevangelium ist es nicht Paulus, der den Thomas ermahnt, sondern Jesus.
- Zwischen Jesus und Thomas geht es nicht um Unvernunft, Treulosigkeit, Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit, sondern es fällt dem Thomas schwer, an Jesu Auferstehung zu glauben.
- Jesus und Thomas führen ein Gespräch unter Juden. Wie sollte dabei Antisemitismus eine Rolle spielen?
↑ Jesus unternahm keine schamanischen Jenseitsreisen
Zum Thema (S. 119) J wie Jenseitsreisen spekulieren Sie ausführlich darüber, ob auch im Alten und Neuen Testament schamanische Einflüsse aufzuspüren sind und insbesondere von „Reisen ins Jenseits“ die Rede ist.
Unter Berufung auf Bernhard Lang (77) erinnern Sie an altorientalische Könige, die „die Welt der Götter“ aufsuchen, um „sich von den übrigen Sterblichen abzusetzen und um ihre Machtposition zu begründen“, ja selbst ein Gott werden und ihren „Platz auf dem Götterberg“ einnehmen. Zwar geben Sie zu, dass sich das „Judentum des ‚Alten Testaments‘ … in seiner Theologie weit vom Schamanismus“ entfernte, aber angeblich
„übernahm [es] … den Brauch der Jenseitsreise. Es sind die Propheten, die sich im Zustand der Ekstase in die göttlichen Sphären aufmachen. Bernhard Lang (78): ‚Die Reise ins Jenseits führt einen Menschen in die Gegenwart des Herrn der Weisheit.‘“
Genau genommen machen sich aber die jüdischen Propheten nicht in die göttlichen Sphären auf, sondern es ist umgekehrt Gott, der sie in ihrer jeweiligen Situation aufsucht, anspricht, aufrüttelt. Jedenfalls nimmt kein Prophet irgendwelche Drogen oder übt irgendwelche Rituale aus, um eine Jenseitsreise anzutreten.
Wenn Sie weiterhin (S. 120) apokryphe jüdische Schriften wie „Ezechiel der Tragiker“ oder hebräische Fragmente des Buches „Jesus Sirach“ dafür ins Feld führen, dass Mose „den göttlichen Thron besteigen“ darf oder sogar Gott genannt wird, dann handelt es sich dabei auf jeden Fall um Außenseitertexte, die aus gutem Grund „nicht in den als heilig empfundenen Kanon aufgenommen wurden“.
Wie ist das aber im Neuen Testament? Sie stellen die
„provokativ anmutende Frage…: Stand Jesus selbst in der uralten Tradition des Schamanentums? Wurden konkrete Hinweise über den historischen Jesus in der langen Geschichte der theologischen Geschichtsforschung missachtet, weil sie ein ganz anderes, befremdliches Jesusbild vermittelt haben?“
Recht reißerisch formulieren Sie, dass in dieser Hinsicht „die sensationellen Forschungsergebnisse von Jan-Adolf Bühner (79) geflissentlich missachtet“ wurden. Dieser hat angeblich herausgefunden, dass Jesus (S. 121)
„die uralte Jenseitsreise des Schamanen [praktizierte]. In geistiger Entrückung steigt der Schamane zu Gott empor, um dann wieder zur Erde zurückzukehren. Just dieser Sachverhalt wird im Evangelium nach Johannes beschrieben [3,13]: ‚Kein anderer ist in den Himmel hinaufgestiegen als jener, der vom Himmel (wieder) hinabgestiegen ist: der Menschensohn.‘“
Auf genau diesen Bibelvers waren Sie ja bereits in Ihrem Kapitel über die H wie Himmelfahrt eingegangen. Und ähnlich wie Sie dort den Sinn der Himmelfahrten verschiedener biblischer Gestalten nicht zu unterscheiden vermochten, zeigt hier das eingeklammerte „wieder“ ein weiteres Missverständnis an: Es geht Johannes nicht um eine schamanische Reise Jesu in den Himmel, sondern es geht um den präexistenten Gottessohn, der als wahrer Mensch in die Welt herabgestiegen ist und durch sein Leiden hindurch wieder in den Himmel erhöht wird. Das heißt: Jesus steigt nicht als Gott-suchender Mensch in den Himmel hinauf und kehrt WIEDER zur Erde zurück. Stattdessen sieht Johannes ihn als Gott-gleichen Menschensohn oder logos, als vor aller Zeit existierendes „Wort“ Gottes (gleichzusetzen mit der ChaKMaH = sophia = „Weisheit“), der im Zuge seiner Kreuzigung in den Himmel erhöht werden wird, von dem er ZUVOR bei seiner Geburt herabgestiegen war.
Aber wie ist es mit der Geschichte der Verklärung Jesu, die von den anderen Evangelien (den Synoptikern) berichtet wird? Unter Berufung auf John Pilch (80) verstehen Sie diese als einen Hinweis darauf, dass Jesus ein „Lehrmeister“ war,
„der nicht nur selbst Jenseitsreisen praktizierte, sondern seine Jünger auch an seinen spirituellen Erlebnissen teilhaben ließ. … Jesus führt seine auserwählten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf einen ‚Berg‘. In der Sicht des Schamanen: Gemeinsam treten sie eine geistige Jenseitsreise an und sehen die längst verstorbenen Mose und Elija [Markus 9,2-8].“
Auch diese Interpretation geht jedoch weit am eigentlichen Sinn dieser Erzählung vorbei.
- Berge sind zwar in der Bibel oft Orte der Offenbarung Gottes oder eine besonderen Nähe zu Gott, aber sie gehören zur Erde und befinden sich nicht in einem jenseitigen Bereich des Himmels. Es geht hier nicht einmal im Ansatz um eine Reise in den Himmel.
- Stattdessen sehen die Jünger die beiden herausragenden Repräsentanten der Heiligen Schrift der Juden, nämlich Mose als den Bringer der Tora und Elia als den Propheten, dessen Wiederkunft vor dem Kommen des Messias erwartet wurde, hier auf der Erde in der Gemeinschaft mit Jesus. Die Evangelisten machen damit klar, dass Jesus das, was in der Tora und in den Prophetenschriften steht, nicht aufheben, sondern zur Erfüllung bringen will.
- Dass Jesus den Vorschlag des Petrus ablehnt (Markus 9,5-6), hier auf dem Berg für Jesus, Mose und Elia Hütten zu bauen, bestätigt zusätzlich, dass der Weg der Jünger ganz und gar nicht in den Himmel gerichtet sein, sondern sogar aus der Nähe des Himmels wieder zurück auf die Erde führen soll.
Abwegig ist das Urteil von Bernhard Lang (81), dass das Erlebnis der Jünger bei der Verklärung religionsgeschichtlich gesehen „als eine in hypnotischer Trance erlebte Halluzination zu bewerten“ sei, und erst recht, dass Jesus
„seine Jünger zur Jenseitsfahrt an[leitete] und … mit ihnen in den dritten Himmel [gelangte], d. h. das Paradies, in dem sich die verstorbenen Gerechten befinden.“
Auf solche Spekulation kann man nur kommen, wenn man den Text der Evangelien mit großer Phantasie ausschmückt und Dinge hineingeheimnisst, die mit keinem Wort angedeutet werden. Nirgends steht dort etwas vom Eintritt in den Himmel, schon gar nicht vom Durchgang durch mehrere Himmel. Das Alte Testament enthält im Übrigen ohnehin nirgends Schilderungen des Himmels, wie sie im apokryphen und vor allem späteren gnostischen Schrifttum vorkommen; und genau wie das Alte Testament ist auch das Neue viel mehr am diesseitigen Leben hier auf der Erde interessiert als am Jenseits. Nicht einmal in der Offenbarung des Johannes, das einen Blick in den Himmel zu riskieren erlaubt, sollen die Menschen in den Himmel kommen, sondern die Hoffnung des Buches läuft darauf hinaus (Offenbarung 21,2-4), dass am Ende das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt und Gott bei den Menschen wohnen wird.
↑ Wurden Prophezeiungen des Jeremia gegen Jesus vertuscht?
Zum Stichwort (S. 122) J wie Jojachin meinen Sie wieder einer Vertuschungsaktion biblischer Übersetzer auf der Spur zu sein. Sie wundern sich nämlich darüber, dass in „der langen Litanei der Ahnentafel Jesu“ in Matthäus 1,11 als Sohn Josias und Vater Schealtiëls in den meisten heutigen deutschen Übersetzungen (82) der Name „Jojachin“ genannt wird und nicht wie im griechischen Urtext der Name „Jechonia“.
Offenbar ist Ihnen nicht bewusst, dass Jechonja oder Konja einfach ein anderer Name für Jojachin, den letzten König von Juda, ist, wie man bei Wikipedia nachlesen kann:
Der hebräische Name … jəhôjākhîn ist ein Satzname. Das Subjekt bildet das theophore Element … jəhô, das Prädikat kommt von der Wurzel … kûn, die im Hif’il „hin- / aufstellen / gründen / schaffen / wieder herstellen“ bedeutet… Der Name wird mit „JHWH verleiht / verleihe Beständigkeit“ übersetzt. Als Namensvarianten erscheinen … jəkhånjāh (1 Chr 3,16), … jəkhånjāhû (Jer 24,1) und … kånjāhû (Jer 22,24), deren Namen abgesehen vom je anderen theophoren Element bedeutungsgleich sind.
Die Septuaginta gibt den Namen mit … iōakim, alle Varianten hingegen mit … iechonias wieder.
Nun ziehen Sie aus dieser angeblichen Entfernung des Jechonia aus dem Stammbaum Jesu, die demgemäß gar nicht stattgefunden hat, eine – wie Sie meinen – brisante Schlussfolgerung:
„Brisant wird diese Information erst, wenn man weiß, was der Prophet Jeremia über Jechonia alias Konia sagt [Jeremia 22,30]: ‚So spricht der Herr: Schreibt diesen Mann auf als einen, der ohne Kinder ist, einen Mann, dem sein ganzes Leben lang nichts gelingt! Denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitzen und in Juda herrschen wird.‘
Es ist eindeutig: Nach der Prophezeiung wird kein Nachkomme Jechonias den Thron Davids besteigen. Ließ man deshalb in den Übersetzungen Jechonia verschwinden? Denn das Prophetenwort schließt ja aus, dass Jesus eben diesen Thron besteigen wird. Denn Jesus gehört nach Jeremia zu dem Personenkreis, der nicht auf dem Thron Davids sitzen wird. Aber genau das behauptet das ‚Neue Testament‘: Jesus ist der Messias, weil er als Nachkomme Davids dessen königliches Erbe antritt.
Es mutet kurios an: Da gibt es ein klares Prophetenwort, das Jesus als Messias ausschließt. Diese Prophezeiung wird in Übersetzungen des ‚Neuen Testaments‘ vertuscht, indem man König Jechonia im Stammbaum Jesu in Jojachin umbenennt.“
Dazu ist in aller Deutlichkeit zu sagen:
- Hier wird schon deswegen nichts vertuscht, weil Jojachin und Jechonia identisch sind. Die heutigen Übersetzungen wählen vermutlich deswegen den geläufigeren Namen Jojachin statt des selteneren Jechonia, um die Leser nicht zu verwirren, zumal sie (wie ja bereits der griechisch schreibende Evangelist) ja ohnehin nicht auf die genaue ursprünglich hebräische Namensform zurückgreifen.
- Über die Prophezeiung Jeremias gegen Konja = Jechonia = Jojachin hatten sich schon diejenigen jüdischen Gruppen hinweggesetzt, die dennoch auf einen Messiaskönig als Befreier Israels auf Grund der Verheißungen an David hofften.
- Jesus war nach Matthäus 1,16 ohnehin kein leiblicher Nachkomme Jojachins, da er kein leiblicher Sohn Josefs war.
- Matthäus verkündet Jesus als einen Messias, der die Hoffnungen Israels auf völlig andere Weise erfüllt als erwartet.
Nebenbei kommen Sie (S. 123) auf Jesaja 11,1-2 zu sprechen, ein
„Prophetenwort, das nun mit Sicherheit nicht auch nur das Geringste mit Jesus zu tun hat… [und das] in der Theologie als ‚Hinweis auf Jesus‘ umgedeutet [wird] [Matthäus 2,23]: ‚Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn …‘“
Aber dazu später mehr unter dem Stichwort N wie Nazoräer.
Sie sind aber noch nicht fertig mit Ihren Ausführungen über
„König Jechonia: Nach den Aufzeichnungen der Chronik [3,16] war Jechonia ein Sohn des Jojakim.“
Das ist richtig, denn Jechonia ist ja gleichzusetzen mit Jojachin, und der war wiederum ein Sohn des Jojakim. An dieser Stelle wird nun deutlich, dass Ihnen ein weiterer „Irrtum“ des Matthäus in seinem Stammbaum entgangen ist (83), denn er lässt den Jojakim in der Generationenfolge einfach aus und macht aus Jechonia = Jojachin einen Sohn Josias, obwohl er nach 1. Chronik 3,14-16 dessen Enkel war.
Sie wollen allerdings auf etwas anderes hinaus, nämlich dass es
„über eben diesen Jojakim .. wiederum beim Propheten Jeremia [36,30] eine sehr konkrete Aussage Gottes [gibt]: ‚Es soll keiner von den Seinen auf den Thron Davids steigen. Und sein Leichnam soll hingeworfen werden, am Tag in der Sonnenhitze und nachts in der Kälte des Frosts.‘
Fazit: Es gibt zwei Prophezeiungen des Propheten Jeremia, die Jesus als Nachfolger Davids ausschließen.“
Ich sage dazu nochmals: Na und? Der Evangelist Matthäus will offenbar von Anfang an Jesus als den Messias verkünden, der durch ein Wunder Gottes zum Messias wurde. Denn zur Ahnenreihe seines menschlichen Adoptivvaters Josef gehören „ehrenwerte“ Männer wie Juda, dessen Doppelmoral in 1. Mose 38 gebrandmarkt wird, Frauen mit zweifelhaftem Ruf wie Rahab und Tamar und sogar zwei Könige, denen vorausgesagt wurde, dass ihre Nachkommen niemals König werden würden. Und doch konnte es Gott gefallen, in Jesus einen „Davidssohn“ auf seinen himmlischen Thron gelangen zu lassen, der diese Ehre verdiente.
↑ Josef von Arimathäa, Jesu Grab und der „Gottesknecht“ Jesajas
In Ihrem Abschnitt (S. 123) über J wie Josef von Arimathäa behandeln Sie die in Ihren Augen sehr widersprüchlichen Angaben über diesen Mann:
- Nach Matthäus 27,57 war er reich und ein Jünger Jesu.
- Nach Johannes 19,38 bekannte er sich nicht offen zu Jesus.
- Nach Markus 15,43 war er ein „angesehener Ratsherr, der „auch auf das Reich Gottes wartete“.
- Und Lukas 23,50-51 bestätigt das und erwähnt zusätzlich, dass er gut und gerecht war und das Vorgehen gegen Jesus nicht gebilligt hatte.
Dass die Evangelisten je nach ihrer theologischen Aussageabsicht die von ihnen übernommenen Überlieferungen durchaus unterschiedlich akzentuieren, ist nichts Neues. Eine Ihrer Bemerkungen allerdings zeugt von einer Fehleinschätzung des Judentums zur Zeit Jesu und der frühen Anhängerschaft Jesu (S. 123f.):
„Bei Markus ist nicht davon die Rede, dass Josef ein Jünger war, im Gegenteil: als ‚Ratsherr‘, also als Mitglied des Synedrium, muss er ein überzeugter Jude gewesen sein [Markus 15,43]: ‚ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete‘. Jeder Jude tat das.“
Falsch ist an diesem Satz die Entgegensetzung von „Jünger Jesu“ und „überzeugter Jude“, denn die Jünger Jesu verstanden sich genau so als überzeugte Juden wie die Mitglieder des Hohen Rates; das Christentum als neue Religion entstand erst im Lauf der nächsten Jahrhunderte.
Fraglich ist auf der Erzählebene des Markus auch Ihr Urteil, dass jeder Jude das Reich Gottes erwartete. In den Augen des Evangelisten tat das die Mehrheit der im Sanhedrin versammelten jüdischen Machtelite eben nicht, weil sie mit der römischen Besatzungsmacht gemeinsame Sache machte, statt Jesus zu schützen. Indem er also Josef zubilligt, das Reich Gottes zu erwarten, zählt er ihn indirekt zur Jüngerschaft Jesu in einem weit gefassten Sinne. Im selben Sinn äußert sich auch Lukas über Josef, während Matthäus und Johannes bei ihrer Übernahme der Erzählung aus der indirekten eine direkte Erwähnung der Jüngerschaft machen.
Gegen die Auffassung des Theologen Ulrich Wilckens (84), dass Josef von Arimathäa „zweifellos eine historische Gestalt“ war, neige ich allerdings wie Sie dazu, Dominic Crossan (85) mit seinem „entgegengesetzten Ergebnis“ Recht zu geben, dass „die Gestalt des Josef frei erfunden“ wurde, zumal auch Herbert Braun (86) zu bedenken gibt:
„Angesichts des bezeugten jüdischen Brauches, Verbrecher in einer Art Schindanger zu verscharren, lässt sich der Zweifel nicht von der Hand weisen, ob die jetzigen Grablegungsgeschichten der Evangelien überhaupt einen historischen Kern enthalten.“
Interessant ist nun Ihre Frage (S. 125), auf welche Texte aus dem Alten Testament die Evangelisten vielleicht bei ihrer Komposition der Erzählung über Josef von Arimathäa zurückgegriffen haben. Dabei stoßen Sie auf den „Gottesknecht“, von dem es in Jesaja 53,4-5 heißt:
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Von diesem „Gottesknecht“ sagt Jesaja 53,9 auch, wo er bestattet wurde:
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern…
„Auch dieses Jesajawort könnte man auf Jesus beziehen: Wenn man davon ausginge, dass er nach der Abnahme vom Kreuz auf einem Schandanger verscharrt wurde, auf dem zahllose andere Hingerichtete formlos beigesetzt wurden. Davon aber wollen die Evangelisten nichts wissen. Übereinstimmend sagen sie aus, dass der reiche Josef von Arimathäa Jesus in das Felsengrab legte, das er eigentlich für sich gedacht hatte [Matthäus 27,60 und entsprechend auch Markus 15,16 und Lukas 23,53]: ‚Und Josef legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen.‘“
Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Wurde Jesus nun (S. 126) „in vornehmer Umgebung“ oder „wie es bei Jesaja heißt, ‚bei den Gottlosen und Übeltätern‘“ bestattet? Ihre Antwort lautet:
„Des Rätsels Lösung: Der Verfasser des Berichts von Jesu Grablegung hat sich schlicht und einfach verlesen! Die hebräischen Wörter für ‚Übeltäter‘ und ‚Reiche‘ sind nämlich zum Verwechseln ähnlich!“
Sie sind sich allerdings nicht ganz sicher,
„bei welchem Text die irrtümliche Verwandlung von ‚Übeltätern‘ in ‚Reiche‘ erstmals erfolgte. Unterlief der Fehler dem unbekannten Verfasser des später nach Markus benannten Evangeliums? Schrieben die anderen Evangelisten dann von ihm ab? Oder wurde der Lesefehler mehrfach begangen?“
Ganz Unrecht haben Sie mit Ihrer Annahme nicht. Allerdings irren Sie sich vollkommen, was die Verantwortlichkeit für diesen Irrtum betrifft. Denn es war nicht etwa ein Evangelist, der sich verlesen hat (oder gar mehrere von ihnen), sondern bereits im hebräischen Urtext steht wörtlich (übersetzt in Anlehnung an die Elberfelder Bibel von 2006 (87)):
Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, bei einem Reichen in seinem Tod…
Schon damals war das Wort „Reicher“ wohl eine Verschreibung gewesen, denn das Wort ˁASchIR = „reich“ besteht aus fast denselben Konsonanten wie das Wort RaSchAˁ, nur in umgekehrter Reihenfolge. Insofern können sich die Evangelisten bei Ihrer Hindeutung der Gottesknechtslieder auf Jesus durchaus mit Recht auch darauf berufen, dass er nach den Worten des Jesaja „in seinem Tod bei einem Reichen“ war.
Recht haben Sie darin, dass Johannes die Bezugnahme auf Jesaja 53,9 insofern „am perfektesten“ umsetzt, als Jesus,
„was kaum möglich zu sein scheint, bei Reichen und Gottlosen zugleich bestattet [wird]: Das Grab des Josef von Arimathäa war das eines Reichen. Johannes siedelt es in unmittelbarer Nähe der Kreuzigungsstätte an, also bei den ‚Gottlosen‘, die so schmählich endeten [Johannes 19,41-42]: ‚Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und im Garten ein neues Grab.‘“
↑ Judas: Widersprüche um seinen Tod
Zum Stichwort (S. 126) J wie Judas gehen Sie auf die „Widersprüche um seinen Tod“ ein. Zur Version des Matthäus, der 27,3 von der Reue des Judas berichtet, spekulieren Sie (S. 127), warum er wohl
„das Silber, das er unter keinen Umständen behalten wollte, zurück in den Tempel“ warf. Ob er glaubte, so seine Schuld seinen Auftraggebern aufzubürden? Dann ‚erhängte er sich selbst‘ [Matthäus 27,5].“
Hier versuchen Sie, eine Geschichte, die Sie an anderer Stelle schon kritisch wegen ihres Rückgriffs auf eine angeblich nicht vorhandene Prophetenstelle betrachtet haben, psychologisch zu deuten, als ob es darum ginge, das Verhalten eines historischen Judas zu erklären. Erklären lässt sich die Geschichte aber genau über die Bezüge, die Matthäus zu den Prophetenstellen Sacharja 11 und Jeremia 18, 32 und 19 herstellt (88).
Aber wieso berichtet Matthäus, dass sich Judas erhängt, während er nach Lukas (Apostelgeschichte 1,18) einem schrecklichen Unfall zum Opfer fällt? Widersprüchlich sind auch die Angaben über den „Blutacker“: Nach Matthäus 27,6-8 „sind es die Hohen Priester, die den Acker kaufen“, während, wie Sie schreiben, in „der Apostelgeschichte … Judas selbst … das Stück Land kauft, bevor er Selbstmord verübt.“ Letzteres stimmt allerdings, wie gesagt, nicht; Lukas erwähnt keinen willentlichen Suizid des Judas.
Sie haben also im Grunde doppelt Recht, wenn Sie schreiben, dass die „wenigen Fakten…, die übermittelt werden, … sich in den wesentlichen Punkten diametral“ widersprechen. Allerdings – ist das wirklich so „erstaunlich“, wie Sie annehmen? Beide Erzählungen bauen wahrscheinlich auf einer Überlieferung auf, in der ein gekaufter Blutacker vorgekommen ist, und die Einzelheiten wurden entweder unterschiedlich erinnert oder ausgestaltet.
Insofern ist der Schluss, den Sie hier zum wiederholten Male ziehen, kurzschlüssig: „Nur eine Version kann stimmen, die andere muss falsch sein.“ Nein, vielleicht treffen auch beide nicht zu; wir wissen nicht einmal, ob es überhaupt eine Überlieferung gab, die an ein historisches Ereignis anknüpfte. Möglich ist auch, dass man auf Grund eines allgemeinen Schuldvorwurfs an DIE Juden, für Jesu Tod verantwortlich zu sein, vom Verrat des beispielhaften Juden mit dem Namen „Jehuda“ = „Judas“ erzählte (89).
Auf die abstrusen Versuche von Gleason L. Archer (90), „beide Versionen miteinander in Einklang zu bringen“, möchte ich nicht weiter eingehen, nur auf Ihre abschließende Bemerkung (S. 129):
„Es mag müßig erscheinen, diese abstrusen Unmöglichkeiten in Gedanken durchzuspielen. Aber erst dann wird wirklich klar, wie in sich widersprüchlich die Berichtslage über den Tod des Judas Ischariot ist!“
Abstrus ist tatsächlich nicht die Berichtslage, sondern lediglich der Harmonisierungsversuch. Die Berichte sind einfach widersprüchlich und vermutlich beide nicht historisch. Matthäus gestaltet die Erzählung prophezeiungstheologisch, Lukas in der Apostelgeschichte greift auf Erzählungen zurück, die vom grausigen Ende als böse beurteilter Menschen handeln.
Schließlich erwähnen Sie noch einen weiteren eklatanten Widerspruch:
„Drei Tage nach seinem Tod am Kreuz kam es zum grandiosen Wunder der Auferstehung, zum Kernstück des christlichen Glaubens. Dieser Triumph Jesu über den Tod ist die Basis christlicher Hoffnung. Bei Paulus heißt es, dass Jesus zunächst von Kephas und dann von den zwölf Jüngern gesehen wurde [1. Korinther 15,4-5]. Das aber ist unmöglich: Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Judas erhängt und der ‚Ersatzjünger‘, ein gewisser Matthias [Apostelgeschichte 1,23-26], war noch nicht gewählt worden.“
Dieser Widerspruch ist leicht zu erklären. Paulus wusste wohl weder etwas von den Überlieferungen über Judas und seinen Selbstmord noch von der Nachwahl des Matthias, sondern er ging einfach von der Vollzahl der zwölf Apostel aus, die er aus der Anfangszeit der Gemeinde in Jerusalem kannte.
↑ Wie zentral ist die christliche Lehre von der Jungfrauengeburt?
Zum Thema (S. 129) J wie Jungfrauengeburt (91) stellen Sie zunächst fest (S. 130), dass die „Jungfrauengeburt Jesu … ohne Zweifel ein wichtiger Bestandteil christlichen Glaubens“ ist. „Sie steht ohne Zweifel im Zentrum des christlichen Glaubens evangelischer wie katholischer Prägung.“ Diese Zweifellosigkeit möchte ich allerdings doch, was die evangelische Kirche betrifft, stark anzweifeln, zumal selbst der von Ihnen erwähnte Theologe Karl Barth (92) das Dogma von der Jungfrauengeburt als zweitrangige Lehre ansieht, die allerdings in seinen Augen die wichtige Aufgabe hat, „das Geheimnis der Offenbarung“ zu bezeichnen, nämlich
„daß Gott am Anfang steht, wo wirkliche Offenbarung stattfinde, Gott und nicht die willkürliche Klugheit, Tüchtigkeit oder Frömmigkeit eines Menschen.“
Weiterhin bezeichnen Sie es als einen „erstaunlichen Irrtum“, im Blick auf Maria von einer „Jungfrauengeburt“ zu sprechen, da in „den biblischen Kindheitsgeschichten … nur von jungfräulicher Empfängnis die Rede“ ist, aber weder Matthäus noch Lukas darauf eingehen, „ob Maria die Geburt des Jesusknaben als Jungfrau überstand“. Dazu möchte ich Folgendes anmerken:
- 1. Eigenartig – auf S. 87 zum Stichwort G wie Geschwister Jesu hatten Sie noch das Gegenteil behauptet. Jetzt sehen Sie also auch ein, dass in keinem Evangelium davon die Rede ist, dass Maria bei und nach der Geburt Jesu Jungfrau bleibt. Matthäus erwähnt in 1,25 sogar ausdrücklich, dass Josef bis zur Geburt Jesu nicht mit Maria schläft, woraus folgt, dass er es für die Zeit danach eben nicht ausschließt.
- Es ist aber kein Irrtum, von Marias „Jungfrauengeburt“ zu sprechen, wenn man damit lediglich eine Geburt auf Grund jungfräulicher Empfängnis meint. Denn nach Wikipedia ist das die landläufige Definition einer Jungfrauengeburt, die auch für die evangelische Kirche selbstverständlich ist. Darüber hinaus gibt es „die immerwährende Jungfräulichkeit Marias vor, bei und nach Jesu Geburt“ als zusätzliche Lehre in der katholischen und in den orthodoxen Kirchen.
- Das wird auch durch die vielen (S. 130-132) von Ihnen angeführten Beispiele jungfräulich geborener Götter und Helden in verschiedensten Mythen der Völker bestätigt, denn sie schließen nicht notwendig die bleibende Jungfräulichkeit der jeweiligen Mütter mit ein. Recht haben Sie tatsächlich darin (S. 130), dass die Jungfrauengeburt „kein besonderes Charakteristikum der christlichen Religion“ darstellt.
Am Schluss dieses Abschnitts (S. 132f.) suchen Sie für „eine jungfräuliche Geburt … rationale Erklärungen, die verständlich und glaubhaft zugleich sind“, finden sie aber nicht. Wie wäre es mit folgenden zwei Erklärungsversuchen:
- Sie drückt bildhaft aus, dass Jesus seine Göttlichkeit nicht von einem menschlichen Vater empfangen haben kann. Insofern haben Sie Recht (S. 133): „Die Jungfrauengeburt ist eine Frage des Glaubens, die intellektuell-rational nicht beantwortet werden kann.“
- Im Anschluss an die amerikanische Theologin Jane Schaberg kann man die Jungfrauengeburt auch als Antwort des Glaubens auf Vorwürfe interpretieren, Jesus sei unehelich geboren worden. Man mag sich sogar die Frage stellen: „War Maria ein missbrauchtes Mädchen?“ und kann Maria als eine biblische Gestalt verstehen, mit der sich Frauen und Mädchen identifizieren können, die sexuelle Gewalt erlitten haben (ohne damit historisch etwas beweisen zu wollen).
↑ Erst spät entstanden die kanonischen Evangelien, noch später die Apokryphen
Zum Stichwort (S. 133) K wie Kanon fragen Sie sich, wann die Texte des Neuen Testaments entstanden und zu einer kirchlich anerkannten Sammlung von Schriften, eben dem „Kanon“, zusammengestellt wurden. Zunächst schreiben Sie:
„Nach dem grausamen Tod Jesu am Kreuz dürfte der Wunsch entstanden sein, das Leben Jesu aufzuzeichnen.“
Dagegen spricht allerdings Ihre eigene Argumentation, die Sie oben unter A wie Apokalypse dargelegt haben, dass nämlich Jesus selbst und die erste Generation nach Jesu Tod noch an eine baldige Wiederkunft Jesu glaubte. Für wen hätte man demzufolge eine Biographie Jesu verfassen sollen? Es gibt auch keinerlei schriftliche Belege für derartige Wünsche. Allenfalls kann man aus den Evangelien Rückschlüsse auf schriftliche Spruchsammlungen mit Jesusworten ziehen, die in den Jahrzehnten nach Jesu Tod kursierten.
Erst der jüdisch-römische Krieg mit der Katastrophe von 70 n. Chr. wurde für den Evangelisten Markus zum Anlass, die Worte und Taten des Messias Jesus aufzuzeichnen, um dieses Trauma zu bewältigen und trotz aller Verzweiflung am Evangelium dieses Jesus festzuhalten und aus seinen Worten und Taten zu lernen, worin wirklich der Wille seines Vaters im Himmel für Israel und die Welt besteht. Weitere Jahrzehnte später formulieren andere Evangelisten diese Deutung der Geschichte Jesu auf ihre jeweilige Weise noch einmal neu.
Ihren weiteren Ausführungen über die Entstehung des neutestamentlichen Kanons möchte ich nichts hinzufügen (93) – außer Ihrem Fazit:
„So wie die Bibel menschliches Reden über Glaubensfragen ist, so trifft dies auch für die außerbiblischen Texte zu. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass nur der Bibel ‚wahre Erkenntnisse‘ über Jesus aus Galiläa zu entnehmen sind. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass apokryphe Texte nur Unwahres über Jesus sagen und dass sie deshalb nicht in den Kanon aufgenommen wurden.“
Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die uns bekannten apokryphen Texte vor den kanonischen Evangelien oder gar den Paulusbriefen entstanden sind. Um so zweifelhafter ist es, dass so späte Schriften beweiskräftigere Angaben über den historischen Jesus enthalten sollen als die im Kanon enthaltenen Evangelien.
↑ Bezeichnete sich Jesus als König der Juden – oder nicht?
Zum Stichpunkt (S. 137) K wie König der Juden überraschen Sie mich wieder einmal damit, dass Sie sich selbst widersprechen. Sprachen Sie unter H wie Hinrichtung noch davon, dass Jesus von Hohepriestern zur Todesstrafe durch Steinigung verurteilt worden sein könnte, wissen Sie hier eindeutig:
„Die militärische und damit auch die politische Macht lag bei den römischen Besatzern. Die Rechtsprechung erfolgte entsprechend durch die Römer. Todesurteile wurden ausschließlich von den Römern gesprochen und vollstreckt. Religiöse Querelen zwischen Juden interessierten die Römer nicht. Die römische Justiz hätte keinen Anlass gesehen, etwa auf Grund einer Klage durch die Priesterschaft gegen einen Juden wegen der Missachtung mosaischer Gesetze vorzugehen.“
Ob nun Jesus tatsächlich (S. 138) von Pilatus verhört und gefragt worden ist (Matthäus 27,11; Markus 15,2; Lukas 23,3; Johannes 18,33): „Bist du der König der Juden?“, kann historisch nicht klar beantwortet werden, erst recht nicht, wie genau Jesus darauf geantwortet hat. Da die Evangelisten ihre jeweiligen Ausdeutungen vom Leben und Sterben des Messias Jesus erst ein bis zwei Generationen nach Jesu Tod aufgeschrieben haben, sind diese Fragen nach der Historie wieder einmal müßig.
Nur noch drei Bemerkungen zu weiteren Einzelheiten in diesem Abschnitt (S. 139):
- Dass Matthäus 27,12 in der Mehrzahl von „Hohepriestern“ spricht, beweist immer noch nicht die Unkenntnis des Evangelisten (94); vielmehr bezeichnet archiereis im Plural die Machtelite der Oberpriester im Sanhedrin, während to archiereōs im Singular der eine jeweils regierende Hohepriester ist, der den Vorsitz im Hohen Rat hat.
- Ob es tatsächlich einen Prozess gegen Jesus gegeben hat, ist historisch ungewiss; vielleicht ist er auch einfach ohne Prozess als angeblich Aufständischer von den Römern hingerichtet worden. Dass Matthäus den jüdischen Hohepriestern die Verantwortung zuschiebt, Jesus an die römischen Machthaber auszuliefern, hat sicherlich mit einer innerjüdischen Anklage gegenüber den Mächtigen im eigenen Volk zu tun; damit werden aber die Römer keineswegs entschuldigt.
- Im Johannesevangelium scheint Pilatus nach 19,16 zwar Jesus den Hohepriestern zur Kreuzigung auszuliefern, aber tatsächlich sind es doch Soldaten Roms, die Jesus kreuzigen, und Pilatus behält das Sagen auch über die Kreuzesinschrift. Johannes irrt also nicht, er kennt sich präzise aus – vor allem in der politischen Verantwortung Roms und der korrupten Machtelite Judäas, für die es keinen König mehr gibt außer dem Kaiser (Johannes 19,15) und die Johannes deshalb in so enger Verbundenheit mit Pilatus darstellt.
↑ Wer war verantwortlich für Jesu Kreuzigung?
Zum Stichwort (S. 139) K wie Kreuzigung betonen Sie nochmals die Verantwortung der Römer für Jesu Todesurteil und (S. 140) weisen auf die falsche Darstellung in Johannes 19,14-18 hin:
„Pilatus, der keine Schuld an Jesus findet, händigt ihn den Juden aus. Von den Juden wird er dann hingerichtet, gekreuzigt. Dem Verfasser des Evangeliums nach Johannes unterlief ein fundamentaler Irrtum. Es war den Juden keineswegs gestattet, Hinrichtungen auszuführen, schon gar nicht zu kreuzigen.“
Wie oben und bereits an anderer Stelle gesagt (95): Letzten Endes behält auch bei Johannes die römische Staatsmacht in Gestalt des Pontius Pilatus die Vollmacht über die Kreuzigung Jesu. Der Evangelist betont aber die initiatorische Schuld der judäischen Machtelite, die keinen anderen König mehr kennt als den römischen Kaiser – so beschreibt Ton Veerkamp (96) die politische Analyse des Johannes.
Obwohl Sie einerseits mit Recht die pauschale Verurteilung DER Juden als Gottesmörder ablehnen (die in einer solchen antisemitischen Schärfe aber noch bei keinem Evangelisten vorkommt, da diese selber ja – bis auf evtl. Lukas – Juden waren und am jüdischen Volk und insbesodere seiner Führung innerjüdische Kritik betrieben, wie es auch die Propheten getan hatten), kommen Sie in diesem Abschnitt zum wiederholten Male (S. 141) auf einen „barbarischen Brauch“ zu sprechen, der nach der jüdischen Tora (5. Mose 21,22-23) Ihnen zufolge angeblich regelmäßig geübt wurde, nämlich
„das nachträgliche Zurschaustellen eines bereits Hingerichteten. Ein Gotteslästerer, zum Beispiel, wurde gesteinigt. Anschließend wurde sein Leichnam zur Abschreckung an gut sichtbarer Stelle aufgehängt. Das konnte an einem Baum geschehen oder an einem Pfahl.“
Aber wie bereits gesagt – beschrieben wird im 5. Buch Mose lediglich, was zu tun ist, FALLS eine solche Zurschaustellung (wie selten auch immer) vorkam. Dann durfte nämlich der Leichnam nicht über Nacht hängen bleiben, es sollte also gerade nicht zu einer längeren Störung der Totenruhe kommen (97).
↑ Jesus – in Bethlehem geboren – in Nazareth aufgewachsen?
Zum Thema (S. 142) K wie Krippe verweise ich hauptsächlich auf meine Kommentierung zu Ihrem Beitrag unter N wie Nazareth im Lexikon der biblischen Irrtümer: Jesus kann in dem Nest ‚Nazareth‘ aufgewachsen sein, denn Jesus wird im Neuen Testament so oft mit Nazareth in Verbindung gebracht, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Matthäus in 2,23 diesen Ort erfunden hat, wie Sie annehmen (S. 143):
„Bezug genommen wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf Jesaja [11,1-2]: ‚Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und ein Zweig wird aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.‘ Wo aber ist da von Nazareth die Rede?
Nun, ‚Zweig‘ oder ‚Sprössling‘ heißt auf Hebräisch ‚nezer‘. Und aus ‚nezer‘ machte man den Wohnort Nazareth.“
Gerade weil diese Bezugnahme auf einer bloßen Lautähnlichkeit der verwendeten Wörter „nezer“, „Nazoräer“, „Nazareth“ beruht, ist es ziemlich sicher, dass Matthäus Nazareth nicht erfunden hat; vielmehr will er wohl begründen, warum Nazareth als Heimatstadt Jesu gilt, obwohl es ein so unbedeutendes Nest ist, dass nicht einmal Josephus es kennt und es im ganzen Alten Testament nicht erwähnt wird.
Umgekehrt ist Bethlehem zwar auch kein erfundener Ort, aber dass Jesus sowohl nach Matthäus als auch nach Lukas in Bethlehem geboren ist, hat mit dem theologischen Grund zu tun, dass beide Evangelisten Jesus als den im Alten Testament verheißenen Davidssohn verstehen, der nach Micha 5,1 in der Davidsstadt Bethlehem zur Welt kommen soll.
Was Sie sonst in diesem Kapitel schreiben, kann ich weitgehend unterstreichen. Neu war für mich die Information über die Höhlen, die Hirten als Unterschlupf dienten.
Recht gebe ich Ihnen auch in Ihrem abschließenden Urteil (S. 147f.), denn es gibt einfach keine nachprüfbaren Fakten über die Geburt Jesu:
„Wer nun aber glaubt, damit seien Autoren des ‚Neuen Testaments‘ zumindest der frommen Schwindelei oder gar des Betrugs überführt, weil sie im ‚Neuen Testament‘ das ‚Alte Testament‘ nachdichteten, der irrt. Sie glaubten so fest, dass sie zu wissen meinten. Sie wollten Glauben vermitteln und unterschieden nicht mehr zwischen felsenfester religiös motivierter Überzeugung und historischer Wirklichkeit.“
Matthäus bzw. Lukas versuchen nach mindestens 80 Jahren, die Geschichte des Messias Jesus auch mit Hilfe von Erzählungen von seiner Geburt in die Verheißungen der Heiligen Schrift sozusagen hineinzuschreiben. Im Glauben haben sie ihn als diesen Messias erfahren; in ihm erfüllt sich, was die Propheten vom erwarteten Messias vorausgeschaut hatten, und was von ihm geglaubt wird, muss von den Worten der Schrift her in rechter Weise begriffen werden. Insofern ist die Wahrheit der Kindheitsgeschichten Jesu noch weniger als die Wahrheit anderer Überlieferungen von Jesus auf der historischen Ebene zu suchen, sondern auf der Glaubensebene.
↑ Warum wurde Jesus in Solidarität mit „Räubern“ gekreuzigt?
Zum Stichwort (S. 149) L wie Lästai (oder in meiner Umschrift lēstai) gehen Sie auf die beiden Männer ein, die nach den vier Evangelisten mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. „Zwei andere zu beiden Seiten“ waren es nach Johannes 19,18. Lukas 23,33 werden sie kakourgoi = Übeltäter genannt; in Markus 15,27 und Matthäus 27,38 dagegen heißen sie lēstai.
In seiner Grundbedeutung meint dieser Ausdruck einen Räuber, der im Gegensatz zum Dieb nicht heimlich stiehlt, sondern mit offener Gewalt Menschen überfällt. Wie in Johannes 10,8 konnten damit auch skrupellose Machthaber bezeichnet werden, aber im Römischen Reich wurde das Wort hauptsächlich für revolutionäre Aufständische gebraucht, die nicht vor Gewalt zurückschreckten. Daraus ziehen Sie den Schluss (S. 150):
„Bei diesem Ausdruck handelt es sich um ein Wort aus der Propaganda-Sprache der Römer, das von den Verfassern der beiden Evangelientexte kritiklos übernommen wurde.“
Recht haben Sie damit, dass man mit diesem Wort bereits „die Aufständischen“ gegen Herodes den Großen „sprachlich zu brandmarken und damit zu kriminalisieren“ versuchte und sie deswegen als lēstai, „als mörderische Räuber“, bezeichnete. Aber übernahmen Markus und Matthäus diesen Ausdruck wirklich „kritiklos“? Sie schreiben (S. 152):
„Das Motto der ‚lästai‘ lautete: ‚Kein Herr ist über uns als Gott!‘ Sie waren religiös motivierte Aufständische, keine ‚Räuber‘. Aus dieser massiven Widerstandsbewegung gingen 7 n. Chr. die Zeloten hervor, die mit Gewalt die Römer vertreiben wollten. Aus dem näheren oder weiteren Umfeld dieser militanten Gruppe dürften mehrere Jünger Jesu gekommen sein. Verwundert es da noch, wenn Jesus mit zwei ‚lästai‘ gekreuzigt wurde?
Es ist an der Zeit, dass die verunglimpfende propagandistische Bezeichnung ‚Räuber‘ einer zumindest neutraleren Bezeichnung weicht. ‚Aufständische‘ wäre in jedem Fall zutreffender.“
Dazu zwei Bemerkungen:
- Sie haben Recht, dass lēstai ein Propagandawort war. Aber es wäre nicht korrekt, eine Kritik an diesem Wort sozusagen „verbessernd“ in den Urtext der Bibel oder in die Übersetzungen einzutragen; das wäre eine Textverfälschung, gegen die Sie sich im Lexikon der biblischen Irrtümer im Zusammenhang mit Genderfragen ja auch selbst ausgesprochen haben (98). Im Urtext steht nun mal lēstai – und man kann sich fragen, warum die Evangelisten es verwendet haben.
- Zumindest Markus übernimmt nicht nur einfach die römische Propaganda, sondern er prangert in Markus 11,17 mit dem Wort spēlaion lēstōn = „Räuberhöhle“ unter Bezug auf Jesaja 7,11 gerade die Ausbeutung der Armen durch den Tempel bzw. die mit den Römern verbündete hohepriesterliche Elite an. Als „Räuber“ gelten ihm somit auf jeden Fall gerade auch die fremden und einheimischen Ausbeuter. Indirekt mag die „Räuberhöhle“ sich allerdings auch auf die Situation im Jüdischen Krieg beziehen, als die Zeloten den Tempel zu ihrem Hauptquartier machen, wie Andreas Bedenbender (99) anmerkt.
- Anscheinend übt Markus mit seiner Bezeichnung lēstai bewusst auch massive Kritik an den Zeloten, weil er sie für den aussichtslosen Jüdischen Krieg und seine Folgen (mit-)verantwortlich macht und ihnen Jesu gewaltfreie Haltung gegenüberstellt. Aber dass er Jesus zwischen zwei „Räubern“ gekreuzigt sein lässt, zeigt doch, dass die Zeloten für ihn trotz ihrer entsetzlichen Fehler zum Volk Israel gehören und nicht verdient haben, von den Römern zu Tode gequält zu werden.
↑ Zwei Stammbäume für den Davidssohn bei Matthäus und Lukas – bei Markus hat Jesus weder Stammbaum noch Davidssohnschaft
Zum Stichwort (S. 152) L wie Legitimation gehen Sie auf die beiden unterschiedlichen Stammbäume Jesu in Matthäus 1,1-17 und Lukas 3,23-38 ein.
Zuvor bemerken Sie einleitend (S. 152f.):
„Ein heutiger Autor, spezialisiert auf geschichtliche Themen, mag sich durch Quellen und zeitgenössische Dokumente arbeiten, um eine möglichst seriöse Biographie Napoleons oder Caesars zu erstellen. Wenn er wirklich sauber arbeitet, dann macht er sich ohne vorgefasste Meinung ans Werk. Er lässt sich von den Fakten leiten. Anders gingen die Evangelisten ans Werk.“
Ganz so möchte ich das nicht stehen lassen. Auch professionelle Historiker können niemals ohne vorgefasse Meinungen sein. Niemand kann sich nur von Fakten leiten lassen, weil alle Fakten, so sie literarisch vorliegen, eingeordnet, gedeutet und beurteilt werden müssen. Recht haben Sie allerdings trotzdem damit, dass die Absichten der Evangelisten nicht auf eine objektive Geschichtsschreibung abzielten, sondern auf eine Deutung ihrer Glaubenserfahrungen, die sie mit Jesus gemacht hatten, der für sie der Messias Israels und der Befreier aller Völker war.
Das ist der Grund (S. 153), weshalb die „Verfasser der Evangelien“ einfach davon ausgehen mussten, dass Jesus als der Messias „aus dem Königsgeschlecht Davids“ abstammte (vgl. Lukas 1,31f. und 2,10f.). Und beide schufen je einen Stammbaum, bei dem „historische Korrektheit völlig nebensächlich war“. Mit Recht schreiben Sie (S. 154):
„Ein Beispiel. Nach Matthäus lagen zwischen Zerubabel und Josef neun Generationen, bei Lukas sind es 18. Vergeblich haben sich Generationen von Bibellesern darum bemüht, diese so eklatant abweichenden Angaben zu ‚harmonisieren‘. Das gelingt aber beim besten Willen nicht. Darum ging es auch den Verfassern gar nicht: Sie wollten nur ihrem Glauben Ausdruck verleihen, dass der Messias Jesus eben tatsächlich aus dem Hause Davids stammte.“
Dann aber stellen Sie sich selber die erstaunte Frage:
„Was aber nützen die extrem voneinander abweichenden ‚Stammbäume‘, wenn dann doch die ‚jungfräuliche Empfängnis Mariens‘ in die Quere kommt! Maria wurde schwanger, so berichtet Lukas, ohne Kontakt mit einem Mann im Allgemeinen oder mit Ehegatten Josef im Besonderen gehabt zu haben.“
Mit dieser Frage stellen Sie schlicht Ihre Grundvoraussetzung in Frage, nämlich dass die wichtigste Legitimation des Messias die leibliche Abstammung von David sei. Für Matthäus und Lukas ist es eben nicht die wichtigste, sondern nur eine – und mit der ‚spielen sie‘ gleichsam und führen Josef auf David zurück, wobei Matthäus zugleich ironisch die Doppelmoral der ehrenwerten Patriarchen zur Schau stellt, indem er Jesus quasi eher aus der Reihe von vier ehrenwerten, obwohl eher weniger geachteter Ahnfrauen hervorgegangen sein lässt, in die dann die uneheliche Mutter Maria gut hineinpasst (100). Sie selbst hatten ja übrigens auch schon unter J wie Jojachin die ganze Stammbaumlegitimation über David in Frage gestellt, weil Jeremia die Verheißungen für David mit Jojakim und Jojachin für beendet erklärt hatte. Matthäus will wohl deutlich machen: Indem Gott Jesus als seinen Messias erwählt, kann er sehr deutlich auf krummen Linien gerade schreiben!
Sie konzentrieren sich dann aber doch wieder auf die historische Ebene, indem Sie schreiben:
„Betrachtet man den Sachverhalt nüchtern, so bieten sich zwei Irrtümer an. Für einen muss man sich entscheiden. Beide Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden!“
Damit meinen Sie (S. 155): Entweder kann Josef „Jesu biologischer Vater“ und damit „Nachkömmling Davids“ gewesen sein, dann aber war Jesu „jungfräuliche Empfängnis ein Irrtum“. Wenn aber Jesus ein Jungfrauensohn war, erfüllt er „nicht die Messias-Bedingung. Dann sind die stark widersprüchlichen Stammbäume überflüssig, weil Jesus schon mit seinem Vater erbbiologisch nichts zu tun hat.“
Aber wie Sie zu Beginn dieses Abschnittes bereits sagten: Es geht hier nicht um historische Irrtümer – es geht um Glaubensgeschichte! Historisch richtig ist keiner der beiden Stammbäume. Wer Jesu Vater war, ist nicht herausfindbar. Und auf der Erzählebene der Evangelisten ist beides wahr: Josef ist nicht der leibliche Vater, und trotzdem ist Jesus der Davidssohn – weil Gott es so will! „Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen?“ Dieses Wort aus Hiob 14,4 steht vielleicht im Hintergrund des matthäischen Stammbaums Jesu: Eigentlich hätte aus einer solchen Abstammung sowieso nicht der reine Gottesohn hervorgehen können, dennoch ist er auf wunderbare Weise der, den Gott verheißen hat (101).
Sie erwähnen nun, dass einige Abschreiber des Lukasevangeliums versucht haben, „das unlösbare Problem durch eine Fälschung geschickt aus der Welt zu schaffen“, nämlich indem sie im Text zwei Wörter änderten (S. 155f.):
„So hieß es bei Lukas [2,4]: ‚Er (Josef) war aus dem Hause und Geschlecht Davids.‘ Einige spätere Abschriften machten daraus (102): ‚Sie waren aus dem Hause und Geschlecht Davids.‘ Oder: ‚Beide waren aus dem Hause und Geschlecht Davids.‘ Wenn man auch Jesu Mutter, ohne dass es dafür den geringsten Anhaltspunkt gibt, zur Nachkommin von David machte, verschwand das Problem: Jetzt konnte Jesus auch dann als Nachkomme Davids angesehen werden, wenn er ohne biologische Mitwirkung Josefs jungfräulich empfangen wurde. Dann erfüllte er trotzdem die wichtigste Voraussetzung dafür, der Messias zu sein.“
Um diesen Textsinn herzustellen, war es im griechischen Urtext sogar nur notwendig, lediglich einen Buchstaben zu ändern, nämlich das Wort auton für „ihn“ (auf Josef bezogen) in ein autous für „sie“ (auf Josef und Maria bezogen) zu verwandeln (103). Ob man das allerdings als eine bewusste Fälschungsaktion begreifen muss, lasse ich einmal dahingestellt sein. Vermutlich war es ein schlichter Abschreibfehler. Denn, wenn sie „Jesus über seine Mutter zum David-Spross“ hätten machen wollen, wären sie ja in direkten Widerspruch zu Lukas 3,23 geraten, wo ausdrücklich „Sohn des Josef“ steht.
Ihre Bemerkung (S. 156) zum „Evangelium nach Markus“, nämlich dass in ihm „der Stoff für unzählige religiöse Abhandlungen und Predigten bietende Themenkomplex ‚Vorfahren und Verwandtschaft, Zeugung und Geburt Jesu‘ übersprungen“ wird, beruht insofern auf einem Irrtum, als Markus keineswegs etwas übergeht, sondern umgekehrt die auf Markus aufbauenden Evangelisten Matthäus und Lukas die Geschichten von Jesu Herkunft hinzufügen.
Richtig merken Sie an, dass Markus auf jede „Messiaslegitimation Jesu“ durch einen positiven „Hinweis auf David“ verzichtet. Andreas Bedenbender (104) sieht darin eine indirekte Abgrenzung von der zelotischen Vereinnahmung der davidischen Messiashoffnungen für ihren gewaltsamen Aufstand gegen Rom. So erwähnt Markus zwar David an einigen Stellen, aber
„er gibt alles preis, was Jesus auch nur von ferne mit dem Davidsreich in Verbindung bringen könnte. In Kapitel 2[,25-26] entkleidet er David jeder politischen Macht, und weil doppelt genäht besser hält, wirft er in Kapitel 12[,35-37] die Vorstellung einer Davidssohnschaft noch hinterdrein.“
Zehn oder zwanzig Jahre nach Markus scheinen die Evangelisten Matthäus und Lukas die radikale Abgrenzung des Markus gegen die Rückbesinnung auf David nicht mehr für nötig zu halten; sie beschränken sich darauf, sie in ihrem Sinne umzudeuten.
↑ Die Lücken im Lebenslauf Jesu können nicht gefüllt werden
Zum Stichwort (S. 156) L wie Lücken beschäftigen Sie sich mit den fehlenden Teilen in der Biographie Jesu. Diese Lücken haben schon früh die fromme Phantasie der Christen dazu angeregt, weitere Geschichten über Jesu Kindheit und Jugend zu erdichten. Sehr viel später kamen auch Spekulationen hinzu (S. 160), dass Jesus die Kreuzigung überlebt haben könnte. So behauptete Ende des 19. Jahrhunderts der Gründer der islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908),
„Jesus habe die Kreuzigung überlebt, sei mit einem Wunderöl wieder ganz kuriert worden und habe schließlich den langen Marsch nach Indien angetreten. In Kaschmir sei er schließlich nach einem erfüllten Leben im Alter von stolzen 120 Jahren verstorben und in Srinagar beigesetzt worden.“
In diesem spannenden Kapitel habe ich einiges über das angebliche Grab Jesu in Kaschmir gelernt, das zeitweise auch einem hinduistischen Prinzen oder einem islamischen Propheten zugesprochen wurde. Ihr Fazit (S. 162):
„Mirza Ghulam Ahmads Identifizierung des ‚Jesus-Grabes‘ in Srinagar ist wissenschaftlich nicht haltbar (105). Das wird an den Glaubensüberzeugungen der Anhänger der Ahmadiyya-Sekte nichts ändern.“
Es bleibt also dabei: Was Jesu Leben betrifft, stehen uns nur die Überlieferungen der Evangelien zur Verfügung, die fast nur vom öffentlichen Auftreten Jesu im Alter von etwa 30 Jahren bis zu seinem Tod am Kreuz erzählen. Visionen des Auferstandenen treten hinzu; Matthäus und Lukas ergänzen nur wenige Geschichten, die sich um Jesu Geburt und Kindheit drehen. Letztere sind sicher nicht historisch, aber theologisch weitaus wertvoller als die späteren Kindheitsevangelien, die Jesus eher als verzogene Göre schildern und nichts mit den Anliegen der vier kanonischen Evangelisten zu tun haben.
↑ Glaube und Hoffnung auf Gott bewirken Heilung, nicht Magie
Zu Ihrem Kapitel (S. 163) über M wie Magie möchte ich nur anmerken, dass Sie das Problem sehr gut umreißen, auf Grund welcher Kräfte und in welchem Zusammenhang Jesus seine wunderbaren Heilungen vollzogen haben könnte. Er verstand sich (S. 164) nicht als Magier, von ihm „sind weder magische Zauberformeln noch rituelle Handlungen überliefert“, vielmehr heilt er in der Regel auf Grund des Vertrauens, das ihm bzw. der heilenden Kraft Gottes entgegengebracht wird. Offen bleiben muss Ihnen zufolge dabei aber zum Beispiel die Frage, wie Jesus in Markus 9,14-29 „einen an Epilepsie erkrankten jungen Mann“ heilen kann, obwohl (S. 165) nicht von seinem eigenen Glauben die Rede ist, sondern nur „der Glaube des Vaters an Jesu Kräfte“ erwähnt wird. Zu Recht erinnern Sie auch daran,
„dass für Jesus die gelungenen Heilungen eine apokalyptische Bedeutung haben. Jesus war davon überzeugt, dass die Endzeit unmittelbar bevorstand. In dieser letzten Phase war die Macht des Bösen bereits überwunden.“
Eine Herausforderung für den heutigen christlichen Glauben bleibt Ihre abschließende Bemerkung:
„Fast zwei Jahrtausende sind seither verstrichen. Jesus hat sich also ganz entschieden geirrt: Der Weltuntergang ist bisher ausgeblieben.“
Ich bin überzeugt, dass man trotz dieses Irrtums nicht aufhören muss, an das Kommen des Friedensreiches Gottes zu glauben. Wem der Glaube an Jesus Christus geschenkt ist, dem bleibt es eine lebendige Zukunftshoffnung, die bereits in der Gegenwart Früchte bringt. Er erlebt bereits hier und jetzt Wunder des Heilwerdens durch Vertrauen und Liebe (106).
↑ „Mammon“ = „Gott des Geldes“ oder = „Göttin Mamre“?
Zum Stichwort (S. 166) M wie Mammon kommen Sie auf den Widerspruch in Lukas 16,13 und Lukas 16,9 zu sprechen, dass Jesus einerseits sagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, andererseits aber dazu auffordert: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon.“ Und Sie fragen: „Was gilt nun: Sind Mammon und Gott nun Gegensätze oder nicht?“
Dazu versuchen Sie herauszubekommen, was eigentlich mit „Mammon“ gemeint war. Ist er, wie in „der mittelalterlichen Dämonologie … der Gott des kaufmännischen Geschäftssinns“? Vielleicht (S. 167) geht „Mammon“ auch ursprünglich auf die Göttin „Mammitu“ zurück, deren Name im
„Mittleren Osten … vor Jahrtausenden höchst positiv besetzt [war]. Man sprach davon, dass unerschöpfliche Ströme von Milch aus den Brüsten der Muttergöttin Mammitu flossen. … Auch im vielleicht ältesten Urepos der Weltliteratur taucht die Himmlische auf, im rätselhaften Gilgameschepos. Hier heißt sie ‚Mammetun‘ und war als ‚Mutter des Schicksals‘ hoch angesehen. So wundert es nicht, dass sie auch Eingang ins ‚Alte Testament‘ fand.“
Abgesehen davon, dass „Mammetum, die Schicksalsschöpferin“, die gemeinsam mit den „Anunnaki“, den großen Göttern, die Geschicke festsetzt, gerade mal in einem einzigen Vers des Gilgamesch-Epos vorkommt (107), ist es ziemlich belanglos, ob der biblische „Hain Mamre“, wo Abraham (1. Mose 18,13) wohnt und in dessen Nähe er (1. Mose 23,17 und 25,9) eine Familiengrabstätte kauft und in ihr auch bestattet wird, ursprünglich einer Göttin mit dem Namen „Mamre“ als Kultstätte gedient hatte. Jedenfalls gibt es nirgends auch nur eine Andeutung dafür, dass JHWH als der Gott Israels sich an diesem Ort mit einer älteren Gottheit auseinanderzusetzen hatte. Es mag auch sein (S. 168), dass der Name der in Apostelgeschichte 19,27 erwähnten Göttin Diana ein „Pseudonym“ für „die Urgöttin Mamre“ ist. Aber ich sehe keinen Hinweis darauf, dass der „Mammon“ im Gleichnis Jesu etwas mit einer solchen Göttin „Mamre“ zu tun hat.
Dass die „Mythologin Barbara G. Walker (108) … in Jesu Gleichnis eine tiefere versteckte Botschaft“ erkennt, nämlich dass die „wirkliche Alternative … nicht Gott oder Geld, sondern Gott oder Göttin“ ist, hat wohl mit ihrem Wunsch zu tun, möglichst viel geheimes Wissen der Frauen aufzuspüren.
Aber kann es tatsächlich sein, dass Sie mit Ihrer auf Walker basierenden Interpretation des Jesuswortes Recht haben? Einerseits erklärt Jesus, „man könne nicht Göttin und Gott dienen“. Andererseits fordert er dazu auf:
„Freundet euch mit Mamre an – mit der Göttin, mit der weiblichen Seite Gottes. Und schon sind beide Aussagen keineswegs mehr gegensätzlich. Jetzt schließt nicht mehr eine die andere aus. Jetzt ergänzen sie sich: Freundet euch mit der weiblichen Seite Gottes an, denn sonst sind Gott und Göttin unüberwindbare Gegensätze. Es geht nun nicht mehr um Göttin oder Gott, sondern um das Göttliche mit seinen männlichen und weiblichen Aspekten!“
Oberflächlich gesehen klingt das gut. Aber:
- Es ist absolut auszuschließen, dass Jesus als Jude, der an den Einen Gott Israels glaubt, seine Anhänger dazu auffordert, sich mit einer heidnischen Göttin anzufreunden. Den Namen der heidnischen Göttin mit der weiblichen Seite Gottes zu identifizieren, verbietet sich aus demselben Grund.
- Wer Gottes weiblicher Seite auf die Spur kommen will, sollte lieber seine Barmherzigkeit, seine Mütterlichkeit und viele weibliche Attribute anschauen, die ihm auch in der Bibel beigelegt werden. Nach Erhard S. Gerstenberger ist der biblische Gott nur vordergründig „ein patriarchaler Gott“ – zentral ist er „der befreiende Gott“ (109).
Letzten Endes spricht doch alles dafür, „dass mit ‚Mammon‘ Geld gemeint ist“. Davon geht auch die hinsichtlich der Gleichnis-Interpretation kompetente feministische Theologin Luise Schottroff (110) aus, derzufolge sich Jesus in diesem Gleichnis kritisch mit der Geldwirtschaft und dem bereits im Römischen Weltreich ausgeprägten „Warenterminhandel“ auseinandersetzt.
Warum aber macht Jesus „innerhalb eines Kapitels … zwei konträre Aussagen, die nicht wirklich miteinander in Einklang gebracht werden können“?
„Jesus stellt gleich zwei Forderungen, von denen aber immer nur eine erfüllt werden kann. Denn Jesus sagt einerseits [Lukas 16,13]: Man muss sich für Gott oder für Geld entscheiden, Geld und Gott schließen einander aus. Jesus sagt aber andererseits [Lukas 16,9]: Man muss sich mit Geld Freunde machen, damit man in den Himmel kommt.“
Dazu habe ich oben zum Stichwort B wie Betrug, als es um Jesu „Lob eines Betrügers“ ging, bereits ausgeführt, dass Jesus einerseits für den Verwalter eines raffgierigen Großkapitalisten durchaus Sympathie aufgebracht haben kann und dass er den Betrüger andererseits in paradoxer Weise dafür lobt, weil er innerhalb dieses kapitalistischen Systems des „Mammon“ mit Hilfe schmutzigen Geldes (so Luise Schottroff, S. 211)
„- unfreiwillig – eine für christliche Gemeinden gangbare Praxis vormacht: Geld zu benutzen, um Freundschaften aufzubauen – in diesem Leben und im kommenden Leben“.
↑ Bezeichnete sich schon Jesus als der kommende Menschensohn?
Zum Thema (S. 169) M wie Menschensohn beziehen Sie sich zunächst auf das „Buch Henoch“, das „nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen“ wurde und in dem vom zukünftigen Kommen des „Menschensohnes“ die Rede ist (S. 169f.), genau wie im biblischen Buch Daniel 7,13-14:
Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende.
Im Neuen Testament redet Jesus immer wieder in der dritten Person von diesem Menschensohn, meint aber damit sich selbst. Andere nennen Jesus den Messias, den Sohn Gottes oder auch den Sohn Davids, aber nie reden sie ihn mit „Menschensohn“ an. Der Theologe Larry W. Hurtado (111) vermutet, dass vielleicht der historische Jesus selbst eine aramäische Wendung, die dann mit dem bestimmten Artikel ins Griechische übersetzt wurde, auf sich selber bezogen hat. Im Alten Testament gibt es „den Menschensohn“ nicht mit bestimmtem Artikel. Auf jeden Fall haben die ersten Christen diesen Ausdruck offenbar als besondere Selbstbezeichnung nur für Jesus benutzt.
Einer brisanten Entdeckung meinen Sie auf der Spur zu sein, wenn es in Psalm 146,3 heißt:
Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.
Warum „brisant“?
„Übersetzt man aber etwas genauer, bleibt man näher am hebräischen Text, dann taucht wieder der ‚Menschensohn‘ auf – und das ganz und gar nicht in positivem Licht: ‚Verlasst euch nicht auf Prinzen, nicht auf (einen) Menschensohn, von ihm kommt keine Rettung.‘“
An dieser Stelle ist aber überhaupt nicht der in der Zukunft erwartete Menschensohn oder Messias gemeint. Das Wort BeN ˀADaM oder BaR ˀÄNaSch hieß wörtlich nichts anderes als einfach „Mensch“, und in diesem Sinne ist im Psalm auch von menschlichen Fürsten die Rede. Es handelt sich hier nicht um eine Herabwürdigung des zukünftigen Menschensohnes.
Warum sich christliche Theologen wünschen sollten, dass das Buch Henoch „in den Kanon der Bibel aufgenommen“ wurde, wie Sie meinen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Sie schreiben:
„Denn im Buch Henoch wird ganz eindeutig vom Menschensohn berichtet, der als Messias am Ende der Zeit zu den Menschen kommen wird. Im Gegensatz zu den Belegstellen im ‚Neuen Testament‘ für den ‚Menschensohn‘ zieht niemand die Echtheit des entsprechenden Wortes bei Henoch in Zweifel.“
Aber Henoch behauptet doch weder, dass Jesus der Menschensohn ist, noch könnte er es beweisen. Sie scheinen allerdings den außerbiblischen Texten, „die heute noch als außerbiblisches, apokryphes Schrifttum ein sehr bescheidenes Stiefmütterchendasein fristen“, besondere Sympathie entgegenzubringen. Bisher ist mir nicht deutlich geworden, worauf sich diese Sympathie gründet – ist es nur das Geheimnis des noch Verborgenen, das sich um sie rankt?
↑ Wem galt Jesu Missionsbefehl – Juden? Heiden? Samaritanern?
Zum Stichwort (S. 173) M wie Missionsbefehl fragen Sie sich, warum Jesus nach dem Evangelisten Matthäus neben dem Auftrag in 28,19 „machet zu Jüngern alle Völker“ in 10,5 einen Befehl erteilt,
„der im krassen Gegensatz zum präzise formulierten Missionsauftrag steht. Da heißt es: ‚Diese zwölf (Jünger) sandte Jesus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in die Städte der Samariter.‘“
Unter Berufung (S. 174) auf George M. Lamsa (112) bestreiten Sie allerdings, dass Jesus „wirklich verlangt“ hat, „seine Jünger sollen sich von Nichtjuden fern halten“. Denn:
„Das Wort ‚Straße‘ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht ‚Landstraße‘ oder ‚Weg‘, sondern ‚Art‘. ‚Gehet nicht auf der Heiden Straße‘ heißt also: ‚Nehmt nicht der Heiden Gewohnheit und Sitten an.‘“
Daraus schließen Sie (S. 174f.), dass Jesus „zwei keineswegs widersprüchliche, sondern sich ergänzende Befehle“ erteilte:
„Missionsarbeit war angesagt, aber keine Anpassung an andere Glaubensvorstellungen sollte erfolgen.“
So gerne ich in diesem Fall Ihrer Argumentation folgen würde – ihr widerspricht der zweite Teil von Matthäus 10,5. Denn dort verbietet das Jesuswort ausdrücklich, in eine Stadt der Samariter hineinzugehen, worauf Lamsa nicht eingeht und was kaum im übertragenen Sinn zu interpretieren ist.
Es mag durchaus sein, dass der historische Jesus noch der Auffassung gewesen war, dass seine Sendung sich auf den Bereich des Volkes Israel, also Galiläa und Judäa im engeren Sinne zu beschränken hatte. Auf der Erzählebene des Matthäusevangeliums scheint Jesus diese Haltung während seines irdischen Lebens zu vertreten, als er seine Jünger im Umkreis des eigenen Volkes aussendet; erst als Auferstandener weitet er den Befehl der Aussendung auf alle Völker aus. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Matthäus den „Missionsbefehl“ sicher nicht als einen Aufruf zum Religionswechsel versteht, sondern als Aufforderung, alle Völker die Tora Israels zu lehren, so wie sie der Messias Jesus erfüllt hat.
Interessant ist, dass Jesus im Johannesevangelium dagegen besonderen Wert gerade auf die Wiedergewinnung der Samaritaner zum Volk Gottes legt, während die Heidenmission bei ihm gar keine Rolle spielt (113).
↑ Worauf im AT spielt Matthäus mit dem Wort „Nazoräer“ an?
Auf einiges, was Sie unter (S. 174) N wie Nazoräer schreiben, habe ich bereits unter dem Stichwort K wie Krippe geantwortet. Sie stellen noch einmal die Frage, auf welche Prophezeiung sich Matthäus wohl bezieht, wenn er in 2,23 schreibt:
„Und er (Josef) kam und wohnte in der Stadt, die Nazareth heißt, so dass sich erfüllen möge das Wort des Propheten: Er soll Nazarener heißen.“
Ganz stimmt Ihre Übersetzung nicht, wörtlich steht da Nazōraios = „Nazoräer“, was Sie später (S. 177) selber ebenfalls betonen. Wenn bis 1912 in der Lutherbibel (allerdings seit 1984 nicht mehr) mit „Nazarenus“ oder noch in der heutigen Zürcher Bibel mit „Nazarener“ übersetzt wird, dann mag das tatsächlich als „eine bewusste oder unbewusste Angleichung der griechischen Bezeichnung an Nazareth“ geschehen sein.
Auf die Ähnlichkeit des hebräischen Wortes NeTsäR = „Zweig“ oder „Spross“ in Jesaja 11,1-2 mit Nazareth sind Sie ja bereits oben unter K wie Krippe eingegangen. Aber natürlich meinte Matthäus nicht, dass „Josef wegen der Ähnlichkeit von ‚Nazareth‘ und ‚nezer‘ nach Nazareth gezogen“ ist, nur „um eben die ehrwürdige Prophezeiung zu erfüllen“. Tatsächlich mag Matthäus in 2,23 auf das Wort NeTsäR hindeuten, um zu begründen, warum Jesus ausgerechnet in dem unbedeutenden Kaff Nazareth aufwächst, das noch nicht einmal „in den umfangreichen Auflistungen von Orten im Buch Josua, noch in den sehr exakten Aufzeichnungen des Historikers Josephus zu finden“ ist.
Immerhin erwägen Sie hier (S. 178), dass es „zu Jesu Lebzeiten“ vielleicht doch „ein Dörfchen Nazareth gegeben haben“ könnte, was Sie oben noch grundsätzlich abgestritten hatten, meinen aber, dass „doch niemals aus einem Nazoräer ein Bewohner von Nazareth“ wird. Dem Evangelisten Matthäus ging es aber gar nicht um eine präzise Übereinstimmung zwischen einem Wort, das er als prophetisch verstand, und seiner Erfüllung; ihm genügten oft Ähnlichkeiten einzelner Worte, um ganze Kapitel des Alten Testaments ins Gedächtnis zu rufen und die Geschichte Jesu auf diese Weise in Zusammenhänge einzuordnen, die ihm wichtig waren. Dass er nochmals daran erinnern wollte, dass Jesus ein Nachkomme Isais war, was er schon in 1,5-6 deutlich gemacht hatte, ist für seine Verhältnisse ein fast schon zu simpler Hinweis.
Weiterhin kommt hier aber eine Spur ins Spiel, auf die Sie selbst (S. 176) ebenfalls aufmerksam machen. Im Buch der Richter 13,3-5 heißt es nämlich von der Mutter des Richters Simson, dessen gewaltige Stärke legendär werden sollte:
Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: ‚Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein oder starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst… Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein…
Es ist Matthäus durchaus zuzutrauen, dass er mit seiner zwischen Nazareth und Nazōraios schwankenden Wortwahl auch auf das in diesem Text vorkommende hebräische Wort NaZIR anspielt (114), mit dem nach Eduard König (115) jemand gemeint ist,
„‚der sich von gewissen profanen Dingen (Weingenuss etc.) fern hält, sich dadurch vom gewöhnlichen Menschenleben absondert und eben dadurch zugleich der Gottheit weiht.‘ Die zitierte Stelle aus dem Buch der Richter bezieht sich also nicht auf einen Ort namens Nazareth. Nirgendwo ist im Umfeld davon die Rede, dass jemand in Nazareth das Licht der Welt erblicken wird. Geboren wird, so kündigt es der Engel an, der Superman des ‚Alten Testaments‘, Simon. Mit Jesus hat das offensichtlich überhaupt nichts zu tun.“
Vielleicht wollte Matthäus aber doch durch diese kleine Andeutung bewirken, dass seine Leser sich fragten: War Jesus ein Held, der die Kraft von Simson besaß (nicht „Simon“, wie Sie wohl auf Grund eines Druckfehlerteufelchens schreiben), oder worin bestand seine Stärke?
Möglicherweise hat übrigens auch der Evangelist Lukas Richter 13 im Hinterkopf, als er die Ankündigung der Geburt Jesu durch einen Engel an Maria sehr ähnlich wie dort schildert (116). Ein Engel Gottes übergeht bewusst den Vater des Kindes und wendet sich direkt an die Mutter – das kommt so nur zwei Mal in der Bibel vor.
↑ Nachfolger: Größere Wunder als Jesus?
Zum Stichwort (S. 178) N wie Nachfolger zitieren Sie eine Stelle aus dem Markusevangelium, wo Jesus den „Menschen, die ihm nach seinem Tod folgen werden, Erstaunliches“ zutraut (Markus 16,17-18):
„Die Zeichen aber, die da folgen werden …, sind die: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden. Schlangen werden sie vertreiben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden.“
Sie sehen das mit Recht sehr kritisch, weil „bis ins 20. Jahrhundert“ bei derartigen „Geisteraustreibungen“ Todesfälle vorkamen und auch (S. 179) lebensgefährliche „Experimente mit Schlangen und Gift“ oft tödlich endeten. Dazu sind allerdings zwei Dinge zu sagen:
- Diese Worte stehen in einem Nachtrag zum Markusevangelium. Sie gehen mit Sicherheit nicht auf Jesus selbst zurück, sondern sind ihm in den Mund gelegt worden.
- Dennoch mag man diesem Jesus in den Mund gelegten Wort Sinn abgewinnen können, wenn man auf die in ihm enthaltenen Anspielungen auf Stellen im Alten Testament achtet und es nicht allzu wortwörtlich auslegt .
Weiterhin fragen Sie sich, „welche Wunder Jesus vorschwebten“, als er in Johannes 14,12 davon sprach, dass „seine Nachfolger noch größere Wunder vollbringen [würden] als er selbst“. Denn: „Ein größeres Mirakel als die Auferweckung von Toten gibt es wohl kaum.“
Ich denke: Jesus schwebten keine Mirakel vor, denn die lehnte er ja gerade ab. Es ging ihm um das Wunder, dass Menschen zur Liebe fähig werden, dass menschliche Gesellschaften es schaffen, in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden miteinander zu leben. Das wäre so ein größeres Wunder – aber zu Stande gebracht haben wir es noch nicht.
↑ Die Nächstenliebe war kein „neues Gebot“ Jesu
Zum Thema (S. 179) N wie Nächstenliebe unterstreichen Sie völlig zu Recht (S. 180), dass das Alte Testament nicht aus einem erdrückenden Gesetz besteht, das letzten Endes „Menschenwerk“ und zu einer „Schlinge“ geworden ist, in die sich „die Juden … verfangen haben“ (wie es die christlichen Theologen Joachim Jeremias (118) und Heinrich Schlier (119) behauptet haben). Richtig ist vielmehr:
„Für den gläubigen Juden ist das, was der Christ ‚Altes Testament‘ nennt, vergleichbar mit dem ‚Neuen Testament‘ für den Christen: ‚Evangelium‘ oder ‚Eu-angelium‘, also Frohe Botschaft. Es geht um die Geschichte Israels und um Gottes Zuwendung zu seinem Volk.“
Recht haben Sie auch darin, dass Jesus die Gottes- und Nächstenliebe nicht erfunden hat (S. 181):
„Der Jesus der Synoptiker formuliert die nach seiner Aussage gleichwertigen Gebote am ausführlichsten. Erfunden hat er sie nicht. Er gestaltet den Text auch nicht frei. Er zitiert vielmehr, leicht abgewandelt, zwei Stellen aus dem ‚Alten Testament‘ und fügt sie zusammen!“
Ein kleiner Irrtum unterläuft Ihnen, wenn sie neben 5. Mose 6,5 als Beleg für die Liebe zu Gott den Vers 34 aus 3. Mose 19 zum Beleg für die Nächstenliebe zitieren. Tatsächlich stützt sich Jesus in Markus 12,31 auf 3. Mose 19,18. Dort ist nämlich von der Nächstenliebe die Rede (120).
Dennoch ist es gut, dass Sie den Vers 34 mit zur Interpretation hinzuziehen, denn dort ist in der Tat auch von der Liebe zum Fremdling die Rede – das heißt, die Juden verstanden die Nächstenliebe keineswegs nur als Liebe unter ihresgleichen, wie manchmal unterstellt wurde.
Wie verhält sich dazu aber nun die Aussage Jesu im Evangelium nach Johannes 13,34? Dort scheint er ja die Liebe als ein völlig neues Gebot zu interpretieren:
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
Sicher ist, dass diese Formulierung vom Autor des Johannesevangeliums stammt, also nicht von Jesus selbst. Nach Ton Veerkamp (121) hebt der johanneische Jesus mit diesen Worten interessanterweise das Gebot der Liebe zu Gott auf! Wenn das stimmen würde, gibt es bei Johannes kein Doppelgebot der Liebe, sondern nur das Gebot der Menschenliebe. Warum? Weil eine auf Gott gerichtete Liebe nicht möglich und nicht dringlich ist, wichtig ist einzig und allein die Solidarität der Menschen untereinander. Diese Einschränkung der Liebe versteht Veerkamp als das Neue in der Lehre des Johannes. Trotzdem vertritt dieser damit kein antijüdisches Evangelium, sondern als Jude, der an den Messias Jesus glaubt, setzt er sich – freilich in sehr scharfer Form wie früher auch die Propheten Israels – mit dem rabbinischen Judentum auseinander, das begonnen hat, die christlichen Gemeinden aus den Synagogen auszuschließen.
↑ Saß Jesus im Glashaus und hielt sich nicht an eigene Verbote?
Zum Stichwort (S. 182) N wie Narr weisen Sie auf einen Widerspruch hin, der mir tatsächlich zu denken gibt. Denn in der Bergpredigt (Matthäus 5,22) sagt Jesus:
Wer aber zu seinem Bruder sagt: ‚Du Nichtsnutz!‘, der ist des Hohen Rats schuldig, wer aber sagt: ‚Du [gottloser] Narr!‘, der ist des höllischen Feuers schuldig!
Aber Jesus selbst hält sich nicht an sein eigenes Verbot, denn im selben Evangelium nach Matthäus wettert er in 23,17 gegen Schriftgelehrte und Pharisäer mit den Worten:
Ihr Narren und Blinden!
Folgerichtig werfen Sie Jesus vor:
„Auch für Jesus sollte gelten: Wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen! Für uns vollkommen unakzeptabel ist, dass Jesus für einen Menschen, der einen anderen als ‚Narr‘ tituliert, den Tod vorgesehen hat. Wenn er schon an andere so extrem strenge Maßstäbe anlegt, dann sollte er die eigene Zunge zügeln und selbst darauf verzichten, andere zu beschimpfen.“
Nun mag man sich zunächst fragen, was eigentlich im Urtext mit dem Wort moros gemeint ist. Interessant ist, dass Sie behaupten (S. 183): „Den ‚gottlosen‘ Narren gibt es nur in der Übersetzung, nicht aber im griechischen Original.“ Aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Das, was wir unter einem Narren verstehen, also einen dummen Menschen oder vielleicht sogar einen Fastnachtsnarren, der für die Zeit der tollen Tage über die Stränge schlägt, ist bei Matthäus gerade nicht gemeint. Vielmehr ist mit dem Wort moros in der Bibel wirklich der törichte, gottlose Mensch im Gegensatz zum guten, gesetzestreuen Menschen gemeint. Wer seinen Nächsten als moros abstempelt, der sagt damit: „Du gehörst in die Hölle!“ Ausführlicher meint Ulrich Luck (122) in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium:
„Dem Beschimpften wird damit jede Gemeinschaft aufgekündigt. Die angedrohte Strafe der Gehenna bezeichnet das Gericht für den Gottlosen, so daß auf diese Weise auf den, der einen anderen so beschimpft, die entsprechende Strafe zurückkommt.“
Insofern wird deutlich, dass Jesus keineswegs einen Menschen, der einen anderen in relativ harmloser Weise beschimpft, mit dem Tode bestrafen will. Er hält allerdings demjenigen, der einen anderen „gottlos“ nennt, in drastischer Weise vor Augen, was er damit eigentlich tut: er verdammt diesen Menschen nämlich wörtlich genommen in die Hölle – und damit spricht er, wenn er falsch urteilt, letzten Endes sich selbst das Verdammungsurteil.
Aber wie kann sich dann Jesus selber das Recht herausnehmen, Menschen als moros zu bezeichnen? (123) Wir wissen zwar nicht, ob es der historische Jesus wirklich getan hat. Matthäus aber mag annehmen, dass Jesus als der Menschensohn und künftige Weltenrichter (Matthäus 25,31-46) durchaus berechtigt ist, ein solches Urteil zu fällen, denn ihm ist der göttliche Geist in Vollkommenheit geschenkt, und so kann er wie Gott selbst den Menschen ins Herz sehen, wie es in 1. Samuel 16,7 heißt:
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.
Das heißt: Wenn Jesus Menschen als gottlose Toren oder Narren bezeichnet, dann hat er guten Grund dazu. Wenn andere Menschen das tun, dann überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten und tun möglicherweise Menschen Unrecht, denen sie eben nicht ins Herz sehen können. Dann würde – auf der Erzählebene des Matthäus – kein Widerspruch mehr bestehen.
↑ Nathan: Ein klarer Irrtum bei Lukas
Zum Stichwort (S. 183) N wie Nathan kommen Sie nochmals auf die Abstammung Jesu zurück, die Sie bereits im Abschnitt L wie Legitimation behandelt hatten, und beschäftigen sich nunmehr mit der Version des Stammbaums Jesu, die der Evangelist Lukas in 3,23-38 bietet.
Auch Lukas „will Jesu Anwärterschaft auf das heilige Messiastum damit begründen, dass Jesus ein direkter Nachkomme des legendären Davids ist“, behauptet aber (Lukas 3,31) dass Jesus „ein Nachkomme des Nathan“ und nicht des Salomo war. Nach 1. Chronik 29,1 ist aber Salomo der von Gott erwählte Nachfolger Davids auf dem Königsthron. Somit unterläuft Lukas
„ein eklatanter Irrtum: Das Königtum wurde nicht via Nathan auf Jesus übertragen, sondern via Salomo.“
Ich gebe wieder zu bedenken, dass hier nicht einfach ein Irrtum vorliegt, sondern dass Lukas eine bestimmte Aussageabsicht mit seiner scheinbar fehlerhaften Liste der Vorfahren Jesu verfolgt.
- Zunächst erinnere ich daran, dass sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas ohnehin keine leibliche Davidssohnschaft Jesu vorliegt, denn beide Stammbäume laufen auf Josef hinaus, der ausdrücklich nicht als leiblicher Vater Jesu bezeichnet wird. In Lukas 3,23 heißt es ja: „Jesus … wurde gehalten für einen Sohn Josefs…“. Genau wie Matthäus (siehe oben) geht es Lukas also nicht um den Nachweis, dass Jesus tatsächlich einen Anspruch auf den davidischen Königsthron hatte, sondern dass er die Verheißungen erfüllt, die mit den alttestamentlichen Messiashoffnungen verknüpft waren. Allerdings tut er das auf eine völlig andere Weise, als die revolutionär agierenden Zeloten sich den Davidssohn vorstellten. Wie bei Matthäus konnte Gott Jesus also auch bei Lukas auf Umwegen zu seinem Messias bestimmen. Auch Lukas „spielt“ mit der Davidssohnschaft Jesu auf seine Weise.
- Möglicherweise ruft Lukas mit der Rückführung des Stammbaums auf Nathan Vorbehalte gegen König Salomo ins Gedächtnis, der nach den ersten Kapiteln des Buches 1. Könige keineswegs unumstritten zum Nachfolger Davids geworden ist und in 1. Könige 11,1-13 abschließend eher negativ beurteilt wird. Auffällig ist, dass Lukas wörtlich Natham statt Nathan schreibt, als ob er selber andeuten wollte, dass es hier nicht um historische, sondern um theologische Wahrheit geht. Vermutlich geht es Lukas gar nicht um den Davidssohn Nathan, von dem wir so gut wie nichts wissen, sondern um die Namensähnlichkeit mit dem Propheten Nathan, der ja David im Auftrag Gottes ins Gewissen redete, als er Ehebruch mit Bathseba trieb und ihren Mann umbringen ließ, um den Ehebruch zu vertuschen. Vielleicht will Lukas auf diese Weise Jesus in gewisser Weise zum Erben der prophetischen Stimme Nathans machen: Er ist jedenfalls nur insofern ein Davidssohn, als er – anders als David und sein Sohn Salomo und genau wie Nathan – bereit ist, ganz und gar den Willen Gottes zu befolgen.
Recht haben Sie darin, dass man nur scheitern kann, wenn man im Sinne historischer Geschichtsschreibung „versucht, König David und den Messias Jesus ‚stammbaummäßig‘ miteinander zu verbinden“. Hier begründen Sie das mit folgendem Satz:
„Zu Lebzeiten von Maria und Josef war das Geschlecht der Davidianer längst ausgestorben!“
Ob das allerdings wirklich stimmt, vermag ich nicht zu beurteilen. Haben Sie Beweise dafür? Eine solche Begründung ist aber gar nicht nötig, denn dass keiner der Stammbäume direkt auf Jesus führt, ist sowieso klar, und dass beide historische Fehler enthalten, ebenfalls. Und Sie selbst hatten ja unter J wie Jojachin nachgewiesen, dass Gott (Jeremia 22,30 und 36,30) die ganze davidische Dynastie ab Jojachin oder sogar ab Jojakim vom Königtum ausgeschlossen hatte. Wenn Jesus im Neuen Testament also doch als Sohn Davids verstanden wird, dann kann das auch nach dem Evangelisten Lukas nur auf Gottes wunderbare Fügungen zurückzuführen sein.
↑ Sollten Jesu Wunder geheim bleiben oder offenbar werden?
Unter dem Stichwort (S.184) O wie Offenbarung wundern Sie sich über einen Widerspruch in den Darstellungen von Jesu Wunderheilungen in den verschiedenen Evangelien. Sie fragen sich, warum Jesus überhaupt heilte, und finden in Johannes 9,3 im Blick auf einen von Geburt an Blinden Jesu Antwort: „es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“ Dazu schreiben Sie (S. 184f.):
„Der Mann wurde also blind geboren, damit Jesus ihn heilen konnte, so die göttliche Macht demonstrierend. So weit die Theorie.
Diese klare, den heutigen Zeitgenossen etwas befremdende Antwort steht im eklatanten Gegensatz zur Praxis und der oftmals von Jesus anbefohlenen Geheimhaltung. Wie sollen denn Gottes Werke offenbar werden, wenn Jesus von ihm selbst Geheilte immer wieder streng zu Geheimhaltung ermahnt? …
Manchmal ist Jesu Geheimniskrämerei geradezu absurd. Einen Kranken zu heilen und dann auch noch zu erwarten, dass der Überglückliche über seine wundersame Genesung schweigen werde, das zeugt nicht gerade von großer Menschenkenntnis.“
Mal sehen, ob ich andeutungsweise deutlich machen kann, was hinter diesem merkwürdigen Satz Jesu und der dazu im Widerspruch stehenden Aufforderung zur Geheimhaltung seiner Wunder tatsächlich steckt:
Der Widerspruch ist nicht im Verhalten des historischen Jesus begründet, sondern in der unterschiedlichen Deutung des Wunderhandeln Jesu bei den Synoptikern einerseits und dem Johannesevangelium andererseits.
Man wird Jesu Verhalten in den synoptischen Evangelien nicht gerecht, wenn man es mit einer hier unpassenden psychologischen Deutung auf mangelnde Menschenkenntnis Jesu zurückführt.
Auf der Erzählebene der Evangelisten Markus und später auch noch des Matthäus und Lukas geht es um etwas völlig anderes. Sie schreiben ja ihr Evangelium in relativer zeitlicher Nähe zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels (Markus vermutlich direkt um 70 n. Chr., Matthäus und Lukas vielleicht zehn bis zwanzig Jahre später), das heißt: Sie verarbeiten in ihren Schriften diese traumatische Erfahrung, dass Jesu Messianität zunächst bis zu seinem Kreuzestod und dann noch einmal in der Katastrophe des Jüdischen Krieges eben NICHT offenbar wurde. Es war, so ihre Deutung, eben NICHT Gottes Wille, dass Jesus hier auf Erden ein herrliches neues Königreich Davids aufrichtet, sondern erst durch sein Leiden und Sterben würde Gott durch Jesus die Menschen auf den Weg eines wahren Friedens führen. Und deshalb wollte Jesus nicht, dass man ihn auf Grund seiner Wundertaten fälschlicherweise als einen Messias feiert, der mit Gewalt gegen die Römer und ihre jüdischen Kollaborateure in einen blutigen Krieg und Bürgerkrieg zieht, wie es wenige Jahrzehnte nach seinem Tod die Zeloten taten.
Als noch einmal zehn bis zwanzig Jahre später die Erinnerung an das genannte Trauma verblasst und die Erfahrung in den Vordergrund rückt, dass auf Jesus vertrauende Gemeinden aus Synagogen ausgestoßen werden, schreibt Johannes ein Evangelium, das sich in der Sprache oft hart mit dem rabbinischen Judentum auseinandersetzt, das von allen messianischen Experimenten die Nase voll hat und daher auch von dem Messias Jesus nichts wissen will.
Dass Jesus sich im Johannesevangelium besonders oft mit den Pharisäern streitet, hängt damit zusammen, dass diese die einzige Gruppe waren, die den Jüdischen Krieg als einflussreiche jüdische Partei überstand (die herrschende Priesterklasse der Sadduzäer hatte ihre Macht bereits mit der Zerstörung des Tempels eingebüßt, und die revolutionären Gruppen der Zeloten fanden spätestens nach den verlorenen weiteren Kriegen gegen die Römer in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. kaum noch Rückhalt unter der jüdischen Bevölkerung).
In dieser Zeit entwirft Johannes eine Konzeption der Wundertaten Jesu, innerhalb derer zuerst Jesus und dann die Jünger Gottes Werke offenbar werden lassen. Dabei kann es so aussehen, als ob Gott den Blinden sozusagen nur zu dem Zweck geschaffen hat, dass Jesus ihn heilen konnte.
Unausgesprochen steht dabei im Hintergrund die Frage, die niemand letztgültig beantworten kann, woher das Böse kommt, ob Gott dafür verantwortlich ist bzw. in welcher Weise es als Schatten der guten Schöpfung Gottes eine Rolle spielt. In diese Richtung geht aber nicht die Aussageabsicht des Johannes.
Der johanneische Jesus wendet sich stattdessen gegen die landläufige Meinung, Blindheit sei eine Strafe Gottes. Stattdessen ist es der Wille Gottes, dass auch Menschen mit Behinderungen in ihrer Würde als Gottes gute Geschöpfe ernstgenommen werden, und zwar so, dass sie nicht nur Heilung erfahren, sondern vor allem auf ihre eigene Verantwortlichkeit vor Gott angesprochen werden.
Dass es Johannes nicht nur um eine vordergründige mirakulöse Heilung geht, zeigt sich vor allem in den Versen 9,35-41: Da stellt Jesus dem Geheilten die Frage, ob er auf den Menschensohn vertraut, und er streitet mit den rabbinischen Juden darüber, ob sie nicht blinder als der ehemals Blinde sind, weil sie in die Sünde der ungerechten und verfehlten Weltordnung verstrickt sind und ihre Mitverantwortung dafür gar nicht wahrnehmen.
Abschließend fragen Sie sich in diesem Abschnitt (S. 185):
„Es gibt einen eklatanten Widerspruch: Auf der einen Seite sollen Jesu Heilungen die Kraft Gottes demonstrieren. Sie sollen die Werke Gottes offenbaren. Auf der anderen Seite ist aber Jesus um strikte Geheimhaltung bemüht. Gibt es hier zwei Überlieferungen? In einer wirkt Jesus im Verborgenen, in der anderen macht ihn seine rätselhafte Fähigkeit zum weithin berühmten Wundermann. Welcher Berichterstatter irrte? Oder irrte sich gar Jesus selbst in seiner Einschätzung der menschlichen Natur?“
Hier sind Sie durchaus auf einer richtigen Spur. Denn – wie gesagt – es gibt zwar nicht zwei Überlieferungen, sondern zwei zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten vorgetragene Deutungen des Wunderwirkens Jesu. Allerdings irrt keine von den beiden Deutungen, denn beide bieten Glaubensvorschläge, die geprüft werden und dann übernommen werden oder auch nicht. Sie können sich sogar ergänzen. Abzulehnen ist der historisierende und psychologisierende Vorwurf, Jesu sei kein Menschenkenner gewesen. Darüber ist schlicht keine Aussage möglich, weil beide Deutungen sicher nicht auf ihn selbst zurückgehen.
↑ Jesus oder Barabbas – von der Menschenverachtung des Pilatus
Zum Thema (S. 186f.) P wie Passah-Amnestie wiederholen Sie, was Sie andernorts zum Auszug aus Ägypten geschrieben haben (124):
„So wie das ‚Alte Testament‘ den legendären Auszug aus Ägypten beschreibt, ist er niemals geschehen. Das Passah-Fest ist nicht Erinnerung an ein historisches Ereignis, sondern Symbol für eine frühe Geschichte, wie unzählige fromme Juden sie gern gehabt hätten.“
Diese Formulierung enthält zwar Wahrheit, aber auch eine abwertende Tendenz gegenüber naiv Gläubigen. Angemessener wäre es zu sagen, dass Israel bzw. die Juden reale Erfahrungen des Protests gegen Unrecht und Unfreiheit, auch reale Befreiungserfahrungen, in die Anfangszeit ihrer Volkwerdung zurückprojiziert haben. Ähnlich wie die Evangelisten Jesu Leben und Sterben, Worte und Taten deuten, so deuten vorher schon die Juden ihre eigene Geschichte mit Erzählungen vielfältiger Art, die allerdings sehr häufig nicht oder nicht vollständig den historischen Tatsachen entsprechen.
Im Zusammenhang mit dem Passah-Fest wiederholen Sie weiterhin (125) Ihre in meinen Augen nicht korrekte Einschätzung der Rolle des Pilatus im Neuen Testament (S. 187):
„Das ‚Neue Testament‘ berichtet von einer Passah-Amnestie: Jesus stand vor dem mächtigen Pontius Pilatus. Der Römer hat großes Mitleid mit dem angeklagten Jesus, den er für unschuldig hielt. Dennoch wagte es der ‚Statthalter‘ nicht, Jesus freizusprechen. Also besann er sich listig einer ‚Gewohnheit‘ [Markus 15,5-7; vgl. Matthäus 27,15; Lukas 23,17; Johannes 18,39]: ‚Zum Fest pflegte er einen Gefangenen freizugeben. Es war aber einer namens Barabbas …‘ Alle vier Evangelien berichten übereinstimmend über die Existenz dieses angeblichen Brauchs.“
Hierzu wiederhole ich, dass vom Mitleid des Pilatus keine Rede sein kann, eher von zynischem Unverständnis, warum ‚die‘ Juden einen harmlosen Spinner unbedingt verurteilen wollen, und von kaltherzigem Kalkül, welches Vorgehen für die römische Weltmacht von Vorteil sein könnte.
Dass die Passah-Amnestie keine historische Grundlage hatte und schon gar nicht, wie im Johannesevangelium angedeutet, ein jüdischer Brauch war, ist wohl richtig. Aber warum „flechten“ die Evangelisten „den Vorfall um die Freilassung des Barabbas“ in ihre Erzählungen mit ein?
Nach Ton Veerkamp (126) tun sie es, „um ihren Gemeinden jegliches Liebäugeln mit den Zeloten, die auch nach dem Krieg politisch aktiv waren, unmöglich zu machen“. Also: auch wenn es die Passah-Amnestie und einen Menschen namens Barabbas niemals gegeben hat, die Evangelisten stellen dennoch die geschichtliche Wahrheit vor Augen, dass sich Juden im Jüdischen Krieg „tatsächlich auf den bewaffneten Kampf eingelassen“ haben, „sie haben tatsächlich Barabbas gewählt“. Bei Johannes ist Barabbas eindeutig ein lēstēs, also ein Terrorist, den man allerdings nach römischer Sprachregelung als „Räuber“ einstufte. Gemeint war ein gewaltbereiter Zelot, dem Jesus als gewaltfrei agierender Messias und Menschensohn gegenüberstand, der nicht mit gewaltiger Macht „auf den Wolken“, sondern „in der Gestalt eines geschundenen, verächtlich gemachten Menschen“ kommt. „So, und nur so, geschieht Befreiung, sagt Johannes. … Jeschua ist die totale und absolute Gegengestalt des zelotischen Messias.“
Im Markusevangelium liegt die Sache nach Andreas Bedenbender (127) noch etwas anders, denn für ihn ist Barabbas möglicherweise sogar wie Jesus ein Unschuldiger (Markus 15,7), der lediglich „mit den Aufständischen, die bei dem Aufstand einen Mord begangen hatten“, inhaftiert wurde. Das hieße, Pilatus hätte das Volk der Juden vor die Alternative gestellt, einen von zwei Unschuldigen kreuzigen zu lassen – ein wahrhaft teuflisch-zynisches Vorgehen.
Lustig machen Sie sich über kuriose Versuche (S. 188), „Jesus und Barabbas zu ein und derselben Person zu erklären!“ Sie verweisen auf zwei Varianten, nämlich
„aus dem ‚barnasch‘, Menschensohn, sei der ‚barbasch‘, Barabbas, geworden“ oder „aus ‚bar rabban‘, aus dem Sohn des Lehrers, der Barabbas. ‚Sohn des Lehrers‘ wird mit ‚Sohn Gottes‘ gleichgesetzt.“
Beide Erklärungen sind für mich nicht schlüssig: Menschensohn heißt BaR ˀÄNaSch, hat ein „N“ zu viel und ein „B“ zu wenig; BaR RaBBaN hat ein „R“ zu viel.
Dennoch mag Matthäus tatsächlich den beiden alternativen Kreuzigungskandidaten zum Verwechseln ähnliche Namen bzw. Titel beilegen. Viel naheliegender ist allerdings die Übereinstimmung von BaR ˀABBaS = „Sohn des Vaters“ mit der Bezeichnung Jesu Christi als „Sohn Gottes“ bzw. des „Vaters im Himmel“. Und die „Handschriften des Evangeliums nach Matthäus“, in denen „der Mann aus Nazareth und Barabbas beide den Vornamen Jesus“ tragen, werden inzwischen durchaus als ursprünglich angesehen. Auf diese Weise mag Matthäus, wie Andreas Bedenbender (128) annimmt, mit anderen Mitteln dasselbe Ziel wie Markus zu erreichen versuchen (zumal das Wort episēmos, das Matthäus 27,16 für Barabbas verwendet wird, nicht unbedingt mit „berüchtigt“ übersetzt werden muss, sondern auch die neutrale Bedeutung „besonders“ oder „bekannt“ haben kann):
„Die Vorstellung einer Verwerfung Jesu durch Israel ist ganz und gar unmöglich. Die einzige Wahl, die das Volk vor Pilatus hatte, war die zwischen Jesus Christus und Jesus Barabbas, zwischen Jesus als Friedensmessias und Jesus als leidendem Gottesknecht.“
Sie dagegen ziehen eine völlig andere Schlussfolgerung:
„Der milde Pilatus ließ demnach das jüdische Volk zwischen zwei Jesussen entscheiden. Der eine würde freigelassen, der andere am Kreuz hingerichtet werden.“
Wie gesagt, ich begreife nicht, wie Sie in der Verurteilung jedenfalls eines Unschuldigen eine Milde des Pilatus erkennen können. Abschließend fragen Sie sich (S. 189):
„Stand also in Wirklichkeit allein Jesus für die Passah-Amnestie zur Wahl? Oder gab es nicht nur einen, sondern zwei Jesusse? Ob man nun von einem oder von zwei Amnestie-Kandidaten ausgeht, macht keinen wirklichen Unterschied. Verantwortlich gemacht für die Kreuzigung Jesu wird bei beiden Varianten das jüdische Volk.“
Genau das aber ist das perfide am Vorgehen des Pilatus – und leider auch mehr und mehr der immer antijudaistischer eingestellten christlichen Kirche –, dass am Ende nur noch DIE Juden – entgegen jeder anzunehmenden historischen Realität – als verantwortlich für den Tod Jesu gelten.
Die Evangelien teilen diese Auffassung aber noch nicht. „Die so genannte ‚Passah-Amnestie‘“ ist zwar wohl erfunden worden, aber nicht, wie Sie meinen, „um die Schuld am Kreuzestod Jesu den Juden zuzuschieben und die historisch verantwortlichen Römer zu exkulpieren“, sondern gerade um das Vorgehen des Pilatus als zutiefst unmenschlich in Frage zu stellen – sei es, dass er, wie bei Markus oder Matthäus, zwischen zwei letztlich Unschuldigen auswählen lässt, oder, bei Johannes, zwischen zwei Messias-Gestalten mit unterschiedlichem politischem Konzept.
Das Szenario des Johannes wäre allerdings, nebenbei bemerkt, historisch schon deswegen unglaubwürdig, weil der reale Pilatus kaum einen Zeloten Barabbas freigelassen hätte, aber es ging ja dem Evangelisten um eine andere Aussageabsicht, nämlich seinen Lesern die verheerenden Folgen der Befürwortung eines zelotischen Messianismus ins Gedächtnis zu rufen.
↑ Wie beurteilte Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten?
Zum Stichwort (S. 190) P wie Pharisäer schreiben Sie, dass Jesus nach Matthäus 23,14 den Pharisäern „ein besonders schlimmes Verbrechen unterstellt“, nämlich dass sie
„den Witwen ihre Häuser wegfress[en]… Beschwichtigend wenden Theologen ein, dass dieser Vers nicht zum ursprünglichen Text des Evangeliums gehört. In älteren Schriftrollen fehlt er. Das heißt, er wurde nachträglich eingefügt. Allerdings findet sich wortwörtlich das gleiche Zitat auch in den Evangelien nach Lukas [20,47] und Markus [12,40].“
Es ist aber wirklich erst die spätere christliche Überlieferung, die den Pharisäern pauschal ein solches Verhalten zuschreibt, indem etwa der genannte Vers ins Matthäusevangelium eingeschoben wurde. Die Parallelen in den Evangelien nach Markus und Lukas sind wiederum nicht wortwörtlich identisch mit dem angeblichen Jesuswort nach Matthäus, denn dort werden erstens nicht Pharisäer, sondern Schriftgelehrte beschuldigt und zweitens auch von diesen nicht pauschal alle, sondern eben nur diejenigen, die sich gesetzeswidrig verhalten.
Schon deswegen trifft ihr folgendes Urteil über Jesus also nicht zu:
„Das Bild von den gemeinen Pharisäern, die sich auf Kosten armer Witwen bereichern, ist historisch falsch. Jesus irrt sich da offensichtlich gewaltig!“
Hier von einem Irrtum Jesu zu sprechen, ist auch insofern fragwürdig, als wir ohnehin nicht wissen, welche Aussagen Jesu in den Evangelien, die sich auf die Pharisäer beziehen, tatsächlich auf den historischen Jesus zurückgehen. Je weiter die Geschichte der entstehenden Christenheit voranschreitet, um so mehr wird der sich immer schärfer ausprägende Konflikt mit dem rabbinischen Judentum auf die Pharisäer zur Zeit Jesu zurückprojiziert.
Keinesfalls werden „die Pharisäer so negativ dargestellt“, weil, wie Sie meinen, „die Evangelien stark römerfreundlich verfasst sind, die Pharisäer aber den Römern gegenüber ablehnend eingestellt waren“. Ganz im Gegenteil: In der Ablehnung der Unterdrückung durch die römische Fremdherrschaft waren sich die frühen Christen mit den Pharisäern und Zeloten weitgehend einig, nur in den Methoden des Widerstandes gab es extreme Unterschiede (129).
Sie irren sich auch in der Zahl der Pharisäer. Ihre Bewegung war keine so kleine Gruppe, wie Sie meinen. Und da sie in Gestalt des rabbinischen Judentums als einzige jüdische Partei das Jahr 70 n. Chr. überlebten, wurden sie schon zur Zeit der Evangelien zu den direkten jüdischen Gegenspielern der Anhänger Jesu, die einen anderen Weg verfolgten als die rabbinischen Juden, obwohl sich die Evangelisten durchaus auch selbst noch als Juden verstanden und auch in der Gegnerschaft zu Rom mit ihnen einig blieben. Es mag allerdings sein, dass sie aus Selbstschutzgründen allzu harte Kritik an Rom vermieden, immerhin konnte jedes Schriftstück der staatlichen Zensur zum Opfer fallen (130).
Auch in Ihre Darstellung der Schriftgelehrten schleichen sich Irrtümer ein. Wie bereits gesagt, kann Jesus sie scharf kritisieren, wo sie sich unrechtmäßig verhalten, aber (S. 191) gerade sein Dialog mit einem Schriftgelehrten über das „größte Gebot“ in Markus 12,28-34 ist von hohem gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe geprägt (131) und wird von Jesus als einem jüdischem Rabbi mit einem anderen jüdischen Rabbi geführt. Sie haben auch insofern Recht, als sich Jesus mit dem jüdischen Schriftgelehrten Rabbi Hillel in der Auslegung des Gebotes der Nächstenliebe weitgehend einig war.
Nicht ganz korrekt ist, was Sie im folgenden Abschnitt über ein angeblich pharisäisches Gebet schreiben:
„Diese beiden Gebote entsprechen aber ganz genau pharisäischer Lehre. Das pharisäische ‚Shema‘-Gebet, das noch heute im alltäglichen Gebrauch ist, lautet (132): ‚Höre, o Israel: Der Herr ist unser Gott und der einzige Gott! Liebe den Herrn, deinen Gott mit all‘ deinem Herzen, mit all deiner Seele und mit all deiner Kraft!‘ Nach pharisäischer Vorschrift genügte es, diese wenigen Worte zwei Mal täglich zu zitieren, um von sämtlichen Gebetspflichten befreit zu werden.“
Bei den Worten des SchɘMAˁ JiSsRaˀEL = „Höre, Israel“ handelt es sich aber nicht um ein auf die Gruppe der Pharisäer beschränktes Gebet, sondern um das grundlegende jüdische Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6,4-5, auf das allerdings die Pharisäer natürlich größten Wert legten.
↑ Missionarische Propaganda stellte Jesus als Herrn der Tiere dar
Zum Stichwort (s. 191f.) P wie Propaganda erwähnen sie, dass ein ägyptischer „Gott namens Sched“ unter dem Namen „El Schaddai“ auch in der Bibel vorkommt, etwa in 1. Mose 17,1 oder in Hiob 13,3. Die übliche Übersetzung von ˀEL SchaDDaJ mit „allmächtig“ stellen Sie in Frage, weil der möglicherweise zu Grunde liegende hebräische Wortstamm SchaDDaD eher „gewalttätig sein, verheeren“ bedeutet.
„Es sieht so aus, als habe man reichlich willkürlich und – sprachwissenschaftlich gesehen – mit Gewalt einen positiv klingenden Ausdruck gewählt.“
Damit mögen Sie Recht haben – zumal etwa Hiob im gleichnamigen Buch Gott tatsächlich anklagt, weil er in seinem Verhalten den gerechten und barmherzigen Gott Israels nicht wiedererkennt. Und bereits der gerechte Gott Israels wird in den Psalmen als gewaltiger Gott dargestellt und kann seine Ziele von Recht und Gerechtigkeit auch mit zerstörerischen Mitteln der Kulturrevolution verfolgen.
Ihnen erscheint es allerdings „logischer und sinnvoller“, den Gott ˀEL SchaDDaJ mit dem „Lexikon der Götter und Dämonen in der Bibel“ (133) als den Gott des „noch nicht vom Menschen kultivierte[n] Urland[es] der Bergregionen mit der dort heimischen Tierwelt“ zu begreifen. „So wild wie das Land waren auch die Tiere, die in freier Wildbahn lebten.“ Diesem speziellen Gott, so meinen Sie (S. 193) werden möglicherweise auch die Worte aus Psalm 50,10-11 in den Mund gelegt:
Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; und was sich regt auf dem Felde, ist mein.
Nun mag es tatsächlich sein, dass im Hintergrund von ˀEL SchaDDaJ Erinnerungen an einen heidnischen Gott vorhanden waren. Aber in der Bibel hat selbstverständlich der Eine Gott die Funktionen aller Götter übernommen bzw. die Juden waren überzeugt, dass es außer ihm keine anderen Götter mit irgendwelcher Macht gab.
Im Blick auf Jesus behaupten Sie, dass der in der Bibel „bis zur Unkenntlichkeit“ verfremdete ˀEL SchaDDaJ in Ägypten „unter der Bezeichnung ‚Horus-Sched‘ … in der griechisch-römischen Spätzeit … auf unzähligen steinernen Stelen und kunstvollen Amuletten … häufig als nackter Knabe und jugendlicher Herrscher über die unterschiedlichsten Tiere dargestellt“ wird und dass (134) „findige christliche ‚Missionare‘ … gezielt den Jesusknaben mit ‚Horus- Sched‘ gleich[setzten]. So entstanden nur in Ägypten märchenhaft schöne Kindheitsevangelien.“ Bei der durch den Kindermord des Herodes ausgelösten Flucht nach Ägypten (S. 193f.) gelingt es
„dem Jesuskind … dabei stets, sein Vorbild Horus-Sched zu übertrumpfen. Tiere verneigen sich anerkennend vor dem Jesusbaby. Dem Jesusbuben gehorchen die wildesten Tiere der Wüste. Sie sind durch seine Präsenz sofort handzahm, unterwerfen sich der Autorität des kleinen Jesus. Nicht nur, dass sie keine Gefahr mehr für die Menschen darstellen, die Jesus lieb und teuer sind. Sie alle verschonen jeglichen Vertreter der menschlichen Gattung: Löwen, Panther und Drachen. Der kleine Jesus kennt keine Furcht.“
Den Dichtern dieser frommen Geschichten ging es, so Ihr Urteil (S. 194), „um fromme Propaganda zur Gewinnung von neuen Anhängern für den neuen Glauben“. Weniger polemisch könnte man sagen: Sie wollten ihre erfahrene und erkannte Glaubenswahrheit auch in Abgrenzung und Konkurrenz zu anderen religiösen Kulten und Kulturen ausdrücken.
↑ Wie bezieht sich das Neue Testament auf alttestamentliche Prophezeiungen?
Zum Thema (S. 195) P wie Prophetenworte kommen Sie noch einmal ausführlich darauf zu sprechen, dass für Evangelisten wie Briefschreiber des Neuen Testaments „der Lebensablauf des Jesus, genannt Christus aus Galiläa, eine einzige Aneinanderreihung von erfüllten Prophezeiungen aus dem ‚Alten Testament‘“ darstellt.
An vielen Stellen haben Sie bereits kritisiert, dass sich solche Prophezeiungen sehr häufig im Alten Testament gar nicht oder nur andeutungsweise auffinden lassen, und wenn doch, dass sie sich oft ursprünglich gar nicht auf eine ferne Zukunft, geschweige denn genau auf Jesus beziehen.
Und schon häufig habe ich Ihnen entgegnet, dass es neutestamentlichen Autoren darauf ankam, ihr eigenes Vertrauen auf Jesus als Messias Israels von den alttestamentlichen Schriften her zu füllen und zu interpretieren. Zu diesem Zweck genügten ihnen oft wenige Andeutungen, um bestimmte Zusammenhänge der Tora und der Propheten ins Gedächtnis zu rufen.
Ob bereits der historische Jesus selbst in dieser Weise „prophetische Worte … auf sich selbst“ bezogen hat, ist fraglich. Ich beschränke mich darauf, danach zu fragen, was auf der Erzählebene der neutestamentlichen Autoren mit dem Rückbezug auf das Alte Testament ausgesagt werden soll.
Worauf bezieht sich zum Beispiel der johanneische Jesus mit seinem folgenden Wort (Johannes 7,38)?
Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.
In genau dieser Form ist diese Prophezeiung im Alten Testament tatsächlich nirgends zu finden. Nach Ton Veerkamp (135) spielt Johannes allerdings offenbar, wie bereits der Reformator Johannes Calvin meinte, auf das Zeugnis der Gesamtheit der Propheten an. So ist in Jeremia 2,13 von Gott als der „Quelle lebendigen Wassers“ die Rede, in Jesaja 43,19 lässt Gott „Wasserströme in der Einöde“ fließen und in Jesaja 55,1 fordert Gott „alle, die ihr durstig seid“, auf, „zum Wasser“ zu kommen. Alles, wovon dort die Rede ist, wird nach Johannes im Leben derjenigen erfüllt, die auf den Messias Jesus vertrauen.
Und wie ist es mit Matthäus 22,31-32?
Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht: ‚Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.‘? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.
Sie schreiben dazu (S. 195f.):
„Der Text ist unmissverständlich: Jesus fragt seine Jünger, ob sie nicht im ‚Alten Testament‘ von der Auferstehung gelesen hätten. Der zitierte Text ‚Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs‘ findet sich tatsächlich bei Mose [2. Mose 3,6]. Da stellt sich Gott Jahwe dem Mose vor, spricht zu ihm aus einem brennenden Dornbusch. Von ‚Auferstehung der Toten‘ ist allerdings bei Mose nichts zu lesen, dabei sollte doch eben dieser Text eine Aussage über die ‚Auferstehung der Toten‘ enthalten. (‚Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten …?‘)“
Zunächst einmal ist zu sagen, dass nur Luthers Übersetzung hier das Missverständnis nahelegt, an der entsprechenden alttestamentlichen Stelle sei wortwörtlich etwas von der „Auferstehung der Toten“ zu lesen. Im griechischen Urtext steht nämlich am Anfang von Matthäus 22,31: peri de tēs anastaseōs tōn nekrōn und dann erst ouk anegnōte to rēthen hymin tou theou legontos…, genauer übersetzt (nach der Elberfelder Bibel 2006):
Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht…
Der matthäische Jesus argumentiert jedenfalls hier wie ein jüdischer Rabbiner, der er ja auch ist. Das heißt, er denkt manchmal durchaus um die Ecke und bezieht sich sehr indirekt auf eine Bibelstelle. Da Gott kein Gott der Toten ist, aber der Gott Abrahams genannt wird, muss Abraham noch leben, insofern ist im Alten Testament indirekt schon von der Auferstehung etwas zu lesen.
Sie mögen „es schwierig“ finden (S. 196),
„ein angebliches Prophetenwort ausfindig zu machen, wenn im ‚Neuen Testament‘ ein konkreter Sachverhalt geschildert wird, der angeblich bereits im ‚Alten Testament‘ vorhergesagt worden sein soll. Oft wird keinerlei Hinweis gegeben, welcher Prophet denn da angeblich zitiert wird. Manchmal gibt es aber doch entsprechende Hinweise, die den Bibelleser auf die richtige Fährte setzen sollen. So bleibt es dem Suchenden erspart, das gesamte ‚Alte Testament‘ nach Hinweisen zu durchforschen, auch wenn die heutige Computertechnik die detektivische Arbeit wesentlich erleichtert.“
Damals bestand die von Ihnen empfundene Schwierigkeit in dieser Weise aber noch gar nicht, denn in den Synagogen wurde die Tora regelmäßig in einem dreijährigen Zyklus vollständig gelesen, und die Juden hatten auch viele Texte der Propheten und anderen Schriften einfach im Kopf.
Darum genügte es auch, wenn Matthäus 4,14-16 mit dem Hinweis auf Jesaja, die Stämme Sebulon und Naphtali und andere Stichworte auf einen Text wie Jesaja 8,23 und 9,1 anspielt, um den Lesern den ganzen Zusammenhang vor Augen zu führen, in den er seine Botschaft von dem Messias Jesus einbetten will. Natürlich wusste Jesaja damals noch nichts von einem konkreten zukünftigen Jesus von Nazareth und seinen Lebensumständen; es ist umgekehrt: der Evangelist deutet seinen eigenen Glauben an Jesus im Geiste der Botschaft des Propheten Jesaja.
In Ihrem Lexikon der biblischen Irrtümer (136) hatten Sie ja selber deutlich gemacht, dass es der Bibel nicht um Hellseherei und Wahrsagerei im landläufigen Sinn geht, sondern Propheten haben den Willen Gottes zu bekunden. In dieser Linie kann man auch die neutestamentlichen Deutungen der alttestamentlichen Aussagen verstehen: Die Jesusnachfolger waren überzeugt davon, dass der Heilswille Gottes für sein Volk Israel und für die Völker durch den Messias Jesus erfüllt werden sollte.
Nun schreiben Sie aber (S. 197):
„Bei manchen Prophetenworten kann man bezweifeln, ob sie sich mit Jesus erfüllten oder nicht. Man mag zudem kritisch einwenden, dass man nur dann von einer echten eingetroffenen Vorhersage sprechen kann, wenn sie dem ‚Gegenstand‘ der Zukunftsschau unbekannt war. Konkreter ausgedrückt: Wenn ein Wahrsager ankündigt, ein bestimmter Mensch werde eine ganz bestimmte Handlung vollziehen und der Mensch tut, was prophezeit wurde … kann man dann überhaupt von einer echten erfüllten Prophezeiung sprechen? Wenn Jesus sein Leben bewusst nach Prophetenworten ausrichtete, dann mussten sie ja auch in Erfüllung gehen, weil Jesus sie kannte und sie als ‚Regieanweisungen‘ befolgte. Wären sie ihm aber unbekannt gewesen, wären sie dann auch in Erfüllung gegangen? Und haben sie sich denn wirklich erfüllt? Oder wurden die oft vage formulierten Prognosen erst nachträglich durch geschicktes ‚Zitieren‘ passend gemacht? Oder wurden Ereignisse aus Jesu Leben schlicht und einfach so erfunden, dass damit ‚Prophetenworte‘ bestätigt wurden?“
Das heißt, Sie stellen mit einer Reihe kritischer Fragen Ihre eben zitierte frühere Definition von Prophetie grundsätzlich in Frage:
- Indem Sie das Stichwort „Wahrsager“ verwenden, bringen Sie Prophetie in Verbindung mit platter Hellseherei. In dieser Form erfüllte sich hundertprozentig vermutlich kein einziges Prophetenwort.
- Ziemlich albern wäre es zudem, sich vorzustellen, dass Jesus sein ganzes Leben an einer vordergründigen Erfüllung hellseherisch vorausgesehener Prophezeiungen ausgerichtet hätte. Das würde eher „Monty Python‘s Life of Brian“ passen als zur Geschichte Jesu Christi, an den Millionen von Christen glauben.
- Wird aber Prophetie korrekt als Ansage von Gottes Willen verstanden, dann ist es mit einem solchen Verständnis sogar völlig kompatibel, dass Jesus sich natürlich bemüht hat, dem Willen Gottes entsprechend zu leben.
- Umgekehrt ist dann das Vorgehen der Evangelisten und anderen Autoren des Neuen Testaments nachvollziehbar und sinnvoll, mit Hilfe von Rückgriffen und sogar nur vagen Anspielungen auf Texte des Alten Testaments zu verdeutlichen, in welcher Weise Jesu Leben und Sterben zu interpretieren ist, nämlich dass der Wille Gottes für Israel und die Völker zu seiner Erfüllung gelangt, nämlich in Freiheit und Gerechtigkeit, im Gottvertrauen und im Frieden zu leben.
- Zu diesem Zweck haben sich Evangelisten auch die Freiheit erlaubt, Einzelheiten aus Jesu Leben nach Worten aus dem Alten Testament dichterisch zu gestalten. Ob es sich dabei um eigene Erfindungen oder Ausgestaltungen von Überlieferungen handelt, ist meist nicht klar zu beantworten.
Zur Prophezeiung Jesu, er werde „drei Tage und drei Nächte im Grabe liegen“, so „wie Jonas drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war“, wiederholen Sie Ihre Behauptung, dass dies „ganz und gar nicht in Erfüllung“ ging – was ich dazu oben bereits gesagt habe, muss ich hier nicht wiederholen (137). Hier ergänzen Sie die Bemerkung (S. 197f.), dass gerade „dieses angebliche Prophetenwort … aber im kleinen Büchlein ‚der Prophet Jona‘ [2,1] gar nicht als Prophezeiung zu erkennen“ ist. Aber, wie bereits mehrfach gesagt, die neutestamentlichen Autoren „spielen“ oft sozusagen mit alttestamentlichen Bibelstellen und greifen als Prophezeiung auch Texte auf, die nicht als solche gemeint waren – und zwar, um das Neue im Licht des Alten zu interpretieren.
Weiterhin ergänzen Sie (S. 198):
„Die Dreitagesfrist, die Jesus nach der eigenen Prophezeiung im Grabe liegen würde, stehen im unauflöslichen Widerspruch zu einer weiteren Prophezeiung. Im Evangelium nach Lukas sagt Jesus zu dem reuevollen Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird [23,43]: ‚Und er (der andere Gekreuzigte) sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein!‘
Beide Prophezeiungen schließen einander aus: Wenn Jesus nach drei Tagen und drei Nächten von den Toten aufersteht, dann kann er nicht schon am gleichen Tage, also am Tag des Todes, zusammen mit dem anderen Gekreuzigten im Paradies sein. Das ist unmöglich, selbst wenn Jesus noch am Tage der Auferstehung gen Himmel fuhr.“
Und wieder stellen Sie sich mit Ihrer historistischen und faktizistischen Sicht ein Bein. Es geht hier um bildhafte Rede (138). Und bildhafte Rede kann sich widersprechen, ohne unwahr zu werden.
Ein weiteres „prophetisches Versprechen von recht profaner Natur, das nie in Erfüllung ging“, soll Ihnen zufolge Jesus seinen Jüngern gemacht haben. Eben noch hat er ihnen erklärt (S. 199), „dass wohl ein Reicher kaum in den Himmel gelangen könne“, da
„fragt Petrus, was denn sie, seine treuen Jünger, erwarten dürften. Haben sie nicht alles aufgegeben, um Jesu Jünger werden zu können?“
Ganz stimmt das nicht, sowohl in Markus 10,28 als auch in Lukas 18,28 spricht Petrus nur davon, dass sie im Gegensatz zu dem reichen Jüngling, mit dem Jesus zuvor gesprochen hatte, alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Er fragt nicht nach Lohn.
Jesus scheint allerdings von sich aus den Jüngern „recht reiche und profane Belohnungen“ zu prophezeien,
„und zwar nicht für den fernen, nicht näher bestimmbaren ‚Sankt Nimmerleinstag‘, sondern für die unmittelbar bevorstehende Zukunft. Wer Familie, Haus und Äcker aufgibt, um sich Jesus anzuschließen, der wird noch zu Lebzeiten ‚hundertfach empfangen … Häuser, Brüder, Schwestern und Mütter und Äcker‘, später als Zugabe noch ‚das ewige Leben‘.
Man mag unterstellen, dass die zitierte Prophezeiung teilweise tatsächlich in Erfüllung ging. Wer als Jünger Jesus ‚Haus und Hof‘ verließ, der gewann sicher unter Gleichgesinnten neue Freunde hinzu. Vielleicht kann man die engere Anhängerschaft Jesu als ‚neue Familie‘ verstehen. Der versprochene irdische Reichtum hingegen wurde nach biblischen Berichten keinem der Jünger zuteil. Es klingt zudem sehr befremdlich nach einem Versuch Jesu, neue Jünger anzuwerben: Kommt, folgt mir und ihr werdet Reichtümer erhalten. Solche Worte passen schlecht zum Jesus-Verständnis der christlichen Kirchen. Jesus als Bauernfänger, der mit plumpen Tricks Neuzugänge für seine Anhängerschaft suchte?‘“
Befremdlich ist allerdings hier mehr Ihre Interpretation als der Text Jesu selbst. Weder Markus noch Lukas können im Sinn gehabt haben, dass den Jüngern irdische Reichtümer zufallen sollen, auf Grund derer sie womöglich sogar eine künftige herrschende Elite der Gesellschaft darstellen werden. Das würde ihrer gesamten sonstigen Botschaft widersprechen. Ich denke, dass zumindest Lukas hier auf das Gemeineigentum anspielt, an denen nach Apostelgeschichte 4,32-37 alle Mitglieder der Jesusgemeinschaft Anteil hatten. Es geht also nicht darum, dass einzelne Jünger Jesu einen größeren Reichtum als andere anhäufen werden, sondern um ein Gottvertrauen, das damit rechnet, in einer Solidargemeinschaft mit allem versorgt zu sein, was man zum Leben braucht.
Nicht ganz sicher bin ich mir, ob Sie die eigentliche Zielrichtung der christlichen Selbstkritik des Theologen Markus Barth (139) verstanden haben:
„Wir geben zu, dass seit dem ersten Jahrhundert nach Christi Geburt Christen prophetische Aussprüche aus der hebräischen Bibel gesucht, gesammelt und wiederholt haben, um den Juden die Messianität Jesu zu beweisen … Aber das tut ihnen noch den Juden etwas Gutes.“
Es geht Markus Barth nicht einfach um die Frage, ob „die angeblichen ‚Prophezeiungen‘ auch immer welche“ waren. Es geht um die Funktion des Rückgriffs auf das Alte Testament. Ich denke, dass die Evangelisten noch das, was sie im Glauben an den Messias Jesus als Wahrheit erfahren haben, auf dem Hintergrund der Tora und der Propheten zu interpretieren suchten. Erst im Laufe der Zeit verstand die entstehende christliche Kirche immer weniger die Botschaft Jesu Christi vom Alten Testament her, sondern versuchte umgekehrt, diesem nur noch eine Vorläuferfunktion auf das Neue Testament hin zuzubilligen. Die neue Wahrheit des christlichen Glaubens wollte man den Juden beweisen im Sinne einer Aufnötigung, nämlich um sie ins Unrecht zu setzen und zu behaupten, dass nun die Kirche das Volk Gottes sei und Israel enterbt habe. Dagegen wendet sich Markus Barth mit vollem Recht.
Am Ende dieses langen Kapitels (S. 200) kommen Sie dankenswerterweise darauf zurück, was nach dem Alten Testament ein Prophet tatsächlich war:
„Er war nicht in erster Linie dafür da, den Menschen vorherzusagen, was die Zukunft für sie bereithält. Ein Prophet war ein Mensch, der für Gott sprach, auch Künftiges kundtat, aber mehr noch eine moralische Funktion ausübte, kritisierend und mahnend.
Wer das nicht versteht, begreift das Wesen des biblischen Prophetentums nicht. Wer Texte des ‚Alten Testaments‘ mehr oder minder willkürlich zu Weissagungen macht, der mag seinen eigenen Glauben bestätigen, verfälscht aber biblische Aussagen. Verstand Jesus die Propheten falsch, irrte er? Oder irrten die Verfasser des ‚Neuen Testaments‘, die Jesus die Aussagen über angeblich erfüllte Prophezeiungen zuschrieben?“
Hier wiederholen Sie eine eigene widersprüchliche Darstellung des Prophetenthemas aus Ihrem Lexikon der biblischen Irrtümer. Sie haben ja Recht, dass die Propheten keine Wahrsager waren, sondern den Willen Gottes kundtaten. Trotzdem verbanden die Propheten ihre Mahnungen und Trostworte auch mit einer Vorausschau in die Zukunft. Und wenn Jesus oder die Evangelisten oder die Briefschreiber des Neuen Testaments sich auf Texte des Alten Testaments bezogen, um sie als erfüllte Prophezeiungen zu deuten, dann bewegen sie sich zunächst durchaus in der Tradition des rabbinischen Judentums, das in der auslegenden Deutung der Tora und der Propheten oft auch sehr frei verfährt. Wesentlich ist, nicht aus den Augen zu verlieren, worum es in der Prophetie tatsächlich geht: den Willen Gottes klarer zu erkennen.
↑ Historisch gesehen gab es keinen Prozess Jesu vor jüdischen Richtern
Zum Stichwort (S. 200) P wie Prozess nehmen Sie den Prozess gegen Jesus noch einmal genau unter die Lupe. „Mehr als unlogisch“ erscheint es Ihnen, dass man Jesus nach Johannes 18,13 „zunächst zum früheren Hohen Priester, zu Hannas, bringen“ lässt.
„Wieso zum Vorgänger des Amtsinhabers? … Hannas war von den Römern bereits 15 n. Chr. abgesetzt worden.“
Nach Ton Veerkamp (140) geht es hier allerdings nicht um den Versuch, die Ereignisse zur Zeit der Verhaftung Jesu genau zu rekonstruieren. Johannes mag auf eine Überlieferung zurückgreifen, in der Hannas eine Rolle gespielt hat, aber das ist unerheblich. Vielmehr gibt Johannes eine politische Analyse, wie und warum Jesus und seine Bewegung von der jüdischen Führung und den römischen Machthabern eingeschätzt und ausgeschaltet wird und welche Rolle die verschiedenen jüdischen und messianischen Bewegungen in der Folgezeit, vor allem um den Jüdischen Krieg herum, spielen. Er kann sich offenbar nicht vorstellen, dass es eine oder zwei Verhandlungen gegen Jesus vor dem Hohen Rat gegeben hat, was die anderen Evangelisten hervorheben, sondern weist Hannas die Rolle eines Untersuchungsrichters zu, dem gegenüber Jesus keine Chance hat, Gerechtigkeit zu erfahren. So beschreiben auch Sie die Erzählstruktur in Johannes 18,12-29 (S. 201):
„Es hat überhaupt keine Verhandlung gegen Jesus vor dem ‚Hohen Rat‘ gegeben. Es gab nur ein hastiges Verhör von Jesus durch Hannas. Der reichte den Delinquenten an Kaiphas weiter, der ihn wiederum an Pilatus weitergab. Über einen wie auch immer gearteten Prozess unter jüdischer Federführung weiß das nach Johannes benannte Evangelium gar nichts.“
Ton Veerkamp verdanke ich auch den Hinweis, dass in Johannes 18,22, als Jesus im Verlauf des Verhörs durch Hannas von einem Beamten geschlagen wird, für diesen Schlag das Wort rapisma benutzt wird, das im Alten Testament nur ein einziges Mal auftaucht, nämlich in Jesaja 50,6 – dort ist vom Gottesknecht die Rede, mit dem Jesus durch diese Andeutung in Verbindung gebracht werden soll.
Sie haben Recht damit, dass keiner der Evangelisten die Ereignisse um die Verurteilung Jesu historisch genau schildert. Alle verfolgen sie die Absicht, das Schicksal Jesu auf jeweils ihre eigene Weise zu deuten. In einem Punkt führt Ihre Argumentation aber haarscharf an einer entscheidenden Wahrheit über die Evangelisten vorbei (S. 202), und zwar im Zusammenhang mit der Frage, die der Hohepriester an Jesus richtet (Matthäus 26,62): „Bist du der Christus, der Sohn Gottes?“ (141) Nach Ihrem Urteil hätte nämlich keiner der Evangelisten über das Judentum informiert geschweige denn selbst jüdischer Herkunft gewesen sein:
„Es ist kaum anzunehmen, dass diese Frage in einem von gelehrten Juden geleiteten Prozess gestellt wurde. Die Fragestellung offenbart nämlich, dass wer auch immer sie formulierte und im Prozess an Jesus richten ließ, wenig oder keine Ahnung von den Grundprinzipien der jüdischen Glaubenswelt hatte.“
Wie kommen Sie auf diese Unterstellung? Sie schreiben:
„Die Frage unterstellt, dass Christus und Messias als ein und dieselbe Person angesehen wurden. Diese spätere christliche Vorstellung wäre einem Juden völlig fremd vorgekommen. Sie wäre ihm als so absurd erschienen, dass er nie und nimmer die Begriffe so verquickt hätte.“
Hier irren Sie eindeutig. Denn das griechische Wort Christos ist nichts anderes als die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes MaSchIaCh = „Messias“ = Gesalbter. Allerdings wollen Sie auf etwas anderes hinaus:
„Der Christus (eigentlich Christos) war der Gesalbte, der damit nicht gleichzeitig der ‚Sohn Gottes‘ war.“
Es geht Ihnen also gar nicht darum, den Christus und den Messias voneinander zu unterscheiden, sondern den Messias/Christus vom Gottessohn. Hier muss man aber genauer hinsehen:
- Recht haben Sie darin (S. 203), dass im Judentum ein „frommer, redlicher, gesetzestreuer und gottesfürchtiger jüdischer Mensch … ganz allgemein als ‚Sohn Gottes‘ bezeichnet“ werden konnte.
- Es stimmt auch historisch, dass es im „Laufe der jüdischen Geschichte … immer wieder Männer [gab], die von sich behaupteten, der Messias zu sein“, und dass „gegen keinen dieser Männer … Anklage erhoben“ wurde.
- Trotzdem waren zumindest Markus und Matthäus in der jüdischen Tradition verwurzelt. Sie projizieren aber in den Prozess Jesu eine Vorstellung zurück, die seit dem Tod Jesu zur festen Glaubensüberzeugung in den entstehenden christlichen Gemeinden geworden ist, nämlich dass Jesus in anderer Weise als ein „normaler“ jüdischer Gerechter „der“ Sohn Gottes war, der gemeinsam mit dem Vater im Himmel Anbetung beanspruchen durfte . Und eine solche Vorstellung wird zur Zeit der Evangelisten von Seiten des rabbinischen Judentums vehement als Gotteslästerung abgelehnt.
Zum Prozess gegen Jesus urteilen Sie schließlich (S. 204):
„Wichtig ist: Man kann aufgrund der unterschiedlichen Berichte der Evangelisten nicht mehr rekonstruieren, wie der Prozess gegen Jesus tatsächlich verlaufen ist.“
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Man kann sogar vermuten, dass gar kein ordentliches Gerichtsverfahren stattgefunden hat, sondern dass die römischen Behörden mit Jesus einfach kurzen Prozess gemacht haben, vielleicht auf Grund eines Vorfalls wie der sogenannten „Tempelreinigung“, vielleicht auch auf eine Anzeige aus der jüdischen Führungsschicht hin (143).
Interessant finde ich, dass Sie (S. 237) im späteren Abschnitt T wie Tempelzerstörung selber auf das Schicksal eines gewissen „Menachem“ im Jahr 66 n. Chr. zu sprechen kommen. Dieser „selbsternannte Messias“, der wohl „aus einer Dynastie von Aufständischen“ stammte, „wurde nicht von den Römern hingerichtet, sondern von dem Tempelpriestertum nahe stehenden Juden ermordet“. Es gab also durchaus eine Lynchjustiz, die an den römischen Behörden vorbeigehen konnte.
Interessant ist für mich eine Konsequenz, auf die Ihre (S. 205) ausführliche „kritische Analyse des von den Evangelisten geschilderten Prozessverlaufs“ letzten Endes hinausläuft. Die von Ihnen aufgelisteten „Verstöße gegen das damals gültige Recht“ widersprechen vollkommen Ihren Ausführungen über die Todesurteile, die nach den sogenannten MOTh JUMaTh-Texten des Alten Testaments angeblich vom jüdischen Volk unmittelbar durch Steinigung vollzogen wurden. Hier bestätigen Sie die Einschätzung, die ich Ihnen unter Berufung auf Erhard S. Gerstenberger mehrfach entgegengehalten habe, dass es sich bei diesen Texten eben nicht um rechtlich bindende Bestimmungen handelte, sondern um drastische Ermahnungen in der häuslichen oder synagogalen religiös-ethischen Unterweisung.
↑ Außerbiblische Quellen schweigen über den historischen Jesus
Zum Stichwort (S. 206) Q wie Quellen kommen Sie im Blick auf außerbiblische Zeugnisse über den historischen Jesus zu der zutreffenden Einschätzung (S. 211):
„Zieht man … in Betracht, welche Fülle an geschichtlichen Daten über die Zeit Jesu erhalten ist, so nehmen sich die wenigen Hinweise auf Jesus mehr als bescheiden aus. Man muss eigentlich von einem Schweigen der Historiker sprechen. Der historische Mensch Jesus entzieht sich unserem Zugriff.“
↑ Reaktionen auf Johannes den Täufer und auf Jesus
Zum Stichwort (S. 210) R wie Reaktionen fragen Sie sich, wie bestimmte Gruppen von Menschen auf Johannes den Täufer oder Jesus reagiert haben. Während (S. 211) „das jüdische Volk auf Johannes den Täufer … vermutlich positiv“ reagierte, da „seine Kritik“ vor allem an der römischen Besatzungsmacht „für angemessen gehalten“ wurde, konnte es Ihrer Ansicht nach „gefährlich für den Täufer“ werden, wenn er
„die römische Obrigkeit … dazu aufforderte, auf Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung zu verzichten [Lukas 3,13-14]: ‚Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold!‘ Die Römer reagierten rasch und nahmen den Störenfried fest.“
Hier irren Sie gleich in zweierlei Hinsicht:
- Es sind nicht die Römer, die Johannes festnehmen, sondern der Landesfürst Herodes. Der ist zwar von Rom als tetrarchēs = „Vierfürst“ (Herrscher über einen von vier Landesteilen Palästinas) eingesetzt worden, aber ein Römer ist er trotzdem nicht.
- Die Ursache für die Verhaftung des Johannes ist auch nicht seine moderate Aufforderung an römische Soldaten, sich mit ihrem Sold zu begnügen, statt Übergriffe gegen die jüdische Zivilbevölkerung zu begehen. Stattdessen lässt ihn Herodes ausdrücklich wegen der Kritik an seinem Ehebruch mit der Frau seines Bruders ins Gefängnis werfen. Das ist übrigens ein weiterer Beleg dafür, dass Herodes eben kein Römer ist – denn einem Römer hätte man kaum vorgeworfen, sich nicht an das jüdische Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ gehalten zu haben.
Eigentlich wissen Sie beides auch selber ganz genau, denn nur eine Seite weiter (S. 212) zitieren Sie Matthäus 14,3-5 sowie Markus 6, 17-18, wo von Herodes und seinem Ehebruch die Rede ist.
Wie aber reagierte „das Volk der Juden“ auf Jesus? Sie wundern sich darüber, dass ihm nach dem Evangelisten Johannes 2,23 „schon am Anfang seines Wirkens in Jerusalem große Zustimmung zuteil“ wurde, während Jesus „nach Matthäus, Markus und Lukas erst am Ende“ seines Wirken als Messias anerkannt wurde (Matthäus 21,1-9; Markus 11,1-10; Lukas 19,28-40). Und wieder stellen Sie die müßige Frage:
„Wer schildert nun den Sachverhalt richtig, wer falsch? Wer irrt?“
Wenn man überhaupt sinnvoll so fragen kann, dann liegt die historische Wahrheit näher bei den Synoptikern, da möglicherweise ein Vorfall im Tempel die Römer dazu veranlasst hat, mit Jesus kurzen Prozess zu machen. Aber alle Evangelisten hatten theologische Gründe, ihr Evangelium so aufzubauen, wie sie es eben getan haben; es ging ihnen nicht, wie ich schon oft betont habe und was Sie auch wissen, um historische Korrektheit (144).
Weiter fragen Sie:
„Und wenn Jesus in der Metropole Jerusalem für so großes Aufsehen sorgte, sei es nun am Anfang oder am Ende seines Lebens, wieso nahm die Geschichtsschreibung davon keinerlei Kenntnis?“
Vielleicht war das Aufsehen eben doch nicht so groß, das Jesus damals erregte. Die Evangelisten beschreiben die Reaktion der Menschen auf Jesus ja aus ihrer eigenen Perspektive, mindestens eine bis zwei Generationen später, als die Jesusbewegung längst größer geworden ist und begonnen hat, öffentlich sichtbar zu werden. Das mag auch der Grund dafür sein, dass „Josephus Flavius … nicht eine einzige Zeile“ über Jesus schreibt, stattdessen aber auf „Jakobus, den ersten Bischof von Jerusalem“ und „seine Hinrichtung durch Steinigung“ eingeht.
In diesem Zusammenhang unterläuft Ihnen ein Irrtum, indem Sie schreiben, dass Josephus außerdem auch „über Johannes den Täufer, über seine aufsässigen Reden und seine Hinrichtung am Kreuz“ berichtet. Tatsächlich erwähnt Josephus zwar die Hinrichtung des Johannes, aber nicht die Todesart, sondern nur den Ort der Exekution in der Festung Machaerus (145). In diesem Fall darf man wohl darauf vertrauen, dass die Art der Hinrichtung in den Evangelien historisch korrekt überliefert ist, nämlich durch Enthauptung (Matthäus 14,10; Markus 6,27; Lukas 9,9).
↑ Wollte Jesus eine Reform des Judentums – oder die Apokalypse?
Zum Stichwort (S. 214) R wie Reformation gehen Sie zutreffend davon aus, dass Jesus als Jude keine „neue Religion gründen wollte“. Und Sie schicken das Urteil voraus:
„Wenn sich Jesus je grundlegend geirrt hat, dann in der vollkommen falschen Einschätzung der Konsequenzen seines Handelns. Was wollte Jesus, wenn es keine Loslösung vom Judentum war?“
Es ist schon etwas verwegen, über Jesus das Urteil zu fällen, dass er sich in den Konsequenzen seines Handelns so grundlegend geirrt hat, wenn man noch nicht einmal weiß, was Jesus überhaupt wollte. Ob man beides genau herausbekommen kann, mag ohnehin fraglich bleiben.
In einer Hinsicht befinden allerdings Sie sich im Irrtum (S. 215), wenn Sie nämlich unter Bezug auf die „Begegnung zwischen Jesus und einem reichen Jüngling“ (Matthäus 19,16-22; Markus 10,17-22; Lukas 18,18-23) zu einer völlig abwegigen Schlussfolgerung kommen. Daraus, dass Jesus auf die Frage, welche „Gebote … zur Erreichung des ewigen Lebens“ erfüllt werden müssen, die ersten drei der Zehn Gebote nicht erwähnt, kommen Sie auf die Idee, dass „die Reform“ des Judentums, „die Jesus vorschwebte“, eine „Öffnung des Judentums für Menschen mit anderen Gottesvorstellungen“ gewesen sein könnte. Aber (S. 216) ein „solcher Gedanke wäre über Jahrhunderte hinweg“ nicht nur „jedem christlichen Theologen als geradezu ketzerhaft erschienen“, sondern gerade als Jude hätte Jesus mit Sicherheit niemals die ersten drei Gebote außer Kraft setzen oder auch nur abschwächen wollen. Das Vertrauen auf den Einen Gott der Befreiung und der Gerechtigkeit war schlicht die selbstverständliche Voraussetzung für die Disziplin der Freiheit, die sich in den Geboten für das zwischenmenschliche Leben ausdrückte.
Wenn die Theologen Gerd Theißen und Annette Merz (146) davon reden, dass Jesus zwar manche ethischen Normen verschärft, gleichzeitig aber „eine Entschärfung trennender ritueller Normen“ vornimmt, dann meinen auch sie definitiv nicht diese grundlegenden jüdischen Gebote, sondern Reinheits- und Speisevorschriften sowie die Regelungen, die mit dem Tempeldienst zusammenhängen. In der Kritik am Tempel ist Jesus sich auch einig mit Propheten und vielen Rabbinern pharisäischer Prägung.
Mir kommt es so vor, als wollten Sie aus Jesus einen religiösen Reformer machen, der eine Art „Judentum light“ vertritt. Er
„verstärkt jene Vorschriften, die sich auf das seiner Ansicht nach allgemeine sittliche Verhalten beziehen. Gleichzeitig nimmt er aber jene Gebote zurück, in denen es um religiöses Brauchtum und Gottesdienstordnung geht. Die reformatorische Absicht ist deutlich zu erkennen: Jesus wollte keine neue Glaubensgemeinschaft neben dem Judentum gründen. Es ging ihm nicht um die Ausgrenzung anderer, sondern um Integration auf der gemeinsamen Basis moralisch-ethischer Glaubensvorstellungen.“
Aber es ist fraglich, ob eine solche Integration sein Ziel war oder zu seiner Zeit überhaupt sein konnte. An anderer Stelle beschreiben Sie selbst ja Jesu Haltung als apokalyptisch, und ich denke, dass Sie damit eher Recht haben.
Im Recht sind Sie auch insofern, dass er Jude blieb und keine neue Religion gründen wollte. Aber er rechnete damit, dass Gott schon bald der globalen Römischen Weltordnung des Unrechts ein Ende setzen und sein ewiges Friedensreich anbrechen lassen würde. Oben hatten Sie ja bereits gesagt, sein größter Irrtum habe darin bestanden, dass er diesen apokalyptischen Weltuntergang bereits für die nahe Zukunft erwartete.
Wie dem auch sei – Ihre folgenden Erwägungen gehen durchaus in eine richtige Richtung:
„Damit wird aber der große Irrtum Jesu deutlich: Sein Denken, Predigen und Handeln führte dazu, dass sich seine treue Anhängerschaft langsam vom traditionellen Judentum entfernte. Es kam aber keineswegs sofort zu einer Trennung. Die neue Bewegung wurde zunächst nur zu einer immer noch innerjüdischen Sekte. Erst um oder nach 70 n. Chr., also nach der endgültigen Zerstörung des Tempels von Jerusalem, kam es schließlich zur definitiven Trennung vom neuen Christentum einerseits und dem alten Judentum andererseits. In jener Zeit befand sich das Judentum in seiner historischen Krise, von der es sich sehr lange nicht mehr erholen zu können schien.“
Ich stimme Ihnen zu – bis auf den letzten Satz. Nach Marcel Simon (147) konsolidierte sich das Judentum nach der Katastrophe von 70 n. Chr. als rabbinisches Judentum doch relativ schnell. Zunächst blieb es sogar noch als hellenistisch geprägtes missionarisches Judentum aktiv, das nunmehr vom Zwang befreit war, den Tempeldienst rechtfertigen zu müssen.
Je feindseliger die entstehende Kirche sich allerdings dem Judentum gegenüber zeigte und je mehr Macht sie ab der Zeit des Kaisers Konstantin im Römischen Reich gewann, desto mehr zog sich das Judentum erst dann auf sich selbst zurück. Leider war also die christliche Kirche Haupturheber einer „historischen Krise“ des Judentums, wenn man es so ausdrücken will.
Zu Recht schreiben Sie zusammenfassend (S. 271):
„Wer Jesus sucht, der muss ihn im Judentum suchen. Das Judentum ist und bleibt seine Heimat. … Wer Jesus aus seinem historisch-religiösen Zusammenhang herauslöst und vor dem Hintergrund eines zu Jesu Zeiten noch gar nicht existenten Christentums sieht, der kann nur in die Irre gehen.
Wer Jesus sucht, der findet ihn im Judentum. Über Jesus hat auch der Christ Zugang zum Judentum. Er ist die Verbindung mit dem Glauben, der seine tiefen Wurzeln in der lebendigen Welt des ‚Alten Testaments‘ hat.“
↑ Spannende Fragen zum Reinigungsritual der Maria im Tempel
Zum Stichwort (S. 217) R wie Reinigungsritual gehen Sie auf die Rituale der Beschneidung, der Reinigung und der Darstellung ein, wie sie in Lukas 2,21-24 beschrieben werden, und Sie fragen sich, was die „Tage der Reinigung“ bedeuten, „die offensichtlich vom mosaischen Gesetz gefordert“ und „von Jesu Familie vollzogen“, aber „in den Kult des Christentums nicht übernommen“ werden.
In diesem Zusammenhang bringen Sie zwei verschiedene Dogmen der katholischen Kirche durcheinander, und zwar, indem Sie die Beantwortung Ihrer Frage mit folgendem Satz einleiten (S. 217f.):
„In der katholischen Theologie spricht man von der ‚unbefleckten Empfängnis‘ Marias. Diese Bezeichnung wird von vielen Frauen als Beleidigung empfunden. Denn wenn Jesu Fall eine Ausnahme ist, so bedeutet das doch in letzter Konsequenz, dass die normale Empfängnis mit einer ‚Befleckung‘ verbunden ist.“
Hier teilen Sie den Irrtum vieler Menschen, dass mit der „unbefleckten Empfängnis“ Marias die jungfräuliche Geburt Jesu durch Maria gemeint sei. Tatsächlich bezieht sich dieses römisch-katholische Dogma aber auf Marias eigene Geburt, die von ihrer Mutter ebenfalls ohne Sünde, also unbefleckt, empfangen und auf diese Weise von der Erbsünde ausgenommen sein soll.
Ihre Kritik daran, dass sich angeblich viele Frauen beleidigt fühlen, weil „die normale Empfängnis mit einer ‚Befleckung‘ verbunden“ sein soll, richtet sich dann aber zunächst gegen das Ritualgesetz der Juden (S. 218):
„Im Judentum geht man davon aus, dass jede Frau sieben Tage ‚unrein‘ ist, ‚wenn sie ihre Tage hat‘ [3. Mose 15,19].“
Zu diesem Vers äußert sich Erhard S. Gerstenberger (148) in seinem Kommentar zum 3. Buch Mose allerdings ganz anders, als Sie das tun. Einerseits weist er darauf hin (S. 186), dass die männlichen Autoren des Texte „ein eigentümliches Wort“ nämlich „niddah“ verwenden, „das in seiner Bedeutung zwischen ‚Abscheuliches‘ und ‚Menstruation‘ schwankt und das in der jüdischen Tradition in starkem Maße das männliche Unbehagen gegenüber dem weiblichen Zyklus aufgefangen hat.“ Andererseits aber (S. 188) hat die „Tabuzeit“ der weiblichen Unreinheit eher positive Folgen für die Frau, denn sie „entzog die Frau … der Verfügungsgewalt ihres Eheherrn.“
Gerstenberger beruft sich schließlich (S. 189) „auf das Zeugnis orthodoxer Jüdinnen“, um zu klären, ob „in den Gesetzen eine Diskriminierung der Frau erkennbar“ ist. Vera L. Chahon (149) beispielsweise weist nach Gerstenberger darauf hin, dass die
„Pflichten der Jüdin … bei der Beobachtung ihrer Monatsregel … ganz in ihre eigene Verantwortung gestellt [sind]. Dem Mann, der sich anmaßen würde, die Menstruation seiner Frau zu kontrollieren, gehören die Hände abgehackt. Die Beachtung der Reinheitsregeln gibt der Frau also die Selbstbestimmung über ihren Körper! Da jeder Geschlechtsverkehr während der Blutung und sieben Tage danach ausgeschlossen ist, bleibt die Frau ein gutes Stück weit autonom. ‚Der jüdische Glaube hindert den Ehemann daran, seine sexuellen Gelüste unkontrolliert auszuleben. So will man ihm zu verstehen geben, daß die Frau nicht sein Lustobjekt ist. Er soll einsehen, daß sie eine Person ist, daß sie Charakter und Rechte hat wie er selbst. Darum lernt der Mann durch die Einhaltung der Karenzzeiten, seine Gefährtin als ein Wesen anzuerkennen, das seinen vollen Respekt verdient.‘“
Aber zurück zum ursprünglichen Thema der Unreinheit der Frau nach einer Geburt. Dazu schreiben Sie (S. 218):
„Nach der Geburt eines Kindes ist die Frau, so hält es das mosaische Gesetz, ebenfalls ‚unrein‘, für wie lange, das hängt vom Geschlecht des Kindes ab: nach Geburt eines Knaben eine Woche [3. Mose 12,2], nach der Geburt eines Mädchens zwei Wochen [3. Mose 12,5]. Nach einer Geburt muss die Mutter erst einmal in Quarantäne zu Hause bleiben. Wiederum ist die Dauer abhängig vom Geschlecht des Kindes: 33 Tage sind es bei einem Buben [3. Mose 12,4], 66 Tage sind es bei einem Mädchen [3. Mose 12,5], eine wahrlich diskriminierende Festlegung! Die von Moses definierte und festgeschriebene ‚Verunreinigung‘ durch ein weibliches Baby hält also doppelt so lang an wie bei einem männlichen Baby.“
Erhard S. Gerstenberger (150) schaut auch hier sehr viel differenzierter hin. Dass die alttestamentlichen Gesetze (S. 138) „in einer patriarchalen Gesellschaft von Männern erlassen“ wurden, ist etwa darin erkennbar (S. 136), dass nach 3. Mose 12,2 der gesamte
„Geburtsvorgang mit Fruchtwasserabgang, Wehen, Ausstoßen des Fötus, Blutungen, Nachgeburt … rituell so viel wie eine Regelblutung [zählt]. „Männer, die so wenig differenzieren, sind nicht Augenzeugen gewesen. Sie verwalten ihre kultischen Riten männerzentriert.“
Er setzt sich weiterhin mit feministischen Autorinnen auseinander (S. 138), die die „speziell auf Frauen gemünzten ‚Reinheitsgesetze‘ … oft – mit Recht – als potentiell diskriminierend“ empfinden und sich, wie zum Beispiel Elga Sorge (151) fragen:
„Sind die natürlichen lebensspendenden Körperfunktionen der Frau (Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) ,unrein‘, d.h. eine ansteckende Krankheit, wie das Judentum jahrtausendelang lehrte (die orthodoxen Juden sogar bis auf den heutigen Tag)? Ist Frausein an sich eine Krankheit?“
Auf der anderen Seite verweist Gerstenberger auf weibliche Stimmen, die den Reinheitsgeboten eine nicht nur negative Rolle zubilligen (S. 139):
„Manche jüdischen Autorinnen betonen demgegenüber die Ehrfurcht und Mystik, welche die alttestamentlichen Reinheitsgesetze inspiriert, und sie verweisen auf ihre Schutzfunktionen gegenüber männlicher Willkür (152). Unstrittig bleibt aber auch bei wohlwollendster Betrachtung, daß die ‚weibliche Unreinheit‘ im Verlauf der christlichen Auslegungsgeschichte der Leviticus-Tradition zum gewichtigen Argument gegen die kultische Gleichberechtigung der Frauen geworden ist“.
Besonders spannend finde ich Gedankengänge, die Gerstenberger abschließend zu diesem Themenbereich erwägt und die ich daher sehr ausführlich zitieren möchte. Er regt nämlich dazu an (S. 139), sich
„auf den Ursprung der Tabuisierung weiblicher Ausflüsse zu besinnen. Der Gedanke des Schmutzes und der Verachtung liegt sicher nicht am Anfang der Ritenbildung, sondern eindeutig die Vorstellung der Mächtigkeit. Die Welt war in polare Geschlechtssphären aufgespalten. Wir kennen eine ähnliche Unterschiedlichkeit auf dem Gebiet der Elektrizität: Es gibt positive und negative Ladungen. Ein geregelter Stromfluß ist nützlich, aber jeder Kurzschluß bringt eine gefährliche Entladung. Die ungeschützte Berührung von weiblicher und männlicher ,Ladung‘ hat nach Ansicht der Alten katastrophale Folgen. Darum ist besonders das weibliche Menstruationsblut – ein außerordentlich unheimlicher, mit der lebengebenden Gebärmutter verbundener Fluß – als Träger der femininen Mächtigkeit gefährlich. Es darf nicht mit ‚Heiligem‘ in Berührung kommen. Vielleicht spielt dabei auch die Vorstellung eine Rolle, daß Jahwe doch eher Träger der entgegengesetzten männlichen Mächtigkeit ist. [Hesekiel] 16,6f. setzt sich freilich souverän über derartige Bedenken hinweg: Gott selbst nimmt sich -im Bild gesprochen! – des Findlings an, wäscht sogar das Blut der jungen Frau ab [Hesekiel 16,9].“
In diesem Zusammenhang fragt er sich dann auch (S. 140), warum
„der Wöchnerin eine doppelte Reinigungszeit nach der Geburt eines Mädchens verordnet [wird, 3. Mose 12,5]? Die Antwort lautet: Weil das weibliche Neugeborene eine doppelte Antikraft zum (männlichen?) Heiligen darstellt. Angst und Vorsicht vor dieser weiblichen Mächtigkeit regieren die Bestimmungen, nicht Verachtung und Diskriminierung! Die Summen der Reinigungstage bei Geburt eines Jungen (7 + 33) und eines Mädchens (14 + 66) ergeben übrigens die heiligen Zahlen 40 und 2 mal 40 und haben somit auch einen gewissen Symbolwert.
Im Ursprung ist die ‚Unreinheit‘ der Frau nicht sexistisch zu interpretieren. Sie entspringt vielmehr dem magischen Verständnis des Heiligen und der Tabuisierung des Menstruations- und Geburtsblutes. Aber de facto führte die häufige, durch Männer (Priester) dekretierte, kontrollierte und bewertete ‚Verhinderung‘ der Frau zu ihrem völligen Ausschluß von jeder kultischen Aktivität. Hatten die Frauen in der vorexilischen Zeit ungehinderten Zugang zum Heiligtum (1 Sam 1f.) und nahmen evtl. an den priesterlichen Verrichtungen teil ([2. Mose] 38,8; 1 Sam 2,22) – nicht zu reden vom Hauskult, der von Frauen versorgt wurde (Jer 44,15-19) –, so bewirkte die Konzentration auf den einen und ausschließlichen Gott Jahwe seit dem Exil eine völlige kultische Entmündigung der israelitisch-jüdischen Frau.“
Aber zurück zu Ihnen und zu Ihrer Kommentierung von Lukas 2,22-23:
Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: „Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen.“
Zu dieser Textstelle (bei deren Zitierung Sie das wörtliche auf 2. Mose 13,11-15 bezogene Zitat weglassen), merken Sie kritisch an (S. 218f.):
„Was genau berichtet Lukas? Offensichtlich geht er davon aus, dass Mutter und Kind, ja vielleicht sogar Vater, Mutter und Kind im Tempel gereinigt werden mussten, weil dies die mosaischen Vorschriften so verlangen. Das ist falsch. Der Ritus bezog sich ausschließlich auf die Frau. Weder das neugeborene Kind noch der Ehemann mussten also den Tempel aufsuchen, wie Lukas behauptet. Und die von Lukas behauptete Pflicht, dass Jesus im Tempel ‚gezeigt‘ werden musste, hat nie existiert. Zu Recht kritisiert Theologieprofessor Gerd Lüdemann (153) ‚die Unkenntnis jüdischer Gesetzesvorschriften‘.“
In der Tat kannte sich der Evangelist Lukas, der Heidenchrist war, mit den jüdischen kultischen Vorschriften wirklich nicht so gut aus. Nur die Mutter des Neugeborenen musste sich einer Reinigung unterziehen, nicht auch ihr Mann oder das Kind.
Allerdings achtet Lukas die Verwurzelung der Familie Jesu im jüdischen Glauben. Dabei bezieht er sich in etwas eigenwilliger Weise auf drei verschiedene Tora-Vorschriften: Die Reinigung der Wöchnerin, die Auslösung des männlichen Erstgeborenen (2. Mose 13,11-15) und die Weihung eines Jungen für Gott (wie es Hanna 1. Samuel 1,22 mit Samuel tut). In der „Darstellung“ Jesu im Tempel wird also nicht etwa Jesus in banaler Weise irgend jemandem „gezeigt“, sondern Lukas bezieht sich darauf, dass ein erstgeborener Sohn nach der Tora Gott gehörte und einen Monat nach seiner Geburt durch einen Geldbetrag „ausgelöst“ werden musste. Die Höhe der Auslösungssumme ist in 4. Mose 18,15-16 festgelegt:
Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei allem Fleisch, es sei Mensch oder Vieh, das sie dem HERRN bringen, soll dir gehören. Doch sollst du die Erstgeburt eines Menschen auslösen lassen… Du sollst es aber auslösen, wenn’s einen Monat alt ist, und du sollst es auslösen lassen nach der Ordnung, die dir gegeben ist, um fünf Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums, das Silberstück zu zwanzig Gramm.
Weiter argumentieren Sie (S. 219):
„Die von Lukas geschilderte Reinigungsepisode [Lukas 2,22-39] muss als ein grober Irrtum bezeichnet werden. Sie kann sich so wie beschrieben nicht abgespielt haben. Oder liegt kein Irrtum vor, sondern Absicht? Lukas hat einen Grund, warum er die gesamte Familie und nicht nur Maria zur Reinigungszeremonie in den Tempel gehen lässt. Nur auf diese Weise ist es möglich, den kleinen Jesusbuben in Verbindung mit dem Tempel zu bringen und ihn von ‚Propheten‘ als Messias preisen zu lassen.“
Und damit haben Sie es genau erfasst – es geht Lukas wirklich nicht um die Erhebung historischer Tatsachen, vielmehr bietet er in den Kindheitsgeschichten von Johannes dem Täufer und von Jesus sozusagen eine Ouvertüre für sein Evangelium des Messias Jesus, in der schon einmal die wichtigsten Themen anklingen. Diese Kapitel wollen mehr noch als alle anderen theologisch und nicht im Sinne exakter Geschichtsschreibung ausgelegt werden. Darum ist es auch völlig unerheblich, ob Simeon und Hanna als historische Personen wirklich existiert haben. Interessant ist unter anderem, dass Jesus nach Lukas aus dem Mund sowohl eines Propheten als auch einer Prophetin als Messias bestätigt wurde.
Sie wundern sich weiterhin darüber (S. 220), dass sich Jesu Eltern über diese prophetischen Reden wundern. Maria hatte doch nach Lukas 1,30-33 schon von einem Engel erfahren, „dass sie den Messias gebären werde“, und nach Lukas 2,19 bewahrte Maria alle Worte der Hirten, die sie über ihren Sohn gesagt hatten, in ihrem Herzen.
Es stimmt, hier besteht ein Widerspruch. Er ist dadurch zu erklären, dass Lukas vermutlich auf unterschiedliche Überlieferungen zurückgriff. Aber warum, so fragen Sie (S. 221),
„ließ man dann die einander ausschließenden Behauptungen stehen und hat sie nicht durch redaktionelle Überarbeitung beseitigt?“
Ganz einfach. Antike Autoren hatten einen sehr hohen Respekt vor der Tradition und nahmen oft lieber Widersprüche in Kauf, als einen Text auf Kosten des überlieferten Materials zu „glätten“, also harmonisierend zu verändern.
↑ Richten – oder nicht richten?
Zum Thema (S. 221) R wie Richten zitieren Sie eingangs Jesu Wort aus Matthäus 7,1, das sich fast genau so auch in Lukas 8,15 findet:
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Einerseits, so schreiben Sie, richtet sich auch Jesus selbst nach diesem Wort, wenn er in Johannes 8,15 sagt:
Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand.
Und in Johannes 12,47 sagt er noch deutlicher:
Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette!
Aber andererseits scheint Jesus in Johannes 9,39 „genau das Gegenteil“ zu erklären:
Und Jesus sprach: „Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen!“
Darin liegt, wie Sie urteilen (S. 222), ein wirklich
„eklatanter Widerspruch…, wenn Jesus einerseits beteuert, er sei nicht zum Richten gekommen, während es an anderer Stelle – beim gleichen Evangelisten – heißt, das genau sei seine Aufgabe.“
Aber dieser Widerspruch kommt nur dadurch zu Stande, dass Sie sich nicht die Mühe machen, danach zu fragen, was mit diesem Wort Jesu wirklich gemeint sein könnte.
Mit seinem Wort „Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet“ im Matthäus- und Lukasevangelium kann Jesus ja nicht die gesamte menschliche Gerichtsbarkeit abschaffen wollen. Gerade nach Matthäus 25,31-46 ist Jesus außerdem als Menschensohn der Richter aller Völker. Allerdings richtet dieser nach dem Kriterium der Barmherzigkeit. Sinnvollerweise kann sich Jesu Ablehnung des Richtens also auf folgende Arten des Richtens beziehen:
- die Verurteilung ohne Barmherzigkeit,
- die Relativierung jeder Beurteilung durch Menschen, die selber fehlbar sind,
- die Vorverurteilung von Menschen ohne ordentliches Gerichtsverfahren.
Die oben von Ihnen zitierten Stellen aus Johannes 8,15 und 12,47 bestätigen diese Einschätzung, dass Jesus zwar doch eine Richtertätigkeit ausübt, aber eben im Sinne eines Aufrichtens oder Rettens, nicht im Sinne eines Niedermachens oder Verdammens.
Und nach Johannes 12,48 versteht Jesus das Gericht am Jüngsten Tage so, dass die Menschen, die Jesus als Messias verwerfen, sozusagen sich selbst schon längst gerichtet haben. Insofern muss eigentlich nicht erst Jesus sie richten.
↑ Von Jesajas Rute oder Reis zur Rose im Weihnachtslied
Zum Stichwort (S. 222) R wie Rose stellen Sie dar, dass der Vergleich des Jesuskindes mit einer Rose im Weihnachtslied „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ auf mehreren Irrtümern beruht.
Zunächst allerdings unterläuft Ihnen der Irrtum, dass sie die in „antiquiert wirkendem Deutsch“ formulierte Gedichtzeile „Aus Jesse kam die Art“ auf den Propheten Jesaja beziehen. Nein, das Wort „Jesse“ ist ein Hinweis auf König Davids Vater „Isai“, der im Hebräischen JiSchaJ und ins Griechische übersetzt Iessai hieß.
Richtig ist trotzdem (S. 223), dass der unbekannte Liederdichter sich auf das Wort des Propheten Jesaja 11,1 bezog, als er das dort erwähnte „Reis“, das „aus dem Stamme Isais“ ausgehen werde, irrtümlich zu einer „Rose“ machte.
Oder war es gar kein Irrtum, sondern eine dichterische Freiheit, die er sich erlaubte? Denn schon Jesaja benutzte ja ein Bild aus der Natur, nämlich das Hervorsprossen eines Triebes aus einem fast abgestorbenen Baumstumpf, um auszudrücken, dass das nach Jesaja 10,20f. fast untergegangene Volk Israel noch eine Hoffnung hatte – warum sollte ein christlicher Liederdichter nicht aus dem Bild des Reises, Triebes, Zweiges oder Sprosses in einem anderen Kulturkreis die mitten im kalten Winter aus dem Schnee hervorbrechende Blüte einer Rose machen dürfen?
Am Ende Ihres Abschnitts kommen Sie dann auch selbst auf die Idee (S. 224), dass bei
„der Formulierung des Liedtextes … die europäische Vorstellung vom Weihnachtsidyll einen starken Einfluss aus[übte]: jungfräulich weißer Schnee glitzert bei klirrender Kälte. Und er wird von einer Rose durchbrochen – ‚mitten im kalten Winter‘.
Mit der historischen Realität Jesu hat dies nichts zu tun. Ein Lesefehler führte zu einem Lied, dessen Bild von der Rose fest im Volksglauben verwurzelt ist.“
Natürlich liegt auf der Hand, dass der Liederdichter mit seiner Umdichtung nicht die historische Realität Jesu treffen konnte. Das war sicher gar nicht seine Absicht. Aber er verstand es, das Empfinden der Hoffnungslosigkeit der Lage des Volkes Israel, das durch das Hervorbrechen eines neuen Triebes am Stamm Isais überwunden wurde, in ein Bild umzusetzen, das im oft winterlich kalten Mittel- und Nordeuropa gar nicht als eine Idylle missverstanden werden muss, sondern als ein Zeichen der Hoffnung für Menschen, denen Kälte und Frost oft lebensgefährdend zusetzten.
Zur Jesajastelle 11,1 gehen Sie übrigens auch noch auf das hebräische Wort ChoTäR ein, das erst in der Lutherbibel 1984 und 2017 mit „Reis“ übersetzt wird. Bei Luther selbst stand ursprünglich (und bis zur Revision von 1912) das Wort „Rute“, und die Bedeutung „schwankende Rute“ ist in Ihren Augen auch die eigentliche Grundbedeutung von CHoTäR. Darum fragen Sie sich:
„Warum wurde aus der ‚schwankenden Rute‘ ein ‚Reis‘? Vermutlich aus theologischen Überlegungen: Wenn man das Jesajawort als Prophezeiung verstehen wollte, dann empfand man ‚schwankende Rute‘ für Jesus als unpassend. Also suchte man nach einem positiver besetzten Wort.“
Dazu ist eine ganze Reihe von Einwendungen zu machen:
- Wenn Jesus in dem Gottesknecht wiedererkannt werden konnte, der in Jesaja 53,3 als der „Allerverachtetste und Unwerteste“ bezeichnet wird, dann kann man wohl kaum christlichen Bibelübersetzern unterstellen, sie hielten es für unter der Würde Jesu, aus einer schwachen und „schwankenden Rute“ hervorzugehen. Die Veränderung der Übersetzung liegt wohl eher daran, dass Menschen der Neuzeit unter „Rute“ eben nicht mehr den frischen Trieb eines Baumes oder Strauches verstehen, sondern eher einen schon etwas stärkeren Zweig, der zur Züchtigung verwendet wurde.
- Sie behaupten weiterhin, dass man die Übersetzung unter Bezug auf zwei andere Jesajastellen an die Bedeutung der hebräischen Wörter ZäMaCh = „Spross“ (aus Jesaja 4,2) und JONeQ = „Trieb“ (aus Jesaja 53,2) angeglichen hätte. Dabei lassen Sie außer Acht, dass sogar in Jesaja 11,1 in einer parallelen Formulierung das Wort NeTsäR = „Schössling“ steht (154) – schon dieses Wort bestätigt, dass die Übersetzung „Reis“ oder „Trieb“ für ChoTäR jedenfalls nicht abwegig ist.
- Abgesehen davon muss es schon zur Zeit der Entstehung des Liedtextes von „Es ist ein Ros entsprungen“, also um 1587/88, die Übersetzung „Reis“ für ChoTäR gegeben haben, denn aus dem Wort „Rute“ hätte man kaum die Abwandlung „Rose“ herauslesen können.
↑ Von Schwertern und Pflugscharen und Jesu Aufforderung, ein Schwert zu kaufen
Zum Stichwort (S. 224) S wie Schwert lehnen Sie eingangs mit vollem Recht das Vorurteil ab, das Alte Testament ganz allgemein „als martialisch roh“ einzustufen, während das Neue Testament ausschließlich „als friedlicher Gegenpol gesehen“ wird.
Zum Beleg verweisen Sie auf drei Stellen aus den Prophetenbüchern Joel, Micha und Jesaja (155), dass nämlich
„auf der einen Seite der Prophet Joel zur Gewalt auf[ruft], [Joel 4.10]: ‚Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße!‘ Auf der anderen Seite aber wird auch die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft formuliert. Da wird dann die Aussage des Propheten ins Gegenteil verkehrt [Micha 4,3]: ‚Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.‘ Dieses Szenario wird fast wortgleich auch beim Propheten Jesaja geschildert [Jesaja 2,4].“
Zur Frage, ob Jesus „der friedvolle Pazifist [war], für den ihn viele gern halten“, zitieren Sie (S. 225) Lukas 22,36 mit der Aufforderung Jesu, „seinen Mantel“ zu verkaufen und „ein Schwert“ zu kaufen. Nach George M. Lamsa (156) sind diese
„von Jesus an die Jünger gerichteten Worte … eine aramäische Redensart, die eine alarmierende Lage bezeichnet. Er meinte damit nicht buchstäblich, sie sollten ihre Kleider für Schwerter eintauschen … Jesus wollte seine Jünger auf die nahende Gefahr hinweisen.“
Diese symbolische Bedeutung sehen Sie zu Recht darin bestätigt (S. 226), dass Jesus in Lukas 22,50-51 den Einsatz von Schwertern zu seiner „gewaltsame[n] Verteidigung im Moment der Gefahr“ ablehnt. Das sehen auch alle anderen Evangelien genau so (Markus 14,47; Matthäus 26,51-52; Johannes 18,2-12).
Im Blick auf das Johannesevangelium formulieren Sie allerdings missverständlich und unangemessen reißerisch:
„Er enthüllt, dass Simon Petrus es war, der dem Knecht des Hohen Priesters das rechte Ohr abhaut. Auch der Name des Verletzten wird genannt: Malchus.“
Nein, hier handelt es sich nicht um Enthüllungsjournalismus. Dass Johannes diese Namen nennt, ist nicht unbedingt eine Enthüllung von etwas, was zuvor zu verbergen versucht wurde. Es kann auch sein, dass Johannes dem Text die Namen ohne eine historische Entsprechung hinzugefügt hat. Ob Erfindung oder Enthüllung – das lässt sich also nicht entscheiden.
Wichtiger ist, zu fragen, aus welchem Grund Johannes des Petrus als Täter identifiziert. Ton Veerkamp (157) vermutet als Grund, dass Johannes – anders als die anderen Evangelisten – den Apostel Petrus als gewaltbereiten Zeloten einstuft – und diese Haltung aus seiner Sicht jedoch radikal zurückweist.
↑ Das „göttliche Passiv“ im Aramäischen und Hebräischen – und auch im biblischen Griechisch
Zum Thema (S. 226) S wie Seligpreisungen fragen Sie sich (S. 227), wer denn dafür sorgt, dass die in ihnen ausgesprochenen Verheißungen erfüllt werden. Wer tröstet die Leidtragenden, wer erweist den Barmherzigen Barmherzigkeit? Sie schreiben:
„Eine klare Antwort bietet der biblische Text nicht, nicht in der Übersetzung.“
Überall heißt es nur im Passiv: „sie sollen getröstet werden“, „ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.“ Zu dieser passiven Form schreiben Sie, dass die Muttersprache Jesu, das
„dem Hebräischen sehr verwandte Aramäisch … eine besondere grammatikalische Form [kannte], die es in keiner zweiten Sprache der Welt gibt: das ‚passivum divinum‘. Wenn im Hebräischen im ‚passivum divinum‘ einem Menschen geholfen wird, so wird ihm die Unterstützung durch Gott zuteil, ohne dass der Name Gottes verwendet werden muss, um dies zum Ausdruck zu bringen. Jeder Gläubige wusste, was gemeint war.
Der fromme Jude erkannte sofort, wenn von Gott die Rede war, ohne dass in Worten ausgedrückt werden musste, dass es Gott ist, der Hungernden Speise und Dürstenden Trank zukommen lässt. Jesus benutzte wohl als gläubiger Jude das ‚passivum divinum‘. Es verschwand durch die Übersetzung ins Griechische und durch weitere Übertragungen in moderne Sprachen.
So zeigt es sich, dass eine rein formal korrekte Übersetzung trotzdem in die Irre führen kann. Das ‚passivum divinum‘ existiert als grammatikalische Umschreibung von Gottes Tun, Wirken und Handeln ausschließlich im Hebräischen und im Aramäischen. Bei Übersetzungen muss es verloren gehen, da es keine Entsprechungen in den anderen Sprachen gibt.“
Diese Erklärung trifft allerdings nicht zu. Denn die Form des „göttlichen Passivs“ = passivum divinum unterscheidet sich grammatikalisch gar nicht von einer normalen Passivform. Vielmehr nennt man so die normale Passivform eines Verbs, das ein Handeln Gottes umschreibt, ohne Gott zu nennen. Dieses passivum divinum gibt es, wie wir an den von Ihnen genannten Beispielen sehen, auch im biblischen Griechisch. Um sie als solche zu erkennen und zu verstehen, dazu muss man allerdings über diese Redeweise Bescheid wissen. Allerdings ist selbst in jüdischen Texten nicht immer klar zu entscheiden, ob wirklich mit einem Passiv göttliches oder nicht vielleicht doch manchmal auch menschliches Handeln umschrieben werden soll.
↑ Senfkorn und Senfstrauch – war Jesus im Irrtum über ihre Größe?
Zum Stichwort (S. 228) S wie Senfkorn gehen Sie auf das entsprechende Gleichnis Jesu ein, das die „drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas“ nach Ihrer Zitierung folgendermaßen „übereinstimmend“ überliefern (Matthäus 13,31-32; vgl. Markus 4,30-32 und Lukas 13,18-19):
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte, das ist das kleinste unter den Samenkörnern, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Pflanzen und wird ein Baum.“
Gleich drei Irrtümer beanstanden Sie in diesem „poetische[n] Vergleich…:
Das Senfkorn ist nicht ‚das kleinste unter den Samenkörnern‘, es gibt kleinere wie die von Orchideen.
Das Senfkorn wird keineswegs so groß, dass es alle Pflanzen überragt. Manche Arten werden zwar ‚bis zu 3,30 Meter groß‘ (158), sie sind aber keineswegs größer als ‚alle Pflanzen‘.
Schließlich wird aus keinem Senfkorn der Welt ein Baum.“
Ich streite nicht ab, dass Jesus irren konnte. Allerdings – wer auch immer das Gleichnis zuerst verwendet hat – vielleicht kannte er schlicht keine Orchideen, sondern ging einfach von den Kultursamen aus, die seiner Erfahrung nach ausgesät wurden.
Weiter bedeutet das Wort dendron nicht nur „Baum“, sondern auch „Strauch“, wie noch unser „Rhododendron“ beweist. Und Ihre Übersetzung „alle Pflanzen“ ist falsch, richtig heißt es im Text, dass der Senfstrauch größer wird als alle lachanōn = „Kräuter“; in der Lutherbibel 1545 und 1912 stand noch: „größer denn alle Kohlkräuter“.
↑ Warum wird die Stadt Sepphoris in der Bibel „verschwiegen“?
Zum Thema (S. 229) S wie Sepphoris setzen Sie sich ausführlich mit der Frage auseinander, warum Sepphoris, „ein blühendes kleines Städtchen im Galiläischen“, das „im Jahre 4 v. Chr.“ zerstört und durch „Herodes Antipas (4 v. Chr. – 39 n. Chr.) … zu einer glanzvollen kleinen ‚Metropole‘, die kulturelle Vielfalt bot“, wieder aufgebaut wurde, im Neuen Testament „mit keiner einzigen Silbe“ erwähnt wird (S. 230): „Die Evangelisten verschweigen es ebenso wie die eifrigen Briefeschreiber.“ Ist Jesus dort etwa „bei der Bevölkerung nicht angekommen“? Aber im Blick auf seinen Heimatort Nazareth „wurden Misserfolge des Wanderpredigers Jesus keineswegs verschwiegen“. Sie finden (S. 231) dieses
„Schweigen über Sepphoris … rätselhaft. Wir sind auf Spekulationen angewiesen, denn die Texte des ‚Neuen Testaments‘ geben uns keinerlei Anhaltspunkt. Und die sonst so wortgewandten römischen Geschichtsschreiber hüllen sich auch in Schweigen: Sagt es mehr aus über Jesu Behauptung, der Messias zu sein, als manch beredtes Wort?“
Was Sie mit dem letzten Satz andeuten wollen, bleibt wiederum mir rätselhaft. Was das Schweigen über Sepphoris betrifft, hätte ich die Vermutung anzubieten, dass der historische Jesus ja vor allem den Juden das nahe herbeigekommene Reich Gottes verkündigen wollte. Vielleicht hielt er sich deshalb von den in hellenistischem Prunk aufgebauten Städten eher fern. Sie selbst erwähnen ja „ein prachtvolles Theater“ für „fünftausend Menschen“, das für den Juden Jesus ein Inbegriff heidnischen Götzendienstes gewesen sein muss.
↑ Wollte Jesus durch Milde gegenüber der Ehebrecherin sein eigenes Leben retten?
Unter dem Stichwort (S. 231) S wie Steinigung gehen Sie darauf ein, wie Jesus in Johannes 8,1-11 eine „Ehebrecherin vor dem sicheren Tode“ rettet, und Sie behaupten, dass
„die Interpretation des Textes zu den am häufigsten begangenen Jesus-Irrtümern [gehört]. Laien wie Theologen verstehen häufig die eigentliche Bedeutung des Textes nicht.“
Sie begründen das mit folgendem Gedankengang (S. 231f.)
„Zu Jesu Zeiten galt im ‚Heiligen Land‘ römische Rechtsprechung. Hätte Jesus dem Buchstaben nach das ‚Alte Testament‘ befolgen wollen, dann hätte er zur Steinigung der Frau auffordern müssen. Dann aber hätte er eindeutig gegen geltendes römisches Recht verstoßen! Eine Aufforderung Jesu, die Ehebrecherin zu steinigen, wäre ein Aufruf zum Aufstand gegen Rom gewesen.
Wer altes, längst nicht mehr gültiges jüdisch-mosaisches Recht über geltendes römisches Recht stellt, wendet sich gegen die römische Obrigkeit. Er ist damit ein Rebell, der nach römischer Rechtsprechung nur die Kreuzigung als Urteil erwarten kann.
Jesus rettet mit seiner ‚Milde‘ sein eigenes Leben. Und das der Juden, die ihn herausforderten. Denn hätten sie das Todesurteil vollstreckt, wären sie als Aufständische gekreuzigt worden.“
Dazu ist einzuwenden:
- Genau dieser Abschnitt von der Ehebrecherin ist ein sehr später Einschub ins Johannesevangelium, der schon von daher kaum auf ein historisches Handeln Jesu zurückgeht.
- Aber ganz gleich, ob der Text auf einer alten Überlieferung von Jesus beruht oder von einem späteren Christen erdacht wurde: Ihre Unterstellung, Jesus hätte hier feige sein eigenes Leben gerettet, ist unangemessen und böswillig – zumal oft genug erzählt wird, dass man ihn auf Grund dessen, was er lehrte und tat, töten wollte und er sich am Ende seiner Gefangennahme und Verurteilung nicht durch Gewalt oder Flucht oder Widerruf seiner Lehre zu entziehen versuchte.
- Zur Frage, inwieweit die Steinigung als Todesstrafe geltendem jüdischem Recht entsprach und unter welchen Umständen sie verhängt wurde, habe ich schon mehrfach auf Erhard S. Gerstenberger verwiesen. Insofern kann die Ermahnung Jesu an die Schriftgelehrten und Pharisäer, die eine ehebrecherische Frau verurteilen wollen, sich an die eigene Brust zu fassen, durchaus als Argument innerhalb eines innerjüdischen rabbinischen Streitgesprächs aufgefasst werden.
- Interessant finde ich die Interpretation der Geschichte durch Andreas Bedenbender und Ton Veerkamp : Ihnen zufolge steht die Frau als symbolische Gestalt für das Volk Israel, das seinem Gott untreu geworden ist, indem es dem Messias Jesus nicht vertraut, aber vom Messias Jesus dennoch nicht verurteilt wird. Das heißt, die hinzugefügten Verse 8,1-11 stellen einen Kommentar zum vorangegangenen Kapitel dar, in dem es eigentlich um die Frage geht: „Wer kann in diesem Fall überhaupt richten? Die Peruschim [= Pharisäer] haben gerichtet. Sie, Jehudim [= Judäer, Juden], haben die, die Tora nicht kennen, ebenfalls Jehudim, verurteilt, eben verflucht. ‚Niemand von euch tut die Tora‘, so hat Jeschua gesagt (7,19). Wenn die Tora der Maßstab ist, wer ist dann ohne Verirrung (anhamartētos)? Wer ohne Verirrung ist, mag das Urteil vollstrecken.“
↑ Wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft – oder nicht?
Zum Thema (S. 232) T wie Taufe stellen Sie „erhebliche Diskrepanzen“ der Evangelien über die Taufe Jesu fest.
„Die Verfasser der vier Evangelien sind sich nicht einmal darin einig, ob denn Jesus nun überhaupt von Johannes getauft wurde oder nicht.“
Mit den Unterschieden haben Sie Recht. Aber dass Jesus von Johannes getauft wurde (S. 233), bestreitet kein einziger Evangelist, nicht einmal Lukas, wie Sie meinen. Lukas erwähnt es zwar nicht ausdrücklich, aber im ganzen Kapitel 3 ist von keinem anderen Täufer die Rede als eben von Johannes, darum schließt er in 3,21 selbstverständlich auch Jesus in das von Johannes getaufte Volk mit ein. Dem widerspricht nicht, dass Lukas bereits im Vers zuvor die Gefangennahme des Johannes erwähnt; alles spricht dafür, dass die Taufe Jesu dennoch zuvor geschehen ist, denn es wird nirgends ein Nachfolger des Johannes erwähnt, der seine Taufpraxis fortgesetzt hätte.
Im Blick auf Matthäus und Johannes erwähnen Sie die Frage, warum sich Jesus überhaupt taufen ließ, wenn er doch (S. 232) nach Matthäus „ein ‚Gerechter‘ war“ und (S. 233) nach Johannes 1,29-34 „von eigenen Sünden und Verfehlungen frei“.
Ein interpretatorisches Bein stellen Sie sich selber, indem Sie eine merkwürdige Logik vertreten: Wenn Jesus nach Johannes 1,29 die „Sünde der Welt“ trägt, aber „durch die Taufe die Sünden der Welt von Jesus genommen“ werden, wird dann nicht „die Kreuzigung überflüssig“, die „Jesus zur Vergebung der Sünden der Welt stellvertretend für die Menschheit am Kreuz“ erleiden soll?
So hat der Evangelist aber sicher nicht gedacht – die Taufe des Johannes sollte ja nicht von Jesus die Sünde der Welt abwaschen, für die er freiwillig den Kreuzestod auf sich nahm, sondern indem sich Jesus diesem Ritual unterwarf, stellte er sich damit gerade in eine Reihe mit den denjenigen, deren Sünde er auf sich nahm.
Sie ziehen allerdings aus Ihrer genannten Argumentation den Schluss, dass zwar „Jesus zu Johannes kommt“, dieser daraufhin aber „Jesu Überlegenheit“ bekundet, ohne ihn zu taufen. „Er selbst, Johannes, taufe mit Wasser, Jesus aber ‚mit dem Heiligen Geist‘.“ Recht haben Sie damit, dass Johannes den Vollzug der Taufe Jesu nicht ausdrücklich erwähnt; allerdings erzählt er vom Herabkommen des Geistes auf Jesus, das bei den anderen Evangelisten mit seiner Taufe verbunden war. Ob der Evangelist die Tatsache der Taufe Jesu durch Johannes schlicht für selbstverständlich hielt, aber nicht für so wichtig, lasse ich dahingestellt sein.
Letzten Endes stellen Sie wie bereits in Ihrem Lexikon der biblischen Irrtümer grundsätzlich in Frage, ob Johannes überhaupt Menschen getauft hat. Dazu verweise ich auf meine dortigen Kommentierungen (161).
Dass (S. 234) „die ersten Christen vielleicht ein Problem“ damit hatten, wenn „Johannes ‚ihren‘ Jesus taufte“, weil man meinen könnte, dass dann „Johannes dann über Jesus“ stand – diese Frage wird in den Evangelien durchaus abgehandelt und überall so beantwortet, dass Johannes als Vorläufer Jesus bezeichnet wird, der auf den Messias hindeutet, aber selbst nicht der Messias ist. Nirgends ist erkennbar, dass man deswegen zu bestreiten versucht hätte, dass Jesus überhaupt von Johannes getauft wurde.
↑ Tempelzerstörung: Ist Jesus eine Kopie des Messias Menachem?
Zum Thema (S. 234) T wie Tempelzerstörung stellen Sie die Frage (S. 235), ob Jesus „die Zerstörung des Zentralheiligtums von Jerusalem richtig vorhergesagt [hat] oder nicht“. Sie gehen davon aus (S. 235f.):
„Jesus hat ganz allgemein die Zerstörung des Tempels prophezeit. Mit keinem Wort hat er behauptet, dass er selbst den Tempel zerstören werde. Über einen Wiederaufbau ließ er demnach auch nichts vernehmen.“
Diese Vermutung belegen Sie mit den unterschiedlichen Darstellungen der Evangelien über Jesu Worte über den Tempel gegenüber seinen Jüngern und Zeugenaussagen gegen Jesus während des Prozesses gegen ihn. Historisch lässt sich aus alldem aber gar nichts beweisen, nicht einmal, ob Jesus tatsächlich auch nur allgemein die Zerstörung des Tempels vorhergesagt hat. Es würde zu weit führen, hier im einzelnen nachzuweisen, welche Absicht die verschiedenen Evangelisten mit ihrer jeweiligen Formulierung dieser Jesusworte verfolgt haben mögen.
Immerhin machen Sie hier im Blick auf das Johannesevangelium deutlich (S. 236), dass die
„Tempelzerstörung … zum Bild für die Zerstörung von Jesu Leib und Leben [wird]. Jesu Äußerung, den Tempel in drei Tagen wieder aufzubauen, wird zur Prophezeiung über seine Auferstehung nach drei Tagen. Doch wieder muss darauf hingewiesen werden, dass zwischen Kreuzestod und Auferstehung eben nicht drei Tage, sondern deutlich weniger Zeit lag.“
In Ihrem nachgeschobenen Einwand „vergessen“ Sie aber gleichsam bereits wieder Ihre eben geäußerte Einsicht, dass es sich bei Jesu Wort über Tempelzerstörung und -wiederaufbau um einen bildhaften Vergleich handelt. Die Redewendung von der „Auferstehung nach drei Tagen“ wollen Sie nämlich wortwörtlich im Sinne von 3 mal genau 24 Stunden begreifen, obwohl sie ebenfalls symbolisch zu verstehen ist (162).
Dann verfolgen Sie in Ihren Überlegungen über Jesus und die Tempelzerstörung noch eine andere Spur. Sie fragen sich nämlich (S. 237), ob der „selbsternannte Messias … Menachem, der im Jahre 66 n. Chr. … in die Waffenkammer der Festung Massada ein[drang] und … seine Landsleute zum Sturz der Römer auf[rief]“, nicht vielleicht ursprünglich (S. 239) „das angebliche Jesus-Wort über die Zerstörung des Tempels von Jerusalem“ ausgesprochen hat (163):
„Eigentlich passt es, nimmt man es wortwörtlich und deutet es nicht symbolisch, besser zu Menachem als zu Jesus!
Auffällig ist, dass Menachem weitaus deutlichere Spuren hinterlassen hat als Jesus. Ist vielleicht manches, was Jesus zugeschrieben wird, von den Evangelisten aus der Biographie Menachems übernommen worden? Ist vielleicht Jesus in Teilen seines ihm nachgesagten Verhaltens eine Kopie Menachems? Oder wurden beide von eifrigen Anhängern nach einem Idealbild vom Messias gestaltet?“
Für Ihre Annahme spricht eine ganze Reihe von Übereinstimmungen zwischen den Berichten über Jesus und Menachem (S. 237f.), zum Beispiel dass Menachem nach
„Josephus…, begleitet von wehrhaften Rebellen, in Jerusalem wie ein König eingezogen sein [soll] (164).
Parallelen zu Jesus sind augenfällig: So wie Jesus empört die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertrieb, so zog auch Menachem im Tempel ein: stolz, als messianischer König. Das ließ sich die Príesterschaft nicht gefallen. Es kam zu einer blutigen Auseinandersetzung, bei der mehrere Anhänger und Gefolgsleute Menachems getötet wurden. Er selbst konnte fliehen, wurde aber vor den Toren Jerusalems gestellt und grausam zu Tode gebracht.
Mit der Zerstörung des Tempels wurde er auch in Verbindung gebracht. So wurde von einigen seiner Anhänger nach der Verwüstung des Heiligtums gemutmaßt (165): ‚Wenn er die Zerstörung des Tempels verursacht hat, so wird er ihn auch wieder aufbauen.‘“
Hat also (S. 238f.) der von Ihnen zitierte Theologe Hugo Gressmann (166) Recht, wenn er „glaubt, dass Menachems Einfluss auf das Christentum größer gewesen sein könnte als weithin angenommen wird“?
„War es der Einzug von Menachem mit seinen Gefolgsleuten in Jerusalem, der den Verfasser des Evangeliums nach Markus inspirierte? Ist Jesu begeisterter Empfang in Jerusalem eine Kopie der Begrüßung des Menachem durch das Volk? Galt der Jubel in Wirklichkeit dem militanten Umstürzler, der das Volk von den Römern befreien wollte? Wurden für die Evangelien der Bibel nur die Hauptpersonen ausgetauscht?“
Vieles davon klingt durchaus plausibel – bis auf eine entscheidende Einzelheit. Die Evangelisten mögen Jesu Einzug in Jerusalem tatsächlich in Erinnerung an den Messias Menachem ausgestaltet haben. Aber damit ist Jesus keineswegs eine bloße Kopie des Menachem. Immerhin zieht Jesus nicht mit wehrhaften Rebellen in Jerusalem ein, sondern friedlich auf einem Esel; damit wird bewusst eine Kritik an der gewaltsamen Politik der Zeloten formuliert, die ja auch zum Scheitern verurteilt war. Zwar scheint Jesus mit seiner Wehrlosigkeit genauso gescheitert zu sein, den Evangelisten zufolge liegt aber auf seiner gewaltfreien Haltung und der Erduldung seines Leidens bis zum Tod am Kreuz der Römer Gottes Segen – und die Verheißung einer nachhaltigen Befreiung nicht nur von äußerer Unterdrückung, sondern auch von der Macht des Bösen, die nur durch Feindesliebe zu überwinden ist.
↑ Wann wurde Jesus gekreuzigt – und wann starb er wirklich?
Zum Stichwort (S. 239) T wie Todesstunde stellen Sie fest (S. 240), dass zwei Evangelien den Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu völlig unterschiedlich angeben. Nach Markus 15,25 wird Jesus „um die dritte Stunde“ gekreuzigt, nach Johannes 19,14-15 wird er erst „um die sechste Stunde“ von Pilatus dem „Pöbel Jerusalems“ gegenübergestellt, der dann erst die Kreuzigung fordert.
Einmal abgesehen davon, dass Sie den Zeitpunkt der Kreuzigung mit der Todesstunde Jesu verwechseln (der Tod Jesu trat nach Markus 15,33-37 erst sechs Stunden nach der Kreuzigung ein, nämlich um die neunte Stunde), kommen Sie am Ende zu der Schlussfolgerung (S. 241), dass doch kein Widerspruch zwischen Markus und Johannes vorliegen muss, wenn nämlich bei beiden Evangelisten eine unterschiedliche Zeitrechnung vorausgesetzt wird:
„Nach Plinius dem Älteren begann der Tag bei den Babyloniern mit dem Sonnenaufgang und endete mit dem folgenden Sonnenaufgang. Die Athener hingegen zählten von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Für die Ägypter wie für die Römer gab es wieder eine andere Zeitrechnung: Von Mitternacht zu Mitternacht. Das Gedankengut des nach Johannes benannten Evangeliums ist häufig sehr stark vom römischen Standpunkt geprägt (167). Das darf nicht verwundern, entstand es doch in Ephesus, einer wichtigen römischen Hauptstadt in Asien. Wenn also das Evangelium nach Johannes von der ‚sechsten Stunde‘ spricht, so ist das nach römischer Zählweise die sechste Stunde nach Mitternacht. Umgerechnet auf unsere Zeiteinteilung: 6.00 Uhr morgens wurde Jesus noch verhört. Seine Kreuzigung stand kurz bevor. Nach der Vorstellung der hebräischen Priesterschaft begann der Tagesablauf um 6.00 Uhr morgens. Nach Markus wurde Jesus zur „dritten Stunde“ gekreuzigt, also nach römischer Zeit um neun Uhr morgens. Die Hinrichtung erfolgte also um neun Uhr, somit drei Stunden nach dem letzten Verhör Jesu durch Pontius Pilatus.
Berücksichtigt man also, dass das Evangelium nach Markus nach jüdischer, das Evangelium nach Johannes hingegen nach römischer Zeit rechnet, dann gibt es die vermeintliche Diskrepanz zwischen den beiden Evangelien nicht mehr. Sie ist das Ergebnis eines Interpretations-Irrtums. Die Tatsache, dass das ‚Evangelium nach Johannes‘ so stark dem römischen Denken verhaftet ist, muss bei der Interpretation berücksichtigt werden. Man kann nicht mit einem wertneutralen Bericht rechnen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die römische Seite, etwa Pontius Pilatus, in günstigem, die jüdische Seite hingegen in eher negativem Licht gesehen und beschrieben wird. Das gilt in besonderem Maße bei der Frage nach den Verantwortlichen für Jesu Tod. Es verwundert nicht, wenn das Evangelium nach Johannes historisch falsch die römische Seite von jeglicher Schuld freispricht und ‚die Juden‘ als alleinige Verantwortliche betrachtet.“
Ich habe Sie so ausführlich zitiert, weil Sie Ihre durchaus plausible Argumentation bezüglich der Zeitrechnung mit einer Polemik gegen Johannes verbinden, die ich nicht teile.
- Bereits an anderer Stelle habe ich unter Berufung auf Ton Veerkamp (168) deutlich gemacht, dass das Johannesevangelium keineswegs einen römerfreundlichen Standpunkt vertritt. Man kann auch die römische Zeitrechnung verwenden, wenn man sich in entschiedenster Gegnerschaft zur Unterdrückungspolitik Roms befindet.
- Sie argumentieren insofern widersprüchlich, als Sie oben zum Thema E wie Ehescheidung noch Markus als römerfreundlichen, wenn nicht sogar römischen Autor beschrieben haben; hier verwendet er aber eindeutig die hebräische Zeitrechnung.
- Wann die Kreuzigung tatsächlich stattfand und wann der Tod Jesu wirklich eintrat, weiß niemand genau. Es ist durchaus möglich, dass auch Johannes die jüdische Zeitrechnung verwendete und einfach von einem anderen Zeitpunkt sowohl der Kreuzigung als auch des Todes Jesu ausging. Immerhin lässt Johannes ja auch den Bericht über die dreistündige Finsternis aus, die von den Synoptikern erwähnt wird.
- Ganz interessant ist der Versuch von Karl-Heinz Vanhaiden, die Uhrzeiten am Karfreitag in den Evangelien miteinander in Einklang zu bringen, obwohl er allzusehr daran interessiert ist, die wortwörtliche historische Wahrheit der neutestamentlichen Angaben zu beweisen.
↑ Wie sollen Tote Tote begraben – Abschreibfehler oder Bildwort?
Zum Stichwort (S. 242) T wie Tote fragen Sie sich zu einem Wort Jesu, das sowohl in Matthäus 8,21-22 als auch in Lukas 9,59-60 überliefert wird, wie Tote Tote begraben sollen:
„Ein anderer der Jünger sprach zu ihm (Jesus): ‚Herr, erlaube mir, dass ich nach Hause gehe und meinen Vater begrabe!‘ Und Jesus spricht zu ihm: ‚Folge mir und lass die Toten ihre Toten begraben!‘“
Zur Erklärung verweisen Sie darauf, „dass Jesus Aramäisch sprach und nicht Griechisch.“ Im Aramäischen muss aber die Redewendung „Lass mich erst meinen Vater begraben!“ nicht bedeuten, dass der Vater bereits gestorben ist, sondern sie kann auch meinen: „Mein Vater ist alt, ich will ihn erst bis zu seinem Tode versorgen!“ Indem Jesus darauf antwortet: „Lass die Toten die Toten begraben!“, will er Ihnen zufolge damit folgendes ausdrücken:
„Angenommen, der Jünger folgt Jesu Aufforderung und der Vater des Jüngers stirbt. Wenn dann keine direkten Verwandten des Verstorbenen vor Ort leben, übernimmt die Stadt die Bestattung.
Im Aramäischen heißt Stadt ‚matta‘ und tot heißt ‚metta‘. Wenn die Stadt die Toten beerdigen soll, dann steht im Text auf Aramäisch: ‚matta‘ beerdigt ‚metta‘. Vermutlich liegt ein Abschreibfehler vor: Noch bevor der Text, nachdem er bereits unzählige Male kopiert worden war, aus dem ursprünglichen Aramäischen ins Griechische übertragen wurde! Jesus sagte zu seinem Jünger: ‚Folge mir nach und lass die Stadt die Toten begraben!‘ Durch einen Schreibfehler entstand das absurde ‚Lass die Toten die Toten begraben!‘“
Leider kenne ich mich mit dem Aramäischen nicht gut aus; daher kann ich nicht beurteilen, ob ein solcher Abschreibfehler vorgekommen sein könnte. Aber da die Evangelien in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. bereits ursprünglich auf Griechisch verfasst wurden, gab es für schriftliche aramäische Texte, die zuvor „bereits unzählige Male kopiert worden“ waren und den Evangelisten als Vorlage gedient haben könnten, gar nicht genug Zeit – geschweige denn auch nur die geringste schriftlich aufzufindende Spur.
Außerdem kommt mir Ihr Versuch, das ganze Problem auf diese Weise wegzuerklären, zu simpel vor. Kann es wirklich sein, wie Sie sagen (S. 343), dass in Jesu Augen „die herannahende Apokalypse … wichtiger war … als die Versorgung des greisen Vaters“, die deswegen dann eben einfach „die Stadt erledigen“ sollte? Ist ihm nicht eher ein provokatives Wort zuzutrauen, mit dem er den zögernden Nachfolger bei einer Ausrede ertappt und in dem er bildlich von „Toten“ spricht, die mitten im Leben schon tot sind und ihre Toten begraben sollen? Hinzu kommt, dass das Jesuswort wohl auf die Berufung des Propheten Elisa durch seinen Lehrmeister Elia in 1. Könige 19,19-21 anspielt, bei der nicht ganz sicher ist, ob Elisa erlaubt wurde, sich von seinen Eltern zu verabschieden – es geht jedenfalls um eine radikale Umkehr zu Gott (169).
↑ War der Stern von Bethlehem ein UFO? Wurde Jesus von Außerirdischen durch künstliche Befruchtung gezeugt?
Über das (S. 243), was Sie zum Stichwort U wie UFO äußern, muss ich doch schmunzeln, wenn ich bedenke, welche Theorien über Außerirdische Sie in Ihrem Vorwort über angewandte Paläo-SETI-Forschung zu Band I der Urmatrix-Trilogie von Dieter Vogl und Nicolas Benzin (170) unterstützt haben. Natürlich stimme ich Ihnen zu, wenn Sie sich in Ihrem eigenen Buch (S. 244) von Versuchen distanzieren, „Jesus mit Außerirdischen in Verbindung“ zu bringen (171):
„Demnach war der ‚Stern von Bethlehem‘ ein außerirdisches Raumschiff. Und Jesus wurde durch künstliche Befruchtung gezeugt.“
Die Art Ihrer Argumentation gegen diese beiden Thesen finde ich allerdings nicht überzeugend.
So meinen Sie, dass der „Stern von Bethlehem“ kein UFO gewesen sein kann, weil er „nur scheinbar ein einzelnes Objekt am Himmel“ war.
„In Wirklichkeit handelte es sich um eine Planetenkonstellation, die für persische Astrologen von besonderem Interesse war (172)“.
Aber wie ich bereits zu Ihrem Abschnitt A wie Astrologie bemerkt habe, gibt es dazu auch ganz andere Theorien, nämlich dass es doch ein einzelner Himmelskörper, nämlich ein Komet oder eine Supernova gewesen sein könnte. Wichtiger noch ist die Erwägung, dass letzten Endes die ganze Geschichte nicht auf historischen Tatsachen beruht; stattdessen geht es Matthäus unter Rückgriff auf das Alte Testament von Anfang an um die Einbettung der Geburt des Messias Jesus in einen weltweiten Zusammenhang – denn zu den Völkern sendet der auferstandene Jesus am Ende seines Evangeliums ja seine Jünger hinaus, um sie die Tora der Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe zu lehren.
Sie scheinen allerdings die UFO-Theorie immerhin so ernst zu nehmen, dass Sie meinen, betonen zu müssen, dass der
„‚Stern‘ … ein allgemein am nächtlichen Himmel sichtbares Phänomen“ war und „kein ‚UFO‘, das gezielt die ‚Weisen‘ anlockte. … Ein ‚UFO‘ wäre nur örtlich einem kleinen Kreis von Menschen sichtbar gewesen. Dann hätte der Bibeltext lauten müssen: ‚Da rief Herodes heimlich die Weisen und erkundete eifrig von ihnen, wann ihnen der Stern erschienen wäre.‘ Das ‚ihnen‘ taucht nur in falschen Übersetzungen auf.“
Aber selbst wenn im Bibeltext davon die Rede gewesen wäre, dass der Stern „ihnen“ erschienen war, könnte das ja keineswegs ein Beweis für die Erscheinung eines UFOs sein; auf der Erzählebene des Evangelisten ist auf jeden Fall von einem Himmelskörper die Rede und nicht von einem Raumschiff.
Gegen die These, dass „die ‚jungfräuliche Geburt‘ des Jesuskindes … auf eine künstliche Befruchtung hin[weist]“, wenden Sie ein (S. 244f.):
„Irrtum: Auch eine künstliche Befruchtung führt zu einer ganz normalen, keineswegs jungfräulichen Geburt. Einwand: Streng genommen spricht das ‚Neue Testament‘ allenfalls von einer jungfräulichen Empfängnis [Matthäus 1,22-23]: ‚Das alles ist geschehen, damit sich erfülle, was Gott durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären …‘ Nüchtern betrachtet ist das kein rätselhaftes Ereignis. Jede Mutter war einmal Jungfrau. Und von jeder Frau, die ein Kind gebären wird, kann man sagen: ‚Siehe, sie ist heute eine Jungfrau. Sie wird einen Sohn gebären.‘ Dann wird sie allerdings nicht mehr Jungfrau sein. …
Junge Frauen, die schwanger sind, stellen alles andere als ein ungewöhnliches Phänomen dar. Eine künstliche Befruchtung ist gewöhnlich nicht erforderlich.“
In dieser Argumentation wiederholen Sie Ihr Missverständnis der kirchlichen Lehre von der Jungfrauengeburt (173). Aber:
- Natürlich wollte der Evangelist Matthäus nicht die Binsenweisheit von sich geben, dass Maria wie jede andere Frau vor ihrem ersten Geschlechtsverkehr Jungfrau war und von irgendeinem Mann – da es ihm zufolge ja ausdrücklich nicht Josef war – schwanger wurde.
- Natürlich ging Matthäus von einer jungfräulichen Empfängnis aus, dass sie nämlich ohne Zutun eines Mannes schwanger wurde: durch den Heiligen Geist, indem Gott auf wunderbare Weise im Leib der Maria das Kind hervorbringt.
- Und natürlich verstehen alle christlichen Kirchen unter der Jungfrauengeburt genau diese jungfräuliche Empfängnis und nicht zwangsläufig, dass Maria auch während und nach der Geburt körperlich eine Jungfrau blieb. Die immerwährende Jungfräulichkeit der Maria wurde von der römisch-katholischen Kirche erst Jahrhunderte später zum Dogma erhoben.
- Eine künstliche Befruchtung durch Außerirdische anzunehmen, ist auf der Erzählebene des Matthäus nur dann nicht vollkommen absurd, wenn man an die Annahmen der Paläo-SETI-Forschung glaubt, dass alle religiösen Erzählungen über Gott oder Götter letzten Endes auf den Besuch von Außerirdischen auf der Erde zurückgehen. Wie gesagt, in dem oben genannten Vorwort zur „Urmatrix“ hatten Sie sich sehr klar zu einem solchen Glauben bekannt. Von daher ist eigentlich nicht recht zu begreifen, weshalb Sie sich hier dermaßen gegen die UFO-Theorie aussprechen… 😉
↑ „Umkehr“ meint Umkehr zu Gott, nicht den Übertritt zu einer neuen Religion
Zum Thema (S. 245) U wie Umkehr irren Sie sich gewaltig über die Bedeutung des Wortes „Umkehr“. Zwar haben Sie insofern Recht, als die Forderung „Tut Buße!“, die sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus erheben (Matthäus 3,2 und 4,17), die auf das griechische Wort metanoiete (wörtlich = „ändert euren Sinn!“) zurückgeht, eigentlich „zur Umkehr“ ermahnt: „Kehrt um! Das Himmelreich ist nahe!“ Aber Ihre Schlussfolgerung ist völlig abwegig (S. 245f.):
„Die wortwörtliche richtige Übersetzung aber wäre irreführend, denn wohin sollten denn die Jünger des Johannes wie des Jesus zurückkehren? Jesu Anhänger waren noch fest im Judentum verwurzelt. Allerdings sahen sie, im Gegensatz zu den übrigen Juden, Jesus als den Messias an. Die Evangelien richteten sich aber nicht an die ersten Christen. Zu Jesu Lebzeiten existierten sie ja noch gar nicht. Die Adressaten der Evangelien waren zunächst einmal die Juden-Christen und erst später die ersten Christen: Zur Umkehr sollen sie aber auf keinen Fall aufgefordert werden, denn das hätte ja Abwendung vom neuen Glauben und Rückkehr zum Judentum bedeutet. Und umkehren sollten die Heiden-Christen schon gar nicht. Sie waren ja erst vom Heiden- zum Christentum übergetreten. Sie sollten dem neuen Glauben treu bleiben, nicht zum alten zurückkehren.“
Ihr Missverständnis besteht darin, dass es Johannes und Jesus gar nicht um einen Religionsübertritt geht. Das Christentum als neue Religion entsteht ja erst im Laufe der ersten Jahrhunderte. Es geht ihnen eindeutig um die Umkehr zu Gott, die Umkehr von falschen Wegen zurück zu dem geraden Weg der Tora (= Wegweisung) Gottes, um die es bereits den Propheten Israels ging (vgl. Joel 2,13; Jona 3,10; Jeremia 8,6; 18,8), um eine Rückbesinnung auf das, was Gott von den Menschen will, da seine Herrschaft nahe ist – Jesus und Johannes denken hier apokalyptisch, was Sie ja selbst auch wissen (174).
Auch Ihrer weiteren Argumentation muss ich entschieden widersprechen (S. 246):
„Wozu fordern Johannes und Jesus ihre Anhänger also auf, wenn sie auf das nahe Weltende hinweisen und ‚Kehrt um!‘ rufen? Sie verlangen nicht die Rückkehr ins Alte, sondern das Umsinnen, wobei die Gläubigen im Neuen bleiben: Denkt an die neue Lehre! Entsinnt euch wieder der neuen Lehre und lebt nach ihr!
Das meinten Johannes und Jesus wirklich. Eine wörtliche Übersetzung (‚Kehrt um!‘) hätte völlig unerwünschte Reaktionen auslösen können.“
Nein, um eine neue Lehre geht es Johannes und Jesus mit ihrem Ruf zur Umkehr gerade nicht! Ich verstehe auch nicht, wie Sie an dieser Stelle so tun können, als ob Jesus die „alte Lehre“ – also doch wohl das Judentum! – mit seiner „neuen Lehre“ völlig überwinden und ersetzen wolle – unter R wie Reformation hatten Sie das doch selbst völlig zu Recht bestritten. Johannes wie Jesus verstanden sich als Juden, die die Umkehr zu Gott verkündeten – und selbst der Evangelist Matthäus (5,17-18) besteht noch darauf, dass Jesus die jüdische Tora keineswegs auflösen, sondern erfüllen will. Allerdings soll die Wegweisung des Gottes Israels nach Anweisung des auferstandenen Messias Jesus auch zu den Völkern getragen werden (Matthäus 28,19-20).
↑ War Jesus als Davidssohn ein Messias, der auf einen Umsturz bedacht war?
Zum Stichwort (S. 246) U wie Umsturz überlegen Sie, ob Jesus auf einen solchen bedacht war. Eigentlich hatten Sie die Frage bereits zum Thema A wie Apokalypse beantwortet, denn Jesus erwartete den Umsturz der ungerechten Weltordnung, allerdings von Gott her und durch Gottvertrauen, nicht durch die Anwendung von Gewalt.
In diesem Abschnitt stellen Sie nun die Frage, ob sich Jesus in seiner Interpretation von Psalm 110, der „vom ‚Krönungsfest des Königs‘ schwärmt“, in politischem Sinn als messianischen König begreift. Sie gehen davon aus (S. 247), dass Jesus ihn „rein messianisch im religiösen Sinne“ versteht:
„Demnach bezieht Jesus den Psalm auf sich und bekräftigt gleichzeitig seinen eigenen Anspruch darauf, aus dem Hause Davids abzustammen, aber als Messias und Sohn Gottes weit über dem legendären König der Juden David zu stehen. So viel zur Aussage des Evangelientextes, der von den drei synoptischen Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas in sehr ähnlicher Weise gebracht wird [Matthäus 22,41-44; Markus 12,35-37; Lukas 20,41-44].“
Allerdings kann es sein, dass Markus, der den Text als erster formuliert, ihn noch durchaus politisch interpretiert. Allerdings hat er die Absicht, seine Sicht des Messias Jesus deutlich von einer zelotisch verstandenen Davidssohnschaft abzugrenzen. Anders als bei den späteren Evangelisten Matthäus und Lukas greift Jesus bei Markus nirgends in positivem Sinne auf die Idee der Davidssohnschaft zurück, vielmehr wird David eher in seiner Bedürftigkeit und Menschlichkeit dargestellt, nicht als siegreiche Heldengestalt (175). Markus würde also ausdrücken wollen: Jesus hatte zwar durchaus politische Ziele und ersehnte einen Umsturz der Verhältnisse, aber nicht mit gewaltsamen, zelotischen Mitteln.
Nebenbei erwähnen Sie, dass Jesus „ein Irrtum“ unterläuft, weil er Psalm 110 einen „Psalm Davids“ nennt. Aus heutiger Sicht ist das zwar richtig, weil historisch-kritisch herausgefunden wurde, dass der „wirkliche Verfasser … unbekannt“ ist. Aber bis heute gehen Millionen von gläubigen Juden und Christen (und sogar Muslimen) davon aus, dass die in der Bibel David zugeschriebenen Psalmen tatsächlich vom König David gesungen wurden – und das war auch für Jesus selbstverständlich. Auf der Erzählebene der Evangelisten und auf der religiösen Verstehensebene der Bibel macht es jedenfalls einen guten Sinn, bestimmte Psalmen auf dem Hintergrund dessen zu interpretieren, was in der Bibel von dem durch Gottes Propheten gesalbten König David überliefert wird.
Sie reduzieren allerdings die Auseinandersetzung mit dem Wort Jesu über die Davidssohnschaft wieder einmal auf die historische Ebene, indem Sie schreiben (S. 247f.):
„Die wissenschaftliche Theologie streitet dem Text aber jeden historischen Wert ab. Er beschreibt demnach kein echtes Jesus-Wort, sondern spiegelt eine Diskussion in der frühen christlichen Gemeinde lange nach Jesu Tod wider: Wer ist der erwartete Messias? Welche Abstammung hat er? Wie ist seine Position gegenüber dem König der Juden David? Theologieprofessor Lüdemann (176): ‚Der geschichtliche Wert der Perikope (Bibelausschnitt) ist gleich null, da sie ausschließlich aus Diskussionen in der Gemeinde erklärt werden kann.‘ Der von den Verfassern der Evangelien Jesus zugeordnete Anspruch auf die Position des messianischen Königs der Juden wird somit neu interpretiert: Nicht Jesus hielt sich für den König der Juden, sondern seine Anhänger in der jungen christlichen Gemeinde sahen ihn so, nach seinem Tod am Kreuz, also Jahrzehnte später.“
Das ist zwar insofern richtig, als wir kaum sagen können, ob der historische Jesus sich bereits als König der Juden verstanden hat.
Die letzten drei Wörter Ihres zitierten Absatzes stimmen aber definitiv nicht. Nach Larry W. Hurtado (177) gelangten die Jesusanhänger schon sehr rasch, und zwar wohl unmittelbar nach seinem Tod, zu der Überzeugung, dass Jesus trotz seiner scheinbaren Niederlage der Messias war. Sie beschrieben das als die Erfahrung seiner Auferstehung, als eine Vision des zu Gott, dem Vater, erhöhten Herrn Jesus Christus, und fingen an, ihn gemeinsam mit dem Vater im Himmel anzubeten.
Auf den folgenden Seiten (S 250) gehen Sie darauf ein, dass es
„schon vor Jesus Umstürzler [gab], die ihre Autorität von ihrem angeblichen Messiastum herleiteten. Auch nach Jesus traten weitere Messiasse auf. Wie Jesus, so beriefen sich seine Vorgänger wie seine Nachfolger auf das ‚Alte Testament‘. Wie Jesus forderten auch seine ‚Kollegen‘ das Volk auf, ihnen nachzufolgen. Bei den Messiassen vor wie nach Jesus griffen die Römer mit brachialer Gewalt ein. Sie versuchten einen möglicherweise drohenden Umsturz schon im Keim zu ersticken.“
Unbeantwortet lassen Sie dabei die Frage:
„Warum lassen sich die anderen erfolglosen Umstürzler geschichtlich nachweisen, während Jesus außerhalb der Bibel keine brauchbare, verifizierbare Spur hinterlassen hat?“
Manche moderne Autoren, wie zum Beispiel Francesco Carotta (178), gehen ja davon aus, dass es einen historischen Jesus überhaupt nicht gegeben habe, und entspinnen daraus völlig abwegige Hypothesen, etwa dass die Jesusmythen auf Grund des Glaubens an den göttlichen Julius Cäsar erfunden worden wären.
Meine Vermutung ist: Jesus war anders als viele andere Messiasse kein Zelot und rief nicht zu gewaltsamen Aktionen auf. Er mag deswegen in der gebildeten Öffentlichkeit weniger Aufmerksamkeit erregt haben.
↑ Wie viele Versionen des Vaterunser gibt es in der Bibel?
Zum Thema (S. 250) V wie Vater unser legen Sie richtig dar, dass das wichtigste Gebet der Christen wohl nicht in allen seinen Teilen wortwörtlich auf den historischen Jesus zurückgeht.
Sie unterscheiden vier Versionen des Gebets und beginnen (S. 251) mit der letzten, heute gebräuchlichen, deren letzter Satz (Matthäus 6,13b)
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit
auf jeden Fall „eine Erweiterung jüngeren Datums“ darstellt.
„Er taucht erst im ‚Codex Basileensis‘ auf und wurde von Erasmus von Rotterdam in die griechische Ausgabe des ‚Neuen Testaments‘ aufgenommen, die zwischen 1516 und 1519 erschien. Martin Luther wiederum, der deutsche Reformator, übernahm den Zusatz bei seiner Übersetzung vom Griechischen ins Deutsche. Seither gehört er als fester Bestandteil zum ‚Vater unser‘. Jesus hat ihn wohl weder gekannt noch gebetet“.
Volker Weymann (179) schreibt allerdings, dass bereits „in der sog. ‚Apostellehre‘ bzw. ‚Didaché‘ aus dem Anfang des 2. Jh.“ bezeugt ist, dass „das Vaterunser in den griechisch sprechenden Gemeinden mündlich … mit dem Lobpreis zum Schluss gebetet wurde“.
Zur Version nach Markus 11,25 schreiben Sie (S. 251f.):
„Der Verfasser des nach Markus benannten Evangeliums streicht einfach den größten Teil des Gebets und begnügt sich mit den Schlussworten: ‚Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, so ihr gegen jemanden etwas habt, damit auch der Vater im Himmelreich vergebe.‘ Große Ähnlichkeiten mit dem heute gebräuchlichen ‚Vater unser‘ sind nicht auszumachen.“
Hier lassen Sie außer Acht, dass das Evangelium nach Markus mindestens zehn Jahre älter ist als dasjenige nach Matthäus oder Lukas. Der Markusvers, der ja in seiner Formulierung auch gar kein Gebet darstellt, sondern eine Aussage über das Gebet ist, ist also gar keine Kürzung des Vaterunser; vielmehr kennt Markus das Vaterunser überhaupt nicht. Matthäus und Lukas haben das Vaterunser aus einer anderen gemeinsamen Quelle geschöpft, möglicherweise aus der von vielen neutestamentlichen Theologen vermuteten schriftlichen Spruchquelle Q (180).
Nach Adela Yarbro Collins (181) kannten aber wahrscheinlich sowohl Markus als auch Matthäus eine Tradition, die das Gebet mit der Vergebung verknüpfte, und beide passten diese Überlieferung unabhängig voneinander in ihre jeweiligen Zusammenhänge ein.
Insofern stimmt auch etwas in Ihrem folgenden Satz nicht (S. 252):
„Bei Matthäus wiederum findet sich ein Zusatz, der bei den anderen Evangelisten ebenso wenig wie in unserer heutigen Fassung zu finden ist. Da schärft der Verfasser noch einmal die Wichtigkeit der Vergebung ein [Matthäus 6,14-15]. Es wird das Handeln der Menschen mit dem Handeln Gottes verknüpft: So wie der Mensch anderen Menschen verzeiht, so vergibt auch Gott den Menschen.“
Aber, wie eben gesagt:
- Dieser Zusatz entspricht genau der von Ihnen oben erwähnten angeblichen Markus-Version des Vaterunser, findet sich also doch in einem anderen Evangelium.
- Und dieser Zusatz ist deswegen mit Recht nicht in unserem heutigen Vaterunser enthalten, weil er gar kein Teil des Gebetes selbst, sondern eine Aussage über das Beten als solches darstellt.
Daraus folgt, dass es nur zwei Versionen des Vaterunser gibt, die tatsächlich auf eine Quelle aus der Zeit vor den Evangelien zurückgehen, nämlich die Matthäus- und Lukasfassung (ohne den oben erwähnten Schlusssatz in späten Matthäushandschriften). Ob nun Lukas die ursprüngliche Version gekürzt oder Matthäus sie ergänzt hat, wird sich kaum herausfinden lassen. Ob die Überlieferung, auf die beide zurückgreifen, tatsächlich so von Jesus stammt, ist unbeweisbar, aber nicht unbedingt unwahrscheinlich.
Ich verstehe aber nicht, wie Sie darauf kommen (S. 252), dass
„die heutige Formel in ihrer knappen Schlichtheit … am ehesten der Fassung nach Lukas [ähnelt, 11,2-4]: ‚Vater! Dein Name, er werde geheiligt, dein Reich, es komme, unser tägliches Brot, gib es uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn wir vergeben allen, die sich an uns versündigt haben.‘“
Denn das heutige Vaterunser entspricht doch eindeutig nicht den fünf Bitten des Lukasevangeliums, sondern fast genau den sieben Bitten nach Matthäus 6,9-13 mit den zusätzlichen Bitten: „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden“ und „Erlöse uns von dem Bösen“. Volker Weymann (182) erklärt das folgendermaßen:
„Schon in frühchristlichen Gemeinden wurde das Vaterunser, soweit sich aus schriftlicher Überlieferung ersehen lässt, nirgends in der Fassung bei Lk., vielmehr in der nach Mt. aufgenommen. Ob dies daran lag, dass die verneinende Bitte: ‚Und führe uns nicht in Versuchung‘ nach einer weiteren rief: ‚sondern erlöse uns von dem Bösen‘? Oder ob dies daran lag, dass die Du-Bitten in die dritte Bitte mündeten: ‚Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden‘? Ob der Dreier-Rhythmus der Du-Bitten und die Siebener-Reihe der Bitten insgesamt dem Vaterunser für den persönlichen wie für den gemeinsamen gottesdienstlichen, also liturgischen Gebrauch einen einprägsameren Rhythmus verlieh?“
↑ Dürfen wir Gott bitten: „… und führe uns nicht in Versuchung“?
Eingehend möchte ich mich zu V wie Vater unser auch mit Ihren Ausführungen (S. 252f.) über die in jeder Vaterunser-Version enthaltene Bitte „und führe uns nicht in Versuchung“ auseinandersetzen. Diese haben nämlich in den vergangenen Jahren eine besondere Aktualität dadurch erhalten, dass seit dem 1. Advent 2017 nach einem Beschluss der französischen Bischöfe diese Vaterunser-Bitte in französischen katholischen Gottesdiensten in folgender neuer Übersetzung gebetet wird:
„Ne nous laisse pas entrer en tentations“ = „Lass uns nicht in Versuchung geraten“ (183).
Und sogar Papst Franziskus hat sich dafür ausgesprochen, das Vaterunser in diesem Sinne zu verändern (184).
Sie befinden sich also in guter Gesellschaft, wenn Sie schreiben, dass die traditionell überlieferte Vaterunser-Bitte in dieser Form nicht auf Jesus zurückgehen könne, da sie
„nämlich im krassen Gegensatz zu einer fundamentalen Aussage über Gott im Brief des Jakobus [steht]. Da wird bestimmt [Jakobus 1,13]: ‚Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.‘“
Und Sie verweisen darauf, dass schon der jüdische Theologe Pinchas Lapide (185) 1995 die Neuübersetzung gefordert hat:
„Lass mich nicht der Versuchung unterliegen.“
Allein eine solche Übersetzung, so denken Sie, würde dem Sinn der Vaterunser-Bitte entsprechen, wie er aus einer Rückübersetzung des griechischen Textes in die aramäische Muttersprache Jesu zu erschließen sei. Weiterhin argumentieren Sie:
„Der noch heute übliche Text unterstellt, dass Gott boshafter Weise selbst aktiv den Menschen in Versuchung führen könnte, was der klaren Aussage des Jakobus-Briefes widerspricht. In der Neuübersetzung nach Lapide bittet der Beter Gott um Kraft, damit er eben nicht der Versuchung unterliegt. Die von Pinchas Lapide vorgeschlagene Übersetzung passt zum Geist des „Vater unser“, die auch heute noch gebräuchliche hingegen nicht (186).“
Volker Weymann (187) hat allerdings gegen die Änderung des Vaterunser in einem gerade erschienenen Artikel des Deutschen Pfarrerblatts vom November 2019 sehr erwägenswerte Argumente ins Feld geführt. Im Blick auf die von Ihnen zitierte Stelle im Jakobusbrief meint er (S. 637), dass es Jakobus „anscheinend um moralische Anfälligkeit des Menschen für Versuchungen“ geht, denn nach Jakobus 1,14 wird „ein jeder, der versucht wird, … von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt“. Demgegenüber wird in anderen Schriften der Bibel der Begriff der Versuchung weiter gefasst. Weymann erinnert daran (S. 636), dass Versuchung auch „existentiell zu verstehen“ ist „als Gefährdung unseres Verhältnisses zu Gott“. Dann würde mit der traditionellen Formel, die exakt der griechischen Matthäus- wie Lukasversion des Vaterunser entspricht,
„gegen Gott zu Gott gebetet: dass er uns nicht in unserm Abfall von ihm, in unserm Unglauben bestätige, vielmehr uns Grund und Quelle des Glaubens, des Vertrauens zu ihm bleibe und erneut werde. So würde mit dieser Bitte im Vaterunser trotz und mit der Vertrauen stiftenden Anrede nicht ausgeschlossen noch umgangen, dass er mir fern, verborgen, abweisend erscheinen kann.“
Im Klartext: Dass es gerade Gott ist und nicht ein der Kontrolle Gottes völlig entzogener Teufel, der uns in Versuchung führen kann, haben in der Bibel sowohl Abraham (1. Mose 22) als auch Hiob, sowohl Psalmbeter (z. B. Psalm 88) als auch schließlich Jesus in Gethsemane (Markus 14,32ff. und Parallelstellen bei Matthäus und Lukas) und in der Gottverlassenheit am Kreuz (Markus 15,34; Matthäus 27,46) erfahren. Ja, sogar in die Wüste, wo Jesus vom Satan versucht wird, ist er nach Matthäus 4,1 „vom Geist“ geführt worden. Wollte man Gott völlig davon entlasten, uns zu versuchen, müsste man (dualistisch) den Teufel zu einem zweiten Gott erklären. Insofern kann ich Volker Weymann nur zustimmen, wenn er es für „lebensnotwendig“ hält (S. 639),
„einer ‚Verharmlosung Gottes und … Banalisierung des Vaterunser(s)‘ (188) Widerstand zu leisten. Freilich wird dies Gebet Jesu und der weltweiten Christenheit mit der Bitte „führe uns nicht in Versuchung“ keineswegs eingängiger und einfacher, gewinnt jedoch damit an geschichtlicher wie lebensgeschichtlicher Weite und an existentieller Tiefe.“
↑ In den Evangelien werden nicht „die“ Juden verflucht
Zum Stichwort (S. 253) V wie Verfluchung wehren Sie sich mit Recht dagegen (S. 254), dass man in der Christenheit viele Jahrhunderte lang die Juden „als ‚verflucht‘ bezeichnet“ und „für etwas verdammt“ hat, „was von Gott von Anbeginn der Zeit geplant und vorgesehen war“, nämlich die Erlösung der Menschheit durch den Sühnetod Jesu Christi als „Teil des göttlichen Weltenplans“.
Allerdings stimmt es nicht ganz, wenn Sie schreiben (S. 253):
„Die Schriften des ‚Neuen Testaments‘ irren historisch, wo sie ‚den Juden‘ die Schuld am Kreuzestod Jesu zuweisen. Römer haben ihn verurteilt und hingerichtet.“
Schaut man nämlich genau hin, so wissen die neutestamentlichen Autoren und noch das Apostolische Glaubensbekenntnis genau, dass der Römer Pontius Pilatus Jesus gekreuzigt hat; Sie weisen ja selbst (S. 255) darauf hin:
„Gelitten unter Pontius Pilatus, nicht ‚unter den Juden‘ steht da.“
Allerdings geben die Evangelisten der korrupten jüdischen Führung die Schuld dafür, Jesus der verhassten römischen Weltordnung ausgeliefert zu haben. Diese Evangelisten waren definitiv keine Römerfreunde (zumindest Matthäus und Johannes waren selber Juden, wahrscheinlich auch Markus), und wo sich ihre Kritik gegen Juden richtete, da war es eine innerjüdische Kritik, die in ihrer Schärfe allerdings oft der Polemik der jüdischen Propheten des Alten Testaments glich. Eine pauschale Judenfeindschaft entwickelte sich in der Kirche erst später, als die Heidenchristen mehr und mehr die Judenchristen zahlenmäßig überstiegen und letzlich völlig verdrängten.
Zu der berühmten Stelle Matthäus 27,25 schreiben Sie (S. 254):
„Bei Matthäus sind es die Juden selbst, die ‚bekennen‘: ‚Da antwortete das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.‘ Diese Aussage widerspricht klar jüdischem Glaubensgebot [5. Mose 24,16]: ‚Die Väter sollen nicht für die Kinder noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine (eigene) Sünde sterben.‘“
Nach Ton Veerkamp (189) wird dieser Vers aber in vielen Bibeln schlicht falsch übersetzt, indem nämlich in den griechischen Satz to haima autou eph‘ ēmas kai epi ta tekna hēmōn, der wörtlich mit „sein Blut auf uns und unseren Kindern“ zu übesetzen ist, das Wort „komme“ im Konjunktiv eingeschmuggelt wird:
„Das steht nirgendwo. Es geht nicht um einen Wunsch, sondern um eine Feststellung des Volkes. Hier steht nicht ochlos, ‚Menge‘, sondern laos, ‚Volk‘, und das ist bei Matthäus immer das Volk Israel. Das Blut Jesu wird nur an einer einzigen weiteren Stelle erwähnt: ‚mein Blut des Bundes‘ (26,28). Das Volk … ruft … hier, ohne sich dessen bewußt zu sein, das Blut des Bundes zur Vergebung der Verirrungen … auf sich herab. Trotz des im [Jüdischen] Krieg sinnlos vergossenen Blutes [auf den der Evangelist Matthäus zurückblickt und für den er zelotische Bewegungen im Volk Israel verantwortlich macht] bleibt der Bund mit Israel bestehen: Das vergossene Blut des schuldlosen Messias ist das Blut des Bundes mit Israel ([2. Mose] 24,8). Die Christen mit ihrer Übersetzung ‚komme‘ machen daraus die Aufkündigung des Bundes und einen Freibrief für Judenhaß und letztlich für Auschwitz.“
Sie haben also Recht, sich gegen Thesen von der Kollektivschuld DER Juden am Tod Christi zu wenden, wie sie die Theologen Julius Schniewind oder Heinrich Schlier vertreten haben. Allerdings wird diese Kollektivschuldthese noch nicht in den Evangelien selbst vertreten.
↑ Zum wiederholten Male: Wer ist verantwortlich für Jesu Tod?
Zum Stichwort (S. 256) V wie Verhaftung und Verhör wiederholen Sie vieles, was Sie bereits in vorherigen Abschnitten behandelt haben, und kommen zu der Schlussfolgerung (s. 257):
„Die biblischen Berichte über Jesu Verhaftung und Jesus im Verhör sind teilweise widersprüchlich und über weite Strecken hin historisch nicht korrekt. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass es den Autoren um den Versuch der historisch korrekten Wiedergabe geht. Klar und unverkennbar ist die falsche Schuldzuweisung am Tod Jesu.“
Dazu habe auch ich schon mehrfach Stellung genommen. Recht habe ich Ihnen gegeben, dass es sich tatsächlich nicht um historisch korrekte Augenzeugenberichte handelt. Widersprochen habe ich Ihnen insofern, als den Evangelisten die Verantwortlichkeit der Römer am Tod Jesu durchaus bewusst war. Allerdings sehen die Evangelisten auch eine Mitschuld der jüdischen Machtelite an Jesu Tod (190).
Ein paar Anmerkungen möchte ich aber noch zu Ihren Ausführungen in diesem Abschnitt hinzufügen (S. 256):
- Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass die jüdische Priesterschaft persönlich bei Jesu Verhaftung anwesend war, aber dass Lukas 22,52 deswegen unglaubwürdig wäre, weil die „Verhaftungsgruppe … keineswegs von Hohen Priestern begleitet worden sein [kann], denn es gab stets nur einen Hohen Priester im Amt“, stimmt nicht. Sie missverstehen immer noch die unterschiedlliche Bedeutung von archiereōs = „der amtierende Hohepriester“ im Singular und archiereis = „die Machtelite der Priesterschaft“ im Plural.
- Dass nach Matthäus und Markus nur Juden Jesus verhaften (dann aber zu Pilatus bringen), hängt mit ihrer innerjüdischen Kritik an der jüdischen Führung zusammen. Und es passt auch zu Ihrer Erwähnung, dass der spätere selbsternannte Messias Menachem von jüdischen Verantwortlichen des Tempels getötet wurde (191).
- Mit Recht weisen Sie darauf hin (S. 256f.), dass nach Johannes 18,3 „immerhin eine Kohorte, das sind 600 Mann, auf[marschierte], um Jesus zu überwältigen. Nur im griechischen Original erkennt man die Speira, die Kohorte. In den Übersetzungen wird sie, in Anpassung an die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas zur nicht näher bestimmbaren ‚Schar‘. … Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die römische Obrigkeit dem jüdischen Hohen Priester eine Kohorte zur Verfügung gestellt hat, um einen religiösen Querulanten dingfest zu machen.“ Historisch ist das sicher unwahrscheinlich; auf der Erzählebene des Johannes ist aber sogar ein chiliarchos = tribunus, also ein hoher römischer Beamter bei Jesu Verhaftung anwesend; er bringt in Johannes 18,12 Jesus zum Verhör durch den Untersuchungsrichter Hannas. Beweist nicht gerade diese Einzelheit, dass Johannes keineswegs ein römerfreundlicher Evangelist ist, wenn er doch durch seine Erwähnung der römischen speira deutlich macht, dass er Jesus in Konfrontation mit der römischen Weltordnung sieht (192)?
↑ Viele Fragen um den Verrat des Judas – fand er überhaupt statt?
Zum Stichwort (S. 259) V wie Verräter fragen Sie sich zunächst, ob es den Verräter Judas wohl tatsächlich gegeben hat. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander:
„Über Judas Ischariot stellen Theologen seit Jahrhunderten widersprüchliche Überlegungen an. Eine Einigung wurde bislang nicht erzielt: Hat er wirklich gelebt, oder ist er nur eine Fiktion? Wie ist sein Name zu erklären? Ist Judas eine Fantasiegestalt? Oder war er ein Freiheitskämpfer? Wie ist es möglich, dass die Theologie keine schlüssige Antwort anzubieten hat?“
Die letzte Frage ist einfach zu beantworten: Die biblischen Quellen erlauben keine sicheren Rückschlüsse auf historische Fakten. Und die theologische Deutung der Gestalt des Judas geht schon in biblischer Zeit inhaltlich sehr weit auseinander.
Als (S. 260f.) das „negativste Bild von Judas“ erwähnen Sie die Sicht des Evangeliums nach Johannes (6,70-71), in dem „Judas als ‚der Teufel‘ bezeichnet“ wird: „Jesus antwortete den Jüngern: ‚Und einer von Euch ist der Teufel!‘ Er sprach von Judas, vom Sohn des Simon Ischariot.“ Einen Widerspruch erkennen Sie darin, dass dann aber nach Johannes „vor dem Verrat ‚der Satan in Judas‘ [Johannes 13,27]“ fuhr:
„Wie soll man sich das vorstellen: Der Teufel fuhr in den Teufel? Wie auch immer: Die explizite Gleichsetzung des Jüngers Judas mit dem Teufel, also mit dem personifizierten Bösen, findet sich ausschließlich im Evangelium nach Johannes, nirgendwo sonst.“
Dazu habe ich einiges anzumerken:
- In Johannes 6,70 steht wörtlich: „einer von euch ist ein Teufel“, nicht DER Teufel (ex hymōn eis diabolos estin). Eine solche Redeweise kennen wir auch in unserer Sprache; wenn wir von einem besonders heimtückischen oder abgrundtief schlechten Menschen sprechen, können auch wir ihn im übertragenen Sinn als „einen Teufel“ bezeichnen.
- In Johannes 13,27 ist davon die Rede, dass der Satan, nicht der Diabolos in Judas hineinfährt (eisēlthen eis ekeinon ho satanas). Schon die Abweichung der Vokabel deutet darauf hin, dass mit dem Satan hier die böse Macht gemeint ist, die aus dem Menschen Judas sozusagen einen Diabolos macht.
- Das griechische Wort diabolos heißt wörtlich „Durcheinanderbringer“, kann auch die Bedeutung „Ankläger“ haben. Auch im Alten Testament hatte der Satan (hebräisch: SsaTaN, in der griechischen Septuaginta mit diabolos übersetzt) im Hofstaat Gottes die Funktion eines Anklägers (er kommt nur im Buch Hiob, in Sacharja 3,1-2 und in 1. Chronik 21,1 vor). In der Bibel ist dieser Satan noch nicht mit dem absolut bösen Herrn aller höllischen Gewalten identisch, zu dem er im Laufe der späteren Kirchengeschichte werden sollte.
- Ton Veerkamp und Andreas Bedenbender vertreten noch eine andere Auffassung. Ihnen zufolge steht der Satan in den Evangelien repräsentativ für die dem Gott Israels mit seiner Wegweisung der Freiheit und Gerechtigkeit feindlich gegenüberstehende ungerechte Weltordnung des Römischen Reiches (193). So gesehen, wird Judas durch seinen Verrat Jesu, ohne dass ihm das bewusst ist, zum Werkzeug der Römer.
Die Schilderungen des Verrats im Neuen Testament stellen Sie (S. 261f.) mit Recht in ihrer Widersprüchlichkeit dar. Allerdings wird eigentlich gar nicht der Verrat selbst geschildert, sondern lediglich, wie Jesus mit seinen Jüngern über den Verrat spricht (194). Und dabei wundern Sie sich (S. 262) über das Verhalten der Jünger:
„Trotz der Nachricht, die doch alle erschüttern, empören und in Aufruhr versetzen müsste, bleiben alle seltsam gelassen.“
Daraus kann man sicher schließen, dass es sich nicht um Augenzeugenberichte handelt. Es geht um die nachträgliche Deutung des Todes Jesus, und zwar hier insbesondere um die Frage, ob es sogar im engsten Jüngerkreis Menschen geben kann, die zum Verräter des Herrn Jesus Christus werden können, indem sie etwa in Verfolgungen von ihrem Glauben abfallen.
Sie allerdings wollen auf etwas anderes hinaus. Auf Grund des Wortes paradidonai im griechischen Urtext der Evangelien meinen Sie, dass Judas gar nicht Jesus „verraten“ hat, sondern mit Jesu Einverständnis daran beteiligt war, dass Jesus sich „freiwillig hingab“. Sie begründen das so:
„Was aber bedeutet ‚paradidonai‘? Das geht aus dem Brief des Paulus an die Galater deutlich hervor [Galater 2,20]: Paulus preist Jesus, der sich als Sohn Gottes für den Menschen Paulus freiwillig hingab. Für den Neutestamentler Pinchas Lapide ist somit Judas nicht der bösartige Verräter Jesu, sondern der treue Jünger Jesu, der mithalf, den göttlichen Plan im Einverständnis mit Jesus selbst in Erfüllung gehen zu lassen.“
Allerdings: Sich selbst hingeben und einen anderen hingeben ist ein großer Unterschied! Das Wort paradidonai heißt im Alten Testament meistens „in die Hand anderer Völker preisgegeben, ausgeliefert werden“. Das passt doch eher mit der Bedeutung „Verrat“ zusammen. Auf der Erzählebene der Evangelisten Matthäus und Lukas kann im Übrigen schon deswegen nicht „aus einem Verrat durch Judas die ‚Dahingabe‘ mit Jesu Einverständnis“ werden, weil dann absolut unverständlich wäre, warum Judas sich nach Matthäus 27,5 erhängt und warum Judas nach Apostelgeschichte 1,16-19 als Strafe für sein Verhalten eine so schreckliche Strafe erleiden muss. Und wie soll Judas bei Johannes im Einverständnis mit Jesus handeln, wenn doch der Satan in ihn hineinfährt?
Wieder einmal sind Sie nicht in der Lage, mit Spannungen innerhalb theologischer Texte umzugehen. Judas bleibt für seine Tat der Auslieferung Jesu an die Behörden, die ihn töten wollen, verantwortlich, auch wenn Gott aus dem Bösen, das er tut, letzten Endes Segen hervorgehen lassen kann. Es ist ja nicht so, dass Gott den Tod seines Sohnes bewusst herbeiführen will. Es sind Menschen, die das tun. Menschen nehmen sich das Recht heraus, Gott selbst und seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Menschenfreundlichkeit töten zu wollen! Dieser Tod ist eigentlich das Sinnloseste und Furchtbarste, was es gibt. Dass Jesus am Kreuz seinen Mördern und auch dem Verräter vergibt und dass Gott mit der Auferweckung Jesu seine wunderbare Macht erweist, dass die Liebe stärker bleibt als jeder Hass, als Tod und Teufel – all das verharmlost nicht, was der Verräter Judas und der Verleugner Petrus getan haben und was all die Feinde der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes tagtäglich tun. Im Licht der Vergebung durch das Kreuz Christi wird geradezu erst schlaglichtartig deutlich, wie schrecklich die Tat auch des Judas war, mit dem er seinen Freund (aus welchen Motiven heraus auch immer) furchtbaren Folterqualen und einem entsetzlichen Tod preisgab.
Weiterhin fragen Sie sich (S. 263), ob denn ein Verrat Jesu überhaupt notwendig gewesen wäre, wenn sich doch Jesus nach Matthäus 26,55 „vor seiner Verhaftung … an mehreren Tagen im Tempel von Jerusalem“ aufgehalten hat und „vermutlich zu Tausenden“ gepredigt hat. Sicher kann man den Verrat historisch bezweifeln, allerdings liegen auch für die Predigt vor so vielen Menschen keine historischen Beweise vor. Auf ihrer Erzählebene stört die Evangelisten ein solcher Widerspruch offenbar nicht, da ihr Anliegen ja gar nicht ein historisches, sondern ein theologisches ist.
Schließlich rufen Sie (S. 263f.) den Apostel Paulus als Zeugen dafür auf, dass „Judas … Jesus nicht verraten“ hat. Denn
„Paulus, der älteste Kronzeuge des ‚Neuen Testaments‘, verliert kein Wort über einen Verrat, den Judas begangen haben soll. Paulus berichtet, dass Jesus nach der Auferstehung zunächst dem Kephas, dann den zwölf Jüngern erschienen sein soll, also auch Judas [1. Korinther 15,5]. Glaubt man aber den Evangelisten, dann war der vermeintliche ‚Verräter‘ zu diesem Zeitpunkt längst tot, weil er sich aus Schuldbewusstsein das Leben genommen hatte.“
Dadurch ist aber historisch nichts bewiesen, weil ja, als Paulus die Jerusalemer Gemeinde bei einem kurzen Aufenthalt kennenlernte, längst die Zahl der Zwölf durch Nachwahl des Matthias wieder aufgefüllt worden war. Paulus muss also von einem Verrat des Judas überhaupt nichts gewusst haben, wie er ja überhaupt sehr wenig aus dem irdischen Leben Jesu zu berichten weiß (195).
Mein Resümee: Natürlich ist es möglich, dass aus alttestamentlichen Stellen heraus die Geschichten über den Verrat des Judas erdichtet worden sind. Möglicherweise steht die Gestalt des Judas repräsentativ für die Teile des jüdischen Volkes, die nicht auf den Messias Jesus vertrauen; immerhin ist Judas = JeHUDaH der Stammvater, auf den der Name des Judentums zurückgeht. Aber es ist auch möglich, dass die Erzählungen vom Verrat auf Erfahrungen von Verrat und Glaubensabfall innerhalb der Jüngerschar oder der frühen christlichen Gemeinde zurückgehen. Damit setzen sich die Evangelisten auseinander, und da es solche Erfahrungen in jeder Gemeinschaft immer wieder geben kann, ist das viel wichtiger als die historische Frage.
↑ War Johannes der Täufer als Vorbote Jesu der wiedergekehrte Elia?
Zum Stichwort (S. 264) V wie Vorbote kommen Sie noch einmal auf Johannes den Täufer zu sprechen. Im Abschnitt zu E wie Elia hatten Sie bereits bezweifelt, dass er tatsächlich der wiedergekommene Elia gewesen sein könnte, da er nicht alle Verhältnisse in Ordnung gebracht hat, wie das von Elia erwartet worden sei. Hier gehen Sie auf Widersprüche in den Evangelien zu der Frage ein, ob Johannes der Täufer überhaupt mit Elia als dem Vorboten des Messias identisch war, und zwar zunächst auf die in Ihren Augen bereits in sich widersprüchliche Sicht des Evangelisten Johannes (S. 264f.):
„Nach dem Evangelium des Johannes sah sich Johannes der Täufer als diesen ‚Vorboten‘ Jesu [Johannes 1,29-30]: ‚Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus kommt. Und er spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt! Dieser ist‘s, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.‘ Der Täufer bezeichnet sich als Jesu Ankündiger, wovon allerdings die drei anderen Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas nichts wissen.
Wenn Johannes dieser Vorbote war, dann müsste er mit Elia identisch sein.
Der Täufer weist aber eben diese Annahme, er sei der wiederkehrende Elia, weit von sich [Johannes 1,21-22]. Johannes bestreitet einerseits, Elia zu sein. Andererseits beharrt er aber darauf, der Mann zu sein, der die Ankunft des Messias verkündet und vorbereitet [Johannes 1,23]: ‚Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg!‘“
Nach Ton Veerkamp (196) will sich Johannes der Täufer mit seiner Aussage in Johannes 1,21, er sei weder Elia noch der nach 5. Mose 18,15.18 angekündigte Prophet, der wie Mose sein würde, bewusst von den in Johannes 1,22 erwähnten Pharisäern (197) abgrenzen. Stattdessen nennt er sich „Stimme eines Rufenden“ und bezieht sich damit auf ein Wort des Propheten Jesaja (40,3):
„Das Jesajazitat sagt, Jochanan [= Johannes der Täufer] sei wie der Prophet Jeschajahu [= Jesaja]; so wie dieser damals in Babel etwas ungehört Neues ankündigte, so ist Jochanan der, der heute, in der Zeit der Römer, Neues ankündigt. Die Parallele ist die zwischen der Befreiung aus Babel und der Befreiung von Rom.“
Demgegenüber legen Sie richtig dar, dass nach Matthäus 17,11-13 Johannes der Täufer durchaus der wiedergekommene Elia ist, und daraus folgern Sie (S. 265):
„Der Widerspruch ist eklatant: Einerseits behauptete Jesus, dass der Täufer Johannes kein anderer als Elia war, der auf die Erde zurückkam. Seine Aufgabe bestand darin, Jesus anzumelden. Nach Jesus wurde sein Vorbote Johannes der Täufer bereits hingerichtet, so wie auch er selbst hingerichtet werden würde. Andererseits bestritt Johannes selbst, eben dieser Elia zu sein. Müsste er das nicht eigentlich wissen? Wer irrt sich? Jesus oder Elia?“
Sie verkennen dabei, dass diese Frage, ob sich Jesus oder Elia irrt, so einfach keinen Sinn macht. Nach Matthäus ist Johannes der Täufer identisch mit Elia, aber nicht nach dem Evangelisten Johannes. Also könnte der matthäische Täufer durchaus auch selber wissen, dass er Elia ist (198), während der johanneische Täufer das auf der Erzählebene seines Evangeliums eben deswegen nicht weiß, weil er es ganz einfach nicht ist. Ob Jesus oder Johannes der Täufer selbst tatsächlich eine solche Identität mit Elia angenommen haben, ist historisch nicht ergründbar.
Auch im Blick auf das Lukasevangelium argumentieren Sie noch einmal so, als ob sich aus allen vier Evangelien zusammen ein einheitliches historisches Bild ergeben müsste:
„Das Evangelium nach Lukas schreibt über den Vorboten Jesu [Lukas 1,17]: ‚Er wird vor ihm (vor Jesus) hergehen in Geist und Kraft des Elia.‘ Das heißt doch, dass Jesus nicht von Elia selbst, sondern von einem Mann ‚in Geist und Kraft des Elia‘ avisiert werden würde. Diese Aussage widerspricht den klar formulierten Worten Jesu.“
Der letzte Satz stimmt, wie gesagt, nur, wenn Sie von allen Evangelien dieselbe Sicht der Dinge erwarten. Ja, Lukas widerspricht der Sicht des Johannes. Er bietet noch einmal eine anders akzentuierte Deutung des Vorboten Jesu. Der Version des Matthäus widerspricht der lukanische Jesus allerdings nicht ganz, denn die Wiederkunft des Elia wurde ja ohnehin nicht so verstanden, dass genau derselbe Mensch wie damals noch einmal auf der Erde leben würde, sondern man erwartete einen Propheten, der in der gleichen Weise wie Elia vom Geist und von der Kraft Gottes erfüllt sein würde.
Nun behaupten Sie außerdem (S. 265f.), dass Lukas 1,17
„nicht nur im Widerspruch zu Jesus, sondern auch zum ‚Alten Testament‘ [steht]. Da heißt es im letzten Buch, also bei Maleachi [3,23 (199)], eindeutig: ‚Siehe ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn.‘ Maleachi prophezeit also Elia als Vorboten der Apokalypse. Und da der Messias zur Apokalypse erwartet wird, ist nach Maleachi eindeutig Elia der Vorbote Jesu, wenn Jesus der Messias ist. Auf diesen Text mag sich Jesus bezogen haben.“
Recht haben Sie insofern, als alle Evangelisten, die erwägen, ob Johannes der Täufer als Vorbote Jesu anzusehen ist, sich auf diesen Maleachi-Text beziehen. Aber alle tun es in unterschiedlicher Weise:
- Für Matthäus ist Johannes der Täufer eindeutig Elia.
- Lukas geht gleichermaßen davon aus, dass die Geburt Johannes des Täufers, die er in Lukas 1,11-17 seinem Vater Zacharias ankündigt, eine Erfüllung der Prophezeiung des Maleachi ist.
- Johannes, der Evangelist, entscheidet sich, wie oben erläutert, dagegen, Johannes den Täufer als wiedergekehrten Elia zu begreifen; dabei macht er zugleich deutlich, dass es andere Bibelstellen gibt, die etwa einen neuen Propheten wie Mose voraussagten (5. Mose 18,15.18); und er selbst sieht Johannes in einer Linie mit dem Propheten Jesaja.
- Zu erwähnen vergessen haben Sie die Sichtweise des Evangelisten Markus, der zwar ähnlich wie nach ihm Matthäus Johannes den Täufer mit Elia gleichsetzt, aber nach Andreas Bedenbender (200) tut er das nur „in Andeutungen“. So bleibt (S. 15, Anm. 17) in Markus 2,1 unausgesprochen, dass der dort erwähnte Bote Elia ist und dass er nicht bei Jesaja, sondern in Maleachi 3,23 angekündigt wird. Und (S. 17, Anm. 21) in Markus 1,6 trägt Johannes „gerade die Kleidung, an der Elia der biblischen Tradition zufolge [2. Könige 1,7-8] identifiziert werden konnte“. Schließlich wird in Markus 9,13 „in Verbindung mit Mk 6,17-29 (Jesu Satz über Elia – ‚sie haben mit ihm gemacht, was immer sie wollten‘“ deutlich, dass Markus den in Johannes wiedergekehrten Elia jedenfalls nicht im Sinne zelotischer Juden als siegreichen Überwinder der römischen Fremdherrschaft darstellt, sondern als ebenso leidend und zum Tod verurteilt wie den Messias Jesus, dessen Vorbote er ist (201).
↑ Wunder: Wie viele Blinde heilte Jesus?
Zum Thema (S. 266) W wie Wunder fragen Sie sich zu den Erzählungen der Evangelisten von einer „Blindenheilung“ durch Jesus, welche davon denn nun tatsächlich in ihren Details zutrifft, obwohl es allmählich klar sein sollte, dass diese Frage müßig ist – haben doch die verschiedenen Autoren ihre Darstellung aus theologischen Gründen oft sehr unterschiedlich gestaltet. Ihre folgenden Fragen (S. 267) lassen sich also nicht historisch beantworten – und warum die Geschichte in Matthäus 20,29-34 und Lukas 18,35-43 so verschieden erzählt wird, obwohl sie beide auf Markus 10,46-52 zurückgreifen, vermag ich auch nicht zu erklären:
„Heilte nun Jesus einen Blinden oder zwei? Kam es zum Wunder auf dem Weg nach Jericho, oder als man Jericho nach dem Besuch wieder verließ? Die unterschiedlichen Angaben zur Zahl der Blinden lässt sich nicht harmonisieren.“
Aber sind die Zahl der Blinden und der Ort ihrer Heilung so wichtig für das Verständnis der Erzählung? Verliert sie ihre Bedeutung für das Vertrauen auf Jesus Christus, wenn sich die unterschiedlichen Versionen nicht harmonisieren lassen?
Recht haben Sie natürlich mit Ihrer Zurückweisung abwegiger Harmonisierungsversuche, als ob „sich Jesus und seine Mannen innerhalb Jerichos … von der Alt- in die Neustadt“ bewegt hätten:
„dann waren sie bereits in der Stadt. Dann kamen sie weder in Jericho an, noch gingen sie aus Jericho weg. Dann stimmen, streng genommen, alle drei Evangelientexte nicht.“
Weiterhin beschäftigen Sie sich mit der Frage, auf welche Weise Jesus Wunder vollbracht hat. Bei der erwähnten Blindenheilung „erklärt [Jesus] dem oder den Geheilten, dass ihr Glaube geholfen hat.“ Markus 8,22-26 erzählt allerdings von einem weiteren Blinden (S. 267f.), den Jesus erst in zwei Anläufen und mit ganz anderen Mitteln, nämlich mit Speichel und Handauflegung, heilen konnte. Sie fragen (S. 269):
„War es nun der Glaube der Blinden, der ihnen half? Wurden sie sehend, weil sie es selbst wollten? Oder weil ihr Glaube an den ‚Wundermann‘ Jesus so stark war? War es im medizinischen Sinne Jesu Spucke? Half Jesus als Aufklärer und Verfechter der Gesetze der Hygiene? Oder floss aus Jesu Händen die Kraft Gottes?“
Viele Interpretationen sind möglich. Mir erscheint am plausibelsten, dass die Wunderkraft Jesu darauf beruht, dass er in den Menschen ihr Gottvertrauen stärkt, durch das heilende Prozesse in Gang gesetzt werden. Die Einzelheiten der Erzählungen, die zum Teil auch auf gängige Heilungspraktiken, auch magischer Art, Bezug nehmen (weshalb vielleicht Markus 8,22-26 von Matthäus und Lukas gerade nicht übernommen wird), deuten vielleicht darauf hin, dass psychosomatische Heilungsprozesse auch mit körperlichen Berührungen und der Überwindung des Ekels vor Speichel oder Ohrenschmalz verbunden sein können. Dass Jesus in Markus 8,23 den Blinden aus dem Dorf herausführt und ihn in 8,26 nicht wieder dorthin zurückschickt, mag damit zu tun haben, dass Jesus die Ursache seiner Erkrankung in etwas erblickt, was ihm in der dortigen Gemeinschaft widerfahren ist.
Von einer solchen Einfühlsamkeit in die psychosomatische Bedeutung der Wunder Jesu ist in den von Ihnen zitierten Auszügen aus dem Werk von Gustav Mensching (202) über „Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Völker“ leider nichts zu spüren. Sie unterstellen ihm, dass er Wunder „seziert und klassifiziert“, um „das Geheimnisvolle salonfähig zu machen“, und zitieren seine Definition eines Wunders als die
„erlebnishafte Begegnung des Menschen mit dem Heiligen und das antwortende Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen“.
Aber sollte Jesus nun als Mensch „mit übernatürlichen Kräften“ dargestellt werden? Sollten seine Wunder seine „Autorität“ als „einer göttlichen Person bekräftigen“? Oder ging es um besondere religiöse „Begegnungen mit dem Heiligen“, die „Staunen und Verwunderung“ hervorriefen? Bei all diesen verschiedenen Kategorisierungen bleibt allerdings die Heilung selbst mit ihren sozialen, politischen und psychologischen Kontexten ausgeklammert.
Sie schreiben abschließend (S. 270):
„Wunderheilungen lassen den glaubenden Menschen ehrfurchtsvoll, vielleicht auch ein wenig schaudernd staunen. Er fühlt sich dem großen Mysterium gegenüber unendlich klein. Jesu Wunderheilungen bestätigen ihm die Richtigkeit seines Glaubens, weil er glaubt. Der rein rational denkende Mensch hingegen sieht die Irrtümer der biblischen Berichterstatter im Vordergrund und lehnt Mirakel als unmöglich ab, weil für sie kein Platz ist in seinem Weltbild. Beiden, dem Glaubenden wie dem Rationalisten, wird mit Analysen à la Mensching in keiner Weise geholfen.“
Ich stimme Ihnen zu, indem ich allerdings über Ihre Einschätzung folgendermaßen hinausgehe:
- Demut ist gegenüber dem Geheimnis des Wunderwirkens Jesu angebracht – allerdings bestätigen Jesu Wunder nicht allein die Richtigkeit des Glaubens dessen, der glaubt, sondern der auf Jesus Vertrauende kann auch selber die heilende Kraft dieses Gottvertrauens erfahren.
- Menschings Analysen greifen zu kurz, weil Jesu Wunder eben keine Mirakel sind, sondern auf der Heilkraft von Vertrauen und Liebe den Beziehungen des Menschen zu Gott, zu anderen Menschen und sich selbst beruhen.
↑ Gott wollte, dass Jesus den Versuchungen des Satans standhielt
Zum Stichwort (S. 270) W wie Wüste befassen Sie sich mit den Versuchungen, denen Jesus in seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste ausgesetzt war. Matthäus 4,1-11 und Lukas 4,1-13 erwähnen drei Versuchungen durch den Teufel, während Markus 1,12-13 nur die Tatsache der Versuchung als solche erwähnt:
Und alsbald trieb ihn [Jesus] der Geist in die Wüste; und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.
Dazu kommentieren Sie (S. 270f.):
„Worin die ‚Versuchung‘ bestanden haben soll, verschweigt Markus. Umso gesprächiger sind Matthäus und Lukas. Allerdings widersprechen sich die beiden Texte, was die Reihenfolge der Versuchungen angeht. …
So einfach die kleine Geschichte auch zu sein scheint, muss es doch verwundern, dass sich Matthäus und Lukas nicht über die Reihenfolge der Versuchungen einigen können. Logischer aufgebaut ist die Version nach Matthäus: Die Versuchungen steigern sich vom Brot gegen den knurrenden Magen bis hin zur Herrschaft über die gesamte Welt.“
Allerdings kann keine Rede davon sein, dass Markus etwas „verschweigt“, was er möglicherweise weiß, aber nicht weitersagen will. Nach dem Kommentar zum Lukasevangelium von Walter Schmithals (203) ist
„die Versuchungsgeschichte in [der Logienquelle] Q … eine Ausführung der kurzen Notiz Mark. 1,13, Jesus sei während seines Wüstenaufenthaltes auch vom Satan versucht worden.“
Insofern ist (S. 274) auch Gerd Lüdemann (204) im Blick auf diese Überlieferung schlicht zuzustimmen, wenn er schreibt: „Die Tradition ist unhistorisch.“ Dazu ist allerdings wieder einmal zu sagen: Na und? Viel wichtiger ist doch, was mit diesen Erzählungen über den Glauben an Jesus und über die Bewältigung von Versuchungen ausgesagt werden soll.
Zur Reihenfolge der Versuchungen schreibt Schmithals (an der eben genannten Stelle):
„Da Gründe, aus denen Lukas [die in der ihm vorliegenden Quelle Q vorliegende Reihenfolge] umgestellt haben sollte, nicht ersichtlich sind und Lukas im allgemeinen Q genauer überliefert als Matthäus, dürfte er auch im vorliegenden Fall die ursprüngliche Reihenfolge haben. Sie bietet eine gute Szenenfolge: Nach der Versuchung in der Wüste führt der Teufel Jesus in die Höhe und dann hinunter auf das Tempeldach. Auch eine erzählerische Steigerung ist unverkennbar: Nachdem Jesus zweimal der Versuchung mit Hilfe eines Bibelwortes widerstand, versucht der Teufel es schließlich selbst mit einem Wort der Schrift. Ferner liegt insofern eine Ringkomposition vor, als in V. 1f. und in V. 12 von ‚Versuchung‘ die Rede ist; Jesu letzte Antwort beschämt den ‚Versucher‘ doppelt, weil sie ihm indirekt sein Tun überhaupt verweist. Die zweite Versuchung gehört auch deshalb in die Mitte, damit sie von dem ‚wenn du Gottes Sohn bist‘ (V. 3.9) eingerahmt wird, das neben dem ‚wenn du also vor mir niederfällst‘ (V. 7) nicht stehen konnte. Matthäus hat anscheinend die zweite Versuchung an das Ende gestellt, weil er sie fälschlicherweise für den Höhepunkt der Versuchung hielt. Indessen ist das Angebot der Herrschaft über den vergehenden Weltlauf keine besondere Versuchung für den ‚Sohn Gottes‘, den Herrscher im ‚Reich Gottes‘.“
Das finde ich überzeugend; zum „fälschlicherweise“ im vorletzten Satz möchte ich allerdings anmerken, dass Matthäus die von ihm als dritte angesehene Versuchung wohl deswegen für die entscheidend wichtige hielt, weil er als toratreuer Judenchrist sich um so entschiedener von zelotisch denkenden Juden abgrenzen wollte, die im Jüdischen Krieg ja tatsächlich den fatalen Versuch unternommen hatten, der Römischen Weltordnung mit gewaltsamen Mitteln ihre Herrschaft zu entreißen.
Wichtiger ist Ihnen allerdings die Frage (S. 271), „wer denn für die Versuchungen verantwortlich ist“, und zwar nicht vordergründig, sondern letzten Endes ursächlich. Das ist nach allen drei synoptischen Evangelien (Markus 1,12; Matthäus 4,1; Lukas 4,1)
„aber der ‚Heilige Geist‘. Denn der ‚Heilige Geist‘ ist es, der Jesus in die Wüste treibt. Er ist es, der den sprichwörtlichen Stein ins Rollen bringt. Das wiederum wirft eine ketzerisch anmutende Frage auf, nämlich ob denn gar dem ‚Heiligen Geist‘ selbst die Gebote der Bibel nicht bekannt sein sollten? lm Brief des Jakobus [1,13] heißt es nämlich explizit: ‚Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.‘“
Zu dieser Frage, ob Gott Menschen in Versuchung führen kann, habe ich zum Abschnitt V wie Versuchung bereits ausführlich Stellung genommen. Hier möchte ich wiederholen bzw. ergänzen: Wenn Gott der Eine und Einzige Gott ist, dann muss letzten Endes auch er für die Versuchungen, in die Menschen geführt werden, zumindest indirekt verantwortlich sein. Und wenn die Evangelisten deutlich betonen, dass es der Heilige Geist ist, der Jesus in die Situation in der Wüste bringt, in der er der Versuchung durch den Satan ausgesetzt ist, dann sagen sie damit: Gott will, dass Jesus sich bewusst diesen Versuchungen aussetzt, und zwar, damit er sie durchsteht und ihnen widersteht. Denn nur so erweist er, dass er der vollkommen von Gottes Geist erfüllte Sohn und Messias Gottes ist.
Im Blick auf den Jakobusbrief schreiben Sie weiterhin (S. 272):
„Nach Jakobus versucht Gott nicht zum Bösen. Was heißt das? In der Wüstenepisode ist es doch der ‚Heilige Geist‘, der Jesus versuchen lässt. Nach der Lehre der Trinität (Dreifaltigkeit) sind aber Gott und Heiliger Geist eines. Also ist es doch Gott, der als Versucher auftritt. Aber nach Jakobus tut Gott genau das nicht. Nach der Trinitätslehre ist aber auch Jesus und Gott eins. Nach Jakobus kann aber Gott nicht versucht werden. Wird aber in der Wüste nicht doch Gott in Gestalt Jesu versucht? Widersprüche über Widersprüche ergeben sich, die nicht aufgelöst werden können.“
Diese Spannungen bestehen tatsächlich, aber ich würde sie nicht Widersprüche nennen, die man aufzulösen wünschen kann. Wieder einmal zeigt sich, dass Sie die Trinitätslehre nicht in ihrer wirklichen Tiefe verstehen. Sie meint nämlich nicht, dass Vater, Sohn und Geist einfach dasselbe sind. Nein, sie sind drei-einig: in bestimmter Hinsicht eins, in anderen Hinsichten unterschieden.
Versucht werden kann Jesus, insofern er nicht nur wahrer Gott, sondern zugleich wahrer Mensch ist, der Versuchungen in gleicher Weise ausgesetzt ist wie alle anderen Menschen. Die Versuchung durch den Satan kann Gott, der Vater, zulassen, indem das Böse als gegengöttliche Macht zwar in der Welt ist (die Existenz dieser Macht kann man letztlich nicht erklären), aber nicht als ein zweiter oder sogar mächtigerer Gott als der Eine Gott selbst. Das heißt, nur indirekt führt Gott in die Versuchung, und zwar mit der Absicht, dass die in Versuchung Geführten ihr nicht verfallen, sondern sich im festen Vertrauen zu Gott aus der Macht des Bösen befreien lassen.
Einen Ausweg aus den von Ihnen angesprochenen Widersprüchen erwägen Sie noch:
„Eine Ausflucht ist denkbar: Den Verfassern der Wüstenepisode, also den Autoren der nach Matthäus, Markus und Lukas benannten Evangelien, war die Trinitätslehre unbekannt.“
Dazu ist zu sagen, dass die Evangelisten natürlich noch nicht die Trinitätslehre in ihrer späteren dogmatischen Formulierung kannten. Aber dass der Heilige Geist der Geist des Einen Gottes war, darin waren sie mit den späteren Verfechtern der Dreieinigkeit absolut einig.
Und es geht ja auch nicht um Ausflüchte. Die Spannung zwischen der Versuchung, gegengöttlichen Mächten zu verfallen (und sei es sogar, dass diese Versuchung darin besteht, mit Gewalt einen Gottesstaat aufbauen zu wollen), und der Einsicht, dass es Gott selber ist, der darauf besteht, dass Jesus dieser Versuchung widersteht, soll überhaupt nicht aufgelöst, sondern ausgehalten werden.
Dass Jesus 40 Tage in der Wüste war, ist natürlich, wie Sie mit Recht annehmen, „symbolhaft gemeint“. Zwar formulieren Sie etwas ungenau, dass Mose für die Juden zur Zeit Jesu der „Messias“ des „Alten Testaments“ war, aber er war für sie tatsächlich derjenige, der „das Volk Israel aus ägyptischer Gefangenschaft“ geführt hatte, und so, wie es Mose damals getan hatte,
„so sollte der neue Messias das Volk aus der Unterdrückung durch die Römer geleiten. Mose zog angeblich nicht nur 40 Jahre durch die Wüste. Er stieg auch in dieser Zeit auf den Berg Sinai, um die Gesetzestafeln zu erhalten. 40 Tage lang blieb er auf dem Gipfel. Deshalb ließen die Evangelisten in ihren ‚Berichten‘ Jesus auch 40 Tage lang in der Wüste darben.“
↑ Jesus war Messias = Christus = Gesalbter und Menschensohn
Zum Stichwort (S. 274) X wie Christos ist Ihnen kein neutestamentliches Wort mit X eingefallen, aber der Christustitel Jesu beginnt im Griechischen mit Chi = χ, das wie ein deutsches X aussieht.
Leider bringen Sie in diesem Abschnitt Ihres Buches eine ganze Reihe von Begriffen heillos durcheinander. Das beginnt schon mit dem ersten Absatz:
„Schon in der jungen christlichen Gemeinde sah man in Jesus den ‚Gesalbten‘ und den Messias in Personalunion. Jesus Christos (Griechisch, übersetzt „der Gesalbte“) und der Erlöser (‚Messias‘) waren ein und dieselbe Person. Für diese Gleichsetzung lassen sich unzählige Belege in den Schriften des ‚Neuen Testaments‘ anführen.“
Falsch ist es hier, für den „Gesalbten“ und den „Messias“ eine unterschiedliche Wortbedeutung anzunehmen. Nein, beide sind identisch, denn das hebräische Wort MaSchIaCh = „Gesalbter“ wird ins Griechische mit christos und ins Deutsche mit „Messias“ übersetzt. Nichts anderes als eine solche Übersetzung nimmt der Evangelist Johannes sowohl in 1,41 als auch in 4,25 vor (an beiden Stellen steht das ans Griechische angepasste hebräische Wort Messias und die griechische Form christos, wobei letztere in deutschen Übersetzungen manchmal mit „Christus“, manchmal aber auch mit „der Gesalbte“ übersetzt wird).
Falsch ist dagegen umgekehrt die Gleichsetzung der Begriffe „Messias“ und „Erlöser“. Für den Erlöser gibt es im Hebräischen das Wort GaˀAL (er ist derjenige, der Schuldverpflichtungen auflöst), aber auch das Wort MOSchIAˁ, das ähnlich wie „Messias“ klingt, aber wörtlich „Retter“ oder „Helfer“ heißt und ins Griechische mit sōtēr übersetzt wurde.
Richtig ist es also, dass man in Jesus schon früh den Messias und den Erlöser „in Personalunion“ sah, also den MaSchIaCh und den MOSchIAˁ bzw. den christos und den sōtēr. Das zeigt sich zum Beispiel im urchristlichen Fischsymbol, denn die Buchstaben des griechischen Wortes IChThYS = „Fisch“ kann man als die Anfangsbuchstaben der Kurzfassung eines frühen christlichen Glaubensbekenntnisses lesen: Iēsous Christos Theou Hyios Sōtēr = „Jesus [ist der] Christus, Gottes Sohn [und der] Retter“.
Schon im dritten Absatz dieses Abschnitts unterläuft Ihnen der nächste Irrtum. Nicht in der Eigenschaft als „Christos, der Gesalbte“, kann Jesus nach Matthäus 9,2 oder Lukas 5,20 „Sünden vergeben“, sondern er tut es (Lukas 5,24), weil „der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben“ (vgl. sinngemäß ebenso Matthäus 9,6). Natürlich vereinigt Jesus in sich die Eigenschaften des Christus und auch des Menschensohns, aber wenn Sie schon zwischen den einzelnen Hoheitstiteln Jesu unterscheiden wollen, dann sollten Sie dabei auch genau hinschauen (205).
Denselben Fehler begehen Sie auch im nächsten Absatz:
„Der Christos des ‚Neuen Testaments‘ wird als himmlische, gottgleiche Gestalt betrachtet, den die Menschen kommen sehen ‚in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln‘ [Matthäus 16,27]. Ihm unterstehen die himmlischen Wesen, die Engel. Er wird sie ‚senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die Ärgernis geben und die Unrecht tun‘ [Matthäus 13,41].“
Auch hier verwechseln Sie die Vorstellung des Menschensohns mit der des Christus – überall an den von Ihnen zitierten Stellen ist ausdrücklich vom hyios tou anthrōpou = „Menschensohn“ und nicht vom christos die Rede.
Und die Kette des begrifflichen Durcheinanders, das Sie anrichten, reißt auch im folgenden Absatz nicht ab (S. 275):
„Sogar beim Verhör vor dem jüdischen Rat wird den jüdischen Gelehrten unterstellt, Christos (den Gesalbten) mit Gottes Sohn gleichzusetzen, anders ist die Frage des Hohen Priesters nicht zu erklären [Markus 14,61]: ‚Bist du der Christus, der Sohn Gottes?‘ Nur so kann der Gesalbte ‚in der Herrlichkeit des Vaters‘ [Matthäus 16,27] erscheinen.“
Hier bringen Sie sogar drei Hoheitstitel für Jesus miteinander in eine Verbindung: den Christus, den Gottessohn und den Menschensohn. Grundsätzlich ist das ja nicht falsch, da die frühen Christen alle diese Bezeichnungen auf Jesus bezogen. Aber es ist nicht der Gesalbte, also der Christos, der Matthäus 16,27 „in der Herrlichkeit seines Vaters“ erscheint, sondern eben „der Menschensohn“.
Nicht ganz korrekt ist hier auch, dass Sie Zitate aus zwei verschiedenen Evangelien miteinander in Beziehung setzen; in diesem Fall bietet allerdings auch Markus in 8,38 fast dieselbe Formulierung wie Matthäus 16,27.
Mit einem Irrtum beginnen Sie ebenfalls, wenn Sie weiterhin die Messiasvorstellungen im Alten und Neuen Testament so grundsätzlich unterscheiden wollen, dass sie praktisch überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben sollen:
„So sehr das ‚Neue Testament‘ Jesu Autorität von echten oder vermeintlichen ‚prophetischen‘ Worten aus dem ‚Alten Testament‘ ableitet, so ist der Messiasbegriff im ‚Alten Testament‘ doch ein ganz anderer als im ‚Neuen‘. Vor allem haben im ‚Alten Testament‘, im Gegensatz zum ‚Neuen‘, Messias und Gesalbter überhaupt nichts miteinander zu tun. Eine Gleichsetzung von ‚Messias‘ und ‚Gesalbtem‘ hätte Unverständnis und Befremden ausgelöst. Unter dem ‚Gesalbten‘ versteht man einen Menschen aus Fleisch und Blut, keine Idealgestalt ohne Fehl und Tadel. …
Der Messias war ein letztlich politischer Hoffnungsträger, keine göttliche Lichtgestalt.“
Falsch ist hier wieder die begriffliche Unterscheidung zwischen dem „Messias“ und dem „Gesalbten“. Auch im Alten Testament ist nämlich der MaSchIaCh = Messias identisch mit dem „Gesalbten“, denn das Wort ist nun einmal genau so zu übersetzen.
Recht haben Sie allerdings darin, dass die Vorstellung des Messias Jesus im Neuen Testament sich sehr stark von allem unterscheidet, was zuvor als Messias gesehen worden war. Allerdings war die Messiasvorstellung schon seit alttestamentlichen Zeiten immer in einer Veränderung begriffen gewesen. Umgekehrt aber sind alle Schriften des Neuen Testaments immer bestrebt, ihre Aussagen über den Messias Jesus von den Schriften des Alten Testaments her zu begreifen und zu füllen.
- Zunächst ist im Alten Testament dieser Gesalbte tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, nämlich in der Regel ein König oder auch ein Priester Israels.
- Nach der Rückkehr aus der babylonischen Deportation kann auch der persische König Kyros bildhaft als Gesalbter Gottes gepriesen werden, weil er dem Volk Israel die Rückkehr und eine eingeschränkte Autonomie in einem Staatswesen unter der Verfassung der Tora ermöglicht.
- In der apokalyptischen Bewegung, die auf Grund der hellenistischen Unterdrückung entsteht, in der es keine politische Hoffnung auf Verbesserung der Zustände gibt, entwickelt sich die messianische Hoffnung bereits in Richtung einer zukünftigen Lichtgestalt. Manche erwarten einen Friedenskönig aus der Dynastie des Königs David. Andere setzen ihre Hoffnung auf einen, der „wie ein Mensch“ regieren wird, auf den so genannten „Menschensohn“ nach Daniel 7,13-14.
- Jesus als Apokalyptiker bezeichnet sich vielleicht selbst als dieser „Menschensohn“ oder „einer wie ein Mensch“, oder er wird von seinen Nachfolgern so gesehen. Zugleich erkennen seine Nachfolger in ihm nach seinem Tod nicht nur den Christos, den Gesalbten Gottes, sondern auch den „Sohn Gottes“ im Sinne einer vollkommenen Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, so dass er schon frühzeitig mit Gott zusammen als Kyrios = „Herr“ angebetet werden kann (206). In seinem Namen offenbart sich in ihren Augen der heilige NAME des Gottes Israels. Und so kann man mit Jesus auch die Vorstellung des auf den Wolken wiederkommenden Menschensohnes verbinden.
- Sicher verändern die frühen Christen die Messiasvorstellung des Alten Testaments, aber zunächst ist durchaus auch Jesus als Messias noch ein „politischer Hoffnungsträger“. Nur verstehen er bzw. seine Nachfolger diese politische Hoffnung nicht in einem zelotischen, auf gewaltsamen Umsturz bedachten Sinn. Stattdessen wird die Vorstellung von Jesus als Messias, als Davids- und Menschensohn, mit der Gestalt des leidenden Gottesknechts aus dem Buch Jesaja verbunden, mit dem Lamm Gottes, das geschlachtet wird, mit dem Richter, der zugleich ein ungerechtes Urteil erleidet und seinen Mördern vergibt, mit dem Hohenpriester, der sich selbst zum Opfer für die Sünden der Welt darbringt. Grundlegend für alle anderen Hoheitstitel Jesu ist jedoch die Überzeugung, dass Jesus DER Messias = Christos = „Gesalbte Gottes“ ist, so dass es nicht lange dauert, bis aus dem messianischen Titel Christos die Bezeichnung „Christus“ als fester Namensbestandteil für Jesus Christus wird.
Im weiteren Verlauf Ihrer Ausführungen gestehen Sie zu (S. 276), dass „der Messiasbegriff des ‚Alten Testaments‘ … komplex gewesen sein“ mag. Aber „er unterschied sich grundlegend vom Messias-Glauben der Anhänger Jesu“, da der
„Messias des ‚Alten Testaments‘ … nicht die Macht der Sündenvergebung [besaß] und … nicht den Menschen die geistige Rettung schenken [konnte]. Der Messias wurde nicht als himmlische Lichtgestalt gesehen, der, unterstützt von den Heerscharen der Engel zur Erde herabstieg. Auf keinen Fall wurde der Messias als gottähnlich oder gottgleich gesehen. Der Messias war ein Mensch, kein Gott oder Gottes Sohn. Der überlieferte Messiasbegriff des ‚Alten Testaments‘ hat mit Sündenfreiheit oder gar Heiligkeit nichts zu tun.“
Ganz stimmt das nicht. Denn bereits der Menschensohn in Daniel 7,13 kommt „mit den Wolken des Himmels“, und schon das Volk Israel ist nach 3. Mose 19,2 dazu berufen, heilig zu sein: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott.“ Was damit gemeint ist, das ist die Frage. Ich bin dafür, die Vorstellungen von Heiligkeit an dem auszurichten, was im Alten Testament damit gemeint war, nämlich die Tora der Befreiung und Gerechtigkeit des Gottes Israels zu befolgen.
Indem Sie am Schluss dieses Abschnitts (S. 177) darauf zu sprechen kommen, dass im Alten Testament der Messias als Mensch der Zukunft gesehen wird, „den Gott dereinst dafür einsetzen würde, Gericht abzuhalten“, und ihn mit dem „Messias des jungen Christentums“ vergleichen, der ebenfalls „als künftiger Richter verstanden“ wird, „aber als himmlisches Wesen, ausgestattet mit der Allmacht des Vaters: zu richten über die Lebenden und die Toten“, sehen Sie den jüdischen und den christlichen Messias in folgender Weise als grundsätzlich verschieden:
„Richter sind sie beide, der Messias des ‚Alten Testaments‘ wie der ‚Christos‘ des ‚Neuen‘. Doch der Messias wurde als für irdische Gerechtigkeit zuständig angesehen, während der ‚Christos‘ des ‚Neuen Testaments‘ das ewige Leben zu vergeben hat.
Vermutlich hat sich die Vorstellung vom ‚Christos‘, dem Weltenrichter, aus der Sehnsucht nach einem irdischen ‚Messias‘ entwickelt. Träumte man erst von einem Menschen, der Israel wieder nach mosaischen Vorstellungen in Ordnung bringen würde? Entstand daraus die Idee vom göttlichen Richter über Tod und ewiges Leben? Wer aber ‚Messias‘ und ‚Christos‘ gleichsetzt, unterliegt einem großen Irrtum. Man kann nicht das Bild vom Jesus-Christus dazu verwenden, um den Messias des ‚Alten Testaments‘ zu verstehen.“
Und genau hier will ich noch einmal einhaken, um Ihre Ausführungen sozusagen umzudrehen, vom Kopf auf die Füße zu stellen: Sie mögen damit Recht haben, dass man den Messias des Alten Testaments nicht vom Jesus-Christus her verstehen kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir Christen gut daran tun, umgekehrt den Messias Jesus des Neuen Testaments vom Messias des Alten Testaments her zu verstehen, schon allein, um nicht allzu sehr ins Jenseitige abzuheben. Denn Jesus, so wie er im Neuen Testament gesehen und verkündigt wird, ist nicht unpolitisch, er ist anders politisch: antizelotisch, aber auch antirömisch. Ihm liegt wie den jüdischen Befreiungsbewegungen vor ihm die Vision der Freiheit und Gerechtigkeit am Herzen, und zwar für Israel wie für die Völker.
↑ Jesus hieß eigentlich Jeschua oder Jehoschua – aber mit Ypsilon schrieb man ihn nicht
Zum Stichwort (S. 277) Y wie Jesus fällt mir zunächst auf, dass Sie offenbar auch zum Buchstaben Y nur auf Umwegen einen Lexikoneintrag bereitstellen können – eigentlich hätte es ja J wie Jesus heißen müssen, selbst wenn man auf die hebräische Form des Namens JeSchuAˁ oder JeHOSchuAˁ zurückgreift.
Wenn Sie darauf hinweisen, dass zur Zeit Jesu, in der sich die „Judäer“ von den „römischen Besatzungstruppen … geknechtet“ fühlten und „das fremde Joch abwerfen“ wollten, „keine jüdische Familie einem Sohn einen lateinischen Namen wie ‚Jesus‘“ gab, so ist das natürlich richtig. Allerdings sollte eigentlich auch niemand annehmen, dass Jesus der ursprüngliche Name Jesu in der Sprache war, die von seiner Familie gesprochen wurde, denn in unseren Bibelübersetzungen sind alle hebräischen, aramäischen und griechischen Eigennamen in der Regel in eine für uns Deutsche leichter auszusprechende Form übertragen worden.
Die Übertragung von Namen in eine andere Sprache ist auch schon in der Antike belegt, so kennt Paulus den Apostel, den wir Simon Petrus nennen, noch unter seinem aramäischen Beinamen Kephas. Und Paulus selbst war sowohl unter seinem hebräischen Namen SchaˀUL, latinisiert Saulus, als auch unter dem lateinischen Namen Paulus = „der Geringe“ bekannt.
Insofern ist „Jesus“ also kein falscher Name für Jesus, ebenso wenig wie „Ludwig XVI.“ kein falscher Name für „Louis Quatorze“ ist, sondern eben einfach eine Übersetzung in eine andere Sprache.
Entstanden ist der lateinische Name „Jesus“, den auch wir im Deutschen benutzen, wie Sie es richtig beschreiben (S. 278), auf Grund des griechischen Namens Iēsous. So heißt Jesus im Neuen Testament, das ja „in griechischer Sprache verfasst“ ist. Aber worauf geht diese griechische Namensform zurück? Sie schreiben:
„Das griechische ‚Iesous‘ ist eine Anpassung des aramäischen ‚Yesu‘. Das aramäische ‚Yesu‘ wiederum ist die Kurzform von ‚Yesua‘. ‚Yesua‘ selbst ist wiederum auch eine verkürzte Version eines längeren Namens, von ‚Yehosua‘.“
Leider belegen Sie nicht, worauf Sie diesen Rückgriff auf die aramäische Sprache stützen. Gab es überhaupt genau diese Namensformen im Aramäischen zur Zeit Jesu? Dass Sie sie mit „Y“ umschreiben, hat sicher nur damit zu tun, dass Sie den Eintrag unter „Y“ und nicht unter „J“ einordnen wollen, denn im originalen Aramäisch gab es meines Wissens genau so wenig ein „Y“ wie im Hebräischen. Aber man muss hier gar nicht auf das Aramäische zurückgehen. Denn sicher ist, dass Iēsous bereits in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, die gängige Übertragung der Namen JeHOSchuAˁ und JeSchuAˁ ist.
Sie bestätigen das dann eigentlich auch selber, indem Sie ausführlich darlegen:
„‚Yehosua‘ war einer der wichtigsten Männer der Geschichte Israels. Yehosua, aus dem unsere Bibel einen Josua macht, war engster Vertrauter von Mose. Schließlich wurde er Mose‘ Nachfolger. Yehosua war es, der … das Volk Israel ins ‚Gelobte Land‘ führte, nicht Mose [5. Mose 34].
Auch wenn gern von theologischen Interpreten behauptet wird, die Bedeutung des Namens sei restlos geklärt, so muss man doch eher von Spekulationen sprechen. Vermutlich lässt sich ‚Yehosua‘ auf zwei Worte zurückführen: auf die Kurzfassung ‚yahu‘ von Jahwe und auf das hebräische Tätigkeitswort ‚sw‘ (helfen). Zusammen ergibt das dann etwa ‚Yahwe hilft‘ oder ‚Yahwe möge helfen‘ (207).“
Zwei Dinge sind an Ihrer Argumentation hier ärgerlich:
- Am Rückbezug von JeHOSchuAˁ auf den Gottesnamen JHWH und das Verb JaSchAˁ = „helfen, retten“ gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wer Hebräisch versteht, hört aus dem Namen eindeutig die Bedeutung heraus: „Gott hilft“, und zwar der Gott, der den heiligen Namen JHWH trägt.
- Spätestens hier trägt Ihr bemühter Versuch, auch die Namen Yehosua und Yahwe mit „Y“ zu schreiben, einfach nur zur Verwirrung bei. Denn die normalerweise auch von Ihnen verwendete Umschrift ist nun einmal diejenige mit „J“. Das ist auch sinnvoll, denn im Hebräischen gibt es gar kein „Y“, sondern nur das Jod, das sowohl den Konsonanten „J“ als auch den Vokal „I“ bezeichnen kann. Das „Ypsilon“ hingegen stammt aus der altgriechischen Sprache und heißt wörtlich „υ psilon“, also „kleines υ“ (ausgesprochen wie „ü“), während das „ω mega“, also ein als doppeltes „υ“ geschriebenes „ω“ (vgl. das englische „w“ = „double-u“) ein „großes ω“ ist (ausgesprochen als langes ō).
Recht haben Sie allerdings mit Ihrer Bemerkung:
„Erst vor diesem Hintergrund kann ein Vers bei Matthäus verständlich werden. In der gängigen Übersetzung bleibt er eigentlich rätselhaft [Matthäus 1,21]: ‚Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von den Sünden.‘ Ersetzt man aber das latinisierte ‚Jesus‘ durch das ursprünglichere ‚Yehosua‘, so wird alles klar.“
Weiter betonen Sie weitgehend zu Recht:
„Der Name ist jedoch weitaus bedeutungschwangerer als man auf den ersten Blick vermuten möchte: Es war Mose, der das Volk Israel aus der ägyptischen Knechtschaft führte. Sein Nachfolger ‚Yehosua‘ vollendete das Werk und geleitete die Israeliten ins ‚Heilige Land‘. ‚Jesus‘, eigentlich ‚Yehosua‘, wird als Nachfolger Mose‘ und neuerlicher Erretter gesehen, nicht nur von der Knechtschaft der Römer, sondern auf spiritueller Ebene. Der ‚Yehosua‘ des ‚Neuen Testaments‘ soll die wichtigere Rettung bringen: jene, die das ewige Leben beschert.“
Nicht ganz stimmt in dieser Einschätzung allerdings Ihre so eindeutige Gegenüberstellung von weltlich-politischer Befreiung im Alten Testament und Erlösung zum ewigen Leben im Neuen. Diese vollständige Verjenseitigung des Glaubens ist erst dem späteren Christentum anzulasten. Jesus selbst und auch Paulus und noch die Evangelisten begreifen Jesus durchaus auch als politischen Befreier. Allerdings ist für sie eine solche Befreiung nicht mit den zelotischen Mitteln des gewaltsamen Aufstands erreichbar, sondern nur auf dem Wege des Vertrauens auf den Messias Jesus, der die Tora zu den Völkern bringt, und durch die Überwindung der Grenzen zwischen Juden und Heiden (= GoJiM = nichtjüdische Völker) in der Gemeinschaft des Leibes Christi, also der gemeinsamen Mahlfeier von Menschen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft (1. Korinther 12,27; Epheser 4,12; Kolosser 1,24).
Weiterhin machen Sie (S. 279) auf Parallelen zwischen dem Josef des Alten Testaments und Jesus, dem „Sohn des Josef“, im Neuen Testament aufmerksam:
„Josef war der Mann, der im ‚Alten Testament‘ das Volk Israel vor dem Hungertod bewahrte. Und dabei wollten ihn seine eigenen Brüder erst ermorden, verkauften ihn dann aber nach Ägypten. Jesus wurde ebenfalls nach dem Leben getrachtet. Jesus wurde auch verkauft, ja gekreuzigt. Das unbeschreiblich Böse, das man ihm antat, vergalt er mit Gutem – genauso wie der Josef des ‚Alten Testaments‘.
Jesus, der ‚Yehosua‘ des ‚Neuen Testaments‘, war ein Sohn des Josef. Nach frühchristlichem Verständnis bringt er, wie sein Vorgänger im ‚Alten Testament‘, auch Brot: Bei der wundersamen ‚Speisung der Fünftausend‘, die von allen vier Evangelisten vermeldet wird [Matthäus 14,13-21; Markus 6,32-44; Lukas 9,9-17; Johannes 6,1-15]. Jesu Mutter, Frau des Josef, heißt Maria – in unseren Übersetzungen. Der ursprüngliche hebräische Name ist aber Miriam oder Mirjam. Wieder gibt es eine ‚Ägypten-Connection‘: Mirjam war die Schwester des Mose [4. Mose 26,59].“
Das stimmt alles – allerdings ziehen Sie daraus keine weiteren Konsequenzen. Wollen Sie damit andeuten, dass den Eltern Jesu vielleicht die Namen Josef und Maria beigelegt wurden, um damit die entsprechenden alttestamentlichen Gestalten ins Gedächtnis zu rufen? Grundsätzlich wäre das möglich, weil die Evangelisten ja Jesu Bedeutung und Auftrag auf Schritt und Tritt von der Tora und den Propheten her zu verdeutlichen versuchen. Unter Rückgriff auf Josef könnten sie also durchaus auf die Macht seiner Vergebung und die Stillung des Hungers durch sein Wort der Liebe anspielen; dazu würde auch die Erzählung von Josef als Gegenspieler des Herodes passen, die an Josef und den Pharao im Alten Testament erinnert. Marias Psalm in Lukas 1,46-55 wiederum – das so genannte „Magnificat“ – könnte Mirjams Befreiungslied in 2. Mose 15,20-21 aufgreifen.
Natürlich sind diese Anknüpfungsmöglichkeiten und Beziehungen nicht an die Annahme gebunden, dass die Eltern Jesu gar nicht wirklich Maria und Josef geheißen haben (208). Bei Josef ist Letzteres zwar vorstellbarer als bei Maria, denn sein Name kommt tatsächlich in den Evangelien nur sehr selten vor, aber immerhin doch in drei Evangelien, nämlich in Lukas 4,22 und Johannes 6,42 sowie unabhängig voneinander in den beiden Geburtsgeschichten des Matthäus und des Lukas, so dass es eine ältere Überlieferung gegeben haben muss, auf denen beide aufbauen.
Zum Abschluss dieses Abschnitts betonen Sie nochmals:
„Die historischen Eltern Jesu hätten nie und nimmer ihrem Kind einen lateinischen Namen gegeben. Und Jesus selbst hätte seinen Namen als schlimme Beleidigung aufgefasst. Jesus hätte er sich nie und nimmer nennen lassen.“
Ich glaube aber kaum, dass es dem himmlischen Jesus etwas ausmacht, von Menschen aus den verschiedenen Völkern mit einem Namen aus ihrer jeweiligen Sprache angebetet zu werden.
↑ Stammt der biblische Satan aus der Religion Zarathustras?
Zum Stichwort (S. 279) Z wie Zarathustra gehen Sie auf die Einflüsse ein (S. 280), durch die um „500 v. Chr. … Jesu Vorfahren fern der Heimat, in Babylonischer Gefangenschaft, … in Versuchung geführt“ wurden:
„Sie lernten fremde Glaubenswelten kennen: Da gab es nicht den einen Gott Jahwe, aber auch keine Vielzahl von Göttern, sondern nur zwei: Ahura Mazda, den Gott des Guten und seinen Gegenspieler Ahriman, den Gott des Bösen. Zwischen diesen beiden, so besagt es die Lehre des Zarathustra, muss der Mensch sich entscheiden.“
Als die Babylonische Gefangenschaft beendet war, so schreiben Sie, „brachten die heimkehrenden Juden den Teufel mit“. So erklärt es sich, dass der Satan in Sacharja 3,1-2 und im Buch Hiob
„zum Hofstaat Gottes gehört… [und] die Funktion eines Staatsanwaltes aus[übt], der Anklage gegen sündige Menschen erhebt. … Von diesem Teufel sprach Jesus, wenn er von Satan redete: Vom Versucher aus dem ‚Alten Testament‘.
Jesus irrte aber, wenn er davon ausging, dass Satan biblischen Ursprungs ist.“
Muss man wirklich in diesem Zusammenhang von einem Irrtum Jesu reden, weil er wie alle seine Zeitgenossen und auch die meisten Menschen bis in unsere Zeit hinein nicht über die entsprechenden religionsgeschichtlichen Kenntnisse verfügte?
Richtig ist es allerdings, dass die Juden Elemente des iranischen Dualismus in ihren Glauben aufnahmen. Nach Erhard S. Gerstenberger (209) geschah das allerdings weniger im babylonischen Exil als in der darauf folgenden Perserzeit:
„Als Hintergrund und Kontext der nachexilischen Gemeindetheologie haben wir … die vielschichtige Religionswelt der altpersischen Kultur anzunehmen. In dieser Welt waren Muster von Glaubenseinstellungen und Weltinterpretationen vorhanden, denen wir auch in den Schriften der hebräischen und aramäischen Bibel begegnen. Von der hohen Einschätzung der liturgischen Wortüberlieferung und der Bedeutung von Mittlergestalten zwischen Gott und Mensch, über Reinheitsanforderungen, ethische Dualismen (gut – böse; Lüge – Wahrheit; Licht – Dunkelheit usw.), Engel- und Dämonenvorstellungen bis hin zu universalen und sowohl rituell wie radikal ethisch geprägten Gottesbildern und apokalyptischen Endzeiterwartungen reicht eine breite Palette von Analogien zwischen persischer und judäischer Spiritualität.“
Allerdings passten die Juden all diese fremden Vorstellungen in ihren monotheistischen Glauben ein. Sie selber weisen ja darauf hin, dass bei Sacharja und Hiob der Satan ein Beamter im göttlichen Hofstaat ist. Er ist kein zweiter Gott.
Und auch Jesus – so, wie ihn die Evangelisten darstellen – sieht den Teufel keinesfalls als einen bösen Gott im Gegenüber zu dem Gott Israels. Zwar hat sich der Satan in den von den Evangelisten Matthäus und Lukas wiedergegebenen Versuchungsgeschichten aus einem Funktionär Gottes zu einer gegengöttlichen Gestalt gewandelt, aber dass Jesus von ihr in eine Versuchung hineingeführt wird, damit Jesus ihr standhalten und ihr nicht verfallen soll, liegt ausdrücklich in der Absicht des Heiligen Geistes Gottes; der Satan bleibt also eine Gott untergeordnete Macht (210).
Auch Ihre folgende Argumentation überzeugt mich nicht (S. 280):
„Die Essenermönche vom Toten Meer behielten den Dualismus bei. In ihren Schriftrollen treten die Geister der Finsternis gegen die Kräfte des Lichts zum Kampf an. Und Jesus selbst übernimmt die positive Seite, in Konfrontation mit dem bösen Widerpart stehend. Jesus fordert die Menschen dazu auf, sich zu entscheiden. Sein Weltbild ist dualistisch, wie das des Zarathustra. Wer sich Jesus anschließt, der folgt den Kräften des Lichts. Wer nicht Jesu Jünger wird, der verfällt dem Bösen [Johannes 8,12]:
‚Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.‘
Jesus fordert die Menschen auf, sich den ‚Kindern des Lichts‘ anzuschließen [Johannes 12,35]: ‚Solange ihr das Licht habt, glaubt ihr an das Licht, auf dass ihr (selbst) Kinder des Lichts werdet.‘“
Richtig daran ist, dass Jesus gegen Mächte der Finsternis kämpft, die der Macht des Lichts, die der Eine Gott Israels verkörpert, entgegenwirken. Aber die Finsternis hat keine göttliche Macht. Nirgends im Neuen Testament gibt es einen Dualismus zweier Götter, deren Zweikampf erst noch entschieden werden müsste. Und alle bösen Mächte werden dadurch, dass Jesus als der Sohn Gottes sich aus Liebe selbst am Kreuz für die Menschen hingibt, ein für alle Mal besiegt.
Interessant finde ich Ihren Hinweis darauf (S. 281), dass „es im Reich von Zarathustra gemäß uralter Lehren ‚Favashi-Engel‘“ gab:
„Diesen beflügelten Wesen oblag es, einzelne Menschen zu beschützen. Diese Schutzengel finden wir erst im ‚Neuen Testament‘ wieder. Jesus warnt [Matthäus 18,10]:
Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen [Kindern] verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Gesicht meines Vaters im Himmel.
Mit anderen Worten: Jedes Kind hat einen Schutzengel im Himmel. Wer einem Kind zu nahe tritt, dessen Schutzengel kann sich dann direkt an Gott selbst wenden.“
Zum Schluss erwähnen Sie noch Jesu Wort (Lukas 10,18):
Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.
Und Sie fragen sich:
„Aus welchem Himmel fiel der Teufel? Letztlich stammt er weder aus dem christlichen noch aus dem jüdischen Firmament, sondern er kam schon Jahrhunderte früher auf die Welt. Satan war ein früherer Gefolgsmann Zarathustras!“
Ein „Gefolgsmann Zarathustras“ war Satan allerdings sicher nicht; vielmehr will nach Gerstenberger (211) die
„Verkündigung des Zarathustra im Namen Ahura Mazdas [des obersten Gottes] … jeden einzelnen Menschen vor die Wahl stellen, dem guten Weg des Schöpfers zu folgen und den Dämonen abzusagen.“
↑ Jesus liefert keine Beweise – aber „Zeichen“ für Vertrauende
Zum Stichwort (S. 281) Z wie Zeichen fragen Sie danach, wie Jesus auf „Skeptiker“ reagiert hat, die daran zweifelten, dass er „der erwartete Messias, der Sohn Gottes“ war (S. 281f.):
„Sie forderten Beweise, ‚Zeichen‘. Für ihn als Sohn Gottes musste es doch Jesus ein Leichtes sein, die Menschen ‚ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen‘ [Matthäus 16,1]. Dann wäre der Beweis geliefert.“
Darauf (S. 282) reagiert Jesus jedoch „bei allen drei synoptischen Evangelisten fast gleichlautend im Wortlaut ähnlich barsch und verweigert einen Beweis, also ein Zeichen“ (Markus 8,12):
Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden!
Jesus fordert also „aus Prinzip Glauben, der keines Beweises bedarf“, so folgern Sie. Aber dann fällt Ihnen ein extremer Widerspruch auf:
„Das genaue Gegenteil ist im Evangelium nach Johannes zu lesen! Der Verfasser bekundet da [20,30]:
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.
Demnach lieferte Jesus also nach dem Evangelium nach Johannes so viele Beweise, dass der emsige Chronist gar nicht alle schriftlich festhalten konnte. …
Hat nun Jesus Beweise geliefert oder nicht?“
Wieder einmal kommen Sie mit einer Spannung nicht zurecht, die in den Evangelien nicht auflösbar ist. Jesus vollbringt durchaus „Zeichen“, griechisch sēmeia, aber nur diejenigen, die auf ihn vertrauen, sind in der Lage, sie zu sehen. Jesu Wunderkraft wirkt ja durch sein vollkommenes Vertrauen auf Gott, und so kann nur derjenige Heilung erfahren und Jesus als Messias erkennen, der sich vertrauensvoll auf die Liebe Gottes einlässt, die er verkörpert.
Im Übrigen übersehen Sie, dass auch in den synoptischen Evangelien „Zeichen“ erwähnt werden, „die folgen werden denen, die da glauben“ (so in Markus 16,17). Als etwa seine Jünger Jesus fragen (Matthäus 24,3; vgl. auch Markus 13,4 und Lukas 21,7): „was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?“, da verweigert er ihnen die Antwort nicht.
Umgekehrt liefert Jesus auch im Johannesevangelium Zweiflern und Feinden keine Beweise, die sie sozusagen objektiv dazu zwingen müssten, Jesus als Messias anzuerkennen. Nur denen, die für ihn offen sind, insbesondere seinen Jüngern, offenbart er durch „Zeichen“ seine Herrlichkeit, zum Beispiel in Johannes 2,11. Aber als man sieben Verse später (Johannes 2,18) von ihm ein „Zeichen“ fordert, zum Beweis, dass er die Wechsler und Taubenverkäufer aus dem Tempel verjagen darf, antwortet er in ähnlicher, wenn auch anderer Weise verschlüsselt wie der synoptische Jesus, der in Matthäus 12,39 und 16,4 oder Lukas 11,29 auf das Zeichen des Jona verweist (Johannes 2,19):
Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten.
Sowohl das Zeichen des Jona als auch dieses Bild des Tempelabbruchs- und -wiederaufbaus verweisen auf Jesu Tod und Auferstehung. Das heißt: Letztlich können nur diejenigen seine Zeichen wirklich verstehen, die begreifen, dass er kein siegreich triumphierender Messias nach Art der gewaltbereiten Zeloten ist, sondern als das Lamm Gottes durch sein Leiden die Macht der Liebe Gottes erweist.
↑ Josef und Jesus waren Handwerker – nicht Zimmerleute im heutigen Sinn
Zum Stichwort (S. 283) Z wie Zimmermann schreiben Sie eingangs:
„Bevor die nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes benannten vier Evangelien entstanden, schrieb bereits Paulus seine Briefe. Evangelisten und Paulus formulierten ihre Texte aus ganz unterschiedlichen Motiven. In den ersten Jahrzehnten nach Christi Kreuzigungstod waren die Erinnerungen so mancher Zeitzeugen noch frisch. Nun galt es, zu missionieren. Als die Erinnerungen an Jesus nach und nach schwächer wurden, war es an der Zeit, für die Nachwelt festzuhalten, was einst geschah – oder wovon man glaubte, dass es geschah, oder wovon man überzeugt war, dass es eigentlich hätte geschehen müssen. Paulus schreibt viel über Jesus, schweigt sich aber über seine Eltern aus: Maria und Josef kommen bei ihm als ‚Eltern Jesu‘ nicht vor. Nach Paulus soll als nächstes Schriftzeugnis das nach Markus benannte Evangelium entstanden sein. Auch darin lesen wir nichts von ‚Vater Josef‘. Hieß Jesu Vater nun Josef oder nicht?“
Daran ist richtig, dass in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod nur wenig über Jesus aufgeschrieben wurde; schließlich erwartete man ja schon in naher Zukunft die Apokalypse, also die Enthüllung des vom Messias herbeigeführte Friedensreich Gottes (212).
Auch Paulus schreibt tatsächlich überhaupt nicht „viel über Jesus“ – nur sein Tod und seine Auferstehung sind ihm wichtig und einige wenige von ihm auf Jesus zurückgeführte Worte. In 2. Korinther 5,16 schreibt er sogar:
auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.
Der einzige Vers bei Paulus, der entfernt an eine Weihnachtsgeschichte erinnert (213), ist Galater 4,4-5:
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen.
Aus ihm geht, wie Sie ganz richtig sagen, nicht hervor, wie seine Eltern hießen. Mit der Formulierung „geboren von einer Frau“ erinnert Paulus übrigens an Hiob 14,1 und 15,14, wo die Vergänglichkeit des Menschen bzw. seine Verfallenheit an Unreinheit und Ungerechtigkeit erwähnt werden. Dieser Rückbezug hat dieselbe Funktion wie der in Matthäus 1 konstruierte Stammbaum Jesu, auf den ich zu Ihrem Kapitel L wie Legitimation eingegangen bin und der das Wunder andeutet, dass Gott seinen Sohn als den Einen Heiligen und Reinen inmitten einer Menschheit von Sündern und Unreinen zur Welt kommen lassen konnte.
Zu den Namen der Eltern Jesu, Maria und Josef, verweise ich auf das, was ich bereits oben abschließend zu Ihrem Abschnitt Y wie Jesus ausgeführt habe.
Aber welchen Beruf hat Jesu Vater und bis zum Alter von 30 Jahren auch Jesus selber ausgeübt? Nach Markus 6,3 war Jesus ho tektōn, nach Matthäus 13,55 ho tou tektōnos hyios – wörtlich zu übersetzen wäre das mit „der Handwerker“ bzw. „der Sohn des Handwerkers“. In allen gängigen Übersetzungen steht allerdings die einschränkendere Bedeutung „Zimmermann“. Dazu schreiben Sie (S. 284):
„So einig sich also weltweit die Übersetzer auch sind, sie alle begehen den gleichen Irrtum. Weder Josef noch Sohn Jesus haben den Beruf eines Zimmermanns ausgeübt. Denn den Beruf des Zimmermanns hat es zur Zeit Jesu überhaupt nicht gegeben. Niemand vermag so recht zu sagen, was denn ein ‚tekton‘ wirklich war.
Holz war im Lande Judäa zu Jesu Zeiten relativ selten und teuer. Es wurde daher wenig verarbeitet. Holzarbeiten fielen schon aus finanziellen Gründen bei der einfachen Bevölkerung wenig an. Wenn bei einer Dachkonstruktion Holz eingesetzt wurde, dann übernahm dies der Maurer. Holz wurde manchmal verwendet, wenn in eine der einfachen Lehmhütten oder der besseren Steinhäuser Türen eingesetzt wurden. War also Josef ein Mann vom Bau? Oder war er eine Art Steinmetz, der aber neben Stein im Bedarfsfall auch Holz bearbeitete? Justin (etwa 100-165 n. Chr.) verneint. Nach seinen Ausführungen ist ein ‚tekton‘ ein Handwerker, der Pflüge und Joche herzustellen vermag.“
Wiederum sind Ihre Formulierungen nicht überall ganz korrekt. Denn man weiß insofern schon, was ein tektōn war, als es ein sehr allgemeiner Begriff für einen handwerklich arbeitenden Menschen war. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments werden diese häufig genauer bezeichnet, zum Beispiel in 1. Samuel 13,19 als tektōn sidērou = „Handwerker des Eisens“ = „Schmied“ oder in 2. Samuel 5,11 als tektonas xylōn kai tektonas lithōn = „Handwerker des Holzes und Handwerker des Steins“ = „Zimmerleute und Steinmetze bzw. Maurer“.
An den beiden neutestamentlichen Stellen fehlt die Beifügung „des Holzes“, so dass tatsächlich unbestimmt bleibt, mit welchen Materialien Jesus bzw. sein Vater gearbeitet haben. Sie haben also Recht (S. 285):
„Vermutlich gab es im Umfeld der Familie Jesu auf dem Lande in Galiläa nicht viele auf einem ganz bestimmten, scharf abgegrenzten Tätigkeitsfeld arbeitende Handwerker. Der Anteil der Bauern dürfte sehr hoch gewesen sein. Man bestellte das Feld, hielt sich vielleicht etwas Kleinvieh – und verrichtete die meisten Arbeiten so gut man das vermochte selbst.
Welchen Beruf übte also Josef, Jesu Vater aus? Welchen Beruf erlernte Jesus von seinem Vater? Wir müssen zugeben: Wir wissen es nicht. Klar ist nur, dass er kein ‚Zimmermann‘ nach unserem heutigen Verständnis war.“
Das einzige, was wir auf Grund des bestimmten Artikels „DER Tektōn“ bzw. „der Sohn DES Tektōn“ vermuten dürfen, ist, dass Jesu Vater und auch er nicht einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt haben, sondern im Hauptberuf handwerkliche Aufgaben ausführten, die im Dorf oder in der Umgebung anfielen – durchaus im Häuserbau und in der Herstellung und Reparatur von Ackergeräten.
↑ Der katholische Priester-Zölibat geht nicht auf Jesus zurück
Ihre Ausführungen zum Thema (S. 285) Z wie Zölibat möchte ich nur geringfügig kommentieren. Sie stellen die Entwicklung zum Zölibat der Priester zutreffend dar (S. 289), der bis heute ein „fester Bestandteil des Lebens der katholischen Kirche“ ist, den es aber „in der jungen Kirche noch nicht gegeben“ hat.
Zu dem rätselhaften Wort Matthäus 19,12 möchte ich aber doch sagen (S. 289f.), dass ihre „leicht modernisiert[e]“ Übersetzung dem Urtext kaum noch entspricht:
„Denn etliche enthalten sich der Ehe, weil sie von Geburt an zur Ehe unfähig sind, etliche enthalten sich, weil sie von Menschen zur Ehe untauglich gemacht sind. Und etliche enthalten sich, weil sie um des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Wer es verstehen kann, der verstehe es.“
Luther übersetzt wörtlicher:
„Denn es gibt Verschnittene, die von Geburt an so sind; und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es!“
Das Wort, das Sie mit „Untauglichkeit zur Ehe“ oder „Verzicht auf die Ehe“ umschrieben haben, lautet im Griechischen einfach eunouchoi. Es geht also wörtlich genommen ganz krass um Kastration. Wikipedia weiß zu berichten:
Der frühchristliche Theologe Origenes soll sich selbst entmannt haben, um seiner Interpretation der Bibel (Mt 19,12) zu folgen.
Recht gebe ich Ihnen, wenn Sie dazu schreiben (S. 290):
„Es ist ein Irrtum anzunehmen, Jesus habe vom Priesterzölibat gesprochen. Seine Rede bezieht sich allgemein auf das Heiraten in einer ganz speziellen Situation! Jesus war der Ansicht, dass die Apokalypse unmittelbar bevorstand… [und] dass sich alle Menschen bald vor einem himmlischen Gericht würden rechtfertigen müssen. Darauf galt es sich vorzubereiten:
Es ging um geistige Einkehr, um eine Neugestaltung des Lebens in Erwartung des himmlischen Gerichts, nicht mehr um die Freude des Augenblicks! In der wenigen noch zu verbleibenden Zeit sollte man sich besinnen, der Welt der Genüsse entsagen. In dieser Endzeit verzichteten manche Zeitgenossen Jesu ‚um des Himmelreichs willen auf die Ehe‘ (214).“
Ob allerdings Jesus es tatsächlich gut geheißen hat, dass Männer sich selbst durch eine Kastration zu einem „Eunuchen für das Himmelreich“ (215) gemacht haben wie später der erwähnte Kirchenlehrer Origenes, muss ungeklärt bleiben.
↑ Zwölf Jünger Jesu – wer irrte sich über ihre Zahl und über die Zugehörigkeit zu ihrem Kreis?
Zum Stichwort (S. 291) Z wie Zwölf kommen Sie noch einmal darauf zu sprechen, dass Paulus sich in 1. Korinther 15,3-5 geirrt haben muss, wenn er davon spricht:
Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen.
Nach der Darstellung der Evangelien kann das Ihnen zufolge nicht stimmen, da
„nach dem Selbstmord des Judas … das Dutzend nicht mehr vollzählig [war]. Die Jünger waren nur noch elf. Der neue zwölfte Jünger, ein gewisser Matthias, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt worden [Apostelgeschichte 1,23-26] Das Evangelium nach Matthäus vermeidet diesen Irrtum [28,16]: ‚Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte.‘“
Bereits im Abschnitt J wie Judas hatten Sie auf diesen Widerspruch hingewiesen, und ich hatte dazu erklärt, dass Paulus offenbar nur sehr wenige Überlieferungen über Jesus und seine Jünger kannte und deswegen einfach von der Vollzahl der zwölf Apostel ausgehen musste, die er in Jerusalem kennenlernte. Sie ergänzen hier folgende Information:
„Zur Ehrenrettung einiger fleißiger Abschreiber muss gesagt werden, dass einige Handschriften des Korintherbriefes eine Korrektur aufweisen. In einigen wenigen Codices (Handschriften) ist von nur elf und nicht zwölf Jüngern als Zeugen der Auferstehung die Rede. Diese richtige Zählweise setzte sich aber nicht durch. Man beließ es lieber – irriger Weise – bei der falschen Zwölf.“
Ich würde hier nicht von Ehrenrettung sprechen. Was diese Abschreiber taten, war ja genau genommen eine Fälschung. Denn Paulus ging tatsächlich von der Zahl Zwölf aus, und deswegen sollte man sie auch so in seinem Text stehen lassen.
Einen entsprechenden Irrtum unterstellen Sie (S. 292) auch Jesus selbst, wenn er „seine zwölf Jünger…, die ihn begleiten“, nach Matthäus 19,28 in der zukünftigen Herrlichkeit gemeinsam mit dem Menschensohn „auf zwölf Thronen“ sitzen sieht, und zwar als Richter über „die zwölf Stämme Israels“. Da zum Zeitpunkt dieser Vorausschau „der spätere ‚Verräter‘ Judas“ noch zu den Zwölfen gehörte, wie konnte er in der Vision Jesu als „einer der Richter“ in der Zukunft des Friedensreiches Gottes erscheinen? So fragen Sie sich:
„Irrte auch Jesus?
Oder irren wir uns, wenn wir die Zahl zu wörtlich nehmen? Ist sie viel mehr nicht wirklich in ihrer nummerischen Bedeutung zu verstehen, sondern als Symbol für das Volk Israel, das aus zwölf Stämmen bestand?“
Und genau hier biegen Sie endlich in die richtige Spur der Auslegung der Zahl „Zwölf“ ein. Tatsächlich ruft diese Zahl überall im Neuen Testament die Erinnerung an die zwölf Stämme Israels auf. Ich frage mich sogar, ob man dem auferstandenen Jesus nicht sogar zutrauen kann, dem Judas im Himmel ein Richteramt zu übertragen, da Judas immerhin nach Matthäus 27,3 seinen Verrat bereut hat und Jesus dem reumütigen Sünder zu vergeben bereit ist, so wie er ja auch in Johannes 21,15-17 dem Petrus, der seine Verleugnung bereut, die Verantwortung für die Gemeinde Jesu überträgt.
Wenn Sie erst einmal eingesehen haben, dass die Zwölfzahl der Jünger eine symbolische Bedeutung hat, dürfte es auch nicht mehr schwer sein zu begreifen, dass die Angaben darüber, wer nun genau zu diesem Zwölferkreis gehörte, in den verschiedenen Evangelien voneinander abweichen. Sie fragen sich (S. 292f.):
„Welche Männer mögen das echte Jüngerteam gebildet haben? Waren es tatsächlich zwölf ? Konsultieren wir das ‚Neue Testament‘! Markus und Matthäus listen einen Thaddäus auf, der aber fehlt bei Lukas. Lukas hingegen hat stattdessen einen zweiten Judas, den Sohn des Jakobus, im Repertoire. Einig sind sich die synoptischen Evangelien aber in der Zahl der Jünger: zwölf sollen es gewesen sein.“
Ich möchte nicht wiederholen, was ich zu diesen Fragen bereits zu Ihrem Abschnitt B wie Berufung unter der Überschrift Zur Symbolik der Zwölfzahl und einiger Namen der Jünger Jesu geschrieben habe. Allerdings habe ich noch zwei Kleinigkeiten zu Ihrem folgenden Absatz zu ergänzen (S. 293):
„Bei Johannes hingegen fehlt jeder Hinweis auf diese Zahl zwölf. An keiner Stelle zählt der Verfasser des Evangeliums auf, wie viele Männer es genau waren, die zum ‚inneren Kreis‘ um Jesus gehörten. Ihm scheint die Ziffer nicht so wichtig gewesen zu sein. Auf Namensnennungen verzichtet aber natürlich auch Johannes nicht. In seinem nach ihm benannten Evangelium entdeckt man als Jünger einen gewissen ‚Nathanael‘ und einen Mann namens ‚Thomas‘, die man beide vergeblich in den Auflistungen der anderen Evangelisten suchen wird (216).“
Sie schreiben dazu abschließend:
„Wieder stellt sich die Frage: Wer irrte sich?“
Und darauf lässt sich hier eine ganz klare Antwort geben: Noch einmal sind Sie derjenige, der sich irrt, und zwar mehrfach:
- Johannes zählt zwar nicht die Gesamtzahl der zwölf Jünger auf, bei ihm kommen auch andere Namen als in den synoptischen Evangelien vor, aber die Zahl „Zwölf“ für die Jüngerschaft, die die Wiederherstellung Israels in all ihren zwölf Stämmen (217) symbolisiert, erwähnt er ausdrücklich in Johannes 6,70f. und 20,24.
- Den Jünger Thomas wiederum, der in Johannes 11,16 und 14,5 und vor allem in Johannes 20,24-29 tatsächlich eine prominente Rolle spielt, findet man nach Matthäus 10,3 – Markus 3,18 – Lukas 6,15 und Apostelgeschichte 1,13 durchaus auch im synoptischen Zwölferkreis, also in allen vier Evangelien.
↑ Nachwort: Wie Martin Luther alle Ästlein des mächtigen Baumes der Bibel abklopfen!
In (S. 295) Ihrem Nachwort betonen Sie noch einmal mit Recht, dass die „Bibel … menschliches Reden über Gott“ ist. Und da
„der Mensch irrt, enthält das ‚Neue Testament‘ – wie das ‚Alte‘ – Widersprüche und Irrtümer. Wer diese Fehler leugnet, weigert sich, das ‚Neue Testament‘ ernst zu nehmen. Wer aber die offensichtlichen Irrtümer nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern auch gründlich untersucht, der kommt den Menschen ein gutes Stück näher, die die Texte der Bibel verfassten und ihrem Glauben (218).“
Nicht in jedem Fall bin ich mit Ihnen einig gewesen, was Ihre Analyse solcher Irrtümer betrifft, etwa wenn Sie behauptet haben (S. 296):
„Judas war kein Verräter, der gegen Gottes Plan handelte, er führte ihn aus – mit Jesu Einverständnis.“
Aber vorbehaltlos stimme ich Ihrer folgenden Einschätzung zu:
„Die verschiedenen Verfasser des ‚Neuen Testaments‘ waren nicht vordergründig daran interessiert, dem historischen Leben Jesu auf den Grund zu gehen. Sie suchten nicht nach biographischen Dokumenten. Sie formulierten, woran sie glaubten. Von der vollkommenen Wahrheit ihres Glaubens waren sie überzeugt. Und diesen Glauben versuchten sie zu vermitteln (219)“.
Und wenn Sie entgegen dieser eigenen Einsicht allzu oft doch nur auf historische Irrtümer eingegangen sind, habe ich mir erlaubt, etwas tiefer zu bohren und danach zu fragen, was denn die biblischen Autoren mit ihren oft widersprüchlichen und auch der historischen Realität widersprechenden Angaben denn wirklich gemeint haben könnten.
Gerne stimme ich auch Martin Luther zu und möchte ihn noch etwas ausführlicher zitieren, als Sie es auf der letzten Seite Ihres Buches tun:
Ich habe nun seit etlichen Jahren die Bibel jährlich zweimal ausgelesen, und wenn die Bibel ein großer mächtiger Baum wäre und alle Worte die Ästlein, so habe ich alle Ästlein abgeklopft und wollte gerne wissen, was daran wäre und was sie trügen. Und allezeit habe ich noch ein paar Äpfel oder Birnen heruntergeklopft (220).
Ich hab nun 28 Jahr seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und draus geprediget, doch bin ich ihrer noch nicht gewaltig (mächtig) und find‘ noch alle Tag etwas Neues drinnen (221).
Ich kann von mir zwar nicht behaupten, dass ich zwei Mal pro Jahr die Bibel ganz gelesen habe und bin auch nie ein Doktor der Theologie geworden. Aber als evangelischer Christ und Pfarrer habe doch auch ich erfahren, dass ich mein Leben lang nicht auslerne (222) und in der Bibel immer wieder etwas Neues finde, das meinen Glauben herausfordert oder stärkt und mich dazu treibt, die Frohe Botschaft des Gottes Israels und seines Messias Jesus immer wieder neu auszulegen und zu verkündigen.
In diesem Sinne danke ich Ihnen auch für „das vorliegende Buch“, das „auf biblische Irrtümer im ‚Neuen Testament‘ aufmerksam“ macht und das Sie „nicht gegen die Bibel, sondern für ein besseres Verständnis der Bibel“ geschrieben haben.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer i. R. Helmut Schütz
↑ Anmerkungen
(1) Alle Zitate in dieser Buchbesprechung, die nach einer bloßen Seitenzahl ohne weitere Quellenangabe aufgeführt werden, stammen aus Ihrem Buch, dabei sind längere Zitate blau hinterlegt. Wo Sie in Anmerkungen auf Bibelstellen verweisen, nehme ich den Stellenverweis in eckigen Klammern in das Zitat selbst mit hinein. Sonstige Zitate, die ich direkt der Bibel entnehme, habe ich meiner Gewohnheit entsprechend gelb hinterlegt, Zitate aus anderen Büchern haben weißen Hintergrund.
(2) Sie zitieren ihn nach Timothy P. Weber: „The Future Explored“, Wheaton, Illinois, USA, 1978, Seite 46.
(3) Dabei beziehen Sie sich auf George M. Lamsa: „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 72.
(4) Siehe dazu zum Beispiel: Rief Jesus zum Hass auf? Drohte er Gewalt an?
(5) Ton Veerkamp, „Alle Worte und Taten des Messias. Das Evangelium nach Matthäus“, in Texte & Kontexte Nr. 157-159, 2018, S. 26/27.
(6) Für die Wiedergabe altgriechischer Wörter verwende ich eine einfache deutsche Umschrift, bei der ich zur Unterscheidung der beiden e- und o-Laute den Oberstrich verwende: Eta = ē, Omega = ō.
Für hebräische Namen und Begriffe benutze ich meist allgemein übliche Eindeutschungen. Wenn ich hebräische Wörter genauer wiedergeben will, greife ich zur deutschen Umschrift auf Großbuchstaben für Konsonanten und kleine Buchstaben für Vokale zurück. Großgeschriebene Vokale tauchen nur als Umschrift für die hebräischen Konsonanten Jod und Waw auf, wenn sie als Vokal für I bzw. O oder U stehen, oder für die beiden Knacklaute Aleph und Ajin, die beide im Anlaut mit A, Ä oder E ausgesprochen werden können und die ich zusätzlich mit ˀ bzw. ˁ umschreibe (im Deutschen werden Knacklaute nicht besonders bezeichnet, z. B. der Laut, mit dem Wörter wie „arbeiten“ oder die zweite Silbe in dem Wort „geehrt“ beginnen). Das unbetonte erste „e“ in dem genannten Wort „geehrt“ entspricht dem hebräischen Schwa, das ich mit „ə“ umschreibe. Die Bezeichnung Ph statt P oder Kh statt K steht für weich ausgesprochene Konsonanten (F für Pe bzw. Ch für Kaph). Ein Ch steht für das hebräische Chet, ein Th unterscheidet das Taw vom T wie Tet. Und die S-Laute unterscheide ich folgendermaßen: Zajin = Z = weiches S; Samech = S und Sin = Ss = scharfes S sowie Schin = Sch, Tsade = Ts = deutsches Z.
(7) Vgl. dazu meine Kommentierung: Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova?
(8) Siehe die Erwägungen von Werner Papke, auf die ich in einem Kommentar zu Ihrem „Lexikon biblischer Irrtümer“ im Abschnitt Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova? eingehe.
(9) Matthäus kann also bei seiner Erzählung durchaus einen späteren Zeitpunkt im Auge haben als Lukas. Um historische Fakten geht es in diesem Zusammenhang ohnehin nicht. Beide Kindheitsgeschichten sind im Rückblick gestaltet worden, um die Person Jesu vom Glauben her und unter Rückgriff auf alttestamentliche Texte und bei Matthäus auch Erinnerungen an Himmelsphänomene zu deuten.
(10) Ton Veerkamp, „Alle Worte und Taten des Messias. Das Evangelium nach Matthäus“, in Texte & Kontexte Nr. 157-159, 2018, S. 16 und 17.
(11) Vgl. Gerd Lüdemanns Aufforderung an die Kirchen, die Jungfrauengeburt aus dem Glaubensbekenntnis herauszustreichen und die „Heilige Nacht“ abzuschaffen, da Maria auf Grund einer Vergewaltigung mit Jesus schwanger geworden sei, in seinem Buch „Jungfrauengeburt? Die wirkliche Geschichte von Maria und ihrem Sohn Jesus“, Stuttgart 1997, S. 132 und S. 140. Ich antworte damals auf seine Kritik mit einem Plädoyer, dennoch am Glauben an die Jungfrau Maria festzuhalten, unter dem Titel: „… Marie, die reine Magd“.
(12) Vgl. dazu auch meine Kommentierung zu Gedanken von Roman Landau unter dem Titel Die Namen der 12 Apostel und das christliche „Paschen“.
(13) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil I, Das Markusevangelium als polyphone Komposition“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 127/128 (2010), S. 50.
(14) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II, Zwischen Römern und Zeloten“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 129/130 (2011), S. 55, Anm. 126.
(15) Er heißt so wie derjenige der zwölf Stammväter des Volkes Israel – hebräisch JɘHUDaH – der zum Namensgeber „der Juden“ wurde.
(16) Sie zitieren ihn nach Pinchas Lapide: „Ist die Bibel richtig übersetzt“, Band 1, 5. Auflage, Gütersloh 1995, S. 92.
(17) Vgl. meinen Gottesdienst: Lob für einen Betrüger?
(18) Wilhelm Kaltenstadler, „Arbeitsorganisation und Führungssystem bei den römischen Agrarschriftstellern (Cato, Varro, Columella)“, Stuttgart und New York 1978, S. 53.
(19) Luise Schottroff, „Die Gleichnisse Jesu“, Gütersloh 2005, S. 205-214; die folgenden drei Zitate stammen aus diesem Buch.
(20) Vgl. Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova? und Gab es die Kreuzesinschrift auch auf Aramäisch?
(21) Viele Anregungen zu meinen folgenden Ausführungen verdanke ich dem Werk von Daniel J. Meister, „Die intertextuelle Dimension der Darstellung der Gegner Jesu im Matthäusevangelium. Mit besonderer Berücksichtigung des Propheten Jeremia“, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Bern, eingereicht 2013, veröffentlicht 2016.
(22) Worte der Propheten, auch wenn sie sich ursprünglich auf die jeweilige Gegenwart oder nahe Zukunft bezogen, konnten in der jüdischen Auslegungstradition auch auf weiter in der Zukunft liegende Zeiten bezogen werden, so dass Ihre Behauptung (S. 49): „Es wird bei Sacharja nichts prophezeit!“ einfach nicht zutrifft.
(23) Große Teile der Ausführungen über den Rückbezug des Matthäus auf Jeremia und Sacharja sind meinem Gottesdienst Die Reue des Judas und der Töpferacker. Gedanken zum Volkstrauertag entnommen, der zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zeilen am kommenden Sonntag unmittelbar bevorsteht.
(24) Sie erwähnen außer 2,13; 6,4; 11,55 auch noch die Stelle 5,1, wo es allerdings nicht um das Passah, sondern um ein nicht näher bezeichnetes Fest geht.
(25) Ton Veerkamp, „Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung“, Berlin 2013, S. 333 (dort sind die beiden folgenden Zitate zu finden). Er stützt sich in seiner Analyse des Markusevangeliums auf die umfangreiche Arbeit von Andreas Bedenbender, den ich bereits an verschiedenen Stellen zitiert habe.
(26) Sie zitieren ihn nach Gleason Archer: „Encyclopedia of Bible Difficulties“, Grand Rapids, Michigan, USA, 1982, S. 327-329.
(27) Sie zitieren ihn nach M. R. DeHaan: „508 Answers to Bible Questions“, Grand Rapids, Michigan, 1982, S. 55.
(28) Sie zitieren es nach Heinrich A. Mertens: „Handbuch der Bibelkunde“, Düsseldorf 1966, S. 46.
(29) Vgl. dazu meinen Ostergottesdienst: Auferstanden am Dritten Tage.
(30) Vitus B. Dröscher, „Über die Tierwunder der Bibel“, Esslingen 1990, S. 119f. Vgl. Symbolhafte Erzählungen und lebensrettende Wale und meinen Gottesdienst: Jona im Wal und Daniel in der Löwengrube.
(31) Vgl. Nicht nur Jesus durfte Gott „Vater“ nennen, wo ich die Stelle ausführlich zitiere.
(32) Adela Yarbro Collins, „Mark. A Commentary (Hermeneia)“, Minneapolis 2007. Die Seitenangaben in der folgenden Aufzählung beziehen sich auf dieses Buch.
(33) Siehe auch: Irrte sich Jesus über den Zeitpunkt der Apokalypse?
(34) Siehe auch: Himmelfahrt – ein Bild für unterschiedliche Glaubenserfahrungen. Ich möchte nicht wiederholen, was ich an anderer Stelle dazu geschrieben habe – dass hier nämlich nicht unbedingt ein Irrtum vorliegt.
(35) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II, Zwischen Römern und Zeloten“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 129/130 (2011), S. 15f.
(36) Sie zitieren sie nach Gerd Theißen und Annette Merz, „Der historische Jesus / Ein Lehrbuch“, 3. Auflage, Göttingen 2001, S. 268.
(37) Siehe dazu „Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
(38) Sie zitieren ihn nach Pinchas Lapide: „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 2, Gütersloh 1994, S. 52.
(39) Sie zitieren ihn nach Pinchas Lapide: „Er predigte in ihren Synagogen“, Gütersloh 1980, S. 63.
(40) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21“, in der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte 109-111, S. 99f.
(41) Hier beziehen Sie sich auf Manfred Barthel: „Was wirklich in der Bibel steht“, völlig überarbeitete und ergänzte Neuausgabe, Düsseldorf, Wien, New York 1987, S. 311.
(42) Andreas Bedenbender, „Der Feigenbaum und der Messias. Beobachtungen zur Komposition des Markusevangeliums (2. Teil)“, in: Texte & Kontexte Nr. 68, 1995, S. 2–71.
(43) Vgl. auch meine Kommentierung zum entsprechenden Abschnitt in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“: Petrus: griechischer Fels oder aramäischer Steinblock?
(44) Vgl. dazu meinen Gottesdienst: Weihnachtsfreude für Bethlehems Kinder.
(45) Ethelbert Stauffer, „Jesus. Gestalt und Geschichte“, Berlin 1957, S. 22.
(46) Jane Schaberg, „The illegitimacy of Jesus. A feminist theological interpretation of the infancy narratives“, San Francisco 1987.
(47) Vgl. dazu meine Auslegung: Wozu einen Maulbeerbaum ins Meer verpflanzen?
(48) Sie zitieren ihn nach Gerd Lüdemann: „Jesus nach 2000 Jahren“, Lüneburg 2000, S. 110.
(49) Vgl. dazu Anm. 47.
(50) Vgl. meinen Gottesdienst: Zwei Juden im rabbinischen Dialog: Jesus und der Schriftgelehrte.
(51) Vgl. dazu meine Kommentierungen zu Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ im Abschnitt: Vegetarismus – Schächtung – Ausländerfeindlichkeit.
(52) „Das dritte Buch Mose – Leviticus, übersetzt und erklärt“
von Erhard S. Gerstenberger, Göttingen 1993, S. 123-128 (das folgende Zitat steht auf S. 124).
(53) Vgl. dazu meine Auseinandersetzung mit Simon Poppe: Muss ein Christ wortwörtlich an die Bibel glauben?
(54) Vgl. dazu den Gottesdienst: Keine Macht den Sorgen.
(55) Siehe meine Erwägungen im Abschnitt: Warum beschimpfte man Jesus als Fresser und Weinsäufer?
(56) Vgl. zum Beispiel sein Rückgriff auf die Propheten Sacharja und Jeremia in Matthäus 28,3-10, wie ich sie im Abschnitt Wie Matthäus in genialer Weise auf prophetische Texte anspielt beschrieben habe.
(57) Sie zitieren ihn nach Wolfang A. Bienert: „Jesu Verwandtschaft“, in: Schneemelcher, Wilhelm: „Neutestamentliche Apokryphen“, Band I, „Evangelien“, 6. Auflage, Tübingen 1990, S. 373-386.
(58) Nebenbei bemerkt heißt der Garten weder bei Lukas noch bei Johannes „Gethsemane“.
(59) Hildegard König: „Religiös musikalisch oder nicht? – Spirituelle Kompetenz von Erzieherinnen“. In: Katrin Bederna / Hildegard König (Hrsg.): „Wohnt Gott in der Kita? Religionssensible Erziehung in Kindertageseinrichtungen“, Berlin 2009, S. 219f.: „Es war der Philosoph Jürgen Habermas, der 2001 in einer vielbeachteten Rede sich selbst einen ‚religiös eher unmusikalischen‛ Menschen nannte. Habermas hatte diese Umschreibung nicht selbst erfunden, sondern von dem Soziologen Max Weber übernommen. Der lebte etwa 100 Jahre früher“ und schrieb „1909 in einem Brief an einen Freund, er sei zwar religiös absolut unmusikalisch, aber nach genauer Selbstprüfung weder antireligiös noch irreligiös.“ … „im Religionsmonitor 2008 oder in den Sinusstudien zur religiösen Landschaft in Deutschland … bezeichnen sich in Westdeutschland etwa 70% der Bevölkerung als mehr oder weniger religiös musikalisch und etwa 30% als religiös ganz unmusikalisch, um bei dieser Umschreibung zu bleiben. In Ostdeutschland ist das Verhältnis nahezu umgekehrt: Etwa 35 % der Befragten halten sich für religiös musikalisch, 65 % dagegen nicht“.
(60) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil I, Das Markusevangelium als polyphone Komposition“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 127/128 (2010), S. 63f.
(61) Sie verweisen dazu auf George M. Lamsa: „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 84.
(62) Vgl. meine Kommentierung zum Thema „Todesstrafe“, wie Sie in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ darauf eingehen: „Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
(63) Sie zitieren ihn mit C. Dennis McKinsey: „The Encyclopedia of Biblical Errancy“, Amherst, New York 1995, S. 133.
(64) Zur Zwölfzahl und einigen Namen der Jünger Jesu, auch des Levi und des Matthäus, habe ich oben schon das Notwendige gesagt.
(65) Albert Schweitzer, „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“, Tübingen ²1913, S. 631: „Es ist der Leben-Jesu-Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um den historischen Jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er ist, als Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. Sie löste die Bande, mit denen er seit Jahrhunderten an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt war, und freute sich, als wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam und sie den historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber er blieb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die seinige zurück.“
(66) Siehe mein Gottesdienst: Als Gott mit Sophia spielte…
(67) Vgl. dazu meine Gottesdienste Elisa begleitet Elia „über den Jordan“ und Maria Magdalena sieht Jesus.
(68) Vgl. „Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
(69) Sie zitieren ihn nach Francesco Carotta: „War Jesus Caesar?“, München 1999.
(70) Vgl. Jesu Leichnam – auf einem Scheiterhaufen verbrannt?
(71) Sie zitieren ihn nach Francesco Carotta: „War Jesus Caesar?“, München 1999, S. 46-49.
(72) Vgl. dazu: Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund.
(73) In der Elberfelder Bibel 2006 findet sich die korrekte Übersetzung „Lehrer“.
(74) Vgl. dazu auch: Wurde Jesus als Meister oder als Rabbi angeredet?
(75) Hierzu berufen Sie sich auf Pinchas Lapide: „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 1, 5. Auflage, Gütersloh 1995, S. 126.
(76) Vgl. dazu meinen Gottesdienst: Von Adam zu Immanuel – Gott mit uns!
(77) Sie zitieren dazu Bernhard Lang: „Jahwe“, München 2002, S. 35.
(78) Ebenda, S. 34.
(79) Sie berufen sich auf Jan Adolf Bühner: „Der Gesandte und sein Weg im vierten Evangelium“, Tübingen 1977.
(80) Sie zitieren ihn nach John Pilch: „The Transfigurationn of Jesus“, in: „Modelling Early Christianity“, herausgegeben von Philip F. Esler, London 1995, S. 47-64.
(81) Von Ihnen zitiert nach Bernhard Lang: „Jahwe“, München 2002, S. 243.
(82) In der Lutherbibel 1545 sowie 1912 steht „Jechonia“, auch in der Zürcher Bibel von 2007.
(83) Vgl. Ulrich Luck, „Das Evangelium des Matthäus“, Zürich 1993, S. 21: „Wie stark in diesem Stück [dem Stammbaum Jesu nach Matthäus] das besondere theologische Interesse des Evangelisten wirksam ist, zeigt sich in der Freiheit, mit der David etwa zweimal gezählt wird (V. 6), nicht jedoch Josia (V. 10 und 11), ebenso wie zwischen Usia (= Achasja?) und Jotham (V. 9) drei Namen ausgefallen sind (vgl. 1. Chr. 3,11.12). Ferner wird auch Jojakim nicht genannt. Für Matthäus steht fest, daß die Welt und ihre Geschichte hingeordnet ist auf die Erfüllung der Abraham gegebenen und David bestätigten Verheißung.“
(84) Sie zitieren ihn nach Ulrich Wilckens: „Das Evangelium nach Johannes“, 17. Auflage, Göttingen 1998, S. 302.
(85) Sie zitieren ihn nach Dominic Crossan: „Der historische ]esus“, 2. Auflage, München 1995, S. 517 und 518.
(86) Sie zitieren ihn nach Herbert Braun: „Der Mann aus Nazareth und seine Zeit“, Taschenbuchausgabe, Gütersloh 1988, S. 41.
(87) Wenn andere deutsche Übersetzungen den „Reichen“ nun doch durch „Übeltäter“ oder „Verbrecher“ ersetzen, dann deswegen, weil man den Irrtum schon des Jesaja meint korrigieren zu müssen.
(88) Vgl. die Predigt, zu der Sie mich angeregt haben, am Volkstrauertag 2019: Die Reue des Judas und der Töpferacker.
(89) Vgl. dazu Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II, Zwischen Römern und Zeloten“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 129/130 (2011), S. 55, und Adela Yarbro Collins, „Mark. A Commentary (Hermeneia)“, Minneapolis 2007, S. 224.
(90) Sie zitieren ihn nach Gleason L. Archer: „Encyclopedia of Bible Difficulties“, Grand Rapids, Michigan, 1982, S. 344.
(91) Siehe hierzu auch Ihr „Lexikon der biblischen Irrtümer“, München 2003, S. 228-235, und meine Kommentierungen dazu: Hieß Jesu Mutter Maria und war sie eine Jungfrau?
(92) Karl Barth: „Die kirchliche Dogmatik“, Band I, 2, 8Zürich 1990, S. 198f.
(93) Ich verweise aber auf meine Bemerkungen zu dem, was Sie im „Lexikon der biblischen Irrtümer“ über den Kanon geschrieben haben: Beruht der biblische Kanon auf reinem Zufall?
(94) Vgl. meine Kommentierungen zu Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“: Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova? und Gab es die Kreuzesinschrift auch auf Aramäisch?
(95) Vgl. auch meine Kommentierung zu Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“: Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund.
(96) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 85-90.
(97) Vgl. Abwegige Zweifel an Jesu Hinrichtung am römischen Kreuz.
(98) Siehe: Gendergerechte Bibelverfälschung?
(99) Vgl. zu diesem und dem nächsten Punkt: Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II: Zwischen Römern und Zeloten“, in: Texte & Kontexte Nr. 129/130 2011, S. 44-47.
(100) Siehe oben zu F wie Fresser, G wie Geschwister Jesu und J wie Jungfrauengeburt.
(101) Vgl. dazu mein Gottesdienst: Männer und Frauen im Stammbaum Jesu
(102) Sie beziehen sich hierzu auf: Nestle/Aland: „Novum Testamentum Graece“, 27. Auflage, Stuttgart 1993, S. 26.
(103) Die griechische Konstruktion des Satzteils dia to einai auton ex oikou kai patrias David wäre nämlich eigentlich wörtlich mit „wegen des ihn aus Haus und Familie David Seins“ zu übersetzen.
(104) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II: Zwischen Römern und Zeloten“, in: Texte & Kontexte Nr. 129/130 2011, S. 20f.
(105) Sie verweisen hierzu auf Salcia Landmann: „Jesus starb nicht in Kaschmir“, München 1996.
(106) Siehe auch A wie Apokalypse und mein Gottesdienst: Lichtschwerter in vorgerückter Nacht zur Auffassung des Paulus, dass das Heil uns heute näher ist als zu der Zeit, als wir zum Glauben kamen.
(107) Werner Papke, Die geheime Botschaft des Gilgamesch. 4000 Jahre alte astronomische Aufzeichnungen entschlüsselt, Augsburg 1993, S. 367.
(108) Sie zitieren sie nach Barbara G. Walker: „Das Geheime Wissen der Frauen“, Frankfurt 1993, S. 651 und 652.
(109) Erhard S. Gerstenberger, „Jahwe – ein patriarchaler Gott?“, Stuttgart 1988, S. 136ff.; vgl. insbesondere S. 146: „Das Gottesbild der Bibel ist zwar von Männern artikuliert und deshalb ergänzungsbedürftig. Aber es ist nicht absichtlich maskulin gestaltet, es ist nicht bewußt sexistisch diskriminierend angelegt. Es beschreibt vielmehr die weltüberlegene transzendente Gottheit für beide Geschlechter und für die gesamte Menschengemeinschaft. Weibliche und außerisraelitische Gotteserfahrungen sind mit in die Theologie des Alten Testaments eingegangen.“
(110) Luise Schottroff, „Die Gleichnisse Jesu“, Gütersloh 2005, S. 213 und 209.
(111) Larry W. Hurtado, „Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity“, Grand Rapids 2003, S. 290ff.
(112) Sie zitieren ihn nach George M. Lamsa: „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 120.
(113) Vgl. dazu Ton Veerkamp, „Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung“, Berlin 2013, S. 330: „Johannes erklärt uns seine politische Absicht unumwunden: ‚Er [Kaiaphas] verkündete, Jeschua/Jesus werde für das Volk sterben und nicht nur für das Volk allein, sondern damit er alle auseinandergetriebenen Gottgeborenen versammle in eins‘, 11.51f. Nun denken wir sofort an ‚Heidenmission‘. Die Völker (ethnoi, ‚Heiden‘) spielen aber bei Johannes überhaupt keine Rolle; dadurch unterscheidet er sich scharf von der Paulusschule bzw. von Matthäus und Lukas. Bei ihm bezieht sich die Sendung des Messias auf Israel. Bei Johannes ist Israel mehr als Judäa. Bei Johannes bemüht sich der Messias um Samaria als ‚Tochter Jakobs‘ (Joh 4). Und das Ziel messianischer Politik ist die große Synagoge, in der sich alle Kinder Israels in Samaria und weltweit versammeln. Der Messias ist die Einheit Israels. Die ‚Kinder des Gottes‘ sind hier nicht ‚alle Menschen‘, sondern Israel. Wenn es heißt: ‚Andere Schafe habe ich, nicht aus diesem Hof‘ (Joh 10.16), sind nicht die ‚Heiden‘ gemeint, sondern die Kinder Israels in der jüdischen Diaspora. Nirgendwo spricht Johannes von einer Sendung zu den Völkern.“ Zur Begründung dieser Deutung verweist Veerkamp auf seinen Kommentar zum Johannesevangelium in: Texte und Kontexte 109-111 (2006, S, 87f. zu 4,31-38 und S. 154ff. zu 10,1-18) und 113-115 (2007, S. 20ff. zu 11,51-53).
(114) Natürlich ist weder Simson noch später Jesus ein „Nasir der Götter“. Sie verwenden das Wort „Götter“ wohl auf Grund des Plurals des hebräischen Wortes ˀÄLoHIM für „Gott“. Dieses Wort kann zwar auch die Götter anderer Völker bezeichnen, aber wo es um den Gott Israels geht, meint dieses Wort tatsächlich nur diesen Einen Gott und muss ins Deutsche mit „Gott“ übersetzt werden.
(115) Sie zitieren ihn nach Eduard König: „Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament“, 2. und 3. Auflage, Leipzig 1922, S. 270.
(116) Vgl. meinen Gottesdienst: Engel, die uns begleiten.
(117) Vgl. meinen Gottesdienst: Power-Glaube.
(118) Sie zitieren ihn nach Joachim Jeremias: „Neutestamentliche Theologie“, Teil I, Göttingen 1970, S. 203.
(119) Sie zitieren ihn nach Heinrich Schlier: „Die Zeit der Kirche“, Freiburg 1975, S. 46.
(120) Vgl. meinen Gottesdienst Zwei Juden im rabbinischen Dialog: Jesus und der Schriftgelehrte.
(121) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 44f.
(122) Ulrich Luck, „Das Evangelium nach Matthäus“, Zürich 1993, S. 68.
(123) Der Evangelist Lukas benutzt übrigens in 11,40 und 12,20 ein anderes Wort, das in den deutschen Bibeln mit „Narr“ übersetzt wird: aphrōn, das wörtlich „Unverständiger“ bedeutet.
(124) Siehe hierzu Walter-Jörg Langbein; „Lexikon der biblischen Irrtümer“, München 2003, S. 22-30: „Auszug aus Ägypten – eine erfundene Story“, vgl. auch meine Kommentierung dazu: Wozu wurde vom Auszug aus Ägypten erzählt?
(125) Vgl. dazu Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund.
(126) Die Zitate dieses gesamten Absatzes stammen aus Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 91f.
(127) Vgl. dazu Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II: Zwischen Römern und Zeloten“, in: Texte & Kontexte Nr. 129/130 2011, S. 48ff.
(128) Ebenda, S. 51f.
(129) Vgl. dazu ebenda, S. 11ff.: „Das Markusevangelium und die Zeloten“.
(130) Vgl. dazu Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil I, Das Markusevangelium als polyphone Komposition“, in der Zeitschrift Texte & Kontexte Nr. 127/128 (2010), S. 61ff.
(131) Vgl. meinen Gottesdienst: Zwei Juden im rabbinischen Dialog: Jesus und der Schriftgelehrte.
(132) Sie berufen sich bei diesem Zitat auf Hyam Maccoby: „Jesus the Pharisee“, London 2003, S. 121.
(133) Sie zitieren es nach Karel van der Toorn: „Dictionary of Deities and Demons in the Bible“, 2. Auflage, Leiden 1999, S. 749-753.
(134) Sie verweisen hierzu auf Gerhard Schneider: „Evangelia infantiae apokrypha – Apokryphe Kindheitsevangelien“, Freiburg 1995; die Einzelheiten im nächsten Absatz beziehen sich auf S. 234/236.
(135) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21“, in der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte 109-111, S. 134f.
(136) Vgl. Sahen Propheten niemals in die Zukunft? und Propheten sahen in die Zukunft – aber wie?
(137) Vgl. dazu: Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea.
(138) Vgl. Jesu Trostwort meinte kein infernalisches Paradies und siehe oben zum Stichwort D wie Drei: Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea.
(139) Sie zitieren ihn nach Markus Barth: „Was kann ein Jude von Jesus glauben und dennoch Jude bleiben?“, Newsletter Nr. 2 des „Kommittee Kirche und das Jüdische Volk“, herausgegeben vom Weltkirchenrat, Genf, Mai 1965, siehe S. 6 und 7.
(140) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 82-85.
(141) Die von Ihnen erwähnten Parallelstellen unterscheiden sich übrigens von der Matthäusversion: In Markus 14,61 fragt der Hohepriester: „Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?“ und in Lukas 22,67 wird Jesus vom gesamten Hohen Rat gefragt, ob er „der Christus“ ist – die Frage nach dem „Sohn Gottes“ kommt nicht vor.
(142) Diese These begründet überzeugend Larry W. Hurtado, „Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity“, Grand Rapids 2003.
(143) Wolfgang Stegemann, „Jesus und seine Zeit“, Stuttgart 2010, schreibt dazu auf S. 382: „Grundsätzlich möglich ist, dass Jesus in Jerusalem im Zusammenhang eines Tumults von römischen Soldaten aufgegriffen und unmittelbar, ohne Beteiligung judäischer Selbstverwaltungsinstanzen vor den obersten Befehlshaber Roms geführt, zum Tode verurteilt und mit anderen „Rebellen/Banditen“ (lestai) gekreuzigt worden ist. Ein anschauliches Beispiel dieser Art schildert die Apostelgeschichte (Apg 21,27ff.). lm Tempel entsteht wegen Paulus ein Tumult, die römischen Truppen greifen ein, doch gibt sich Paulus als römischer Bürger zu erkennen, wodurch ein längeres Gerichtsverfahren sich entwickelt, an dessen Ende die Überstellung des Paulus nach Rom steht. Ganz unabhängig davon, ob es sich um eine korrekte Beschreibung historischer Erfahrungen des Paulus handelt, das Beispiel rechnet damit, dass zunächst keine einheimische Selbstverwaltungsinstanz eingeschaltet wird. … Die Beteiligung judäischer Instanzen (oder auch des Volkes wie im Falle des Paulus) ist prinzipiell nicht auszuschließen. Nahezu unwahrscheinlich ist und kaum mehr vertreten wird allerdings ein regelrechtes Gerichtsverfahren gegen Jesus vor dem höchsten Gericht (Synhedrion/Sanhedrin) Judäas.“
(144) Vgl. dazu: Es ist unwichtig, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat zu Ihrem Stichpunkt C wie Chronologie.
(145) Josephus, „Antiquitates Judaicae XVIII“ 5,2 §116-119.
(146) Sie zitieren sie nach Gerd Theißen und Annette Merz: „Der historische Jesus“, 3. durchgesehene und im Literaturnachtrag ergänzte Auflage, Göttingen 2001, S. 143.
(147) Marcel Simon, „Verus Israel. A study of the relations between Christians and Jews in the Roman Empire (135-425)“, Oxford 1986.
(148) „Das dritte Buch Mose – Leviticus, übersetzt und erklärt“ von Erhard S. Gerstenberger, Göttingen 1993. Die folgenden Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.
(149) Er bezieht sich dabei auf Vera Lúcia Chahon, „A mulher impura. Menstruacao e Judaismo“, Rio de Janeiro 1982; das wörtliche Zitat steht dort auf S. 39f.
(150) „Das dritte Buch Mose – Leviticus, übersetzt und erklärt“ von Erhard S. Gerstenberger, Göttingen 1993, S. 134-140. Die folgenden Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.
(151) Elga Sorge, „Religion und Frau“, Stuttgart, 41987, S. 14.
(152) Gerstenberger beruft sich dazu auf Rachel Biale, „Women and Jewish Law“, New York 1984, und die bereits erwähnte Vera Lúcia Chahon, „A mulher impura. Menstruacao e Judaismo“, Rio de Janeiro 1982.
(153) Sie zitieren ihn nach Gerd Lüdemann: „Jesus nach 2000 Jahren“, Lüneburg 2000, S. 346.
(154) Sie weisen ja selbst im Abschnitt N wie Nazareth darauf hin.
(155) Ich bin genau auf diese Texte in meinem Gottesdienst „Schwerter zu Pflugscharen!“ Oder umgekehrt? eingegangen.
(156) Sie zitieren ihn nach George M. Lamsa: „Die Evangelien in aramäischer Sicht“, Gossau 1963, S. 346.
(157) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 82.
(158) Zu dieser Angabe beziehen Sie sich auf Gleason L. Archer: „Encyclopedia of Bible Difficulties“, Grand Rapids 1982, S. 329.
(159) Siehe z. B. „Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?
(160) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21“, in der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte 109-111, S. 136-138, unter Berufung auf Andreas Bedenbender, Texte & Kontexte 58, 1993, S. 21-48. Das Zitat stammt von Veerkamp, S. 137.
(161) Jesus taufte nicht – aber war auch Johannes kein Täufer?
(162) Siehe dazu Ihre und meine Ausführungen zum Stichwort D wie Drei: Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea.
(163) Sie berufen sich dazu auf Rudolf Meyer: „Der Prophet aus Galiläa. Studie zum Jesusbild der drei ersten Evangelien“, Leipzig 1940.
(164) Dazu verweisen Sie auf Josephus: „Jüdischer Krieg“, II, 17,8-9.
(165) Sie verweisen dazu auf Martin Hengel: „Die Zeloten“, 2. Auflage, Leiden und Köln 1976, S. 299-302.
(166) Sie zitieren ihn nach Hugo Gressmann: „Das religionsgeschichtliche Problem des Ursprungs der hellenistischen Erlösungstradition“, in: „Zeitschrift für Kirchengeschichte“, Jahrgang 40, 1922, S. 189.
(167) Sie verweisen hierzu auf den Abschnitt: „Verhaftung und Verhör: Falsche Schuldzuweisung“ im selben Buch, S. 256.
(168) Siehe: Wer war verantwortlich für Jesu Kreuzigung?
(169) In einem Gottesdienst zum Thema: Nicht zurückblicken! bin ich auf diese Thematik ausführlicher eingegangen.
(170) Dieter Vogl und Nicolas Benzin, „Die Entdeckung der Urmatrix. Die genetische Rekonstruktion menschlicher Organe“, Band I: „Auf der Spur der Schöpfungsformel“, Greiz/Thüringen ²2006, S. 11ff.
(171) Dazu nennen sie exemplarisch: Steinhäuser, Gerhard R.: „Jesus Christus – Erbe der Astronauten“, Wien 1973.
(172) Dazu verweisen Sie auf Ihren Abschnitt: „Astrologie: Korrektur eines Übersetzungsfehlers“, S. 26, zu dem ich bereits Stellung genommen habe: Astrologische Berater bringen Jesus königlichen Tribut.
(173) Vgl. Wie zentral ist die christliche Lehre von der Jungfrauengeburt? zu Ihrem Abschnitt J wie Jungfrauengeburt.
(174) Dass Jesus Apokalyptiker war und keine neue Religion bringen wollte, betonen Sie selbst zu R wie Reformation und A wie Apokalypse.
(175) Vgl. dazu Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II: Zwischen Römern und Zeloten“, in: Texte & Kontexte Nr. 129/130 2011, S. 20f.: Markus „führt mit den Zeloten einen Kampf um die rechte Auslegung der Bibel. Er kämpft leidenschaftlich, aber mit Übersicht. Er … gibt alles preis, was Jesus auch nur von ferne mit dem Davidsreich in Verbindung bringen könnte. In Kapitel 2 entkleidet er David jeder politischen Macht, und weil doppelt genäht besser hält, wirft er in Kapitel 12 die Vorstellung einer Davidssohnschaft noch hinterdrein.“
(176) Dazu verweisen Sie auf Gerd Lüdemann: „Jesus nach 2000 Jahren“, Lüneburg 2000, S. 120.
(177) Larry W. Hurtado, „Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity“, Grand Rapids 2003.
(178) Francesco Carotta: „War Jesus Caesar?“, München 1999.
(179) Volker Weymann, „Und führe uns nicht in Versuchung“. Zur Kontroverse um die sechste Bitte im Vaterunser, Deutsches Pfarrerblatt 11/2019, S. 626.
(180) Vgl. dazu einige Absätze in Rudolf Bultmann verbot keine kritischen Fragen.
(181) Adela Yarbro Collins, „Mark. A Commentary (Hermeneia)“, Minneapolis 2007, S. 537: Die Ähnlichkeit von Markus 11,25 mit Texten der matthäischen Bergpredigt „does not mean that Mark knew a text of the Sermon on the Mount or of Matthew. Rather, both evangelists knew a tradition linking prayer and forgiveness and adapted it independently to their respectiv contexts. Later, because of the similarity between Mark 11:25 and Matt 6:14, v. 26 was added to the text of Mark on the model of Matt 6:15.“
(182) Volker Weymann, „Und führe uns nicht in Versuchung“. Zur Kontroverse um die sechste Bitte im Vaterunser, Deutsches Pfarrerblatt 11/2019, S. 626.
(183) Hans-Christoph Askani, „Une tentation à prix reduit“. A propos de la nouvelle Traduction du Notre Père in: Etudes théologiques et religieuses (ETR) 89/2014, S. 174.
(184) Stefan Reis Schweizer, „Dem Papst gefällt das Vaterunser nicht mehr. Franziskus bemängelt eine Passage im wichtigsten Gebet des Christentums“, in: Neue Zürcher Zeitung. Internationale Ausgabe, Nr. 289, 12.12.2017, S. 18.
(185) Sie zitieren ihn nach Pinchas Lapide: „Ist die Bibel richtig übersetzt?“, Band 1, Gütersloh 1995, S. 124.
(186) Sie verweisen hierzu auf Ihr „Lexikon der biblischen Irrtümer“, München 2003, S. 287-290: „Versuchung – Übersetzungsfehler im Vater unser“; vgl. dazu meine Kommentierung: Welcher Versuchung widerstand Jesus als Sohn Gottes?
(187) Volker Weymann, „Und führe uns nicht in Versuchung“. Zur Kontroverse um die sechste Bitte im Vaterunser, Deutsches Pfarrerblatt 11/2019. Die nachfolgend genannten Seitenzahlen bis zum Ende des Abschnitts beziehen sich auf diesen Artikel.
(188) Mit diesem Zitat bezieht sich Weymann auf Julia Knop, „Gottverlassen beten. Wider die Verharmlosung Gottes und die Banalisierung des Vaterunser“, in: Thomas Söding (Hg.), „Führe uns nicht in Versuchung. Das Vaterunser in der Diskussion“, 2018, S. 97.
(189) Ton Veerkamp, „Alle Worte und Taten des Messias. Das Evangelium nach Matthäus“, in: Texte & Kontexte 157-159, 2018, S. 154-155.
(190) Vgl. dazu folgende Abschnitte: Bezeichnete sich Jesus als König der Juden – oder nicht? – Wer war verantwortlich für Jesu Kreuzigung? – Jesus oder Barabbas – von der Menschenverachtung des Pilatus – Historisch gesehen gab es keinen Prozess Jesu vor jüdischen Richtern – In den Evangelien werden nicht „die“ Juden verflucht – Wer ist verantwortlich für Jesu Tod?
(191) Vgl. dazu: Ist Jesus eine Kopie des Messias Menachem?
(192) Vgl. dazu, was Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 85, zu Johannes 18,28 schreibt: „Sie brachten ihn ins Prätorium, dem Verwaltungssitz des Prokurators der Provinz Jehuda. Sie: die Polizeitruppe und diejenigen, die beim Verhör durch Channan [= Hannas] und Kaiaphas [= Kaiphas] anwesend waren. Sie sind die Jehudim der folgenden Abschnitte. Es handelt sich dabei um ganz bestimmte Jehudim; für das Verständnis dessen, was folgt, ist dieses sie von entscheidender Bedeutung. Die Peruschim [= Pharisäer] sind nicht dabei, auch nicht die Menge, die darüber streitet, ob Jeschua der Messias war oder nicht. Vor dem Prätorium ist keine Menge (ochlos). Es sind ganz bestimmte Mitglieder des Volkes, die Jeschua am Kreuz sehen wollen. Johannes war kein Antijudaist, gar Antisemit! Er war sehr wohl ein Feind der judäischen Führung und ihrer Trabanten.“
(193) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, II. Teil: Johannes 10,22 – 21,25“, in: Texte & Kontexte Nr. 113-115, 2007, S. 43: „Jehuda [= Judas] … nimmt die Rolle an, die Rom – der Satan – ihm zuweist.“ Vgl. auch Andreas Bedenbender, „Am Ort und im Schatten des Todes“. Die neutestamentlichen Ortsangaben Kapernaum, Bethsaida und Chorazin als poetische Verweise auf das Römische Reich, in: Texte & Kontexte Nr. 112, 2006, S. 13: „Die Deutung Kapernaums auf Rom erklärt … die Parallele, die Lukas im 10. Kapitel nicht nur zwischen Babel und Kapernaum, sondern auch zwischen dem Satan und Kapernaum sieht: Der Sturz vom Himmel in die Hölle, den Kapernaum in V. 15 erleidet, entspricht ja genau dem Weg Satans in V. 18. Gerade im Lk-Ev wird aber die auch anderswo im NT erkennbare Nähe zwischen dem Satan und dem römischen Kaiser stark betont. Wie Lk 4,5f. deutlich macht, sind ‚alle Reiche der Welt‘ dem Teufel übergeben; und stolz kann er von sich sagen: ‚Ich gebe sie, wem ich will‘. Der Teufel schaltet politisch also ganz nach Art der Cäsaren [Anm. 19: Vgl. etwa Lk 19,12: der ‚Fürst‘, der ‚in einem fernen Land ein Königtum erlangen‘ wollte, trägt alle Züge des Herodessohns Archelaos, der nur aufgrund der Zustimmung des Augustus das Erbe seines Vaters hatte antreten können.]. Eine Stadt aber, die mit Babel und seinem König, daneben sogar mit dem Satan, auf einer Linie steht, heiße im NT, wie sie wolle – es kann sich nur um Rom handeln.“
(194) In dem Gottesdienst Verrat oder Vertrauen habe ich zu entfalten versucht, was wir vom Glauben her aus den Geschichten über den Verrat des Judas lernen können.
(195) Siehe dazu auch Judas: Widersprüche um seinen Tod und Zwölf Jünger Jesu: Irrte die Bibel oder ihr Kritiker?
(196) Ton Veerkamp, „Der Abschied des Messias. Eine Auslegung des Johannesevangeliums, I. Teil: Johannes 1,1 – 10,21“, in der exegetischen Zeitschrift Texte & Kontexte 109-111, S. 30.
(197) Die Pharisäer stehen nach Veerkamp, ebenda, S. 29, in der Sicht des Evangelisten Johannes für „das sich formierende rabbinische Judentum“, das (S. 30) „einem, der sich von ‚Gesetz und Propheten‘ unterscheidet, … nicht über den Weg“ traut.
(198) Nebenbei bemerkt, ist aber auch vorstellbar, dass er als wiedergeborener Elia sich dessen selber gar nicht bewusst ist; immerhin ist es für Menschen, die an die Reinkarnation glauben, gar nicht so einfach, sich in Trance-Zuständen in eine vergangene Existenz zurückführen zu lassen, um herauszufinden, wer sie vielleicht früher einmal gewesen sind.
(199) Nach älteren Bibelübersetzungen wie der der lateinischen Vulgata ist es Vers 4,5.
(200) Andreas Bedenbender, „Einführung in das Markusevangelium, Teil II: Zwischen Römern und Zeloten“, in: Texte & Kontexte Nr. 129/130 2011, S. 17. Die Seitenzahlen in diesem Absatz beziehen sich ebenfalls auf Bedenbender.
(201) Vgl. dazu meine Ausführungen zu Ihrem Abschnitt E wie Elia.
(202) Sie zitieren es nach Gustav Mensching: „Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Völker“, Leiden 1957.
(203) Walter Schmithals, „Das Evangelium nach Lukas“, Zürich 1980, S. 58.
(204) Sie zitieren ihn nach Gerd Lüdemann: „Jesus nach 2000 Jahren“, Lüneburg 2000, S. 23.
(205) Zur Bezeichnung „Menschensohn“ siehe M wie Menschensohn.
(206) Vgl. hierzu Larry W. Hurtado, „Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in earliest Christianity“, Grand Rapids 2003.
(207) Sie verweisen hierzu auf John P. Meier: „A Marginal Jew“, Band I, New York 1991, S. 207.
(208) In meiner Kommentierung zu Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ habe ich unter der Überschrift Hieß Jesu Mutter Maria und war sie eine Jungfrau? zur Frage Stellung genommen, ob Jesu Mutter evtl. gar nicht Maria hieß.
(209) Erhard S. Gerstenberger, „Israel in der Perserzeit“, Stuttgart 2005, S. 68.
(210) Siehe dazu den Abschnitt V wie Versuchung.
(211) Erhard S. Gerstenberger, „Israel in der Perserzeit“, Stuttgart 2005, S. 64f. Vgl. zu diesem Abschnitt auch den Abschnitt T wie Teufel in Ihrem Lexikon der biblischen Irrtümer und meine Kommentierung dazu: Von Gottes Chefankläger zum teuflischen Lucifer.
(212) Sie widersprechen damit Ihren eigenen Ausführungen über Aufzeichnungen zum Leben Jesu, die angeblich schon früh gemacht worden seien.
(213) Vgl. meinen Gottesdienst Die Weihnachtsgeschichte nach Paulus.
(214) Sie berufen sich dazu auf Elaine Pagels: „Adam, Eve and the Serpent“, New York 1988, S. 17.
(215) So ein Buchtitel von Uta Ranke-Heinemann: „Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität“, München 2000.
(216) Sie berufen sich hierzu auf Peter de Rosa: „Der Jesus-Mythos“, München September 1993, S. 185.
(217) Diese ist Johannes sogar besonders wichtig, und zwar auch unter Einschluss der samaritanischen Nordstämme, worauf Ton Veerkamp hinweist (siehe Anm. 113).
(218) Hierzu berufen Sie sich auf Eduard Meyer: „Urgeschichte des Christentums – Ursprünge und Anfänge/Die Evangelien“, Gütersloh ohne Jahresangabe.
(219) Sie verweisen hierzu auf Robert M. Price: „Deconstructing Jesus“, New York 2000.
(220) D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, Tischreden, II. Band, S. 1877.
(221) Ebenda, V. Band, S. 5193.
(222) Vgl. dazu meinen Abschiedsgottesdienst vom Pfarrdienst: Lebenslanges Lernen, der allerdings nicht meinen Abschied von eben diesem lebenslangen Lernen bedeutete.
