Im vierten Kapitel des Buches trägt Pfarrer Helmut Schütz über die Art, wie Kinder lernen, Einsichten von Manfred Spitzer, Erik H. Erikson, Daniel Stern, Laurie Boucke und John M. Hull zusammen.
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
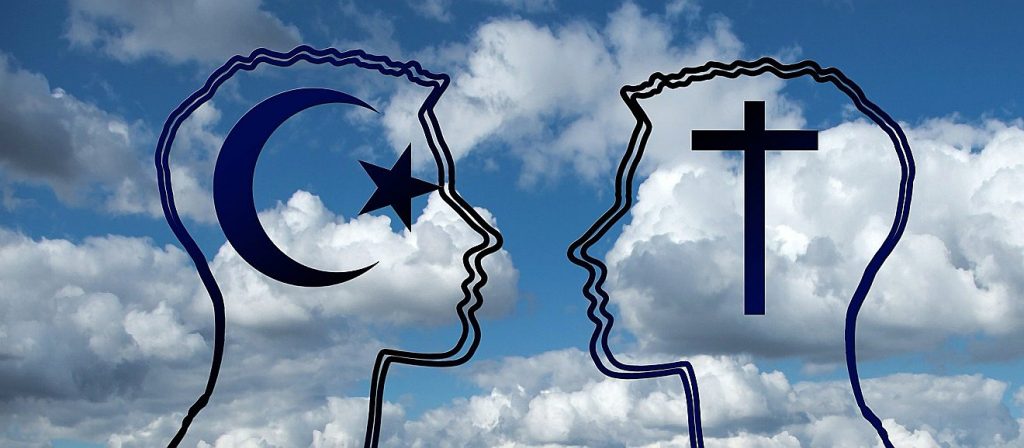
Inhalt dieses Kapitels
4.1.1 Vermeidung von Demotivation als Lösung des Motivationsproblems
4.1.3 Der Mensch als kooperatives Wesen
4.1.4 Vom Aufbau einer Werte-Grammatik im Gehirn
4.1.5 Schlussfolgerungen aus der internationalen PISA-Studie
4.1.6 Kinder brauchen zum Lernen Lehrerpersönlichkeiten, nicht Computer
4.1.7 Kritik am Religions- und Ethikunterricht bundesdeutscher Prägung
4.1.8 Der Mensch als auf Religion angelegtes Wesen
4.1.9 Kinder brauchen Strukturen und Geschichten, Metaphern und Mythen
4.2 Verschiedene Gesichtspunkte zur kindlichen Entwicklung
4.2.1 Eriksons Entwicklungskrisen und die religiöse Entwicklung im Vorschulalter
4.2.2 Arten des Selbstempfindens kleiner Kinder nach Daniel Stern im Kinderkrippenalltag
4.2.3 Laurie Boucke: Beim Sauberkeitstraining für Säuglinge von anderen Kulturen lernen
4.2.4 John M. Hull: Mit Kindern über Gott reden
↑ 4.0 Forschung über Kinder
Auch Grundsatzfragen anderer Art haben mit dem Thema meines Studienurlaubs zu tun, denn meine Absicht, als Baustein einer Kultur des interreligiösen Teilens Kindern im Kindergarten neben biblischen auch koranische Geschichten zu erzählen, steht und fällt ja mit der Frage, ob Kinder in diesem Alter dadurch nicht hoffnungslos verwirrt werden. Muss man Kinder nicht erst einmal langsam in einer eigenen Religion beheimaten, ehe man ihnen die Vielfalt anderer Religionen zumutet? Aufschlussreich fand ich zur Klärung dieser und anderer Fragen zum Thema des kindlichen Lernens eine Reihe von Büchern bzw. Aufsätzen über Gehirnforschung, Entwicklungspsychologie und spezielle kindliche Fähigkeiten.
↑ 4.1 Manfred Spitzer: „Lernen“
Manfred Spitzers Buch „Lernen“ ist ein genial kurzweiliger Einstieg in die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung zum Thema Lernen (336) und für mich eine Bestätigung in meiner Absicht, Menschen jeglichen Alters möglichst viel Geschichten zu erzählen. Denn, so Spitzer gleich in einem der ersten Kapitel:
„Ein guter Lehrer wird Geschichten erzählen. …
Geschichten treiben uns um, nicht Fakten. Geschichten enthalten Fakten, aber diese Fakten verhalten sich zu den Geschichten wie das Skelett zum ganzen Menschen. Wer glaubt, beim Lernen gehe es darum, Fakten zu büffeln, der liegt völlig falsch; Einzelheiten machen nur im Zusammenhang Sinn, und es ist dieser Zusammenhang und dieser Sinn, der die Einzelheiten interessant macht. Und nur dann, wenn die Fakten in diesem Sinne interessant sind, werden wir sie auch behalten.“ (337)
Ebenfalls einleitend macht Spitzer von der Funktionsweise des Gehirns her deutlich, dass man Kindern Regeln und Werte nicht dadurch beibringt, dass man sie zwingt, Regeln und Gebote auswendig zu lernen.
„Was Kinder brauchen, sind Beispiele. Sehr viele Beispiele und wenn möglich die richtigen und gute Beispiele. Auf die Regeln kommen sie dann schon selbst …
Nur dann, wenn die Regel immer wieder angewendet wird, geht sie vom expliziten und sehr flüchtigen Wissen im Arbeitsgedächtnis in Können über, das jederzeit wieder aktualisiert werden kann.“ (338)
Beherzigenswert für mich persönlich fand ich den Hinweis, dass man nur bei ausreichendem Schlaf nachhaltig lernen kann.
„Wer gerne abends im Bett schmökert, der darf dieses Buch gerne danach unter‛s Kopfkissen legen. Die nachfolgenden Tiefschlafphasen sorgen dann für die Übertragung des Gelernten vom eher kleinen und flüchtigen Speicher Hippokampus in den großen Langzeitspeicher Großhirnrinde. …
Das geordnete Wechselspiel von Tiefschlaf und Traumschlaf dient dem Transfer und der Off-line-Verarbeitung von neu erlernten Inhalten.“ (339)
So erklärt sich wohl auch, dass sich manchmal morgens unter der Dusche ein Gedankenchaos vom Vortag wie von selbst in handhabbare Strukturen zergliedern ließ. Dauerstress dagegen überfordert und schädigt letzten Endes den Hippokampus im Gehirn.
„Akuter Stress ist eine biologisch sinnvolle Anpassung an Gefahr im Verzug. Chronischer Stress hingegen ist heute eine der wesentlichen Ursachen von Zivilisationskrankheiten. …
Es scheint … so zu sein, dass chronischer Stress die Neuronen des Hippokampus beständig ‚an den Rand‛ bringen und damit langfristig zum Zelluntergang führen kann. Stress ist damit ungünstig für das Lernen und das Behalten.
Es folgt, dass Lernen mit positiven Emotionen arbeiten sollte. Angst und Furcht können zwar kurzfristig das Einspeichern von neuen Inhalten fördern, führen jedoch langfristig zu den genannten negativen Effekten von chronischem Stress.“ (340)
↑ 4.1.1 Vermeidung von Demotivation als Lösung des Motivationsproblems
Immer wieder betont Spitzer, dass das Gehirn gar nicht anders kann als zu lernen. Zum Beispiel enthält es ein kompliziertes eingebautes Belohnungssystem, das mit dem Botenstoff Dopamin zusammenhängt und nur „bei Ereignissen oder Verhaltenssequenzen anspringt, die ein Resultat liefern, das besser als erwartet ausfällt.“ Das heißt:
„Gelernt wird immer dann, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. … Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste ‚Verstärker‛. …
Man weiß weiterhin, dass die Begegnung mit Neuem zu einer Freisetzung von Dopamin in diesem System führt. Dopamin wurde daher als Substanz der Neugier und des Explorationsverhaltens, der Suche nach Neuigkeit (engl.: novelty seeking behaviour) bezeichnet. …
Wie … Untersuchungen zeigen, sind die gehirneigenen Systeme für Belohnung und Bestrafung völlig verschieden. … Zudem wurde nachgewiesen, dass für optimales Lernen nicht der Absolutwert der Belohnung von Bedeutung ist, sondern deren Unerwartetheit: Immer dann, wenn der Organismus eine bestimmte Erwartung hat und das Ergebnis des Verhaltens besser ist als die Erwartung, wird gelernt.“ (341)
Das bedeutet:
„Menschen sind von Natur aus motiviert, sie können gar nicht anders, denn sie haben ein äußerst effektives System hierfür im Gehirn eingebaut. Hätten wir dieses System nicht, dann hätten wir gar nicht überlebt.“
Die Frage ist also, „warum viele Menschen so häufig demotiviert sind!“
Spitzer nennt auch gleich eine der wichtigsten, meist unbewusst ablaufenden „Demotivationskampagnen“:
„Wir verleihen Preise an den Besten (der ja ganz offensichtlich keine Motivationsprobleme hat) und demotivieren alle anderen Bewerber…
In der Schule wird oft der Beste herausgehoben und gelobt. Damit wird dafür gesorgt, dass sich alle anderen mies fühlen. Man sollte dies vermeiden. Lob ist für jeden Schüler wichtig! Es darf aber keineswegs ‚über den grünen Klee‛ gelobt werden, sondern zeitnah, spezifisch und für den Schüler klar nachvollziehbar.“ (342)
Die Persönlichkeit des Lehrers ist für Spitzer das entscheidende Medium des Unterrichts, denn
„ein vom Fach begeisterter Lehrer, der gelegentlich lobt und vielleicht auch mal einen netten Blick für die Schüler übrig hat, bringt deren Belohnungssystem auf Trab. …
Ein Lehrer muss in der Lage sein, über Sachverhalte seines Faches interessante Geschichten zu erzählen.“ (343)
↑ 4.1.2 Lebenslanges Lernen
Nach Spitzer lernen Kinder bereits vor der Geburt:
„In dem Maße, wie Tastsinn, Sehen, Hören, Riechen und Schmecken im Mutterleib heranreifen und funktionstüchtig werden, bilden sie auch die Grundlage für erstes Lernen, das bereits im Mutterleib stattfindet. Bereits im Mutterleib hört, tastet, schmeckt und riecht der Säugling.“ (344)
Die neue Hirnforschung hat auch herausgefunden, warum der Mensch nicht bereits mit fertigem Hirn auf die Welt kommt. Nur weil „das Gehirn zugleich lernt und sich entwickelt“, kann es sich aus der Vielfalt der Signale aus der Außenwelt diejenigen auswählen, die es zum jeweiligen Zeitpunkt gerade verarbeiten kann. Alles andere rauscht buchstäblich vorüber. Kleine Kinder „suchen sich einfach selbst, was sie gerade am besten lernen können. Ihr sich entwickelndes Gehirn stellt einen eingebauten Lehrer dar.“
Allerdings müssen sie in bestimmten Zeitabschnitten, den „so genannten kritischen oder sensitiven Perioden“, bestimmte Erfahrungen machen, „damit bestimmte Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten erworben werden. Kommt es nicht dazu, werden diese Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten zeitlebens nicht mehr gelernt.“ (345)
Daraus ergibt sich als selbstverständliche Folgerung:
„Dass Kinder … eine interessante Umgebung brauchen, dass ihre Neugier befriedigt werden sollte und dass sie vielfältigen Erfahrungen ausgesetzt sein sollten, liegt auf der Hand.“ (346)
Aber nicht nur über das schnelle Lernen der Kinder, auch über das langsamere Lernen der älteren Menschen hat Spitzer Wesentliches zu sagen. Es hat Gründe, dass Menschen alt werden und im Alter nicht mehr so rasch viel Neues lernen, stattdessen aber das neu Gelernte mit der inzwischen gesammelten Lebenserfahrung verknüpfen.
„Wir werden alt, weil wir lernen können. …
Ältere Individuen stellen einen Erfahrungsschatz dar, der für die Gruppe insgesamt von Nutzen ist. Waren dies früher Vermutungen, so wissen wir um die Bedeutung des Alters für die Gesellschaft durch neuere Untersuchungen immer genauer Bescheid. … Aus neurobiologischer Sicht ist die Großmutter im Vergleich zum Farbfernseher der weitaus bessere Babysitter!“ (347)
Wobei ich eine erste Kritik an Spitzer anbringen muss: dass er den Großvater als Babysitter mit keinem Wort erwähnt, was mir besonders auffällt, da wir während meiner Studienzeit regelmäßig als Großeltern unsere erste Enkelin betreuen durften.
↑ 4.1.3 Der Mensch als kooperatives Wesen
Inzwischen kann, so Spitzer, die Hirnforschung auch Aussagen darüber machen, warum wir Menschen auf Kooperation angelegt sind, dass Bewertungen und Werte in bestimmten Gehirnarealen gespeichert werden und welchen Sinn es macht, dass wir imstande sind, über Gott nachzudenken.
„Wenn Menschen Gemeinschaftswesen sind, … muss es Mechanismen geben, die Kooperation herstellen und aufrechterhalten, denn Kooperation heißt immer auch Verzicht und Teilen – impliziert also Verhaltensweisen, die wir als Kind noch nicht beherrschen, sondern vielmehr erst im Laufe des Lebens erlernen müssen.“
Dass Menschen die Fähigkeit zur Kooperation entwickeln, ist „nach experimentellen Studien“ dort begründet, wo man eine Lösung dieses Problems
„zunächst nicht sucht: bei unseren Emotionen, d. h. in neurobiologischer Hinsicht bei den Systemen, die für Freude und Belohnung bzw. für Ärger und Bestrafung zuständig sind.
… Wenn ich auf den Apfel verzichte und ihn meinem kranken Bruder gebe, obwohl mir selbst der Magen knurrt, dann werde ich zwar nicht vom Geschmack des Apfels, wohl aber vom Gedanken an die Genesung meines Bruders belohnt. Hierzu muss dieser Gedanke im Kortex so stark verankert sein, dass er meine Prädisposition, in den Apfel zu beißen, hemmt. Mein Belohnungssystem muss also gelernt haben, auf mehr als den unmittelbaren Konsum und Profit aus zu sein. Dies braucht Zeit … Aber wir Menschen werden ja auch vergleichsweise sehr alt … und haben damit diese Zeit.“ (348)
Außerdem hat sich im Gehirn die Neigung, unfaire Mitglieder der Gemeinschaft zu bestrafen, schon in grauer Vorzeit ausgeprägt:
„In Gesellschaften von Jägern und Sammlern sind Sanktionen für nicht gruppenkonformes Verhalten häufig bis streng. Man lacht den Egoisten aus, der Tyrann wird exekutiert …
Gerade in den letzten Jahren haben wir sehr viel Gehirnwäsche über uns ergehen lassen, die uns glauben machen sollte, dass in der Natur langfristig immer Unbarmherzigkeit, Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit, Egoismus und vor allem der Stärkere siegt. Gerade weil soziales Engagement gelernt werden müsse, liege es nicht in unserer Natur. Was aber wird aus diesem Argument, wenn das Lernen in unserer Natur liegt? Und wer wollte ernsthaft behaupten, dass Sprechen nicht in unserer Natur liegt, nur weil wir es lernen müssen? Aus der Tatsache, dass wir soziales Verhalten im Laufe des Lebens erlernen, insbesondere während der ersten beiden Lebensjahrzehnte, folgt also keineswegs, dass es nicht unserer Natur entspricht, kooperativ zu sein.“ (349)
↑ 4.1.4 Vom Aufbau einer Werte-Grammatik im Gehirn
Bewertungen werden nach Spitzer im Gehirn in Analogie zur Sprachentwicklung gespeichert:
„Durch die häufige Verarbeitung der Laute unserer Muttersprache schlagen sich diese in den Synapsenstärken von Gehirnarealen nieder, die für die Analyse von Lautmustern zuständig sind. Bereits der sechsmonatige Säugling hat auf diese Weise die Laute der Muttersprache in sich repräsentiert, andere Sprachlaute hingegen nicht. In ganz ähnlicher Weise schlagen sich auch Bewertungen in entsprechenden kortikalen Arealen, die mit unserem Belohnungs- und Bestrafungssystem in enger Verbindung stehen und von diesen Systemen ihren Input bekommen, als Repräsentation nieder. Daher lernen wir im Laufe unseres Lebens nicht nur, die Laute R und L zu unterscheiden und dann sehr treffsicher auch bei sehr viel Hintergrundgeräuschen wahrzunehmen; wir lernen vielmehr auch, angenehm und unangenehm, gut und schlecht sowie gut und böse zu unterscheiden. Wenn wir alt genug sind, erkennen wir dies selbst dann, wenn es sich zunächst eher verbirgt.“ (350)
Unsere menschliche Motivation beruht in erster Linie auf Emotionen:
„Menschen sind motiviert, weil sie etwas gut finden; sie finden etwas gut, weil sie dafür belohnt wurden oder werden. Die körpereigenen Systeme, die für Prozesse zuständig sind, die wir umgangssprachlich unscharf unter Begriffe wie Emotion, Motivation, Triebbefriedigung oder soziale Intelligenz fassen, haben allesamt mit Werten zu tun.“ (351)
Man kann den Aufbau dessen, was wir „Werte“ nennen, nicht scharf von diesen Bewertungen trennen; die Wertsysteme, die in unserem Kopf repräsentiert sind, sind eng verzahnt mit unseren gesamten Emotionen. Trotzdem lässt sich präzisieren, was damit gemeint ist:
„Werte haben mit Zielen zu tun und damit, dass man etwas lässt, um etwas anderes zu tun.
Wenn wir sagen, dass unsere Handlungen durch Werte geleitet sind, so meinen wir damit oft, dass wir gerade nicht das tun, was wir im jeweiligen Moment am liebsten täten. Gesundheit ist uns beispielsweise ein hoher Wert, weswegen so mancher auf die Zigarette nach dem Essen, die dritte Tasse Kaffee zum Frühstück, das zweite Glas Rotwein am Abend oder den Nachschlag beim Mittagessen (ganz zu schweigen vom Nachtisch) verzichtet. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Konjunkturschwäche ist ein Arbeitsplatz von hohem Wert. Auch wer noch müde ist, dreht sich also nicht beim Klingeln des Weckers noch einmal herum, sondern quält sich aus dem Bett, erst in die Dusche und dann an den Arbeitsplatz. Ein Auto ist für viele Menschen ein hoher Wert und sie sparen hierfür, indem sie die Befriedigung anderer Bedürfnisse zurückstellen. Freiheit ist für uns ein so hoher Wert, dass wir zu ihrer Verteidigung sogar bereit sind, Menschenleben zu opfern.“ (352)
Obwohl wir „Fakten und Bewertungen … nur im Nachhinein getrennt [haben], wenn wir über die Dinge nachdenken, sie analysieren und kategorisieren“, besitzen wir in unserem Gehirn mit seinem „modularen Aufbau“ auch ein Modul für Werte (353).
„Jede einzelne Bewertung schlägt sich in uns nieder, führt zum Aufbau langfristiger innerer Repräsentationen von Bewertungen, die uns bei zukünftigen Prozessen der Bewertung zu rascheren und zielsichereren Einschätzungen verhelfen. So entstehen zusätzlich zu den Systemen der unmittelbaren Belohnung und Bestrafung Repräsentationen von Gut und Schlecht oder Gut und Böse oder Angenehm und Unangenehm und darauf aufbauend Repräsentationen von Zielen und Handlungen, Kontexten und Begleitumständen, Zuneigungen und Abneigungen (vor allem im Hinblick auf andere Menschen).“ (354)
Von diesen Überlegungen aus kommt Spitzer zu einer kritisch konstruktiven Würdigung biblischer Werte:
„Wie sieht nun die Grammatik unseres Handelns (ich könnte auch sagen, unser gesellschaftlich geteilter moralischer Kodex) aus? – Wie auch immer man dazu stehen mag, faktisch hat er sehr viel mit einem Kodex zu tun, der auf die Lebensverhältnisse eines Wüstenvolks vor 3.000 Jahren passte, samt den anhand von Aufzeichnungen zum Leben eines revolutionären Außenseiters später vorgenommenen Ergänzungen. Diese Grammatik unseres Handelns kann und sollte nicht unhinterfragt als Richtschnur für die Probleme der Gegenwart herangezogen werden. Ebenso wenig sollten wir leichtfertig mit ihr umgehen, denn die Bibel hat unsere Kultur bestimmt wie kein anderes Buch und damit unsere Lebensbedingungen geprägt.“ (355)
Aus den unterschiedlichen „Grammatiken“ verschiedener Werte-Systeme ergibt sich auch manches Problem im Zusammenleben von Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen stammen.
„Wenn wir uns in verschiedenen Sprachen verständigen, gewinnt die Grammatik besondere Bedeutung. Wenn wir (in zunehmendem Maße) international handeln, ist dies mit der Moral nicht anders. Erst wer eine Fremdsprache erlernt, der lernt auch zu schätzen, was es heißt, über grammatische Regeln zu verfügen und damit eine ganze Menge von Einzelheiten auf einen Streich zu erfassen. Wer in einem anderen Land lebt, tut sich mit der Moral schwerer, denn es gibt für das richtige Handeln weit weniger klare, publizierte und beispielsweise in Buchform erwerbbare Richtschnüre als für das richtige Sprechen. Moral ist weit weniger klar kodifiziert als Sprache und Schrift.“ (356)
„Es ist viel leichter zu lernen, einen Menschen zu umfahren und ihn nicht umzufahren (d. h. die Grammatik der Halbpräfixe), als zu lernen, warum man nicht töten soll, Adolf Hitler aber vielleicht doch (d. h. die Ethik von Tötungshandlungen). … Moralisch handeln, sich in einer komplexen Lebensgemeinschaft zurechtfinden und vielleicht sogar ein erfülltes und glückendes Leben aus der Beliebigkeit und Winzigkeit der eigenen Existenz zu destillieren, ist eben letztlich die höchste Leistung, zu der Menschen fähig sind.“ (357)
Was kann man nun aus diesen Einsichten über das Gehirn des Menschen für die Werteerziehung in der Schule oder im Kindergarten lernen? Das Areal, in dem Werte gespeichert werden, bildet sich erst im Laufe oder sogar nach Abschluss der Pubertät zur vollen Reife heraus. Ist es also sinnlos, Kindern Werte beibringen zu wollen? Dazu führt Spitzer eine aufschlussreiche Analogie an:
„Im Kindergarten über Grammatik zu sprechen ist sinnlos, denn in diesem Alter wird sie noch gelernt (also noch nicht gekonnt), sodass noch keine Intuitionen vorliegen, die durch den Unterricht geklärt und auf den Begriff gebracht werden könnten. Daraus wiederum folgt, dass man Ethik (im strengen Sinn als Reflexion über die Prinzipien moralischen Handelns) in der Unterstufe nicht unterrichten kann. Gewiss, man kann sich über das Raufen unterhalten und Geschichten über böse und gute Menschen erzählen, ebenso, wie man im Kindergarten mit den Kindern sprechen kann und sollte. …
Ebenso, wie die Kinder im Kindergarten den richtigen Sprachinput brauchen, um richtig sprechen zu lernen, brauchen Jugendliche die richtige Umgebung zum Probehandeln auf allen Ebenen des Miteinander, die richtigen Vorbilder, um über Modelllernen ihre Handlungen auszurichten, und genügend Freiräume, um ausprobieren zu können. Ebenso, wie das Kleinkind ‚plappern‛ muss, um sprechen zu lernen, muss der Jugendliche ‚probehandeln‛ können. Er muss, vor allem im Umgang mit Gleichaltrigen, Verantwortung übernehmen lernen, Vertrauen ausbilden können, Interessen abwägen, Konflikte aushalten und sie vielleicht sogar manchmal lösen können. Lässt man Jugendliche unter sich, geschieht dies automatisch, bedarf aber wie beim Spracherwerb permanenter Beispiele. Auch suchen sich Jugendliche automatisch Vorbilder (weil Lernen am Modell so rasch und einfach geht: Die Konsequenzen kann ich beobachten und brauche sie daher nicht zu spüren!).“ (358)
Spitzer betont, dass es „die Varianz früher, d. h. während der Reifung des frontalen Kortex gemachter, Erfahrungen ist, die uns vor Einseitigkeit bewahrt“, und plädiert dafür,
„dass Lehrjahre immer auch Wanderjahre sein sollten… Je mehr Austausch während der Schulzeit erfolgt, je besser, und je mehr einer gesehen hat, desto toleranter wird er später sein. Durch viele unterschiedliche Erfahrungen, durch unser Reiben an den Vorstellungen anderer und durch unser damit verbundenes dauerndes Bewerten werden Räume für Repräsentationen eröffnet, oder besser: aufgespannt. Je differenzierter diese Räume angelegt werden (und dies geschieht noch bis nach der Pubertät), desto eher ist der Erwachsene später zu Bewertungen komplexer Sachverhalte in der Lage.
Und die Moral? – Es ist die Monotonie der in der Jugend erfahrenen Inhalte (und seien sie noch so gut!), die später differenziertes Handeln verhindert und einseitige Bewertungen, um nicht zu sagen: Fanatismus, hervorbringt. Oder kurz, in Anlehnung an eine Volksweisheit zur Bedeutung kritischer Perioden beim Kompetenzerwerb: Für‛s Hänschen die Varianz bringt Toleranz bei Hans.“
Kinder und Jugendliche brauchen also richtige Beispiele, um richtiges Handeln einüben zu können. Denn
„Ethik verhält sich zum richtigen Tun wie Grammatik zum richtigen Sprechen. Wir haben die Grammatik der Muttersprache nie gepaukt, sondern sie anhand von Beispielen uns selbst generiert. Beim Handeln ist dies nicht anders. Wir lernen es dadurch, dass wir es tun, immer wieder, in den unterschiedlichsten Kontexten und mit den verschiedensten Menschen.“ (359)
In diesem Zusammenhang nennt Spitzer als Negativ-Beispiel den unkontrollierten Fernsehkonsum unserer Kinder und Jugendlichen. „Wir predigen den Frieden, trainieren unsere Kinder jedoch stundenlang täglich in Gewaltausübung.“ (360) Zwar versuchen einige Studien zu beweisen, dass jahrelanges Anschauen von Gewaltszenen im Fernsehen (oder das spielerische Einüben von Gewalt mit Videospielen) eher zu einem Abbau von Aggressionen führe, aber was waren die Rahmenbedindungen dieser Untersuchungen?
„Hierzu ein Beispiel: Jungen aus Heimen, die für einen Zeitraum von sechs Wochen entweder Fernsehprogramme mit oder ohne Gewalt angeschaut hatten, wurden im Hinblick auf ihr Verhalten beobachtet. Es zeigte sich, dass die Jungen, die gewaltlose Programme anschauten, zu mehr Gewalt neigten als diejenigen, die Gewalt anschauten. Das Ergebnis widersprach damit den oben beschriebenen Befunden und könnte zunächst als Hinweis auf einen positiven Effekt des Gewaltfernsehens interpretiert werden… Bei genauerem Hinsehen jedoch ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die Jungen sahen Fernsehprogramme mit Gewalt lieber als gewaltfreies Fernsehen und waren über die verordnete sechswöchige Einschränkung ihrer Auswahl verärgert. Dieser Ärger äußerte sich dann in aggressiven Handlungen.“ (361)
↑ 4.1.5 Schlussfolgerungen aus der internationalen PISA-Studie
Sehr interessant sind in Manfred Spitzers Buch über das Lernen auch die Schlüsse, die er aus den Ergebnissen der internationalen PISA-Studie zieht, in der bekanntlich Finnland am besten und Deutschland gar nicht gut abgeschnitten hat. Sie zeigen „klar, dass die Förderung der schwachen Schüler nicht auf Kosten der Förderung starker Schüler gehen muss, wie oft behauptet wird“.
Außerdem hat sich in Finnland gezeigt,
„dass die Lehrer, die zwischen vier und sechs Wochen Weiterbildung jährlich erhalten, bessere Ergebnisse in den Schulen erzielen. Für das finnische System ist weiterhin charakteristisch, dass es für ausländische Schüler bzw. Immigranten vor der Einschulung einen Vorbereitungsunterricht in der Landessprache gibt. Es gibt zudem von Anfang an ein eigenes Sich-heimisch-fühlen-Förderungsprogramm.“
Eine Bemerkung am Rande bezieht sich wieder auf das Fernsehen, dieses Mal auf die Sprache, in der die Filme ausgestrahlt werden:
„Letztlich ist für die gute Leseleistung der finnischen Schüler vielleicht noch eine ganz andere Tatsache von Bedeutung: Da sich bei der geringen Einwohnerzahl von Finnland das Synchronisieren ausländischer Filme nicht lohnt, werden Filme in Englisch, Französisch oder Deutsch im Fernsehen ausgestrahlt, allerdings mit finnischen Untertiteln. Wer die Fremdsprache also nicht gut beherrscht, der muss zumindest dauernd Finnisch lesen, um am Ball zu bleiben. So herum betrachtet muss man bedauern, dass sich bei den gut 100 Millionen Deutschsprachigen in Mitteleuropa das Synchronisieren ausländischer Filme lohnt.“ (362)
Uns Deutschen redet Spitzer auf Grund der PISA-Studie ins Gewissen:
„Die PISA-Studie ist weniger ein Spiegel der Situation der Schulen, als viel eher ein Spiegel des Zustandes der Gesellschaft. Das ist das Beunruhigende an ihr. Ginge es nur darum, dass wir Deutschen in manchen Tests etwas schlechter als andere Nationen abschnitten, hätten wir ein kleines Problem. Weil jedoch die Unterschiede zwischen den Schülern am größten sind; weil dies daran liegt, dass wir viele Kinder mit unseren Bildungseinrichtungen gar nicht wirklich erreichen; weil die Kluft zwischen den Kindern von Arm und Reich nirgendwo so groß ist wie bei uns; und weil wir Einwanderer deutlich schlechter integrieren können als andere Länder, haben wir ein großes Problem.“ (363)
Er nennt auch konkrete Vorschläge, um diese Situation zu ändern:
„Deutsch muss Eingangsvoraussetzung an Grundschulen werden. In den Kindergärten ist dafür zu sorgen, dass Kinder ausländischer Herkunft Deutsch lernen, je früher desto besser. Kinder lernen sehr rasch, sie können bei Kontakt mit einer neuen Sprache bis zum zehnten Lebensjahr diese Sprache fehlerfrei lernen. Je später dieses Lernen geschieht, desto schwerer fällt es, und desto schlechter ist das Ergebnis.“ (364)
Verheerende Folgen für das Lernen in der Schule hat seiner Ansicht nach unter anderem
„die Regel, dass eine Klassenarbeit nur den Stoff der vergangenen sechs Wochen beinhalten darf. Diese Regel stelle man auf den Kopf und führe sie flächendeckend ein, in Schule und Universität. Es wird nichts von dem geprüft, was gerade dran war, sondern alles andere. Bei diesen Randbedingungen lohnt sich das Lernen auf die Prüfung nicht nur nicht, es geht überhaupt nicht! Mit dieser einfachen Änderung werden Schüler und Studenten dazu angehalten, nachhaltig zu lernen und nicht ihre Zeit mit sinnlosem Gepauke zu verschwenden.“ (365)
Auch das Problem der Disziplin muss nach Spitzer bewältigt werden, damit in der Schule gelernt werden kann:
„An vielen Schulen hierzulande mangelt es an Disziplin. Wenn man einen Klassensaal betritt und nicht weiß, ob gerade Unterricht ist oder große Pause, dann stimmt etwas nicht. Wenn Lehrer mit bestimmten Schülern Probleme haben, die Disziplin betreffen, muss es klare Regelungen geben. Die Schüler verlangen geradezu danach. Auch muss es Räume geben, in die sich Schüler während einer Freistunde zurückziehen können, um beispielsweise Hausaufgaben zu erledigen oder sich auf etwas vorzubereiten. Dazu bedarf es in diesen Räumen einer Aufsicht.“ (366)
↑ 4.1.6 Kinder brauchen zum Lernen Lehrerpersönlichkeiten, nicht Computer
Am wichtigsten ist aber die Einsicht, dass das Hauptmedium des Lernen die Persönlichkeit des Lehrers ist. Spitzer sieht die Rolle des Lehrers analog zum Therapeuten in der Psychotherapie:
„Die Psychotherapieforschung hat längst gezeigt, was sich in der Pädagogik erst noch herumsprechen muss: Es kommt nicht auf die Technik an, sondern darauf, ob Therapeut und Klient miteinander klar kommen. Tun sie das, geschieht etwas in der Therapie; ist dies nicht der Fall, geschieht nichts, d.h. findet kein Umlernen, keine Neuorientierung, keine Heilung statt.“
An dieser Stelle möchte ich doch eine Quelle nennen, aus der Manfred Spitzer schöpft, nämlich das Buch „Große Pause. Nachdenken über Schule“ von Marga Bayerwaltes, einer Lehrerin mit langjähriger Erfahrung.
Ihr zufolge
„sieht es in den Schulen der Gegenwart immer noch so aus, dass 20 bis 30 Kinder oder Jugendliche zusammen in einem Klassenraum sitzen und nach vorn auf den Lehrer schauen, der ihnen etwas erzählt. Und in diesem klassischen, fast schon archetypischen Setting menschlicher Wissensvermittlung kommt nun, wie ich meine, immer noch alles auf die Liebe an.
Wenn ein Lehrer Erfolg hat, das heißt, wenn die Schüler gern und gut bei ihm lernen, wenn sie fleißig sind und bereit, sich für bestimmte Aufgaben und Ziele anzustrengen, wenn sie etwas Ungewöhnliches leisten, dann liegt es nach meiner Erfahrung so gut wie nie an irgendwelchen Qualifikationen des Lehrers, sondern immer an der Liebe. Immer steckt hinter solchen Erfolgen ein geliebter Lehrer. Die Kinder, auch die großen, tun es für ihn.“ (367)
Das heißt im Klartext:
„ein guter Lehrer sollte zu allen Zeiten und auch in den Schulen der Zukunft vor allem zwei Dinge unbedingt mitbringen: die Liebe zu Kindern und die Begeisterung für eine Sache.
Lehrer müssen einfach beides haben: ein gutes Herz und ein gut funktionierendes Hirn, Gefühl und Verstand, Warmherzigkeit und Strenge. Jedes zu seiner Zeit. Und die Liebe zu den jungen Menschen wird ihnen sagen, wann es Zeit für das eine und wann es Zeit für das andere ist. …
Über dem Eingang zum Lehrerberuf sollte vielleicht in Zukunft so etwas wie das delphische Erkenne dich selbst stehen, geleitet durch zwei Fragen:
– Willst du wirklich dein ganzes Berufsleben mit (lauten, frechen, anstrengenden) Kindern verbringen?
– Kannst du oder weißt du etwas, das dir selbst so wichtig ist, dass du es Kindern und Jugendlichen immer wieder aufs Neue erklären oder erzählen möchtest?
Und nur wer nach langer und gründlicher Selbstprüfung zweimal laut und deutlich ja gesagt hat, der dürfte hinein.“ (368)
Einen Seitenblick wirft Spitzer auch auf die Frage, ob Kinder zum Lernen einen Computer brauchen.
„In der Grundschule, also den Klassen eins bis vier, liegen die Dinge meiner Ansicht nach recht einfach: Man braucht keinen Computer. Es gilt in diesem Schulabschnitt, ganz grundlegende Fähigkeiten zu erlernen, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Kenntnisse der Lebenswelt (d. h. der die Kinder umgebenden Sachen und Orte). Ebenfalls gelernt bzw. geübt werden die noch wichtigeren Fähigkeiten des Zuhörens und Ausredenlassens, des Konzentrierens auf eine Sache, der Disziplin (weder losreden noch losrennen, wann es einem gerade passt) und des Zusammenarbeitens. Hierfür ist die Person des Lehrers als Vorbild und zugleich als Brennpunkt von Konzentration und Aufmerksamkeit die mit Abstand wichtigste Bedingung. Nicht zu große Klassen, genug Zeit und Geld für Exkursionen in die Umgebung (die Natur und die Kulturschöpfungen) und ganz allgemein die Schaffung einer offenen Atmosphäre sind sicherlich auch notwendig. Der Computer ist es nicht.“ (369)
Selbst in der Unterstufe der weiterführenden Schule ist nach Spitzer in „den so genannten ‚Lernfächern‛, also Erdkunde, Biologie, Geschichte oder Chemie“ ein Buch besser als der Computer:
„Es sollte Spaß machen, in ihm zu lesen, es sollte sich neu anfühlen und neu riechen und damit etwas Besonderes sein. Es sollte gerade nicht Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern wichtige Prinzipien anhand einprägsamer Beispiele vorführen. Wer erst einmal begriffen hat, was ein Bodenschatz oder ein Bruttosozialprodukt ist, der kann sich Informationen hierzu, wenn er sie denn einmal braucht, leicht aus dem Netz besorgen, zumal die Suchmaschinen immer besser und die bereitgestellten Informationen immer detailreicher werden. Wer jedoch noch keine Orientierung über ein bestimmtes Sachgebiet hat, wer die grundlegenden Begriffe nicht kennt, der weiß gar nicht und kann gar nicht wissen, wonach er suchen soll. Daher ist ein verfrühter Einsatz des Internet kontraproduktiv. Man lernt nichts durch die Konfrontation mit unaufbereiteten beliebigen Inhalten.“
Erst recht hält es Spitzer für Unsinn, in der Schule zu lernen,
„wie man in Windows ein Programm aufruft, wie man eine Excel-Tabelle erstellt und daraus eine Balkengraphik macht, wie man in Word einen Brief schreibt oder wie man Text, bunte Bildchen und ein paar langweilige Gags zu einer Präsentation verknüpft“,
denn seines Erachtens ist das
„Erlernen von Anwendersoftware einer bestimmten Firma (und sei sie noch so weltumspannend) etwa so sinnvoll wie das Erlernen der Bedienung von Bohrmaschinen oder Kreissägen einer bestimmten Marke. ‚Der rote Knopf links vorne schaltet das Gerät ein; am gelben stellt man die Geschwindigkeit ein‛, etc. … und in der folgenden Klassenarbeit wird dann nach den Farben der Knöpfe gefragt. – ‚Unsinn‛ wird jeder vernünftige Mensch hier einwenden, mit Recht. Und mit demselben Recht halte ich das Erlernen von Anwendersoftware in Schulen für wenig sinnvoll.“ (370)
Wie viel mehr gelten alle diese Erwägungen für den Einsatz von Computern im Kindergarten!
↑ 4.1.7 Kritik am Religions- und Ethikunterricht bundesdeutscher Prägung
Ein ganzes Kapitel widmet Manfred Spitzer dem schulischen Religionsunterricht. Einerseits findet er es wichtig, sich mit dem Christentum auseinanderzusetzen.
„Wer glaubt, dass für ihn das Christentum nicht maßgeblich sei, da er ja aus der Kirche ausgetreten und auch sonst überhaupt nicht religiös sei, der irrt gewaltig. …
Christliches Gedankengut ist überall in unserer Gesellschaft vorhanden, es wird gelebt, von der großen Mehrheit der Bevölkerung, und unabhängig davon, welches Bekenntnis, wenn überhaupt, im Pass verzeichnet ist. Mit Carl-Friedrich von Weizsäcker oder Karl Rahner muss man feststellen, dass in unserer Gesellschaft sehr viel Christentum steckt, wenn auch viele sich dessen nicht bewusst sind. Es ist wie mit Luft, Leitungswasser oder Strom aus der Steckdose: Man nimmt es erst dann eigentlich wahr, wenn es plötzlich fehlt.“ (371)
Andererseits findet Spitzer scharfe Worte der Kritik am real existierenden Religionsunterricht in kirchlicher Verantwortung.
„Wenn es zutrifft, dass der erwachsene Mensch sein Wertegefüge in der Jugend an Beispielen lernt, die im orbitofrontalen Kortex abgespeichert sind …, und wenn es zutrifft, dass es zur glückenden moralischen Entwicklung des Menschen tausender solcher Beispiele mit größtmöglicher Varianz bedarf, und wenn weiterhin junge Menschen vor allem von Vorbildern und Gleichaltrigen lernen, dann kann der Religionsunterricht der moralischen Entwicklung nicht nur nichts nutzen, er kann ihr auch schaden.“
Das liegt unter anderem daran,
„dass sich religiöse Unterweisung einerseits und Benotung von Leistung und Prüfung andererseits gegenseitig ausschließen. Wenn dann das prinzipiell Unmögliche dennoch irgendwie versucht wird, kann die resultierende Praxis einer wie auch immer verstandenen ‚Werteerziehung‛ nur abträglich sein. Noch einmal: Menschen lernen aus Beispielen, nicht aus Predigten. Diese Beispiele sind nicht die expliziten Lehrinhalte, sondern die Unterrichtspraxis. Wie glaubwürdig ist die gepredigte Toleranz des Priesters in Klasse 11, wenn er in Klasse 3 die Kleinen zum Gang zur Kommunion anleitet (weswegen der katholische Religionsunterricht in der dritten Klasse immer von Pfarrern und nicht von Lehrern oder Lehrerinnen durchgeführt wird)? Wie groß ist die Chance, dass im muslimischen Religionsunterricht tatsächlich Beispiele thematisiert und gelebt werden, aus denen die Schüler die Grundwerte des Grundgesetzes für sich selbst ableiten können?“ (372)
Hier muss ich kritisch anmerken, dass seine Sicht des Religionsunterrichts im Gegensatz zu vielen anderen Erkenntnissen seines Buches nicht auf wissenschaftlichen Analysen, sondern auf negativen Einzelerfahrungen mit diesem Schulfach beruht und dass sein Blick auf den in der bundesdeutschen Wirklichkeit real existierenden Islam nicht differenziert genug ist. Er hat natürlich Recht, wenn er schreibt:
„Muslimischen Religionsunterricht an deutschen Schulen kann es nur unter der Voraussetzung geben, dass der Islam in einer Form unterrichtet wird, die mit dem Grundgesetz vereinbar ist.“
Dann verfängt er sich aber in einem Vorurteil, indem er der Weltreligion Islam eine grundsätzliche Neigung zur Radikalität und Unfähigkeit zur Aufklärung unterstellt, die mit der in Deutschland dominierenden Kultur kaum in Übereinstimmung zu bringen ist:
„Damit, so argumentieren auch letztlich die Kirchen, werde der Islam gezwungen, die Aufklärung gleichsam nachzuholen, die das Christentum bereits durchgemacht hat. Wie wahrscheinlich ist es jedoch, dass eine Weltreligion (die nicht zuletzt aufgrund ihrer Radikalität viele Menschen anspricht und derzeit expandiert) in sich die Aufklärung vollzieht, um in einem kleinen Land der Welt in den Genuss staatlich geförderten Religionsunterrichts zu kommen?“ (373)
Dass man hier durchaus vorurteilsloser und hoffnungsvoller in die Zukunft blicken kann, zeigen die Beispiele, die ich im Kapitel 2 und 5.3 erwähne.
Wie problematisch eine staatlich verordnete religiöse Neutralität sich auswirken kann, zeigt Spitzer übrigens an selbst erlebten Beispielen aus Schulen in den USA, in denen „Weihnachten … nichts Religiöses sein darf“ und mit „weihnachtlichen Nicht-Weihnachtsliedern“ gefeiert wird, die „das religiöse Empfinden von Angehörigen einer anderen Religionsgemeinschaft vermeintlich nicht [verletzen], weil es sich ja um gar keine religiösen Inhalte handelt.“ (374) Ob allerdings die flächendeckende Einführung einer „Religionskunde“ in Deutschland oder eine multireligiöse Erziehung im Kindergarten solche Implikationen haben müsste, darum geht es ausführlich im Kapitel 7.
Einen Ethikunterricht bis zur 7. Klasse lehnt Spitzer ab, wenn er mehr will
„als das Üben von Fähigkeiten…
Wenn … in der 7. Klasse über Werte und Prinzipien, Maximen, Rollen und Normen gesprochen wird, dann ist das etwa so sinnvoll wie das Pauken von grammatischen Regeln mit 5jährigen unter der Annahme, sie würden dadurch das korrekte Sprechen lernen. … Kinder lernen nicht dadurch richtig sprechen, dass sie Grammatik oder Vokabeln pauken. Und genauso wenig lernen sie dadurch richtig handeln, dass sie die zehn Gebote, den kategorischen Imperativ oder das Grundgesetz auswendig lernen. Kinder brauchen Beispiele, nicht Regeln.“
Wichtig ist also, altersentsprechend vom Kindergarten bis zum Konfirmandenalter, „das – immer wieder neue! – Einüben gewaltfreier Konfliktlösungen“ und das Erzählen von „Geschichten über Frau und Mann, Lehrer und Schüler, Vater und Tochter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Käufer und Verkäufer, Großmutter und Enkelsohn, Bruder und Schwester“. Spielerisch sollte
„geübt werden, mit Problemen und Konflikten umzugehen, … anhand fiktiver ‚Fälle‛ aus der Bibel oder dem Koran, der griechischen oder irgendeiner anderen Mythologie. Es muss ja nicht unbedingt Star Trek oder Star Wars sein (darf es aber gelegentlich durchaus, wenn dadurch das Interesse geweckt und die Aufmerksamkeit gefördert wird!).“ (375)
Eine interessante Anregung, wie man erzählerisch mit Stoffen aus der Bibel und dem Koran umgehen kann!
↑ 4.1.8 Der Mensch als auf Religion angelegtes Wesen
Spitzers hirnorganische Sicht auf den Menschen führt ihn übrigens nicht dazu, die Religiosität der Menschen auf Gehirnfunktionen zu reduzieren. Vielmehr ist unser menschliches Gehirn wunderbarerweise auch als Antenne für Gedanken und Empfindungen geeignet, die unser Menschsein transzendieren. Damit wird nicht Gott oder die Wahrheit einer bestimmten Religion bewiesen, aber der Mensch ist von den Fähigkeiten seines Gehirns her als ein auch religiöses Wesen angelegt, das „über Gott nachdenken oder sprechen“ kann.
„Wenn wir uns selbst denken, als endlich, unvollkommen, zeitlich und vergänglich, so müssen wir diese Begriffe auch übersteigen und die Gegenbegriffe denken, das Jenseits der Linie. Es geht damit zugleich auch um Unendlichkeit, Güte und Sterblichkeit. Und wenn wir uns zuweilen klein, hässlich, verlogen und unversöhnlich vorkommen, so müssen wir dennoch auch Größe, Schönheit, Wahrheit und Versöhnung mitdenken. Unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft kann uns dann vielleicht sogar dazu veranlassen, diesen Gedanken mehr Raum zu geben. Unsere Sehnsucht nach Erfüllung und Frieden, nach einem Lächeln, nach Aufgehobensein, kann uns leiten bei der Suche nach Gedanken, die wir auch nur entdecken und nicht erfinden können. Jeder kommt darauf, denkt er nur klar und lange genug über sich selbst nach.“ (376)
↑ 4.1.9 Kinder brauchen Strukturen und Geschichten, Metaphern und Mythen
Abschließend fragt Manfred Spitzer:
„Wie bringen wir es fertig, den Kindern die richtigen Inhalte beizubringen?“ (377)
„Halten wir fest: Wenn es um das Lernen geht und wenn wir das Lernen verbessern wollen, dann folgt aus der Tatsache, dass das Gehirn immer lernt, eines: Es sind die Lebensbedingungen insgesamt und nicht die Lehrpläne, die festlegen, was gelernt wird.
Wenn wir unseren Kindern sagen: ‚Mach‛ Deine Hausaufgaben!‛, ‚Iss Deinen Teller leer!‛, ‚Kipple nicht mit dem Stuhl!‛, ‚Rede nicht immer dazwischen!‛, ‚Sei doch mal vernünftig!‛ etc., dann wird das Kind lernen, dass es jemanden vor sich hat, der immer mit tatsächlich oder stimmlich erhobenem Zeigefinger mit ihm schimpft. Der Rest, also der propositionale Gehalt der Einzelaussagen, wird zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder herausgehen. Gelernt wird, wie schon vielfach betont, das Allgemeine. Was dieses Allgemeine gerade ist, auf welcher inhaltlichen Ebene also gelernt wird, legt nicht der Sprecher (oder dessen Absicht) fest, sondern der Zustand des Hörers.“ (378)
Wichtig ist … für die Diskussion um Bildung, dass klar sein muss, worum es beim Thema Bildung geht. Es geht nicht um das Festlegen von Inhalten, die zu vermitteln sind. Es geht vielmehr um die Schaffung von Lebensbedingungen, unter denen das Richtige überhaupt erst gelernt werden kann.“ (379)
Konkret brauchen Kinder „Strukturen“, denn
„bei wenig äußerer Struktur [kann] eine innere gar nicht entstehen. Dies mag ein Grund dafür sein, dass kleine Kinder – mitunter wörtlich – nach Struktur geradezu schreien.
Da wir nie genau wissen und meist gar nicht wissen können, was ein Kind gerade lernt, d. h. auf welcher Abstraktionsebene sein Gehirn gerade allgemeine Strukturen aus dem Gewühl der Sinne extrahiert, muss man eine möglichst große Varianz für das Kind fordern. Einseitigkeit der Erfahrung wird Einseitigkeit des Denkens produzieren.“
Außerdem brauchen Kinder „Geschichten“ (380) und „Metaphern“, also „Strukturen in unserem Langzeitgedächtnis, die uns beim Zurechtfinden in der Welt helfen“, und auch „Mythen“ sind für sie wichtig:
„Mythen drücken Emotionen aus, sagen uns, was wichtig ist und was nicht, stellen somit Bewertungen und Werte dar. Sie zeigen Konflikte, unlösbare Probleme und die ganze Spielbreite unserer Möglichkeiten, mit so etwas umzugehen.
Kinder fragen unermüdlich, wo wir herkommen, ob das Weltall aufhört (und wenn ja, was dahinter ist, bzw. wenn nein, wie man sich das vorstellen soll), wie es angefangen hat, was nach dem Tode ist und wie alles früher war. Behalten wir diese Neugier. Letztlich treibt sie auch uns um, die wir glauben, wir hätten uns solche Fragen mit Blick auf den Einkaufszettel, die Steuererklärung oder die Hypothek abgewöhnt.“ (381)
↑ 4.2 Verschiedene Gesichtspunkte zur kindlichen Entwicklung
Zur kindlichen Entwicklungspsychologie fand ich Denkanstöße in einem Aufsatz und einem Buch, die jeweils von einem anderen entwicklungspsychologischen Ansatz ausgehen, aber dennoch zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen. Danach werfe ich einen Seitenblick auf die spezielle Frage, wie kleine Kinder in verschiedenen Kulturen „sauber“ werden, und beschäftige mich zielgerichtet mit der Frage der Abstraktionsfähigkeit von Kindergartenkindern in puncto Religion.
↑ 4.2.1 Eriksons Entwicklungskrisen und die religiöse Entwicklung im Vorschulalter
Der evangelische Religionspädagoge Frieder Harz geht in seinem Aufsatz „Welche Rolle spielen die Entwicklungskrisen Eriksons für die religiöse Erziehung im Vorschulalter?“ (382) von den beeindruckenden Forschungsergebnissen
„der kognitiven Entwicklungspsychologie [aus], die uns schon die Säuglinge als ‚kompetente Lerner‛… vorstellen. Von Geburt an gestalten die Kinder aktiv ihre Lernerfahrungen, entscheiden selbst, wem sie sich zuwenden, machen selbst ihre Entdeckungen. Der Aufbau ihrer Vorstellungswelt ist ihr eigenes Werk und kann nicht von außen vorangebracht oder gar gesteuert werden. Das pädagogische Interesse wendet sich den Zeitfenstern zu, in denen bestimmte Lernfähigkeiten ihren Höhepunkt erreichen und entweder genutzt werden oder mangels entsprechender Angebote ungenutzt verstreichen.“
Er betont die Wichtigkeit der „zu fördernden Basiskompetenzen…: Selbstwertgefühl, positives Selbstbild, das Erleben eigener Autonomie, Fähigkeit zur Empathie und Perspektivenübernahme“ und vor allem auch der „Resilienz des Kindes: gemeint ist seine Fähigkeit, besondere Herausforderungen, Umbrüche, bedrängende Situationen in seinem Leben zu meistern.“ (383)
Um Kindern verschiedenen Alters im Kindergarten Geschichten zu erzählen (wobei Harz vor allem von biblischen Geschichten ausgeht), und zwar so, „dass die Kleinen etwas davon haben und es den Großen nicht langweilig wird“, empfiehlt Harz „das Konzept einer konsequenten Elementarisierung…, die das Zusammenfinden von kindlichen Interessen und biblischer Botschaft in einem klaren roten Faden der Erzählung gestaltet, der zu einem einfachen, gut überschaubaren Erzählverlauf führt. Dabei sind die von Erikson erfassten ersten Krisen eine unverzichtbare Hilfe.“ (384)
In der ersten Lebensphase geht es nach Erikson um den Aufbau von Grundvertrauen, das sich gegen ein Grund-Misstrauen ins Leben durchsetzen muss; hinzu kommt in einer zweiten Phase die Entwicklung von Autonomie im Gegensatz zur Erfahrung von Scham und Zweifel und in einer dritten der Konflikt zwischen Initiative und Schuldgefühl (385).
„Vertrauensgeschichten erzählen davon, wie Menschen sich einer Herausforderung stellen und sich darin mit der Zusage von Gottes Schutz und Begleitung getragen wissen. Dieses Thema spricht Kinder an und es schlägt die entscheidende Brücke zwischen dem Geschehen damals und dem Erleben der Kinder heute. Sie leben mit den Jüngern im Sturm auf dem See mit und lassen sich von Jesu Worten beruhigen: Warum habt ihr denn so viel Angst? Ich bin doch da! – so wie Eltern ihr Kind trösten, das nach einem schweren Traum mitten in der Nacht aufwacht. Entsprechendes gilt von Geschichten, in denen Kleinen, Unscheinbaren besondere Wertschätzung zuteil wird und sie in ihrem Können Beachtung finden. Mit Erikson lautet das so: ‚Man muß den Wunsch des Kindes, auf eigenen Füßen zu stehen, unterstützen, damit es nicht dem Gefühl anheim fällt, sich vorzeitig und lächerlich exponiert zu haben‛. Solche Botschaften stehen dann am Höhepunkt auch noch so kurzer biblischer Nacherzählungen und formulieren, was die Gottesbeziehung des kleinen Kindes bereichert: Du bist für Gott ganz wichtig! Gott ist dein Freund! Gott hält zu dir! Gott hat mit dir viel vor! Die älteren Kinder können leicht die ihnen angemessenen Differenzierungen finden, etwa in Dialogen, die sie selbst weiterspinnen.
Entgegen den in der Praxisliteratur dominierenden lediglich methodischen Ideen zum Ausschmücken und Basteln lässt die Orientierung an Eriksons Phasen im Sinne didaktischer Fragestellungen präzise nach Inhalten und Zielen der biblischen Geschichten für Kleine fragen. Zu diesen Grundthemen gehört auch die dritte Krise, Initiative gegen Schuldgefühl – mit Geschichten von Aktivität, Mut, Aufbruch, Ideen und dem Misslingen, Scheitern, schmerzlich an die eigenen Grenzen Stoßen und in und mit diesen Erfahrungen von Gott angenommen zu sein.“ (386)
Zum Thema „Lieber Gott“ und „böser Gott“ sagt Harz:
„Kinder reden gewöhnlich ganz unbefangen vom ‚lieben Gott‛. Gott und Jesus sind ihre Freunde, von denen sie sich auch viel erwarten, v. a. die Erfüllung ihrer Wünsche. Immer wieder wurde von Seiten der Religionspädagogik vor einer Vereinseitigung gewarnt, die nur das Angenehme, Freundliche mit Gott in Verbindung bringt. Die Folgen im späteren Kindesalter und dann v. a. im Jugendalter sind unübersehbar: In den ‚Warum-Fragen‛ nach den Ursachen von Leid und Not zerbricht der Kinderglaube an den freundlichen Gott. Die religionspädagogische Aufgabe, die sich daraus ergibt, lautet also: Wie können schon kleine Kinder in der pädagogisch gebotenen Behutsamkeit Abschied nehmen von einem Gottesbild, das nur helle und freundliche Züge hat? Wie können sie auch etwas von dem unverständlichen, fremden, dunklen, unzugänglichen Gott erfahren? Andererseits aber bleibt doch auch die Forderung bestehen, dass Gott für die Kinder verlässlich und vertrauenswürdig bleiben muss.“ (387)
Harz plädiert dafür, Kindern
„inmitten menschlicher Beziehungen eine Gottesbeziehung zu eröffnen, in der die hellen und die dunklen Seiten an Gott eine glaubwürdige Verbindung eingehen können – in der das Mutmachende, Vertrauenerweckende letztlich die Botschaft ist, in der sichtbar ist, wie der Glaube an Gottes Liebe auch andere Erfahrungen zu integrieren vermag. Beides gehört zusammen, und auch damit sind wir wieder nahe bei Erikson: Urvertrauen gegen Urmisstrauen, Autonomie gegen Scham und Zweifel, Initiative gegen Schuldgefühl. Erikson spricht von einem Balanceverhältnis, in dem aber jeweils der erstgenannte Pol dominieren soll.“ (388)
↑ 4.2.2 Arten des Selbstempfindens kleiner Kinder nach Daniel Stern im Kinderkrippenalltag
Unter dem Titel „Wie Kinder kommunizieren“ haben Marianne Brodin und Ingrid Hylander, zwei schwedische Vorschulpsychologinnen, „Daniel Sterns Entwicklungstheorie, die auf neuer Säuglingsforschung basiert, in die pädagogische Praxis“ in Krippe und Kindergarten umgesetzt (389). Sie gehen davon aus, dass frühere entwicklungspsychologische Ansätze daran krankten, dass sie einen Gegensatz zwischen der emotionalen und der intellektuellen Entwicklung des Kindes konstruierten, vor allem aber davon ausgingen, dass Kindern, je kleiner sie sind, desto mehr fehlt.
„Im Zusammenhang mit jüngeren Kindern wird jetzt der Begriff der »Kompetenz« betont. Das Kind wird nicht länger als defizitäres Wesen, sondern als kompetenter, neugieriger und wissbegieriger kleiner Mensch betrachtet. Gefühl und Verstand werden unter dem Aspekt der wechselseitigen Beeinflussung gesehen.“ (390)
Zum Beispiel konnte der Fehlschluss, dass das Kind „in seinen ersten zwei Lebensmonaten eine kontaktlose (autistische) Phase habe“, inzwischen dadurch korrigiert werden, dass die Forschung ein „verändertes Verständnis über die unterschiedlichen Abstufungen von Wachphasen des Kindes“ entwickelte und nunmehr „der Säugling in seiner aktivsten Phase untersucht werden kann“. Insgesamt zeigt die Forschung
„dass Kinder bereits vom allerersten Augenblick an Kontakt suchen. Schon der Säugling ist eine Persönlichkeit. Sein Temperament, das sich im Verlauf seines Lebens kaum verändert, unterscheidet ihn bereits von anderen Kindern. Das Kind hört, sieht, riecht, schmeckt und erinnert sich. Es setzt sich von Anfang an in Beziehung zu anderen Menschen. Heute wird davon ausgegangen, dass es ein Bedürfnis des Kindes ist, vom ersten Moment an den Dingen einen Sinn zu verleihen und seine Umwelt zu verstehen. Ein anderes Bedürfnis besteht darin, aktiv Kontakte herzustellen und Interaktionen zu suchen. Dem kleinen Kind wird heute Kompetenz und Erkenntnisinteresse zugeschrieben.“ (391)
Früher sah die Fachliteratur
„das Neugeborene als symbiotisches Wesen, das mit seiner Mutter verschmolzen ist und keine Vorstellung von der Begrenzung des eigenen Selbst hat. Zwischen dem »Ich« und dem »Du« verläuft keine Grenze. Das Kind hat noch keinen Begriff von der eigenen körperlichen Begrenzung und von seinen eigenen Gefühlen. Der Entwicklungsprozess verläuft vom totalen, paradiesischen »Einssein« zur wachsenden Unabhängigkeit und schließlich existenziellen Einsamkeit.“
Von dieser Vorstellung müssen wir Abschied nehmen.
„Nach Stern sind wir einsam geboren und streben nach menschlichen Beziehungen, die immer intensiver und nuancierter werden. …
Er vertritt die Annahme, »dass Säuglinge von Anfang an die Realität erleben«. Sie sind durchaus in der Lage, zwischen sich und ihrer Umgebung zu differenzieren. »Ihre subjektiven Erfahrungen unterliegen keinen wunsch- oder abwehrbedingten Verzerrungen …« Der Säugling erlebt sich und den anderen als zwei von einander vollständig getrennte Einheiten. Wie sonst sollte der intensive intersubjektive Austausch, der so charakteristisch für diese Periode ist, erfolgen? Ergebnisse der Säuglingsforschung zeigen, dass sich nur wenige Monate alte Kleinkinder bereits so verhalten, als ob sie über ein Zentrum, einen Kern verfügen. Das kleine kompetente, sich selbst empfindende Wesen, mit dem die Mutter scheinbar schon lange heimlich in Beziehung stand, gibt sich zu erkennen.“ (392)
Daniel Stern „beschreibt fünf verschiedene Arten des Selbstempfindens: das auftauchende Selbst, das Kern-Selbst, das subjektive Selbst, das verbale Selbst und das erzählende Selbst“. Es handelt sich nicht um Phasen, die einander ablösen, sondern um nacheinander einsetzende Prozesse, durch die das Kind seine Kommunikationsbereiche erweitert, zwischen denen es dann hin- und herwechseln kann. Brodin und Hylander haben diesen Kommunikationsbereichen in ihrem Buch „eigene Bezeichnungen“ gegeben und beschreiben mit ihrer Hilfe „die pädagogischen Konsequenzen für den Krippen- und Kindergartenalltag“:
„Im Kapitel »Der Bereich des auftauchenden Selbst« beschreiben wir den 1. Bereich (Zusammensein), im Kapitel »Der Bereich des Kern-Selbst« den 2. (Interaktion), im Kapitel »Der Bereich des subjektiven Selbst« den 3. (Übereinstimmung) und im Kapitel »Die Bereiche des verbalen Selbst und des erzählenden Selbst« den 4. und 5. Bereich (Sprechen und Erzählen).“ (393)
Um neugierig auf das Buch zu machen, picke ich einzelne Gedankengänge heraus, etwa zum Bereich der Übereinstimmung:
„Soll ein Kind sich nach den Signalen des Erwachsenen richten, so setzt das eine gemeinsame positive Beziehung voraus. Das Kind muss sich in dieser Beziehung aufgehoben, verstanden und akzeptiert fühlen. Zu Kindern, die sich selbst schlecht regulieren können, haben Erzieher häufig kaum eine Beziehung. Eine gute Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit diesen Kindern wäre, die Aufmerksamkeit auf eine dritte spannende Sache zu lenken und ein gemeinsames Interesse zu entdecken. Das Herstellen und das Erleben von positiven, gemeinsamen Erfahrungen geben Erwachsenem und Kind ein Gefühl von emotionaler Übereinstimmung. „]Dieses bildet eine wichtige Voraussetzung dafür, um auch in Krisensituationen Übereinstimmung erzielen zu können.“ (394)
Interessant fand ich auch folgende Beobachtung:
„Man könnte als Schlussfolgerung formulieren, dass das Spiel der Mädchen mit Übereinstimmung beginnt, während die Jungen im Spiel Übereinstimmung herstellen.“ (395)
Für mich persönlich fand ich einen anderen Abschnitt aus dem gleichen Bereich lehrreich, und zwar im Blick auf meinen Kontakt zu der seit einem Jahr bestehenden Krippengruppe in unserer Kindertagesstätte. Alle zwei Wochen bin ich auch bei den kleinen „Wichteln“ mit meiner Gitarre zu Gast, um mit ihnen Lieder zu singen, und ich spüre, dass es längere Zeit braucht als bei den älteren Kindern in den regulären Kindergartengruppen, bis sie sich an mich gewöhnt haben. Einzelne Kinder halten anfangs die Gegenwart eines fremden Mannes im Raum nur aus, wenn sie auf dem Schoß der Erzieherin am anderen Ende des Raumes sitzen. Brodin und Hylander schreiben:
„Die Entdeckung des Innenlebens ruft bei dem Kind Verunsicherung gegenüber einem unbekannten Menschen hervor. Ein neues Gesicht ist nicht länger nur interessant und spannend, es weckt auch Fragen. »Was ist das für eine Person? Was wird sie machen? Was geschieht nun? Ist das gefährlich?« Das Phänomen, dass Kinder nach dem ersten halben Lebensjahr ängstlich auf fremde Menschen reagieren, kennen alle. Wir sprechen von der Sechsmonats- oder Achtmonatsangst (in Deutschland vom Fremdeln, Anmerkung der Übersetzerin). Die bisherigen Erklärungsansätze gingen davon aus, dass Kinder erst ab diesem Zeitraum anfangen, fremde Menschen von vertrauten zu unterscheiden. Heute wissen wir, dass Kinder sehr viel früher Menschen, die ihnen nahe sind, erkennen. Uns ist auch bekannt, dass Angst in diesem Zusammenhang ein irreführender Begriff ist, da er der natürlichen Reaktion vor fremden Menschen nicht genug Rechnung trägt. Neugierde und Scheu paaren sich mit dem Gefühl des Abwartens.
… In der Begegnung mit einem fremden Menschen ist es wichtig, sich schnell ein Bild von ihm zu machen. Es ist gut zu wissen, wer das ist, dem man da begegnet, und welche Absichten er hat. In einer Kindergruppe kann deshalb der Austausch von Personal äußerst schwierig sein. Viele Kinder stehen mit großen Augen abwartend da, wenn ein neuer Erwachsener in die Gruppe kommt. Zu Beginn akzeptieren sie keine zu große Nähe: »Wer ist das? Kommt die jetzt immer? Was will die von mir?«, sind Fragen, auf welche die Kinder Antworten haben möchten.“ (396)
Auch zum Bereich des Erzählens sind in Brodins und Hylanders Buch gute Anregungen zu finden:
„Der Begriff von Zeit, das Einordnen von Ereignissen in einen zeitlichen Verlauf, spielt eine zentrale Rolle beim Erzählen. Setzt es doch beim Erzähler die Fähigkeit voraus, sowohl zeitlich nach vorn schauen zu können als auch einen Überblick über die Reihenfolge der Ereignisse zu haben. Wann ist etwas geschehen und welche Ereignisse führten zu bestimmten Resultaten? Durch die Struktur, die das Erzählen schafft, werden die Welt, man selbst und andere Menschen immer besser begreif- und vorausschaubar.
… Es scheint so zu sein, als ob Kinder, die in der Lage sind, ihre emotionalen Erlebnisse in einen Bedeutungszusammenhang zu stellen, es leichter haben, mit schweren Erlebnissen in ihrer Kindheit fertig zu werden. Der norwegische Psychologe Magne Raundalen, der vor allem mit Kindern, die an schweren Kriegserlebnissen leiden, arbeitet, ist der Auffassung, dass es für diese am schlimmsten sei zu hören, dass Krieg sinnlos ist. Es ist leichter, sich mit Tod, einem schweren Unglück oder großen Leiden zu versöhnen, wenn es einen Sinn dafür gibt, d.h., wenn das Geschehen in einen größeren Sinn gebenden Zusammenhang gestellt werden kann. Der Verweis auf das Schicksal oder Gottes Wille kann einigen vielleicht auch dabei helfen.“ (397)
Sehr lesenswert ist das Kapitel über die Rettung des Selbstgefühls, wenn man bei einem Kind durch eine Ermahnung ein Schamgefühl ausgelöst hat.
„Der Kontakt ist abgebrochen. Das Schamgefühl ist verknüpft mit einem Gefühl von Minderwertigkeit und beeinflusst so das Selbstgefühl.
… für einen Teil der Kinder kann das Empfinden »nichts wert zu sein« so stark werden, dass sie einen Weg finden müssen, um sich zu schützen. Sie können weder den Blick senken und sich schämen noch dem ärgerlichen und kritischen Blick des Erziehers begegnen. Es ist, als ob sie der Situation ganz ausgeliefert sind, die über sie hereingebrochen ist. Die Welt erscheint als ein einziges Chaos von Gefühlen, in dem Angst und Panik vorherrschen. Sie schauen hartnäckig weg oder irren mit ihren Blicken unruhig umher, halten sich die Ohren zu, beginnen mit lauter, hoher Stimme unaufhörlich irgendwelche Texte stereotyp zu wiederholen oder lachen dem Erwachsenen direkt ins Gesicht. Es ist ihre einzige Möglichkeit, ihr bedrohtes Selbstgefühl vor dem Angriff des zerstörerischen Schamgefühls zu schützen. …
Kinder, die sich so verhalten, brauchen viele Erfolgserlebnisse. Das Gefühl von Stolz, etwas zu können, muss an die Stelle des Schamgefühls treten. Sie brauchen Lob und Akzeptanz. Beides kann spielerisch in Interaktionen und in Situationen der Übereinstimmung vermittelt werden. …
Oft versöhnen humorvolle Kommentare. Man kann zusammen lachen – es ist alles nicht so schlimm. Kritik, mit Humor vorgetragen, verletzt das Selbstwertgefühl nicht so stark. Das Auftauchen des Schamgefühls kann auf diese Weise verhindert werden. Ein »Gesichtsverlust« findet nicht statt.“ (398)
↑ 4.2.3 Laurie Boucke: Beim Sauberkeitstraining für Säuglinge von anderen Kulturen lernen
Auf ein bemerkenswertes Buch von Laurie Boucke „für Eltern, werdende Eltern, Großeltern, Kindermädchen und jeden anderen…, der sich dafür interessiert, wie man liebevoll und geduldig zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem Baby auf die eigenständige Sauberkeit hin arbeitet“ (399), stieß ich durch unsere am Anfang dieses Jahres geborene Enkelin bzw. ihre Eltern: „TopfFit! Der natürliche Weg mit oder ohne Windeln“. Es ist für westlich geprägte Menschen schwer zu glauben, dass bereits Säuglinge ihren Eltern signalisieren können, dass sie Pipi machen müssen, aber unsere Enkelin hat es uns bewiesen. Dann wird sie ins Bad getragen und über dem Waschbecken oder der Toilette abgehalten, und – wenn Mama oder Papa, Oma oder Opa das Signal richtig verstanden haben – erledigt sie ihr Geschäft. „Das Abhalten basiert auf einer Art des Ausscheidungstrainings, die in großen Teilen Asiens, des ländlichen Subsahara-Afrikas und Südamerikas angewendet wird“ (400), schreibt Laurie Boucke. Ihre älteren Kinder erfuhren „konventionelles westliches Sauberkeitstraining“.
„Ich lernte die Grundlagen einer alternativen Technik von einer Dame aus Indien, die bei uns zu Besuch war. Sie war entsetzt, als ich ihr erzählte, wie wir das Abfallthema behandeln und erklärte mir, wie man damit ‚zu Hause‛ in ihrer Kultur umgeht. Ich war skeptisch, als sie mir erzählte, dass es keine Notwendigkeit gibt, ‚die Tücher‛ für einen Säugling zu benutzen, es sei denn, er ist ‚krank am Bauch‛, fiebert oder nässt nachts oft das Bett. Ich war schon mehrmals in Indien gewesen und hatte gesehen, wie die Familien vor allem auf dem Land ihre Babys für die Ausscheidungen abhielten, aber hatte nicht viel Aufmerksamkeit darauf verwendet. Wie viele andere nahm ich fälschlicherweise an, dass Menschen in den Industrienationen diese Technik nicht nutzen können.
Ich bat also meine neue Freundin mir mehr zu erzählen und mir beizubringen meinen Sohn zu halten und zum Pipimachen zu veranlassen, was sie freudig und mühelos tat. Ich beobachtete gebannt die Kommunikation zwischen ihr und meinem winzigen, 3 Monate alten Sohn, der irgendwie instinktiv wusste, was sie von ihm wollte. Ich kann den Austausch und das unmittelbare Verstehen zwischen ihnen – einer Fremden und einem Säugling – nur als eine wunderbare Entdeckung bezeichnen.
Ich nutzte die Technik, die sie mir zeigte, modifizierte sie etwas und passte sie dem westlichen Lebensstil an – und empfand sie dem konventionellen Windel-zu-Topf-Training gegenüber weit überlegen. Von dem Tag an, als ich begann, mit meinem 3 Monate alten Sohn zu arbeiten, brauchte er kaum mehr eine Windel, tags und nachts. Er war mit 18 Monaten tagsüber größtenteils trocken und vollständig trocken und sauber mit 25 Monaten. Aber viel wichtiger als frühes Saubersein waren die Nähe, die Bindung und die Kommunikation, die wir erlebt hatten.“ (401)
Hier ist nicht der Ort, eingehend mit der „TopfFit-Methode“ vertraut zu werden. Nur einige Gedankenanstöße möchte ich geben:
„Jedes Mal, wenn ein Baby käckert und oft, wenn es pinkelt, muss etwas getan werden. Eltern können dieses ‚Etwas‛ unmittelbar vor dem Ereignis tun oder irgendwann danach. In jedem Fall erfordern die Ausscheidungen Aufmerksamkeit, Zeit und Energie. Es ist eine Frage der persönlichen Vorlieben, wie Eltern sich entscheiden, mit dieser Situation umzugehen. …
Manche Menschen glauben, dass es lediglich für die Eltern und Betreuer bequemer sei, wenn sie dem Baby helfen seine Windel nicht nass oder schmutzig zu machen, und dass es ‚viktorianisch und repressiv‛ sei. Die Leser dieses Buches werden feststellen, dass nicht einer der Erfahrungsberichte über die TopfFit-Methode als einer ‚bequemen‛ Methode spricht, und dass diese Behauptung auch sonst in diesem Buch nicht aufgestellt wird. Es ist wiederholt betont worden, dass Eltern und Betreuer hingebungsvoll, eifrig, geduldig und fleißig sein müssen, um mit dem Baby eng zusammen zu arbeiten. Zugegeben, Mütter wissen es zu schätzen, keine Windeln säubern zu müssen, aber es ist auch wohltuend für das Baby, da es weit hygienischer und angenehmer ist, nicht in einer schmutzigen Windel zu sitzen. …
Das Wort ‚repressiv‛ hat damit zu tun, etwas aus seinem bewussten Geist auszuschließen. Dieses Buch bezieht sich wiederholt auf die Stimulierung und Ermutigung von Babys Bewusstheit bezüglich seiner Ausscheidungen und auch auf die symbiotische Beziehung gegenseitigen Nutzens, die sich zwischen Baby und Betreuer entwickelt. Unabdingbare Elemente dieser nahen Beziehung sind Bonding, Intimität, Kommunikation, Sorge, Geduld und Respekt.“ (402)
Ein Missverständnis wäre es, die Methode der „Windelfreiheit“ mit einer zwanghaften Erziehung im Sinne von Freuds Analitäts-Konzept zu verwechseln:
„Sigmund Freuds berühmtes aber veraltetes Postulat, frühes Sauberkeitstraining führe zur Entwicklung der ‚analen Charakterzüge‛ wie übertriebener Ordentlichkeit, Reinlichkeit und Geiz, wurde nie bewiesen. Die Theorie ist gutes Futter für Klatsch, aber auch nicht mehr. Der Einfluss von Sauberkeitstraining auf die Psyche ist bestenfalls umstritten, und viele Psychologen glauben, dass Freuds Liste der Charakterzüge die Nebenprodukte anderer Erziehungsmethoden sind. In jedem Fall bezieht sich seine Theorie auf eine gänzlich andere, sehr harsche Methode des frühen Sauberkeitstrainings, die in diesem Buch nicht empfohlen wird.“ (403)
Auch bestimmte in der Schulmedizin verbreitete anatomische Annahmen müssen offenbar korrigiert werden:
„Ärzte und Medizinbücher in den westlichen Ländern sagen normalerweise aus, dass die Schließmuskeln im Alter von 20 bis 24 Monaten heranreifen. Hauptsächlich auf dieser Grundlage lehnen sie das Konzept ab, vor dem Alter von einem oder sogar zwei Jahren mit dem Töpfchentraining zu beginnen. Was sie jedoch nicht erwähnen ist, dass ihre Zahl von 20 bis 24 Monaten das Extrem repräsentiert – die längste Zeit, die diese Muskeln brauchen, um sich voll auszubilden – und nicht den Durchschnitt. Sie beziehen die vielen Babys nicht ein, deren Muskeln sich vor 20 oder 24 Monaten entwickeln. Sie betrachten die Tatsache nicht, dass Säuglinge in der Lage sind, Urin und Stuhlgang auf Assoziation mit einem Signal hin loszulassen. Auch versagen sie darin, gesellschaftliche Faktoren wie Akkulturation, Unterstützung, elterliche Hingabe und Lebensstilwahl zu berücksichtigen.
Eine richtigere Feststellung ist, dass die Schließmuskeln bei regelmäßiger Übung die Entwicklung mit 12 bis 24 Monaten abschließen können, wobei 18 Monate das durchschnittliche Alter ist, in dem ein Kind sauber sein kann, aber noch manchmal erinnert werden muss und gelegentliche Unfälle vorkommen. Wie mit allem im Leben gibt es immer Ausnahmen von der Regel. Einige Babys erreichen vollständige Kontrolle, bevor sie 12 Monate alt sind, während andere länger als 24 Monate brauchen.“ (404)
„Die westliche Medizin lehrt, dass Kinder weder physisch noch psychisch bereit sind, mit dem Sauberkeitstraining zu beginnen, bevor sie nicht mindestens 18 Monate (Europa) oder zwei bis drei Jahre (Vereinigte Staaten) alt sind. Beide missachten dabei Milliarden von Familien auf der ganzen Welt. In anderen Gesellschaften sind elterliche Kommunikation, Erwartungen, Training und Führung die Schlüssel zu Bereitschaft und Erfolg.
Man könnte argumentieren, dass Säuglinge nicht bereit sind für konventionelles Sauberkeitstraining, und das stimmt – in dem Sinne, dass ein Säugling nicht ‚Pipi‛ oder ‚A-A‛ sagen kann, nicht zum Töpfchen laufen und sich darauf setzen kann usw. Aber diese Vorbedingungen sind für Säuglinge irrelevant. Eine Mutter meinte: ‚Das ist, als würde man sagen, ein Baby ist nicht bereit laufen zu lernen, bevor es nicht seine Schuhe zubinden kann.‛ “ (405)
„Tatsache ist, dass ein Baby ein wenig Kontrolle über Wasserlassen und Stuhlgang hat und dass diese Fähigkeit sich mit Hilfe einer aufmerksamen Betreuungsperson über die Monate verbessert, bis völlige Schließmuskel-Kontrolle erreicht wird.
Bedeutet die Tatsache, dass ein Baby sich nicht selbst füttern kann, dass wir es nicht füttern sollten? Bedeutet die Tatsache, dass ein Baby sich nicht selbst anziehen kann, dass wir es nicht in saubere Kleidung hüllen sollten?
Bedeutet die Tatsache, dass ein Baby sich nicht selbst die Windeln wechseln kann, dass wir es nass und schmutzig lassen sollten? „]Die Antwort auf diese und ähnliche Fragen ist natürlich nein. Warum dann sollten wohlwollende Eltern kritisiert werden, wenn sie die Ausscheidungskommunikation nutzen und auf die Ausscheidungsbedürfnisse ihres Babys schon in einem relativ jungen Alter liebevoll eingehen?“ (406)
Wir mögen Laurie Bouckes Konzept für verrückt halten. Aber ist es nicht weitaus verrückter, die ersten kritischen oder sensiblen Perioden verstreichen zu lassen, in denen das Baby durch regelmäßiges Üben eine Vertrautheit mit den eigenen Ausscheidungen erwerben kann? Wir lehren es stattdessen, dass es normal sei, in die Windel zu machen, und es wird sich daran
„gewöhnen nass zu sein und seine natürliche Abneigung gegen dieses Gefühl verlieren.“ (407)
Diese Gewöhnung müssen wir dem Kind dann mit zwei bis drei Jahren wieder mühsam abtrainieren. Ganz zu schweigen von den Windelbergen und sonstigen Umweltbeeinträchtigungen, die wir auf diese Weise verursachen… (408)
↑ 4.2.4 John M. Hull: Mit Kindern über Gott reden
Können kleine Kinder etwas mit einer abstrakten Vorstellung wie „Gott“ anfangen? John M. Hull beschäftigt sich einem „Ratgeber für Eltern und Erziehende“ unter der Titel „Wie Kinder über Gott reden“ mit Kindern als kleinen Theologen:
„Den theoretischen Hintergrund dieser kleinen Untersuchung bilden die verschiedenen Hauptrichtungen der Sozialwissenschaft. Da ist zunächst das Piagetsche Stufenmodell der kognitiven Entwicklung des Kindes. Die immer wieder gehörte Behauptung, Kinder könnten sehr viel mehr, als man nach diesem Modell von ihnen erwarten dürfte, ändert nichts daran, dass das Werk Jean Piagets und seiner Nachfolger einen der wichtigsten Beiträge zur Erforschung der kindlichen Entwicklung darstellt. Piaget hat immer wieder betont, dass die sozio-genetische Entwicklung der Intelligenz zwar grundsätzlich dem von ihm angenommenen Stufenverlauf folgt, dass sie dabei jedoch entscheidend von kulturellen Faktoren beeinflusst wird, vor allem auch vom familiären und schulischen Umfeld. Es ist gut möglich, dass zum Beispiel Kinder, die in einer modernen europäischen Stadt aufwachsen, die einzelnen kognitiven Stufen sehr viel rascher durchlaufen als noch vor wenigen Jahrzehnten oder auch heute die Kinder in ländlichen Gebieten.“ (409)
Außerdem bezieht sich Hull unter anderem auf James W. Fowlers „Theorie der Glaubensentwicklung“, Lawrence Kohlbergs „Psychologie der Moralentwicklung“ und Fritz Osers „Untersuchungen zur Entwicklung des kindlichen Nachdenkens über Gott“. Von Donald W. Winnicott ließ er sich zur „Vorstellung von einem »intermediären Raum« oder »Übergangsraum«“ anregen.
„Äußerst wichtig für die Interpretationen in der vorliegenden Studie, in der es ja um den Platz geht, den religiöse Gespräche im Leben von kleinen Kindern einnehmen, war die psychoanalytische Theorie der Objektbeziehung. Die religiöse Sprache wird durch die kognitive Entwicklung geformt, doch ihre entscheidenden Impulse erfährt sie durch den emotionalen Kontext des Familienlebens.“ (410)
Um die Frage zu beantworten, „ob Kinder sich etwas unter Gott vorstellen können“, unterscheidet John Hull zwischen abstrakten Ideen und abstraktem Denken. Schon sehr früh entwickeln Kinder „eine Vorstellung von etwas, das man weder sehen noch anfassen kann“, zum Beispiel können sie Begriffe wie „wie »morgen«, »Dunkelheit«, »groß« oder »Himmel«“ gebrauchen.
„Vielleicht ist eine abstrakte Idee ja aber auch ganz einfach eine Verallgemeinerung. Auch Verallgemeinerungen können Kinder bereits sehr früh vornehmen. …
Wir sehen also, dass kleine Kinder ganz vergnügt von Dingen reden können, die über ihre sinnliche Wahrnehmung hinausgehen, und dass sie durchaus verallgemeinern können. Warum sollen sie dann nicht auch genauso unbefangen von Gott reden können? Abstraktheit scheint ihnen gar nicht so große Schwierigkeiten zu machen.“ (411)
Abstrakt denken können Kinder erst ab etwa zehn Jahren, davor denken sie ab etwa sechs Jahren konkret und davor intuitiv.
„Im Alter zwischen sechs und zehn Jahren denkt ein Kind »konkret«, das heißt, es bezieht sich in seinem Denken unmittelbar auf Gegenstände, Personen oder Situationen, die es umgeben oder die es kennt. Ab zehn Jahren ist es dann nicht mehr auf reale Situationen oder Gegenstände angewiesen, sondern kann über »Sätze« nachdenken. »Abstraktes« Denken ist Nachdenken über »Sätze«, »konkretes« Denken ist Nachdenken über Personen und Dinge.
Das bedeutet nun aber keineswegs, dass Kinder, die noch auf der Stufe des konkreten Denkens stehen, nicht mit abstrakten Wörtern umgehen können.“ (412)
Wie ist das nun mit kleinen Kindern und Gott?
„Gott ist der, von dem die Geschichten, die das Kind erzählt bekommt, handeln; der, zu dem man vor dem Einschlafen betet; der, dem vor dem Mittagessen gedankt wird; der, von dem in Kirche, Schule und andernorts die Rede ist. Auf diese Weise bildet sich allmählich ein Muster heraus, innerhalb dessen das Wort »Gott« Bedeutung gewinnt und mit ihm operiert werden kann. In gewissem Sinn stellt »Gott« eine Verallgemeinerung unendlich vieler Einzelcharakteristika dar, die menschlichen Augen verborgen sind. Doch wir sollten uns von dieser Schwierigkeit nicht abschrecken lassen. Wenn das konkret denkende Kind Gott nicht als abstrakten »Seinsgrund« erkennen kann, als den, ohne den nichts, das ist, wäre, als das, was allen Dingen gemeinsam ist, usw., so ist das nicht weiter schlimm. Es kann Gott statt dessen als den »Freund Moses« kennen und liebhaben oder wie eine Mutter oder einen Vater. Sobald das Kind aber ein wachsendes Repertoire von Gelegenheiten hat, in denen es das Wort »Gott« für eine bestimmte, wenn auch ungreifbare Person gebraucht, beginnt auch die Generalisierung. Anfangs mag der verallgemeinernde Gebrauch jeweils noch mit bestimmten Geschichten und Liedern verknüpft sein, doch der erste Schritt hin zu so allgemeinen Vorstellungen und Begriffen wie »Sein« ist damit schon getan.
Wir können also zusammenfassen: Die Psychologie versteht unter abstraktem Denken abstrakte Denkmuster. »Konkrete Denker« hingegen ordnen die Dinge auf konkrete Weise, ganz gleich, ob sie der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich sind oder auf Verallgemeinerungen basieren. Dennoch gibt es keinen Grund, warum das konkret oder vor-konkret denkende Kind nicht imstande sein sollte, auf eine Weise über Gott nachzudenken, die seinen Bedürfnissen und seinem Verständnis angemessen ist und entspricht, auch wenn seine Denkweise natürlich weder alle Möglichkeiten des Nachdenkens über Gott noch alle Bedeutungen des Wortes »Gott« einschließt. Wir dürfen deshalb aus der Tatsache, dass Kinder nicht alles verstehen, keinesfalls schließen, dass sie nichts verstehen. Kinder können, auch wenn sie konkret denken, bestimmte Aspekte des Wesens Gottes durchaus begreifen, auch dann, wenn diese Aspekte abstrakter Natur sind. Konkrete Denkstile können unsichtbare und nicht greifbare Aspekte miteinbeziehen und abdecken.“ (413)
Wichtig ist nun, dass diese konkrete oder intuitive kindliche Art, über Gott nachzudenken, „nicht weniger vielfältig und spontan ist als die Dinge, Menschen und Situationen, die uns umgeben“. „Immer wieder ist von den engen Grenzen des konkreten Denkens die Rede; dagegen hört man nur sehr selten von seiner Kraft und Flexibilität.“ Wir sollten nicht „die Möglichkeiten des konkreten Denkens unterschätzen“ und ein „theologisches Vorurteil“ pflegen, als ob Gott nur zeit- und raumlos und jenseitig wäre.
„Der Gott des christlichen Glaubens ist ebenso ein konkreter wie ein abstrakter Gott, das heißt, er ist in unserer Geschichte, unserer Zeit und unserem Raum gegenwärtig; alles, was ist, hat das Leben von ihm und lebt durch ihn. Zwar schließt die Vorstellung von Gott bestimmte Aspekte der Unberührbarkeit mit ein, doch es gibt viele Geschichten über ihn, in denen er gehört, gesehen, ja sogar berührt wird.“ (414)
Hilfreich für das Theologisieren mit Kindern findet Hull auch „den Verweis auf das Denken in Bildern“, das wir Erwachsenen vom „Traumdenken“ her kennen, aber auch von den „Metaphern“ unserer Sprache (415).
„Man mussss wohl davon ausgehen, dass in der religiösen Erziehung bisher häufig zuwenig bedacht wurde, welche Rolle Bilder im kindlichen Denken spielen. In der durchaus richtigen Annahme, dass die Begriffe oder Konstrukte des Kindes sich erst allmählich entwickeln, jedoch befangen in dem Irrtum, ein Nachdenken über Gott sei nur in rein begrifflicher Form, auf der Ebene abstrakten Denkens, möglich oder die Mühe wert, haben Eltern, Erzieher und Lehrer den Reichtum und die Kraft religiöser Bilder stark vernachlässigt. Umgekehrt wird vielleicht deshalb trotz allem so hartnäckig an biblischen Geschichten festgehalten. Das ist kein sturer Konservativismus auf seiten der Lehrer, sondern das tiefe Wissen um die bleibende Macht von Bildern.“ (416)
Ähnlich wie der Hirnforscher Manfred Spitzer eine in vielfältiger Weise anregende Umgebung als die wichtigste Voraussetzung für das Lernen von Kindern benennt, schreibt Hull:
„Es ist sehr viel besser, wenn Kinder zu viele Bilder statt zuwenig haben. Ich weiß nicht, ob ein Kind überhaupt zu viele Bilder von Gott haben kann. Jedenfalls ist es eher die Regel, dass Kinder zuwenig Bilder angeboten bekommen oder gar auf ein Bild fixiert werden, in das dann alle Aspekte des göttlichen Wesens hineingepresst werden müssen.“ (417)
Ein einziges Gesprächsbeispiel zwischen Eltern und Kindern (das erste ist 5 Jahre und 2 Monate alt, das zweite 3 Jahre und 9 Monate) aus John Hulls Buch möchte ich zitieren:
„1. Kind: Ist Gott die Luft?
Vater/Mutter: Nein, Gott ist nicht die Luft, aber er ist ein bisschen wie Luft.
2. Kind: Ist Gott die Zimmerdecke?
Vater/Mutter: Nein, Gott ist nicht die Zimmerdecke, aber er ist ein bisschen wie die Zimmerdecke.
1. Kind: Ist er ein dickes, rundes Baby?
Vater/Mutter: Nein, er ist kein rundes Baby, aber er ist ein bisschen wie ein kleines Kind, weil er ganz frisch und neu ist.
2. Kind: Ist er unsichtbar?
Vater/Mutter: Ja, das ist er.
1. Kind: Ist er wie ein dickes, rundes Baby mit Flügeln, das durch die Luft fliegt? (allgemeines Gelächter)
Vater/Mutter: Gott ist ein bisschen wie viele Dinge, aber er ist nicht genau wie irgend etwas.
2. Kind: Warum nicht?
Vater/Mutter: Weil Gott einzigartig ist. Gott hat überhaupt keine feste, bestimmte Gestalt.
1. Kind: Warum hat er keine Gestalt?
Vater/Mutter: Weil Gott eine Art Idee ist. Haben Vorstellungen eine Gestalt?
1. Kind: (Pause, dann lachend) Nein.
Vater/Mutter: Siehst du, Gott ist ein bisschen wie eine ganz mächtige Idee.“ (418)
Zur Interpretation dieses Gesprächs merkt Hull an:
„Der Altersunterschied von achtzehn Monaten zwischen den beiden Kindern macht sich hier deutlich bemerkbar. Das ältere Kind identifiziert Gott mit der Luft, das jüngere mit der Zimmerdecke. Die Zimmerdecke ist sichtbar – erst im weiteren Verlauf des Gesprächs geht das jüngere Kind auf die Qualität des Unsichtbaren ein.
Der Vater oder die Mutter möchte das Gespräch vom Konzept der Identität auf das Konzept der Ähnlichkeit hinlenken, deshalb bewegt sich die Konversation vom Wesen oder Sein Gottes hin zu Bildern oder Modellen von bzw. für Gott. Wenn man Kinder soweit bringen kann, dass sie im Gespräch über Gott das Wörtchen »wie« gebrauchen, ist der Weg frei für Vergleiche aller Art. Der Vater oder die Mutter stimmte zu, dass Gott ein bißchen so ist wie die Zimmerdecke, zum Teil, um das jüngere Kind nicht zu entmutigen, zum Teil aber auch, weil Gott tatsächlich als über uns, höher als wir oder als der, dessen Hände behütend über uns gebreitet sind, gedacht werden kann. …
Das Bild vom pausbäckigen Baby ist dann der nächste Schritt. Der Vater oder die Mutter beginnt, Aspekte des Bildes herauszuarbeiten, die wie Gott sein können. Auch wenn nicht das gesamte Bild anwendbar ist, können doch einzelne Aspekte durchaus brauchbar sein. Mit dem Gedanken der Unsichtbarkeit geht das Gespräch dann von Bildern zu Eigenschaften über. Natürlich hätte man auch hier wieder sagen können, dass Gott in gewissem Sinn unsichtbar ist und zugleich doch auch sichtbar, zum Beispiel in allem Schönen. Das jüngere Kind brauchte an dieser Stelle jedoch stärkere Bestätigung. Es musste wissen, dass es auf der richtigen Spur war, wohingegen das ältere ein größeres Repertoire von Bildern hatte, auf die es zurückgreifen und mit deren Hilfe es noch genauer differenzieren konnte.
… Die auf ein Lachen folgende Pause ist häufig der richtige Augenblick für die Einführung eines neuen Gedankens oder für eine Zusammenfassung des Gesagten; deshalb der Themenwechsel an dieser Stelle. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kinder das Wort »einzigartig« kennen oder nicht. Auch wenn sie es hier zum ersten Mal hören, ist seine Bedeutung doch aus dem Kontext ganz klar, und man kann ja später noch einmal darauf zurückkommen. Das Gespräch schließt mit der Einführung eines neuen Bildes, dem Bild von Gott als Idee. Wie bei den anderen Bildern treffen auch hier nur bestimmte Aspekte auf Gott zu; daher der Schlussgedanke, dass Gott ein bisschen so ist, aber nur kleines bisschen.“ (419)
Ein anderes Mal geht Hull darauf ein, wie man mit Kindern am besten über Jesus redet und über seine Fähigkeit, Wunder zu tun.
„Ein Großteil der Verwirrung um die Zuordnung von Gott und Jesus kann vermieden werden, wenn man immer wieder betont, dass Jesus erst ein Säugling war, dann ein Kind und dann ein Erwachsener, dass er wie wir als Mensch auf der Erde lebte und dass es Geschichten darüber gibt, was er auf der Erde tat. Wenn man Kindern Gott im Rahmen einer christlichen Erziehung durch die Gestalt Jesu nahebringen möchte, sollte man vor allem die Menschlichkeit Jesu in den Vordergrund stellen, sonst wird Jesus statt zum Mittler zwischen Gott und den Menschen einfach zum Träger derselben magischen Eigenschaften und Attribute, wie sie Gott zugeschrieben werden. Was diese letzteren betrifft, so ist Kindern durchaus schon begreiflich zu machen, dass es Grenzen des Aussagbaren gibt, wenn man vernünftig reden will, und dass Unsinn nicht einfach dadurch vernünftig wird, dass man den Namen »Gott« in den Satz einfügt. Auf diese Weise wird das Wort »Gott« zu einem Unsinns-Wort und nicht etwa ein unsinniger Satz sinnvoll. (420)
Auch zum Thema des Erzählens anstößiger Geschichten über Gott für Kinder hat Hull eine besondere Meinung, auf die ich im Kapitel 9.5.2 näher eingehe.
Nebenbei äußert sich John Hull in seinem Ratgeber, der sich ja nicht nur an Eltern, sondern auch an Erziehende in öffentlichen Bildungseinrichtungen richtet, auch darüber, wer seiner Auffassung nach die Verantwortung für die religiöse Erziehung in der Familie, im Kindergarten und in der Schule trägt.
Für öffentliche Bildungseinrichtungen wie die Schule widerspricht er der Ansicht vieler Lehrer,
„ein Gespräch über Gott müsse den Zweck verfolgen, den Glauben des Kindes zu wecken und zu fördern. Damit übernehmen sie nicht nur eine Aufgabe, die eigentlich den Kirchen, Moscheen und Synagogen obliegt, sondern indoktrinieren die Kinder geradezu. Diese unterschiedliche Auffassung über die Kompetenz von Religionsgemeinschaften und Schule ist immer wieder anzutreffen, und gerade hier können auch viele Fehler gemacht werden. Dennoch sollte man nicht prinzipiell davon ausgehen, dass ein Gespräch über Gott nicht auch einem erzieherischen Zweck dienen kann. Allerdings darf es dabei keinesfalls schwerpunktmäßig darum gehen, den Kindern die »rechte« Lehre vermitteln zu wollen – das ist einzig und allein Sache der Religionsgemeinschaften.“
Trotzdem kann man als Lehrer
„versuchen, den religiösen Wortschatz der Kinder zu erweitern und im Gespräch mit ihnen religiöse Bilder und Vorstellungen zu entwickeln, die die Kinder befähigen, sich auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe selbständig mit den Fragen und Erfahrungen auseinanderzusetzen, die sich aus den Gesprächen über Gott ergeben. Wenn man über etwas oder jemanden redet, wird damit nicht automatisch ausgesagt, dass das oder der Betreffende tatsächlich existiert, aber das Gespräch fördert die Vorstellung, dass es hier in jedem Fall um etwas Wichtiges und Vielschichtiges geht. Die Gesprächswelt vieler Kinder ist heutzutage – trotz oder vielleicht auch wegen der unaufhörlichen Informationsflut des Fernsehens und wegen anderer Begleiterscheinungen der Medien- und Bequemlichkeitskultur – sehr stark eingeengt. In dieser Situation kommt der Schule in der Tat die Aufgabe zu, den Kindern das geistige Handwerkszeug für das Gespräch über Gott zu vermitteln und ihnen damit gleichsam eine Art geistliche Ressourcen anzubieten.“ (421)
Wertvolle Impulse gibt Hull aber gerade auch für
„die christliche Erziehung von Kindern in Familie und Kirche… Viele christliche Familien scheinen noch heute in längst überholten pietistischen Stereotypen von Familienleben gefangen. Andere haben die christliche Erziehung überhaupt aufgegeben und ihre Kinder auf Gnade oder Ungnade ihren Peer-Groups, den Medien und der Schule überlassen – vielleicht in der heimlichen Hoffnung, die christliche Gemeinde an ihrem Wohnort würde ihnen schon eine solide christliche Grundlage vermitteln. Wieder andere pflegen einen christlichen Lebensstil, der sich in erster Linie dem sozialen Engagement für die Armen oder andere Randgruppen der menschlichen Gemeinschaft verpflichtet fühlt, versäumen jedoch, Kindern diesen Lebensstil im Lichte einer explizit christlichen Sprache und Symbolik nahezubringen. Die Kunst des theologischen Gesprächs gerade auch mit kleineren Kindern ist in unserer Gesellschaft eindeutig unterentwickelt, und das gilt für einen Großteil der christlichen Erziehung in den Gemeinden ebenso wie für die häusliche Erziehung. Gott kann real für Kinder werden, wenn sie in einem Zuhause und in einer Glaubensgemeinschaft aufwachsen, in denen die Realität Gottes durch die Auseinandersetzung mit Themen wie der Frage nach Frieden und Gerechtigkeit konkret wird. Dazu aber gehört das Reden über Gott ebenso wie der Wille, sich auch aktiv mit den entsprechenden sozialen Problemen zu befassen. Es ist zu hoffen, dass das vorliegende Büchlein christliche Eltern und vielleicht auch Eltern aus anderen theistischen Traditionen dazu anregt, neu darüber nachzudenken, wie sie ihre Kinder an Gebet und Frömmigkeit, an die Heilige Schrift und die religiösen Pflichten heranführen können.“ (422)
↑ Anmerkungen
(336) Das Buch ist so beliebt bei den Nutzern der Gießener Uni-Bibliothek, dass ich bis zum Ende meines Studienurlaubs warten musste, um es ausleihen zu können, und zwar ohne Verlängerungsmöglichkeit, da es schon weitere drei Male vorgemerkt war. Ich zitiere viel aus Spitzers Buch, wobei ich wegen der Vielzahl der Quellen darauf verzichte, die Studien zu nennen, auf die er zurückgreift.
Es bleibt viel übrig, was sich außerdem zu lesen lohnt, zum Beispiel, warum eins der fünf Kinder des Autors, der „7jährige Thomas“, der „gerade in die erste Klasse“ ging und auf die Aufforderung der Lehrerin „Wörter mit O“ zu sagen, das Schwangerschaftshormon „Oxytocin“ zu nennen wusste (eine Geschichte „aus dem bescheidenen Blickwinkel nur einer Familie“, die klar machen sollte, „wie unterschiedlich Schüler heute sein können“ (Spitzer, S. 404f.).
(367) Ebd., S. 412, zitiert nach Bayerwaltes, S. 85f.
(368) Ebd., S. 413f., zitiert nach Bayerwaltes, S. 91f.
(382) Harz, Erikson, S. 26.
(383) Ebd., S. 27. Wo er Kinder als „kompetente Lerner“ erwähnt, bezieht er sich auf Elschenbroich, Lerner, S. 18ff.
(385) Zitiert nach dem Titelbild von Erikson und die Religion.
(386) Harz, Erikson, S. 31f.
(388) Ebd., S. 33. Dazu im Kapitel 9.5 weitere Ausführungen!
(389) Brodin/Hylander, S. 11.
(398) Ebd., S. 137-139. Vgl. meine Ausführungen über Schuld und Scham in: Schütz, Vertrauen, Kapitel 11: „Schuld und Frieden“ (dieses Kapitel ist nur in der Online-Ausgabe verfügbar).
(408) Ebd., S. 119ff. Aus dem Kapitel „Umwelt und Windeln“ soll ein Zitat das Ausmaß des Problems verdeutlichen: „Die Anzahl von Wegwerfwindeln, die in einem Jahr in den USA verbraucht werden, schwankt um 20 Milliarden.“
(409) Hull, Kinder, S. 10f. Vgl. Dommel, Diskriminierungsgrund, S. 151: „Die Grundannahmen Piagets darüber, dass Kinder nicht abstrakt denken können und mit einem grundlegenden Egozentrismus die Welt betrachten, waren jedoch schon zu seinen Lebzeiten umstritten und wurden inzwischen vielfach empirisch widerlegt: Kinder können, je nachdem, welche Förderung und Anregung sie erhalten, nachweislich mehr, als Piaget ihnen zutraute“. Dabei beruft sich Dommel auf ein Buch von Cohen.
(410) Hull, Kinder, S. 94f.
(417) Ebd., S. 40. Mir fällt dazu auch die Haltung des Philosophen Odo Marquard zur Geschichtenvielfalt ein, zum Beispiel Marquard, Universalgeschichte, S. 88: „Ein Mensch muß viele Geschichten haben dürfen“ oder Marquard, Geschichten, S. 62: „Man hat nicht nur eine Geschichte; man muß viele Geschichten haben dürfen: darauf kommt es an.“ Sympathisch ist ihm auch die „Bibel als Werk, das viele Geschichten mit Gott erzählt“ (Marquard, Gott).
(418) Hull, Kinder, S. 40f.
