Im achten Kapitel des Buches formuliert Pfarrer Helmut Schütz Bausteine für eine Kultur des Teilens im multireligiösen Kindergarten auf der Grundlage evangelischer Freiheit und Liebe.
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
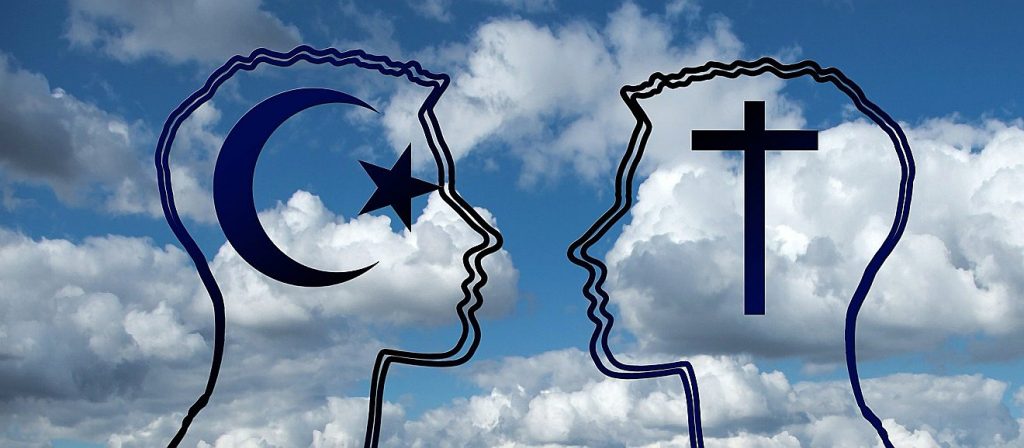
Inhalt dieses Kapitels
8.0 Konzeptionelle Überlegungen von Helmut Schütz
8.2 Religiöse Gäste in der Kita als dem gemeinsamen Zuhause der Kinder
8.5 Evangelische Identität zwischen Freiheit und Liebe
8.6 Erziehungspersonal und Kita-Ausschuss-Vorsitzende mit anderer Religionszugehörigkeit
8.7 Geschichten teilen statt „missionarische Vereinnahmung“
↑ 8.0 Konzeptionelle Überlegungen von Helmut Schütz
Dem, was Christa Dommel als Konzept der Religions-Bildung in der öffentlichen Bildungsinstitution des Kindergartens vorgestellt hat, möchte ich kein eigenes Konzept entgegen oder an die Seite stellen, sondern ich empfehle, mit Hilfe der von ihr vorgeschlagenen Wirkfaktoren die eigene religionspädagogische Praxis zu überprüfen und sich von den Konzeptionen auch anderer Autoren anregen zu lassen. Was mir selber zur Zeit an konzeptionellen Überlegungen am wichtigsten geworden ist, fasse ich in diesem Kapitel kurz zusammen.
↑ 8.1 Konvivenz
Mein Ausgangspunkt ist die von Eva Hoffmann ausdrücklich gestellte
„Frage, ob in zukünftigen konzeptionellen Überlegungen zur interreligiösen Erziehung von Kindergartenkindern nicht mehr als ein ‚bloßer‛ Gaststatus für Kinder mit nichtchristlicher oder ohne Religionszugehörigkeit anvisiert werden sollte. Die Anregungen von Harz und Hugoth sind sicher ein erster Schritt dahingehend, den Glauben und die Religion unterschiedlicher Kinder im Kindergartenalltag wahrzunehmen und ihnen Respekt zu zollen. Es bleibt aber zu diskutieren, ob nichtchristliche Religionen oder nicht religiös begründete Weltanschauungen nicht noch intensiver im Kindergartenalltag berücksichtigt und aufgegriffen werden könnten“ (705).
Noch deutlicher formuliert Christa Dommel die Herausforderung, vor der jede Kindertageseinrichtung, in welcher Trägerschaft auch immer, steht. In den auf Europa-Ebene entwickelten „40 Qualitätszielen für Kindertageseinrichtungen“, denen zufolge „jedes einzelne Kind … sich mit der Kultur seiner Familie, seinem Glauben und seiner Religion … in der Einrichtung wiederfinden können“ soll,
„wird eindeutig davon ausgegangen, dass nicht religiöse Erziehung im Sinne einer Religionsgemeinschaft, sondern die ‚Beheimatung‛ aller Kinder in der Kindertagesstätte zum öffentlichen Auftrag der Kindertageseinrichtungen gehört.“ (706)
Für eine solche Beheimatung aller Kinder sind die Voraussetzungen im Kindergarten im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Orten ideal. Nirgends sonst teilen Menschen verschiedener Herkunft und Religionszugehörigkeit so intensiv und so selbstverständlich ihr Leben miteinander wie gerade in der Kita.
„Anders als in der Schule ist Religion in Kindertagesstätten kein separates »Fach«, sondern eine von vielen Dimensionen des Alltagslebens in der Einrichtung. Dazu gehören beispielsweise Kalender mit Mond- und Sonnenmonaten, religiöse Feste, Essen, Kleidung und Rituale. In kaum einer anderen Institution ist gemeinsames Lernen von Kindern und Erwachsenen zu diesem Thema in ähnlich alltagsnaher Form möglich.“ (707)
Was Erwachsene auf der Suche nach gelingendem „Zusammenleben“ mit einem aus der Befreiungstheologie Lateinamerikas stammenden Begriff „Konvivenz“ bezeichnet haben, nämlich
„ein mit Hingabe tatsächlich gelebtes Leben, das Erfahrung und Praxis, Individuelles und Kollektives, Partizipation und Austausch umfasst“ (708),
gehört für Kita-Kinder schlicht zu ihrem normalen Alltag. Der Kindergarten ist für sie ihr zweites Zuhause, in dem sie sehr viel Zeit verbringen.
Frieder Harz schreibt:
„In ihrer Kindertagesstätte hat die Gemeinde einen Ort, an dem tagtäglich Erwachsene und Kinder ihr Miteinander gestalten. Hier kann täglich neu erprobt werden, wie Glauben und Leben zusammenpassen.“ (709)
Nur ist es dabei wichtig, Glauben auch ganz selbstverständlich im Plural zu denken! Dessen ist sich auch Harz im Grunde bewusst:
„Vermutlich sind es in unserer Gesellschaft die Kindertagesstätten, in denen das Miteinander der religiös Verschiedenen am intensivsten als erzieherische Aufgabe wahrgenommen wird.“ (710)
Wenn allerdings die Kita als verlängerter Arm der Kirchengemeinde ersetzen soll, was im Blick auf die Beheimatung der Kinder in der christlichen Tradition im Elternhaus versäumt wird, verspielt man möglicherweise auf längere Sicht die genannten Chancen der Konvivenz in der Kita als einer öffentlichen Bildungsinstitution. Letzten Endes liegt es in der Verantwortung der Eltern, in welcher Weise sie ihre Kinder religiös erziehen und geprägt wissen wollen, und welche Angebote der Religionsgemeinschaften sie zur Unterstützung der Beheimatung in einer bestimmten Religion nutzen möchten. Und so wie muslimische Eltern entscheiden, ob sie mit ihren Kindern zur Moschee gehen, sie zur Koranschule schicken, an Veranstaltungen der Moscheevereine teilnehmen, finden christliche Familien in den Kirchengemeinden eine Vielfalt von Möglichkeiten, ihre Kinder in der eigenen Glaubensgemeinschaft heimisch werden zu lassen, vom Kindergottesdienst bis zur Mitwirkung beim Kinderkonzert, vom Familiengottesdienst bis zum Kinderkirchentag.
↑ 8.2 Religiöse Gäste in der Kita als dem gemeinsamen Zuhause der Kinder
Allerdings lehne ich die von Frieder Harz verwendete Gast-Metapher nicht vollständig ab. Ich denke, sie passt für religiöse Vollzüge, die vor allem in den explizit für gottesdienstliche Feiern und Rituale ausgewiesenen Räumen einer Kirchen- oder Moscheegemeinde stattfinden, zum Beispiel wenn zu Familiengottesdiensten in der Kirche auch ausdrücklich muslimische Kinder mit ihren Familien als religiöse Gäste eingeladen werden oder wenn bei Moscheebesuchen christliche Kinder das islamische Gebetsritual als Gäste miterleben. Zu beachten ist hierbei nach Ursula Sieg das
„Leitbild: »Beim anderen zu Gast sein«; ein stilles, von Achtung und Ehrfurcht getragenes Dabeisein, das die Schranke zwischen dem eigenen Glauben und dem des anderen respektiert und trotzdem Gemeinsamkeit erleben lässt… Ittmann formuliert u. a. folgende Leitfrage: »Welche Informationen über Festverlauf, Bräuche und Traditionen muss der Gastgeber den Gästen aus anderen Religionen geben, damit sie entscheiden können, ob sie teilnehmen oder fernbleiben wollen?«“ (711)
Aber in den Räumen der Kita und des Familienzentrums sind alle Kinder (bzw. ihre Familien) mit den Erzieherinnen gemeinsam „zu Hause“, auch wenn die Einrichtung von der evangelischen Kirche getragen ist. Im Unterschied zum Kindergottesdienst oder zum Lernen in der Koranschule kann hier keine auf nur eine einzige Religion bezogene Einübung religiöser Vollzüge erfolgen. Wenn hier gebetet wird oder Elemente religiöser Feste vorkommen, dann muss darauf geachtet werden, dass nicht immer dieselben Kinder als Gäste dabei zuschauen müssen, sondern auf Beiträge der verschiedenen Religionen zurückgegriffen wird. Oder es wird ein Weg gesucht, zum Beispiel Gebete so zu formulieren und gemeinsame Lieder so auszusuchen, dass sich möglichst kein Kind beim Mitsprechen ausgeschlossen fühlen muss.
Das evangelische Profil kann also nicht in Form der Bevorzugung christlicher Kinder bei der Beheimatung in ihrer eigenen Herkunftstradition zum Tragen kommen, sondern gerade darin, dass die Kinder aller in der Kita vertretenen Konfessionen, Religionen, Weltanschauungen und Kulturen sich im diesem gemeinsam bewohnten Haus heimisch fühlen können. Wohlgemerkt: nicht indem christliche Traditionen unsichtbar gemacht werden, sondern indem muslimische Traditionen (gelegentlich auch buddhistische) ebenfalls sichtbar werden (712) und indem hin und wieder auch darüber nachgedacht wird, dass manche Menschen nicht an Gott glauben. Dies setzt beim evangelischen Träger sowie bei allen beteiligten Erwachsenen vom Kita-Team bis zur Elternschaft die Bereitschaft voraus, den Wahrheitsanspruch der eigenen Religion oder Weltanschauung nicht absolutzusetzen, sondern sich auf die Begegnung auch mit fremder oder fehlender Religiosität einzulassen.
Besonders sinnvoll finde ich die Gast-Metapher, wenn ich über meine eigene Rolle als Pfarrer in der Kita nachdenke. Wenn ich alle zwei Wochen einmal für eine halbe Stunde am Stuhlkreis der Kinder teilnehme, dann sind die Kinder diejenigen, die dort zu Hause sind, und ich bin in der Rolle des Gastes, der die Kinder besucht. Natürlich ist es auch eine Bevorzugung der christlichen Kinder, wenn sie nur mich als Repräsentanten der christlichen Religion in der Kita erleben; daher ist es sinnvoll, auch Gäste aus anderen religiösen Gemeinschaften einzuladen, die den Kindern Geschichten, Lieder, Gebete und anderes aus ihrer jeweiligen Tradition mitbringen. Ich selber bringe in Form von Handpuppen schon lange auch andere „Gäste“ in den Stuhlkreis mit, die mir beim Erzählen biblischer Geschichten helfen; in Zukunft wird oft die Handpuppe Jamal, ein kleines Kamel mit seiner Herkunft aus der arabischen Wüste, als Identifikationsfigur für die islamische Tradition mit dabei sein und mir beim Erzählen koranischer Geschichten helfen.
In der Auseinandersetzung mit der evangelischen Profilierung nach Frieder Harz ist mir bewusst geworden, worauf ich eher verzichte, wenn ich bei den Kindern zu Besuch bin. Harz schreibt:
„Biblische Geschichten, Gebete und Segen bestimmen Andachten und Gottesdienste, die in vielen Einrichtungen ihren festen Platz haben. Und so liegt es nahe, sie mit den Kindern als Bewusstwerden der Gottesbeziehung zu feiern: Ein kleiner liturgischer Rahmen wendet zunächst den Blick von den äußeren Aktivitäten nach innen und damit hin zu der Beziehung zu Gott – durch ein Lied, ein Ritual, das zur Ruhe bringt (Kerze, Klangschale, gestaltete Mitte), ein Gebet, in dem die Beziehung zu Gott ihre Sprache findet. Eine Geschichte erzählt von dieser Gottesbeziehung, in Symbolen wird das festgehalten, in der Fürbitte werden andere in diese Beziehung mit hineingenommen, der Segen weist voraus zu den neuen Aktivitäten und Herausforderungen.“ (713)
So gottesdienstlich im christlichen Sinne gestalte ich das Zusammensein mit den Kindern nicht, sondern eher als Erzähl- und Gesprächskreis mit Elementen einer interreligiösen Feier, indem zur Gitarre Lieder gesungen werden, in denen nicht das christlich von anderen Religionen Abgrenzende, sondern das Gemeinsame betont wird (siehe Kapitel 10.1). Das erinnert an
„deutsche inklusive Modelle von Religions- Bildung für die Grundschulpädagogik…, die sich für den Kindergartenbereich nutzen lassen“
und in denen
„der Grundgedanke des Pendelns zwischen ‚Eigenem‛ und ‚Gemeinsamem‛ … eine pädagogische Innovation dar[stellt] im Vergleich zur üblichen Entgegensetzung zwischen ‚Eigenem‛ und ‚Fremden‛ in der konfessionellen Religionspädagogik.“ (714)
Genau zu diesem Pendeln leite ich mit Hilfe meiner Handpuppen an, und das Stichwort „fremd“ kommt immer nur am Rande vor: es bleibt manchmal stehen und verschwindet manchmal, indem man das Fremde versteht oder merkt, dass es gar nicht so fremd ist. Und auch das „Eigene“ kann zugleich fremd sein.
↑ 8.3 Kultur des Teilens
Das Modell meiner Wahl zum Umgang mit religiöser Pluralität wäre am ehesten das interreligiöse Modell, wie es der katholische Religionspädagoge Matthias Hugoth beschreibt. Dieses Leben im Raum der Interreligion im Kindergarten ist in meinen Augen eine Kultur des Teilens. Im „Teilen“ steckt das „Teil“. Als Individuen sind wir immer zugleich auch Teil einer sozialen Gemeinschaft, darum finde ich den englischen Begriff des „social individualism“ (715) so genial, mit dem der Gegensatz zwischen den egoistischen Gefahren eines individualistischen Liberalismus und den totalitären Gefahren eines kollektivistischen Sozialismus oder Kommunismus überwunden wird. Kinder im Kindergarten teilen miteinander viel Zeit, Spielzeug und andere Dinge. Sie können auch Geschichten, Gebete und andere Elemente ihrer religiösen Traditionen miteinander austauschen und gemeinsam erleben. Zugleich steckt im Stichwort „Teil“ auch ein Element der Entgegensetzung oder Abgrenzung, wenn manche nicht vereinnahmt werden möchten von dem, was an anderen anders ist, bzw. nicht an allem teilnehmen möchten, was andere mitbringen. Wichtig ist, dass dieses Element der Abgrenzung sich nicht als totale Ausgrenzung einzelner Kinder oder ganzer Gruppen von Kindern auswirkt.
Eine solche Kultur des Teilens lässt sich auch, wenn man es wissenschaftlicher mag, als fragmentarisch-partizipatorischen Ansatz beschreiben. Indem wir endliche, sterbliche Geschöpfe sind, ist unsere Existenz immer Stückwerk („Fragment“), und nur indem wir am Schicksal anderer Anteil nehmen („partizipieren“) (716), werden wir zwar nicht vollkommen, aber gelangen wir zur Sinnerfüllung unseres Lebens (717).
↑ 8.4 Inklusion
Was ich mit einer Kultur des Teilens in der multireligiösen Kita meine, kann auch unter dem Stichwort „inklusive Bildung“ zusammengefasst werden (718). Ich benutze den Begriff allerdings mit Vorbehalten, da er auf sehr unterschiedliche Weise verwendet und verstanden wird, gerade im Zusammenhang mit Interreligion.
Wenn zum Beispiel muslimische Kinder selbstverständlich an Andachten mit dem Pfarrer im Kindergarten oder an Krippenspielen in der Kirche teilnehmen (719), ist das nicht unbedingt inklusive Bildung, sondern es kann auch eine Vereinnahmung sein. Allgemeiner gesagt, kann sich der Absolutheitsanspruch einer Religion auch darin äußern, dass ihre Vertreter einen „inklusiven“ Anspruch geltend machen, also davon ausgehen, dass in der eigenen Religion die Wahrheit am deutlichsten zum Ausdruck kommt und andere Religionen in abgestufter Weise an dieser Wahrheit einen mehr oder weniger geringen Anteil haben. Gegen alle Formen exklusiver oder inklusiver Wahrheitsansprüche der Religionen wendet sich die »Pluralistische Theologie der Religionen«. Sie ist nach Reinhold Bernhardt
„die zusammenfassende Bezeichnung einer überkonfessionellen und in der Tendenz sogar überreligiösen Bewegung, deren zentrales Anliegen es ist, die Bestimmung der Beziehung zwischen den Religionen auf eine neue Grundlage zu stellen. Dabei soll auf jede Form von Absolutheitsansprüchen konsequent verzichtet werden. Das betrifft sowohl die Exklusivansprüche auf Alleingeltung als auch die inklusiven Ansprüche auf höhere oder höchste Geltung einer Religion. Stattdessen vertreten die ›Pluralisten‹ die Position: »Die großen Weltreligionen mit ihren vielfältigen Lehren und Praktiken bilden authentische Wege zum höchsten Gut.«… Daraus ergibt sich ein Verhältnis der Ebenbürtigkeit zwischen ihnen, das zur Beziehungsform des Dialogs führen muss.“ (720)
Elke Kuhn schreibt im gleichen Sinn in ihrem Buch über christlich-muslimische Schulfeiern:
„Im günstigsten Fall bilden die Religionen eine Lerngemeinschaft, in der es nicht zu einer Mischreligion kommt, sondern zu einer Vertiefung des je eigenen Selbst-, Welt- und Gottesverständnisses.“ (721)
In anderer Hinsicht kann der Begriff der Inklusion paradoxerweise sogar ausschließend wirken, je nachdem, auf welche Personengruppen man ihn bezieht. Wir inkludieren die einen und exkludieren die anderen, schlicht indem wir uns ihrer Existenz oder Gegenwart gar nicht bewusst sind. Da kümmern wir uns um „inklusive“ Sprache im Gottesdienst und eine gendergerechte Bibelübersetzung wie die „Bibel in gerechter Sprache“ (siehe Anm. 120), aber Fürbitten formulieren wir häufig so, als ob „die Behinderten, die Benachteiligten, die Verachteten, die Ausgestoßenen und bestimmte ‚Randgruppen‛“ normalerweise sowieso nicht in der Kirche anwesend sind, sonst würden wir sie nicht als die anderen definieren, „für die wir uns als Kirche einsetzen müssten“ (722). Und stellen wir Erziehungspersonal für heilpädagogische Integrationsmaßnahmen ein, schaffen wir barrierefreie Gemeinde- und Familienzentren, um Menschen mit Behinderungen einzubeziehen, bleiben vielleicht andere Formen der Ausgrenzung auf Grund sozialer, ethnischer oder religiöser Unterschiede unbeachtet. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die
„religionspädagogische Diskussion zur ‚Integration‛ Behinderter … seltsamerweise völlig getrennt und ohne Bezug zur gleichnamigen ‚Integrations‛-Debatte interkulturellen und interreligiösen Lernens“ verläuft (723).
Verwenden wir den Begriff der „Inklusion“, sollten wir ihn daher in einem möglichst weiten Sinn definieren, zum Beispiel in Anlehnung an Christa Dommels Erfahrungen in England:
„Inspiriert durch internationalen Austausch innerhalb der EU … entwickelte sich in England eine Zusammenschau verschiedener Herausforderungen für ‚Normalität‛ unter dem Stichwort ‚Inclusion‛ in der pädagogischen Theorie und Praxis, die diverse ‚Sonderpädagogiken‛ in einen gemeinsamen Diskussionszusammenhang bringt, der neben Behinderungen und Sexismus auch ethnische und religiöse Ausgrenzung thematisiert.“ (724)
↑ 8.5 Evangelische Identität zwischen Freiheit und Liebe
Bleibt bei aller Inklusion und Konvivenz in dieser Kultur des Teilens nun nicht doch das christliche „Proprium“ auf der Strecke, wie wir vor 40 Jahren während meines Theologiestudiums das „Eigene“ unseres Glaubens nannten? Damals schien sich die christliche Identität nach Auffassung der einen in Politik oder Psychologie, in soziale Aktivitäten bis hin zur kommunistischen Ideologie aufzulösen, während die anderen darauf bestanden, dass der christliche Glaube gerade in den politischen, sozialen, psychischen und gruppendynamischen Vollzügen des menschlichen Lebens seine befreiende und verwandelnde Kraft entfaltet (725). Heute sehen viele die Gefahr für das christliche Profil einerseits in der individualistischen Beliebigkeit, mit der sich in der modernen Gesellschaft Menschen ihre eigene Religion oder Weltanschauung patchwork-artig selber zusammenbasteln, andererseits in der wachsenden Zahl von Menschen, die sich auch in Deutschland anderen Religionen als der christlichen zugehörig oder herkunftsmäßig verbunden fühlen.
Ich plädiere in Anlehnung an die Überlegungen von John M. Hull (siehe Kapitel 6.5) für einen selbstbewussten Umgang mit der Frage der eigenen christlichen Identität und möchte sie ganzheitlich, also alle Menschen einladend, und nicht totalisierend, also im Sinne eines Absolutheitsanspruchs ausgrenzend oder vereinnahmend, definieren.
Für das Profil einer Kita in evangelischer Trägerschaft sollte Martin Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“ leitend sein:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Diese zwei Leitsätze sind klar: Paulus, 1. Kor. 9, 19: »Ich bin frei von jedermann und habe mich eines jedermanns Knecht gemacht«, ebenso Röm. 13, 8: »Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebet.« Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, was sie lieb hat.“ (726)
Natürlich sind Freiheit und Liebe ausgesprochen dehnbare Begriffe. Ich will hier auch nicht versuchen, sie allgemeingültig zu definieren. Sicher entsprechen Martin Luthers Vorstellungen von „der Freiheit eines Christenmenschen“ und der ihr entsprechenden christlichen Liebe nicht genau dem, was wir heute unter Freiheit und Liebe begreifen. Jeder Theologe, jeder Christ, jeder Kirchenvorstand wird in eigener Weise darüber nachdenken und sich dafür verantworten müssen, wie in seinem Leben, seiner Gemeinde und auch in der von dieser Gemeinde getragenen Kindertagesstätte diese Freiheit und diese Liebe gelebt wird.
Dabei kann es meiner Ansicht nach hilfreich sein, sich besonders mit Christa Dommels Ansatz inklusiver Religions-Bildung zu beschäftigen, weil er sich dem Recht aller Kinder auf Religion verpflichtet weiß („Liebe“) und ohne Berührungsängste einen offenen Umgang mit verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Haltungen anstrebt („Freiheit“). Ja, Freiheit und Liebe als die entscheidenden Merkmale christlicher Identität nach evangelischem Verständnis sind sogar in besonderer Weise kompatibel mit den von Dommel formulierten Wirkfaktoren, denn unter ihnen spielt sowohl die Liebe als auch die Freiheit, indem das Thema Macht kritisch ins Auge gefasst wird, eine herausragende Rolle. Genau genommen hat auch das christliche Stichwort „Liebe“ mit dem Thema „Macht“ zu tun, denn das biblische Gebot der Nächstenliebe in 3. Mose 19, 18, das Jesus als Hauptgebot Gottes aufgreift und des öfteren zitiert (727), ist ja eine Zusammenfassung der Tora des einen Gottes von Juden und Christen, die alle absoluten Machtansprüche politischer, wirtschaftlicher, ideologischer oder religiöser Art (übrigens auch bezogen auf die eigene Religion) in Frage stellt und auf Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen hinausläuft.
Der evangelischen Freiheit entspricht auch die Haltung des Apostels Paulus, die er im 1. Korintherbrief 6, 12 zum Ausdruck bringt (728):
„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangennehmen.“
Daraus ziehe ich den Schluss, dass es zum evangelischen Profil einer Einrichtung gehört, die eigene Haltung nicht aufdringlich und vereinnahmend zu vertreten. Für das Zusammenleben mit Menschen, denen bestimmte Speisegebote heilig sind, bildet die Mahnung des Paulus im Römerbrief 14, 20 eine gute Leitlinie:
„Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein; aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst.“
Gerade weil es nach Paulus in der Mitwirkung an Gottes Werk, am Reich Gottes, nicht um „Essen und Trinken“, sondern um „Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist“ geht, gilt es, nach dem zu streben, „was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander“ (Römerbrief 14, 17.19). Das heißt, der Christ soll respektieren, was dem Muslim als Speisegebot heilig ist, der Muslim soll aber auch den Christen nicht verachten, wenn er von seiner christlichen Freiheit Gebrauch macht, da Jesus „alle Speisen für rein“ erklärt hat (Markusevangelium 7, 19).
Dass die evangelische Kirche in Deutschland gegenwärtig als Trägerin von Kindertagesstätten im Einklang mit staatlichen Bildungszielen auftreten kann, hängt damit zusammen, dass es unserer Kirche im vergangenen Jahrhundert gelungen ist, die Menschenrechte in Übereinstimmung mit der eigenen Tradition zu interpretieren und zu akzeptieren, denen die demokratisch verfasste Bundesrepublik seit ihrer Gründung verpflichtet ist (729). Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Entscheidungen in einem evangelischen Kindergarten sich an staatlichen Vorgaben orientieren müssten. Regelungen darüber, ob zum Beispiel muslimische Erzieherinnen im Dienst ein Kopftuch tragen dürfen oder nicht, sollten nicht einfach vom Staat übernommen, sondern in Absprache mit dem Kita-Team und mit der Elternschaft vom jeweiligen Kirchenvorstand in eigener Verantwortung beschlossen werden.
Profilierungen dienen ja normalerweise zu Abgrenzungszwecken. Mir erscheint es daher wichtig, abschließend darauf hinzuweisen, wo ich solche Abgrenzungslinien sehe und wo eher nicht.
Keine grundsätzliche Abgrenzungslinie sehe ich zwischen verschiedenen Kindergartenträgern, sofern sie ihre praktische religionspädagogische Arbeit an den Dommelschen Wirkfaktoren messen, insbesondere an der „Liebe“, an der Berücksichtigung des „Macht“-Faktors und an den „Geschichten aus der Geschichte“. Bei der Betrachtung religionspädagogischer Konzeptionen aus unterschiedlichen konfessionellen wie religiösen Zusammenhängen wurde meines Erachtens bereits deutlich, dass es in jeder Konfession und Religion Pädagogen gibt, deren Bildungsziele in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung nicht weit voneinander entfernt liegen.
Außerdem denke ich, dass es zwar zum besonderen Profil einer evangelischen oder katholischen oder auch islamischen Einrichtung gehören kann, auf die religiöse Bildung besonderen Wert zu legen, dass dies aber gerade nicht als ein „Alleinstellungsmerkmal“ hervorgehoben werden sollte, denn das „Grundrecht des Kindes auf religiöse Bildung“ gilt auch für Kinder in nicht von Kirchen, Moscheen oder Synagogen getragenen Kindertagesstätten.
Abgrenzungslinien kommen dort zum Tragen, wo beispielsweise Kinder bzw. Familien ausgegrenzt oder in ihrer Würde verletzt, rassistische oder kulturalistische Vorurteile ausgelebt, Mädchen gegenüber Jungen benachteiligt, homosexuell lebende Menschen beleidigt werden. Was im Kapitel 3.3 zur „vorurteilsbewussten Erziehung“ gesagt wurde, bildet den Rahmen für ein Konzept inklusiver Bildung, das im Grunde nur denjenigen ausgrenzt, der selber lieblose bzw. inhumane Grenzen zieht. Mit dem evangelischen Profil einer Kita würde es sich zum Beispiel nicht vertragen, eine Erzieherin einzustellen, die die eigene Religion in einer Weise vertritt, dass dadurch die Einstellung oder der Glaube von Menschen anderer Religion oder Weltanschauung herabgesetzt wird. Im Grunde verläuft die wichtigste Abgrenzungslinie quer durch die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen zwischen denen, die Andersdenkenden und Andersglaubenden mit Offenheit und Respekt begegnen, und denjenigen, die ihre eigene Religion oder Ideologie mit fundamentalistischer oder fanatischer Engstirnigkeit absolut setzen.
Den Eltern müsste schon bei der Anmeldung ihrer Kinder in der Kita deutlich gemacht werden, dass zum Konzept der Kita auch die Begegnung mit den verschiedenen religiösen Traditionen der Kinder gehört. Dazu kann vieles gehören: der Besuch des Pfarrers im Stuhlkreis der Kinder, der neben Geschichten aus der Bibel manchmal auch Geschichten aus dem Koran erzählt; die Einbeziehung von Gästen aus der Moscheegemeinde oder des buddhistischen Tempels im Stuhlkreis der Kinder; ein Besuch der Kinder als Gäste in der Kirche, in der Moschee, in der Synagoge, im buddhistischen Tempel; die Gestaltung einer Zuhause-Ecke in der Kita, in der die Kinder Elemente aus ihren religiösen Familientraditionen zusammentragen; der Aufbau einer Bibliothek im Familienzentrum, die unter anderem Bilderbücher mit Geschichten aus der Bibel und aus dem Koran und mit Informationen über die verschiedenen Religionen enthält, aber auch Bücher, die auf die Themen der vorurteilsbewussten Erziehung eingehen und vieles mehr.
↑ 8.6 Erziehungspersonal und Kita-Ausschuss-Vorsitzende mit anderer Religionszugehörigkeit
Was sich meines Erachtens sehr gut mit dem evangelischen Profil einer auf eine Kultur des Teilens bedachte Kindertageseinrichtung verträgt, ist die Einstellung von Erzieherinnen anderer Religionszugehörigkeit. „Selbstverständlich vorausgesetzt ist dabei die Akzeptanz der christlichen Grundausrichtung der Kita durch die Erzieherin“ (730).
Götz Doyé hat dazu wegweisend Stellung genommen und sich dabei in meinem Sinne an einem evangelischen Profil der Freiheit und Liebe orientiert:
„In der Freiheit eines Christenmenschen, der sich anderen gerne zum ‚Diener‛ macht, wenn es deren Leben stärkt, kann sich der Träger einer Kita im Blick auf die muslimischen Kinder so weit öffnen, dass sie in der Einrichtung einer Person begegnen können, die in gleicher religiöser Praxis steht wie sie und ihre Familien. … [Eine] muslimische Erzieherin …
… kann … Dolmetscherin für Eltern und Erzieherinnen sein mit Blick auf kulturell-religiöse Deutungen von Alltagspraxis und Lebensverständnis. Sie kann aus dem Verstehen der eigenen Religion Wege zum Verstehen anderer Weltsichten ebnen. Damit kann in der Kita das praktiziert werden, was unsere Gesellschaft derzeit dringend braucht: Dialog und Einübung in einen toleranten Umgang. Das kann praktisch bedeuten, dass Familien, deren Kinder zusammen in der Kita sind, sich auch außerhalb der Kita wahrnehmen und im Alltag unterstützen. Die Kita wird für Kinder und Erwachsene zum Übungsfeld gesellschaftlicher Integration und schließt dabei das Thema Religion gerade nicht aus.
Recht verstanden wäre eine in Deutschland lebende Muslima mit sozialpädagogischer Ausbildung ein Glücksfall für eine evangelische Tageseinrichtung mit muslimischen Kindern. Paradoxerweise könnte sogar das Profil einer evangelischen Kita dadurch gestärkt werden, da dem Thema Religion bewusste Aufmerksamkeit zukäme.“ (731)
Im Gegensatz dazu lehnt Wolf-Peter Koech die Einstellung muslimischen Erziehungspersonals unter ausdrücklichem Bezug auf das Beheimatungsmodell von Frieder Harz im evangelischen Kindergarten ab, denn:
„Die Kindertagesstätte nimmt mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine wesentliche Verkündigungsaufgabe der Gemeinde wahr…
Das Wirken unserer Erzieherinnen in der Einrichtung ermöglicht es, dass Kinder dem christlichen Glauben in biblischen Geschichten, im Gestalten des Tagesablaufes oder auch mit ihren eigenen Fragen, Hoffnungen und Wünschen begegnen können. Zudem eröffnet die Arbeit häufig den Eltern, den Erwachsenen, Menschen, die vielleicht seit langer Zeit nicht mehr mit Glaubensfragen in Kontakt gekommen sind, über ihre Kinder, über das, was die Kinder an erlebtem Glauben mit nach Hause bringen, einen eigenen neuen Zugang.
In diesem Maße kann das eine Erzieherin, die einer anderen Religion angehört oder bewusst keiner Religion angehören möchte, nicht mitvollziehen. Ich möchte zudem niemanden auf etwas verpflichten, das er oder sie aufgrund eines anderen Glaubens nicht erfüllen kann; und andererseits möchte ich den Anspruch als evangelische Kirchengemeinde, mit einer Kindertageseinrichtung das Evangelium weiterzusagen, nicht aufgeben.“ (732)
Wie bereits in den Kapiteln 5 bis 7 ausführlich dargelegt, halte ich einen so eng gefassten evangelischen Verkündigungsauftrag nicht für vereinbar mit dem Status eines evangelischen Kindergartens als öffentlicher Bildungseinrichtung. Ich sehe dagegen mit Götz Doyé gerade auch religionspädagogisch sehr große Chancen darin, dass die Kinder in der Kita auch muslimischen Erzieherinnen begegnen:
„Religionspädagogisch ist davon auszugehen, dass man jeder ‚fremden‛ Religion immer nur religionskundlich begegnen kann, weil Religion sich nur aus einer inneren Beteiligungs-Beziehung erschließt. Ziel des kirchlichen Trägers kann es nicht sein, die muslimischen Kinder und ihre Familien für den christlichen Glauben zu gewinnen. Diesbezüglich personifiziert eine muslimische Erzieherin das religiöse Überwältigungsverbot, das auch für eine kirchliche Einrichtung gilt. Durch die Möglichkeit, dass muslimische Eltern ihre Kinder in eine konfessionell geprägte Einrichtung bringen können, kann sich aber eine positive Grundhaltung dem christlichen Glauben gegenüber entwickeln. Dies kann befördert werden, wenn die Familien/Eltern in der Einrichtung auf eine Erzieherin treffen, die der eigenen Religion verbunden ist.“ (733)
Dass wir auf Grund des Einstellungsgesetzes unserer Landeskirche von 2009 (734) eine muslimische Erzieherin einstellen konnten, hat sich in unserem Kinder- und Familienzentrum bereits bestens bewährt.
Höchste Zeit wird es, dass unsere Evangelische Kirche in Hessen und Nassau einen Passus in ihrer Kindergartenausschussverordnung aus dem Jahr 1992 (735) ändert, demzufolge als Vorsitzende und deren Stellvertreter im Kindergartenausschuss nur Mitglieder einer christlichen Kirche wählbar sind. Dass auf Antrag die Kirchenverwaltung nur für einen von beiden eine Ausnahme zulassen kann, halte ich für eine Vorgehensweise, die eine Tendenz zu einer in meinen Augen nicht hinnehmbaren Entwürdigung bzw. Ausgrenzung von engagierten Elternvertretern hat. In einem kleinen Akt zivilen Ungehorsams habe ich in unserer Gemeinde bereits zum zweiten Mal gegen diese Verordnung verstoßen, indem ich zugelassen habe, dass sowohl zur Vorsitzenden als auch ihrer Stellvertreterin eine Mutter muslimischen Glaubens gewählt wurde, denn ich hielt es nicht für verantwortbar, bei der Wahl zur Vorsitzenden des Kita-Ausschusses den Anwesenden zu erklären, dass nur christliche Vertreterinnen gewählt werden dürfen. Bei den letzten beiden Wahlen wäre im Übrigen eine Wahl unter diesen Voraussetzungen überhaupt nicht durchführbar gewesen, weil entweder alle oder die drei anwesenden von vier vorgeschlagenen Kandidatinnen muslimischen Glaubens waren. Wir sind froh und stolz darauf, dass seit einigen Jahren eine ganze Reihe türkisch(stämmig)er Mütter und in Einzelfällen auch Väter Verantwortung im Kita-Ausschuss übernehmen, und wären auch dann dagegen, sie vom Vorsitz im Ausschuss auszuschließen, wenn sich genug christliche Eltern für diese Aufgabe bereit erklären würden. Eine solche Abgrenzungslinie würde sich nicht mit einem evangelischen Profil, das sich an Freiheit und Liebe orientiert, vereinbaren lassen.
↑ 8.7 Geschichten teilen statt „missionarische Vereinnahmung“
Einem christlichen Profil entsprechend, das sich an Freiheit und Liebe ausrichtet, kann das Hauptziel eines evangelischen Kindergartens nicht darin bestehen, sozusagen als verlängerter „missionarischer“ Arm der Kirchengemeinde – salopp gesprochen – „die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen“, indem den Kindern möglichst viele evangelische Inhalte vermittelt und christliche Rituale mit ihnen vollzogen werden. Dem entspräche ein falscher, weil vereinnahmender und übergriffiger Begriff von Mission, der die Situation von Familien anderer Religionszugehörigkeit ausnutzen würde, die ihre Kinder – aus welchen Gründen auch immer – einer evangelischen Einrichtung anvertrauen. Wenn man überhaupt den belasteten Begriff der „Mission“ verwenden will, muss man ihn definieren als authentisches Bezeugen des eigenen Glaubens im respektvollen Gespräch mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, und zwar ohne irgendeinen Druck auszuüben, der mit einer Haltung evangelischer Freiheit unvereinbar wäre. So schwierig das in der Praxis auch umzusetzen ist: einer evangelischen Grundhaltung entspricht gerade die Kultur des Teilens mit dem Ziel der – auch religiösen – Beheimatung aller Kinder im Kindergarten als ihrem zweiten Zuhause.
Damit ist nicht gemeint, dass keine christlichen Inhalte im Kindergarten vorkommen dürften; im Gegenteil: gemessen am Wirkfaktor „Geschichten aus der Geschichte“ kann man Kindern gar nicht genug Geschichten erzählen – allerdings eben nicht ausschließlich Geschichten aus der vom Kindergartenträger repräsentierten religiösen Tradition. Vielmehr sollten Wege gesucht werden, um die religiösen Traditionen der Familien aller Kinder im Kindergarten zu berücksichtigen.
Das bedeutet den Verzicht auf eine bestimmte Art des im schlechten Sinne „missionarischen“ Erzählens biblischer oder koranischer Geschichten, nämlich so, als ob nur die eine, eigene Religion absolut wahr sei und alle Menschen, die etwas anderes oder gar nichts glauben, als „Ungläubige“ abgewertet werden.
Fundamentalisten aller Religionen werden einwenden: Aber unsere heiligen Bücher warnen doch eindringlich vor dem Unglauben!
Demgegenüber ist erstens zu sagen, dass nicht wir Menschen es sind, die über den Glauben oder Unglauben eines Menschen ein Urteil zu fällen imstande sind, sondern nur Gott selbst, der das „Gottesdenken der Religionen“ (736), also die Art, wie über Gott nachgedacht und geredet wird, absolut übersteigt.
Zweitens verläuft die Unterscheidung von „Glaube“ und „Unglaube“ nicht zwangsläufig entlang von Religionsunterschieden, da wahrer Glaube in einer Haltung des Gottvertrauens besteht, der wiederum eine Lebensführung nach dem Willen Gottes entspricht. Zwar wird nicht nur über Gott, sondern auch über seinen Willen und die Art und Weise, ihn erfüllen zu können, in den Religionen unterschiedlich nachgedacht, aber wer Menschen anderer Religion mit Respekt begegnet, wird davon ausgehen, dass auch sie auf ihre Weise in der Verantwortung vor Gott stehen und sich bemühen, ihr gerecht zu werden, wobei sie nicht mehr und nicht weniger auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind als man selbst.
Drittens kenne ich Menschen, die sich selbst als Atheisten bezeichnen oder als „ungläubig“ im Sinne einer Religionszugehörigkeit, die aber dennoch hohe ethische Ideale nicht nur vertreten, sondern auch leben (737).
Wer Kindern Geschichten aus verschiedenen religiösen Traditionen erzählt, wird die Unterschiede der Religionen nicht verschweigen, aber nicht zulassen, dass die eine oder andere Anschauung herabgesetzt wird. Im Teilen der Geschichten kann man darüber staunen, wie viel in den Religionen gleich oder ähnlich ist, man kann vieles voneinander lernen, aber auch merken, dass die Menschen verschiedene Dinge glauben. Und das ist gut so!
↑ Anmerkungen
(706) Dommel, Religions-Bildung, S. 465. Vgl. Kapitel 5.1, S. 81.
(707) Dommel, Diskriminierungsgrund, S. 152.
(708) Popp, S. 6, Anm. 25, mit Bezug auf Schoenborn, S. 45, Anm. 10. Vgl. auch Kapitel 6.1.1 und Molthagen.
(709) Harz, Bildung, S. 95.
(710) Harz, Erikson, S. 34.
(711) Sieg, Brücken, S. 609. Sie zitiert Ittmann, S. 52 und 53.
(712) Vgl. Hoffmann, S. 225: „Auch die Frage, inwiefern in einem Gespräch von Kindergartenkindern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit nicht auch Traditionsbezüge zu nichtchristlichen Religionen aufgezeigt werden sollten, ist zukünftig zu klären.“
(713) Harz, Bildung, S. 72.
(714) Dommel, Religions-Bildung, S. 423, wo sie auf Sieg, Hamburger Modell und Sieg, Pendeln, Bezug nimmt.
(715) Der in Dommel, Religions-Bildung, auf S. 90, 107 und 246 zitiert wird.
(716) Vgl. Marquard, Multiversalgeschichte, S. 73: „Die Kommunikation mit den Anderen ist unsere einzige Möglichkeit, mehrere Leben und dadurch viele Geschichten zu haben: und zwar nicht nur die – simultane – Kommunikation mit gleichzeitigen Anderen, sondern auch die – historische – Kommunikation mit Anderen anderer Zeiten und Kulturen, wobei gerade ihre bunte Andersartigkeit gebraucht wird und wichtig ist, die in der Kommunikation mit ihnen also nicht getilgt, sondern gepflegt und geschützt werden muss.“
(717) Siehe die Kapitel 6.5 und 6.6, in denen ich dazu ausführlich auf John M. Hull und Henning Luther eingehe.
(718) Vgl. Dommel, Religions-Bildung, S. 397 und 463.
(719) Vgl. den Zeitungsartikel von Keller/Martens.
(720) Bernhardt, Pluralistische Theologie, S. 168. Er zitiert „das sechste der neun Grundprinzipien, die auf dem sog. »Pluralist Summit« in Birmingham am 09.09.2003 verabschiedet wurden. Sie werden zusammen mit den dort gehaltenen Vorträgen in einem von Paul F. Knitter herausgegebenen zweiteiligen Sammelband unter dem Titel »The Pluralist Model for Understanding Religious Pluralism« veröffentlicht.“
(722) Schütz, Vertrauen, S. 283. Das Zitat ist im Abschnitt „Hilfe für Missbrauchsopfer in christlichen Gemeinden?“ im 10. Absatz zu finden.
(723) Dommel, Religions-Bildung, S. 281. Vgl. auch Kapitel 3.4.
(725) Vgl. meine Wissenschaftliche Hausarbeit zum Ersten Theologischen Examen: Schütz, Praxis.
(726) Luther, Freiheit, S. 2.
(727) Markusevangelium 12, 31; Matthäusevangelium 19, 19 und 22, 39; Lukasevangelium 10, 27. Außerdem wird das Liebesgebot sowohl von Jakobus (2, 8) als auch von Paulus im Galaterbrief 5, 14 und Römerbrief 13, 9 zitiert.
(728) Zitiert nach [B] Luther.
(729) Vgl. meine Ausführungen zu Bielefeldt im Kapitel 2.2.2.
(730) Doyé, Muslimische Erzieherinnen, S. 116.
(732) Koech, S. 117. Außerdem befürchtet Koech (ebd.), die Einstellung muslimischer Erzieherinnen könne die Gefahr bergen, „dass irgendwann jemand an dem verbrieften Recht der Kirchen, ihre Personalauswahl selbst zu regeln, rührt. Versuche auf europäischer Ebene hat es dazu bereits gegeben.“
Da die Öffentlichkeit sehr empfindlich gerade auf eine restriktive Personalpolitik der Kirchen reagiert (ich denke an Entlassungen langjähriger kirchlicher Mitarbeiter nach Kirchenaustritt oder – im Falle der katholischen Kirche – Wiederverheiratung Geschiedener), wird diese Gefahr kaum dadurch verstärkt, wenn kirchliche Institutionen von sich aus ihre Personalauswahl mit guten Gründen flexibler handhaben – und zwar nicht erst dann, wenn das Personal zunehmend knapp wird. Vgl. Kapitel 1.3.
(733) Doyé, Muslimische Erzieherinnen, S. 116.
(734) Vgl. die entsprechenden Paragraphen im Einstellungsgesetz der EKHN, die ich in Anm. 24 zitiert habe.
(735) Verwaltungsverordnung über die Bildung von Kindergartenausschüssen im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Kindergartenausschussverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 1992 (Amtsblatt 1992, S. 82):
㤠5 Sitzungen (1)
1 Der Kindergartenausschuss wählt aus seiner Mitte den/ die Vorsitzende(n) und dessen/deren Stellvertreter/in.
2 Wählbar ist, wer einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört.
3 Auf Antrag des Kirchenvorstandes kann die Kirchenverwaltung für einen von beiden eine Ausnahme zulassen.
4 Der/die Vorsitzende oder der/die Stellvertreter/in soll ein/e Elternvertreter/in sein.“
(736) Bernhardt, Theologische Grundlagen, S. 19. Siehe auch Kapitel 10.3.
(737) Besonders schätze ich die Auseinandersetzung mit Atheisten, die im Grunde, wie es der britische Autor der „Scheibenweltromane“, Terry Pratchett, mir gegenüber bei einer Autorenlesung im Jahre 1997 in Köln formulierte, auf Gott wütend sind, weil es ihn nicht gibt: „being angry with God for not existing“.
Vgl. Marquard, Irrational, S. 70: „Gott ist und bleibt, auch angesichts der radikal als schlimm erfahrenen Welt, der gute Gott genau dann, wenn es ihn nicht gibt, oder wenn er jedenfalls nicht der Schöpfer und Täter ist: das ist die radikale, die mögliche verbleibende Theodizee, die Theodizee durch einen Atheismus ad maiorem Dei gloriam.“
