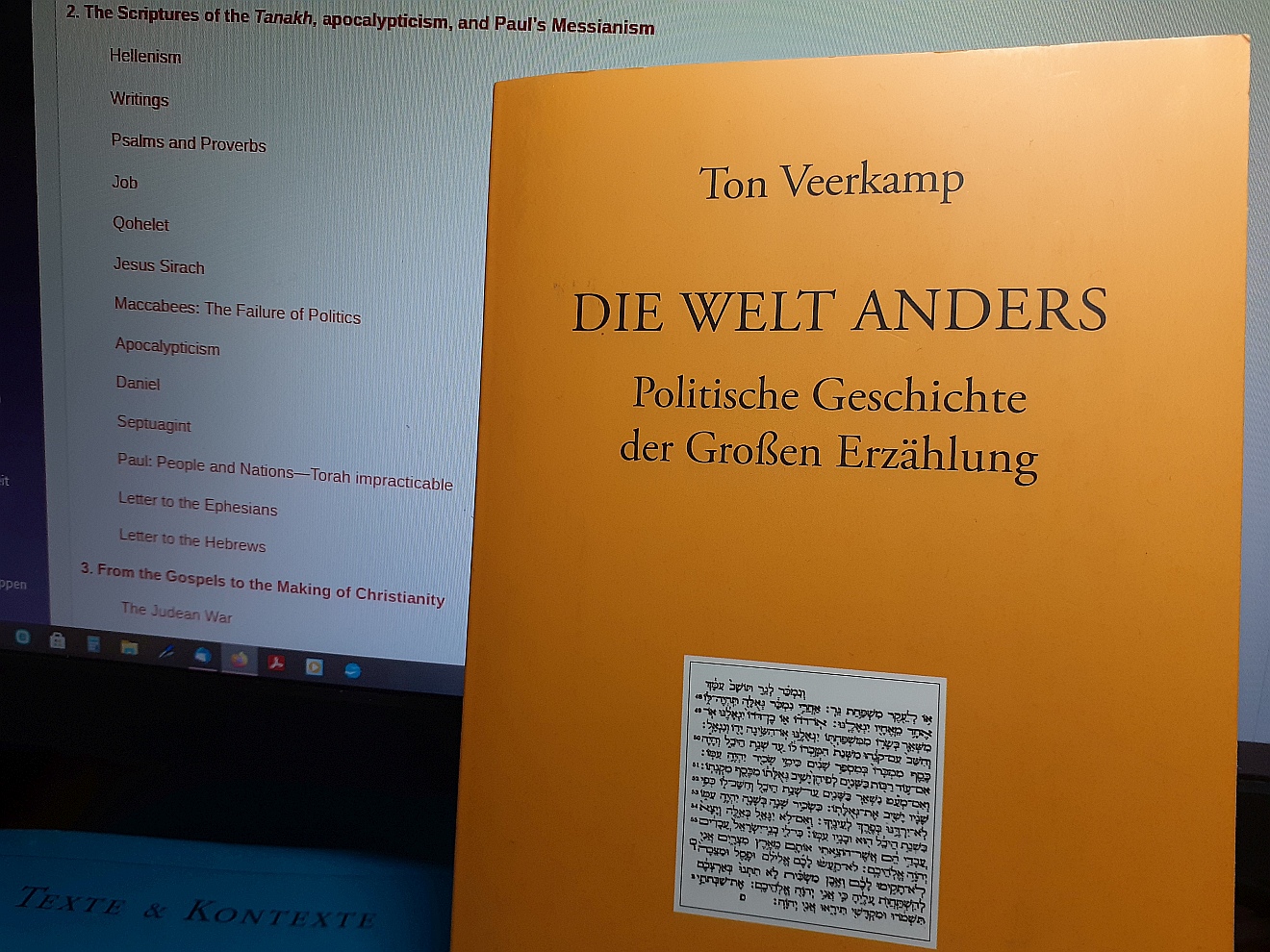Eigentlich sollte sein Buch „Nur Stimme“ heißen. Denn „Gott“ ist für Ton Veerkamp nach der „Großen Erzählung“ der Bibel kein höchstes Wesen, sondern die Stimme, die in der Tora Israels eine Grundordnung der Freiheit und Gleichheit absolut verbindlich zur Sprache bringt. In vier Vortragsentwürfen empfehle ich seinen herausfordernden Blick auf die Bibel dringend zur Lektüre. (A)
To the English version of this book review!
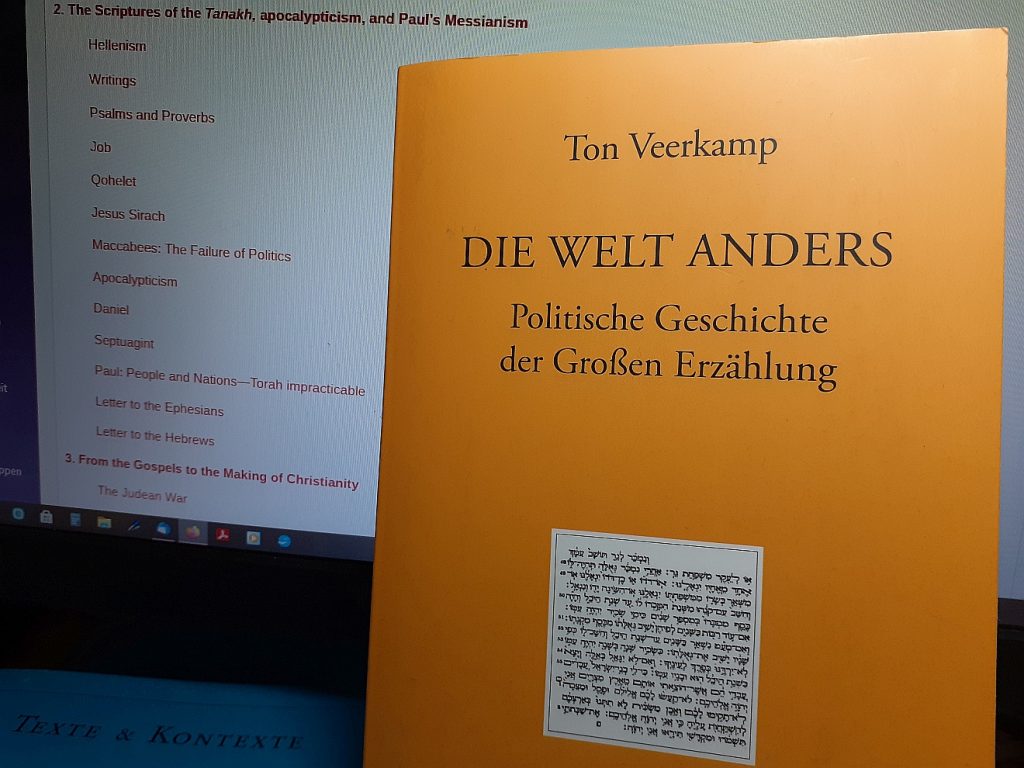
Inhaltsverzeichnis
1. Vom Werden der Tora und der Propheten
Verschiedene Lektüren der Bibel
Die Struktur der Großen Erzählung
Die Sprache der Großen Erzählung
Elia und Elisa, Amos und Hosea
Deuterojesaja (der zweite Jesaja)
Esra und Nehemia: Bildung der Torarepublik
Die fünf Bücher Mose – Geschichtsbuch der Torarepublik
Die Einheit der zweifachen Tora
2. Die Schriften des TeNaK und der Messianismus des Paulus
Makkabäer: Das Scheitern der Politik
Apokalyptik: Apolitische Politik
Septuaginta: Transkulturelle Höchstleistung
Paulus: Volk und Völker – Tora undurchführbar
3. Von den Evangelien zum Werden des Christentums
Große Erzählung – messianistisch interpretiert
Von den Pastoralbriefen bis zu Justin und Ignatius
Pseudo-Barnabas und Diognetbrief
Weggabelung: Judentum und Christentum
Irenäus und Quartodezimanerstreit
4. Die verwandelte Große Erzählung: Das Glaubensbekenntnis der Kirche
Renaissance der Antike: Apuleius und Plotin
Christliches Gegenmodell: Ecclesia und Dilectio
Neues Römisches Reich: Vom Prinzipat zum Dominat
Gesellschaftliche Platzzuweisung und christliche Religion
Verwandlung der Großen Erzählung: Nizäa bis Chalcedon
„Antijüdisch-christliche Tradition“
Augustin über den Staat Gottes
↑ Einleitung: Große Erzählung
Obwohl es seit der Deutschen Wende 1989 nicht mehr „in“ ist, hält Ton Veerkamp an dem Ziel fest, die Welt zu verändern – hin zu einer Gesellschaft ohne Ausbeutung, (5) „in der niemand Sklave und niemand Herr sein soll“. Ausbeutung versteht Veerkamp, (72) wie Karl Marx sie definiert hat, nicht als ethisch verwerflich, sondern als ein Wirtschaftssystem, innerhalb dessen sich Teile der Gesellschaft das von den Produzenten erarbeitete „Mehrprodukt“ in bevorzugter Weise aneignen. Und die Bibel versteht er als das Dokument einer „Großen Erzählung“, die die Sehnsucht nach „Freiheit und Gleichheit“ wachhält.
Eine Große Erzählung ist etwas, (421) worin die Mehrheit der Menschen in einer Gesellschaft „wohnen“ kann, in der sie auch ihr individuelles Leben wiederfinden und durch die sie wissen, wo sie hingehören. In der Neuzeit gab es zwei Große Erzählungen, die sich als nicht religiös verstanden haben, erstens die des Bürgertums, deren Vision die „Emanzipation aus traditionellen Abhängigkeiten“ war, und zweitens die „Erzählung der Arbeiterbewegung von der Befreiung aus der Abhängigkeit vom Privateigentum an Produktionsmitteln und von der Solidarität der Menschen“. Im heutigen Liberalismus, (14) der nur noch Individuen kennt, die um möglichst viel Profit konkurrieren, gibt es keine Große Erzählung mehr; die Menschen bleiben „unbehaust“.
↑ 1. Vom Werden der Tora und der Propheten
Mein erster Vortrag handelt von Israel und Juda unter der Oberherrschaft von Assyrien, Babylon und Persien.
↑ Hellas und Israel
Ton Veerkamp setzt ein (15ff) mit einem Vergleich der altisraelitischen und der altgriechischen Gesellschaft. Die Große Erzählung der alten Griechen ist durch die Epen Homers und durch Philosophien vom Ursprung und vom Werden aller Dinge geprägt. Die sogenannten vorsokratischen Philosophen beginnen in derselben Zeit zu wirken wie die biblischen Propheten Jeremia und Hesekiel, also seit dem 6. Jahrhundert v. Chr.
In Hellas gibt es Freiheit nur für wenige Mächtige. In der Ausübung ihrer Macht haben sie die Wahl zwischen Maß und Maßlosigkeit (Hybris); das Herrschaftssystem als solches gilt als unabänderliches Schicksal (Tyche), dem sich die Menschen mit Notwendigkeit (Ananke) unterwerfen müssen. Der Staatsreformer Solon will ein Rechtssystem einführen, das den Machtmissbrauch der Herrschenden einschränkt, u. a. durch den Erlass von Schulden.
Als Nehemia in Israel ähnliche Maßnahmen ergreift, (16) nämlich „einen Schuldenerlass und eine Bodenreform“, kann er auf oppositionelle Visionen eines sozialen Rechtes zurückgreifen, die es im Land bereits gibt. Hier ist nicht ein weiser Mensch wie Solon, (17) sondern Gott selbst durch Mose „der eigentliche Gesetzgeber“. Hier (18) gibt es keine Tragödien, keine tragischen Helden, die an dem, was das Schicksal ihnen zuteilt, notwendig scheitern müssen. Vielmehr sind die Gesetze der Rechtsordnung, die Gott selber „ist“, grundsätzlich für alle Menschen verständlich. Daher sind die Menschen auch verantwortlich für das, was ihnen geschieht.
In Israel (20) soll es grundsätzlich weder Sklaven noch Herren geben. Das ist zwar auch hier praktisch nie der Fall, aber Israel stellt die eigene „Klassengesellschaft unter die radikale Kritik seiner Großen Erzählung“. Israel will nach Veerkamp „die Ermöglichung von Egalität“, Griechenland will nur „die Zähmung der Tyrannen.“ Das ist auch (21) „der tiefste Grund für das Gebot der Trennung von den Völkern“, bei dem es nie um eine religiöse Überlegenheit der monotheistischen Religion oder gar um eine moralische Überheblichkeit des jüdischen Volkes geht.
↑ Verschiedene Lektüren der Bibel
Ton Veerkamp plädiert dafür, (24ff) die Große Erzählung der Bibel wieder möglichst originalgetreu zu lesen. Denn wir Christen haben sie 2000 Jahre lang „allegorisch“, das heißt, „anders“ gelesen: also nicht mehr bezogen auf Israel und den Platz dieses einen Volkes inmitten der Völker, sondern als Heilsgeschichte für die ganze Welt. Das wird dann zu einem Problem, wenn Juden genötigt werden sollen, die christliche Lesart anzuerkennen, also z. B. dass Jesus Christus auch für sie gestorben ist.
Auch den Folgen (25) der historisch-kritischen Methode begegnet Veerkamp mit Skepsis, denn durch sie wird der Gesamttext der Großen Erzählung in ähnlicher Weise zerstört wie die sozialen Strukturen „im Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft“. Im Grunde (26) sucht Veerkamp ein wirksames „Defragmentierungsprogramm“, um die Einzeltexte der Bibel wieder als Teile eines Ganzen zu lesen. Die Bibel als Ganzes entsteht auf Grund von Veränderungen der altisraelitischen Gesellschaft und wirkt verändernd auf diese Gesellschaft zurück.
↑ Josia und die Tora
Zentrale Bedeutung für die Große Erzählung Israels hat (33ff) die Geschichte der Auffindung der Tora im Tempel von Jerusalem unter König Josia im Jahr 623 v. Chr. In dieser Zeit bricht das assyrische Reich zusammen, so dass die Gelegenheit günstig scheint, sich aus der Abhängigkeit von Assyrien zu lösen und die Selbstständigkeit von Jerusalem und Judäa als Mittelmacht zwischen Ägypten und Mesopotamien zu festigen. Darum schafft Josia den assyrisch geprägten Staatskult ab, der seit Mitte des 8. Jahrhunderts bis auf die Zeit Hiskias auch in Jerusalem betrieben wurde.
So wird zum Beispiel (41) in Jerusalem im Tal der Söhne Hinnoms (ge bene-hinnom), aus dem später die Gehenna oder Hölle werden sollte, die Opferstätte zerstört, an der Kinder dem Moloch geopfert wurden. „Moloch“ heißt an sich einfach „König“; tatsächlich ist es der eigene Gott Jahu, dem diese Opfer gegolten haben.
Deswegen hält sich Veerkamp an die jüdische Regel, den Namen Gottes, in der hebräischen Bibel mit JHWH bezeichnet, nicht auszusprechen; er umschreibt ihn im Deutschen mit dem Wort „der NAME“, groß geschrieben. „Ein Grund dafür, dass der NAME nie wieder als Jahu (Jahwe) ausgesprochen werden sollte, war das Bestreben, jegliche Verwirrung des NAMENS mit dem Stadtdämon Jahu, die bis tief in die persische Zeit andauerte, auszuschließen.“
Die (40f) Kulturrevolution, die Josia durchführt, ein regelrechter Bildersturm, wird nicht als Modernisierung, sondern als Rückkehr zur uralten Tora dargestellt. Mit der Umwandlung (42f) des ehemaligen Frühlingsfestes Pesach in ein Befreiungsfest aus dem Sklavenhaus verankert Josia die Tora in der Erinnerung des Volkes.
Zwanzig Jahre (46ff) nach Josias Tod geht dennoch das Königreich Juda unter. Schuld daran ist nach Propheten wie Jeremia die Politik der Könige vor und nach Josia. Die nach Ägypten geflohene Rest-Oberschicht Judas macht aber eher Josias Chaos-Politik und Jeremias Propaganda für den Untergang verantwortlich.
↑ Die Struktur der Großen Erzählung
Die Bibel (50) ist nicht orthodox, sondern vielschichtig. Sie besteht aus vielen Büchern und ist dennoch einheitlich, wenn auch nicht ohne Widersprüche wie ein Parteiprogramm.
Nach Veerkamp begreift die Bibel Gott nicht als „höchstes Wesen“, sondern als die Beschreibung einer Funktion. Diese Definition erinnert an Martin Luthers Satz: “Worauf du nu . . . Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.” (B) Ton Veerkamp meint also: „Es existiert kein Wesen Gott, so wie es kein Wesen, sondern nur die Funktion ‚König‘ gibt.“ Das Wort „Gott“ beschreibt, (51) was in einer Gesellschaftsordnung „als zentrales Organisationsprinzip für Autorität und Loyalität“ funktioniert. Das ist gemeint, wenn man in der Antike fragte: „Was ist sein [Gottes] Name?“
In Israel (53) ist dieser Name unaussprechlich, „der NAME ist ‚nur Stimme‘.“ Er hat keine Gestalt, man darf kein Bild von ihm machen und anbeten. Er ist gefüllt mit dem, was er tut; er führt aus dem Sklavenhaus, er befreit. Das altbekannte Wort „Gott“ bekommt einen neuen Namen, einen neuen Inhalt. (55) „Der NAME ist die Chiffre für eine Grundordnung, welche die Sklaverei ausschließt, Ba‘al ist die Chiffre für eine Gesellschaft der großen Eigentümer, die Sklaverei zwingend voraussetzt.“
↑ Die Sprache der Großen Erzählung
Trotzdem (56) kommt die Bibel nicht darum herum, den NAMEN in metaphorischer Redeweise als (vorwiegend männliche) Person auftreten zu lassen. Darum sind Missverständnisse unausbleiblich. „Tatsächlich war der Gott Jahu, der in Samaria und Jerusalem verehrt wurde, ein altorientalischer Gott wie alle anderen altorientalischen Götter, die Religion Israels prinzipiell keine andere als die altorientalischen Religionen auch.“
Aber es geschieht etwas (57) mit der Metapher des Königs. Israels Gott wird nicht mehr in Analogie zu absolut herrschenden menschlichen Königen gedacht, sondern nur noch der NAME darf mit Recht „König“ genannt werden. Denn nur dieser wahre König versklavt nicht wie andere Könige, sondern er befreit von jeder Sklaverei. Wer die Bibel ernstnehmen will, muss beachten, dass hier nirgends Gott in eine Reihe mit menschlichen Herrschern gestellt werden soll, sondern jede Art der Herrschaft wird vom befreienden und Recht schaffenden Handeln Gottes her kritisiert. Das gilt auch (59) für das alte Judäa, das „immer eine Klassengesellschaft war“.
Die Mehrheit der Bevölkerung verstand den NAMEN damals aber eher „normal“ wie jeden anderen Gott, und die Bibel kann bis heute so gelesen werden, als ob Gott ein Tyrann sei wie andere menschliche Herren. Aber so übertritt man das erste Gebot. „Aufgabe der Theologie ist es, solch falsches Bewusstsein aufzubrechen und Wissen herzustellen. Es war immer eine Minderheit, die den Widerspruch zwischen ‚Gott als Herrn‘ und dem NAMEN zur Sprache brachte und versuchte, eine völlig andere Politik einzuleiten. Das war das Geschäft der Propheten.“
↑ Elia und Elisa, Amos und Hosea
Im (60) 6. Jahrhundert v. Chr. bereiten die großen Propheten eine völlig neue Gesellschaftsordnung vor. Ein Text wie Exodus 6.2ff zeigt, dass der NAME in Israel als etwas völlig Neues erscheint; vorher war der Gott Israels genau wie alle anderen Götter der Völker, „ein El Schaddai, der Gott, der die Gewalt ausübt, ein Allgewaltiger, ein Pantokratōr wie Zeus.“
Die Propheten wollen, dass die Heimkehrer aus Babylon gemeinsam mit den Daheimgebliebenen eine neue Gesellschaftsordnung der Freien und Gleichen aufbauen, was im 5. Jahrhundert unter Esra und Nehemia auch ansatzweise in die Tat umgesetzt wird.
In (61) den Büchern der Könige (1. Könige 17 bis 2. Könige 13) wird allerdings rückblickend berichtet, wie schon der Prophet Elia im 9. Jahrhundert v. Chr. im Nordreich Israel gegen König Ahab, Königin Isebel und die Verehrung des Gottes Baˁal kämpft und wie sein Nachfolger Elisa mit der Salbung Jehus zum König einen blutigen Umsturz und die Verehrung des Gottes Jahu in Gang setzt. Tatsächlich tauchen in den historisch überlieferten Königslisten dieser Zeit erstmals Namenszusätze auf mit -ja oder -jahu am Ende und Jo- oder Jeho- am Anfang. Vorher hatten viele Namen den Zusatz -‘el oder -ba‘al gehabt. Die Geschichten (62) um Nabots Weinberg zeugen vom Widerstand dagegen, „dass der Staat Grund und Boden zu marktfähigen Waren machte“. Dass der Prophet Elia als „legendäre Gestalt … ohne jede Einbindung in das Vorangehende eingeführt“ wird, ohne Nennung seines Vaternamens, also ohne „Geschichte“, (63), „wie vom Himmel gefallen“ und er „auch wieder – in den Himmel“ verschwindet (2 Könige 2)“, deutet auf den Charakter eines solchen prophetischen Eingriffs „in den gesellschaftlichen Prozess“ hin, der „ohne Kontinuität“ erfolgt, „er ist keine Entwicklungsstufe, er ist die Revolution.“
Allerdings (64) war König Jehu in den Augen schon des Propheten Hosea eher durch einen normalen Militärputsch an die Macht gekommen, als dass er eine soziale Revolution auslöste. Und (63) nach einer „Stele, die 1993 bei Ausgrabungen bei Tel Dan im heutigen Nordgaliläa gefunden wurde“, werden zwar die Namen der Könige Ahab und Jehu historisch verbürgt, aber anders, als die Königsbücher berichten, hat nicht Jehu, sondern König Hasael von Damaskus die Nachfolger Ahabs getötet. Der Militärputsch Jehus wird nachträglich in eine soziale Revolution umgedeutet. Aus historischer Sicht war „Israel … ein normales altorientalisches Gebilde, mit Jahu als Staatsgott und Jehu als einem von der Mittelmacht Aram-Damaskus eingesetzten Vasallen. Nach der Zerschlagung von Aram-Damaskus durch Assur konnte Israel unter Jarovam II. [Jerobeam II.] seinerseits zu einer Mittelmacht aufsteigen.“
Und nun kommen die ersten historisch und nicht nur legendarisch bezeugten Propheten ins Spiel. So tritt zum Beispiel der Feigenzüchter Amos aus dem Südreich gegen König Jerobeam II. auf, wendet sich gegen den Jahukult in Bethel und leistet Widerstand gegen Ausbeutung.
Für (65) den Propheten Hosea im Nordreich ist Gott „eine Ordnung, die von Ägypten befreit“; im Volk sollen an sich „Bande der Menschlichkeit …, Stricke der Liebe“ (Hosea 11, 4) herrschen. Aber tatsächlich übernehmen die Assyrer die Rolle der Ägypter, und schon unter dem eigenen König ist Israel zum Sklavenhaus geworden. Hosea übt praktische Kritik an der Institution „König“. Bei ihm (67) wird „aus dem Staatsgott Jahu der NAME JHWH, vollkommener Widerspruch zu allen Göttern“.
↑ 5. Buch Mose – Deuteronomium
Das 5. Buch Mose, (68) auch Deuteronomium, 2. Gesetz, genannt, enthält altehrwürdige Gesetzesparagraphen, ist aber nach Veerkamp vermutlich erst nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 587 v. Chr. in einem Judäa ohne König zusammengestellt worden. Es predigt nicht, (72) dass Ausbeuter die Ausgebeuteten gnädigerweise gerechter behandeln sollen, sondern die Ausbeutung als solche wird in einer „Gesellschaftsordnung der Freien und Gleichen“ abgeschafft. Der „Gott“, der dafür steht und also ganz anders ist als ein himmlischer Tyrann, kann erwarten, dass man ihn nicht fürchtet, sondern liebt (Deuteronomium 6, 5). Nach der Verwüstung Jerusalems erteilt das Deuteronomium allen Staatsillusionen eine Absage und greift auf Hosea zurück.
Im Rückblick (70) hält es die Weigerung, ins Land zu ziehen, für den schwerwiegendsten Vorfall während der Wüstenwanderung. Die Zahl 38 spielt dabei eine besondere Rolle (Deuteronomium 2, 14). Denn 38 Jahre liegen zwischen der Zerstörung Jerusalems 587 und der Zerschlagung des Mederreichs durch den Perserkönig 549.
Veerkamp (74) verortet das Deuteronomium in den Kreisen derer, die zwischen 587 und 520 in vom Krieg verschonten Gebieten den historischen Zufall nutzten, dass es die Großmacht Babel versäumte, „eine neue Eliteschicht anzusiedeln“. Er vergleicht die hier durch viele Gesetzesvorschriften gründlich (75) „regulierte Anarchie“ (Christian Sigrist), mit heutigen „akephalen“ Gesellschaften ohne zentralstaatliche Institutionen wie in Afghanistan oder Westafrika.
Da man (77) die tief verwurzelte Neigung zum Opferkult nicht abschaffen kann, wird er streng geregelt und nur an einer zentralen Stelle zugelassen; (80) Kinderopfer und den Kult der Himmelskönigin gibt es nach 400 v. Chr. jedenfalls nicht mehr.
Gerade indem (78) Israel ein heiliges Volk sein soll, wird sein alltägliches Leben entsakralisiert, von allen Götzenkulten befreit. Dezentral geregelt werden „die Abgabenverwaltung, das Rechtswesen und die Kriegsführung.“ Einen König muss es in Israel nicht geben; wenn es aber doch einen gibt, (79) soll er – die Tora lesen und verkörpern!
↑ Jeremia
Im (81) Todesjahr des letzten großen assyrischen Königs Assurbanipals, 627/626 v. Chr., fängt der Prophet Jeremia an zu wirken, im dreizehnten Jahr des Königtums Josias (Jeremia 1, 2). Er mag bis dahin zur oppositionellen Untergrundbewegung gehört und Josias Politik-Umstellung mit vorbereitet haben.
Als (82) Gott im Reich Juda unter der Regierung von Jojakim und Zedekia (608-587) wieder ein Normalgott unter anderen Göttern und Göttinnen wird, zerreißt König Jojakim die Gottesworte Jeremias, die Baruch aufgeschrieben hat. Josia hatte dagegen vor Trauer seine Kleider zerrissen, als ihm die Tora vorgelesen worden war. Jeremia vertritt nur eine kleine Minderheit am Königshof, findet kein Gehör, wird verfolgt und schließlich von der aus Judäa fliehenden Rest-Elite mit nach Ägypten verschleppt.
Jeremia (83f) sieht eine Zukunft für einen König aus dem Haus David voraus, der „Recht und Wahrheit“ tut, (84ff) und wendet sich wie die Propheten Hosea, Micha, Amos und Jesaja gegen jeden Tempelkult. Priesterliche Vermittler zwischen Gott und den Menschen werden nicht mehr gebraucht, (86) denn Gott selbst wird seine Tora in ihre Herzen einschreiben (Jeremia 31, 33).
Ähnlich (87) sieht später der Hebräerbrief den Tempelkult abgelöst durch „das Vertrauen in den Messias“. Aber eine solche Gesellschaft ohne Kult, die von der Opposition gegen die Tempelhierarchie nach 515 v. Chr. angestrebt wurde (Jesaja 1, Amos 5, Micha 6 und Psalm 41, Jeremia 7.21ff und 31.31-34), war „zu keiner Zeit politisch durchsetzbar gewesen“.
↑ Ezechiel (Hesekiel)
Der (93) Priester Ezechiel (Hesekiel) gehört zur Jerusalemer Oberschicht, die 597 nach Babel deportiert wird. Dort kommt über ihn eine „völlig neue Sicht auf Gott (marˀot ˀelohim)“, durch die er erkennt, dass die Kultobjekte, die die Söhne Josias wieder in den Tempel geschafft haben, etwas Scheußliches, nicht Anbetungswürdiges, sind. In einzigartiger expressionistischer Sprache (95) verkündet Ezechiel „schonungslos, aber nicht hoffnungslos“ den NAMEN als den Gott, (96) der „erforschlich“ ist, der (97f) einen Staat und (99ff) (im Gegensatz zu Amos, Hosea, Micha und Jeremia) auch einen Kult will, der ausschließlich dem Recht dient.
In (98) Ezechiel 34 sieht Veerkamp ein Musterbeispiel der Beschreibung einer Klassengesellschaft („drängen, stoßen, fettes Schaf, mageres Schaf“). Nicht ein König, wie es ihn bisher gab, sondern ein „Erhabener in eurer Mitte“ aus dem Haus David soll „eine gesegnete Zeit“ heraufführen, in der „ausgedörrten Knochen Lebensgeist eingehaucht“ wird. Das (101) „Gebiet in der Breite des Heiligtums, das sich in der Länge vom Mittelmeer bis zum Toten Meer ausstreckt (Ezechiel 45.7f)“, das dieser Erhabene erhält, „trennt und vereinigt zugleich das Haus Israel und das Haus Jehuda“. Neben Jojakins Enkel Serubbabel, der dann wirklich von den Persern als Bevollmächtigter für Judäa eingesetzt wird, bekommt allerdings „der Großpriester des neuen Heiligtums eine Machtposition, die der Serubbabels ebenbürtig war“, wie beim Propheten Sacharja nachzulesen ist.
Das (100) Buch Levitikus wird den Kult im Sinne Ezechiels regeln. In Ezechiel 40-48 zeigt sich bereits der Konflikt zwischen den später herrschenden zadokitischen und den niederen levitischen Priestern. Zadok war als Nachfahre Aarons ein bedeutender Priester zur Zeit von König David gewesen.
Die (98f) Kapitel 38 und 39 sind bereits apokalyptisch geprägt: Gott selber wird den Kampf gegen „Gog aus dem Lande Magog“ führen. Schon dort (98) ist „die Welt der Völker … eine Welt, in der ‚ein Land von Bauern, von Beruhigten, die in Sicherheit wohnen, ohne Mauer, ohne Riegel, ohne Türen‘ nicht existieren kann, 38.11.“
↑ Deuterojesaja (der zweite Jesaja)
In (88) der hebräischen Bibel zählen die vier Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige zu den Vorderen Propheten. Die Hinteren Propheten Jesaja, Jeremia, Ezechiel und das Zwölfprophetenbuch sind alle gleich aufgebaut: der Ankündigung des Gerichts ans eigene Volk folgen das Gericht über die Völker und die Verheißung eines Neuanfangs.
Im Buch Jesaja beziehen sich nur die Kapitel 1-39 auf den Propheten dieses Namens, der 740 v. Chr. berufen wird und sowohl Kritik am Volk übt als auch „in der assyrischen Krise des 8. Jahrhunderts“ Trost spendet. (89) In den Kapiteln 40 bis 66 werden nach der Rückkehr aus Babylon Worte anderer Propheten angefügt.
Ihren wichtigsten Vertreter nennt die theologische Wissenschaft „Deuterojesaja“, den zweiten Jesaja. Er gehört zur Gola, also zu den nach Babylon Verschleppten, und ist davon überzeugt, dass der Gott Israels den persischen König Kyros als sein Werkzeug benutzt, um das Volk wieder in sein Land zurückzuführen.
Deuterojesaja (90ff) kennt die persische Religion, in der die Mächte des Lichts und der Finsternis ewig miteinander kämpfen, vertritt aber selbst eine völlig andere Schöpfungstheologie, denn alles, was der Gott Israels schafft, ist sehr gut. Das ist keine Welterklärung, sondern politische Theologie. Deuterojesaja (92) wagt es, den Gedanken zu denken, dass das persische Reich und die gesamte Schöpfung im Grunde nur dazu da sind, den Israeliten die Kraft zu geben, aus Babel wegzuziehen.
Inspiriert durch Jesaja 40-48 wurde „das Lehrgedicht über den Schöpfer“ in Genesis 1.1-2.4a zum Auftakt der Heiligen Schrift und „zum Fundament aller Politik, die auf die Veränderung der Welt zielt und hofft.“
↑ 1. Buch Mose – Genesis
Damit sind wir bei Veerkamps Analyse des 1. Buchs Mose, der Genesis angelangt. (102) Unsere Theorien der Entstehung der Welt und der Evolution des Lebens werden durch Genesis 1 „weder entkräftet noch bestätigt“. Vielmehr gilt: Alles hat seinen Ursprung in der Macht des Schöpfers und Gottes Israels. „Schöpfung heißt, dass es für Israel – und wir fügen hinzu: für die Menschheit – immer und überall eine Alternative zu allen herrschenden Verhältnissen gibt.“
Veerkamp folgt in der Betrachtung des Buches Genesis dem niederländischen Theologen Frans Breukelman, der die Struktur des Buches als eine Abfolge verschiedener Zeugungen (Toledot) beschrieben hat.
Die „Zeugungen von Himmel und Erde“ leiten die hebräische Bibel (103) als eine „biblische Anthropologie“ ein: (102) „Der Mensch als Bild und Gleichnis Gottes ist Mann und Frau, Gen 2-3, der Mann und sein Bruder, Gen 4. Die Ordnungen, in denen die Menschen tatsächlich leben müssen, stehen in schroffem Gegensatz zu der tiefsten und intimsten Zusammengehörigkeit von Männern und Frauen und zur Solidarität (‚Brüderlichkeit‘) unter den Menschen. Der Mann beherrscht die Frau, der Mann mordet seinen Bruder. Das Essen von der verbotenen Frucht, die Verwirrung jenes Ebenbildes Gottes, das die Menschheit ist, mit dem Anspruch auf göttliche Macht über die Schöpfung, des Mannes über die Frau, des Mannes über seinen Bruder“ steht als Symbol für diesen (103) „Irrweg der Menschen (chataˀ, die eigentliche Ursünde), auf dem sie bis heute gehen.“
Das eigentliche „Buch der Zeugungen von ‘Adam, Menschheit“ unterteilt sich in insgesamt neun Zeugungen:
- Die Urväter zeugen jeweils „einen Erstgeborenen unter vielen Brüdern und Schwestern“ (5.1b-6.8).
- Noah bewältigt „die große Flut“ (6.9-9.17).
- Sem, Ham und Japhet bilden den „Ursprung der Völkerwelt“ (10.1-11.9),
- Sem im besonderen den Ursprung „der semitischen Völker“ bis Abram (11.20-26).
- Terachs Zeugungen enthalten (11.27-25.11) „die ganze Geschichte Abrams (erhabener Vater), der zu Abraham (Vater einer Menge) wurde“. Auffälligerweise fehlt ein Kapitel der „Zeugungen Abrahams“, weil Isaak „der einzige, einziggeborene Sohn“ ist, den „der NAME für sich in Anspruch nimmt (Gen 22!)“
- Ismael wird als „Ursprung der Bewohner der Wüsten des Südens“ erwähnt (25.12-18).
- Isaaks Zeugungen enthalten im Rückblick auch die Zeugung Isaaks durch Abraham sowie die gesamte Geschichte Jakobs, „des Erstgeborenen, der nicht Erstgeborener war und dennoch zum Erstgeborenen wurde“, bis hin zum Frieden „zwischen den verfeindeten Brüdern“ Esau und Jakob (25.19-35.29).
- Das Kapitel (103f) der Zeugungen Esaus bzw. Edoms (36.1-37.1) „ist nötig, weil Edom eine Schicksalsrolle in der Geschichte Judäas spielt, als Nutznießer des Elends nach der Zerstörung Jerusalems bis hin zur Rolle der Idumäer (Edomiten) Antipater und Herodes (s. Obadja, Ps 60.2, Ps 137.6 u. ä.).“
- Jakobs Zeugungen (104) enthalten die „Geschichte von Joseph und seinen Brüdern“ (37.2-50.26).
So werden die ursprünglich getrennt voneinander überlieferten Erzählungen von Abraham, Isaak und Jakob zu einer Familiengeschichte verschmolzen; im Hintergrund steht das Interesse, die „Einheit der beiden Häuser“, des Nordreichs Israel und des Südreichs Juda in einem Land zu begründen.
Mehrfach bewegen sich die Väter hin und her zwischen dem versprochenen Land und Mesopotamien bzw. Ägypten. (104f) „Die politische Lage des Erstgeborenen unter den Völkern zwischen den großen Mächten, die den Völkerozean dominierten, gibt den Grundrahmen der Toraerzählung ab.“
Indem Genesis 47.23-26 weniger die Vergangenheit (105) als „die tatsächlichen Verhältnisse im Ägypten des 6. Jahrhunderts v.u.Z.“ beschreibt, erweist sich (106) die Genesis „weniger als Buch über vergangene Geschichte als vielmehr als politische Zukunftsmusik für die Menschen im babylonischen bzw. ägyptischen Exil“. Denn (105) die letzten Könige Jerusalems hatten sich innen- und außenpolitisch an Ägypten orientiert, und die nicht nach Babylon deportierten Eliten Judas waren nach Ägypten emigriert. „Ein radikaler Neuanfang setzte die Befreiung von Ägypten, von ägyptischer Politik und von ägyptischen Verhältnissen zwingend voraus.“
↑ Esra und Nehemia: Bildung der Torarepublik
Bevor Veerkamp die drei mittleren Bücher der Tora behandelt, geht er auf die Bücher Esra und Nehemia ein. In ihnen (123f) sieht er das grundlegende Dokument der politischen Geschichte Israels, nämlich die Bildung einer Torarepublik.
Was (107) zwischen 515 und 445 v. Chr. geschehen ist, ist nicht eindeutig zu klären, nicht einmal, ob Nehemia als persischer Statthalter mit judäischen Wurzeln 445 oder 384 nach Jerusalem kam, da es zwei persische Könige gab, die Artaxerxes hießen.
Zu unterscheiden ist zwischen den Judäern, „die nach der Zerstörung Jerusalems im Land geblieben waren“ und denen, „die nach Babel verschleppt wurden“. Die letzteren, die Gola genannt wurden, bildeten bald wieder eine herrschende Schicht. Die ersteren, die Pleta, hatten „unter der Herrschaft der Gola zu leiden“. So blieb die judäische Gesellschaft voller Klassengegensätze, und der neu erbaute Tempel blieb „eine normale phönizische Institution mit einem phönizischen Kult.“ Esra und Nehemia versuchten, das zu ändern. Esra versuchte, die Gola dazu zu bewegen, sich an die Tora zu halten. Nehemia wollte durch eine umfassende Gesellschaftsreform (108) die „üble und schmachvolle Lage“ der Pleta überwinden. Manches gelang, anderes nur ansatzweise, vieles gar nicht.
Das Projekt, die beiden Häuser Juda und Israel wieder zu vereinigen, scheiterte daran, dass der Davidide Serubbabel das Angebot der Bewohner Samarias ablehnte, gemeinsam mit der Gola den Tempel zu errichten. So gibt es (109) für die Bücher der Chronik die Einheit der beiden Häuser als Ziel der Politik nicht mehr. (110) „Der Norden findet daher in diesem Geschichtswerk nicht mehr statt.“
Der unvermeidliche Kult (111) wurde „entgiftet“, indem die Erzählung der Bindung Isaaks in Genesis 22 den Menschen erklärte, dass Gott selbst, der NAME, geboten habe, das Opfer des erstgeborenen Sohnes durch ein Tieropfer abzugelten; nur die Erstgeburt des Viehs und die Erstlinge der Ernte mussten weiterhin geopfert werden.
Mit dem (113ff) unsozialen Chaos, das die Prophetenbücher Tritojesaja, Haggai und Sacharja widerspiegeln, versucht Nehemia als Abgesandter des persischen Hofes aufzuräumen. Er stärkt die Opposition, zu der wohl auch Nehemias Bruder Hanani gehört, lässt gegen den Widerstand Samarias die Stadtmauer neu errichten und ergreift Maßnahmen gegen die Hungersnot, die Verpfändung des Grundbesitzes und den Verkauf junger Frauen als Sklavinnen auf dem Land. Gegen einflussreiche von Abgaben befreite Menschen und Verwaltungsbeamte (Chorim und Seganim), die Felder und Weinberge kleiner Grundbesitzer an sich gebracht haben, setzt er einen Schuldenerlass und eine Bodenreform durch. Weiterhin (116) siedelt Nehemia in der Stadt „Menschen von priesterlicher und levitischer Herkunft“ an, „daneben wahrscheinlich Handwerker“. Um den Bau von Häusern zu finanzieren, werden Sondersteuern erhoben; einen Teil der Kosten übernimmt der Gouverneur selbst. Judäa hat damals wohl 50000 Einwohner, Jerusalem 5000.
Die Kapitel (117ff) Nehemia 8-10 enthalten die notariell beurkundeten Gründungsdokumente der Torarepublik, die (118) „von allen Israeliten, Männern und Frauen (ein rares Beispiel inklusiver Sprache, gerade hier!) und den größeren Kindern (alle, die zuhören und verstehen konnten), mit klarem Verstand verabschiedet werden“. Dabei garantieren 13 Priester gemeinsam mit dem Priester und Schriftgelehrten Esra die Autorität der Tora, und 13 Leviten sind – im doppelten Sinne – für die Bildung des Volkes zuständig.
Nach der Proklamation der Tora (119ff) weint das Volk zunächst; um die Gründung der Torarepublik zu feiern, wird ein Erntedankfest zum Hüttenfest (sukkot) umgewandelt, an dessen Ende die Freude an der Tora steht (simchat tora). So (123) nutzen die Judäer den geringen Spielraum unter der persischen Oberherrschaft, um „eine Grundordnung von Autonomie und Egalität“ zu verabschieden. (125) „Zum ersten Mal wurde ein Gemeinwesen gegründet, das sich radikal von der Ausbeutungsordnung des Alten Orients verabschiedet, soweit die globalen Verhältnisse es zulassen.“
Um das Experiment zu schützen, muss Israels „Trennung von den Völkern“ verfügt werden, werden Mischehen verboten, (126) wird der Sabbat im Zusammenhang mit den Bestimmungen über das Sabbat- und Jobeljahr zum Zeichen „der gewollten Absonderung des jüdischen Volkes.“
↑ Die fünf Bücher Mose: Geschichtsbuch der Torarepublik
Die fünf Bücher Mose (129) versteht Veerkamp als Geschichtsbuch der Torarepublik, das seit der Mitte des 5. bis zum 2. Jahrhundert v. Chr. entsteht.
„Viel Erzählstoff in der heutigen Tora ist wahrscheinlich älteren Datums, aber die Tora und somit die inhaltliche Orientierung der Erzählstoffe stammt aus der Zeit der Torarepublik und spiegelt die politischen und sozialökonomischen Auseinandersetzungen jener Zeit wider.“
Das Heiligtum in Jerusalem (129f) muss dafür sorgen, dass die Tora von der Bevölkerung akzeptiert wird. Zu diesem Zweck wird von Schriftgelehrten und Priestern in mehreren Anläufen eine Große Erzählung geschaffen, „in der die wichtigen Gruppen des Volkes Jerusalems und die bäuerlichen Familien ihre eigenen Geschichten miterzählt wussten.“
Dabei beschreibt (130) das Buch Genesis, „wie Israel zum Erstgeborenen unter den Völkern wurde und ihm ein Land zugesagt wurde“.
Im Buch Exodus geht es um die Befreiung aus der Sklaverei und die „Verpflichtungen des Bundes“, die im Buch Levitikus als „Disziplin der Freiheit“ ausgeführt werden.
Im Buch Numeri verzweifelt das Volk „sieben Mal an seiner Führung und am Gott der Führung“ und bekommt im Buch Deuteronomium noch einmal von Mose die „Disziplin der Freiheit“ verkündigt.
Die (131) Bücher Exodus und Numeri mit ihrer Erzählung vom „schmerzlichen und verzweifelten Gang durch die Wüste“ versteht Veerkamp im engeren Sinne als „das Geschichtsbuch der Torarepublik“ mit ihren inneren Konflikten in der persischen und hellenistischen Zeit.
Neben (129f) den ersten vier priesterlich redigierten Büchern der Tora erhält das levitisch orientierte Deuteronomium nahezu unverändert seinen Platz. So bleibt die Möglichkeit offen, die gleiche Große Erzählung anders zu erzählen.
↑ 3. Buch Mose – Levitikus
Das Buch Levitikus (131f) regelt den im Sinne der altorientalischen Normalität unvermeidlichen Kult strikt nach den Regeln der Tora: „Befreiung und Disziplin der Freiheit“.
Zuerst werden die Verfehlungen beschrieben, die Opfer notwendig machen, dann folgt die Darstellung „des rechten Kultes und des heiligen Lebens“. Durch die Schlachtung oder Verbrennung von Opfergaben (132f) wird der „Ernst eines Fehltrittes“ gegen den Gott der Befreiung zum Ausdruck gebracht. Daneben gibt es auch Opfer zum Ausdruck der Dankbarkeit oder aus Anlass von Selbstverpflichtungen.
Als (136f) weiteres Fest wird (frühestens im 4. Jahrhundert v. Chr.) Jom Kippur eingeführt; es soll die Untaten Israels bedecken, also unschädlich machen; vergeben kann nur Gott allein.
Die Tora (133f) reglementiert genau, was Priester dürfen. Sie dürfen nicht eigenmächtig den Kult über die Tora hinaus „schöpferisch“ fortentwickeln, sich nicht vom Ziel der Tora, der Befreiung, lösen. Das ist der Sinn der „Erzählung über die grausame Bestrafung Nadabs und Abihus“.
In Israel (134ff) ist nur der NAME heilig; er unterscheidet Israel als ein heiliges, befreites Volk von anderen Völkern. Der Kult soll nach Levitikus 10, 10-11 ausschließlich dieser Unterscheidung von heilig und unheilig, rein und unrein, im Sinne der Unterweisung des Volkes in der Tora dienen.
Indirekt (140) st aus verschiedenen Bestimmungen des Buches Levitikus zu erschließen, dass Priester entgegen Ez. 44.28 und Dt. 10.9 doch Grund und Boden und auch Sklaven besitzen und „von indirekter und direkter Ausbeutung“ leben. Aber (141) „das ‚Sozialgesetzbuch‘ in Leviticus 25“ dokumentiert „die ‚Besonderheit‘ Israels: Schabbatjahr, Jobeljahr und seine Konsequenzen für das Eigentumsrecht und das Schuldrecht.“ Als Sklaven des NAMENS dürften Israeliten von keinem Menschen mehr versklavt werden; Grundbesitz dürfte nicht im Besitz einzelner angehäuft werden.
↑ 2. Buch Mose – Exodus
Das (142) Buch Exodus erinnert in seiner Überschrift an die Zusammengehörigkeit des Nord- und Südreiches, indem es die Namen aller Söhne Jakobs aufführt. Es enthält drei Teile: Befreiung, Bund, Zelt der Begegnung. (143) Das Volk Israel soll dem Gott dienstbar werden, „der aus der Dienstbarkeit unter Menschen befreit – Grundgestalt aller Emanzipation.“
Als auf dem Weg zum Berg des Bundes Wasser und Brot ungenießbar sind bzw. fehlen, protestiert nach Veerkamp das Volk mit Recht, sein Murren ist „mehr als übelgelauntes Meckern“. Der NAME erweist sich als Arzt, er heilt das Wasser und das Volk. (144) Selbst als sich im Zusammenhang mit einer Hungersnot wehmütige Erinnerungen an Ägypten melden, kommt es (noch) nicht zur Konterrevolution.
„Das ‚Brot vom Himmel‘ dient der Befriedigung berechtigter Bedürfnisse, alle bekommen das, was sie brauchen…, aber mehr nicht. … Vorratsbildung ist unsinnig, Schatzbildung zum Zwecke späterer Geschäfte erst recht. Eine völlig neue Ökonomie wird in der Wüste erprobt.“
Vor der Errichtung des Zeltes der Begegnung stehen die Rechtsordnungen des Bundesbuches; das heißt: (145) „Politik in der Torarepublik ist Exekutive im strikten Sinne des Wortes: Sie hat den Willen des NAMENS auszuführen, nur das, sonst nichts.“
Zwischen der Anweisung zum Bau des Zeltes und ihrer Ausführung erzählt Exodus 32-34 vom „Goldenen Kalb“, vom Bau des Zeltes außerhalb des Lagers und von der „Bundeserneuerung mit einer neuen Tora.“ Das erinnert an die Goldenen Kälber, die König Jerobeam im Nordreich Israel hatte errichten lassen (1Kön 12. 26ff). Das heißt, (146) hier wird der um 520-515 v. Chr. wiedererrichtete „Tempel in Jerusalem“ als neues Goldenes Kalb angegriffen, das die Herrschaft der Priester absichern soll. Allerdings soll es (147) das Volk gewesen sein, dass von der Priesterschaft fordert, „die Zügel der Tora, … die Disziplin der Freiheit,“ abzustreifen. Statt dem Ruf des Volkes „nach einer Konterrevolution, nach einer neuen Führung durch neue Götter … entgegenzutreten, redete Aharon dem Volk zu Munde.“ Indem (148) Mose das Volk durch die Leviten bestrafen lässt, befürwortet das Buch Exodus (im Gegensatz zu Numeri 16-17) „den gewalttätigen Versuch der Leviten, ihre Ordnung gegen das Volk und gegen die Jerusalemer Priesterschaft durchzusetzen.“
Nach dem Zwischenfall mit dem Goldenen Kalb soll Mose das noch gar nicht gebaute Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers aufstellen (Ex 33.7); so soll es „die Transzendenz des NAMENS verkörpern, als absolute Autorität dem Volk und seinen jeweiligen Ordnungen gegenüber“. Indem allein Mose in diesem Zelt unmittelbar mit dem NAMEN redet, wird die Macht der Priester in Frage gestellt.
Indem der NAME mit dem Volk weiterzieht, (149) aber sich nicht „von Angesicht zu Angesicht“ sehen lässt, sondern nur „in Seinem Hinterher“, zeigt sich, dass man nur im Nachhinein erkennen kann, ob wirklich der NAME sich in einer bestimmten Situation durchgesetzt hat. „Eine Vergangenheit wie die deutsche aus den Jahren 1933-1945“ oder wie der Irrweg des Goldenen Kalbes in Israel (150) „wird nicht ungeschehen gemacht, an sie muss immer wieder erinnert werden, aber sie kann Sprungbrett zu einem Neuanfang werden.“
So spiegelt (150f) das Buch Exodus die Zerrissenheit der altjudäischen Gesellschaft wider, in der die Priesterschaft Jerusalems beides sein wollte: „Religionsfunktionär, Diener eines Normalgottes, der mit den Göttern der Welt austauschbar war, und Lehrer der Tora Mosches und somit Diener des NAMENS, der alle Götter (Ordnungen) aller Völker außer Kraft setzt.“
↑ 4. Buch Mose – Numeri
Das Buch Numeri (151) enthält viele Gesetze, die während der Zeit der Torarepublik fortgeschrieben werden.
Das Kapitel 3 über den Stamm Levi wird wie ein zehntes Kapitel der Toledot des Buches Genesis eingeleitet, nämlich als die Zeugungen Aarons und Moses. Noch einmal (152) geht es um die „Angst vor dem Unwillen des Gottes…, dem man seinen Erstgeborenen verweigerte.“ Indem sich ein „Sohn Israels“, nämlich der Stamm Levi, „ausschließlich dem Dienst im Heiligtum zur Verfügung stellt“, werden alle anderen Kinderopfer unnötig und verboten.
Den Hauptteil des Buches Numeri bildet die „Erzählung über den Wüstenzug Israels“. Sie erzählt von blutig ausgetragenen Konflikten (insgesamt sieben plus einem), (153) in denen „sich die Auseinandersetzungen in der Torarepublik“ ausdrücken.
Konflikt 1 (11): Als ein reaktionärer Haufen (‘asaphsuph) (154) einen Luxus verlangt, „den sich nur die Wohlhabenden in Ägypten und Judäa leisten konnten“, überfrisst sich das Volk und füllt die „Lustgräber“. Mose werden zur Entlastung 70 geisterfüllte Älteste zur Seite gestellt.
Konflikt 2 (12): Nachdem (155f) Aaron und Mirjam Mose die „Übertretung des Verbotes der Exogamie“ vorwerfen, wird vor allem Mirjam bestraft, was vielleicht mit „mit der Prophetin Noadja, der Gegnerin Nechemjas (Nehemia 6.14)“ zusammenhängt. Die Position Moses und der Tora werden nicht in Frage gestellt.
Konflikt 3 (13-14): Dass (156) Kundschafter „von ‚Riesen‘ mit ihren übermächtigen Ordnungen“ berichten und (157) das Volk „zum endlosen Zug durch die Wüste“ verurteilt wird, erinnert an die Übermacht des Hellenismus. (157f) „Die Wüste: das ist Jerusalem des 4. und 3. Jahrhunderts.“
Konflikt 4 (16-17.5): Als der Levit Korach (159) gegenüber Mose und Aaron die Auffassung des Deuteronomiums vertritt, „es solle keine Priester und Lehrer geben, die über die Qahal Adonaj, die Versammlung des NAMENS, erhaben sind“ (Ex 19.6), was die Aaroniten anders auslegen, wird diese Opposition buchstäblich in Grund und Boden verdammt.
Konflikt 5 (17-18): Das Volk (160) solidarisiert sich mit den Leviten, protestiert gegen Mose und Aaron. 14700 Menschen sterben. Aarons grünender Stab wird aufbewahrt als „ein Mahnmal gegen eventuelle künftige Unruhen“. (161) Das Heiligtum wird „für das Volk zu einer tödlichen Angelegenheit“; es gibt „eine äußere Bannmeile, die dem Volk zu überschreiten verboten war, und eine innere Bannmeile, die für die Leviten galt.“ Numeri 16-18 spiegelt wider, wie die Priester ihre Herrschaft in Jerusalem im 4. Jahrhundert v. Chr. sichern.
Konflikt 6 (20): Als das Volk erneut „einen Rechtsstreit“ gegen Mose führt, weil es kein Wasser gibt, gebietet der NAME Mose und Aaron, dem Volk Wasser zu geben. Aber da Mose dem Volk nicht gibt, „was es braucht und worauf es ein Recht hat, 20.12f“, und (162) „das Volk als Gegner, Rebellen (morim)“ bezeichnet, darf er „dieses Volk nicht in das Land führen“.
Konflikt 7 (21.4-9): Hier geht es (163) um ein reaktionär gewordenes Volk, das sich zurück nach Ägypten aufmacht. Eine Schlangenplage wird dadurch geheilt, „dass dem Volk vor Augen geführt wird, was es angerichtet hatte: Es musste hinaufschauen nach der Schlange, die Mosche auf ein Stück Holz nageln und hochhalten musste.“ Damit wird eine 2Kön 18.4 erwähnte beliebte Kultpraxis entmythologisiert.
„Beide Erzählungen, 20.2-13 und 21.4-9, zeigen, dass weder das Volk noch die Führung ohne Fehl sind. Man kann Protest und Aufruhr des Volkes nicht von vornherein billigen, und Wiederherstellung der Ordnung durch die Führung nicht von vornherein als rechtmäßig darstellen. Jeder Vorfall verdient eine differenzierte Betrachtung. Insofern kann Numeri 11-21 als Vorbild für jede Geschichtserzählung dienen.“
Konflikt 8 (25): (164) Eine Kultstätte für die phönizische Gottheit Ba‘al im moabitischen Ort P‘or ist der Schauplatz für den Grundkonflikt des Volkes; indem Israeliten sich mit Frauen fremder Völker verbinden, unterwirft sich Israel „einer Gesellschaftsordnung, die der Ordnung des NAMENS entgegengesetzt war.“
Die Legende über Pinchas (165) zeigt, „dass in Jerusalem der Kampf um das strikte Verbot der Ehe mit Nicht-Israeliten mit harten Bandagen geführt wurde.“ In den abschließenden „Rechtsverordnungen über das Frauenerbrecht“ wird deutlich, dass auf jeden Fall verhindert werden sollte, „dass Erbeigentum zu anderen Völkern wandert.“
↑ Die Einheit der zweifachen Tora
Wie schon erwähnt: Auch wenn die Priesterschaft in Jerusalem im Grunde eine normale altorientalische Herrschaft aufgerichtet haben, (167) können die Leviten ihre Sicht der Tora im Deuteronomium dennoch „in die Gesamttora Israels einbringen“. Das Deuternomium schallt von „jenseits des Jordan“ herüber, also von außerhalb und nicht aus dem Zelt der Begegnung. So erinnert es daran, dass in Israel noch niemand wirklich „angekommen“ ist. „Das Heiligtum ist durchweg Goldenes Kalb, die Torarepublik die Wüste, das Volk steht vor dem Jordan und Mosche muss es immer noch unternehmen, diese Tora zu erklären.“
↑ 2. Die Schriften des TeNaK und der Messianismus des Paulus
Mein zweiter Vortrag handelt von der Torarepublik in der Zeit des Hellenismus, von der Apokalyptik und von der Entstehung des Messianismus im Römischen Reich.
↑ Hellenismus
Mit dem Hellenismus (168) taucht in der Welt erstmals etwas auf, „was wir heute Globalisierung der Märkte nennen würden“, und (172ff) – was der Lehrer Alexanders des Großen, der Philosoph Aristoteles, beklagte – der Übergang von einer maßvoll geregelten Hauswirtschaft zu einem Handelskapitalismus, der (173) den „Gelderwerb zum Zweck in sich“ werden lässt.
Münzgeld (176ff) wird ursprünglich in den Tempeln zur Abgeltung von Opfergaben eingeführt (so Bernhard Laum, siehe Levitikus 27). Seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. gibt es sakrale Münzen; zunächst garantiert der Tempel deren Wert, ist also so etwas wie eine Zentralbank, die Geld in Umlauf bringt. Unter den Persern übernimmt der Staat diese Funktion, aber nur um das Geld zu horten. Das führt letzten Endes zum Untergang des Reiches.
In Umlauf gebracht wird das Geld erst durch den hellenistischen Staat. (178) „Staatsschatz und Tempelschatz bedeuteten nichts anderes als Geldvernichtung. Tempelraub war aus dem gleichen Grund Geldschöpfung. Nur zirkulierendes Geld hält die Ökonomie in Gang, weil es nur so die Funktion des Tausch- und Zahlungsmittels (Transaktionsmittel) erfüllen kann.“ (179) Im späten 4. Jahrhundert beginnt „die ganze Bevölkerung in Münzgeld zu denken“. Man kann also über den Hellenismus sagen: „Zum ersten Mal in der Geschichte regierte das Geld die Welt.“ (176) Durch das Münzgeld wird allerdings auch der Betrug mit falschen Gewichtssteinen zum Auswiegen des schon lange als Tauschmitel verwendeten Edelmetalls eingeschränkt (Deuteronomium 25.13, Levitikus 19.35, Amos 8.4f und Micha 6.11f).
Indem (179) der Hellenismus Elemente der griechischen Polis in die urbane Kultur der beherrschten Völker überträgt, kommt es zu einem „Gegensatz zwischen Stadt und Land“. Die Städte (184) besitzen eine unterschiedliche Struktur, je nachdem ob es sich um eine parasitäre Stadt, eine Handelsstadt oder eine Ackerbürgerstadt handelt. „Parasitär ist eine Stadt, die von Importen aus dem umliegenden und weiter entfernten Land lebt, ohne das Land auf dem Wege des gleichen Tausches mit eigenen Produkten zu beliefern.“ Viele Städte (180) wie z. B. Alexandrien, Antiochien, Seleukia werden neu gegründet, u. a. auch zur militärischen Herrschaftssicherung.
Aber nach wie vor (170) sind die hellenistisch beherrschten Gebiete Agrargesellschaften; das Staatseinkommen steigt also mit der Größe der eroberten Länder, das auch gebraucht wird, um die Kosten der Kriege zu decken. (180) „Stehende Heere und die ständig einsatzbereite Kriegsflotte sind oft eine viel schwerere Belastung für die regionalen Bevölkerungen als die Kriege selbst“. Allerdings haben (170) unter den drei letzten der sechs zwischen den Ptolemäern und Seleukiden geführten Kriege (219-217, 202-200 und 170-168 v. Chr.) „gerade Südsyrien (Judäa, Palästina)“ besonders zu leiden.
Für (180f) die Oberschicht entsteht eine relativ einheitliche hellenistische Kultur; aber die Unterschiede der eroberten Gebiete bleiben bestehen. (182) Im seleukidischen Reich eignet sich der König das meiste Land an und lässt es durch Sklaven oder Pächter bewirtschaften. „In Judäa und in Teilen Samarias konnten sich kleinere freie Grundbesitzer halten, in Galiläa war Großgrundbesitz mit halbfreien Pächtern vorherrschend.“
Aber die Bevölkerung (186f) hat außer hohen Tributen an das Reich eine Tempelsteuer und viele weitere Abgaben zu entrichten. (188) „Durch die Privatisierung des staatlichen Finanzwesens auf dem Wege der jährlichen Verpachtung der Steuern teilte sich das Mehrprodukt jetzt unter drei ‚Berechtigten‘: Staat, Handel und dem privaten Finanzwesen.“ Kommen außergewöhnliche Ereignisse hinzu, wie z. B. „Dürre, Pflanzenkrankheiten, Insekten“, müssen Betriebe aufgegeben werden. Es entsteht „eine Unterschicht, die praktisch vom gesellschaftlicen Leben ausgeschlossen“ ist und das Heer der Tagelöhner, Bettler, Räuber oder niederen Dienstleister in der Stadt vergrößert.
Jerusalem (185) wird im Lauf des 3. Jahrhunderts v. Chr. zu einer parasitären Stadt; „das Land arbeitete sozusagen gratis für die Stadt.“ Während (188ff) sich Mitglieder der Oberschicht an die neue hellenistische Kultur mit ihren Tempeln, Erziehungsanstalten und Sporteinrichtungen anpassen, bis hin zur operativen Rückgängigmachung der Beschneidung, werden die unteren Schichten an den Rand gedrängt.
↑ Schriften
Wie entwickelt sich die Große Erzählung während der Torarepublik? (192) „Die ideologische Tätigkeit der Schriftgelehrten, der Leviten und vielleicht auch anderer Kreise bestand im 4. Jahrhundert vor allem in der Endredaktion der Tora, der Verschriftung der prophetischen Überlieferung, der Erstellung einer eigenen Fassung des Rückblicks auf die Vergangenheit Israels und der Sammlung und Komposition von Liedern, die in der Liturgie Verwendung finden konnten. Dazu kam das Sammeln und Verfassen von ‚lehrreichen‘ Texten.“ Sie werden von den Juden unter der Überschrift Ketuvim (Bücher bzw. Schriften) „in der dritten Abteilung der Schrift“ zusammengefasst. Sie enthält zwei Teile mit je vier Büchern: 1. Psalmen, Sprüche Salomos, Hiob, Fünf Rollen (Rut, Hohes Lied, Prediger, Klagelieder und Ester); 2. Daniel, Esra, Nehemia, Chronik.
Damit ist die hebräische Bibel vollständig; zu ihr gehören die Tora, die Propheten und die Schriften; genannt wird sie in abgekürzter Form auch TeNaK von T wie Tora, N wie Nebiim und K wie Ketuvim.
↑ Psalmen und Sprüche
Die Psalmen (119) sind nach Veerkamp keine in unserem Sinn individuellen Lieder, sondern „die ganze Schrift atmet in diesen Liedsammlungen und in jedem einzelnen dieser Lieder. … Das ‚Ich‘ der Psalmen ist das ganze Volk, exemplarisch konzentriert im verachteten, verfolgten, geretteten und befreiten Mitglied des Volkes.“
Indem (194) Gott aufgefordert wird, „aufzustehen“, wird nach Veerkamp der Wunsch ausgedrückt, die gesellschaftliche Grundordnung der Tora möge sich doch wieder gegen ihre Feinde durchsetzen. (199) „Viele Psalmen deckten die tiefen sozialen Risse in der judäischen Gesellschaft auf, in der Hoffnung, dass sie geheilt werden können.“ Sie sind (195) „strukturiert durch den doppelten Gegensatz zwischen dem raschaˁ, dem Rechtsbeuger und somit Verbrecher, und dem zadiq, Bewährten – dem sich an der Tora Bewährenden – auf der einen sowie durch den Gegensatz zwischen dem raschaˁ und dem ˁani weˀevjon, dem Gebeugten und Mittellosen, auf der anderen Seite.“
Sowohl (196) im Psalm 37 als auch im Buch der Sprüche „herrscht ein derart unverwüstliches ‚Gottvertrauen‘, ein derart großes Vertrauen in die Kraft einer sich gegen alle und alles durchsetzenden Tora, dass man dieses Lied als einen Gegengesang gegen das Buch Hiob lesen kann.“ Das Sprüchebuch bettet den eben genannten Widerspruch außerdem ein „in den Gegensatz zwischen chakam (weiser Mensch) und kessil (törichter Mensch). Verbrechen ist Dummheit und Dummheit Verbrechen, Bewährung ist weise und vernünftig.“
Mit der personalen Anrede der Psalmen an Gott tut sich Veerkamp allerdings schwer. (200) Nur „wegen der Armut der Sprache und der Neuheit des Sachverhalts“, meint Veerkamp, indem er Lucretius zitiert, würden die Psalmen die a-personale Instanz des „Gottes“ ihrer Gesellschaftsordnung persönlich anreden, z. B. als König, Hirten oder Fels. „Die vier Buchstaben JHWH, die den Namen ‚Gottes‘ eher verdecken als offenbaren, werden, wie gesagt, als Subjekt eines Verbs immer mit der dritten Person Singular-männlich konjugiert und suggerieren eine absolut-männliche Instanz. Diese Vorstellung ist in der Schrift eigentlich verboten, aber sie erweist sich als nahezu unausrottbar.“
↑ Hiob
Während (199) die großen Propheten wie Jesaja Neues angekündigt haben, sieht Qohelet (in der Lutherbibel Prediger Salomo genannt) nichts Neues unter der Sonne. „Und Ijjob stellt noch radikaler als Qohelet die gesellschaftliche Wirklichkeit in Frage.“ Als (201f) Knecht Gottes steht Ijjob, den wir unter dem Namen Hiob kennen, für das Volk Israel als Ganzes, das im herrschenden Hellenismus die Tora nicht mehr verwirklichen kann. Während (203) Hiobs Freunde auf Gottes Unerforschlichkeit hoffen, leidet Hiob unerträglich unter Gott selbst. Nicht der Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen im allgemein menschlichen Sinn zerbricht hier, sondern (204) „dass er, der in seiner Gesundheit Geschlagene, sich als von allen Menschen – und so von ‚Gott‘ – Verlassener auf einem Müllhaufen wiederfindet, das sei nicht hinnehmbar, hier werde sein Recht auf Menschlichkeit unheilbar verletzt, jetzt sei nicht länger das Recht, sondern das Unrecht der ‚Gott‘.“
Veerkamp besteht darauf, dass Hiob in 42.5 seine Illusionen über den Gott der Tora endgültig verliert. Darum und nicht, weil er zu Kreuze kriechen würde, schweigt er und schmeißt er alles hin. Er bereut nicht, was er gegen Gott gesagt hat. (206) „Für die kleine Welt Judäas war die hellenistische Umgestaltung der Wirtschaft eine wirkliche Globalisierung: Zerstörung jeder Aussicht auf Autonomie und folglich auf Egalität.“ (204ff) Gott selbst hat sich verwandelt, die Gesellschaft besteht nur noch aus Rechtsbeugung.
In den Kapiteln 32-37 (210ff) wird eine radikale Kritik an den vorhergehenden Kapiteln 3-31 geübt. Elihu gesteht Hiob zu, dass er sich nichts hat zuschulden kommen lassen, aber er zeichnet von Gott in seiner Erhabenheit ein gut griechisch geprägtes Bild. (212) „Der Gott Elihus steht so weit über der Welt, dass er mit ihr nichts zu tun hat.“ Man kann ihm daher kein Unrecht vorwerfen.
Im selben Geist zeigt die erste Gottesrede 38-39 „eine Schöpfung ohne Herz und Seele, ohne Sinn und Verstand, eben ohne Adam, Menschheit.“ Dieser Gott einer ewigen und unveränderlichen Weltordnung kümmert sich nicht um die Rechtlosen.
In der zweiten Gottesrede 40-41 tauchen in den Bildern des Leviatan und Behemoth die hellenistischen Großmächte Ägypten und Syrien auf, gegen die der machtlose Hiob nichts mehr sagen kann und will.
„Erst in 42.7ff bricht eine Hoffnung durch, dass die Weltordnung, ‚Gott‘, veränderlich ist, dass sie/er umkehren kann und will – und muss. Kein Happy End, aber ein guter Schluss!“
↑ Qohelet (Prediger Salomo)
Das Buch Qohelet (213) dient nach Klara Butting dazu, „Fortschritt als Zerstörung zu entlarven und die Nichtigkeit der fortschreitenden Zerstörung zu erkennen“. Veerkamp meint: „Es geht nicht um die metaphysische Flüchtigkeit des menschlichen Daseins, sondern um die Unberechenbarkeit des Lebens in einer Gesellschaft, in der jene Regel nicht mehr gilt, nach der Bewährung das Gute schaffe, Verbrechen das Böse.“ Das heißt: (214) Obwohl das Wort „tov, gut“ in „keinem anderen Buch des TeNaK … relativ so oft vor[kommt] wie in Qohelet, 53 Mal“, sieht Qohelet „anders als in Gen 1.1ff … das Gute gleichauf mit dem Bösen, 7.14.
In Tagen des Guten bleibe im Guten,
in Tagen des Bösen sehe ein:
Auch das hat Gott gemacht
gleichauf mit dem…“
Melancholisch beschränkt sich Qohelet auf die kleinen Dinge des Lebens und „politische Vorsicht“; für ihn ist „die Welt von dereinst, die Welt der Bewährung an der Tora, vergangen.“
↑ Jesus Sirach
Das (127) Buch Jesus Sirach (um 200 v. Chr.) gehört nicht zum Kanon der hebräischen Bibel, ist aber (221) ein aufschlussreiches Dokument der Haltung derer, die „den neuen Zeitgeist ablehnten, … aber zutiefst von ihm durchdrungen“ sind.
Jeschua ben Sira (219) lobt „die Tora, er lobt die großen Gestalten aus Israels Vergangenheit“, aber (217f) er geht als hellenistisch geprägter Mensch davon aus, dass nur von körperlicher Arbeit freigestellte weise Menschen den Staat führen können. Seine (219) Sympathie gilt den Armen, seine Empörung den Reichen; aber (220) weit hinter der Tora zurück bleibt sein Satz: „Sklaven gut zu behandeln entspricht dem eigenen Interesse.“ Aus dem öffentlichen Leben zieht er sich zurück. (221) „Bei ihm und seinesgleichen ist die Große Erzählung zu einer Anleitung zu einem persönlich tadellosen Leben geworden.“
↑ Makkabäer: Das Scheitern der Politik
Als (225f) Antiochus IV. 167 v. Chr. in Jerusalem einzieht und eine Zeusstatue im Tempel aufstellt, um den Gott Israels in das Pantheon der hellenistischen Weltordnung einzugemeinden, kommt es zum makkabäischen Aufstand. (226) „Aus Opposition wurde Widerstand und der Widerstand nahm die Form eines Guerillakrieges an. Er wurde angeführt von der Familie des levitischen Priesters Mattatija aus Modin, einem Marktflecken im südlichen Samaria.“
Wichtiger als die Konflikte zwischen Leviten und Zadokiten oder zwischen Samaria und Judäa ist der ökonomische „Widerspruch zwischen der lokalen hellenistischen Ausbeutungszentrale und den Ausgebeuteten vor allem auf dem Land, zwischen Stadt und Land.“
Als „Jehuda Makkabi“ Jerusalem erobert, reinigt er wie vormals Josia das Heiligtum; der 14. Dezember 164 v. Chr. wird daher zum Festtag „für das Judentum, Chanukka, Erneuerung.“
In der Folgezeit spielen die Brüder Jehudas, Jonathan und Schimon, sowie (227) der Sohn des letzeren, Jochanan Hyrkanos, wichtige Rollen in der politischen Führung und bei der Annektion von Idumäa, Philistea, Galiläa und Samaria. „Nominell blieb dieses große Gebiet Teil des seleukidischen Reiches und Jochanan Hyrkanos blieb Ethnarch, ein von der Reichsregierung ernannter ‚Führer des Volkes‘. Erst dessen Sohn, Aristoboulos, nahm 103 v.u.Z. den Titel eines Königs an.“
Weder die Römer noch das eigene Volk „akzeptierte die Monarchie der Nachfolger der Makkabäer, der Hasmonäer“. Sie beuten als korrumpierte Führungsschicht das Volk genauso aus wie die Ptolemäer und Seleukiden. (228) „Die Bevölkerung mag die Eroberung Jerusalems durch die Römer unter Pompeius (63 v.u.Z.) zunächst als Befreiung empfunden haben…, aber bald mussten sie erfahren, dass hier Beelzebub den Teufel ausgetrieben hatte.“
Zwischen (239) 170 v. und 70 n. Chr. setzt sich der gesellschaftliche Zerfall in Judäa fort. Während Jehuda Makkabi von „assimilationsfreudigen“ Juden im Ausland hohe Wertschätzung erfährt, wird er „aus der Geschichte Israels praktisch ausgetilgt; im Talmud wird er nirgends erwähnt.“ Das liegt am Konflikt der regierenden Hasmonäer mit den „Peruschim (griechisch Pharisaioi, deutsch Pharisäer)“.
„Die Hasmonäer regierten von oben und von außen; ihre Staatsraison wurde ihnen von der hellenistischen Umwelt diktiert. Das judäische Staatswesen, meinten die Peruschim, müsse von innen und von unten her neu aufgebaut werden. Sie beriefen sich dabei auf eine mündliche Überlieferung, die ununterbrochen von Mosche bis zu den großen Volkslehrern der Gegenwart durchgehalten worden sei.“ Sie zeichnen eine Linie von Mose, Josua, den Ältesten der Richterzeit (Richter 2.7) und den Propheten bis zu Esra und Nehemia, „den Männern der Großen Versammlung. Diese sprachen drei Worte: Seid bedachtsam bei Gerichtsurteilen, bestellt viele Schüler, macht einen Zaun um die Tora.“
Im (241) ersten Jahrhundert stehen den Pharisäern die Sadduzäer (zadokitische Priestereliten) und Herodianer (hasmonäische Eliten des Hofes) gegenüber. (242) Aussteigergemeinschaften und die Essener, „die in der Welt abgekehrt von der Welt lebten (vgl. Joh 15.18f; 17.9ff)“, gibt es auf der anderen Seite.
„Von seinen Politikern erhoffte sich das Volk immer weniger, für einige Menschen aus dem Volk konnte Hilfe nur noch vom Himmel kommen. Es schlug die Stunde des Messianismus.“
↑ Apokalyptik: Apolitische Politik
Vorbereitet wurde die Hoffnung auf einen Messias, der dem Volk Israel vom Himmel her Rettung bringen würde, (222) ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. in den apokalyptischen Texten, die gegenüber der hellenistisch beeinflussten Weisheit „ein völlig neues Lied“ anstimmten. „Der Hintergrund der Apokalyptik ist das Wissen darum, dass die elementaren sozialen Strukturen im Zusammenleben der Menschen in der hellenistischen Zeit zerstört wurden. Das Sichtbare und Erfahrbare ist daher Schein, dahinter vollzieht sich etwas ganz anderes.“
Veerkamp (224) sieht die Apokalyptik in paradoxer Weise als eine „apolitische Politik“, die sich aus der Realpolitik zurückzieht und (223) nur noch „beten und ausharren“ kann. (224) „Was die Propheten sagten und taten, war unter den Bedingungen der definitiv verlorenen Autonomie nicht länger möglich. Die Apokalyptik bzw. der Messianismus war eine Antwort; die Antwort der Pharisäer und des rabbinischen Judentums war die Alternative.“
Der (228ff) Psalm 74 ist ein Dokument apokalyptischen Denkens: (230) „Da das Volk nichts tun kann, handelt Gott nicht mehr, und da Gott nicht mehr handelt, kann das Volk nichts mehr tun.“ Daher verlangt der Psalm den „Aufstand Gottes“, der „seine Rechtsordnung gegen die herrschende Rechtsordnung“ wieder durchsetzen soll.
↑ Daniel
Die (238) einzige apokalyptische Schrift, die in die hebräische Bibel aufgenommen wurde, ist das Buch Daniel. Es enthält (233) eine Staatslehre unter hellenistischen Bedingungen und will sich mit den neuen Verhältnissen nicht mehr einfach abfinden. „Die großen altorientalischen Reiche (Babel, Medien, Persien)“ werden als „Raubtiere“, als „Ausbeuterstaaten“ charakterisiert; der Hellenismus überbietet sie alle durch seine „Universalität und Destruktivität“.
In den Visionen (234) von Daniel 7 wird der Staat durch „ein senatorisches Gericht“ mit „der Weisheit und der Lebenserfahrung einer älteren Generation“ an Hand der geöffneten Bücher der Tora abgeschafft. Das im Psalm 74 geforderte Recht wird in Kraft gesetzt, indem (236) „die Menschheit mit ihrer ganzen Menschlichkeit an die Macht“ kommen wird. Der (237) Menschensohn (bar ‘enosch), angemessener mit „wie ein Mensch“ zu übersetzen, wird in Daniel 7, 27 als „das Volk der Heiligen des Höchsten“ verstanden, also derjenigen, „die auf die Tora hören“. Unter hellenistischen Bedingungen kann Israel nur zu seinem Recht kommen, „wenn die Verhältnisse in der ganzen Menschheit in Ordnung kommen.“
Aber (238) aktive Politik ist im Buch Daniel nicht möglich; die „Entmachtung der Unterdrückung“ wird vom Himmel her erwartet. „Diese Passivität ist neben der Universalität und der Endgültigkeit das dritte Wesenselement der Vision Daniels und später jenes Messianismus, den wir bei den Schülern des Jeschua von Nazareth finden werden.“ Politisch machtlos (239) begreifen die Apokalyptiker: „Die Politik des hasmonäischen Königshauses kann die Wende nicht herbeiführen, weil es mit den Mitteln des Hellenismus den Hellenismus zu besiegen versucht.“ Sie hoffen auf den Himmel, „der kein Jenseits ist, sondern eine plötzliche Einsicht, die das Volk blitzartig erfasst. Das ist die Initiative des ‘attiq jomin, des ‚Fortgeschrittenen an Tagen‘, Politik des Himmels für die Erde.“
↑ Septuaginta: Transkulturelle Höchstleistung
Auf den Weg in die Welt des Neuen Testaments machen wir uns (243f) mit Hilfe der griechischen Übersetzung des TeNaK. Spätestens seit der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. benutzt man in Judäa und Mesopotamien nicht Hebräisch, sondern Aramäisch als Umgangssprache, in Nordägypten Griechisch. Kein Zufall ist es also, (244) dass dort in Alexandrien die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt wird. Auch wenn es nur eine Legende ist, dass diese Septuaginta von 72 Gelehrten unabhängig voneinander wörtlich gleich übersetzt worden sein soll, ist sie doch eine „transkulturelle Höchstleistung“, zumal (245) es unmöglich ist, „das Ganze einer Kultur in das Ganze einer anderen Kultur“ zu übertragen.
Sprachlich ist die Septuaginta kein reines Griechisch, sondern „ein verhellenisierter jüdischer Text“, ähnlich wie Martin Buber im 20. Jahrhundert bei seiner „Verdeutschung“ der Bibel den hebräischen Charakter des TeNaK erhalten will. Trotzdem (246) war eine Verfremdung der Großen Erzählung unvermeidlich. Von Nichtjuden kann sie als eine von vielen Philosophien betrachtet werden.
Indem man (247) den „NAMEN“ mit Kyrios = „Herr“ oder ho theos = „der Gott“ übersetzt, weckt man „tyrannische Assoziationen“ und gibt Anlass zum Missverständnis, als gehöre der NAME „zur Gattung der Götter“.
In (248) Ex 3.14 wird die hebräische Aussage über den Gott, der geschieht, in die andere Struktur des Griechischen zwar nicht mit dem Begriff des Wesens (ousia) übertragen, sondern „mit ‚egó eimi ho ón, ich bin der Seiende‘“. Das hindert aber die Christen später nicht daran, Gott eben doch im griechischen Sinne als ein unveränderliches höchstes Wesen zu begreifen.
Veerkamp erwähnt (252) den judäischen Gelehrten Aristoboulos, der „als Lehrmeister des jungen Königs Ptolemaios VI. (180-143) tätig“ ist und sich „mit den philosophischen Themen Griechenlands“ beschäftigt. „Aristoboulos schlägt vor, die Tora allegorisch zu lesen“, um „die verborgenen, aber eigentlichen Inhalte hinter und zwischen den Zeilen an den Tag bringen.“ Er will seinen „griechischen Zeitgenossen deutlich machen, dass Lebensweise und Vorstellungen der Judäer durchaus im griechischen Sinne des Wortes vernünftig sind.“ Diese judäische Philosophie erreicht (252f) „in Philo ihren Gipfel“ und beeinflusst später die Bemühungen der „griechischen Kirchenväter“ und Augustins, „ihre Theologie der ‚heidnischen‘ Welt“ zu erklären.
Während (249) die hebräische Bibel seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. aus den „drei Hauptabteilungen, Tora, Propheten, Schriften“ besteht, ist die (250) uns Christen geläufige Anordnung der Septuaginta mit der anderen Dreiteilung historischer, poetischer und prophetischer Bücher vermutlich erst in der christlichen Periode vorgenommen worden. „Der von der hebräischen Bibel abweichende Aufbau ist nur die Außenseite der strukturellen Differenz zwischen beiden Bibeln. Die christliche Bibel hat eine lineare, heilsgeschichtliche Struktur, die hebräische Bibel des Judentums eine konvergente, um die Tora, das Land und das Heiligtum in Jerusalem konzentrierte Struktur.“
Christlich hört das Alte Testament mit Maleachi auf, „wo zum Schluss das Kommen des Propheten Elijahu angekündigt wird. Elijahu werde ‚das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern wenden, dass ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage‘. Dann kommt in unseren Bibeln das ‚Neue Testament‘, wo nach allgemein christlichem Empfinden die Juden als Messiasleugner mit dem Bann von Mal 3.24 (bzw. 4.6) geschlagen wurden.“ Demgegenüber steht am Schluss des TeNaK das Rückkehredikt des Kyros im Buch der Chronik „mit der Aufforderung, nach Jerusalem zurückzukehren“.
↑ Paulus: Volk und Völker – Tora undurchführbar
In seiner politischen Deutung (253) der Paulusbriefe schließt sich Veerkamp an den niederländischen Theologen K. H. Kroon und den deutschen Theologen Gerhard Jankowski an.
Paulus, ein Jude mit römischem Bürgerrecht aus der Stadt Tarsos, gehört „in den dreißiger Jahren des 1. Jahrhunderts“ zur „Partei der Peruschim (Pharisäer) in Jerusalem“ und widmet sich der Aufgabe, „die Juden in der Diaspora zu einem pharisäischen Lebenswandel anzuleiten und die zahlreichen neuartigen, modernistischen oder chaotischen Kräfte im damaligen Judentum zu bekämpfen.“ (254) Eines Tages wird ihm „auf dem Weg nach Damaskus … ‚blitzartig‘ (Apg 9.31) klar, dass nicht nur der Weg der kulturellen Assimilation, sondern auch der pharisäische Weg der ‚Trennung von den Völkern‘ in eine Sackgasse führte und dass beides politische Irrwege waren. Er muss dann irgendwelche Kontakte zu den Messianisten, die in Jeschua ben Joseph aus Nazareth den Messias sahen, aufgenommen haben.“
Drei Jahre später trifft er Petrus und Jakobus in Jerusalem und einigt sich mit ihnen auf eine Arbeitsteilung: „Schaˀul, nunmehr Paulus, sollte sich der Propaganda für den Messianismus unter den Nichtjuden widmen, Kephas (Petrus) unter den Angehörigen seines eigenen Volkes.“ Nach 14 Jahren, 49/50 n. Chr. wird die „eigenwillige Form des Messianismus“ des Paulus von den „Jerusalemer Messianisten“ zwar in Frage gestellt; es bleibt aber bei der Arbeitsteilung.
Nach Veerkamp (255) ist es „nicht zufällig, dass ein jüdischer Mensch, der zugleich aus der Diaspora stammte und Toraspezialist war, bewandert in den Traditionen seines Volkes, die völlige Neuartigkeit des römischen Projektes verstanden hat“; das Römische Kaiserreich ist durch „eine weltweit operierende und zentral geleitete Militärmaschinerie“ derart abgesichert, dass (256) eine „lokale, zeitweise erfolgreiche Messiasgestalt“ nichts Gutes bewirken kann.
Paulus ist erstens davon überzeugt, dass nur ein weltweiter Sieg des Messias über das Römische Reich auch dem judäischen Volk helfen könnte, „und zweitens, dass dieser Messias nicht auf ‚römische‘ Weise siegen würde, sondern so, dass alles Militärische ad absurdum geführt wird.“ Wenn der Messias nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern militärisch gesiegt hätte, „wäre aus dem Messias der Welt ein neuer Cäsar geworden, schrecklicher und teuflischer als alle Cäsaren vor ihm… Der Gekreuzigte siegt durch die Auferstehung über das Weltsystem des Römischen Reiches und alle militärischen Gegenstrategien sind zum Scheitern verurteilt.“
Wie (258) verhalten sich Kreuz und Auferstehung bei Paulus zueinander? Die Niederlage des Messias, der „am Hinrichtungsgerät für rebellische Sklaven“ scheitert, „überwindet das System“, und zwar durch die Auferstehung des Messias. Sie bedeutet (259) „die vollkommene Veränderung der Verhältnisse, unter denen das Leben gelebt werden muss. … hier beginnt der Aufstand, der das Ende des Systems des Todes bedeutet.“
Möglicherweise sind es (259f) die blutigen „Auseinandersetzungen zwischen den jüdischen und griechischen Volksgruppen in den Städten Syrien-Palästinas und in Nordafrika“, insbesondere „in Alexandrien im Jahr 38“, durch die Paulus zur Einsicht gelangt, (260) „dass die Politik der Trennung von den Völkern nur zu weiteren Katastrophen führen würde. Nur im Messias konnte diese mörderische Feindschaft überwunden werden. Wo sich Juden und Griechen in messianischen Gemeinden zusammenfanden, wurde sozusagen der Tod überwunden. Die Auferstehung zeigt sich im Leib des Messias, wie Paulus die messianische Gemeinde nannte. Die politische Vision des Messianismus in der Fassung des Diasporajuden Paulus und seiner Schüler besteht im Frieden zwischen dem Volk und den Völkern, den Gojim. Der Messias Jesus führt durch sein ‚Scheitern‘ alles Streben nach politischer und militärischer Macht ad absurdum und ermöglicht so das solidarische Zusammenleben (agapé, 1Kor 13!) zwischen dem Volk und den Nichtjuden, den Gojim. Das sei der einzige Weg zum Frieden und zu einem Leben ohne Angst für die Juden und für die Griechen.“
Auf Grund dieser Einsichten wird für Paulus die Tora fragwürdig, denn sie ist „unter römischen Verhältnissen nicht länger durchführbar, adynaton, Römer 8.3.“ (261) „Wenn ich, so Paulus, nach ihr zu leben versuche, erzeuge ich Feindschaft, ja geradezu Mordlust der anderen, der Gojim. Andererseits kann und darf ich die Tora nicht verurteilen, als wäre sie böse. Die gute Tora, das Gegenteil des Systems, bestätigt die Macht des Systems.“
Aber (263) durch den Messias Jesus wird das System überwunden. „Wer wie der Messias konsequent – das heißt also politisch – nach der guten Tora leben will, wird vom System mit einem barbarischen Tod bestraft; wer aber gezwungen ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der real existierenden Ordnung zu leben, wer also eigentlich nicht anders kann als ‚gotteslästerlich‘ leben, wäre nach der eigentlichen Tora des Todes schuldig. Für einen Juden, der wirklich Jude sein will, ist eigentlich kein Leben möglich. Der Grieche, der nur Grieche sein will, kann nicht anders, als die Juden zu verfolgen, weil sie durch ihre reine Existenz die Griechen und ihre Weltordnung in Frage stellen, also kann auch er nur in entstellter Weise Grieche sein. Das bedeutet Gesetz des Fleisches, alle können nicht anders als einander Feind sein. Der Ausweg ist die messianische Inspiration (Pneuma, Geist). Die Inspiration besteht darin, dass wir versuchen messianisch zu leben.“ Insofern gilt: (262) „Die messianische Gemeinde ist der absolute Gegenentwurf zum römischen Weltsystem, Körperschaft des Messias gegen Körperschaft des Todes.“
Ausführlich begründet Veerkamp, (267) wie „Israel bei Paulus nicht verabschiedet, sondern zu seinem Ziel geführt“ wird. „Erst durch die Revolution des Messias, die den mörderischen Kampf zwischen Juden und Griechen … endgültig beendet, kann Israel, kann das jüdische Volk im Lande wie in der Diaspora seine Identität bewahren und nach den eigenen Ordnungen leben. Die Einheit im Messias Jesus ist daher kein Einheitsbrei. Die Menschen sind verschieden und bleiben verschieden, aber Verschiedenheit wird nicht länger durch den Stachel der Feindschaft vergiftet.“
Gibt es (268) an Stelle Israels ein neues Gottesvolk? Im Hinblick auf Exodus 32.10 sagt Veerkamp: „Bei Paulus soll Israel nicht vernichtet werden, aber es soll aufgehen in eine neue ‚große Volksmacht‘. Paulus sieht einen Konflikt aufkommen und er nimmt dazu Stellung.“
In Röm 9-11 sagt er, (269) dass die Berufung eines neuen Gottesvolkes „nicht die Verstoßung des alten Volkes“ bedeutet.
In Galater 4 führt Paulus (270) „zum Zeugen gegen die, die die Tora als Zwangsverpflichtung allen anderen auferlegen möchten … durch seine allegorische Lektüre von Gen 16 bzw. 21“ (271) „die Vorstellung über die zwei Bünde ein“, die sich verhängnis auswirken sollte; „das Resultat war ein unversöhnlicher Gegensatz zwischen Gesetz (Juden, Sklaventum) und Evangelium (Christen, Freiheit).“
In 2. Korinther 3.4-6.12 wird deutlich, dass Paulus (272) „sich nicht für die Erzählungen über die Worte und Taten des Messias“ interessiert. Ihm geht es „nicht um den Ersatz des alten Gottesvolkes durch ein neues Gottesvolk, sondern um eine neue Schöpfung und somit einen neuen Himmel und eine neue Erde, um eine neue Menschheit.“
Die (281) patriarchalen Strukturen überwindet Paulus trotz Galater 3.28 („hier ist nicht Mann noch Frau“) nicht wirklich. Er (282) mahnt „die Frauen, die klassische Frauenrolle in der griechisch-römischen Gesellschaft zu respektieren, auch in der Gemeinde, freilich bis der Messias kommt.“
Ebenso gilt: „Paulus rüttelt nicht an der sozialen Institution Sklaverei, er nimmt sie hin, wie er die römische Obrigkeit hinnimmt… Ertragen kann man das, weil der Messias kommt und die Verhältnisse in der Welt so ordnen wird, dass es weder Sklaven noch Herren geben wird.“
Auf den ökonomischen Gegensatz reich/arm geht Paulus in Galater 3.28 nicht ein, er deutet ihn nur in 2. Korinther 8.13f an. „Dort soll die Gemeinde in Korinth der wegen der damals in Judäa herrschenden Hungersnot notleidenden Gemeinde in Jerusalem so viel abgeben, dass materielle ‚Gleichheit‘ entsteht.“
Lukas und Jakobus werden dieser Frage einen viel größeren Raum widmen. (282f) „Die messianischen Gemeinden haben sich am Ende des ersten Jahrhunderts sehr schwer damit getan, die messianische Vision der Einheit als Gleichheit in Einklang mit Verhältnissen zu bringen, an denen vorerst nicht zu rütteln war.“
Aber Veerkamp meint: (283) „Paulus und die Texte aus dem späten ersten Jahrhundert stellten die Solidarität (Agapé) ins Zentrum jener Moral, die die herrschenden Verhältnisse den Menschen abverlangten. Das Wort hatte bei Paulus die Qualität einer revolutionären Tugend; deswegen sollte man in diesem Zusammenhang Agapé immer mit Solidarität übersetzen; ihr widmete er ein Loblied, 1Kor 13.“
↑ Epheserbrief
Von (273) „den Texten, die in der Schule des Paulus nach dem Judäischen Krieg entstanden sind“, betrachtet Veerkamp ausführlich den Epheserbrief. (274) „Die Häufung solcher Worte wie Vermögen, Wirkung, Macht, Stärke, Herrschaft (dynamis, energeia, kratos, ischys, kyriotétis), die auf das Durchsetzungsvermögen Gottes hinweisen, also auf das Durchsetzungsvermögen der Ordnung, für die ‚Gott‘ steht, dient der Stärkung der ‚Vertrauenden‘, die im Widerstand gegen die Gegenmacht des Systems stehen.“ Der Kampf gegen die „römische Weltordnung“ wird „nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern auch gegen überhimmlische Wirkungen und Mächte bzw. Dämonen und Götter des Reiches“ geführt. (275) „Standhalten und widerstehen sind die entscheidenden Aufgaben der messianischen Gemeinde.“
Epheser 2 erläutert (276) „die Wurzel des paulinischen Messianismus“. Nach der Zerstörung des Tempels wohnt „der Gott Israels … in der messianischen Gemeinde“, und zwar im (277) „sōma tou Christou, Körperschaft des Messias“, der „Versammlung oder Gemeinde (ekklesia) aus gleichberechtigten Juden und Nichtjuden (Gojim)“ als einem „Haus des Friedens“. Da die jüdische Prägung der Gemeinde bereits zurückgegangen ist, erinnert der Verfasser „die, die von den Gojim stammen, daran, dass sie einst ‚fern‘ waren, ‚keine Hoffnung hatten und gottlos (atheoi) waren unter der Weltordnung‘…, denn ihre Religiosität war in seinen Augen gefangen in einer Weltordnung von Gewalt und Ausbeutung, die die Götter der Gojim repräsentierten.“ An Stelle des römischen Bürgerrechts sei „das Recht der Mitbürger Israels (sympolitai)“ die Grundlage der messianischen Gemeinde, die „sozusagen ein Brückenkopf des Friedens im Feindesgebiet einer durch Krieg und Bürgerkrieg verunstalteten Menschheit“ ist.
Der Maßstab, (278) den Paulus in Galater 3.28 für die „Einheit im Messias“, also die „geeinte neue Menschheit“ gesetzt hat, führt im Epheserbrief allerdings nicht zur Hinterfragung, sondern zur Überhöhung der patriarchalischen Strukturen der Gesellschaft. (279) „Es gibt eben nicht das Verhältnis, in dem agapan, solidarisch sein, und phobein, Ehrfurcht haben, auf Gegenseitigkeit beruhen, vielmehr sind Männer solidarisch und Frauen haben Respekt.“ Die (280) „wiederholten Aufforderungen in den Pastoral- und katholischen Briefen an die Frauen, sich den Männern unterzuordnen“, zeigen jedoch, dass Frauen wohl eine echte Gegenseitigkeit der Agape eingefordert haben.
Zwischen (279) Herren und Sklaven gibt es das gleiche Gefälle: „die Herren gerecht, die Sklaven gehorsam“. (280) „Von ‚eins sein im Messias‘ mit den Herren wird hier mit keiner Silbe mehr geredet.“
↑ Hebräerbrief
Der (283) Hebräerbrief ist zwar kein Paulusbrief, aber für Veerkamp gehört er trotzdem politisch in die gleiche Richtung. „Was Paulus mit der Tora tat, tat der Hebräerbrief mit dem Kult. Beide, Tora und Kult, haben ihr Ziel im Messias Jesus erreicht.“
Hier wird (283f) der „TeNaK konsequent auf den Messias zu“ gelesen. „Diese typologische Allegorese macht den Messias zum eigentlichen Inhalt des TeNaK.“ Der Hebräerbrief antwortet auf die Frage, wie es nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels weitergehen kann.
Josua hatte (285) das Volk zwar „in das Land geführt, aber nicht in die katapausis“, nicht in die „Ruhe der vollendeten Schöpfung“. Stattdessen fand im Land nur „das Brauchtum des Schabbats, der sabbatismos“ statt. Erst der Messias wird „die Ruhe der Vollendung“ erreichen, aber dafür muss er zu einem ganz besonderen Hohenpriester werden, für dessen Funktion der Hebräerbrief das Wort „metriopathein, so etwas wie ‚maßgerecht leiden‘“ erfindet. Er fühlt und leidet mit den „Unwissenden und Irrenden“.
Eingesetzt wird dieser Hohepriester „nicht nach der traditionellen Ordnung Aharons“, sondern es findet (286) ein „Wechsel der Tora“ statt (nomou metathesis, 7.12), was an den Makkabäer Jonathan erinnert, der sich, obwohl er Levit war, „153 v.u.Z. als Hohepriester einsetzen ließ“. Der Hebräerbrief hält „nach der Katastrophe des Jahres 70 … eine neue und diesmal endgültige Veränderung der priesterlichen Ordnung“ für erforderlich. „Der Messias übernimmt diese Führung nach der Ordnung des vater- und mutterlosen Melchisedek, als Hohepriester, der zugleich König der Wahrhaftigkeit und König des Friedens ist.“ Er macht „jedes weitere Priestertum ein für alle Mal überflüssig, weil er sich selbst als Qorban, als Nahopfer, dargebracht hat.“
Hebräer 8, 13 (287) bedeutet nach Veerkamp aber nicht, dass der „neue Bund … das Judentum außer Kraft“ setzt. Israel wird nicht enterbt, sondern wie bei Jeremia braucht der alte Bund eine Erneuerung. „So wie die Tora laut Paulus nicht zum Ziel führt, so führt laut dem Hebräerbrief der Kult nicht zum Ziel. Er kann die Verfehlungen bzw. Sünden nicht aufheben, deswegen müssen die Opfer immer wiederholt werden. ‚Sünde‘ … ist nicht die individuelle moralische Unvollkommenheit, sondern die Verstrickung in die Verbrechen des Systems. Weder Tora noch Kult können diese Verstrickung auflösen.“ Aber: (288) „Wenn sich der Messias opfert, dann haben alle anderen Opfer keinen Sinn mehr.“ Der Hebräerbrief teilt (10.4) die Kultkritik der Propheten (Jesaja 1.11; Jeremia 7.21ff; Micha 6.6, vgl. Psalm 40.7). (289) „In der Tat: der Hebräerbrief ist das Grunddokument für das Ende der Religion.“ Da der Messias „das höchste aller Opfer“, nämlich sich selbst, dargebracht hat, ist kein weiteres Opfer mehr sinnvoll und nötig.
„Die Gemeinde lebt im System, ist aber nicht länger Teil des Systems.“ Die „täglich gemachten Erfahrungen in der Verfolgungszeit“ kann man aushalten (290) im Vertrauen auf den „kommenden Staat“ (Hebräer 13.14), der “wortwörtlich zu nehmen” ist. Da es für die Christen aber „keine reale Strategie der radikalen Weltverwandlung“ gibt, kommt es aber schon bald zur „Vertröstung auf das Jenseits“. Indem „die Religion durch eine Superreligion abgeschafft wird, die Entzauberung der Kultmagie mit dem ‚Blut von Stieren und Böcken‘ durch das Metaopfer des Messias“, kommt es letztendlich zur „Satisfaktionstheologie, die den Messianismus entpolitisierte. Alles ist getan, für die Menschen blieb nichts übrig als die Anerkennung des Opfers. Dennoch: das Anliegen des Briefes, ein Leben ohne Kult und die Erwartung einer völlig anderen politischen Ordnung, der Polis mellousa, bedeutet einen bedenkenswerten Abschluss des Corpus Paulinum.“
↑ 3. Von den Evangelien zum Werden des Christentums
Mein dritter Vortrag handelt vom Judäischen Krieg als Hintergrund der Entstehung der Evangelien und zeichnet die Entwicklung bis zum Werden des Christentums in der Zeit der Kirchenväter nach.
↑ Der Judäische Krieg
Sehr ausführlich (291) beschreibt Ton Veerkamp den Judäischen Krieg, da ohne ihn die Evangelien nicht so geschrieben worden wären. „Der Judäische Krieg war ein Bürgerkrieg. Der treibende politische Widerspruch war nicht der zwischen der römischen Reichsregierung und der judäischen Bevölkerung als solcher, sondern zwischen den verschiedenen Schichten und Klassen, die ein jeweils anderes Verhältnis zum Römischen Reich hatten.“
Nach der Herrschaft Herodes des Großen (292f) war die Gesellschaft um das Jahr 6 n. Chr. extrem instabil. Judas der Galiläer, dessen Vater Ezekias als Guerillaführer von Herodes hingerichtet worden war, „rief im Jahr 6 die Galiläer zum Aufstand gegen die Römer auf, weil diese eine Volkszählung durchführen ließen. Diese Volkszählung kennen wir aus der Weihnachtserzählung. Lukas lässt also Jeschua aus Nazareth genau im Jahr der Volkszählung geboren werden, als Joudas Galilaios mit seinem Aufstand begann.“ Dessen (293) Söhne Jakob, Simon und Menachem „spielten im Widerstand gegen die Römer eine führende Rolle“ und wurden alle hingerichtet; sein Enkel Ezekias gehörte zu den Belagerten in Massada und beging in aussichtsloser Lage Selbstmord. (294) „Es scheint, dass unsere Evangelisten trotz versteckter Bewunderung das Sinnlose eines militärischen Kampfes gegen Rom unterstreichen wollten und die Evangelien des Jeschua ben Joseph aus Nazareth in Galiläa als Gegenerzählung gegen die galiläischen Messiasse aus dem Haus des Joudas Galilaios aufschrieben. Dieser Jeschua von Nazareth wurde mit zwei Guerilleros (léstai) unter Pontius Pilatus hingerichtet. Das ist so ungefähr das Einzige, das wir mit Sicherheit von Jeschua von Nazareth wissen: ein Galiläer, unter Pontius Pilatus gekreuzigt. Ein Teil seiner Schüler, vorwiegend Galiläer, blieb in Jerusalem.“ Es ist denkbar, das sie „eine gewisse Sympathie für den militanten Widerstand“ hatten; jedenfalls wurde sowohl Jakobus, der Bruder des Johannes, von Herodes Agrippa I. als auch Jakobus, der Bruder Jesu, vom Hohenpriester Ananaios II. hingerichtet. „Die Evangelien, die nach dem Krieg geschrieben wurden, lassen die Führer der messianischen Gemeinde, die Apostel, nicht gut wegkommen. Der immer wieder erhobene Vorwurf, die Apostel hätten wenig Vertrauen (Oligopistoi, Wenigvertrauende) in die Erzählfigur Messias Jeschua von Nazareth gehabt, weist auf die Zeit vor dem Judäischen Krieg hin, wo sie Sympathien für Galiläer wie die Söhne des Joudas Galilaios zeigten und lieber auf das Schwert – also auf eine militante messianische Strategie – setzten (Simon Petrus im Garten Gethsemane).“
Über die gesellschaftlichen Strukturen trägt Veerkamp eine Menge an Informationen zusammen. „In Judäa war noch ein grundbesitzendes Kleinbauerntum vorhanden, in Galiläa hatte sich der Großgrundbesitz durchgesetzt. Die Gleichnisse über den (Grund-) Herrn, der sich nicht auf seinen Gütern aufhält und jährlich Rechenschaft verlangt, sind tatsächlich typisch für die Verhältnisse in Galiläa.“ Neben den Pächtern der Güter gab es Tagelöhner, Bettler und Leute, die „schlecht angesehene Dienstleistungen verrichtet haben. … Viele dieser Leute lebten im Elend. Erst recht galt das für solche, die behindert waren oder unter ansteckenden Hautkrankheiten litten.“
Die Kriminalität war hoch. „Unter den léstai waren nicht nur Guerillakämpfer, sondern auch Räuber und Wegelagerer. Überhaupt wird es einen fließenden Übergang zwischen Guerillakampf und Banditentum gegeben haben, wie man heute in einem Land wie Kolumbien sehen kann.“
Wenn (296) Jesus bei Matthäus „die Marginalisierten ‚Mühselige und Beladene‘“ nennt, „denen er ‚Ruhe‘ in Aussicht stellt (11.28)“, fordert er sozusagen „die Nachhut des wandernden Israels durch die Wüste“, also diejenigen, „die nicht mithalten konnten“ (Dt 25.18), dazu auf, „sich ihm anzuschließen, weil er selbst ein Gedemütigter (prays, ‘ani) und ohne jedes Ansehen (tapeinos, schophel) war. Erst wenn diese Menschen sich der Unerträglichkeit ihres Lebens bewusst werden, sind sie, sofern sie nicht – und das wird wohl die Mehrheit (gewesen) sein – durch die Sorgen des täglichen Lebens abgestumpft sind, bereit, gegen die Verhältnisse aufzustehen.“
In (298) Judäa herrscht eine einheimische Ausbeuterschicht, die sich aus Großgrundbesitzern, priesterlichen und herodianischen Eliten zusammensetzt, und „das Römische Reich und sein Verwaltungs- und Aufsichtspersonal im Lande selbst“ als auswärtige Ausbeuterschicht. Es gibt eine Vielzahl von Belastungen für die Bauern und Handwerker: Kopfsteuer, Grundsteuer, Pachtsteuer, Sonderabgaben für das Militär und den Herrscher, „Bußgelder, … Wegesteuer, Marktsteuer, Haussteuer, Salzsteuer usw.“ Private Zollpächter sind besonders verhasst. (299) „Die obere Schicht der Handwerker war traditionalistisch eingestellt, aus diesem Grund romfeindlich und neigte zur Partei der Peruschim (Pharisäer). Sie waren sozusagen eine akzeptierte und offizielle Opposition und standen dem Aufstand skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. Sie spielten im Krieg keine Rolle.“ (300) „Die Schichten oberhalb der Schicht der sehr Armen und der Verelendeten werden dann die Träger des militanten Widerstandes gewesen sein, denen sich im Laufe der kriegerischen Auseinandersetzungen wahrscheinlich Teile der verelendeten Schichten angeschlossen haben.“
Anlass (301f) für den Judäischen Krieg ist der Raub des Tempelschatzes durch den Prokurator Gessius Florus (64-66) und (302) die Verweigerung der Opfergaben für Rom durch den Hohenpriester Elasar. „Die Rom ergebenen Eliten fassten die Aktion des Elasar als Erklärung des Bürgerkrieges auf; sie forderten bei den Römern und den Herodianern Truppen an.“
Daraufhin brennen Aufständische aus der Umgebung wichtige Gebäude nieder: (303) „Die drei Gebäude, die Paläste des Hohepriesters und des herodianischen Königs und das Gebäude der zentralen Schuldenverwaltung, hielten die Herrschaftsstruktur zusammen… Der Aufstand bekam Züge eines ‚Klassenkampfes‘.“ Menachem, ein Sohn von Judas, dem Galiläer, zieht „wie ein messianischer König in Jerusalem“ ein und lässt „den Hohepriester und seine Anhänger töten“, aber schon bald wird er selber getötet, und nun sind es die Priester, die „in der Folge den Krieg gegen Rom“ organisieren. (304) „Die radikale Phase der Revolution hatte kaum länger als einige Monate gedauert.“
Der Priester Josephus, der über den Judäischen Krieg Bericht erstattet, ist für die Koordinierung des Aufstandes in Galiläa zuständig, wo er es mit Johannes von Gischala zu tun bekommt, der „für ihn nichts als ein gewöhnlicher Krimineller und Bandit“ ist. Als die Römer „den Kampf in Galiläa bis zum Herbst des Jahres 67“ beenden, schlägt sich Johannes „mit einigen hundert Leuten nach Jerusalem“ durch, wo er mit Hilfe von „Guerilleros vom Land“ den Bürgerkrieg anfacht. Als er (305) „das Amt des Hohepriesters … während einer Volksversammlung durch Los bestimmen“ lassen will, verliert er seinen „Kredit bei den Priestern“, er wird Führer der Zeloten, die „außer Idumäa den ganzen äußersten Süden der Provinz Judäa in ihrer Gewalt“ haben, und schaltet mit ihnen „die Priestereliten restlos“ aus.
Inzwischen gibt es „auf dem Land südlich von Jerusalem“ weitere Guerillakämpfe „unter der Führung des Simon bar Giora“, der „im April 69 vor den Mauern Jerusalems“ erscheint und im Kontakt mit dem Enkel Judas des Galiläers in Massada steht. „Er proklamierte die Befreiung der Sklaven und eine umfassende Neuverteilung des Landes. Die Römer hatten indes andere Sorgen. Kaiser Nero hatte im Mai 68 Selbstmord verübt; um seine Nachfolge kämpften drei Heerführer. Vespasian verließ Judäa, übergab das Kommando seinem Sohn Titus und setzte sich gegen die Thronprätendenten durch. Das erklärt die Erfolge der Guerilla im Süden während des Jahres 68.“
In der Folgezeit bekämpfen sich Johannes und Simon, bis Titus (306) im Jahr 70 Jerusalem belagert und Johannes den Hohepriester Elasar ben Simon ermorden lässt.
„Nach vier Monaten Belagerung nahmen die Römer die Stadt ein. … Sie töteten in Jerusalem die Gegner und die Unbrauchbaren (‚Alte und Schwache‘) und ließen die Arbeitsfähigen am Leben. … Johannes wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, Simon hingerichtet. … Josephus zufolge verloren bei der Belagerung Jerusalems 1,1 Millionen Menschen das Leben. Die Zahl ist mit Sicherheit übertrieben. Man kann aber sagen, dass im Judäischen Krieg bzw. Bürgerkrieg Unzählige umgekommen sind, mindestens ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Die Führer des Widerstandes hatten letztlich das Volk ins Verderben geführt. So sahen es die Peruschim. Ihre Nachfolger, die Rabbinen und ihre Schüler, urteilten streng über die Führer des Aufstandes. Ähnlich äußerte sich die zweite Generation der Schüler des Jeschua (Jesus) von Nazareth.“
Der (307) zweite Judäische Krieg von 132 bis 135 „unter der militärisch-politischen Führung des Simon bar Kosiba bzw. bar Kochba“ wird „unterstützt vom angesehenen Rabbi Aqiva“, hat jedoch gegen das Römische Reich unter Kaiser Hadrian keine Chance. „Der vehemente Antimessianismus der Rabbinen datiert aus Zeiten nach diesem Krieg.“ (309) „Ob man das Überleben der ‚nationalen Identität‘ den Kriegern der beiden judäischen Kriege zuschreiben kann, darf bezweifelt werden. Vielmehr waren es Schriftgelehrte und Peruschim, die in Javne so etwas wie die Grundlagen für ein späteres jüdisches Gemeinwesen gelegt haben. Ihr Konzept, im Römischen Reich und nicht gegen das Reich den Raum zu behaupten, wo ein toragemäßes Leben möglich wäre, brachte das Judentum hervor. Sicher erfüllten sie so den Auftrag der ‚Trennung von den Völkern‘ als Überlebensstrategie seit Esra und Nechemja.“
Sehr breit geht Veerkamp auch auf die Ereignisse bis zum Untergang des Judentums in Alexandria ein (115-117), die – wie gesagt – „hinter der paulinischen und deuteropaulinischen Vision der Einheit von Griechen und Judäern in den messianischen Gemeinden“ standen.
Das Fazit dieses Abschnitts: (315) „Die Geschichte Israels im Lande und in der Diaspora ist während der letzten zwei Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung und des ersten Jahrhunderts nach der Zeitenwende eine furchtbare Katastrophengeschichte gewesen. Unsere messianischen Texte spiegeln diese Katastrophengeschichte wider.“
↑ Evangelien
Um (315) den Unterschied von Paulus und seinen Schülern einschließlich des Hebräerbriefes zu den Evangelien zu kennzeichnen, benutzt Ton Veerkamp das hebräische Wort davar, das sowohl „Wort“ als auch durch das Wort bewirkte „Tat“ und „Tatsache“ bedeuten kann. Für den paulinischen Messianismus „ist allein die eine Tatsache, davar, des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Messias wichtig. Die vier ‚Evangelien‘ stellen aber diese auch für sie entscheidende Tatsache in den Kontext des konkreten, also politischen Lebens des Messias und damit in den Kontext des politischen Lebens ihres judäischen Volkes. Sie erzählen die vielen devarim, Tatsachen, Worte und Taten, des Messias, die in Wort-und-Tat (davar) seines Todes und seiner Auferstehung kulminieren.“ Es ist die „Katastrophe des Jahres 70“, die es notwendig macht, „sein Fleisch, seine konkret-jüdische Existenz in seinem Volk in den Mittelpunkt“ zu rücken. „Jedes Evangelium hat seine eigene Erzählung, sie hatten alle ihren Kairos, ihre eigene politische Zeit“.
Die (316) Worte „Evangelium“ und „evangelisieren“ stammen aus der „Vorstellungswelt der messianischen Gemeinden, die durch Paulus geschult wurden. … Im ersten Jahrhundert hat das Wort eine politische Bedeutung: Der Inhalt der Botschaft ist der Sieg des Messias über das System. Die gebeugten und erniedrigten Menschen müssen als Adressaten der ‚Evangelisation‘ begreifen, dass sich die Zeiten ändern werden und die Zeit des römischen Systems vorbeigeht.“
Markus, Matthäus, Lukas und Johannes „sehen die Leidensgeschichte des Messias als die Leidensgeschichte des judäischen Volkes und die Leidensgeschichte dieses Volkes als Leidensgeschichte des Messias. Wer die ‚Evangelien‘ ohne den Judäischen Krieg liest, mag alles Mögliche verstehen, erhabene Moral, erhabene Religion, aber sein Verständnis geht an der Sache vorbei, die bei diesen vier verhandelt wird.“ (316f) „Die ‚Evangelien‘ behandeln die ‚Verstörung‘ des Messianismus durch den Krieg und seinen Ausgang: Der Messias sei nicht gekommen und habe sein Volk der Vernichtung durch Rom ausgeliefert. Genauso wie der TeNaK von der Zerstörung Jerusalems durch Babel, so sind die messianischen Schriften von der zweiten Zerstörung bestimmt.“
Schriften, die (321) – wie etwa das Thomasevangelium – in ihrer „Grundform und Grundintention“ nicht dem Markusevangelium entsprechen, können nach Veerkamp „alles Mögliche sein, aber auf keinen Fall ein Evangelium“.
Matthäus, Lukas und sogar Johannes (317) sind unter anderem „auch Markuskritik. Sie haben sich mit ihm auseinandergesetzt, sie wollten aber nicht bei dem, was Markus erzählt hat, oder besser: wie er es erzählt hat, stehen bleiben. Alle vier erzählen das ‚Scheitern‘ des Messias, wenn als Kriterium seine Akzeptanz im judäischen Volk angewendet wird. Am deutlichsten ist das bei Johannes. Aber gerade bei ihm wird das Scheitern nicht nur in einen, sondern in den absoluten und endgültigen Sieg verwandelt.“
Insgesamt begreifen sich die Evangelien nach Veerkamp als „Pauluskritik.“ Er spielt aber nicht Paulus und seine Kritiker gegeneinander aus, „als seien die Evangelisten die einzigen Vertreter eines wahren Christentums und Paulus sei der Fälscher gewesen“.
↑ Markus
Bei der Analyse des Markusevangeliums stützt sich Veerkamp auf Untersuchungen von Andreas Bedenbender. (C)
Markus (317) bringt „eine mündliche Überlieferung über die Devarim Jeschua Mschiach, die Worte und Taten des Jesus Messias … auf einmalige Weise in Zusammenhang mit der realen Geschichte des Judäischen Krieges.“ Ein Messianismus wie vor dem Krieg ist für ihn nicht mehr möglich. (318) Sein Evangelium endet mit der Furcht der Frauen und dass er „nach dem Tod des Messias einen ‚Engel‘ – den verwandelten Jüngling, der bei der Festnahme Jesu nackt fliehen musste – die Schüler zurück nach Galiläa schicken“ lässt.
„Evangelium“ bedeutet bei Markus, „dass der Messias Jesus in Wort und Tat das ‚Evangelium Gottes‘ ankündigt und dass der Messias selbst das Evangelium Gottes ist.“ Es beginnt mit der „Stimme des Rufenden“ in der „Wüste der Überlebenden des Judäischen Krieges“. (319) „Die Auseinandersetzung mit Rom ist durch die Niederlage des Jahres 70 entschieden, aber anders, als die Römer denken. Der Sieg liegt in den Worten und Taten des Messias.“ Diese zeigen, „dass das Königtum Gottes nahe ist“; es ist aber noch nicht da. (319f) „Das Königtum Gottes ist die Quintessenz der Großen Erzählung Israels, es ist die Gesellschaftsordnung, Weltordnung des Gottes Israels, des NAMENS. Für Markus besteht es in der Heilung der Menschen“.
Militärischer Widerstand (320) gegen Rom endet in der Verzweiflung. „Die messianische Gemeinde muss und kann zurück nach Galiläa, um den neuen und wahren Weg zu finden. … Auferstehung heißt bei Markus nur noch: ‚Er ist nicht hier‘, nicht in den Massengräbern seines Volkes in der Umgebung Jerusalems. Aber ist das denn ein Weg?“
Die anderen Evangelisten (320f) knüpfen an diese Frage an und beantworten sie unterschiedlich. Matthäus und Lukas bedienen sich dabei unter anderem einer Überlieferung von Sprüchen, die man in der Wissenschaft die „Spruchquelle Q“ nennt und die ebenfalls „ihre Wurzel in der frühen mündlichen Überlieferung über die Devarim Jeschua“ hat.
↑ Matthäus
Anders als für Markus (322) ist Jesus für Matthäus „von Anfang an (1.11) der messianische König, also ‚Sohn Davids‘“, aber ganz anders „als die zelotischen Könige Menachem, Sohn des Joudas Galilaios, und Simon bar Giora.“
Vom Titel her knüpft Matthäus an Gen 5.1 an; mit dem „Buch der Zeugung des Jesus Christus (Jeschua Mschiach), des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“, beginnt er ein neues Kapitel der „Großen Erzählung“. Jesu Zeugung wird als „ein passiver Vorgang“ beschrieben und in dreifacher Weise gedeutet: als Vertrauensgeschichte Josefs, als Verfolgungsgeschichte durch Herodes und als „Geschichte der Auswanderung nach Ägypten und der Rückkehr in das Land, das nicht Judäa, sondern Galiläa sein soll, das Land der Devarim Mschiach und das Land der Völker, Galilaia tón ethnon (4.15).“ (323) „Die Bewegung bei Matthäus läuft vom Galiläa der Völker zu ‚allen Völkern‘, panta ta ethné, 28.19.“ Im Hauptteil des Evangeliums (4.12-25.46) stellt Matthäus in „fünf großen Durchgängen … die Taten und die Reden des Messias dar, um dann seinen Tod und seine Auferstehung zu erzählen.“
Bei Matthäus (324) hebt Jesus die Geltung der Tora nicht auf, auch die mündliche Überlieferung bleibt verbindlich; „pharisäische Rabbis“ sind nur dann zu kritisieren, wenn (324f) „ihre Lebensführung im Gegensatz zu ihrer Lehre steht.“ (325) Wie bei Paulus (Röm 2.5f) sind es „die Werke der Menschen, die sie am Tag des Gerichtes (Krisis) rechtfertigen oder verurteilen werden (25.31ff). Es sind die Werke des Erbarmens oder der Solidarität (Eleos), für die das Vertrauen (Pistis) in den Messias die Kraft gibt. … Aber anders als für Paulus bleibt für ihn die Tora der notwendige Rahmen für Gericht, Erbarmen und Vertrauen. Hier trennen Welten Matthäus von Paulus.“
Nach 28.19-20 ist es der „Inhalt der Mission…, die Völker in der Lehre der vom Messias um das Gericht, das Erbarmen und das Vertrauen zentrierten Tora zu schulen.“ So lässt Matthäus die Schüler „aus Galiläa mit der Tora … zu den Völkern gehen.“
↑ Lukas und Apostelgeschichte
Zwei zusammenhängende Werke werden dem Evangelisten Lukas zugeschrieben. „Lukas schreibt einem Griechen und muss dessen wissenschaftlicher Ordnungsliebe Rechnung tragen.“ Die Apostelgeschichte gehört eng mit dem Evangelium zusammen und „beschäftigt sich mit der Versöhnung der zwei messianistischen Hauptrichtungen.“
Sollte Lukas „Matthäus gekannt haben, dann ist sein Werk eine deutliche Kritik an dessen Evangelium;“ (327) „mit einem torageleiteten Messianismus kannst du die Völker nicht gewinnen.“ Sein „Gesamtwerk beginnt im Jerusalemer Tempel und endet in Rom, es beginnt im Zentrum des judäischen Volkes und endet im Zentrum des Römischen Reiches.“ (328) Im Evangelium führen „alle Wege des Messias … nach Jerusalem“, in der Apostelgeschichte gehen „alle Wege der vom Messias Inspirierten … von Jerusalem aus“ – und zwar (329) führen sie „von den Trümmern Jerusalems weg“, und zwar, als die Judäer den Messias zurückweisen (Apg 18.6), „nach Rom!“ Dieser Weg (329f) bedeutet aber „nicht das Ende Israels, sondern Paulus unternimmt alles, damit sich die Hoffnung Israels erfüllt – wenn es sein muss, auf dem Umweg über die Völker.“
↑ Johannes
Bei (330) Johannes spielen im Gegensatz zu Paulus, Matthäus und Lukas die „Völker (ethnoi, ‚Heiden‘) … keine Rolle. … Bei ihm bezieht sich die Sendung des Messias auf Israel.“ Allerdings „bemüht sich der Messias“ um die Wiederherstellung von ganz Israel, nicht nur um Judäa, sondern auch „um Samaria als ‚Tochter Jakobs‘ (Joh 4). Und das Ziel messianischer Politik ist die große Synagoge, in der sich alle Kinder Israels in Samaria und weltweit versammeln. Der Messias ist die Einheit Israels. … Nirgendwo spricht Johannes von einer Sendung zu den Völkern.“
Wenn Johannes 1.14 sagt: „Das Wort geschieht als Fleisch, hat sein Zelt unter uns“, dann meint er mit Fleisch (331) „die konkrete gesellschaftliche Existenz, mit allen ihren Unwägbarkeiten, verletzlich, vergänglich, aber ‚unter uns‘, also nicht unter uns Menschen an sich, sondern unter jüdischen Menschen des ersten Jahrhunderts.“ Das Johannesevangelium ist für Juden geschrieben, die sich „zum Messias Jeschua bekennen“, und grenzt sich scharf ab gegen „die Peruschim und ihre Nachfolger in den jüdischen Gemeinden der Diaspora.“ Sie sind Gegner, aber keine Feinde; der eigentliche politische Feind ist Rom.
Gegenüber Pontius Pilatus „vertritt Jeschua nichts anderes als die ‚Trennung von den Völkern‘. Sein Reich sei ‚nicht von dieser Weltordnung‘, das entspricht dem Ausdruck ‚wie bei allen Völkern, kekol haggojim‘ von 1Sam 8.5. Der König Israels ist der Gott Israels, keiner sonst.“
Johannes sieht die Welt also wie Judas, der Galiläer, lehnt aber dessen Mittel total ab. (331f) „Für ihn sind die galiläischen Kämpfer schlicht Verbrecher, Räuber und Mörder (10.8-10). Das Johannesevangelium ist ein kompromisslos antizelotischer Text. Feinde sind aber die führenden Priester (Archiereis), denn sie haben feierlich und öffentlich erklärt: ‚Wir haben keinen König, es sei denn Cäsar‘ (19.15).“
Ebenso feindlich stellt sich Johannes auch gegen diejenigen, „die sich nach anfänglicher Gefolgschaft vom Messias und seiner Gemeinde getrennt haben, 6.66“; das ist bei ihm wie „in allen Sekten aller Zeiten ein verbreitetes Verfahren. Gojim und Juden kann man notfalls tolerieren, Abtrünnige (Ketzer) aber nicht.“ Jedoch: „Die Juden an sich sind bei Johannes keine Feinde, nicht einmal Gegner, sie sind eher eine verwirrte Masse…, schwankend und unentschlossen… Sie werden von den Feinden, den führenden Priestern, manipuliert und so zur Feindschaft aufgehetzt.“
Für Johannes (333) ist der „Rahmen der messianischen Erzählung … nicht länger der Zug von Galiläa nach Jerusalem, sondern der Festkalender“. Da er den zelotischen Messianismus ablehnt, ist Jerusalem für ihn „nicht die Stadt Davids, sondern der Ort der Feste, besonders der Ort des Pesach. Johannes komponiert wie ein Priester … sein Evangelium an den großen Festen Israels entlang.“
Einige Stoffe hat Johannes mit den Synoptikern gemeinsam, baut sie aber auf seine Weise ins Evangelium ein. (334) „Die messianische Hochzeit ist die Zukunft Israels, der sterbenskranke Sohn bzw. Knecht des königlichen Beamten die Gegenwart Israels. Zwischen diesen Zeichen spielt sich das Leben des Messias ab. Die anderen Zeichen lassen sich den Hauptwerken des Messias zuordnen: der Mobilisierung des gelähmten Israels (Joh 5.1ff), der Ernährung des hungernden Israels (6.5ff), der Heilung des erblindeten Israels (9.1ff) und der Belebung des toten Israels (11.1ff). Die Werke bezeugen die Glaubwürdigkeit des Messias“.
Auch für Johannes ist „das Kreuz des Messias – und somit das Kreuz des judäischen Volkes – nicht die große Niederlage…, sondern der entscheidende Anfang des langen, aber unumkehrbaren Prozesses des Aufstiegs des Messias und Israels. Es ist daher der Sieg, 16.33.“ (335) „Die Schüler Jeschuas, sagt Johannes, müssen ohne Messias leben, freilich werden sie aus der Inspiration dieses dahingegangenen, allerdings aufsteigenden (anabainón) Messias leben“, und zwar in der „Agapé“, der „Solidarität in der messianischen Gemeinde.“
So gilt (334) für Johannes gegen Matthäus und Lukas: „Nicht die Tora (Mosche!) als bleibende Bezugsgröße auch für den Messias, nicht die Völker als die wirklichen Adressaten der messianischen Botschaft, sondern das mandatum novum, die neue Tora der Solidarität der Messianisten untereinander und die Konzentration auf Israel und nur auf Israel, das ist der Weg des Messias, der Weg, der der Messias ist, 14.6. Diese Botschaft hat kaum jemand verstanden… Sie hat sektiererische Züge“; das zeigt sich zum Beispiel, als Jesus darauf besteht, dass seine Schüler sein Blut trinken und sein Fleisch kauen sollen. „Später hat sich die Gruppe um Johannes dazu durchgerungen, sich den anderen nicht-paulinischen Gruppen anzuschließen. Im Anhang des Johannesevangeliums“ wird sie „förmlich beschworen, sich ‚Petrus‘ anzuschließen und ihre sektiererische Isolierung aufzugeben.“
↑ Die vier Evangelien
So unterschiedlich (336) Matthäus, Lukas und Johannes „die Frage des Markus“ beantwortet haben, wie man „nach allem was passiert ist, noch … dem Messias Jeschua vertrauen“ kann, gibt es doch auch viele Gemeinsamkeiten. „Alle vier Evangelien teilen die Kritik an den ‚zwölf Aposteln‘, den anderen Weggefährten des Messias und dessen Familie“. (336f) „Die Gemeinde des Johannes war die messianische Gemeinde, in der die Mutter des Messias und Frauen aus ihrer Umgebung eine wichtige Rolle spielten. Nicht nur sie; auch die Tochter Jakobs in Joh 4 und die beiden Frauen in Bethanien (Joh 11) weisen auf eine Gemeinde, in der, anders als in Jerusalem, Frauen den Ton angaben. Einmütig sind die vier wiederum in der Kritik an der Gemeinde der Brüder des Messias in Jerusalem. Aus der Sicht aller vier Evangelisten muss sie in der Zeit vor dem Judäischen Krieg völlig versagt haben.“ Darauf deutet zum Beispiel hin, (337) dass Petrus „und das heißt, die Führung der messianischen jüdischen Gemeinden“ nicht „das Kreuz – also die Niederlage – auf sich nehmen“ wollte.
„Es ist unbedingt notwendig, diese Texte vor dem Hintergrund der (338) zerschlagenen Messiaserwartungen in der Zeit des Judäischen Krieges zu lesen. Die Annahme des Kreuzes heißt: zur Kenntnis nehmen, dass die Befreiung Israels nicht auf militantem, gar militärischern Wege zu erreichen ist. … Alle vier Evangelien stellen die Passion an das Ende ihrer Erzählungen. Die Passion des Messias ist in doppelter Hinsicht ein Prozess gewesen. Einmal ist die Passion das Resultat des Lebensprozesses des Messias. Zum anderen wird sie in einem Prozess als einer Gerichtsverhandlung herbeigeführt. … Einig sind sich die Evangelien darin, dass die Priester neben den Römern selbst die Verantwortung für die Hinrichtung Jesu trugen, also nicht die Juden, nicht einmal die Pharisäer.“ (339) „Gemeinsam ist ihnen auch, dass der Messias unter den noch (!) herrschenden Verhältnissen kein anderer sein kann als der geschundene ˀevjon weˁanaw, der Bedürftige und Gebeugte: ‚Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dass ich ein Gebeugter und Erniedrigter (praӱs … kai tapeinos) bin‘, Mt 11.29. Der geschundene Messias ist der geschundene Diener des NAMENS in Jes 53. … Dem triumphierenden ‚Menschensohn‘ von Dan 7 geht bei allen der ‚leidende Knecht‘ Deuterojesajas voran. Nur so kann die messianische Gemeinde nach dem Jahr 70 die Katastrophe des Messias und seines Volkes verarbeiten.“
„Die andere gemeinsame Messiasvorstellung ist der Messias als Gegen-David, kein Pseudo-David, der die Stadt im Sturm nehmen will. Die vier Evangelien zeigen alle – vor dem Hintergrund des Judäischen Krieges – das Gegenbild von Sach 9.10ff: Juble sehr, Tochter Zion, jauchze laut, Tochter Jerusalem, da, dein König kommt zu dir, ein Wahrhaftiger und Befreier ist er, ein Gebeugter (‘ani), der auf einem Esel reitet, auf einem Füllen, Eseljungen. ‚Ich rotte Streitwagen aus Ephraim aus, Kavallerie aus Jerusalem, Ich rotte den Bogen des Krieges aus, ich rede den Völkern: Friede!‘ … Alle vier Evangelien haben sich am Bild von Sach 9 orientiert. Aber eine gemeinsame Antwort auf die Frage, was nach der Katastrophe des Jahres 70 zu tun sei, finden sie nicht.“
Veerkamp spricht sich dafür aus, „diese vier Versuche in ihrer Eigenständigkeit stehen“ lassen. (340) „Die ideologische Heterogenität unserer Texte sah man schon im zweiten Jahrhundert als große Schwierigkeit. Aber es gibt eine innere Harmonie: Alle wollen klarstellen, dass die Niederlage des Messias und des judäischen Volkes nicht das letzte Wort ist. Darum lassen alle die Auferstehung als Schlussakkord hören, zwar keinen triumphalen, aber doch als Sieg. Ein Johannesschüler schrieb: ‚Die Weltordnung geht vorbei, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt bis zur kommenden Weltzeit‘; 1Joh 2.17.“
↑ Offenbarung
Die (340) Offenbarung ordnet Ton Veerkamp „in die Welt der vier Evangelien“ ein. In ihr wird der „Sieg über die Weltordnung … zum Finale der Großen Erzählung Israels… Das Buch schildert den großen Kampf gegen das Ungeheuer und sieht das neue Jerusalem, die große und endgültige Alternative zu Rom, vom Himmel herabsteigen.“
Wie (341) im Buch Daniel wird scharfsinnig politisch analysiert und „apolitische Politik“ betrieben. Das Römische Reich wird als „eine riesige Handelsassoziation“ dargestellt, innerhalb derer „sogar mit den ‚Körpern und Seelen von Menschen‘ (18.11-17)“ gehandelt wird. Vernichtet wird es „nicht von den Menschen, die es unterdrückte, sondern ‚von einem starken Engel‘ … (18.21)“. Im Unterschied (342) zu Daniel 7 siegt letzten Endes nicht der Menschensohn, sondern ein geschächtetes Lamm, also „ein massakriertes Israel, … über die römische Weltordnung. Sowohl die Vorstellung ‚Lamm‘ (‚Lamm Gottes‘, Joh 1.29) als auch die Konzentration auf Israel lassen Nähe zum Johannesevangelium vermuten.“
Die Offenbarung „setzt eine Kriegssituation voraus, die für das Römische Reich kritisch war.“ Einer (340) von drei Kriegen könnte ihren Hintergrund bilden: „der erste Judäische Krieg 66-70, der Krieg in der Diaspora 115-117 und der dritte Judäische Krieg 132-135.“ (345) Am Ende wird alles neu. „Der Feind, die Hure Babylon, Rom, das das alte Jerusalem zerstörte, ist nicht mehr. Jerusalem wird es geben, freilich ein völlig neues Jerusalem, eine Stadt, die es noch nie gegeben hat, eine Stadt ohne Tempel. … Die Stadt Israels wird auch eine Stadt für die Völker sein, das Problem des Messianismus, Israel und die Völker, wird endlich gelöst, definitive Lösung eines definitiven Problems.“
↑ Große Erzählung – messianistisch interpretiert
Veerkamp (345) zieht das Fazit, dass die „Haupttexte dessen, was später Neues Testament genannt wird“, verschiedene Spielarten eines Messianismus widerspiegeln, der als „eine der vielen verschiedenen Richtungen“ zum Judentum des ersten Jahrhunderts gehört.
Aber was geschieht, (246) als spätestens nach dem zweiten Judäischen Krieg 132-135 „mit einer umfassenden Änderung der herrschenden Weltordnung nicht mehr zu rechnen“ ist? Die Hoffnungen der Offenbarung auf ein „neues Jerusalem vom Himmel“, des Matthäus auf die Schulung der Völker in der Tora und die des Lukas auf „Versöhnung der messianistischen Hauptrichtungen“ werden enttäuscht. „Der Messianismus war zunächst nicht mehr als ein weiterer Farbtupfer in der bunten Welt der orientalischen Subkultur des Römischen Reiches. Die Sammlung der zerstreuten Kinder des Gottes Israels in einer Synagoge gelang zwar, aber die Synagoge wurde vom rabbinischen Judentum, den Nachfolgern der schärfsten Gegner des Johannes, organisiert.“
Man hielt zwar an den Texten der Gemeinden fest, „die an der Tora als einer die Messianisten verpflichtenden Halaka festhielten…, aber sie hörten auf, eine eigenständige Richtung zu sein. Einigen war auch dies zu viel. Marcion, der nur eine gereinigte Fassung des Lukasevangeliums zuließ, hatte um die Mitte des zweiten Jahrhunderts einen nicht geringen Zulauf. Spätestens von diesem Zeitpunkt an zeigte sich die Notwendigkeit, Ordnung in das ideologische Chaos zu bringen und eine allgemeine, die Gemeinden bindende Lehre zu entwickeln. So wird sich die Große Erzählung Israels in eine andere Große Erzählung, die des Christentums, verwandeln.“
↑ Von den Pastoralbriefen bis zu Justin und Ignatius
Das (347) Wort christianoi wird in Apg 11.26 und 1Petr 4.16, also erst gegen Ende des 1. Jahrhunderts für die „Anhänger eines ganz bestimmten Messias, Jeschua ben Joseph aus Nazareth“, verwendet.
Das Wort Christianismos, zu übersetzen mit Christentum, meint „nicht länger Messianismus, erst recht nicht im jüdischen Sinn des Wortes. Das Wort ist analog zum Wort Ioudaismos gebildet worden. Ioudaismos kennen wir aus dem Galaterbrief (1.13f) und es bedeutet nichts anderes als das, was die Rabbinen Halaka nennen, die Lebensweise toratreuer Judäer. Zum ersten Mal taucht das Wort Christianismos in den Briefen des Ignatius von Antiochien als Gegensatz zu Ioudaismos … auf.“
Ab der Mitte des 2. Jahrhunderts beginnen sich mit einem Streit des Christen Justin und des jüdischen Gelehrten (348) Tryphon „über die legitime Schriftlektüre … zwei grundverschiedene Lektüren der Großen Erzählung“ herauszubilden. Mit dem talmudischen Judentum und dem Christentum entwickeln sich zwei unterschiedliche Große Erzählungen. „Das Konstrukt der Heilsgeschichte war die Brille, durch die die Christen die Große Erzählung Israels zu lesen begannen.“ Auf der Septuaginta und den „messianischen Schriften … wurde das Gebäude einer verbindlichen, auf dem allgemeinen (katholischen) Glaubensbekenntnis beruhenden Lehre errichtet.“
Die Pastoralbriefe 1. und 2. Timotheus, Titus und 1. Petrus und die Texte der „Apostolischen Väter, genannt nach solchen, die die Apostel noch gekannt haben sollen, aber selber keine Apostel waren“, stehen am Anfang dieses Prozesses.
Mit (349) dem Bischof Ignatius von Antiochien beginnt die Tendenz, (351) nicht mehr „das Evangelium von der Schrift her“ zu lesen, sondern „die Schrift wird nur noch verständlich, wenn sie auf das Evangelium hin verkündigt wird.“ (352) „Nach Ignatius schließen sich Joudaismos (jüdische Lebensführung) und Christianismos (christliche Lebensführung) aus.“
Ignatius gehört übrigens zu denen, die nach Veerkamp mit einer gewissen „Lüsternheit“ danach streben, „auf blutige Weise Zeuge (Märtyrer)“ zu werden.
Nach wie vor (353) ist das Römische Reich „der große Feind“. Die Lage für die Christen kann sich „sprunghaft, innerhalb weniger Monate, ändern“. Darum fordert Ignatius „Disziplin und Linientreue“ für die „Untergrundbewegung, die das Christentum bis 313 immer wieder sein musste.“
Es entsteht (354) eine Orthodoxie (rechte Meinung) im Sinne einer heilsgeschichtlichen Lesart des TeNaK; „vor Heterodoxie (anderer Meinung) bzw. vor Kenodoxie (sinnloser Meinung) oder vor Kakodoxie (schlechter Meinung)“ wird dagegen gewarnt, um Spaltungen zu verhindern.
↑ Pseudo-Barnabas und Diognetbrief
Mit (354) dem „Brief des Barnabas – als Pseudo-Barnabas bekannt“ beginnt die Lehre (355) der „Enterbung der Juden“ durch die Christen. „Nicht nur der Erbe wurde durch einen neuen Erben ersetzt, auch der Schabbat durch einen neuen Feiertag.“ (356) „Statt einer messianischen Gemeinde aus Juden und Gojim haben wir eine christliche Gemeinde, die prinzipiell ohne Juden auskommen will.“
Aber statt das Alte Testament zu verwerfen, wie es Marcion vorschlug, wird es „als Beweismittel gegen die Juden“ benutzt. Die Christen „ahnten wohl, dass ohne die Große Erzählung Israels ihr Christentum zu einer Pflanze ohne Wurzel werden müsste, zu einem Zwischending zwischen einer gnostischen Sekte und einer orientalischen Mysterienreligion.“
Ab der Mitte des 2. Jahrhunderts behaupteteten die christlichen Apologeten „ihre Anschauungen als wahre Religion gegen Judentum und Heidentum“. Der „Brief an Diognétos“ ging so weit, die gesamte Religion der Juden als „unsinnig, … Aberglaube, Angeberei, unernst, eben ‚nicht der Rede wert‘ (oudenos axia logou)“ darzustellen.
↑ Weggabelung: Judentum und Christentum
Einerseits (357) beginnt nach Daniel Boyarin die Entfremdung zwischen Judentum und Christentum als ein „Prozess der Entwicklung von zwei sich gegenseitig ausschließenden Orthodoxien…, mit der Folge, dass sie sich gegenseitig als ‚Ketzer‘ (minim bzw. hairetikoi) definierten und zwar mit dem Zweck, an- und gegeneinander die eigene Identität zu stiften.“
Andererseits spielt sich innerhalb des Christentums nach wie vor der Streit „zwischen den beiden Hauptrichtungen der Messianisten ab, zwischen ‚Petrus‘ – oder genauer Matthäus – und ‚Paulus‘.“ Ein „konsistentes und widerspruchsfreies Lehrgebäude“ sollte entstehen, in dem „weder die, die an der jüdischen Halaka festhalten wollten, noch die, die, wie Marcion, die ganze Große Erzählung Israels verworfen hatten, einen Platz finden“.
↑ Irenäus und Quartodezimanerstreit
Irenäus beschreibt um 180 „in seinem Buch Adversus Haereses, Gegen die Spaltungen“ (358) die christliche Lehre bereits wie „das klassische dreiteilige Glaubensbekenntnis“. Mit der Schöpfungslehre von Genesis 1 grenzt er sich vom Gnostizismus ab; im „irenäischen Glaubensbekenntnis“ fehlt aber vor dem Artikel über Jesus völlig der Bezug auf „das Werden Israels zum Erstgeborenen der Völker, seine Versklavung, Befreiung, die Führung des Volkes durch die Wüste, seine Schulung in der Disziplin der Freiheit, damit es das Land beerbt, um dort als befreite Sklaven zu leben.“ (359) Aus der Befreiung wird allenfalls schon hier „eine seelische Befreiung von der Herrschaft der Sünde“.
Im sogenannten „Quartodezimanerstreit“ entschieden sich die westliche Kirche und Alexandrien um die Mitte des 2. Jahrhunderts dafür, das Osterfest „am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond [zu] feiern“, während es „die östlichen Gemeinden, vor allem die in Anatolien und Syrien, am 14. und 15. Tag des Monats Nisan, das heißt zwei Wochen nach diesem Neumond, also an wechselnden Wochentagen“ feiern, „wie Pesach bis heute bei den Juden gefeiert wird.“ Die Karfreitags- und Osterliturgie konfrontieren die „Befreiungstaten Gottes für Israel“ mehr und mehr „mit der Verwerfung und Tötung des Messias durch Israel“.
↑ Von der Halaka zur Lehre
Ursprünglich wollen sowohl das Christentum als auch das Judentum „eine andere Welt, eine neue Erde unter einem neuen Himmel“. Dem entspricht eine besondere Lebensführung, sei es die „jüdische Halaka nach Tora und Talmud“ oder die „messianische Halaka, die Imitatio Christi, die Nachfolge des Messias, normiert durch den lebendigen Prozess der apostolischen Überlieferung.“
Für die Christen ist Jesus der Messias, der „das Ganze – panta ta ethné, alle Völker“ unter seinem Haupt vereint. „Es geht nicht länger um das eine Volk, sondern um alle Völker, um das Ganze, nicht um Israel, sondern um die neue Menschheit überhaupt. Das Christentum konnte zur allgemeinen Religion werden, weil es weniger Volks– als Völkerreligion war.“
„Dagegen musste das Judentum auf dem realen Weg Israels und auf der Gabe der Tora bestehen. Die Gabe des Landes und das Wohnen (schekina) des NAMENS im Ort, den er erwählt hatte, blieb für das Judentum Gegenstand messianischer Hoffnung.“ Das Judentum kann deswegen „keine allgemeine Religion sein. Es lebt mit einer Großen Erzählung, in der die Völker – und nicht nur als Feinde – vorkommen und vorkommen müssen, aber sie ist keine Erzählung für alle Völker.“
Aber auch das Judentum muss, da „nach den Katastrophen der Judäischen Kriege im 2. Jahrhundert“ die Hoffnung auf die „Rückkehr an den Ort, wo der Gott Israels seinen NAMEN wohnen lassen will“, in weite Ferne gerückt ist, auf völlig neue Weise eine „Lehre“ formulieren, (362) um „den einstweiligen Wartestand zu organisieren“. (361) „Die erste Verschriftung der mündlichen Überlieferung aus dem frühen 3. Jahrhundert, die Mischna, bildete das Herz der ‚Lehre‘, Talmud“, der allerdings „anders als eine orthodoxe Dogmatik … unterschiedliche, ja widersprüchliche Meinungen der Diskutanten nebeneinander stehen“ lässt.
Im folgenden (362) verweist Veerkamp zur Beschäftigung mit dem Judentum auf Daniel Boyarin; er selbst verfolgt die Frage weiter, wie sich die christlichen Gemeinden mit ihrer „monarchischen Organisationsstruktur“ den „Herausforderungen durch die römische Weltordnung“ stellen.
↑ 4. Die verwandelte Große Erzählung: Das Glaubensbekenntnis der Kirche
Mein vierter Vortrag handelt davon, wie sich in der Zeit des Übergangs vom Römischen Prinzipat zum Dominat mit den Entscheidungen der großen Konzile zum Glaubensbekenntnis und dem Buch Augustins über den Gottesstaat eine neue Große Erzählung des Christentums herausbildet.
↑ Die Krise Roms
Um die gesellschaftlichen Hintergründe im Römischen Reich zu erläutern, (386) unterscheidet Ton Veerkamp nach der Zeit der Republik zwischen zwei Phasen des Kaiserreiches, dem Prinzipat und dem Dominat. Im Prinzipat ist der Kaiser offiziell Erster unter Gleichen, erst im Dominat wird er zum absoluten Alleinherrscher.
Die Krise, (363ff) die gegen Ende des 3. Jahrhunderts durch den Übergang zum Dominat bewältigt wird, beginnt im 1. Jahrhundert v. Chr. damit, dass (366) seit den Bürgerkriegen „der Großgrundbesitz und die großen Geldvermögen … die gesellschaftliche Struktur in den wichtigsten Gebieten des Römischen Reiches“ prägen und (367) die Produktivität der Güter immer schlechter wird. Die „landlosen Bauern“ geraten mehr und mehr „in Abhängigkeit von den Gutsbesitzern“; der Pächter (Colonus) wird praktisch zum Hörigen oder Leibeigenen. Zugleich führt Landflucht zum Wachstum der Städte mit armen Unterschichten. (364) Für die „Bevölkerung auf dem Lande“ etwa in Italien und Griechenland kann man sagen: „Es reichte eben zum Leben, aber kaum zu mehr.“ Aber „in Notzeiten“ sind die Leute vor allem in den Provinzen „arm im absoluten Sinn des Wortes.“
Für die Zeit „unter den Adoptivkaisern von Nerva bis Mark Aurel (98-180)“ gilt noch, dass sie in den „Kerngebieten die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen“ können. Aber dann (367ff) kommen zwischen 235 und 284 Soldatenkaiser durch Putsch an die Macht. Die versuchen, wie es Septimius Severus schon 211 seinen Söhnen geraten haben soll, die Soldaten reich zu machen, um ihre Probleme zu lösen, und der Staat muss wegen mangelnder Produktivitätssteigerung seine Ausgaben inflationär finanzieren. Infolgedessen verliert das Geld immer mehr an Wert.
Wirtschaftlich gesehen (368) bleibt das Römische Reich „eine agrarische Gesellschaft“ mit großen parasitären, also von der Versorgung durch das Land abhängigen Städten. Im „Chaos des 3. Jahrhunderts“ üben die Christen, die „in den städtischen Kreisen des Handwerks und der Dienstleistungen zu finden“ sind, „durch ihren Zusammenhalt gerade in den Notzeiten nach 235 … eine wachsende Anziehungskraft auf Nichtchristen aus.“
↑ Familia und Pietas
Zusammengehalten (369) wird die römische Gesellschaft lange Zeit durch das System von familia und pietas. „Die Grundeinheit der römischen Gesellschaft war die Familia“, über die der „Vater, Pater Familias, … eine fast absolute Autorität“ ausübte. Und die ist durch die Pietas diskussionslos zu akzeptieren. Pietas ist also nicht Pietät oder Frömmigkeit in unserem Sinne, sondern Pflichterfüllung.
Die Aufgabe (369f) des Vaters „bestand in der Fürsorge für die Mitglieder der Familia“. Zu den Familien der Oberschicht gehört außer Sklaven die „Klientel“ als eine dem Vater – „und nur ihm – ergebene Bevölkerungsgruppe.“ (370) „Die Fürsorgepflicht des Kaisers bezog sich auf die Bevölkerungsgruppen Roms, die keiner Klientel angehörten, und vor allem auf die Armee, den kaiserlichen Hof und die kaiserlichen Beamten, die sozusagen eine Art kaiserliche Klientel waren. Darüber hinaus hatte der Kaiser für das Wohl des ganzen Reiches zu sorgen.“
Da die Götter Roms „die himmlischen Garanten der Paternität und somit des Zusammenhalts der römischen Ordnung“ sind, kommt die Verweigerung der Opfer für die Götter praktisch einer Ablehnung der Pietas dem Kaiser gegenüber gleich.
„Die Pietas als politische Grundhaltung funktionierte in der Republik, solange die Gesellschaft übersichtlich strukturiert war. Auf der einen Seite stand der senatorische Adel aus den alten Familien, auf der anderen Seite das politisch verfasste Bürgertum, die Plebs, die sich hauptsächlich aus freien Bauern zusammensetzte.“ Aber schon während „der großen Kriege des 3. und 2. Jahrhunderts v.u.Z.“ hat sich „ein Stand von vermögenden Grundeigentümern“ entwickelt, die sich als Equites („Ritter“) „der Republik in Kriegszeiten mit Pferd und Rüstung zur Verfügung“ stellen müssen. (371) Es entstehen größere Domänen oder Villen (Gutshöfe „mit Behausungen für Pächter“), deren Eigentümer oft in den Städten wohnen und auf denen „die Pietas durch die von Verwaltern organisierte Arbeitsdisziplin ersetzt“ wird. (372) Die städtische Unterschicht hat „Anspruch auf die Zuteilung von Brot und anderen Lebensmitteln“, erfreut sich aber auch an den brutalen Gladiatorenspielen, die erst Ende des 5. Jahrhunderts verboten werden. „Panis et circenses, Brot und Spiele (Sozialhilfe und events): das war die ‚Sozialpolitik‘ des Reiches.“
↑ Renaissance der Antike: Apuleius und Plotin
Die Erzählung Metamorphosen des Apuleius von einem Mann, „der in einen Esel verwandelt wurde“ und am Ende „durch die Göttin Isis aus dieser qualvollen Existenz erlöst wird“, bringt „die Sehnsucht der Menschen nach einem anderen und besseren Leben zum Ausdruck“.
Allerdings: (375) „Soziale Revolutionen kamen im Kaiserreich nicht vor, allenfalls in der Peripherie … bei bestimmten Fraktionen der Zeloten im Judäischen Krieg, bei den sogenannten Circumcellionen, die im 4. Jahrhundert am Rande der donatistischen Unruhen die Villen der Großgrundbesitzer überfielen und versuchten, sich das Land anzueignen, und bei den Bacauden in Gallien und Spanien vom späten 3. bis zum frühen 5. Jahrhundert“.
Die (374f) Mysterienreligionen, der Gnostizismus, aber nur teilweise das Judentum und das Christentum bringen ihren Unfrieden „mit der realen Weltordnung“ auf eher weltflüchtige Weise zum Ausdruck und fassen „das irdisch-gegenwärtige Leben als reine Vorbereitung auf das Leben im Himmel“ auf. (376) Auf die Unsicherheit des städtischen Lebens mit seiner „freien Marktwirtschaft“ reagiert das Christentum anders „als die Gnosis oder die Mysterienreligionen“, denn es lehnt zwar „die herrschende Weltordnung – also ihre ‚Götter‘ – ab, aber nicht die Welt als materiellen Lebensraum. Der Gnostizismus macht daraus die Verdammung der materiellen Welt an sich, gleich wie die Menschen sie ordnen, ordnen können oder sollen. Er kennt keine Tugend, das heißt kein gutes Leben in der bösen Welt.“
Kaiser Diokletian verfolgt die Christen ohne Schonung, um die „Orientierungsmacht“ der alten Götter wiederherzustellen. (377) Der Philosoph Plotin (204-270) ist bemüht, „die Große Erzählung der Antike zu erneuern“, und entwirft gegen die Gnostiker, ausgehend von der Philosophie Platons, „ein durchstrukturiertes Bild des Alls, in dem alles und alle ihren Platz haben.“ (378) „Nur im Denken – also im Geist – findet die Seele ihr wahres Leben“, indem es „das materielle Leben mit seiner Schwere und seinen Beschwernissen“ überwindet. (379) „Das ist elitär im strikten Sinne des Wortes. Nur die, die es sich leisten können, andere für sich einzuspannen, können den Weg in die Welt des Geistes finden.“
Aus zwei Gründen „wirkte das Denken Plotins im Christentum weiter“. Erstens ist „Ammonios Sakkas (180-242) … der gemeinsame Lehrer Plotins und solcher christlichen Theologen wie Clemens von Alexandrien und Origenes“ und (380) zweitens „bot Plotins Moralphilosophie die Möglichkeit, die messianische Kritik der Weltordnung zu überhöhen, ohne in den dumpfen Dualismus der Gnosis zu verfallen.“
↑ Christliches Gegenmodell: Ecclesia und Dilectio
Im (381) 3. Jahrhundert ist das Christentum „zu einer sozialen Erscheinung geworden, die die Zentralregierung nicht länger vernachlässigen konnte.“ Sowohl Kaiser Decius (249-251) als auch Valerian I. (253-260) veranlassen Christenverfolgungen, um die nationale Sicherheit zu garantieren; sie stützen sich dabei auf einen „vor allem in den unteren Schichten und bei den durchweg konservativen Eliten“ vorherrschenden Christenhass.
Unter (382) Gallienus (260-268) und dessen Nachfolgern gibt es eine „De-facto-Toleranz, bis Diokletian 303 eine große und sehr blutige Christenverfolgung entfesselte, die im Westen bis 305, im Osten bis 311 andauerte. Die Vorwürfe gegen das Christentum waren haltlos. Die Christen lebten zwar zurückgezogen und hielten sich von öffentlichen Veranstaltungen mit ihrem unvermeidlichen Götterkult fern, waren aber sonst eher ‚brave Bürger‘.“ Da es große Ermessenspielräume im römischen Strafrecht gibt, „war die Haltung der Behörden den Christen gegenüber unberechenbar.“ (383) Zwar haben sich manche „Funktionsträger der Kirche … in der römischen Gesellschaft häuslich eingerichtet“, aber viele Christen betrachten „den Tod – vor allem den Tod des Märtyrers – als eigentliche Geburtsstunde des wahren und ewigen Lebens“.
Auf viele (384) „wirkten die christlichen Gemeinden … sowohl attraktiv als auch unheimlich.“ Zur Anziehungskraft der christlichen Gemeinde trägt offenbar der Eindruck bei, „ein Ort zu sein, an dem man Halt und Unterstützung fand. Zwar blieben Sklaven Sklaven, Frauen Frauen, Reiche reich, Arme arm, aber niemals elend, vielmehr bereiteten sich alle auf ein ewiges Leben vor, in dem alle unterschiedslos gleich sein würden. Und diese Erwartung wirkte sich in einer gewissen gegenseitigen Hochachtung aus.“
Veerkamp betont in diesem Zusammenhang, dass der von Tertullian geprägte Begriff „dilectio, Hochachtung“ nicht mit „Liebe, gar Nächstenliebe“ zu verwechseln sei. (385) „Nur durch die Erzählung der dilectio stiftet Wohltätigkeit Würde, ohne sie vernichtet sie die Würde. Durch die dilectio wird Wohltätigkeit zu Solidarität, zu Agapé.“
In einer Zeit, in der die „Paternität, das Modell von Pietas und Familia … die Gesellschaft nicht länger zusammenzuhalten“ vermochte, sprach die Dilectio „immer mehr Menschen an. Sie entwickelte sich von einem Modell sektiererischer Abkapselung zu einer Behausung für alle Menschen, sie wurde zu einer Großen Erzählung.“
Sicher muss man sich vor einer Idealisierung der Zustände hüten; auch in den christlichen Gemeinden gab es „unterdrückerische Verhaltensvorschriften“ gegenüber Frauen und Sklaven, die „kritiklos aus der Umwelt“ übernommen wurden. (386) Zweifellos übernahm aber „die Kirche vielerorts Funktionen der staatlichen Fürsorge“.
↑ Neues Römisches Reich: Prinzipat und Dominat
Als Kaiser Diokletian 284 an die Macht kommt, sorgt er für eine umfassende Reform des Kaiserreiches. Aus der von ihm eingeführten Tetrarchie (Regierung der Vier) wird vierzig Jahre später die Alleinherrschaft der absoluten Monarchie. Er baut (387) eine vom Militär getrennte umfassende Bürokratie und ein durchdachtes Steuersystem auf, führt eine Währungsreform durch und setzt Regeln für das städtische Gewerbe durch. „Zum ersten Mal konnte die Zentralregierung Politik im umfassenden Sinn des Wortes machen, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Kultpolitik. Der Staat fing an, sich direkt in alle Lebensbereiche der Bürger einzumischen.“
In der Zeit von Augustus (27 v. Chr.) bis Gallienus (268 n. Chr.) ist der Kaiser „nur der Erste unter rangmäßig Gleichen, also Princeps.“ Im neuen „Staatsabsolutismus“ ist er „der Herr (Dominus) aller, auch der adligen Großgrundbesitzer und der Heerführer.“ Aus dem Prinzipat wird das Dominat.
Mit Konstantin (388) beginnt der Kaiser, „sich als „Servus Dei, Diener Gottes“, und als „episcopos koinos, als allgemeinen Bischof, sozusagen als Bischof der Bischöfe“ zu verstehen, der das Recht hat, „Synoden einzuberufen, wenn die Einheit der Kirche und damit des Reiches in Gefahr war. Eine Trennung zwischen Religion und Politik gab es nicht, hier stand Konstantin in der religiösen Tradition der Antike.“ Nach Konstantin wird „die alte Toleranz des Reiches den verschiedenen Kultformen gegenüber“ nach und nach abgeschafft, bis unter Theodosius (378-395) „das Christentum die einzig zugelassene Religion war.“
↑ Kolonat
Um die Frage zu beantworten, (389) ob es im Dominat auch „neue Produktionsverhältnisse“ gibt, verweist Veerkamp darauf, dass nach wie vor „in der Landwirtschaft … nahezu das ganze Wirtschaftsprodukt produziert“ wird. Zwar gibt es kein „allgemeines und homogenes Wirtschaftssystem, genannt Kolonat, … für das ganze Römische Reich des Dominats“, aber er sieht einen entsprechenden Trend. „Die Coloni (Pächter) waren keine Sklaven, sie konnten nicht verkauft werden. Aber sie waren leiblich an Gut und Gutsbesitzer gebunden, sie waren Leibeigene.“
Während die Güter mit ihren Coloni eine Kopfsteuer und Grundsteuer aufzubringen haben, werden (390) seit Mitte des 4. Jahrhunderts „der kirchliche Grundbesitz und die kirchlichen Funktionsträger von der Steuerpflicht befreit. Hier entwickelte sich eine Situation, die wir aus dem Mittelalter kennen: zwei privilegierte Stände, Adel und Klerus, die einer Masse von unfreien Menschen gegenüberstanden.“
Was auf dem Land noch an kleinerem Grundbesitz vorhanden ist, wird vielfach in die Güter der „großen und adligen Grundbesitzer“ eingebracht, die auf diese Weise „zu ‚väterlichen Beschützern‘ der Pächter und jener Bauern [werden], die wegen des Steuerdrucks den Schutz der Grundbesitzer suchten; das System wird daher Patrozinium genannt. Solche Strukturen wurden verinnerlicht und haben sich fast ‚ewig‘ gehalten.“
In (391) den Städten werden die bisher freiwilligen Zusammenschlüsse der Gewerbetreibenden, die Collegia, „zu Zwangsverbänden. Um den Nachwuchs im jeweiligen Gewerbe zu sichern, wurde den Kindern der Beruf des Vaters zwingend vorgeschrieben.“
Als im Westen „wegen der andrängenden germanischen Völker“ der Staat „sein bürokratisches Zwangssystem immer weniger durchsetzen“ kann, „nahm im 5. und 6. Jahrhundert die Flucht aufs Land immer größere Dimensionen an. Die Handwerker siedelten sich um die Villen großer Grundbesitzer an, mit der Folge, dass im frühen Mittelalter (ab dem 6. Jahrhundert) die Villenwirtschaft zu einer autarken Wirtschaft wurde“ und „die Städte ihre politische Bedeutung“ bis zur ersten Jahrtausendwende verlieren.
„Die christliche Kirche konnte im Westen zur politischen Gegeninstanz zum grundbesitzenden Adel werden… Im Osten kam es dagegen zur Herausbildung einer staatsabsolutistischen Feudalität“; die Kirche (392) bleibt „wie die weltliche Grundherrschaft … durchgängig einem mächtigen Staatsapparat untergeordnet.“
↑ Gesellschaftliche Platzzuweisung und christliche Religion
Vereinfacht gesagt, (392) gibt es im Prinzipat „eine Art von freier Marktwirtschaft“; ab dem Ende des 3. Jahrhunderts führt „eine Kette von finanz- und sozialpolitischen Maßnahmen … hinter dem Rücken der Politiker zu so etwas wie einem staatsfixierten System“, dem Dominat.
„Der neue Staat des Dominats war bestrebt, den Menschen feste Plätze in der Gesellschaftsordnung zuzuweisen.“ (393) „Überhaupt ist die Platzsuche, Platzeroberung, Platzzuweisung zum Hauptmerkmal einer Epoche geworden, die man die ‚Zeit der Völkerwanderung‘ nannte. Platzzuweisung war ein Zwangsakt: die Bindung der abhängigen Bauern an den Boden des Grundherrn, die Bindung der Gewerbetreibenden und ihrer Familien an das jeweilige Gewerbe, die Ansiedlung neuer Volksgruppen“.
Das Christentum hat keine andere Wahl, als zur „Staatsideologie des Dominats“ zu werden und die „Menschen ideologisch ‚sesshaft‘ zu machen, sesshaft im umfassenden Sinne des Wortes, feste Bleibe und Akzeptanz des gesellschaftlichen Ortes, an dem jeder Mensch zu leben gezwungen war.“ Kaiser Konstantin (306-337) ist zwar selbst kein Christ, aber da die Verfolgung der Christen die Einheit des Reiches nicht festigen kann, nutzt er zu diesem Zweck nun diese Kirche selbst und hilft ihr, ihre eigenen inneren Konflikte zu überwinden, (394) indem er in sie hineinregiert.
„Die Reichsteilung nach dem Tod des Theodosius im Jahr 397 … führte zur Entwicklung von zwei Typen der christlichen Großen Erzählung, des westlichen ‚Katholizismus‘ Roms und der östlichen ‚Orthodoxie‘ Konstantinopels. ‚Katholisch‘ und ‚orthodox‘ waren beide… sie waren zur Religion im strikten Sinne des Wortes geworden, Religion des Staates im Osten und Religion ohne Staat im Westen.“
Das (395) Prinzipat hatte noch „eine Vielheit von Meinungen und Kultformen“ toleriert und „auf einem Minimalkonsens, die Grundordnung (die Götter des Reiches) zu ehren“, bestanden. Aber „je chaotischer die Zustände an den und sogar innerhalb der Grenzen des Reiches, umso größer die Notwendigkeit, überall Einigkeit und Einheit durchzusetzen. Auch innerhalb der Ideologie müssen die Positionen eindeutig festgelegt werden. Andere Meinungen, Heterodoxien, sind eine Gefahr und müssen unterdrückt werden.“
Im Gegensatz dazu (396) waren die internen christlichen Streitigkeiten bis zum 4. Jahrhundert für den Staat uninteressant. Ohne Chance war „der Versuch des Kaisers Julian, 361-363, das Christentum aus seiner politischen Rolle zu entlassen und zur ideologischen Toleranz des Prinzipats zurückzukehren“.
Im Dominat wird also „Gott“ praktisch zum Inbegriff einer „Grundordnung der unlöslichen Einheit von einem dem Staat ergebenen Großgrundbesitz und absolutem, den Großgrundbesitz begünstigendem Staat“. Jedenfalls kann der christliche Gott „für die politische Führung nichts anderes als ein Staatsgott (Dominus) sein“.
Aus einer „Durchhaltereligion“ im Prinzipat, in der es darauf ankommt, „sich von politischer Beteiligung tunlichst fernzuhalten, möglichst wenig aufzufallen und einander zu stärken, zu trösten, materiell zu unterstützen“, ist (397) eine „Massenbewegung“ geworden, die „nicht in die Katakomben zurück, … kein Element der Subkultur bleiben“ kann. „Deswegen ist es ein moralistischer Kurzschluss, hier vom Konstantinischen Sündenfall der Kirche zu sprechen, die sich wegen materieller Vorteile (Grundbesitz, Steuerbefreiung) dem Staat ausgeliefert hätte. … Der Staat im Dominat war auf eine allgemeine Ideologie, auf einen Verinnerlichungsapparat, angewiesen.“
↑ Verwandlung der Großen Erzählung: Nizäa bis Chalcedon
Das Christentum (397) hat im 4. und 5. Jahrhundert „die Einheit aller Menschen im Reich zu repräsentieren“; daher muss seine „Lehre widerspruchsfrei gemacht werden. Der Staat hatte bei der Formulierung ein wichtiges Wort mitzureden“.
Das Grundproblem, (399) um das es auf dem Konzil von Nizäa geht, ist nach Veerkamp, wie man die Szene, die das Markusevangelium bei „der Taufe des Messias im Jordan“ schildert, „verbindlich zu denken“ hat, also wie verhält sich der eine „Gott Israels (‚Vater‘)“ zu (400) „dem Gott der messianischen Gemeinden (‚Sohn‘)“. Origenes (185-245) hatte Jesus als göttliches Geschöpf oder als zweiten Gott bezeichnet. Für den Priester Arius „war der ‚Sohn‘ ein Geschöpf, ein bloßes Instrument, als Erstes geschaffen, um durch ihn die weitere Schöpfung ins Dasein zu rufen.“ Da Konstantin den Arianismus im Osten als Bedrohung der Einheit des Reiches ansieht, „rief er zu einer allgemeinen Synode in Nizäa“ auf. Dort wird 325 festgelegt: „Wir glauben an den einen Gott, Vater Allbeherrscher… Und an den einen Herrn Jesus Christus, gezeugt als Einziggeborener aus dem Vater…, wesensgleich dem Vater…“.
Aber (401) diese Erklärung stellt niemanden zufrieden. Vor allem über den „Begriff homoousion, wesensgleich“ wird weiter gestritten. Der „Begriff ousia (Wesen)“ wird „auf der Synode in Sirmium (heute Mitrovica in Serbien) … als unbiblisch abgelehnt.“ Stattdessen wird vorgeschlagen: „der Sohn sei dem Vater … ‚nach den Schriften in jeder Hinsicht ähnlich (homoios)‘. Man schmuggelt in das Wort homoousion ein Iota ein, homoiousion, ein Vorschlag zur Güte“ – aber auch die Wesens-Ähnlichkeit taugt zu keinem tragfähigen Kompromiss; es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Kämpfen. (402) „Die Vorstellung der ousia, nach der es nur ein höchstes Wesen gibt, das immer und überall existiert, bestätigte die monarchische Struktur der Politik im Kolonat: eine Zentrale, eine Autorität, ein Gott.“ Aber nach der „‚Trinitätstheologie‘ des Johannes“ gilt: „Der Messias ist nicht etwas anderes als der VATER, er bringt keine neue und andere Religion. … Diese Einheit versuchten die Theologen auf den Begriff zu bringen.“
Auf einem weiteren Konzil in Konstantinopel wurde 381 auch die Gottheit des Heiligen Geistes verbindlich beschlossen. Zum „Streit zwischen der westlichen und der östlichen Kirche“ führt ein einziges Wort: „Die lateinische Kirche hat den Satz ‚der aus dem Vater hervorgeht‘ ergänzt: ‚Der aus dem Vater und dem Sohn (filioque) hervorgeht‘.“ Sie besteht darauf, dass „die Inspiration der Heiligung“ nicht nur von dem als Allherrscher verstandenen Gott, sondern zugleich vom befreienden Messias Jesus ausgeht.
Weiter streitet man darüber, (403) wie man im Sohn Gottes „die Einheit zwischen ‚Gott‘ und ‚Mensch‘ denken“ muss. Origenes hatte gelehrt, „Jesus Christus habe eine ‚göttliche Seele‘, also eine einzige (moné), und zwar göttliche Beschaffenheit (physis), war also kein wahrer Mensch.“
Die sogenannten Monophysiten behaupten, in etwas abgeschwächter Form, „die menschliche Beschaffenheit ‚vermischte‘ sich mit der göttlichen, und zwar so, dass sie sich in der göttlichen Beschaffenheit auflöste.“ Ihr Kampfbegriff lautet: „Theotokos, Gottesgebärerin“, denn ihnen zufolge „brachte die Jungfrau Maria einen wahren Gott und keinen wahren Menschen zur Welt“.
Das Schlagwort der gegnerischen Nestorianer ist „Asynchytós, unvermischt“: Sie verstehen „die Menschwerdung des Logos nur analog etwa der Beiwohnung des Mannes mit seiner Frau oder der Einwohnung der Gottesstatue in einem Tempel“; sie (404) „vertraten eine reale Zweiheit auf Kosten der Einheit der Person.“
Nach Veerkamp bleibt in beiden Fällen „die wesentliche Verbindung mit dem Volk, aus dem Jesus stammte, auf der Strecke“. Bei den Monophysiten „ist das ‚physische‘ Band des Christus mit seinem Volk (Maria!), aus dem (der) er geboren wurde, zerrissen: Maria hätte keinen Juden, sondern ein Gottwesen zur Welt gebracht.“ Und bei den Nestorianern „bleibt das Menschliche in Christus zufällig, akzidentell“.
Zwei Synoden zu Ephesus 431 und 449 („Räubersynode“) bringen den Monophysiten den Sieg. Da dieser im Westen nicht anerkannt wird, ruft der Kaiser „alle Kirchenführer aus Ost und West 451 nach Chalzedon“ zu einem weiteren allgemeinen Konzil.
Dort findet man einen Kompromiss, in dem (405f) der „Begriff homoousios“ nicht nur auf Jesu Wesensgleichheit mit Gott, sondern auch auf seine Wesensgleichheit mit uns Menschen angewendet wird. „Es lag dem Konzil daran, die Einheit Jesu Christi deutlich zu betonen… Gleichzeitig geht es aber auch um die Betonung des Menschen in Jesus Christus.“ (407) Die Einheit der Person Jesu wird dadurch gewahrt, dass man von „zwei physeis, ‚Beschaffenheiten‘“ ausgeht. „Die zwei ‚Beschaffenheiten‘ dürfen nicht vermischt werden und gegeneinander auswechselbar sein (gegen die Monophysiten), sie dürfen nicht auseinandergerissen und geteilt werden (gegen die Nestorianer), sie bleiben, was sie sind. … Die zwei Beschaffenheiten werden durch das, was man ‚Persona‘, Prosópon nennt, zusammengehalten… Jesus Christus hat daher ein ‚Gesicht‘, nicht zwei.“
Die abstrakte Redeweise wird nur verständlich, wenn man den abschließenden Satz ernstnimmt: „Wie es die Propheten von früher über ihn und Jesus Christus selbst uns gelehrt haben“. Denn dieser „Satz besagt: Was das bedeutet, kann man nicht bei Plato, Aristoteles, Plotin, sondern nur im TeNaK und in den Evangelien lernen.“
↑ „Antijüdisch-christliche Tradition“
Ton Veerkamp zieht das Fazit: (408) „Beide Sätze: ‚Jesus Christus ist wahrhaft Mensch‘ und ‚Jesus Christus ist wahrhaft Gott‘ bedeuten: Jesus ist der Jude, von dem erzählt wird, wie er in den politischen Kämpfen seines Volks diese und keine andere politische Position bezieht, und der aus diesem Grund exemplarisch die Ordnung von Autonomie und Egalität verkörpert, die in Israel allein durch die Vokabel ‚Gott‘ wiedergegeben wird.“
Aber faktisch gilt: (409) „Die Juden, das reale Israel, waren keine ständige Anfrage an die Lehre und die Erzählung des Christentums, sie wurden vielmehr zu etwas lllegitimem, Anderem, Fremdem, Feindlichem. Es kam schon in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts zu christlichen Übergriffen gegen die Juden… Die christliche Erzählung wurde praktisch zu einer durchgehend anti-jüdischen Erzählung. Das Religionsmonopol des Christentums machte die Existenz der Juden zu etwas höchst Prekärem, Lebensgefährlichem. Die ersten Schritte auf dem Weg nach Auschwitz wurden im 4. Jahrhundert getan.“
Noch die Theologische Erklärung von Barmen 1934 (D) ist zwar „eine Kampfansage an den deutschen Nationalsozialismus“, indem das, „was in Nizäa/Konstantinopel und Chalzedon gesagt wurde, gerade als politischer und nicht als religiöser Satz“ ausgelegt wird: „Jesus ist ‚Gott‘ bedeutet also: der Hitlerfaschismus ist nicht ‚Gott‘.“ Aber auch die Barmer Erklärung schweigt noch „zu der sich schon 1934 anbahnenden Vernichtung der Juden“.
Insofern sagt Veerkamp sehr deutlich: „Deswegen hat niemand das Recht, gegen vermeintliche Gefahren, die heute vom Islam ausgehen würden, die abendländische, angeblich ‚jüdisch-christliche‘ Tradition zu beschwören. Es gab sie nie, es gab allenfalls eine ‚antijüdisch-christliche Tradition‘. Dass Teile der Christenheit in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts anders zu denken begannen, muss uns einerseits geradezu eine illusionslose Sicht auf unsere Vergangenheit und andererseits die bewusste Annahme unseres Andersseins ermöglichen. Aus guten Gründen Nichtjude sein zu wollen, soll nie wieder bedeuten, Antijude sein zu müssen. So selbstverständlich, wie sich das anhört, ist es auch heute nicht.“
↑ Augustin über den Staat Gottes
Abschließend macht Ton Veerkamp über „christliche Lehre und christliche Lebensorientierung“ (411) in ihrer Ausformulierung durch Augustin (354-430) einige Anmerkungen, indem er auf seine „Zweiundzwanzig Bücher über den Staat Gottes“ eingeht.
„Das Werk ist ein Hauptdokument der Großen Erzählung des christlichen Abendlandes.“ (412) Nach Ulrich Duchrow ist es „eine politische Theologie“. In ihr geht es „nicht in erster Linie um das Leben eines Christenmenschen, der den Kampf gegen seine Laster aufnimmt und besteht“. Vielmehr hat sich Augustin „zu einem christlichen Theologen“ entwickelt, „der seine Verantwortung für die Civitas terrena, den Staat und die Gesellschaft übernimmt“. Indem er „für die Hauswirtschaft … das Modell Ecclesia und Dilectio zur Zähmung des Pater Familias“ einsetzt, geht er allerdings nicht über den Epheserbrief hinaus. Und auf der Ebene „der Gesellschaft und des Staates“ bedeutet Gerechtigkeit: (413) „jedem das Recht zu geben, auf das er an seinem gesellschaftlichen Ort Anspruch erheben kann.“ Er „war schlicht nicht in der Lage, die Aktionen der Circumcellionen als Echo der Großen Erzählung von Autonomie und Egalität zu hören“.
So bleiben (414f) „Augustins Orientierungen für eine christliche Lebensführung in der realen Welt … ‚zweideutig‘: Anpassung an die herrschenden Verhältnisse und so Rechtfertigung der gewaltsam zugewiesenen sozialen Orte im Kolonat auf der einen, Hoffnung auf eine andere Weltordnung, einen neuen Himmel und eine neue Erde jenseits der realen Geschichte des ‚sechsten Tages‘ auf der anderen Seite. Alles in allem wirkte Augustin als Ideologe des Kolonats, das wir als System der ökonomisch-sozialen Platzzuweisung kennengelernt haben. Aber seine ‚Eschatologisierung‘ schleuste nun doch das Virus des Zweifels an der Selbstverständlichkeit der Platzzuweisung ein. Immer wieder haben sich Menschen gefragt, warum ‚der siebte Tag‘ jenseits der sechs Tage liegen und ein Sankt Nimmerleinstag sein soll.“ (415) „Beides ist bei ihm zu finden: Kritik und Rechtfertigung der Welt.“
So ist „die Große Erzählung Israels“ bei Augustin „aufgehoben in einer verfremdeten Gestalt, beides. Aufgehoben, weil wir – die Völker – ohne das Christentum, das von Augustin tief geprägt wurde, nie die Große Erzählung Israels gehört hätten. Verfremdet, weil wir die Erzählung Israels nur in der entfremdeten Gestalt einer christlichen Religion gehört haben.“
↑ Epilog: „Sprache abgehetzt“
Indem (421) die Christen „ihre völlig andere Welt einstweilen von der Erde in den Himmel verlegt“ haben, „wie der Islam das Friedensreich ins Paradies“, geht es ihnen letzten Endes „doch um die Erde und nicht um den Himmel. Jeder Tod sei vorläufig, die Gangster sollen nicht glauben, dass sie sich als toter Staub aus dem Staub machen können. Sie werden aufleben, um ihren Lohn entgegennehmen zu müssen, ewiges Feuer. Sagen die Erzählungen. Die Muslime glaubten das noch heftiger als die Christen und die Juden, das Feuer des Gerichts lodert in fast jeder Sure des Korans.“
Aber indem (422) Christentum und Islam dem Erhalt der Macht der „christlichen und ‚mohammedanischen‘ Machthaber“ dienten, „wurden aus großen Erzählungen Große Religionen. In ihnen sind die Großen Erzählungen aufgehoben, abgeschafft und bewahrt zugleich.“
Einen Seitenblick wirft Veerkamp auf die „Armen des Abendlandes“, die „im 19. Jahrhundert in hellen Scharen die Gefängnisse des Christentums“ verlassen und „ihre eigene Große Erzählung“ schaffen. Heute (423) sieht Veerkamp auch die Große Erzählung „der Arbeiterbewegung, der Erzählung derer, die die Erzählung der Bourgeoisie ernst nahmen, wahre Freiheit, wahre Gleichheit und wahre Solidarität, nicht nur in der Kirche, auch in der Fabrik“, als „fast vollständig vergessen… Alle Erzählungen sind nur noch Gerüchte. Hin und wieder kann man sie hören, flüchtig, verkrüppelt oft. … Man weiß nicht, wer noch zuhört, ob überhaupt noch jemand zuhört. Für einige sind die Erzählungen Wegzehrung.“
An den Schluss stellt Veerkamp ein Wort des Dichters Johannes Bobrowski:
abgehetzt
mit dem müden Mund
auf dem endlosen Weg
zum Hause des Nachbarn
↑ Anmerkungen
(A) Alle Zitate nach einer bloßen Seitenzahlangabe beziehen sich auf Ton Veerkamp, Die Welt anders. Politische Geschichte der Großen Erzählung © Institut für Kritische Theologie Berlin e. V. nach der in Berlin erschienenen Ausgabe © Argument Verlag 2013.
(B) Martin Luther, Großer Katechismus, Auslegung des ersten Gebots, Bekenntnisschriften der evang.-lutherischen Kirche (BSLK) 560,22-24: “Worauf du nu … Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.”
(C) Zusammengefasst sind seine Forschungen zum Markusevangelium in folgenden (sehr empfehlenswerten!) Büchern zu finden: Andreas Bedenbender, Frohe Botschaft am Abgrund. Das Markusevangelium und der Jüdische Krieg, Leipzig 2013, und Andreas Bedenbender, Der gescheiterte Messias, Leipzig 2019.
(D) Wortlaut der 1. These: „Jesus Christus, wie er uns in der Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“