Im siebten Kapitel des Buches stellt Pfarrer Helmut Schütz das überzeugende Konzept der Religionswissenschaftlerin Christa Dommel dar. Im Kindergarten gleich welcher Trägerschaft hat jedes Kind ein Recht auf Religions-Bildung, die sich an den fünf Wirkfaktoren „Sprache und Kommunikation“, „Geschichten aus der Geschichte“, „Liebe“, „Erfahrung“ und „Macht“ orientiert.
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
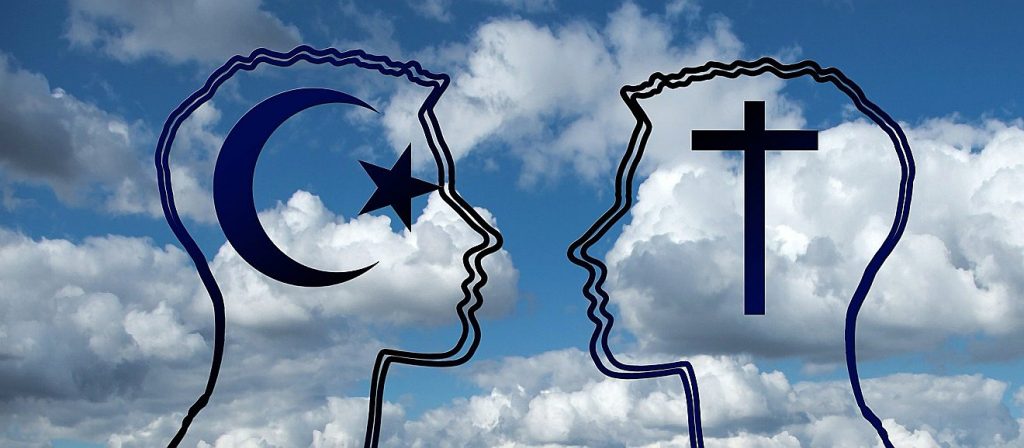
Inhalt dieses Kapitels
7.0 Das überzeugende Konzept der Religionswissenschaftlerin Christa Dommel
7.1 Kinder als Religionsforscher
7.2 Fünf Wirkfaktoren für Religions-Bildung im Kindergarten
7.2.1 Sprache und Kommunikation
7.2.2 Geschichten aus der Geschichte
7.3 Kompetenzmodell religiöser Welterfahrung
↑ 7.0 Das überzeugende Konzept der Religionswissenschaftlerin Christa Dommel
Nach einem langen Rundgang durch Literatur zu Interkultur und Interreligion, zur Religionspädagogik aus den Blickwinkeln verschiedener Konfessionen und Religionen und zu Fragen der Identität und Inklusion gehe ich auf ein religionswissenschaftlich fundiertes Konzept der „Religions-Bildung“ im Kindergarten ein, das mich am meisten überzeugt hat, weil es der Situation in einem multireligiösen Kindergarten angemessener ist als jedes konfessionell-einseitig profilierte Modell, das Kinder anderer oder gar keiner Religionszugehörigkeit in irgendeiner Weise dauerhaft ausgrenzt. Mein Kollege Matthias Weber kam in seinem Bericht vom Studienurlaub 2010 zum Thema „Religion im Kindergarten“ auf ähnliche Schlussfolgerungen, als er den „Beitrag der Religionswissenschaftlerin Christa Dommel“ dem mehr und mehr skeptisch betrachteten Gast-Modell von Frieder Harz gegenüberstellte (646).
Im „Handbuch Interreligiöses Lernen“ schreibt Dommel:
„Das Nichtvorhandensein von separaten »Fächern« bietet im Kindergarten die Chance, Religion nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext von Lebenssituationen, in denen Religion und Religiosität in andere Lernfelder integriert werden können (z. B. bei Themen wie »Reisen«, »Zeit«, »Tod und Trauer«). Religiös-weltanschaulich gemischte Kindergruppen machen die Institution Kindergarten zu einem besonders geeigneten Ort, an dem interreligiöse Pädagogik im ganzheitlichen Sinne weiterentwickelt werden könnte – Lernen an lebensweltlichen Themen, mit allen Sinnen und generationsübergreifend (mit Eltern und Erzieher/innen) lässt sich hier leichter realisieren als im Schulbereich. Dem steht leider entgegen die Identitätsdebatte, die in der deutschen religionspädagogischen Diskussion an starren Religionsbegriffen orientiert ist. »Religion« wird entgegen allen empirischen Befunden zur Religiosität in Deutschland im konfessionellen Sinne enggeführt mit »Kirche« bzw. »Moschee« oder »Synagoge« verbunden. Anders als im englischen Sprachraum, wo z. B. der weiter gefasste Begriff »Spiritualität« positiv besetzt ist, werden nicht institutionell verankerte Äußerungen von Religion hier zu Lande pädagogisch ignoriert oder mit Argwohn beobachtet.“ (647)
Genau diese religiöse Vielfalt ist „im Kindergartenalltag“ vertreten:
„nicht in sich einheitliche »Religionen« und »Kulturen«…, sondern Familienkulturen, die unter anderem durch religiöse Traditionen geprägt sind, die auch innerhalb derselben Religion sehr unterschiedlich sein können. Wenn sich die öffentliche Wahrnehmung von »Religion« auf Vertreter der Religionsgemeinschaften beschränkt, wird dabei die Mehrheit der Gläubigen ignoriert.“ (648)
Der theologische Dialog zwischen Pfarrer und Imam und die zwischen Kirche und Moscheegemeinde organisierte „Begegnung“ oder „Gastfreundschaft“ reicht als „Konzept für religiöse Bildung von Anfang an“ nicht hin, wenn
„damit den Familien ein festes Korsett von Zuschreibungen bestimmter religiöser Attribute aufgezwungen wird, die nicht unbedingt ihrer Selbstdefinition entsprechen. Außerdem legen Begriffe wie »Dialog« oder »gegenseitige Gastfreundschaft« eine strukturelle Gleichrangigkeit der Beteiligten nahe, die nicht den realen Machtverhältnissen entspricht (649). Selbst wenn muslimische Eltern es zu schätzen wissen, dass Religion generell in kirchlichen Einrichtungen nicht tabuisiert, sondern gewürdigt wird, muss nach den europäischen Qualitätszielen für Kindertageseinrichtungen für jedes einzelne Kind mehr als ein bloßer »Gaststatus« realisiert werden im Hinblick auf die Religion nichtchristlicher Kinder: »Die Erziehung und das Lernumfeld sollten die Familie jedes Kindes, sein Zuhause, seine Sprache, das kulturelle Erbe, seinen Glauben, seine Religion und sein Geschlecht widerspiegeln und wertschätzen.« (650)
Gefühle von Vertrautheit oder Fremdheit sind für jedes Kind und seine Lernmotivation äußerst wichtig: Kinder, die im Kindergarten mit viel Fremdem konfrontiert sind, haben es schwerer als andere, Sprechbereitschaft und Lernmotivation zu entwickeln. Die Diskussion um »religiöse Beheimatung« muss daher dringend weiterentwickelt werden – ähnlich wie die Debatte um den Gebrauch von Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten, in der sich nach jahrzehntelangem Streit inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Kinder unterschätzt und sogar in ihrem Sprachlernprozess gehemmt werden, wenn sie im Kindergarten »künstlich« nur dem Deutschen als Zweitsprache begegnen, unter Vermeidung ihrer Muttersprache…
Angesichts von widersprüchlichen Normensystemen, eigenen Bedürfnissen und Umwelterwartungen sind subjektive Interpretationen notwendig, um balancierende Identitäten und damit die Chance individueller Autonomie zu entwickeln. Bezogen auf die religiöse Entwicklung in der Kindheit ist es gerade diese Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit widersprüchlichen Normen, die Kinder im religiös pluralistischen Kontext dringend brauchen. Dafür sind Erfahrungen religiöser oder philosophischer »Beheimatung« durchaus notwendig, und die Familie als primäre Bezugsgruppe eines Kindes ist dabei von größter Bedeutung. Das direkte Einbeziehen jeder Familienkultur … im Kindergarten, der Austausch mit den Eltern und ihre aktive Mitwirkung sind Voraussetzung für die notwendige Einzelfallanalyse, bei dem jedem Kind die Sicherheit gegeben werden soll: »Ja, ich bin besonders, so wie jeder Mensch besonders ist, aber ich bin nicht anders!«“ (651).
Auch im „Handbuch Kinderwelten“ wehrt sich Christa Dommel gegen „Diskriminierung wegen Religionszugehörigkeit“ und spricht sich für einen konsequenten Wechsel der Blickrichtung in Sachen Religion aus.
„Für öffentliche Bildungseinrichtungen, die allen Kindern gleichermaßen eine Heimat sein wollen, ist ein Verständnis von »religiöser Identität« als Bollwerk gegen die Gefahren der Pluralität und ein kulturpessimistisches Bild von »Kindheit als Verlustgeschichte von Bindung und Orientierung« … nicht angemessen. Orientierende Bildung im Zusammenhang mit Religion erfordert von allen Beteiligten einen Perspektivenwechsel und den Mut, »die Stimme in uns, die die Stimme der Anderen ist, sprechen zu lassen«“ (652).
↑ 7.1 Kinder als Religionsforscher
Mitten in dem Buch „Wohnt Gott in der Kita?“, das den oben skizzierten katholischen religionssensiblen Ansatz vertritt, stellt Christa Dommel ein religionswissenschaftlich fundiertes Modell unter dem Titel „Kinder als interreligiöse Religionsforscher“ vor. „Kinder sind von Geburt an Forscher“, so beginnt sie ihren Artikel (653).
Ausgehend von entwicklungspsychologischen Einsichten Daniel Sterns (siehe Kapitel 4.2.2), dass Kinder schrittweise lernen, als selbstständige Individuen zu leben, indem sie zugleich die Verbundenheit und Nähe zu Erwachsenen brauchen, außerdem von Ideen der Theologin Ursula Sieg, die „interreligiöses Lernen als ‚Pendeln zwischen Eigenem und Gemeinsamem‛“ beschreibt (654), und schließlich von einer Liste des „Weltwissens der Siebenjährigen“, in der auch „Religion und religiöse Unterschiede“ aufgeführt sind (655), beschreibt sie die religiöse kindliche Neugier folgendermaßen:
„Kinder beobachten genau, welche Zugehörigkeiten und Zuschreibungen in der Erwachsenenwelt Anwendung finden und probieren diese Kategorien zur Unterscheidung von Menschen auch selbst aus, um sich selbst und andere einzuordnen. Dabei stellen sie manchmal neugierige Fragen, die die religiösen Selbstverständlichkeiten der Erwachsenen auf ähnliche Weise erschüttern können wie religionswissenschaftliche Fragestellungen es tun: Beide, die kindliche und die wissenschaftliche Neugier, haben einen gewissen Forschungsabstand zum Gegenstand ihres Interesses. Zum Beispiel:
• Was ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch?
• Stimmt es, dass die einen anders beten als die anderen?
• Warum fasten viele Muslime im Ramadan?
• Warum wandert dieser Fastenmonat rückwärts durch das Jahr, Weihnachten und Ostern aber nicht?
• Sind alle Kinder bei der Geburt religiös gleich?
• Wer entscheidet eigentlich, zu welcher Religion ich gehöre: Meine Eltern? Oder der Pfarrer?
Um solche Fragen beantworten zu können, brauchen pädagogische Fachkräfte religionskundliches Grundwissen und die Bereitschaft, sich mit den Kindern und ihren Familien gemeinsam auf Erkundungsreise zu begeben. Nicht nur die gelehrte Religion religiöser Experten, sondern die gelebte Religion in den Familien und im persönlichen Umfeld der Kinder ist es, die für ihr Selbstempfinden und ihre Verbundenheit mit anderen bedeutsam ist.“ (656)
Wenn ich Kollegen, die sich etwas in der internationalen religionspädagogischen Landschaft auskennen, von meiner Begeisterung für Christa Dommels Ansatz erzähle, der sich vor allem von John M. Hull und der in England seit drei Jahrzehnten praktizierten „multi faith religious education“ inspirieren ließ, erwidern sie regelmäßig: Aber das ist ja nur Religionskunde, kein wirklicher Religionsunterricht, der nur authentisch von Vertretern einer bestimmten Religionsgemeinschaft erteilt werden kann. Richtig daran ist ein Gesichtspunkt, den auch Christa Dommel betont:
„Das gemeinsame Lernen über und von Religion (,learning about and learning from religion‛ als Leitlinie in der englischen Religionspädagogik) ist nicht dasselbe wie religiöse Erziehung und Beheimatung in einer bestimmten religiösen Tradition. Sie richtet sich an alle Kinder, auch an diejenigen, die nicht religiös gebunden sind, und schafft einen Rahmen, in dem Religion wertschätzend, aber nicht missionierend thematisiert werden kann.“ (657)
Ich denke, in einer öffentlichen Bildungseinrichtung wie dem zum überwiegenden Teil kommunal finanzierten Kindergarten, auch wenn er in kirchlicher Trägerschaft geführt wird, sollte man nicht mehr, aber auch nicht weniger an religiöser Erziehung erwarten. Nach allem, was ich von Christa Dommel gelesen habe, zielt ihr Ansatz auf weit mehr als eine Religionskunde, nämlich eine Religions-Bildung, die sowohl den emotionalen als auch den kognitiven Bereich berücksichtigt und weder die kindliche Erfahrung noch die konkreten Traditionen der Religionsgemeinschaften ausklammert.
Anstatt auf ein räumlichen Modell verschiedener Religionszugehörigkeiten, die einander den Platz streitig machen und einander ausgrenzen, wählt Christa Dommel einen Blick auf die verschiedenen Religionen unter dem Gesichtspunkt der Dimension Zeit:
„Aus Sicht einer inklusiven, interreligiösen Religionsbildung könnte man Religion als menschliche Kommunikation über Zeit bezeichnen. Beginnend mit dem heutigen Datum und seiner Zählung (,vor Christus‛ und ‚nach Christus‛, im Unterschied zur Zeit nach dem jüdischen oder islamischen Kalender) über die Einteilung der Woche in sieben Tage, von denen einer als religiöser Fest- und Ruhetag gilt (Freitag im Islam, Sabbat im Judentum, Sonntag im Christentum), bis hin zu den verschiedenen Festzyklen im Jahresablauf stellen wir fest: Die Messung und Zählung von Zeit steht ebenso im Zusammenhang mit religiös geprägter Kommunikation wie das persönliche Zeitempfinden in unserem Leben. Selbst diejenigen, die sich nicht als religiös verstehen, können sich kaum der Frage entziehen: ‚Was machst Du an Weihnachten?‛ Religion prägt also auch unabhängig vom individuellen Glauben unsere Kultur und unsere Zeitwahrnehmung – mehr, als es der Mehrheitsgesellschaft bewusst ist. Religiöse Minderheiten dagegen spüren die Wirksamkeit dieser ,Spielregeln‛ sehr deutlich. Gemeinsam mit ihnen lassen sich auch dabei neue, inklusive Möglichkeiten der Zeit-Kommunikation entwickeln, ohne dass dabei einer der Beteiligten die eigene Tradition aufgeben muss. Sie erscheint dadurch in einem neuen Licht, weil sie nicht nur für sich betrachtet wird, sondern in Verbindung mit anderen. Diese Betrachtungsweise führt nicht vom ‚Eigenen‛ weg, sondern setzt es in einen größeren Zusammenhang. Damit kommt sie ihren eigenen Ursprüngen besonders nahe, denn keine Religion ist aus sich selbst heraus entstanden.“ (658)
Wenn „das Kinderrecht auf »Bildung von Anfang an« auch für das Thema Religion“ gilt, muss es „für Religions-Bildung … einen kommunikativen Prozess des Aushandelns und der verlässlichen Vereinbarungen“ geben.
„Allgemeine, ein für allemal richtige »interkulturelle Lösungen« kann es bei Konfliktthemen wie »Schweinefleisch« oder »Kopftuch« nicht geben; unabdingbar jedoch sind gemeinsame »prozessuale Werte« für einen möglichst gleichberechtigten Austausch aller Beteiligten – und dazu gehören Kinder und ihre Familien ebenso wie pädagogische Fachkräfte und Trägerinstitutionen. Sie alle als Ko-Konstrukteure im Religions-Bildungsprozess sind nicht in erster Linie aufgefordert, Antworten zu geben, sondern Fragen zuzulassen und ihnen gemeinsam nachzugehen. Inklusive Religions-Bildung bedeutet Dezentrierung von eigenen Selbstverständlichkeiten – nicht um sie aufzugeben, sondern um überhaupt fähig zu werden für einen Austauschprozess mit denjenigen, die anderes für selbstverständlich halten.
Es geht um das Abschiednehmen von einer Kultur des Rechthabens, die »die Wahrheit« als Besitz der jeweils eigenen Religionsgemeinschaft betrachtet – aber auch von der Anmaßung, alle religiös Gläubigen als »irrational« zu belächeln. Religiöse Rationalität, ein gleichermaßen emotionales wie kognitives menschliches Potenzial, ist als Bestandteil von kultureller Kompetenz ein Thema für alle.“ (659)
↑ 7.2 Fünf Wirkfaktoren für Religions-Bildung im Kindergarten
Christa Dommels im Jahr 2007 erschienene Dissertation ist ein fundiertes Konzept für „Religions-Bildung“, die „notwendiger Bestandteil von Allgemeinbildung schon im Kindergarten“ (660) und prinzipiell für alle von religiöser Vielfalt geprägten Kindergärten geeignet ist.
Wie bereits erwähnt, lässt sich Dommel dazu durch Erfahrungen mit dem englischen Bildungssystem anregen, deren Übertragbarkeit auf Deutschland allerdings von vielen deutschen Pädagogen in Frage gestellt wird. Meines Erachtens gelingt es ihr, diese Einwände zu entkräften. Ich kann nicht ihre gesamte Analyse deutscher und englischer religionspädagogischer Ansätze referieren, möchte aber ihr Fazit zitieren:
„Insgesamt wird in der Analyse deutlich, dass weder der religiös-kulturelle Hintergrund noch die Frage, ob ein Bildungskonzept theologisch geprägt ist oder nicht, noch die Zugehörigkeit zum englischen oder deutschen Diskurs einheitliche Antworten in der Frage des ‚Kinderrechts auf Religions-Bildung‛ hervorbringen. Dies widerspricht gängigen Stereotypen in der öffentlichen Debatte: weder sind Muslime, Juden und christliche Theologen prinzipiell gegen säkulare religionskundliche Bildung, noch sind englische Ansätze ignorant gegenüber der Gefühlsdimension von Religion. Die Rezeption englischer Ansätze in der deutschen konfessionell-theologisch orientierten Religionspädagogik zeigt ein Diskursmuster, das sich bereits bei Friedrich Schleiermacher (1799) abzeichnete: nationale Zuschreibungen über ‚jämmerliche Empirie‛ verleugnen, dass die Religionspädagogik in England sehr viel ‚Deutsches‛ enthält (Kant, Fröbel, Tillich, Bonhoeffer, Küng, um nur einige Beispiele zu nennen), wie umgekehrt die deutsche Pädagogik viele englische Elemente aufnimmt (angefangen beim Begriff ‚Bildung‛/‚formation‛), dass die pädagogische Theoriebildung demnach internationaler ist als ihr Ruf. Die Frage des Individualrechts auf Religions-Bildung bleibt auf diese Weise in Deutschland marginalisiert, ‚Autonomie‛ bleibt ein Gegensatz zu ‚Abhängigkeit‛ von einer Gemeinschaft.“ (661)
Christa Dommel geht davon aus, dass Kinder aller Konfessionen und Religionen sowie auch konfessionslose Kinder ein Recht auf Religions-Bildung haben und dass Religion für die Entwicklung von Basiskompetenzen, insbesondere von „cultural literacy“, wie sie in den internationalen PISA-Studien als Ziel beschrieben werden „eine entscheidende Rolle spielt“ (662).
Um diesem Anspruch zu genügen, braucht man eine allgemein gehaltene Definition von Religion, die sowohl für kommunale wie für jüdische, christliche, islamische oder buddhistische Kindergärten taugt. Nach Franz-Xaver Kaufmann trägt Religion zur „Identitätsstiftung, Handlungsführung, Kontingenzbewältigung, Sozialintegration, Kosmisierung und Weltdistanzierung“ bei; für Armin Nassehi gehören zum „Begriff des Religiösen“ auf jeden Fall „folgende Merkmale:
1. Religion unterscheidet Vertrautes und Unvertrautes, und überführt Unvertrautes in Vertrautes, um die Welt bestimmbar zu machen.
2. Religion verbindet Anspruchserhaltung mit Anspruchszurücknahme.
3. Religion unterscheidet Transzendenz und Immanenz und beruft sich auf einen Sinn von außen (was immer als dieses Außen thematisiert wird).
Religiöse Kommunikation ist nur immanent möglich, benötigt aber Sinnverleihung von außen.“ (663)
Dommel führt nun in die Diskussion über Religions-Bildung im Kindergarten ein Element ein, das ich für sehr geeignet halte, um zu überprüfen, ob die pädagogischen Anstrengungen auf diesem Gebiet dem Recht der Kinder auf Religion entsprechen und ihre Ziele auch tatsächlich erreichen. Sie geht zur „Vermeidung bisheriger Sackgassen“ von einer Reihe von „Schlüsselthemen“ aus, „denen Religions-Bildung verpflichtet sein muss“, und formuliert sie „als ‚Wirkfaktoren‛…:
1. Sprache und Kommunikation
2. Geschichten aus der Geschichte
3. Liebe
4. Erfahrung
5. Macht (664)“
Unter der Voraussetzung, dass diese fünf Wirkfaktoren aus „religionswissenschaftlicher Perspektive“ und nicht „metaphysisch begründet“ werden, sind sie „als empirisch überprüfbare, d. h. wissenschaftlich messbare Gradmesser einer inklusiven Religions-Bildung nutzbar“ (665). In den folgenden Abschnitten betrachte ich mit ihrer Hilfe einige Aspekte der Religions-Bildung im Kindergarten.
↑ 7.2.1 Sprache und Kommunikation
Im Zusammenhang mit dem Wirkfaktor „Sprache und Kommunikation“ macht Christa Dommel trotz weitgehenden Traditionsabbruchs auf die zunehmende Bedeutung von Religion in der bundesdeutschen Öffentlichkeit aufmerksam:
„Nicht nur für ethnische Minderheiten ist Religion eine Möglichkeit der emotionalen Selbstvergewisserung. Auch für die Mehrheitsgesellschaft eröffnet religiöse Sprache – gerade weil sie inzwischen zur ‚Fremdsprache‛ geworden ist –, eine potentielle Gegenwelt zu einer unbefriedigenden Alltagsrealität und einem defizitären Lebensgefühl. Ein Beispiel ist die überraschende Karriere der Boulevard-Schlagzeile ‚Wir sind Papst!‛ in Deutschland, die mittlerweile zur stehenden Redewendung wurde.“
Da sich „das Islambild in der deutschen Öffentlichkeit … als potentielle Diskriminierungsursache“ und „Bildungshemmnis für die Entwicklung der Kinder auswirken kann“, ist es wichtig, auch muslimischen Kindern im Kindergarten die Möglichkeit zu geben, über ihre Religion zu reden, denn: „Die emotionale Kraft religiöser Selbstkonzepte ist eng verbunden mit ihren sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten.“ Und:
„Was die Religionspädagogik im Interesse von ‚Bildung für alle‛ leisten muss, ist, Kindern aus nichtchristlichen Minderheiten im Kindergartenalltag Anknüpfungspunkte anzubieten, in denen sich ein Stück ihrer Kultur widerspiegelt – sprachlich und kulturell-religiös, und daneben die christliche Perspektive für Nichtchristen zu ‚übersetzen‛, d. h. verständlich werden zu lassen.“
Dommel spricht sich in diesem Zusammenhang auch für die Einstellung zweisprachiger Erzieherinnen aus (vgl. Kapitel 3.2, 3.3.2 und 8.6):
„Wenn es türkische Erzieherinnen gibt, die die Muttersprache der Kinder sprechen und die womöglich selbst ein Kopftuch tragen, sind dies ‚Anknüpfungsinseln des Vertrauten‛ in der für die Kinder zunächst unzugänglichen Einrichtung. Es gibt (wenige) christliche Kindergärten in Deutschland, die trotz grundsätzlicher Vorbehalte gegenüber möglichen ideologischen Konnotationen des Kopftuchs und trotz (oder wegen) ihres explizit christlichen Profils den Mut haben, die konkrete Einzelperson wahrzunehmen und pädagogisch kompetente zweisprachige türkische Erzieherinnen mit und ohne Kopftuch einzustellen, weil sie damit deren hohes Förderungsvermögen für türkischsprachige Kinder nutzen und würdigen.“ (666)
Unter Bezug auf den türkischen Sprachphilosophen Nermi Uygur (siehe Kapitel 3.3.2) geht Dommel auch auf die Relevanz einer „Außenperspektive auf Eigenart und Grenzen der eigenen Sprache … für eine vorurteilsbewusste Pädagogik im Zusammenhang mit Religion“ ein.
„Ein gängiges Zerrbild ‚des Islam‛ besagt, dass hier das Individuum prinzipiell keine bedeutende Rolle spielt, sondern dass das Leben durch ‚Kollektivismus‛ geprägt sei. Dieses hartnäckige Vorurteil verkennt nicht nur die individualistischen Seiten der islamischen Tradition…, sondern auch die verschiedenen länderspezifischen Ausprägungen, die auch durch ihre sprachlichen Weltsichten geprägt sind. Die Kenntnis des subjektbezogenen, emotionalen und ästhetischen Reichtums der türkischen Sprache kann nicht nur Vorurteile nichttürkischer Kinder und Eltern in Frage stellen, sondern auch ihre Lebensmöglichkeiten um bisher unbekannte Facetten erweitern, sofern das in unseren Kindergärten reichlich vorhandene mehrsprachige Potential pädagogisch genutzt wird. Ich halte es für einen notwendigen Bestandteil gegenwartsbezogener ‚Allgemeinbildung‛, den kulturellen Reichtum, der in unserer Gesellschaft vorhanden ist, auch der nicht türkischsprachigen Bevölkerung zugänglich zu machen.“ (667)
Im Umkreis des Wirkfaktors „Sprache und Kommunikation“ erinnert Dommel auch an die Bedeutung von „Körpersprache“ sowie an die „kulturelle und sprachliche Minderheit“ der Gehörlosen mit ihrer „Gebärdensprache als Muttersprache“. Diese ist
„aus sprachwissenschaftlicher Sicht eine vollwertige Sprache, die mit der Kultur der Gehörlosen verbunden ist, und die literarische Formen, Dialekte und nationale Unterschiede aufweist. Doch das Negativimage der defizitären ‚Behindertensprache‛ greift Gehörlose als Personen an, indem ihre Sprache als Kompetenz geleugnet wird.“ (668)
Bereits im Kapitel 3.4 bin ich auf John M. Hulls „Spiritualität der Behinderung“ eingegangen, als ein
„Beispiel für eine … Verknüpfung von inklusiver Religions-Bildung mit einer Perspektive, die nicht den Weltzugang der Sehenden zur allgemeinen Norm im religiösen Denken und in der Symbolsprache erklärt“ (669).
↑ 7.2.2 Geschichten aus der Geschichte
Für den zweiten Wirkfaktor „Geschichten aus der Geschichte“ interessiere ich mich besonders, da ich ja im Kindergarten selber Geschichten aus verschiedenen religiösen Traditionen erzählen will.
„Der Umgang mit Geschichte und das Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist ein wichtiger ‚Wirkfaktor‛ für Religionspädagogik. Das Verhältnis einer religiösen Tradition zu ‚Geschichte‛, ihre Gedächtnisstrukturen und ihre ‚Erinnerungskultur‛ sind ein Schlüssel zum Verständnis für die Abgrenzung zwischen ‚Religion‛ und ‚Nicht-Religion‛. Die ‚Wirksamkeit‛ dieses Faktors zeigt sich im Alltag einer Kindertagesstätte nicht zuletzt im Jahreskreis der Feste. Fragen wie ‚Welche religiösen Feste finden Beachtung, welche nicht?‛ oder ‚Welche Geschichten aus der religiösen Geschichtsschreibung werden den Kindern zugänglich gemacht, und in welcher Form?‛ sind ein Indikator dafür, dass dieser Wirkfaktor in jedem Falle die pädagogische Praxis beeinflusst; wie er sie beeinflusst, hängt davon ab, wie die Antwort auf diese Fragen ausfällt.“ (670)
Zu diesen Fragen äußert sich Dommel auch in ihrem „Religionsforscher“-Aufsatz:
„Religiöse Feste und Rituale sind nicht nur deswegen ein willkommener Anlass zum Forschen, weil sie den Alltag und seine Unterbrechungen strukturieren. Sie ermöglichen uns auch, die ‚Geschichten aus der Geschichte‛ näher zu erkunden, die sich mit jedem der religiösen Feste verbinden. Sie machen deutlich, dass und wie Religion riesige Zeitdistanzen überbrückt. Das klingt zunächst abstrakt, wird aber schnell konkret, wenn wir die Vornamen in den Gruppen gemeinsam mit den Kindern auf Ursprung und Bedeutung hin untersuchen. Wieviele der Kinder tragen, bewusst oder unbewusst, Namen wie Sarah, Ibrahim, Johannes, Mohammed, Fatma oder Christiane, die sie mit einer alten religiösen Tradition verbinden? Der Bezug zu den religiösen Urahnen schwingt auch dann als ‚Flair‛ mit, wenn die Eltern nicht ausdrücklich daran gedacht haben, als sie den Namen für ihr Kind ausgesucht haben. Die besondere Attraktivität liegt unter anderem darin begründet, dass eine Kontinuität hergestellt wird zwischen unserer kollektiven Geschichte und unserer heutigen Lebensrealität. Ein traditionsreicher Name würdigt die Spannung dazwischen und integriert die gesellschaftlichen Veränderungen.“ (671)
In Deutschland gibt es nach Christa Dommel sowohl in der Forschung als auch im Kindergartenalltag große Defizite im Blick auf den Wirkfaktor der Geschichten aus der Geschichte.
„Der Anspruch, mit Geschichten tatsächlich ein Bewusstsein der eigenen Geschichte – im wissenschaftlichen Sinne – oder der von anderen Menschen zu entwickeln, spielt in den Erzählkonzepten für Kinder nur selten eine Rolle. Dies gilt in besonderem Maße dann, wenn es um Religion geht. Gerade religiöse Erzähltraditionen, die die Sprachentwicklung, kulturelle Neugier und Denkfähigkeit der Kinder ebenso unterstützen könnten wie andere ‚Geschichten‛ (Märchen, Abenteuergeschichten, Sagen), werden aus den deutschsprachigen kulturpädagogischen Erzähl-Konzepten in der Regel konsequent ausgespart, auch dann, wenn es z. B. um den islamischen Nasreddin Hodscha geht, der als Figur des türkischen Humors, aber nicht als Inhaber eines religiösen Amtes vorgestellt wird… Religion wird isoliert und an die Religionspädagogik delegiert. Dort wiederum gelten religiöse literarische Texte nicht als ‚Literatur‛, d. h. als Kunstform, die als Teil des Bildungskanons allen Kindern zugänglich gemacht wird, sondern als ‚heiliger‛ Text, der vor einer Vermischung – im Sinne von Gleichbehandlung – mit profaner Literatur in einem Sonderbereich geschützt wird.“
Dommel betont aber zu Recht:
„Um die eigene Geschichte oder auch die Geschichte anderer zu kennen und zu verstehen, ist es notwendig, auch Religion im kulturellen Gedächtnis zu kennen, zu erzählen und womöglich literarisch in Worte zu fassen – diese Fähigkeit ist Teil von Religions-Bildung.“ (672)
↑ 7.2.3 Liebe
Als dritten Wirkfaktor für Religions-Bildung benennt Christa Dommel die „Liebe“, die als „Fremdkörper erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung und Praxis eher belächelt“ (673) und „üblicherweise als wissenschaftlich nicht messbar eingestuft und zudem auf den Privatbereich verwiesen“ wird.
„Dass ‚Liebe‛ als erziehungswissenschaftliche Kategorie und erlernbare Kompetenz relevant ist und auf eine bestimmte Art als solche genutzt wird, die inklusiver Bildung oft entgegensteht, möchte ich demonstrieren.“ (674)
„Während christliche Religionspädagogen sich mühen, ihre religiösen Motive in eine möglichst ‚objektive‛, gefühlsarme und erst dadurch als wissenschaftlich anerkannte Sprache hinüberzuretten“, sind es nach Dommel
„vor allem jüdische Autoren, die die moderne Pädagogik bis heute theoretisch mit der Liebe in Verbindung bringen – und das nicht nur im Rahmen psychoanalytischer Pädagogik: Micha Brumlik, Erich Fromm, Bruno Bettelheim, Janusz Korczak sind nur einige prominente Beispiele. Ihnen gemeinsam ist ein Verständnis von ‚Liebe‛ im Sinne eines praxeologischen Theoriekonzepts, das nicht auf das Privatleben beschränkt bleibt, sondern als notwendige menschliche Kompetenz gelehrt und gelernt werden kann und muss.“
Sie führt aus, dass Micha Brumlik ausgehend „von sechs Tugenden…: Gerechtigkeit, Mut, Mäßigung und Besonnenheit, Hoffnung, Glaube und Liebe … eine Theorie der Freundschaft“ entwickelt, und zwar als
„eine Möglichkeit, den scheinbar unheilbaren Privatismus der Liebe mit dem Freiheits- und Gerechtigkeitsprinzip der Öffentlichkeit zu verbinden – einen für das Verständnis des Bildungsgeschehens in einer Demokratie zentralen Begriff.“ (675)
An gleicher Stelle geht sie auf Janusz Korczak ein. Er
„hebt neben der Liebe auch den Hass hervor: ‚Denn wie wollt ihr ein Kind ins Leben einführen, wenn es überzeugt ist, dass alles richtig, gerecht, verständig begründet und unabänderlich sei? In der Theorie der Erziehung vergessen wir, dass wir das Kind nicht nur lehren sollten, die Wahrheit zu schätzen, sondern auch, die Lüge zu erkennen, nicht nur zu lieben, sondern auch zu hassen, (…) sich nicht nur zu fügen, sondern auch zu entrüsten, nicht nur nachzugeben, sondern sich auch zu empören.‛ “ (676)
Dommel diskutiert ausführlich Narzissmus- und Regressionstheorien und kritisiert religionspsychologische Annahmen Eriksons, insofern er „Religion … auf die Erinnerung an das verlorene Paradies der Kindheit zurück[führt] – in Gestalt der Verschmelzung mit der Mutter –, und … dieser Sehnsucht die Möglichkeit einer Reifung als Kombination von Glaube und Realismus gegenüber[stellt].“ Demgegenüber müssen der
„veränderte gesellschaftliche Kontext – etwa die stärkere Beteiligung von Vätern bei der Kinderbetreuung von Kleinkindern oder die jeweils konkret feststellbaren Bedingungen des Kindseins, die durchaus nicht immer paradiesisch sind – … in eine kultur- und religionswissenschaftlich orientierte Religionspädagogik Eingang finden…, wenn sie ihre Adressaten erreichen will.“ (677)
Schließlich verweist Dommel auf Erkenntnisse „über das erste Auftreten von Mitgefühl und prosozialem Verhalten in der Kindheit und die Einflüsse von Eltern und Kindergartenpersonal auf diese Kompetenz“, die von der „Forschungsgruppe ‚Mitgefühl‛ der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Augsburg“ im Jahr 2002 veröffentlicht wurden:
„gegen die Annahme vom ‚natürlichen‛ frühkindlichen Egozentrismus oder Narzissmus konnte in vielen Studien nachgewiesen werden, dass Kinder bereits kurz nach ihrer Geburt empfänglich sind für das Weinen anderer, dass sie Gefühlsausdrücke anderer unterscheiden und imitieren können und über Gefühlsansteckung Emotionen anderer ‚stellvertretend‛ erleben. Nach dem ersten Geburtstag entwickelt sich die Besorgtheit um das Wohlbefinden anderer im Sinne von aktivem prosozialem Verhalten, d. h. in Form von spontanen Bemühungen, zugunsten einer leidenden Person zu intervenieren… Im zweiten Lebensjahr nimmt die Vielfalt der Fähigkeiten für Mitgefühl ebenso stark zu wie die der Handlungsmöglichkeiten – gleichzeitig jedoch auch die Fähigkeit, anderen Leid zuzufügen. Der Einfluss der elterlichen Motivation zu Hilfsbereitschaft, Teilen etc. sowie Bestärkung oder Nichtbeachtung durch die Erzieherinnen wurde untersucht und ergab ein differenziertes Bild… Demnach entwickeln Kinder bestimmte Kriterien, nach denen sie über ihr soziales Verhalten entscheiden, bei dem sich auch bemerkenswerte Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen ergaben: schüchterne Jungen sind durch einen gleichgültigen, kalten Erziehungsstil eher verletzbar und von sozialem Verhalten abzubringen als schüchterne Mädchen, bei denen Schüchternheit gesellschaftlich weniger negativ sanktioniert ist…
Insgesamt bestätigt diese bemerkenswerte Studie mit ihren zahlreichen Verweisen auf andere empirische Untersuchungen die zentrale Bedeutung emotionaler Zuwendung nicht nur im Elternhaus, sondern auch im Kindergarten.“ (678)
↑ 7.2.4 Erfahrung
Den Wirkfaktor „Erfahrung“ will Christa Dommel bewusst nicht eingeengt im Sinne nur „religiöser Erfahrung“ verstehen, aber auch über sie trifft sie klare Aussagen:
„Religiöse Erfahrung, gedacht als ‚echte‛, persönliche Erfahrung, gilt weithin als authentisch und schützenswert, während religiöse Institutionen, insbesondere die Kirchen, inzwischen unter Generalverdacht geraten sind, solche Erfahrungen eher zu behindern als zu fördern. So konstatierte eine Studie der Düsseldorfer Identity Foundation, durchgeführt von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 2006, dass nur 10 % der deutschen Bevölkerung noch als ‚Traditions-Christen‛ zu bezeichnen sind, sie werden zahlenmäßig weit überflügelt von den Kategorien ‚Religiös Kreative‛ (35 % der Bevölkerung; gemeint sind Angehörige der Glaubensgemeinschaften, die sich jedoch bewusst von deren Lehrmeinungen abgrenzen und Anregungen aus anderen Religionen und der Philosophie aufnehmen) und ‚Spirituelle Sinnsucher‛ (15 % der Bevölkerung; Suche nach eigener Berufung und innerer Mitte mit Hilfe von Fragmenten aus Humanismus, Anthroposophie, Mystik und Esoterik, und mit Praktiken wie Yoga, Chi Gong oder Trancereisen, Schamanismus und Kartenlegen). [Die übrigen (40 %) werden der Kategorie ‚Alltags-Pragmatiker‛ zugeordnet.]
Für mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist demnach ‚religiöse Erfahrung‛ und ihre Definition ein Thema, das von Interesse ist und das nicht durch die Vorgaben der Religionsgemeinschaften abschließend geklärt ist. Wird der Erfahrungsbegriff im Zusammenhang mit Religion kommunikationstheoretisch verstanden, d. h. wird er aus seiner substantialistischen Verengung auf außeralltägliche und ‚übernatürliche‛ Erfahrungen (Gotteserfahrungen) gelöst, kommen die von Menschen entworfenen Rituale in den Blick der Religionswissenschaft, die als ‚Brücke‛ in andere transzendente Welten fungieren. Im Rahmen einer solchen Perspektive kann Erfahrung von Religion und Transzendend nicht mehr eindeutig als positiv bewertet werden, weil sie – wie jede Kommunikationserfahrung – bestimmten sozialen Zielen dient, von denen ihre Bewertung abhängt.“ (679)
Im Zusammenhang mit mit einem erweiterten Begriff von Erfahrung hält Dommel die folgenden „drei Aspekte für zentral:
1. Körperliche Erfahrung und Sinneswahrnehmung
2. Erfahrung als Lebenserfahrung in der Biographie
3. Erfahrung als Empirie und Experiment“ (680)
Zum 1. Punkt erinnert sie unter anderem an die im jüdischen und islamischen Alltagsleben praktizierten
„Essensgebote, die zwischen erlaubten und nicht erlaubten Nahrungsmitteln unterscheiden: der Genuss von Essen, das ‚halal‛ (arabisch: ‚erlaubt‛) bzw. ‚koscher‛ (jiddisch: ‚tauglich‛; von hebräisch: ‚kasher‛ zum Genuss erlaubt) ist, bietet Muslimen und Juden nicht nur das innere Bewusstsein, sich an religiöse Vorschriften zu halten, sondern konstituiert auch eine körperlich-sinnliche Gotteserfahrung.“ (681)
Außerdem geht Dommel auf die nicht nur positiven, sondern auch negativen Erfahrungen mit Religion ein:
„Weder ein Wegdefinieren der gewalttätigen Folgen menschlicher Religions-lnszenierungen als ‚Nicht-Religion‛ noch eine pauschale Diffamierung von Religion als per se anti-emanzipatorisch wird dem komplexen Befund gerecht. Erfahrung mit Religion ist per definitionem aus religionswissenschaftlicher Sicht weder eindeutig gut noch schlecht, weder eindeutig nützlich noch schädlich für Individuum und Gesellschaft, sondern potentiell beides. Gerade deshalb ist es notwendig, sie als Bestandteil öffentlicher Bildungsanstrengungen nicht nur beizubehalten, sondern ernster zu nehmen als bisher – auch im Kindergarten.“
Sie empfiehlt
„ein sensibles Aufgreifen der eigenen Erfahrungen der Kinder…, die ohnehin alles, was in der Welt geschieht, widerspiegeln… Das Vertrauen in die eigene Welterfahrung zu stärken und gleichzeitig den Austausch mit anderen Erfahrungswelten zu ermutigen ist das Hauptanliegen frühkindlicher Religions-Bildung im Hinblick auf den Wirkfaktor ‚Erfahrung‛.“ (682)
Den 2. Punkt des Wirkfaktors „Erfahrung“ als Lebenserfahrung (683) hält Dommel für besonders relevant
„gerade im Kontext säkularer Religions-Bildung im Vorschulbereich. Religion gilt in öffentlichen Kindergärten bislang nicht als Bestandteil des Kanons der Allgemeinbildung. Auch für einen großen Prozentsatz der pädagogischen Fachkräfte in kirchlichen Einrichtungen wäre ein allgemeinbildendes Konzept von Religions-Bildung angebracht, da viele sich selbst nicht als religiös in dem Sinne verstehen, wie offizielle kirchliche Stellungnahmen … zum Auftrag der christlichen Kindergärten es sich erhoffen.“ (684)
Als beispielhaft beschreibt Christa Dommel die Art, wie der evangelische Theologe Henning Luther in seinem Aufsatz „Der fiktive andere“ die religiöse Dimension nicht erst dort auftauchen sieht, wo explizit von Gott die Rede ist, sondern sie implizit „in der formalen Struktur biographischer Reflexion“ aufspürt (685). Wer über sein eigenes Leben nachdenkt und vielleicht einem Tagebuch seine Gedanken anvertraut, schreibt nach Luther „für einen »fiktiven anderen«“, dem „zwei Eigenschaften“ zukommen, „die sich benennen lassen“.
„Dieser »andere« ist zum einen mindestens ebenso verständnisvoll wie das schreibende Ich sich selbst gegenüber. Berechnende Stilisierungen werden diesem anderen gegenüber hinfällig, da er sich von diesem vorab angenommen und geliebt fühlt. …
Andererseits unterstellt diese Offenheit dem »fiktiven anderen« zugleich eine kritische Kraft, die helfen könnte, das aufzuhellen, was dem Tagebuchschreiber an sich selbst problematisch erscheint.
Der »fiktive andere« ist also liebend und kritisch zugleich, und zwar eins im anderen.“ (686)
Religiös ist also nicht erst das ausdrücklich an einen Gott gerichtete Gebet, sondern jedes Nachdenken über sich selbst unter einem liebend-kritischen Horizont. Christa Dommel zieht daraus den Schluss:
„Die hier konstatierte strukturelle Verwandtschaft von Gebet und Biographie wirft ein neues Licht auf den Wirkfaktor ‚Erfahrung‛ in vorschulischen Konzepten von Religions-Bildung sowohl für Erzieher/innen (Erwachsenenbildung) als auch für Kinder: sie erlaubt es, das Merkmal ‚Transzendenz‛ nicht im metaphysischen Sinne zu definieren, ohne diese Definitionsmöglichkeit auszuschließen.“
Ähnlich argumentiert Gert Otto zum Thema Gebet:
„Wenn es zum Menschen wesenhaft gehört, dass er sich nach vorn ausstreckt, dass er auf etwas aus ist, weil er bedürftig ist, dann gibt das Gebet dieser ‚Struktur‛ des Menschseins gewiss von alters her Ausdruck.“
Im Blick sowohl auch Henning Luther als auch auf Gert Otto, bei dem ich übrigens 1973 bis 1976 Praktische Theologie studiert habe, schreibt Dommel:
„Die Tatsache, dass diese Überlegungen von christlichen Theologen stammen, konstituiert ihre Fragerichtung sicherlich in eine bestimmte Richtung. Dennoch betreiben sie an dieser Stelle Religionswissenschaft, nicht Theologie. Theologen anderer religiöser Herkunft zu einem solchen religionswissenschaftlichen Diskurs innerhalb der allgemeinen Pädagogik einzuladen, ist ein Anliegen dieser Studie.“ (687)
Zum 3. Punkt „Erfahrung als Empirie und Experiment“ ruft Christa Dommel „die religionstheoretischen Arbeiten des amerikanischen Philosophen und Erziehungswissenschaftlers John Dewey (1859-1952) in Erinnerung“ (688), dessen „Ausgangspositionen“ zum Teil mit denen ihrer eigenen
„Studie – trotz des zeitlichen Abstands und des amerikanischen Kontexts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – nahezu identisch [sind]:
a) er stellt die Entgegensetzung von säkular und heilig in Frage
b) er setzt ‚Religion‛ nicht gleich mit etwas Übernatürlichem
c) er plädiert für eine Konzentration der religiösen Qualität auf zwischenmenschliche Beziehungen und demokratisches Engagement
d) er beschreibt mit dem religiösen Aspekt von Erfahrung ein breites Spektrum ästhetischer, wissenschaftlicher, moralischer oder politischer Erfahrungen, sowie Partnerschaft oder Freundschaft“ (689)
John Dewey vertritt ein „säkulares Konzept religiöser Erfahrung“, das zum amerikanischen „philosophischen Konzept des Pragmatismus“ gehört (690). Aus seiner Perspektive folgt „die Unterscheidung zwischen ‚Religion‛ als Substantiv und ‚religiös‛ als Adjektiv“.
„Aufgrund des riesigen und widersprüchlichen Spektrums von Inhalten und Ausdrucksformen von ‚Religion‛ – etwa Geisterglaube, Deismus, personalisierte Gottesvorstellungen sowie Ausdrucksformen wie Prostitution, Askese oder Gerechtigkeitsethos … – ist der gemeinsame Nenner dieses Begriffs wenig gehaltvoll. …
Das Adjektiv „religiös“ dagegen beschreibt Dewey zufolge eine bestimmte Qualität der Alltagserfahrung, die potentiell jeder Erfahrung innewohnen kann und nicht einem eigenen, aus sich selbst heraus existierenden Bereich zugeordnet werden kann…
Alle Religionen beanspruchen, dass es die Macht der Religion ist, die den fragmentarischen Episoden unserer Existenz eine Perspektive gibt. Dewey behauptet umgekehrt, dass nicht die Religion es ist, die uns diese Perspektiven eröffnet, sondern dass uns dies ermöglicht wird von dem, was einer bestimmten Geisteshaltung entspringt: eine Geisteshaltung, die unsere Abhängigkeit von Kräften, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, anerkennt.“ (691)
Ene solche Geisteshaltung, ganz gleich, ob sie sich auf Vorstellungen einer konkreten Religion bezieht oder nicht, nennt Dewey religiös.
„Es ist diese Qualität, die Dewey in vielen diesseitigen menschlichen Lebenserfahrungen beobachtet und als ‚religiös‛ wertschätzt – d. h. imstande, das Selbst zu einem ‚Ganzen‛ zu machen: Eltern, die ihre Kinder aufziehen, Wissenschaftler/innen, die sich einem Projekt verschreiben, Bürger/innen, die sich für ein gemeinsames Ziel engagieren. … Die Möglichkeiten der Kommunikation und Verständigung zwischen Menschen bezeichnet Dewey als ‚Wunder‛.“ (692)
Eine „Neureflexion seines Verständnisses von ‚religiös‛ im Zusammenhang mit sozialer Intelligenz“ hält Dommel für einen
„Weg aus der Sackgasse vieler religionspädagogischer Kontroversen. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen dabei nicht um ihre Existenz fürchten – was jedoch von ihnen verlangt werden muss, ist die Aufgabe ihres Anspruchs auf eine ‚exklusive und maßgebliche Position‛… Dewey geht im Gegenteil davon aus, dass die von ihm angeregte Verschiebung von Imagination, Denken und Fühlen vom Übernatürlichen auf die menschlichen Beziehungen die Kirchen und Religionsgemeinschaften revitalisieren und sie auf ihre ureigensten Anliegen zurückführen würde.“ (693)
↑ 7.2.5 Macht
Zum fünften Wirkfaktor „Macht“ bemerkt Christa Dommel einleitend:
„Macht – besonders die jeweils eigene – ist vermutlich derjenige Wirkfaktor, der am wenigsten explizit thematisiert wird, in religionspädagogischen Diskursen wie in der Pädagogik generell. Das liegt nicht nur daran, dass diejenigen Diskursteilnehmer/innen, die eine machtvolle Position innehaben, in der Regel kein Interesse daran haben, ihren privilegierten Status selbst zu thematisieren und damit womöglich zu gefährden, sondern auch daran, dass in hochkomplexen modernen Gesellschaften die Machtverteilung keineswegs so eindeutig zu orten und angemessen zu erfassen ist, wie es monokausale oder personenbezogene Erklärungsmuster gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen nahe legen. Michel Foucault hebt die neuen Machtmechanismen seit dem 18. Jahrhundert hervor, die nicht nur auf Repräsentationen des Rechts oder der staatlichen Gewalt zurückgeführt werden können, sondern die mit Technik statt Recht, mit Normalisierung statt Gesetz, und mit Kontrolle statt Strafe arbeiten. Sie können mit dem Bild des ‚Königs‛, das noch immer politisches Denken dominiert, nicht erfasst werden.“ (694)
Interessant ist in diesem Zusammenhang Dommels differenzierter Gedankengang zum Anachronismus religiöser Bildersprache:
„Religiöse Bildersprache wie das biblische ‚Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen‛ (Lukas 1,52) hat zwar noch immer eine Ausdruckskraft für menschliche Ohnmachtserfahrungen…, kann mit der ‚Königsmetapher‛ jedoch die gegenwärtig wirksamen Funktionsweisen von Macht und Gegenmacht in komplexen modernen Gesellschaften nicht erfassen und hat daher anachronistischen Charakter. Dieser ist allerdings Gladigow zufolge … notwendiges Konstitutivum von Religion und auch Voraussetzung für deren Modernisierung. Anachronismus, auch in der Herrschaftskritik, ist also kein Grund, um Religion als irrelevant für moderne Gesellschaften einzustufen.“ (695)
Vieles, was in den Zusammenhang mit dem Wirkfaktor „Macht“ gehört, ist von mir bereits im Kapitel 3 angesprochen worden. Christa Dommel zufolge enthält die weitgefächerte Thematik viele „Fußangeln“ (696); zum Beispiel stoßen gut gemeinte Initiativen zur Herstellung von Gerechtigkeit auf das Problem,
„dass niemand sich gern pauschal selbst zur ‚benachteiligten Bevölkerungsgruppe‛ erklärt… In der Umgangssprache der Jugendkultur spiegelt sich das allgemeine Unbehagen am Thema Chancengleichheit im beliebten Schimpfwort ‚Opfer‛, das traditionelleren Titulierungen an Schärfe deutlich überlegen ist, während dagegen altgediente Schimpfworte inzwischen selbstbewusst von ihren Träger/innen adaptiert wurden und neuerdings Stolz und Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen (z. B. ‚Zicke‛).“ (697)
Um mit dieser Situation umzugehen, schlägt Christa Dommel ähnliche Strategien vor wie der in Kapitel 3.1.2 zitierte Paul Mecheril:
„Wenn das Ziel von Religions-Bildung ist, Ideologiekritik mit Respekt für religiöse Unterschiede zu verbinden, muss sie andere Kommunikationsstrategien und Konzepte wählen als den Appell an ein (möglicherweise nicht vorhandenes) schlechtes Gewissen. (Selbst-)Ironie und Humor sind dabei unentbehrlich.“ (698)
„Religion“ ist nach Christa Dommel
„im Kräftespiel um Gleichheit und Gleichberechtigung auf allen Seiten vertreten: weder lässt sich leugnen, dass Religion als Mittel zur Stabilisierung von rassistischen, antisemitischen oder sexistischen Stereotypen genutzt wurde und wird, noch dass sie imstande ist, deren Wirkungsmacht erheblich zu reduzieren. Bezogen auf das Anliegen, einen adäquaten Ort von Religion in frühkindlicher Bildung zu skizzieren, kann diese Erkenntnis nur bedeuten: es muss Religions-Bildung darum gehen, die rationalen und emotionalen Fähigkeiten von Kindern und Erwachsenen zu schärfen, das eine vom anderen zu unterscheiden und die Möglichkeiten der persönlichen Entscheidung für das eine oder andere Potential hervorzuheben, einschließlich ihrer Konsequenzen. Die pädagogische Sparte ‚Frühkindliche Bildung‛ richtet sich an das pädagogische Personal von Kindertageseinrichtungen und wirkt sich damit über Erwachsene auf Kinder aus – es geht hier keineswegs nur um Themen, die Kleinkinder bereits kognitiv verarbeiten können, wie die hier skizzierten politischen Kontroversen zeigen. Auch Kleinkinder haben schon ein feines Gespür für Machtverhältnisse und daraus resultierende ‚Hack-Ordnungen‛ und Vorurteile. Sie lernen den Umgang damit von ihren erwachsenen Bezugspersonen.“ (699)
Eine ganze Reihe von Gesichtspunkten ist im Blick auf den Wirkfaktor „Macht“ zu bedenken, zum Beispiel, dass man nicht in diverse Fallen tappt:
Zum Beispiel die Falle des falschen moralischen Schuldgefühls:
„Eine politische Analyse von Machtstrukturen und der eigenen Teilhabe daran ist … nicht gleichzusetzen mit einem individuellen Schuldeingeständnis (einer säkularisierten Form der Beichte …) oder dem Bekenntnis, ein schlechter Mensch zu sein. Gleichzeitig ist auch der gesellschaftliche Status als ‚Unterdrückte/r‛ kein Merkmal moralischer Qualität oder Überlegenheit. Diese besonders in der christlichen Kultur weit verbreitete Gleichsetzung führt zu einer auf die zwischenmenschliche Ebene verschobenen und dadurch persönlich enorm belastenden Auseinandersetzung über Machtverhältnisse, die eine Art Stellvertreterfunktion erfüllt und von einer Untersuchung der Situationen und Strukturen ablenkt. So werden verschiedene Opfer-Typologien konstruiert, die es weiterhin erschweren, Verantwortung für die eigene Bevölkerungsgruppe zu übernehmen. Der israelische Psychologe Dan Bar-On nennt als Beispiel das ‚Auch-wir-haben-gelitten‛-Syndrom: die Tendenz, eigene Leidensgeschichten zu schildern, sobald wir mit denen anderer konfrontiert werden, das als Schutzschild gegen die Last der Asymmetrie dient…
Diese Erkenntnis ist relevant für eine Religions-Bildung, die offen sein muss auch für nichtchristliche religiöse Traditionen und Einflüsse, ohne diese dabei auf eine ‚ethnic identity‛, ‚Außenseiter‛- oder ‚Opfer‛-Perspektive festzuschreiben, sondern mit dem Ziel, ihre Anfragen als Herausforderung für den ‚mainstream‛ zuzulassen. ‚Macht‛ wäre dann nicht notwendigerweise gekoppelt an moralische Schuld, sondern als Synonym für politische Artikulations- und Handlungsfähigkeit zu verstehen, die auf verantwortliche oder unverantwortliche Weise genutzt werden kann.“ (700)
Auch die Falle einer „Transparenz“ in falsch verstandenem Sinn ist tunlichst zu vermeiden:
„Wenn säkulare Religionspädagogik den Wirkfaktor ‚Macht‛ im Rahmen einer kritischen Bildungstheorie reflektiert, wie das hier vorgeschlagen wird, geht es nicht um ein ‚Transparentmachen‛ der christlichen Mehrheitsposition in dem Sinne, dass sie die eigene Position aus dem hierarchischen Konstruktions- und Konstitutionsprozess ausnimmt…, der über religiöse Zuschreibungen Identitäten festlegt und Bildungsziele definiert.“
Gayaratri Chakravorty Spivak, „eine der Protagonistinnen im postkolonialen Diskurs“, legt eine andere Strategie nahe:
„Statt Transparenz wird Selbstverortung im Konstruktionsprozess der Machtbeziehungen vorgeschlagen, und dies bedeutet, die Stimme in uns, die die Stimme der Anderen ist, sprechen zu lassen…
Religions-Bildung im Kindergarten kann demnach Vorbehalte und Stereotype über andere religiöse Traditionen als die christliche Mehrheitsreligion, und auch umgekehrte Zerrbilder von Minderheiten über die Mehrheitsreligion beim pädagogischen Personal, bei Eltern und bei Kindern nicht einfach ‚wegtrainieren‛ mit Hilfe einer noch so reflektierten interreligiösen oder multikulturellen Pädagogik. Auch die differenzierteste Bildungstheorie kann gesellschaftlich real existierende unterschiedliche Rahmenbedingungen zwischen Mehrheits- und Minderheitenreligion nicht beseitigen – dies wäre eine Überschätzung der Möglichkeiten von Pädagogik. Selbstverortung als pädagogische Strategie kann jedoch zumindest eine Objektivierung der ‚Anderen‛ bzw. ‚Fremden‛ verhindern.“ (701)
Was hier so wissenschaftlich in schwierigem Soziologendeutsch verhandelt wird, bedeutet im Klartext, dass sich zum Beispiel die kirchlichen Träger multireligiöser Kindergärten bewusst machen sollten, welche Macht sie allein dadurch ausüben, dass sie Einfluss auf zwei Drittel aller deutschen Kindertageseinrichtungen ausüben. Wie wenig ausgeprägt das Nachdenken über den Wirkfaktor „Macht“ in kirchlichen Veröffentlichungen ist, zeigt sich in den kirchlichen Konzepten zur Religionspädagogik und auch zum interreligiösen Lernen, wenn dort fast durchgehend davon ausgegangen wird, dass muslimische Familien doch froh sein können, in christlichen Kindergärten wenigstens als Gast an religiösen Vollzügen teilnehmen zu dürfen, um es karikierend zu sagen. Ich sage das auch selbstkritisch im Blick auf die 13 Jahre meiner Mitverantwortung für einen evangelischen Kindergarten, in denen auch ich nur sehr wenig auf die religiösen Bedürfnisse der muslimischen und nichtkonfessionellen Kinder geachtet habe.
Christa Dommel will im übrigen alle Träger von Kindergärten in die Pflicht nehmen, sich ihrer Verantwortung für Religions-Bildung bewusst zu werden. Sie wehrt sich dagegen, einen Gegensatz aufzubauen zwischen kirchlichen und öffentlichen Trägern, als ob sich
„weltfremde, missionarisch-eifernde Religionsgemeinschaften hier, aufgeklärt-rationale, neutrale und emotionslose säkulare Pädagogik dort“
gegenüberstehen würden. Eine „Grundlage für praktische Lösungen der anstehenden Herausforderungen“ wäre ihrer
„Überzeugung nach die Bereitschaft aller Beteiligten am frühkindlichen Bildungsgeschehen, die Begrenztheit der jeweils eigenen Perspektive anzuerkennen und diese nicht als Defizit, sondern als Stärke zu werten: ‚Ich sehe was, was du nicht siehst!‛.“
Sie fordert eine „Selbstbeschränkung in öffentlicher Bildung“, die „nicht als Geringschätzung religiöser Kommunikation gedeutet werden“ darf, „sondern als sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften im Interesse inklusiver Bildung“, wobei auch die kirchlichen Träger in ihren multireligiösen Kindertageseinrichtungen öffentliche Bildung anbieten – und nicht die Beheimatung nur der christlichen Kinder in ihrer eigenen Tradition. Das bedeutet: Christliche oder auch muslimische religiöse Vollzüge wie Beten, Gottesdienst usw. sind und bleiben „Aufgabe und Kompetenz religiöser Erziehung, nicht aber öffentlicher Religions-Bildung, die an dieser Stelle auf religiöse Gemeinschaften verweisen kann und muss“ (702).
„Konkret bedeutet dies, dass in öffentlichen bzw. in nicht-kirchlichen Kindertageseinrichtungen in Deutschland die Beschäftigung mit implizit und explizit religiöser Kommunikation und Tradition verstärkt werden muss, um inklusive Bildung und Chancengleichheit zu fördern. Hier sollten insbesondere die englischen Ansätze für den deutschen Kontext weiterentwickelt werden. Die enge Zusammenarbeit mit den Theologien der Religionsgemeinschaften ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Umgekehrt steht für kirchliche Kindertageseinrichtungen, die in Deutschland noch immer die große Mehrheit darstellen, eine offene Auseinandersetzung mit dem strukturell entstehenden Konflikt zwischen religiöser Profilbildung und allgemeinen Religions-Bildungsstandards an.“
Ich finde es sehr beherzigenswert, wenn Christa Dommel als Mitglied einer kleinen Freikirche uns Vertretern der christlichen Großkirchen ermutigend ins Gewissen redet:
„Im Sinne inklusiver Bildung kann diese Auseinandersetzung nur dann geführt werden, wenn es den Kirchen gelingt, aus der Defensive, bedingt durch Mitgliederschwund und Angst vor Konkurrenz, herauszukommen, indem sie sich dessen vergewissern, was sie als ‚Eigenes‛ bezeichnen. Ohne den ‚Wirkfaktor Liebe‛, d. h. das auch emotionale und intuitive Erforschen und Bekunden geliebter Traditionen, die sich nach kritischer Prüfung bewährt haben, werden die Chancen, in der Öffentlichkeit mit dieser Botschaft anzukommen, gering bleiben.
Beispiele einer intellektuell und emotional ‚bekennenden‛ [nicht formal-konfessionell gebundenen] inklusiven Religions-Bildung sind etwa John Hulls säkulare Theologie der ‚Blessings of Secularity‛ oder Micha Brumliks Bildungstheorie der Freundschaft als Tugend, die die Liebesfähigkeit mit Politikfähigkeit verbindet, Hasan Alacacioğlus islamisch-säkulare ‚Bildungs-Gänge‛, Angela Woods Bestehen auf der Einheit von Methode und Inhalt (Judentum auf jüdische Art lehren) auch im Rahmen inklusiver Bildung, … und ‚Religionskunde‛ als kritische Bildungstheorie im Sinne von Jürgen Lott und Gert Otto.“ (703)
↑ 7.3 Kompetenzmodell religiöser Welterfahrung
Dieses Kapitel abschließend stelle ich Christa Dommels „Vorschlag für ein Kompetenzmodell religiöser Welterfahrung“ vor, der auf den oben ausgeführten Wirkfaktoren basiert:
„Religiöse Rationalität als kulturelle Kompetenz
1. Sprache, einschließlich der Körpersprache, als Weltbild und Beziehungs-Organ, Mehrsprachigkeit als religiöse Mehrfachbegabung
2. Geschichten aus der Geschichte als Transzendenz
3. Liebe als Erscheinungsform der Freundschaft, die Selbstliebe und Nächstenliebe umfasst, und die in vielen Theologien auf Gottesliebe gründet
4. Erfahrung als soziale Intelligenz, in der Körper, Intellekt, Gefühl und Handeln miteinander verbunden sind
5. Macht als Möglichkeit, Größe angesichts von Begrenztheit und skeptisch gegenüber jedem ‚Wir‛ zu denken (‚Autonomie in Abhängigkeit‛)“ (704)
↑ Anmerkungen
(647) Dommel, Elementarbereich, S. 442.
(648) Ebd., S. 443. Vgl. ebd. unter Bezug auf Elias, S. 130ff.: „Christoph Elias … etwa weist auf die Notwendigkeit hin, dass sich öffentliche Erziehung auf die religiös-kulturelle Identität der Eltern beziehen muss, dass z. B. »die säkularisierten türkischen Bewohner nicht als atypische Randgruppe unter den Muslimen vernachlässigt werden dürfen«.“
(649) Dommel, Elementarbereich, S. 443. Vgl. Dommel, Religions-Bildung, S. 59: „Das Problem, das sich für religiöse Minderheiten in einer mehrheitlich christlichen Gesellschaft durch den dominierenden Religionsbegriff ergibt, liegt im Machtgefälle eines jeden ‚interreligiösen Dialogs‛: während die Minderheit, um sich überhaupt verständlich machen zu können, mindestens zwei religiöse Bedeutungssysteme kennen muss – ihr eigenes und das christliche –, um die eigenen Kategorien mit Hilfe von christlichen Kategorien zu erklären, wird diese doppelte Kompetenz aus einer christlichen Mehrheitsposition heraus in der Regel nicht für nötig erachtet. Dabei wird aus Sicht der Mehrheit häufig unterschätzt, wie groß der theologische Zusammenhang mit und auch die eigene Abhängigkeit von anderen religiösen Traditionen ist.“
(650) Dommel, Elementarbereich, S. 443, wo sie das Ziel 20 des Netzwerks Kinderbetreuung der Europäischen Kommission 1996 zitiert (veröffentlicht bei Textor).
(651) Ebd., S. 444. Der letzte Satz wurde von Christa Dommel unter Bezugnahme auf Texte von Petra Wagner formuliert.
(652) Dommel, Diskriminierungsgrund, S. 153. Die Zitate stammen aus Diehm, S. 45f., bzw. von Gayatri Chakravorty Spivak, die wiederum von Schirilla, S. 262, zitiert wird.
(653) Dommel, Religionsforscher, S. 95.
(654) Ebd., S. 98, mit Bezug auf Sieg, Pendeln, S. 236ff.
(655) Ebd., mit Bezug auf Elschenbroich, Weltwissen.
(656) Dommel, Religionsforscher, S. 98.
(659) Dommel, Diskriminierungsgrund, S. 156f.
(660) So Gordon Mitchell und Jürgen Lott im Vorwort zu Dommel, Religions-Bildung, S. 13.
(661) Dommel, Religions-Bildung, S. 256, wo sie sich unter anderem auf Schleiermacher bezieht.
(662) Ebd., S. 262. Vgl. Kapitel 5.1 und Kapitel 4.1.5.
(663) Dommel, Religions-Bildung, S. 73f. Ihr zufolge beruft sich Nassehi bei seiner Definition von Religion „auf Luhmanns Modell der drei binären Unterscheidungen, die die Entstehung von Religion erklären (1989), modifiziert durch Welker (1992)“; beide Bücher fehlen in ihrem Literaturverzeichnis.
(664) Ebd., S. 266. Christa Dommel übernimmt ebd., S. 258, den „Begriff der ‚Wirkfaktoren‛ … aus der psychologischen Forschung [von Tschuschke und Kroll], wo er sich auf das Behandlungs-Setting für Therapiegruppen bezieht und als Kategorie diejenigen Elemente beschreibt, die zur Heilung der Klienten beitragen“, der „über die Sozialpsychologie auch Anwendung in der Pädagogik [bei Ulich]“ findet.
(665) Dommel, Religions-Bildung, S. 267.
(666) Ebd., S. 277f. „Bei Bedarf, wenn es sich aus der Dynamik innerhalb der Einrichtung ergibt, kann ein religionspädagogischer Beitrag das Angebot sein, explizit ‚Kopftuchkulturen‛ im interkulturellen Vergleich zu thematisieren. Eine solche ethnographische Annäherung an die eigene Alltagswelt kann die Vieldeutigkeit des ‚Zeichens‛ Kopftuch bewusst machen und den Austausch zwischen Eltern und Einrichtung erheblich stärken.“ Siehe auch Kapitel 2.4.
(669) Ebd., S. 282. Sie bezieht sich dabei auf Hull, Disability.
(670) Dommel, Religions-Bildung, S. 283.
(671) Dommel, Religionsforscher, S. 106.
(672) Dommel, Religionsbildung, S. 293f.
(673) Ebd., S. 297: „So berichtete Christa Preissing von der Freien Universität Berlin, die mit Jürgen Zimmer für die Arbeitsgruppe ‚Qualität im Situationsansatz‛ im Rahmen der ‚Nationalen Qualitätsinitiative im System der Kindertageseinrichtungen‛ der deutschen Bundesregierung verantwortlich ist, von einer Kontroverse mit ihrem Kollegen Wolfgang Tietze, der mit Susanne Viernickel zwei der Parallel-Arbeitsgruppen zu pädagogischen Qualitätskriterien und Qualitätsentwicklung leitet. Im Verlauf der Koordinationsgespräche äußerte Wolfgang Tietze, im Gegensatz zu seinem Qualitätsbegriff gehe es in Christa Preissings Arbeitsgruppe zum Situationsansatz weniger um Wissenschaft, sondern vielmehr um ‚Glaube, Liebe, Hoffnung‛. Preissings Antwort darauf lautete, das sei im Kontext von Pädagogik nicht das Schlechteste.“ [Mündlicher Bericht von Christa Preissing, mit ihrer Genehmigung zitiert.]
(675) Ebd., S. 298, mit Bezug auf Brumlik, Glück, S. 26-28 u. 240.
(676) Ebd., Anm. 232, wo sie Korczak, S. 121, zitiert.
(677) Ebd., S. 314, wo sie sich auf „Erikson 1975“, zitiert nach Schweitzer, Lebensgeschichte, S. 85, bezieht.
(678) Ebd., S. 314f., unter Bezug auf Ulich/Kienbaum/Volland.
(683) Vgl. ebd., S. 458: „Fragen wie: Wie war ich als Baby? Wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? sind für Kinder existenziell bedeutsam.“
(684) Ebd., S. 336, unter Hinweis auf die Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kindertageseinrichtungen.
(685) Ebd., S. 338, bzw. Luther, Fiktive andere, S. 76.
(686) Luther, Fiktive andere, S. 73f.
(687) Dommel, Religions-Bildung, S. 339 einschl. Anm. 269, wo sie Otto, S. 100, zitiert.
(689) Ebd., S. 341, mit Bezug auf Dewey.
(690) Ebd., Anm. 272: „Die Grundauffassung der pragmatischen Perspektive – im Unterschied zur realistischen und der idealistischen – besteht darin, den Ursprung der Welt in der Handlung zu sehen (nicht in der Materie oder im bewegenden Geist).“
(691) Ebd., S. 342f. Das Zitat im ersten Absatz aus Dewey, S. 164.
(693) Ebd., S. 346, unter Bezug auf Dewey, S. 222 und 221f.
(694) Ebd., S. 347, unter Bezug auf Foucault, S. 110 (Hervorhebung im Text von mir, H. S.).
(695) Ebd., S. 348, wo sie sich auf Gladigow bezieht.
(700) Ebd., S. 367f., wo sie auf Bar-On, S. 40f., Bezug nimmt (Hervorhebung im Text von mir, H. S.).
(701) Ebd., S. 374 und Anm. 300; zum Spivak-Zitat im ersten Absatz verweist Dommel auf Schirilla, S. 262.
