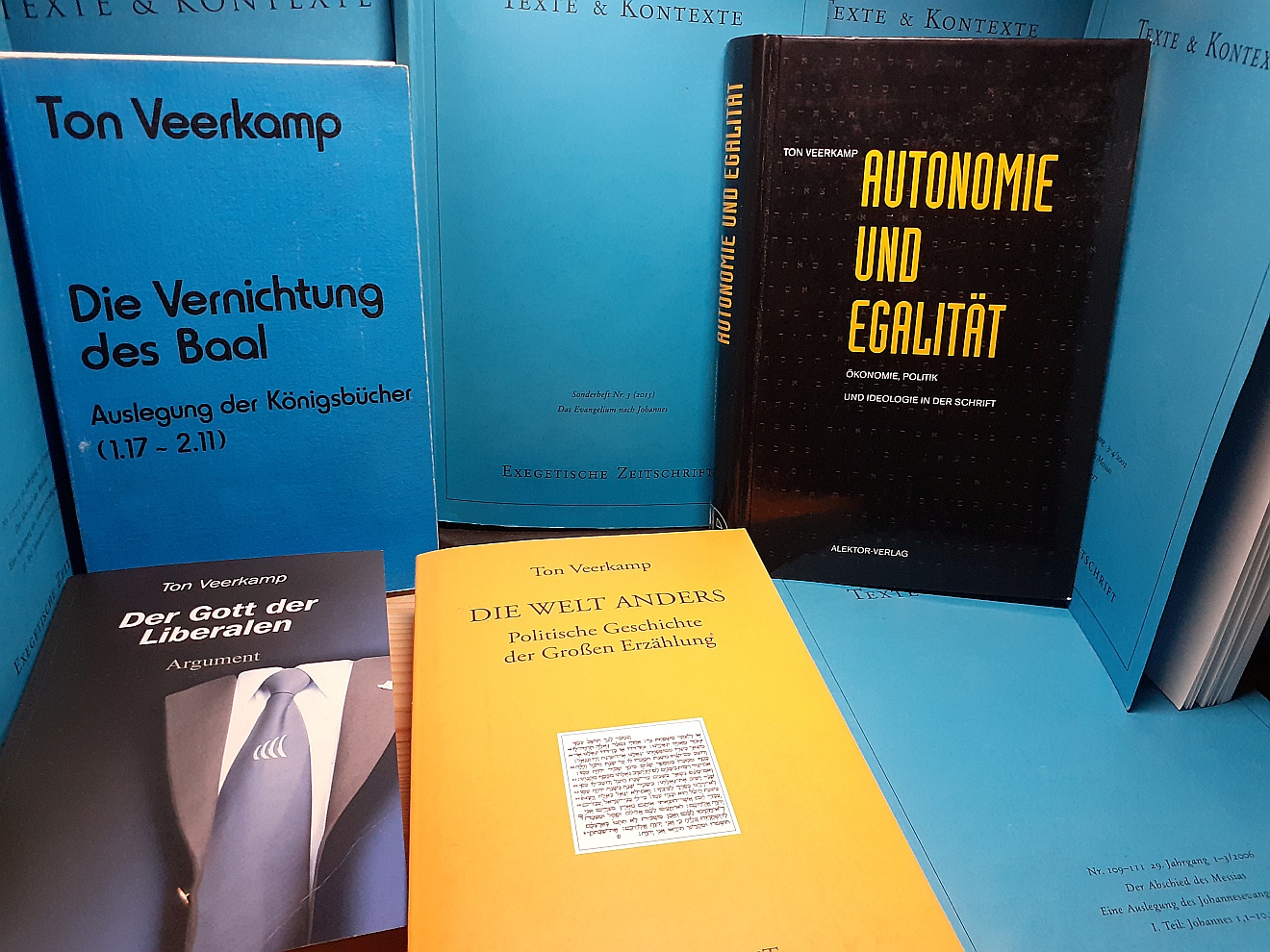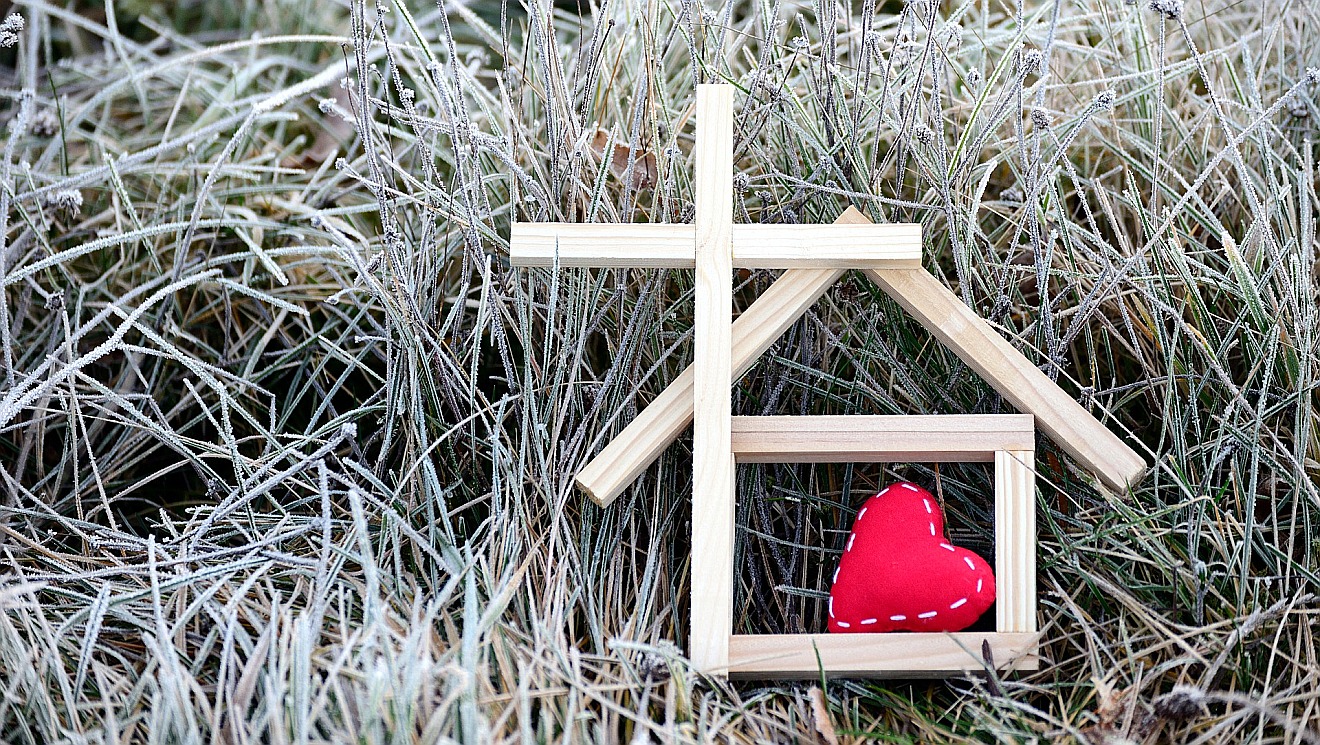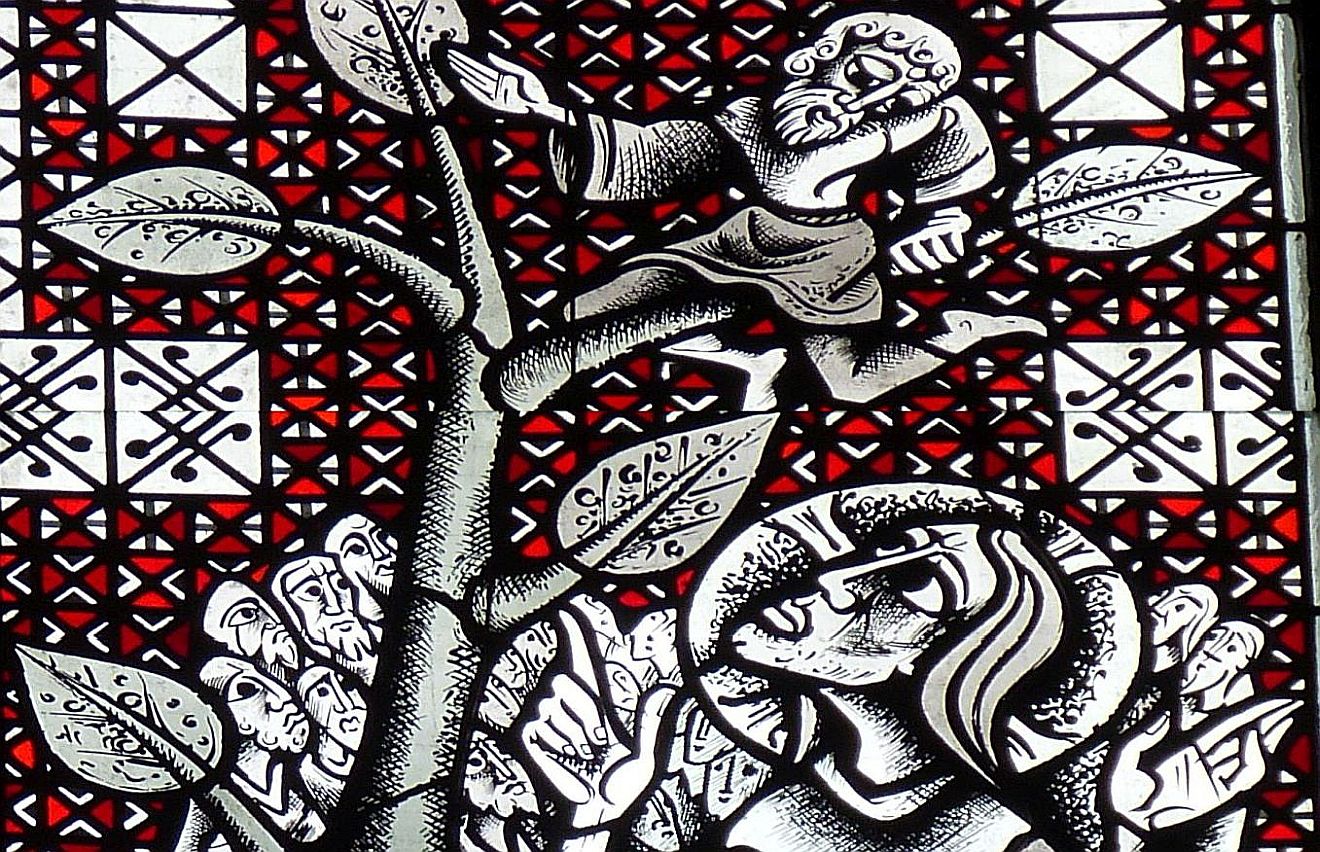Ton Veerkamp ist auf der Bibelwelt mit seiner Auslegung des Johannesevangeliums unter dem Titel „Solidarität gegen die Weltordnung“ vertreten, außerdem mit dem Beitrag „Gott – nur Stimme“.
Weiterhin habe ich hier eine Zusammenfassung seines Buches „Die Welt anders“ veröffentlicht und mich unter dem Titel „Bibelauslegung – politisch UND fromm“ unter anderem auch mit Ton Veerkamps politischer Theologie und Exegese …