Im zweiten Kapitel des Buches gibt Pfarrer Helmut Schütz Einblicke in verschiedene Sichtweisen des Islam, den Koran, das klassische Arabisch, den Dialog mit dem Christentum und den Kopftuchstreit.
Zum Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Buches „Geschichten teilen“
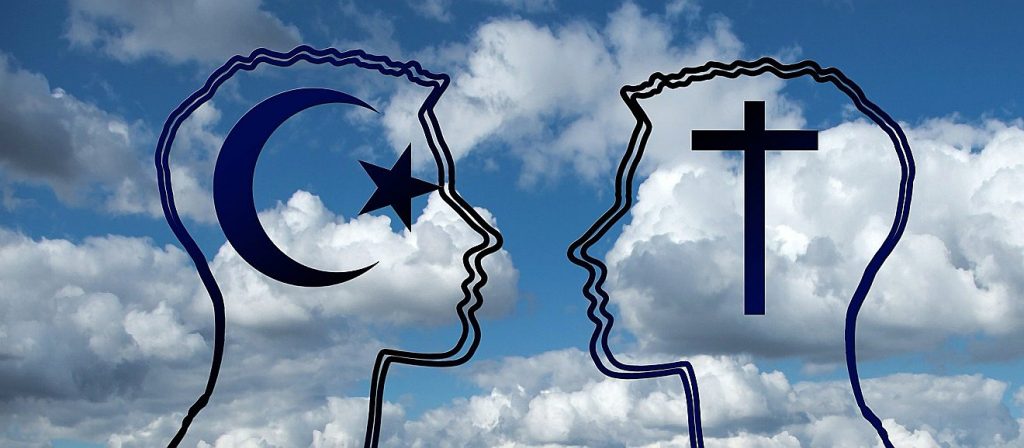
Inhalt dieses Kapitels
2.1 Islam in Geschichte und Gegenwart
2.1.1 Islam-Lexikon zum Nachschlagen
2.1.2 Ein Blick auf den weltweit real existierenden Islam
2.1.3 Hans Küngs Paradigmenanalyse des Islam
2.1.4 Liberale und konservative Reformer des Islam
2.2.1 Müssen sich Islam und Christentum voneinander abgrenzen, um zu wissen wer sie sind?
2.2.2 Christlich-muslimische Begegnung als Lernprozess
2.2.3 Warum ist der Dialog mit Muslimen besonders für Christen wichtig?
2.3 Koran: Das heilige Buch der Muslime
2.3.1 „Die Schönheit und Vollkommenheit der koranischen Sprache“
2.3.2 Reinschnuppern ins klassische Arabisch
2.3.3 Deutsche Koran-Übersetzungen und eine Sammlung islamischer Weisheit
2.3.4 Literatur zum Vergleich zwischen Bibel und Koran
2.4 Kopftuch: Das komplizierteste Kleidungsstück der Welt
2.4.1 Wie kam es zum Verschleierungsgebot in einer Religion der Gleichheit aller vor Gott?
2.4.2 Zwangsentschleierung und Widersprüche in der westlichen Haltung zu den Frauenrechten
2.4.3 Islamisch-traditionelle und islamisch-feministische Kritik am westlichen Blick auf Frauen
2.4.4 Das Kopftuch aus der Sicht von Verfassungsrechtlern und eines Bundespräsidenten
2.4.5 Die Haltung der bundesdeutschen Großkirchen zum Kopftuch
2.4.6 Das Kopftuch als Persönlichkeitsmerkmal, als Schamgrenze oder als Gefahr?
2.4.7 Neo-Muslimas: nicht unsichtbar wie Zucker im Tee, sondern sichtbar wie Milch im Kaffee
2.4.8 Einsatz für Chancengleichheit und interkulturelle Toleranz statt Kopftuchverbot
↑ 2.0 „Den“ Islam gibt es nicht
Breiten Raum in meinem Studienurlaub nahm die Beschäftigung mit dem Islam ein. Sofort muss ich diese Formulierung korrigieren, denn „den“ Islam, dem man immer und überall in gleicher Ausprägung begegnen könnte, gibt es so nicht, genau so wenig wie „das“ Christentum oder „das“ Judentum. Man kann sagen:
„die Weltgemeinschaft der Muslime, die Umma, … lebte … stets mit der Vielfalt von Meinungen, was nicht nur für theologische Dispute galt, sondern ebenso für die so wichtigen Auffassungen der Orthopraxie, die den Alltag der Gläubigen beherrschen. Hinzu kommt, dass es unter den Muslimen ebenso wie unter allen anderen Menschen Gleichgültige, Agnostiker, Atheisten, Feiertagsgläubige, Fromme, Eiferer, Fundamentalisten und Extremisten gibt. Wenn ein evangelischer Frommer mit einem türkischen Gleichgültigen diskutiert, ergibt sich ein gänzlich anderes Bild des Islam, als wenn ein muslimischer Eiferer mit einem deutschen Agnostiker ins Gespräch kommt.“ (27)
Und der Religionswissenschaftler
„Jacques Waardenburg zeigt …, dass Religionen keine statischen Gebilde oder keine abstrakten Größen sind, die für sich selbst existieren, sondern von Menschen mit Leben gefüllt werden. Deswegen sollte man auch nicht von der Begegnung von Islam und Christentum sprechen, was wissenschaftlich sowieso nicht zutrifft, sondern eher von der Begegnung von Muslimen und Christen, die jeweils sich selbst repräsentieren und nicht für den Islam oder das Christentum stehen können.“ (28)
↑ 2.1 Islam in Geschichte und Gegenwart
Obwohl ich in meinem Studium an einem Seminar bei Ulrich Schoen über den Koran und die Entstehung des Islam teilgenommen hatte (29), blieb mir der Islam lange Zeit fremd. Erst als ich vor 13 Jahren das Gemeindepfarramt in der Gießener Paulusgemeinde übernahm, lernte ich Islam durch die Begegnung mit Muslimen und den Besuch von Moscheen sozusagen „aus erster Hand“ kennen. Wie entscheidend persönliche Begegnungen für die Veränderung des Blicks auf eine andere Religion wie den Islam sein können, zeigt das Beispiel des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt, dessen Freundschaft mit dem ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat ihm erst die Augen dafür öffnete, „dass Juden und Christen und Muslime ihren Glauben aus der gleichen Wurzel empfangen haben. Alle drei berufen sich auf Abraham und dessen Nachkommen; sie stimmen im Glauben an den einen Gott überein und ebenso in vielen anderen Elementen des Glaubens.“ (30) In meinem Studienurlaub habe ich mich mit einer ganzen Reihe verschiedener Facetten des Islam vertraut gemacht.
↑ 2.1.1 Islam-Lexikon zum Nachschlagen
Nicht durchgelesen, aber zum Nachschlagen bestimmter Begriffe aus dem Bereich des Islam genutzt habe ich das „Islam-Lexikon“ der Professoren für Religionswissenschaft Adel Theodor Khoury, Missionswissenschaft Ludwig Hagemann und Islamwissenschaft Peter Heine, das mir dankenswerterweise aus einem Nachlass zur Verfügung gestellt wurde. Es besteht nicht aus kurzen lexikalischen Einträgen, sondern geht auf Begriffe wie „Barmherzigkeit“ (31) und „Toleranz“ (32) oder Personen wie „Jesus“ und „Maria“ (33) ausführlich ein.
↑ 2.1.2 Ein Blick auf den weltweit real existierenden Islam
Zufällig (34) stieß ich in der Gießener Uni-Bibliothek auf das Buch „Das Böse in der Sicht des Islam“, das zwei interessante Beiträge von Klaus Berger über die Eschatologie des Islam (35) sowie über die Rolle des Teufels im christlichen Judasbrief und bei der Erschaffung Adams im Koran (36) enthält.
Zwei Artikel bringen aber auch einen interessanten Überblick über mehrheitlich islamisch geprägte Nationen in aller Welt: Rupert Neudeck nimmt seine Leserschaft auf eine „kleine Reise in islamische Länder und Regionen“ (37) mit, die in den Iran, nach Bosnien, Indonesien, Palästina, Äthiopien, Afghanistan und Ruanda (38) führt, und Georg Evers beschreibt den asiatischen Islam in Pakistan, Bangladesch, Indien, Malaysia, Indonesien und auf den Philippinen:
„Bei aller Berücksichtigung des großen Einflusses, den der arabische Islam bis heute hat, gilt es doch festzuhalten, dass zahlenmäßig die große Mehrheit der Muslime von etwa 650 Millionen,… d. h. ziemlich genau die Hälfte aller Muslime, in Asien leben.“ (39)
↑ 2.1.3 Hans Küngs Paradigmenanalyse des Islam
Jedem Christen, der am Dialog mit dem Islam interessiert ist, lege ich die kompakte und differenzierte Einführung in die Welt des Islam ans Herz, mit der Hans Küng in seinem Buch „Der Islam. Wesen und Geschichte“ seine Trilogie über die drei abrahamischen Religionen vollendet.
14 Jahrhunderte Islam stellt Küng mit Hilfe der von ihm entwickelten Paradigmenanalyse dar, denn genau wie im Judentum und Christentum wurde ihr zufolge auch im Islam das wesentlich Bleibende auf Grund neuer Herausforderungen im Laufe der Geschichte immer wieder in voneinander unterschiedenen paradigmatischen Ausprägungen zugleich verändert und bewahrt. Unterschiede im gelebten Islam der heutigen Zeit ergeben sich demzufolge schon daraus, dass jeder dieser paradigmatischen Entwürfe nicht nur Geschichte ist, sondern noch heute Einflüsse auf Menschen und ganze Staaten ausübt:
„- Das ur-islamische Gemeinde-Paradigma (P I) bleibt für Muslime aller Zeiten so etwas wie das Ideal: ein unwiederbringlich verlorenes Goldenes Zeitalter, aber auch immer wieder Appellationsinstanz. Doch auch die späteren Paradigmen bleiben lebendig als Gegenstand der Erinnerung und der Sehnsucht, mit ihren je eigenen Elementen und Strukturen, verkörpert in Leitfiguren und gelebt in größeren oder kleineren Gemeinschaften.
– So ist das arabische Reichs-Paradigma (P II) noch immer präsent im Panarabismus, der Idee von einer einzigen arabischen Nation, aber auch in den verschiedenen arabischen Nationalismen.
– Das klassisch-islamische Weltreligions-Paradigma (P III) wirkt nach in den Ideen der Einheit aller Muslime über alle Nationen hinweg, im Traum eines Panislamismus.
– Das mittelalterliche Ulama-Sufi-Paradigma (P IV) perpetuiert sich in den verschiedenen Formen des islamischen Traditionalismus und, programmatisch, im radikalen Islamismus.
– Schließlich wirkt sich das Modernisierungs-Paradigma (P V) deutlich aus in allen Formen des islamischen Reformismus, extrem aber im ‚islamischen‛ Säkularismus.“ (40)
Küng stellt in seinem Buch die Frage, ob der Islam dazu fähig ist, jenseits der beiden Alternativen „Traditionalistischer Islamismus“ oder „Radikaler Säkularismus“, innerhalb derer sich der Islam entweder religiös isoliert oder religiös entleert, im Zeitalter der Globalisierung als „Religiös emanzipierter Islam“, der „religiöse Substanz mit modernem Weltbezug“ vereint, ein Paradigma der Nach-Moderne (P VI) zu entwickeln (41).
↑ 2.1.4 Liberale und konservative Reformer des Islam (42)
Ob man unsere Zeit nun „modern“ oder „postmodern“ nennen will (43), sie ist jedenfalls ein Zeitalter, in dem ein Pluralismus von Auffassungen und Lebensformen auch innerhalb der Religionen unaufhaltsam ist. Dass der Islam längst in diesem Heute angekommen ist, zeigt das Buch „Der Islam am Wendepunkt. Liberale und konservative Reformer einer Weltreligion“, in dem Gesichter eines Islams der Gegenwart und Zukunft gezeigt werden, der sich in einer breiten Vielfalt präsentiert:
„Die Palette an Lesarten des Islam, die [dieses Buch] vorstellt, will mit einem klassischen Vorurteil aufräumen: das es den einen Islam gibt.“ (44)
„Denn die Abkehr von der autoritativen Tradition zugunsten je individueller Schriftauslegung durch jeden einzelnen Gläubigen führt im auf die heiligen Schriften fixierten Islam der Moderne (nicht anders als im Reformchristentum der Protestanten) zu einer unendlichen Vervielfältigung der Standpunkte.“ (45)
„Dieses Buch … berücksichtigt das gesamte Reformspektrum und stellt liberale und konservative Standpunkte einander gegenüber. Dennoch gibt es Grenzen. Ausgeschlossen werden erstens antipluralistisch-totalitäre und revolutionäre Positionen, zweitens rein weltlich begründete Standpunkte und drittens Vertreter eines bornierten Buchstabenglaubens, der die Notwendigkeit jeglicher und insbesondere historischer Auslegung bestreitet.“ (46)
Auf die muslimische Meinungsbildung auch in Deutschland haben zwei konservative Reformer besonderen Einfluss: der in Westeuropa lebende und lehrende muslimische Reformer Tariq Ramadan und der in Qatar lebende und aus Ägypten stammende Yūsuf al-Qaradāwi, der wohl „bekannteste Rechtsgelehrte des sunnitischen Islam in der heutigen Zeit“. Die Themen, zu denen Yūsuf al-Qaradāwi Rechtsgutachten abgibt, die überall in der muslimischen Welt Beachtung finden, „reichen von der Weiterentwicklung des islamischen Rechts über soziale und wirtschaftliche Fragen bis hin zu theoretischen Überlegungen zu Globalisierung und Islam“ (47). „Er bezeichnet seine Lehre nach dem koranischen Wort von der ‚Gemeinschaft der Mitte‛ (Q 2:143) als Schule der Mitte (wasatīya) und tritt für Ausgewogenheit bei der Anwendung des islamischen Rechts ein.“ (48)
Tariq Ramadan setzt sich dafür ein, den Westen als Muslim nicht im Sinne des traditionellen Gegensatzes zum islamischen „dār al-islām“, also „Haus des Friedens“ als „Haus des Krieges“ oder „Haus des Vertrags“ zu sehen (arabisch „dār al-harb“ oder „dār al-‛ahd“), in dem sich Muslime „nicht als Bürger zu Hause fühlen könnten. Stattdessen macht er sich dafür stark, den Westen, in dem Muslime ihren Glauben ja frei ausüben können, als „dār asch-schahāda“, also „Haus des Bezeugens“, aufzufassen: als einen Raum, in dem Muslime von ihrem Glauben Zeugnis ablegen.“ (49)
Für Deutschland wichtiger sind Persönlichkeiten wie der Imam Bekir Alboga, der nicht als „führender Theologe“ hervorgetreten ist und auch „keine Reformbewegung ausgelöst“ hat (50).
„Was ihn auszeichnet, ist praktische Arbeit an ‚kleinen Dingen‛, die das Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit im multikulturellen Alltag betreffen. …
Er hat Tausende durch die Räumlichkeiten der Moschee geführt, christlich-islamische Trauungen geschlossen, zusammen mit christlichen Kirchen eine ‚interreligiöse Morgenfeier‛ kreiert, die abwechselnd in der Kirche und in der Moschee stattfindet…“ (51)
Sein Motto lautet:
‚Wenn ein muslimisches Kind, Mensch, sich für das Christentum nicht interessiert und wenn ein christliches Kind, Mensch, sich für den Islam nicht interessiert, obwohl sie in einem Land, in einem Stadtteil, in einer Straße und in einer Schule, kurzum in ein und demselben Lebensraum leben, dann ist das gesamte Bildungssystem zum Scheitern verurteilt‛.“ (52)
Wie weit die Ansichten der islamischen Reformer auseinander liegen, zeigen folgende Beispiele.
Der „syrische Ingenieur und ‚islamische Denker‛ Muhammad Schahrūr plädiert seit Beginn seiner reformatorischen Arbeit vor knapp 15 Jahren lautstark dafür, dass die Muslime sich ohne ‚Unterwürfigkeit gegenüber der Autorität der historisch entstandenen islamischen Jurisprudenz (fiqh)‛ am Wortlaut der Offenbarungsschrift selbst als eigentlichem Kriterium der Wahrheit orientieren mögen“ (53).
Eine islamische Befreiungstheologie hat Farid Esack in Südafrika entwickelt. Für ihn ist etwa das
„Exodus-Thema beispielhaft für die koranische Idee des Pluralismus. Unabhängig davon, dass die Israeliten zunächst Polytheisten, also Ungläubige waren, habe Gott sich durch Moses mit ihnen solidarisiert. Der Koran fordere somit die Solidarität mit allen Unterdrückten, unabhängig von ihrem Glauben.“ (54)
Abdal-Hakim Murad wendet sich gegen eine solche allzu freie Koranauslegung:
„Als Waffe gegen subjektivistischen idschtihād (eigenständige Interpretation) sowohl feministischer Exegeten wie auch von Salafiten, die andere zu Ungläubigen erklären, bietet Murad den traditionellen Gelehrtenkonsens (idschmā‛) an… Wenn Murad den kompromisslosen Liberalismus eines Farid Esack oder Muhammad Schahrūr an den Pranger stellt und ihnen grobe Nachlässigkeit gegenüber dem Korantext vorwirft, hat er sicher nicht ganz Unrecht. Denn kaum einer der zeitgenössischen ‚Reformer‛ hat eine ordentliche Ausbildung in den islamischen Wissenschaften und kann seinen eigenen Ansatz aus der 1400-jährigen Tradition islamischer Gelehrsamkeit herleiten.“ (55)
Aber wer ist eigentlich dieser Korangelehrte?
„Der britische Konvertit Abdal-Hakim Murad ist ein Wanderer zwischen den Welten. Als Timothy J. Winter ist er seit 1996 Dozent für Islamic Studies an der Theologischen Fakultät der Universität Cambridge und Direktor für theologische Studien des Wolfson College. Als Shaykh Abdal-Hakim Murad ist er ein bekannter muslimischer Gelehrter und Leiter der Moschee an der Cambridge University.“ (56)
Murad widerspricht übrigens der „verbreiteten These, dass der Islam nicht an der Moderne und am Westen teilhaben könne, weil er keine Reformation gehabt habe“, und zwar aus dem folgendem Grund,
„dass eine Reformation die Auffrischung einer Religion durch Umgehung der mittelalterlichen Geschichte und direkten Rückgriff auf die Schriften bedeute. Eben dies sei aber gerade in den Bewegungen und an den Orten im Gange, die der Westen höchst beunruhigend finde! Die islamische Welt befinde sich zur Zeit mitten in ihrer Reformation, und ihre ‚Calvins und Cromwells erweisen sich überhaupt nicht als toleranter und flexibler als ihre europäischen Vorgänger‛… Daher hält Murad eine Reformation für eine schlechte Lösung, da sie die gewachsene Vielfalt und Anpassungsfähigkeit des Islam im Zweifelsfalle durch eine auf die Zeit des Propheten und seiner Gefährten fixierte, buchstabengläubige Variante ersetzen würde.“ (57)
Der ägyptische Korangelehrte Nasr Hamid Abu Zaid wurde „durch seine Zwangsscheidung zu einem weiteren Symbol für die Engstirnigkeit des konservativen Islam“ (58). Interessant ist er für mich, da er zu den islamischen Exegeten des Koran gehört, die ihr heiliges Buch auch als literarisches Werk in Augenschein nehmen, ähnlich wie christliche Theologen die Bibel auch aus historisch-kritischem Blickwinkel betrachten.
„Ein zentraler Punkt, an dem Abu Zaid der muslimischen Mehrheitsmeinung widerspricht, ist seine Betonung der ‚Erschaffenheit‛ des Koran. Damit ist bei ihm in erster Linie die Abhängigkeit seiner Entstehung von den herrschenden Umständen gemeint. Jedes sprachliche Bild, jeder Vergleich, aber auch jede im Bereich des Rechts relevante Aussage sei von Gott auf die in der Umgebung Muhammads verbreiteten Anschauungen, Handlungsweisen und Informationen hin zugeschnitten worden. Dass diese Sichtweise dem islamischen Denken zumindest im Ansatz nicht fremd ist, versucht Abu Zaid unter anderem durch den Verweis auf das Konzept der ‚Abrogation‛ (naskh), der Aufhebung früher Verse durch spätere, zu belegen: Schon die klassische Koranwissenschaft wusste: Wenn ein früher Vers (16:67) den Alkohol als Zeichen göttlicher Güte preist, ein späterer (4:43) die Muslime dazu anhält, nicht betrunken zum Gebet zu erscheinen, und ein noch späterer (5:90) den Alkoholgenuss ganz untersagt, dann ist dies eine kluge Anpassung des göttlichen Sprechers an die Umstände, in denen die Anhänger Muhammads lebten. Gott stellte sich auf Horizont und das Maß ihrer Bereitschaft zur Aufgabe liebgewordener Laster ein, brachte ihnen sozusagen schonend das neue Gebot bei. Zu Ende gedacht heißt das: Eine koranische Aussage steht in direkter Beziehung zu dem Ort und der Zeit ihrer Offenbarung. Deshalb sollte der Interpret des Koran die spezielle Situation der frühesten muslimischen Gemeinde berücksichtigen.“ (59)
Auch auf Reformerinnen des Islam macht das Buch aufmerksam, zum Beispiel auf die gemäßigte Islamistin Nadia Yassine, die von ausländischen Journalisten die „vielleicht einflussreichste Frau Marokkos“ genannt wurde (60).
„Auf der einen Seite ist Nadia Yassine eine der aktivsten politischen Persönlichkeiten im Land; auf der anderen Seite protestiert sie dagegen, dass Polygamie verboten wird, Frauen nach der Scheidung die Hälfte des Besitzes erhalten und bei Wiederheirat das Sorgerecht für ihre Kinder nicht verlieren. Warum tut sie das? Eigenständigkeit und kulturelle Identität sind die Schlüsselworte, um eine solche Haltung zu verstehen. Man will modernisieren, man will demokratisieren, aber man will nach allem, was es an ‚Kontakten‛ mit dem Westen gab, diesen in gar keinem Fall imitieren und dabei auch noch gegängelt werden.“ (61)
„Nadia Yassine ist nicht nur die weltgewandte, frankophone Politikwissenschaftlerin. Sie kommt auch in den Armenvierteln von Marokko gut an. Hier hilft sie Frauen, die ihren Rat suchen – sei es, weil der Ehemann sie verlassen hat oder die Familie die Kinder nicht mehr ernähren kann. Gerechtigkeit und Wohlfahrt hat ein weit verzweigtes Netzwerk. Die Armen und die Analphabeten sind die Klientel der Islamisten. Nadia Yassine … [möchte] das Gefühl der Benachteiligung, das bei vielen Muslimen herrscht, für andere verstehbar machen … ‚Seit dreißig Jahren rufen wir zur Gewaltfreiheit auf. Und trotzdem sind wir für niemanden politischer Ansprechpartner.‛ “ (62)
Die Iranerin Schirin Ebadi ist dadurch, dass sie im Jahr 2003 den Friedensnobelpreis erhielt, einer breiteren Öffentlichkeit auch im Westen bekannt geworden. Sie ist grundsätzlich davon
„überzeugt, dass der Islam nicht im Widerspruch zu Menschenrechten und Demokratie steht. … Dass Frauen heutzutage nicht gleichberechtigt sind, liegt für sie eben nicht am Koran, sondern daran, dass bisher nur Männer den Koran interpretiert und ihn ausschließlich zu ihren eigenen Gunsten ausgelegt haben. ‚Der Islam hat mit der Unterdrückung der Frauen nichts zu tun. Der Islam ist ein Glaube der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.‛ Doch ‚die Herren an der Macht‛ hätten es über die Jahrhunderte vorgezogen, den Islam für ihre eigenen Interessen zu missbrauchen. Durch eine richtige Interpretation des Islam würde es in Iran eine völlige Gleichberechtigung der Geschlechter geben. Laut Ebadi ist der Koran an sich so frauenfreundlich oder -feindlich wie jede andere Offenbarungsschrift auch. Es komme einzig darauf an, wie man ihn interpretiert.“ (63)
Ebadi lässt sich „nicht gerne als Feministin“, sondern lieber als „Verteidigerin der Menschenrechte“ bezeichnen. Bedenkenswert ist ihre Haltung zur Kopftuchdebatte im Iran und in westlichen Ländern.
„Sie lehnt den in Iran herrschenden Kopftuchzwang ab, denn es müsse die freie Entscheidung der Frauen sein, ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Andererseits sagt sie, die Präsenz von Frauen in den verschiedensten Sphären der iranischen Gesellschaft belege, dass Kopftuch und gesellschaftliche Aktivität keine unüberwindbaren Gegensätze seien. Sie wird nicht müde zu verneinen, was alle Fragenden immer wieder unterstellen: dass das Kopftuch für den Ausschluss der Frauen aus der Gesellschaft stehe. Iran sei dafür ein gutes Gegenbeispiel, und außerdem lägen die wesentlichen Probleme der Frauen im rechtlichen Bereich. Zu viel Symbolcharakter solle man dem Kopftuch daher nicht beimessen.
Als Menschenrechtlerin kritisiert sie aber auch die europäische Kopftuchdebatte: Jeder Frau, die das Kopftuch aus freien Stücken tragen möchte, solle dies gestattet sein. ‚Wenn sie nicht missionieren will, sollte sie das dürfen. Genau so wie man das Recht haben sollte, mit Hut spazieren zu gehen. Oder nackt.‛ Und sie findet, europäische Staaten sollten sich nicht mit dem iranischen Gottesstaat gemein machen, indem auch sie den Frauen vorschreiben, wie sie sich zu kleiden haben. Die Menschen müssten die Freiheit haben, so zu leben, wie sie es wollen. Wenn aber bestimmte Länder das Kopftuch für Schülerinnen und Lehrerinnen verbieten, verstoße dies gegen die Freiheit.“ (64)
Außerdem wird unter den Reformerinnen des Islam eine Frau erwähnt, die sich in Ägypten als Kandidatin der Muslimbrüder für die Parlamentswahlen aufstellen ließ. Gihan al-Halafāwī wollte sich „im Parlament besonders für die Belange der Frauen einsetzen, für Bildung und gegen Analphabetismus“; dieser politische Erfolg wurde ihr dann doch verwehrt, aber sie blieb eine „Symbolfigur der Reformer innerhalb des islamistischen Lagers“ (65).
Besonders beeindruckt hat mich die Gestalt des feministisch eingestellten Ägypters Gamāl al-Bannā‛, der als Bruder des 1949 ermordeten Gründers der Muslimbruderschaft Hasan al-Bannā‛ „eine gewisse Narrenfreiheit unter den islamischen Organisationen“ genießt (66). Er beschreibt in seinen Büchern „den Propheten Muhammad als den einsamen Gentleman in einer verrohten, frauenverachtenden Stammesgesellschaft“:
„Die Problematik der Frauenfrage in den islamischen Gesellschaften besteht nach Gamāl al-Bannā‛ darin, dass der Koran in einem extrem patriarchalischen Umfeld offenbart worden sei. Das gelte gleichermaßen für die arabische Stammesgesellschaft wie für die damaligen Hochzivilisationen des Nahen und Mittleren Ostens, Byzanz und Persien. Mit der Entstehung der islamischen Staaten und der Institutionalisierung des Islam in Rechtsschulen haben sich die frauenfeindlichen Traditionen wieder regenerieren können. Diese seien durch die Rechtsgelehrten mittels diskursiver Entstellungen des Koran, Umdeutung von Begriffen, Fehlinterpretationen und Hinzuziehung von zweifelhaften Aussprüchen des Propheten islamisch legitimiert worden. Selbst unter den engsten Vertrauten sei Muhammad – gerade was seine Haltung gegenüber den Frauen betraf – immer wieder auf Ablehnung gestoßen. Um das zu untermauern, beruft sich al-Bannā‛ auf eine Geschichte aus den Prophetenüberlieferungen. Als sich die Frauen seiner Gefährten bei Muhammad darüber beschwerten, dass sie von ihren Männern geschlagen würden, empfahl ihnen dieser, nach alter Stammestradition Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Daraufhin reagierten die Gefährten derartig empört, dass Gott persönlich intervenieren musste, um zu verhindern, dass sie wieder vom neuen Glauben abfielen. Er räumte ein, dass sie ihre Frauen sanft züchtigen dürften, aber erst nachdem alle anderen Überzeugungsversuche gescheitert seien. Dem habe Muhammad mit dem Satz nachgegeben: ‚Wir wollten etwas, aber Gott wollte es anders, und was Gott will, ist gut.‛ “ (67)
Immer wieder kommt Gamāl al-Bannā‛
„auf dieselbe Grundthese zurück. Der Islam habe die Befreiung und die Gleichberechtigung der Frau gewollt und nicht ihre Unterdrückung. Er habe die Frau überhaupt erst zu einem gesellschaftlichen Subjekt gemacht in einer Gesellschaft, in der sie als rechtloses Eigentum ihres Mannes galt.“ (68)
↑ 2.2 Islam und Christentum
Auf den Islam blicke ich als Christ, der am friedlichen Miteinander und am Dialog von Menschen verschiedener Religionszugehörigkeit interessiert ist. Dabei bin ich realistisch genug, um mit Stephen Prothero die Unterschiede der Religionen nicht zu unterschätzen:
„Wenn die Anhänger der Religionen Bergsteiger sind, dann besteigen sie sehr unterschiedliche Berge, erklettern sehr unterschiedliche Gipfel und verwenden sehr unterschiedliche Werkzeuge und Techniken beim Aufstieg.“ (69)
Und gerade weil der Islam und das Christentum eng miteinander verwandt sind, ist ihre Begegnung mit um so größeren Schwierigkeiten behaftet, denn beide Religionen haben eine lange Geschichte der gegenseitigen Entfremdung und oft sogar Feindseligkeit hinter sich.
↑ 2.2.1 Müssen sich Islam und Christentum voneinander abgrenzen, um zu wissen, wer sie sind? (70)
Zwar gibt es Christen und Muslime, die den Dialog beider Religionen von vornherein ablehnen, da die Gegensätze zu groß seien bzw. die Angehörigen der jeweils anderen Religion nur als Ungläubige betrachten könnten (71). Das Buch „Identität durch Differenz?“ half mir dagegen, „wechselseitige Abgrenzungen in Christentum und Islam“ auf den Prüfstand zu stellen, „differenzierte theologische Denkwege“ zu beschreiten und „einen Mittelweg zwischen verschiedenen, durchaus auch extremen Positionen zu finden“ (72).
Jacques Waardenburg, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Lausanne, nennt
„die Aussage, dass Islam und Christentum als solche einander wesentlich entgegengesetzt sind, wissenschaftlich ungenau und faktisch einfach unwahr. Man sollte genau sagen, welchen Islam man welchem Christentum so radikal entgegengestellt sieht und weshalb man gerade dieser Verschiedenheit als »Gegensatz« so viel Bedeutung und Gewicht beimisst.“
Und selbst wenn die religiösen Systeme beider Weltreligionen viel Unvereinbares enthalten, sollte doch beherzigt werden, dass nicht etwa die jeweils eigene Religion, sondern nur Gott selbst, den kein Mensch, welcher Religionszugehörigkeit auch immer, vollständig erfassen kann, anbetungswürdig ist; nach Waardenburg ist aber
„mit Hilfe der Begriffe »Islam« und »Christentum« von Muslimen und Christen eine erstaunliche Unterwerfung bzw. Loyalität verlangt worden, die höchstens Gott selber zukommen würde.“ (73)
Darum kann man den eigenen Zugang zu Gott als wahr, heilig und unantastbar empfinden und dennoch zugestehen, dass jeder Mensch anders glaubt und – religionswissenschaftlich gesprochen – seine jeweils eigene Religion „verschieden konstruiert, konzeptualisiert, interpretiert und aktualisiert“ (74).
Abdullah Takım betont, dass gerade „die Fremdheit, also die Differenzen“, zum Anlass werden können, „voneinander zu lernen“ (75), und Tahsin Görgün meint:
„Der Dialog unter den Angehörigen der Religionen kann dazu dienen, dass die gläubigen Frauen und Männer sich gegenseitig in ihrem Glauben bekräftigen, indem jeder in seinem Gegenüber einen Menschen findet, der ihn bestätigt. Die Bestätigung soll aber nicht unbedingt in der Art und Weise geschehen, dass jeder dem Anderen Recht gibt, sondern indem er ihn als ebenbürtig anerkennt.“ (76)
Die drei im gleichen Buch enthaltenen Beiträge über die Kreuzzüge enthalten ebenfalls aufschlussreiche Einsichten. So betont Peter Antes, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Hannover:
„Die Kreuzzüge sind ein westeuropäisches Unternehmen, das gegen seine eigene Intention durch islamischen Einfluss zur Kultivierung und Bildung der Christen positiv beitrug und daher vor Ort oft viel toleranter gewesen ist (man denke etwa an Wilhelm von Tyrus), als dies in der Theorie vorgesehen war.“
Infolgedessen haben die Kreuzzüge im Westen
„unbeabsichtigt zu einer beträchtlichen Erweiterung des Wissens in kultureller, geographischer und wissenschaftlicher Hinsicht beigetragen, weil bis dahin unbekannte Schätze des Wissens aus der griechischen wie aus der arabisch-islamischen Kultur für Europa entdeckt und nutzbar gemacht wurden“.
Bei den betroffenen Muslimen haben dagegen
„die Kreuzzüge zu einem Schock über die Unkultiviertheit und Grausamkeit der Christen Westeuropas geführt und das Bild der (West-)Europäer nachhaltig geprägt“ (77).
Aber, so argumentiert Thomas Würtz, erst durch die zunehmende „politische Dominanz Europas“ wurden die Kreuzzüge für Muslime „unter dem Begriff salībīya“, der erst Ende des 19. Jahrhunderts als „Abstraktum von dem arabischen Wort für Kreuz salīb“ geprägt wurde, „zu dem zentralen Paradigma westlicher Übergriffe auf islamisches Territorium“ (78).
Ob und wie der auf beiden Seiten nach wie vor gepflegten »Kreuzzugs-Rhetorik« (79) zu entkommen ist, fragt der Professor für Vergleichende Ethik an der Freien Universität Berlin, Michael Bongardt. Sie
„gehört zur Dynamik einer Identitätsvergewisserung, die die für die eigene Identität notwendige Abgrenzung durch die Abwertung der je anderen zu erreichen sucht. Deshalb kann sie nur überwunden werden, wenn Wege gefunden werden, die Wahrung der eigenen Identität mit der Anerkennung fremder Identitäten zu verbinden.
Dem Islam und dem Christentum kommt bei dieser Suche eine prominente Rolle zu. Denn sie stehen nicht nur in der Tradition gewaltsamer Selbstbehauptung. Sie bergen auch das Wissen um den Wert und die Möglichkeiten einer wertschätzenden Anerkennung der Fremden, die das Eigene nicht leugnet, sondern stärkt.“ (80)
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Seitenblick auf den von Antes erwähnten Wilhelm von Tyrus, der in Jerusalem 1130 geboren wurde und 1186 starb, Erzbischof von Tyrus und Kanzler des Königreichs Jerusalem war und als einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber des Mittelalters gilt. Einen Beleg für dessen für die damalige Zeit tolerante Haltung gegenüber dem Islam als Religion sieht der Schweizer Historiker Rainer Christoph Schwinges in Wilhelms Beurteilung seines muslimischen Gegners Nur ad-Dīn:
„Wilhelm von Tyrus bezeichnete Nur ad-Dīn als felix. Offensichtlich glaubte der Chronist, dass Leben und Taten des muslimischen Fürsten auch religiös so verdienstvoll waren, dass sie von gottgewolltem Glück begleitet wurden…
Wer Gott nicht dient und eben deshalb keine Verdienste aufzuweisen hat, sei er Heide oder ein unfrommer Mensch, der verfällt dem Schicksalsdämon, und sein vermeintliches Glück täuscht ihn am Ende doch, weil Gottes Segen nicht auf ihm ruht. …
Wer sich aber in frommer Ergebenheit der Gottesordnung unterstellt, sei er Muslim oder Christ, der wird des beständigen Glücks teilhaftig, auf Erden und erst recht im Jenseits. Eben dies gilt für Nur ad-Dīn. „]Wilhelm rechnet den muselmanischen Herrscher zum Kreise derer, die glücklich sind, weil ihre Taten als Verdienste gewertet werden.“ (81)
Das Buch „Identität durch Differenz?“ enthält auch drei Artikel über „Fundamentalistische Abgrenzungsdiskurse im Christentum und im Islam“ von Bekim Agai, Gritt Klinkhammer und Arnulf von Scheliha (82). Zum Nachdenken regen besonders Schelihas Thesen zum fruchtbaren Umgang mit Fundamentalismus an:
„Religiöse Fundamentalisten spüren also die ›Sollbruchstellen‹ auf, die sich im Zuge der notwendigen Traditionsfortschreibung in den Religionen einstellen. Insofern könnte man die Fundamentalismen auch als Nebenwirkung der Modernisierung der Religionen deuten, die genau dann politisch bedeutsam werden, wenn die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen Sprengkraft enthalten. In dieser Perspektive wären religiöse Fundamentalismen Begleit- und Reflexionsgestalten der Liberalisierung der Religionen… Sie sind in ihrem Selbstabschließungsversuch widersprüchlich, weil sie sich von einem Gegenüber abgrenzen, von dem sie doch leben, indem sie sich kritisch darauf beziehen. In ihrer überstiegenen Radikalität machen sie aber darauf aufmerksam, dass jede religiöse Identitätsbildung mit Differenzen leben und sie als Differenzen thematisieren und verarbeiten muss. …
Religion in ihrer nicht-fundamentalistischen Form aber stellt einen produktiven Umgang mit den Differenzen dar, weil sie sie nicht überspringt, sondern sie in ihre Denkungsart integriert und theologisch reflektiert. Insofern ist der genuin religiöse Umgang mit der Erfahrung von Differenzen auf dialogische Deutung angelegt, die sich nun ihrerseits nicht gegen den religiösen Fundamentalismus abschließen darf, sondern ihn einzubeziehen hat. … Die Deeskalation fundamentalistischer Strömungen muss also mit der Bereitstellung kommunikativer Kontexte erfolgen, die nicht auf Abschließung abstellen, sondern Anschlussstellen offerieren.
… Dafür, dass solche Offerten aufgegriffen werden, können nicht die Religionen allein einstehen. Vielmehr müssen dafür auch politische, ökonomische und soziale Rahmenbedingungen gegeben sein, die es den (potenziellen) Anhängern religiöser Fundamentalisten sinnvoll erscheinen lassen, den Weg der gesellschaftlichen Inklusion zu beschreiten, ohne um religiöse und personale Identität bangen zu müssen.“ (83)
Einen weiteren Gedanken zum Fundamentalismus in Christentum und Islam steuert Olaf Schumann, Professor für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften an der Universität Hamburg, bei:
„Nicht die Zivilisationen stehen sich kampfbereit gegenüber und schon gar nicht die Religionen bzw. ihre Gemeinschaften. Vielmehr geht es, wie der pakistanische, in England lebende Intellektuelle Tarik Ali es auf dem Hintergrund der politischen Erfahrungen seines Volkes seit der Unabhängigkeit 1948 formulierte, um einen »clash of fundamentalisms«“ (84).
In einem Beitrag für das Handbuch für Friedenserziehung stellt der englische Religionspädagoge John M. Hull die Frage „Can the Religious Fanatic be Educated?“ (85). Kann der religiöse Fanatiker, „der keine Falten im Tischtuch des reinen Glaubens“ dulden kann (86) und sich auf Grund von Unterlegenheitserfahrungen danach sehnt, am bevorstehenden Sieg der eigenen Religion über alle Feinde Anteil zu haben (87), (um-)erzogen werden, ist er zugänglich für Bildungsanstrengungen? Hull beantwortet diese Frage nicht im Blick auf den einzelnen Fanatiker, sondern im Blick auf die Verantwortung des gesamten Bildungssystems. Nur wenn es gelingt, „neue Haltungen gegenüber dem religiösen Glauben … in einem Klima des Respekts“ einzuüben, kann man dem religiösen Fanatismus entgegenwirken (88), während auch nur der Anschein, man wolle die Ausübung der wahren Religion verfolgen oder unterdrücken, das Aufblühen fanatischer Religiosität eher stärkt (89). In der Schule sollte nach Hull „inner-religiös“ gelernt werden, dass jede Glaubensüberlieferung im Lauf der Geschichte unterschiedlich verstanden wurde, „inter-religiös“ sollte Religions-Bildung als ein Gespräch zwischen den Religionen verstanden werden, die nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten aufweisen, und außerdem sollten Schüler auch „intra-religiös“ einen sozial-, geschichts- und sprachwissenschaftlichen sowie philosophischen Blick auf die Religionen werfen können (90).
↑ 2.2.2. Christlich-muslimische Begegnung als Lernprozess (91)
In dem Buch „Lernprozess Christen Muslime“ fand ich viele Anregungen zum christlich-islamischen Dialog.
„Anzustrebendes Ziel ist weder ein Nebeneinander-Leben in passiver Toleranz, noch eine völlige Anpassung (Assimilation) der Minderheit an die Mehrheitsgesellschaft, sondern vielmehr eine Bewahrung der jeweiligen kulturellen und religiösen Identität und Tradition bei gleichzeitiger Akzeptanz und konstruktiver Mitgestaltung des gesellschaftlichen Grundkonsenses bzgl. der politischen und rechtlichen Ordnung.“ (92)
Thomas Naumann sieht unter Berufung auf die biblische Verheißung an Ismael in der Abrahamsgeschichte „die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit einer geschwisterlichen Begegnung von Christen und Muslimen in versöhnter Verschiedenheit in den Tiefen der eigenen religiösen Tradition.“ (93) Zwar sind
„Christentum und Islam … trotz vieler Gemeinsamkeiten im Kern verschiedene Wege zu dem einen Gott Abrahams. … Dieser konkurrierende Wahrheitsanspruch kann aber in versöhnter Verschiedenheit der jüdischen, christlichen und muslimischen Kinder Abrahams ausgehalten und miteinander in ein fruchtbares Gespräch gebracht werden, in der Hoffnung, dass Gott selbst dereinst die Rätsel löst (vgl. Sure 5, 48). … das biblische Bild der Abrahamfamilie bietet ja unterschiedlichen Frauen, Söhnen und Völkern (und Kulturen) einen Raum, in dem es neben Nähe und Gemeinsamkeit auch Fremdheit und Konfliktpotentiale gibt und geben kann. Nur wird in der Erzählung die Erfahrung der Fremdheit Hagars und Ismaels (und ihrer Nachkommen) für die israelitischen Erzähler nicht dazu genutzt, sie aus dem Segen Gottes auszugrenzen. … In dieser Perspektive ist auch der Auftrag zu hören, der Abraham von Gott nach Gen 18, 19 zugedacht ist, nämlich seine Söhne und sein Haus zu lehren, den Weg Gottes zu bewahren und dabei Gerechtigkeit und Recht zu verwirklichen. Auf diese Weise sollen Isaak und Ismael (und deren Nachkommen) dazu beitragen, dass die Völker der Welt im Namen Abrahams einander Segen wünschen.“ (94)
Der evangelische Theologe Reinhard Leuze ist „sogar für eine christlich-theologische Anerkennung Muhammads als echten Propheten aufgrund seiner monotheistischen Botschaft“. Seiner Überzeugung nach
„kann kein Zweifel bestehen, dass Muhammad wesentliche Momente der jüdisch-christlichen Tradition für die muslimische Welt erschlossen hat – wer von einem in der Geschichte handelnden Gott ausgeht, wird diese epochale Tat nicht nur mit dem religiösen Genie des Stifters erklären wollen, sondern als Offenbarung des einen Gottes verstehen, der sich den Menschen bekannt machen will.“ (95)
Aber wie verträgt sich eine solche Anerkennung mit dem jeweiligen absoluten Wahrheitsanspruch beider Religionen? Reinhard Leuze antwortet:
„Christentum und Islam kommen nicht umhin, mit dieser Diskrepanz von universalem Anspruch und faktischer Begrenzung zu leben. Sie sollten sich dazu bereit finden, in beiden Momenten den Willen Gottes zu erkennen: Die Universalität folgt aus dem monotheistischen Gedanken, dass Gott der Gott aller Menschen ist, nicht nur der Gott eines bestimmten Volkes und dass deshalb Besonderheiten der Rasse, des Geschlechts oder anderer spezifischer Merkmale keine Rolle spielen. Die Partikularität ist Ausdruck der kulturellen Bedingtheit, die eine Religion auch dann nicht verliert, wenn sie universale Intentionen verfolgt, einer Bedingtheit, die sie in einen Gewinn für sich selbst verwandeln kann, wenn sie zur Erkenntnis gelangt, dass Gott größer ist als das Bild, das sie sich von ihm macht.“ (96)
Hans Zirker wirbt für eine christliche Lektüre des Koran, der „gerade auch das mit biblischen Traditionen Gemeinsame in einer unerhört eigenen Weise zur Sprache“ bringt.
„Der weite Spielraum möglicher Distanz und Betroffenheit lässt sich theologisch nicht abmessen und disziplinieren, aber als Ort interreligiöser Erfahrung würdigen. … Die christliche Sicht des Koran muss … nicht dort schon zu Ende kommen, wo die christliche Theologie an ihre Grenzen stößt.“ (97)
Auch Martin Bauschke meint:
„Muslime sollten das Neue Testament studieren, und Christen den Koran! Wer die Heilige Schrift des anderen nicht kennt, kann keinen sinnvollen Dialog mit ihm führen. … Ich erinnere an die Befreiungstheologie, an die feministische Christologie oder an die tiefenpsychologisch-therapeutische Christologie. Immer gibt es wieder etwas Neues an Jesus zu entdecken – warum nicht auch in der Begegnung mit Muslimen und dem Koran?“ (98)
Besonders anregend sind seine Gedankengänge, mit denen er eine „auf einen Grundkonsens zwischen Christen und Muslimen hinarbeitende Christologie“ umreißt, die „theozentrisch“, „prophetisch“, „charismatisch“, „metaphorisch“ und „ethisch“ akzentuiert sein sollte. „Der christo-logische Dialog muss zum christo-praktischen Dialog werden.“ (99)
Auch muslimische Autor(inn)en plädieren für ein neues Verständnis christlicher Glaubensvorstellungen, zum Beispiel Smail Balič (100), der etwa in der Theologie Hans Küngs ein Bild Jesu zu entdecken vermag, das sich „weitgehend jenem des Islam angenähert“ hat, „indem bei all seiner Größe seine menschlichen Züge zum Vorschein kommen“ (101), oder Beyza Bilgin, Professorin für Religionspädagogik in Ankara, die aufzeigt, „wie die islamische Theologie das Christentum sah und sieht und welche Themen und Positionen der christlichen Religion bis heute den Muslimen Mühe bereiten“ (102). Sie setzt sich unter Berufung auf den evangelischen Religionspädagogen Johannes Lähnemann dafür ein, zur Frage der Gottessohnschaft Jesu die „neuere Jesusforschung“ zu berücksichtigen (103) und Ängste und Missverständnisse „über die christliche Missionierung“ abzubauen (104).
Heiner Bielefeldt, Professor am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld, appelliert an Christen und Muslime, „einseitige Erbansprüche im Blick auf Menschenrechte zu überwinden“ (105). Vor allem Christen vergessen zuweilen, dass die Menschenrechte in Europa zunächst gegen den Willen kirchlicher Autoritäten durchgesetzt wurden, bevor die Kirchen im Laufe der Zeit in ihnen „durchaus etwas ‚Eigenes‛ erkennen“ konnten und sie inzwischen „zu einem selbstverständlichen Bestandteil kirchlicher Verkündigung und Praxis“ haben werden lassen.
„Genau in dieser Selbstverständlichkeit liegt allerdings auch eine Gefahr. Denn die Anerkennung eines ‚eigenen‛ ethischen Anliegens in Menschenrechten kann gelegentlich zu einer vorschnellen oder gar exklusiven ‚Aneignung‛ der Menschenrechte in die christliche Tradition führen… Dadurch aber drohen sowohl die spezifisch modernen Aspekte menschenrechtlicher Emanzipation aus dem Blick zu geraten als auch die Möglichkeiten eines interreligiösen und interkulturellen Normkonsenses über Menschenrechte verbaut zu werden.“ (106)
Wichtig ist es nach Bielefeldt, dass alle Religionen bereit sind,
„die Säkularität der Menschenrechte – d.h. ihre Eigenständigkeit als ‚weltliches Recht‛ – anzuerkennen und zu würdigen… Erst auf der Grundlage einer solchen prinzipiellen Anerkennung der modernen Säkularität von Recht und Staat können die Religionsgemeinschaften auch eine Wächterrolle für die moderne Gesellschaft wahrnehmen. Sie sind die berufenen Mahner, wenn es gilt, die stets drohende Versuchung absoluter Selbstermächtigung des Menschen zu bekämpfen, in der der Mensch werden will wie Gott.“ (107)
Schließlich gibt Thomas Lemmen in dem 2002 erschienen Buch als Momentaufnahme der damaligen Situation „einen differenzierten Einblick in die fünf bedeutendsten islamischen Organisationen in Deutschland“, um auf der Suche nach Ansprechpartnern im Bereich des Islam fündig zu werden (108). Einem Vortrag über den Islam in Europa von Pfarrer Bernd Apel am 26. Oktober 2011 in Gießen konnte ich entnehmen, dass diese Organisationen nach wie vor bestehen: als Dachverbände der „Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.“ (ZMD) und der „Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“ sowie als große Zusammenschlüsse von Moscheegemeinden der „Verband der Islamischen Kulturzentren e. V.“ (VIKZ), die „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“ (DİTİB) und die „Islamische Gemeinschaft Milli Görüş e. V.“ (IGMG). Seit 2007, so Bernd Apel, gibt es außerdem den „Koordinationsrat der Muslime in Deutschland“ (KRM), den Vertreter der vier erstgenannten Organisationen gegründet haben. Die „Deutsche Islamkonferenz“ (DIK) versucht seit 2006 einen langfristig angelegten Dialog zwischen Vertretern des deutschen Staates sowie organisierten und nicht-organisierten Muslimen in Gang zu bringen.
Praktische Hinweise für das konkrete Zusammenleben von Christen und Muslimen gibt die Religions- und Islamwissenschaftlerin Monika Tworuschka im Blick auf „christliche und islamische Feste als interreligiöse Lernorte“ (109), und Andreas Renz macht Vorschläge zum Thema „Gemeinsames Beten von Christen und Muslimen“ (110). Auf diese Themen komme ich ausführlicher in den Kapiteln 9.2.3 und 10.3 zurück.
↑ 2.2.3 Warum ist der Dialog mit Muslimen besonders für Christen wichtig?
Von seinem Selbstverständnis her ist das Christentum quasi eine in sich abgeschlossene Religion. Nach Jesus Christus als „Weg, Wahrheit und Leben“ für alle Völker der Welt kann eigentlich keine weiterführende Offenbarung mehr kommen. Unter anderem deshalb tun sich viele Christen schwer mit dem Wahrheitsanspruch des Islam und vor allem der Rolle des Propheten Muhammad als Überbringer der letztgültigen Offenbarung Gottes, dem „Siegel der Propheten“.
Martin Luther lebte in der Zeit, als die Osmanen zum ersten Mal Wien belagerten (1529), und hat wohl das Bild, das sich evangelische Christen vom Islam machten, bis in unsere Zeit hinein geprägt. In seiner „Untersuchung zum Türken- und Islambild Martin Luthers“ legte Johannes Ehmann dar, wie der Reformator in der 1542 erschienen „Verlegung des Alcoran“, im Rahmen einer „explizit theologischen Auseinandersetzung mit islamischer Lehre (soweit dem Reformator bekannt)“ diese zu widerlegen versucht. Luther nimmt den Islam „als religiöse Lehrauffassung ernst…, indem er sie in die reformatorische Auseinandersetzung um rechte Lehre integriert. Von einer bedingten Anerkennung des Islam ist allerdings zu sprechen, insofern der Islam konsequent in die christliche Häresiologie und Ketzergeschichte – insbesondere in den Zusammenhang mit Arius und Nestorius – eingeordnet wird.“ (111) Insbesondere wird durch Luther „der prophetische Anspruch Mohammeds … beharrlich zurückgewiesen. … Zweifellos trägt … Mohammed mit dem Anspruch der Offenbarung (Empfang und Weitergabe des Koran) für Luther eine gegenüber der Bibel neue Lehre vor… Wenn aber Mohammed selbst sich auf die biblischen Propheten, auf die Psalmen und das Neue Testament (Christus!) beruft, so irrt er geradezu unheilvoll. Denn er verleugnet die Quintessenz der Schrift: das Handeln des dreieinen Gottes und die Inkarnation des Logos.“ (112) Trotzdem ist Luther „durchaus in der Lage, im Bereich natürlicher Vernunft die kulturelle und gesellschaftliche Leistung der Türken anzuerkennen“ (113), und er lehnt die „Bekämpfung der Türken durch einen Kreuzzug … entschieden ab“, denn: „Die Türken sind Gottes Rute und ihre Bedrohung Ausdruck des Zornes Gottes.“ Im Rahmen seiner „Polemik gegen das Papsttum“, insbesondere „gegen die Verwaltung des Bußsakraments“, identifiziert er die islamischen „Nichtchristen mit den Werkzeugen göttlichen Handelns zum Gericht an der christlichen Kirche entsprechend der Geschichte Gottes mit Israel im Alten Testament. … Nicht kämpfen Gläubige gegen Ungläubige, sondern »mohammedanische« gegen christliche Ungläubige. Der Riss zwischen Glaube und Unglaube trennt nicht nur Christen und Nichtchristen, sondern durchzieht auch und vor allem die Kirche.“ (114)
Aus heutiger christlicher Sicht fragt Olaf Schumann:
„Wenn tatsächlich der Islam eine »Rute Gottes« über die Christen ist, was sind dann die Fehler, die diese »Strafe« verdienen? Und wo hat der Islam, bzw. haben die Muslime, ihr eigenes Recht? Treffen sie in ihrem Gottesdienst tatsächlich nur auf den deus absconditus, den verborgenen, zornigen Gott, oder auch auf den deus revelatus, der sich auch ihnen, wenn auch in anderer Weise, mitgeteilt hat? Oder gibt es eine dritte, bisher noch nicht benannte Option?“ (115)
Ich selbst habe inzwischen gelernt, den Islam als eigenständige Religion mit eigenem Wahrheitsanspruch zu achten, der durch den christlichen Wahrheitsanspruch nicht einfach ins Unrecht gesetzt wird. Wenn Gott, der sich zuerst dem Volk Israel und dann durch Jesus Christus aller Welt offenbart hat, beschlossen hat, sich auf für uns Christen verborgene Weise auch im Islam zu offenbaren (116), dann können wir Christen das als eine Herausforderung betrachten, um mit Muslimen zu wetteifern
- im Glauben gemäß dem jeweils eigenen Glaubensverständnis,
- im Tun entsprechend der Tora, dem Evangelium, der Rechtleitung
- und in der Abwehr von Absolutheitsansprüchen, Vorurteilen und Fanatismus.
Außerdem können wir unsere eigenen Traditionen tiefer verstehen, einschließlich ihrer Wirkungs- und Ketzergeschichte, und eigene Irrwege bzw. Versäumnisse selbstkritisch betrachten und korrigieren.
Ich denke dabei vor allem an folgende Themen:
- Verstehen Christen eigentlich selber ihre eigene Lehre der Dreieinigkeit und der Gottessohnschaft Jesu, und sind alle Angriffe des Islam auf eine Dreigötterlehre in bestimmten Ausprägungen des Christentums ungerechtfertigt?
- Welche Bedeutung haben für uns Maria und die Jungfrauengeburt, wenn Glaubensaussagen in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig die Gottessohnschaft Jesu begründen?
- Welcher Sinn steckt in der christlichen Lehre von der Erbsünde und welche Bedeutung hat Jesu Tod am Kreuz für die Menschen?
- Macht es die christliche Rechtfertigungslehre nötig, jüdische bzw. islamische Vorstellungen von der Barmherzigkeit Gottes und der Angewiesenheit des Menschen auf Vergebung zu ignorieren oder in ihrer Bedeutung herabzuwürdigen?
- Steht die Rechtfertigungslehre des Paulus einer praktischen christlichen Ethik, auf die Jakobus Wert legt, im Wege?
- Welche Bedeutung hat das Gleichnis Jesu von Splitter im fremden und Balken im eigenen Auge für unser christliches Nachdenken über die Gewaltgeschichte im Christentum und im Islam?
- Wie gehen wir mit Zweifeln an Gottes Allmacht um und was können wir zur Theodizeefrage von Muslimen lernen?
- Welchen Stellenwert haben Wunder für den Glauben an Gott – im Christentum und Islam?
- Trägt die Aufklärung abendländischer Prägung zur Auflösung oder Stärkung des Glaubens bei, und was können Christen vom Vernunftgebrauch im Islam lernen?
Ich belasse es bei diesen Stichworten, möchte aber im Blick auf die im ersten Punkt genannte Thematik auf einen Beitrag von Andreas Götze im Deutschen Pfarrerblatt hinweisen, in dem er zu bedenken gibt, dass nicht nur die Christen, für die „das Bekenntnis zu dem einen Gott stets wesentlich“ blieb, „theologisch klären“ mussten, „wie denn der ewige transzendente Gott seine Souveränität und Freiheit behalten könne, wenn er sich auf die Welt, auf die Immanenz einlasse. Diese Fragestellung bestimmt jüdische wie islamische Theologie ebenso“, und das versucht Götze „beispielhaft am Verständnis des »taw‛hid« (»Eins-heit«, »Eins-Sein« Gottes)“ zu zeigen (117).
„Wir haben uns daran gewöhnt, sofort auf unsere unterschiedlichen Antworten zu schauen statt erst einmal gemeinsam zu entdecken, wie viele Fragestellungen uns verbinden… Sich feindlich oder überlegen geben, den anderen karikieren oder als einheitlichen Block wahrnehmen, die Unterschiede in falsch verstandener Toleranz einebnen – all das sind keine spirituellen Haltungen im Dialog.“ (118)
↑ 2.3 Koran: Das heilige Buch der Muslime
Mit dem heiligen Buch der Muslime ging es mir zunächst wie mit dem Islam selbst: Die Ausgabe des Koran in der Übersetzung von Max Henning, die ich seit meiner Studienzeit besaß, blieb mir weitgehend fremd und so gut wie ungelesen in meinem Bücherregal stehen. Eine Annäherung gelang mir auf verschiedenen Wegen.
Zunächst durch ein sehr empfehlenswertes Buch, nämlich die Einführung in den Koran, erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury, die mir mein Mentor, Pfarrer Bernd Apel leihweise für die Zeit des Studienurlaubs zur Verfügung stellte. Sie enthält nicht nur einen überaus reichen Schatz an Wissen zum Koran, sondern auch viele Kalligraphien und farbige Miniaturen mit Darstellungen koranischer Szenen. Unter vielen anderen interessanten Einzelheiten fand ich hier auch eine Formel, mit der man muslimische Daten aus dem offiziellen islamischen Mondkalender in christliche Daten umrechnen kann,
„wobei C für christliches Jahr
und H für Hidjra/Auswanderungsjahr stehen:
C = H – 3H/100 + 622“ (119).
↑ 2.3.1 „Die Schönheit und Vollkommenheit der koranischen Sprache“
Warum gläubige Muslime von der Unübersetzbarkeit des Korans überzeugt sind, und zwar nicht nur im allgemeinen Sinn, in dem die Übersetzung jedes Textes in eine andere Sprache einen Verlust bzw. eine Veränderung des Sinnes mit sich bringt, habe ich erst durch die Lektüre von Navid Kermanis Buch „Gott ist schön“ ansatzweise begreifen können. Zwar ist es auch unmöglich, eine ein für alle Mal „richtige“ Übersetzung der Bibel ins Deutsche zu erstellen (120), aber beim Koran kommt hinzu, dass er erstens seinem Selbstverständnis nach dem Propheten Muhammad als arabischer Koran von Gott selbst offenbart worden ist und zweitens in weitaus stärkerem Maße als die Bibel im Ganzen in poetischer Sprache verfasst und nicht zum stillen Lesen, sondern zum mündlichen Vortrag (121) bestimmt ist. Nicht nur der Offenbarungscharakter des arabischen Korans verbietet es, seine Übersetzungen ebenfalls als Gottes Wort anzuerkennen; hinzu kommt der muslimische Glaube an „die Schönheit und Vollkommenheit der koranischen Sprache“ als „das größte und für viele Theologen einzige Bestätigungswunder des muslimischen Propheten“ (122):
„Man kann geteilter Meinung sein, ob der Koran der schönste Text der Welt ist, wie Muslime behaupten, aber schwerlich lässt sich daran rütteln, dass die Schönheit, die sie ihm zusprechen, von keiner anderen Dichtung oder Offenbarung behauptet wird. Das wäre, wenn man es säkularisieren und als historische Einzigartigkeit und wissenschaftliche Unerklärlichkeit fassen möchte, das eigentliche Wunder des Islams, so wie, um eine letzte Entsprechung zu suchen, im Christentum nicht die Kreuzigung selbst das Einzigartige und Unerklärliche wäre (Jesus Christus war nur einer von vielen, die zu seiner Zeit ans Kreuz geschlagen wurden), sondern der Glaube an Christi Auferstehung, somit die Reaktion seiner Mitmenschen und der späteren Generationen. Sie erst macht den Kreuzestod und sie erst macht die Sprache des Koran zum Wunder.“ (123)
Drei weitere Zitate Kermanis mögen andeuten, was mit diesem Wunder gemeint sein könnte, zunächst zum koranischen Arabisch als dichterischer Sprache:
„Die Schwierigkeiten, einen poetischen Text in eine andere Sprache zu übertragen, liegen nicht nur auf der lexikalischen und syntaktischen oder allgemein der semantischen Ebene. In vielen Fällen schwerwiegender ist das klangliche Problem. Je mehr ein Text vom Klangbild seiner Buchstaben, vom Rhythmus, von der Sprachmelodik lebt und dem Musikalischen sich nähert, desto aussichtsloser muss der Versuch erscheinen, ihn zu übersetzen. Für den Koran, dessen Rezitationscharakter nicht nur vom Text selbst hervorgehoben wird, sondern vom ersten Vers an offenkundig ist, und der als bloß gelesener Text nicht wirklich existiert, gilt dies in einem Maße, wie es in der Poesie abendländischer Sprache selten vorkommt, etwa in Goethes Über allen Gipfeln ist Ruh, in dem sich die künstlerische Botschaft viel mehr durch die Melodie der Verse, den dreifachen Fall der hellen in die dunklen Laute, als durch ihre semantische Bedeutung der Verse vermittelt“ (124).
Was Muslime speziell am sprachlichen Gefüge des arabischen Koran wunderbar finden, davon mag die „Kompositionslehre“ des Al-Ğurğāni, der nach Kermani „unter den großen i‛ğāz(125)-Theoretikern der islamischen Geschichte“, also denen, die sich mit dem Wundercharakter des Koran wissenschaftlich befasst haben, „gewiss der poetisch sensibelste“ ist (126), auch einem Nichtmuslim eine gewisse Ahnung vermitteln:
„Ich gestehe, dass mir in meiner Beschäftigung mit der ästhetischen Rezeption des Koran erst die Lektüre von al-Ğurğāni die ganze Dimension des Wunders vor Augen geführt hat, die der Koran aus arabisch-muslimischer Sicht darstellt. Wenn man über Hunderte von Seiten verfolgt, wie al-Ğurğāni noch die minimalen sprachlichen Differenzen in ihrer Aussagekraft definiert, wie er penibel festlegt, in welchem Falle welche der zunächst absolut unscheinbar wirkenden Varianten zwingend angewendet werden muss, wenn man entdeckt, welch «beinah magische» Wirkung (šabīh bi-s-sihr) beispielsweise eine Ellipse haben kann, so sie an der richtigen Stelle eingesetzt ist, oder wenn man allein die Kapitel über Voranstellung und Nachstellung eines Satzgliedes heranzieht, deren syntaktische Funktionen (aufgeteilt danach, ob sich der Kasus des vorangestellten Wortes verändert oder nicht) studiert, wenn man die Bedeutungsunterschiede kennenlernt, die sich jeweils im Aussagesatz und in dem mit der Partikel a- eingeleiteten Fragesatz durch die Voranstellung entweder des Prädikats oder des selbständigen Personalpronomens, das für das Prädikat steht, ergeben, und zwar je nachdem, ob die Absicht des Sprechers eine negative oder affirmative Stellungnahme zu einem bereits Gesagten ist, wenn man lernt, wie sich die Bedeutung eines Fragesatzes verändert, je nachdem, ob das vorangestellte Verb ein Imperfekt oder eine Präsensform ist oder ob es ein Imperfekt mit präsentischer oder eines mit futurischer Bedeutung oder ob das vorangestellte Satzglied ein Subjekt oder ein Objekt, ob es ein vollständiges Prädikat ist oder eines, das durch ein Personalpronomen ausgedrückt wird, wenn ähnlich detaillierte Festlegungen des eloquenten Sprachgebrauchs auch für den Relativsatz, die Bekräftigungspartikel inna, den Zustandssatz, die Metapher und viele andere grammatische, syntaktische und rhetorische Fragen getroffen werden, dann wird das Wundersame des Koran aus der Perspektive eines al-Ğurğāni nachvollziehbar. Als Außenstehender mag man die von ihm aufgestellten Gesetzlichkeiten in Frage stellen, man mag auch bezweifeln, ob der Koran wirklich, wie der Autor meint, ihre Anwendung in allen Einzelheiten zur Perfektion gebracht hat, aber für den Autor selbst ist beides, sowohl die Stimmigkeit der von ihm aufgestellten Maßstäbe wie ihre vollkommene Übereinstimmung mit der sprachlichen Realität des Koran, gesicherte, anhand von Textbelegen bewiesene, durch die Rezeptionsgeschichte und eigene ästhetische Erfahrung bestätigte, objektive wissenschaftliche Erkenntnis. Und wenn man sich für einen Augenblick in den Autor hineinversetzt und die Richtigkeit seiner Analyse als so gültig akzeptiert, wie es ihm selbst vorkommt, dann muss der Koran tatsächlich als etwas höchst Erstaunliches, kaum Erklärbares, eben Wunderbares erscheinen. Denn dass Mohammed, der – so, wie es sich für al-Ğurğāni darstellt – kein Dichter war und die Feinheiten der Rhetorik sich nicht in langen Jahren der Schulung mühsam angeeignet hat, der die Geheimnisse der Grammatik (nahw), Wortkunde (luġa), Überlieferung (riwāya) oder Metrik (‛arūd) nicht kannte, von rhetorischen Figuren (badī‛) nichts ahnte, ja nicht einmal die Schrift beherrschte (was als gleichbedeutend mit fehlender literarischer Schulung verstanden wurde), dass ein solcher poetischer Laie auf Anhieb und ohne irgendeine zuvor gezeigte Neigung zum dichterischen Wort das gesamte, von keinem normalen Menschen jemals in allen Einzelheiten völlig zu beherrschende System der poetischen Sprachbehandlung perfekt angewendet und, vom Geist der Inspiration beseelt, in unnachahmlicher und zuvor nicht gekannter, daher nicht zu erlernender Weise aus dem bekannten Material der Wörter, Tropen und syntaktisch-stilistischen Regeln etwas völlig Neues, bis dahin Unbekanntes und seither nie wieder auch nur annähernd Erreichtes geschaffen hat, dieses historische Faktum, nachprüfbar, nachweisbar und für jedermann ersichtlich, muss einem dann wie ein Wunder vorkommen.“ (127)
Wichtiger ist, dass der Koran im Selbstverständnis der Muslime einen ähnlichen Stellenwert einnimmt wie Jesus Christus als lebendiges, Fleisch gewordenes Wort Gottes für den christlichen Glauben. Daher kann Kermani, das Hören, Auswendiglernen und Rezitieren des Korans mit dem christlichen Abendmahl vergleichen:
„Gottes Wort im Mund zu führen, durch die Ohren es aufzunehmen, im Herzen es sich zu vergegenwärtigen, ist dem Wesen nach, auch wenn der Islam diese Begrifflichkeit nicht verwendet, eine sakramentale Handlung; das Göttliche wird nicht nur erinnert, es wird vom Gläubigen – ähnlich Jesus Christus im Abendmahl – physisch in sich aufgenommen (weshalb der Gläubige übrigens sorgfältig den Mund ausspülen und die Zähne putzen soll, bevor er die Rezitation beginnt…)“ (128).
Als ich in einer Moschee anwesend sein durfte, während ein älterer und ein jüngerer Muslim abwechselnd eine Sure des Korans laut auf Arabisch rezitierten, spürte ich etwas von dem sakramentalen Ernst dieser Situation, der mich zwar auch an das gemeinsame Bibellesen in einem christlichen Bibel- oder Hauskreis erinnerte, aber mehr noch an den feierlichen Empfang des Heiligen Abendmahls am Tisch des Herrn.
In der gleichen Moschee erlebte ich mit, wie zehnjährige Jungen nach dem Diktat eines aus Syrien stammenden Studenten der Medizin koranische Suren und Hadithe Muhammads auf Arabisch abschrieben, um sie auswendig zu lernen, wobei die Methode des Auswendiglernens nicht darauf zurückzuführen war, dass der Lehrende – wie er mir gegenüber deutlich machte – in Ermangelung ausgebildeter Lehrkräfte sich der Aufgabe des Koranunterrichts als pädagogischer Laie nach besten Kräften stellte. Vielmehr ist gläubigen Muslimen bis heute wichtig, was Kermani schreibt:
„Mit dem quasi sakramentlichen Charakter der Koranrezitation hängt auch der überragende Stellenwert zusammen, dem das Memorieren des Koran in traditionell-muslimischen Gesellschaften zukommt. … Mehr noch als das Hören entspricht das meditative Nachsprechen (dikr) und im Idealfall das vollständige, auswendige Beherrschen (hifz) der herabgesandten Verse dem Aufnehmen Seiner Rede und damit, will man die Parallele zum Sakrament ziehen, einem Einverleiben Gottes. Es ist daher nicht Ausdruck überkommener Lehrmethoden, wie es mitunter dargestellt wird, sondern Konsequenz des muslimischen Offenbarungskonzeptes, wenn der Unterricht in den katātīb, den Koranschulen von Kuala Lumpur bis Duisburg, in erster Linie mit dem Memorieren des Koran bestritten wird. Genauso wie zum christlichen Lebensweg die Taufe gehört und im Mittelpunkt der religiösen Unterweisung im Kommunions- und Konfirmandenunterricht die Einweisung in die Sakramente steht, findet keine genuin muslimische Erziehung statt, ohne dass nicht einige Suren auswendig gelernt würden“ (129).
Kermanis Buch „Gott ist schön“ über das „ästhetische Erleben des Koran“ hat mich übrigens dazu angeregt, auch Rudolf Bohrens Buch über „Praktische Theologie als theologische Ästhetik“ unter dem Titel „Dass Gott schön werde“ aus dem Jahr 1975, das immer nur in meinem Bücherregal stand, endlich einmal zu lesen. Im Vergleich beider Bücher wird der Unterschied der zentralen theologischen Anliegen beider Religionen noch deutlicher: Während die Schönheit Gottes im Islam eng mit der sprachlichen Vollkommenheit der Gottesoffenbarung im Koran verknüpft ist, ja durch sie geradezu ihren beweiskräftigen Ausdruck findet, ist für den christlichen Theologen Gottes Schönheit in seinem dreieinigen Wesen begründet. Schon die Titel beider Bücher sind bezeichnend: Christlich gesehen kann Gottes Schönheit nicht einfach an der Vollkommenheit des in der Bibel aufgezeichneten Gotteswortes abgelesen werden, sondern Gott wird in unseren Augen schön, indem wir eine Geschichte mit ihm erleben: eine Geschichte mit Gott dem Schöpfer, der uns zugleich in seinem fleischgewordenen Wort bzw. Gottessohn Jesus anspricht und aus der Gottesferne erlöst. Rudolf Bohren legt besonderen Wert auf den dritten Aspekt der Dreieinigkeit, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gott „in der Natur, in der Kultur und damit in der Geschichte und in der Kirche“ praktisch wird. „Das Praktisch-Werden Gottes ist ein Schön-Werden, weil Gott selbst schön ist. Gott wird uns in seiner Gegenwart schön, so dass wir ihm in unserer Gegenwart schön werden.“ (130)
↑ 2.3.2 Reinschnuppern ins klassische Arabisch
Als Nicht-Muslim ist es nicht mein Ehrgeiz, Koransuren auf Arabisch zu rezitieren, aber um ein gewisses Gespür für die Ästhetik der arabischen Sprache zu gewinnen, habe ich mich darum bemüht, die arabische Schrift wenigstens entziffern zu können und ein paar Grundbegriffe des klassischen Arabisch zu erlernen (131). Vieles an der arabischen Schrift – ihr konsonantischer Charakter, die Schreibweise von rechts nach links und die Ähnlichkeit mancher Buchstaben – erinnerten mich an das Alt-Hebräische (132). Auch sprachlich gibt es viele Übereinstimmungen des alten Hebräisch mit dem klassischen Arabisch, so zum Beispiel hat das hebräische „rachum“ den gleichen Wortstamm wie das arabische „rachim“ = „barmherzig“, und Jesus wird im Koran unter anderem als „masīh“ bezeichnet, was dem hebräischen „maschiah“ = Messias und dem altgriechischen „christos“ entspricht.
Eine Hilfe für mich, arabische Buchstaben auch in fortlaufendem Text zu erkennen, war für mich die Anordnung des Alphabets auf unorthodoxe Weise in einer von mir gestalteten Tabelle, die allerdings nur jemandem nützt, der die arabischen Buchstaben bereits kennt und weiß, dass es die arabische Schrift nur als Schreibschrift gibt, in der die Buchstaben innerhalb der Wörter (bis auf Ausnahmen) miteinander verbunden werden, und dass dabei die Buchstaben auf vier verschiedene Weise geschrieben werden, je nachdem, ob sie am Anfang, in der Mitte, am Ende eines Wortes oder für sich allein stehen.
Die 28 arabischen Buchstaben lassen sich in vier Gruppen von je sieben Schriftzeichen mit gewissen Ähnlichkeiten einteilen. In der Tabelle habe ich jeden Buchstaben drei Mal hintereinander geschrieben, damit zu sehen ist, wie er am Anfang (rechts), in der Mitte und am Ende eines Wortes (links) aussieht. Die grau hinterlegten Buchstaben dürfen auch mitten im Wort nicht mit dem folgenden Buchstaben verbunden werden, sonst würde man sie mit anderen Buchstaben verwechseln. Diesen Buchstaben habe ich jedes Mal ein „h·a“ (133) (gehauchtes „H“) vorangestellt, um zu zeigen, wie sie mit dem Vorgängerbuchstaben (also nach rechts hin) verbunden werden. Wenn die Buchstaben am Schluss stehen (oder allein für sich, was ich in der Tabelle nicht dargestellt habe), sind die meisten durch einen unterschiedlich geschwungenen Bogen zusätzlich erkennbar.

In der ersten Zeile tauchen fünf Buchstaben mit einem langen senkrechten Strich auf (OK, beim „k“ ist der Strich nur am Ende eines Wortes gerade), davon zwei verbunden mit einer runden Schleife wie bei unserem deutschen „b“ und zwei weitere nur mit Schleife und einem kurzen Aufstrich. Jeweils zwei dieser Buchstaben unterscheiden sich nur durch einen darüber gesetzten Punkt.
Die zweite Zeile enthält sieben Buchstaben, die innerhalb des Wortes lediglich aus einem Aufstrich („n“, „t“, „th“, „b“ und „y“) oder drei Aufstrichen („s“ und „sch“) bestehen, ähnlich wie bei unserem deutschen Schreibschrift-„i“ oder -„u“. Unterschieden werden diese Buchstaben mitten im Wort nur durch die Anzahl und Stellung von null bis drei Punkten unterhalb oder oberhalb des Buchstabens (das erinnert mich an die Unterscheidung zwischen „u“ und „n“ in der alten deutschen Schreibschrift durch den liegenden Bogen auf dem „u“ und natürlich an die Schreibung der deutschen oder türkischen Umlaute).
Eine nach links geöffnete haken- oder bogenförmige Form weisen die sieben Buchstaben in der dritten Zeile auf, und die letzte Zeile enthält weitere sieben Buchstaben, die unterschiedliche Formen von geschlossenen Rundungen enthalten.
Sicher gibt es auch andere Möglichkeiten, sich einen Zugang zur Wiedererkennung der arabischen Buchstaben zu verschaffen, mir fiel das außerordentlich schwer, bis mir die genannten Ähnlichkeiten auffielen.
↑ 2.3.3 Deutsche Koran-Übersetzungen und eine Sammlung islamischer Weisheit
Um mich dem Koran inhaltlich anzunähern, verwendete ich vor allem die sprachlich wie ästhetisch anspruchsvolle Übersetzung des Koran von Hans Zirker, die durch ein „differenzierendes Schriftbild“ auch seinen „vielfältigen kommunikativen Strukturen, rhetorischen Gesten, paränetischen Ausdrucksformen, szenischen Skizzen, Rollenzitaten, antiphonischen Wechselreden, Zwischenfragen und Zwischenrufen, Satzbrüchen, kommentierenden Anmerkungen, emphatischen Klauseln usw.“ gerecht zu werden versucht (134). Sie lag an meinem Arbeitsplatz, um mich in den Koran einzulesen und vor allem auch Suren nachzuschlagen, die in Büchern und Aufsätzen angegeben waren.
Außerdem standen mir Muhammad Ahmad Rassouls „Die ungefähre Bedeutung des Al-Qur’an Al-Karim in deutscher Sprache“ sowie „Der edle Quran und die Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche Sprache“ von Scheich Abdullah as-Samit Frank Bubenheim und Dr. Nadeem Elyas als Download aus dem Internet zur Verfügung. Aus der letzteren Übersetzung und der Transliteration des arabischen Koran von Hans Zirker, ebenfalls im Internet abrufbar, stellte ich mir eine Tabelle zusammen, mit deren Hilfe ich die 6236 Verse des Koran leichter nach bestimmten Namen und Worten sowie insbesondere Übereinstimmungen wie Unterschieden mit biblischen Inhalten durchsuchen konnte. Manfred Däschner aus Württemberg, der mit der Evangelischen Thomasgemeinde Gießen in Beziehung steht und aus unserem Gemeindebrief das Thema meines Studienurlaubs erfuhr, stellte mir sechs Teilbände einer aus der islamisch-sunnitischen Tradition heraus kommentierten arabisch-deutschen Koranausgabe zur Verfügung (135). Auf Sammlungen koranischer Geschichten und eine besondere Koran-Ausgabe für Kinder werde ich im Kapitel 9 eingehen.
Eine Fundgrube für ausgewählte kurze Texte aus der islamischen Tradition war für mich das kleine Büchlein „Weisheit im Islam“, das Annemarie Schimmel herausgegeben hat. Einiges, was mich besonders angesprochen hat, möchte ich daraus zitieren (136).
Ein Paschto-Sprichwort (137) hilft gegen selbstverschuldetes Selbstmitleid:
„Sie molk in ein Sieb
und klagte über das Schicksal.“ (138)
Folgendes Zitat von ‛Ali (139), „dem Vetter und Schwiegersohn des Propheten Muhammad“, erinnert mich an Jesu Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner und an die Selbstkritik des Paulus, der sich nicht wegen seiner Stärken, sondern wegen seiner Schwachheit rühmen will:
„Eine schlechte Tat, die dir schlecht erscheint,
ist in Gottes Sicht besser als eine gute Tat,
die dich selbstgefällig macht.“ (140)
Von Rumi (141), „dem größten mystischen Dichter des Islam“, fand ich folgende Gedanken, die dem Sinn nach mit Jesu Gleichnis vom Splitter und vom Balken übereinstimmen:
„Wenn du einen Fehler in deinem Bruder siehst,
so ist der Fehler, den du in ihm siehst,
in dir selber. Die Welt ist ja gleich einem Spiegel,
in dem du dein eigenes Bild siehst, denn:
»Der Gläubige ist der Spiegel des Gläubigen«.
Reinige dich von dem Fehler in dir;
denn was dich am anderen schmerzt,
schmerzt dich in Wirklichkeit in dir selbst.Alle schlechten Eigenschaften
wie Unterdrückung, Hass, Neid, Gier,
Unbarmherzigkeit, Lust, Zorn, Stolz –
wenn sie in dir sind, schmerzt es dich nicht.
Wenn du sie aber in einem anderen
wahrnimmst, dann scheust du davor
und es schmerzt und verletzt dich –
doch wisse, dass du vor dir selbst scheust.
Ein Mensch empfindet keinen Ekel
vor seinem eigenen Geruch und seinem Abszess;
er taucht seine entzündete Hand in die Brühe
und leckt sich die Finger ab,
ohne sich im geringsten anzustellen.
Aber wenn er einen kleinen Pickel oder
einen halben Kratzer bei einem anderen sieht,
dann mag er diese Suppe nicht und ekelt sich.
Schlechte Eigenschaften
sind ebenso wie Pickel und Geschwüre:
wenn jemand sie hat, bekümmert ihn das nicht,
aber wenn er sie in anderen
auch nur in geringem Maße sieht,
ist er bekümmert und angeekelt.“ (142)
Eine Weisheit, die dem Propheten Muhammad (143) selbst zugeschrieben wird, hat mir ein wenig nachvollziehbar gemacht, wie Muslime das für uns Christen so fremde rituelle Gebet erfahren:
„Solange du beim Ritualgebet bist,
klopfst du an die Pforte des Königs,
und wer an die Pforte des Königs pocht,
dem wird aufgetan.“ (144)
Was Muhammad Iqbal, „geistiger Vater Pakistans und indo-muslimischer Dichter-Philosoph“ (145), zum Gebet sagt, könnte ich auch auf christliches Beten beziehen:
„Dein Gebet kann dein Geschick nicht ändern,
doch vielleicht kann es dich selbst verwandeln:
Wenn in dir die große Wandlung einsetzt,
ist‛s kein Wunder, wenn sich Welten wandeln.
Ewig bleibt der Wein, berauschtes Rufen –
doch der Krug, der Schenke wird sich wandeln.
Dein Gebet: dass sich dein Wunsch erfülle!
Mein Gebet: möge dein Wunsch sich wandeln!“ (146)
Zum Thema der Sündenvergebung fand ich einige Aussprüche, die sich durchaus mit Anliegen der christlichen Rechtfertigungslehre in Übereinstimmung bringen lassen, zum Beispiel die beiden folgenden von Ibn ‛Ata Allah (147), ein dritter von Muhammad:
„Es gibt keine kleine Sünde,
wenn Seine Gerechtigkeit dir gegenübersteht,
und keine große Sünde,
wenn Seine Gnade dir vor Augen steht.“
„Halte deine Sünde nicht für so gewaltig,
dass sie dich absperre davon,
Gutes von Gott zu denken,
denn wer seinen Herrn kennt,
dem erscheint gering seine Schuld,
verglichen mit Seiner Huld.“
„Wenn jemand viele Sünden hat
und keine Werke,
die diese Sünden verhüllen könnten,
sucht Gott ihn mit Traurigkeit heim,
um seine Sünden zu verhüllen.“ (148)
Und hier noch einen Gedanken von ‛Ali zur Praxis der Feindesliebe, die wir von Jesus (oder vielleicht noch passender von David gegenüber König Saul) kennen:
„Wenn du deinen Feind
in deine Gewalt bekommst,
so verzeihe ihm als Dank dafür,
dass du ihn in deine Gewalt bekommen hast.“ (149)
Einen Gedanken von Annemarie Schimmel selbst erwähne ich, weil er ein durch die Lektüre der Abenteuerromane von Karl May genährtes Vorurteil entkräftet:
„Der Fatalismus, dessen der Muslim häufig angeklagt wird, hat in seinem echten Sinn nichts mit einem mechanischen Fatum, einem fühllosen Geschick (in der Literatur oft als »die Sphäre«, »das Himmelsrad« bezeichnet) zu tun; der Glaube an das »Zugeteilte«, qismat, bedeutet vielmehr, dass man bei Unglücksfällen und Katastrophen das Geschehen akzeptiert, da es der Wille Gottes ist, der ja weiß, was für den Menschen in diesem oder jenem Augenblick gut ist – selbst wenn man es intellektuell nicht verstehen mag. Diesem tiefen Vertrauen in die Weisheit Gottes entstammen viele der schönsten Gebete, Gedichte und Sprüche in der islamischen Welt.“ (150)
Zum Abschluss dazu noch eine Weisheit von Ibn ‛Ata Allah:
„Der Achtlose fragt sich am Morgen:
»Was werde ich tun?«
Der Vernünftige schaut:
»Was wird nun Gott mit mir tun?«“ (151)
↑ 2.3.4 Literatur zum Vergleich zwischen Bibel und Koran
Um mich näher mit den inhaltlichen Überschneidungen von Bibel und Koran vertraut zu machen, las ich vor allem das aufschlussreiche Buch des katholischen Theologen Karl-Josef Kuschel „Juden – Christen – Muslime. Herkunft und Zukunft“, in dem er die gemeinsamen Traditionen aus beiden Teilen der Bibel und dem Koran theologisch zueinander in eine fruchtbare Beziehung setzt und davon ausgeht, dass Juden, Christen und Muslime in einer „Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft“ miteinander verbunden sind (152). Seine Darstellung war für mich ein guter Wegweiser, um die über den Koran verstreuten Erzählungen von biblischen Gestalten nicht nur aufzuspüren, sondern inhaltlich ansatzweise einordnen zu können. Kuschel lädt dazu ein, einen weiten Weg durch fünf Themenkomplexe zu durchwandern, die mit Adam, Noah, Mose, Maria und Jesus sowie Abraham verbunden sind.
Das Buch von Karl-Wolfgang Tröger, „Bibel und Koran. Was sie verbindet und unterscheidet“, gibt einen guten Überblick über alle Traditionen, die sowohl in der Bibel als auch im Koran auftauchen.
„Jedenfalls enthält der Koran eine Fülle von Geschichten, Vorstellungen und Gedanken, die aus der Bibel und aus außerbiblischen Quellen bekannt und vielen Menschen vertraut sind, und das war auch schon bei Mohammeds Zeitgenossen und den Hörern seiner Botschaft der Fall. … Sie finden sich vorwiegend in der Bibel, aber auch in der nachbiblischen jüdischen Überlieferung von Talmud und Midrasch, vor allem in den volkstümlichen Erzählungen der Haggada (dem nichtgesetzlichen Bereich der Bibelauslegung) sowie in den apokryphen Schriften der frühen Christen, z.B. in den Kindheitsevangelien. Oft sind es auch nur einzelne Züge von Menschen oder Ereignissen in außerbiblischen Quellen, die sich im Koran in Verbindung mit biblischen Aussagen wiederfinden.
Da biblische Geschichten, Erzählungen aus der rabbinischen Literatur und christliche Legenden zur Zeit Mohammeds bereits einer breiteren Bevölkerungsschicht in Arabien bekannt waren, konnten auch verkürzte biblische Aussagen oder Andeutungen in Mohammeds Verkündigung verstanden werden. Mit all diesen Traditionen waren und sind auch die islamischen Theologen wohl vertraut.“ (153)
Über die von Kuschel ausführlich behandelten Propheten hinaus beschäftigt sich Tröger mit den Überlieferungen zu Saul, David und Salomo bis hin zu Elia und Elisa, Jona und Hiob. Allerdings fällt ihm auch auf:
„zu einem großen Teil der biblischen Texte gibt es keine Entsprechungen im Koran, und das heißt: Die ganze Fülle der biblischen Schriften, der Geschichtsbücher und der Weisheitsliteratur, der Psalmen und der Propheten von Jesaja, Jeremia und Ezechiel über Daniel, Amos und Hosea bis zu Micha, Habakuk und Maleachi findet im Koran ihresgleichen nicht. Das ist wiederum nur eine Feststellung und keine Wertung. Verwunderlich ist nur, dass im Koran sowohl die großen als auch die »kleinen Propheten« – mit Ausnahme von Jona – namentlich nicht auftauchen und in die Propheten-Reihen keinen Eingang gefunden haben und das, obwohl die Propheten eine so zentrale Funktion haben. Anklänge an die biblischen Propheten lassen sich im Koran zwar durchaus feststellen, vereinzelt treten sie auch deutlich hervor – wie die Vision der Totenerweckung von Ezechiel 37 in Sure 2, 259 – aber als Gottgesandte und Propheten spielen sie im Koran keine Rolle.“ (154)
Tröger setzt sich auch mit dem auseinander, was Christen und Muslime im Glauben trennt bzw. verbindet und diskutiert unter anderem die zwischen beiden umstrittene Frage der Dreieinigkeit:
„Wenn im Gottesdienst der Segen des »dreieinigen Gottes« im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes (vgl. 2. Kor 13, 13) ausgeteilt und von den Gläubigen empfangen wird, kommt kein Christ auf die Idee, dass damit drei Götter gemeint sein könnten. Dies kann gegenüber Muslimen, die das vom Koran und von ihrem Verständnis des christlichen Glaubens her anders hören und beurteilen, einfach nur bezeugt werden. Es gibt aber auch muslimische Theologen, vor allem in der Mystik, die dem Trinitätsdenken etwas abgewinnen können (z. B. der liebende Mensch, der geliebte Gott, die verbindende Liebe).“ (155)
Nach Tröger macht das Neue Testament in seinen Aussagen
„über das Verhältnis von »Vater« und »Sohn« … deutlich, dass Gott nicht in Jesus Christus aufgeht. Gott bleibt Gott, auch bei seiner Erscheinung in Jesus Christus. Er bleibt jenseitig und unverfügbar. In diesem Punkt kann der Islam mit seiner nachhaltigen Betonung der Transzendenz Gottes ein Korrektiv zu manchen christlichen Ansichten sein, die den »Herrn Jesus« allzu sehr vereinnahmen und verniedlichen oder die Gott ganz im Menschlichen, in Humanismus und Ethik, aufgehen lassen. Der Koran hebt immer wieder Gottes Erhabenheit hervor (Sure 20, 114; 23, 92.116; 2, 255; 59, 23). Er ist sichtbar und (doch) »verborgen« (57, 3), sodass er letztlich für die »Blicke« der Menschen unerreichbar ist (6, 103). Das unterstreicht auch die Bibel, wo Gott auf die Bitte des Mose Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen! antwortet:
Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen … Mein Angesicht kann niemand sehen! (2. Mose 33, 18-23)
Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott, bekennt Jesaja (45, 15), und der Apostel Paulus charakterisiert den König der Könige und Herrn der Herren als denjenigen, den kein Mensch gesehen hat noch je zu sehen vermag (1. Tim 6, 15f.). …
Trotz des wesentlichen Unterschiedes zum christlichen Glauben, wonach Gott selbst sich in Jesus Christus zu erkennen gibt, gilt auch für die Bibel, dass es nicht die Aufgabe des Menschen ist, Gott zu ergründen, sondern seinem Willen gemäß zu leben und zu handeln.“ (156)
Martin Bauschke geht in seinem Buch über „Jesus im Koran“ unter anderem sehr ausführlich auf die im Koran dargestellten „Wundertaten Jesu“ (157) und auf Parallelen zu den Gleichnissen Jesu ein (158).
Auch das „Geheimnis des Kreuzes“ spart er nicht aus und kommt in seiner Auseinandersetzung mit muslimischen Koran-Kommentatoren zu dem Fazit:
„Exegetisch spricht viel für die innerislamische Mehrheitsauffassung, die einen Ersatzmann für Jesus am Kreuz annimmt, welchen der Korantext möglicherweise nahelegt. Gleichwohl ist und bleibt es letzten Endes Gottes Geheimnis – wie viele zeitgenössische Kommentatoren mit Recht betonen –, was genau am Kreuz auf Golgatha geschehen ist und wie der Gott, dessen Wege und Mittel alle unsere Vorstellung übersteigen, Jesus vor dem Kreuz bewahrt und errettet hat. Das Geheimnis des Kreuzes ist das Geheimnis Gottes. Es wird mit Seinem Gesandten Jesus nichts passiert sein, was nicht Er wenigstens zugelassen hat.“ (159)
In Martin Bauschkes Buch über „Abraham im Koran und im Islam“ unter dem Titel „Der Spiegel des Propheten“ fand ich eine schöne Geschichte für Kinder und Jugendliche von der Gastfreundschaft Abrahams, in der dieser von Gott gescholten wird, weil er einen Gast wegschickt, der kein Tischgebet mit ihm sprechen will (160), und aufschlussreiche Tabellen über die für die jeweilige Religion entscheidend wichtige „Opfergeschichte im Vergleich“ zwischen Judentum (Genesis 22), Christentum (Evangelien) und Islam (Sure 37) (161).
Aus islamischer Sicht schrieb der iranische Korangelehrte und Politiker Mehdi Bazargan ein auch für Christen lesenswertes Buch über den „Koran und die Christen“ mit dem Titel „Und Jesus ist sein Prophet“. In der Einleitung denkt Navid Kermani über Bazargans Verständnis von Toleranz nach:
„Bazargans Toleranzbegriff passt in keine multikulturelle Seligkeit, insofern er auf der absoluten Wahrheit seines Glaubens und der Unwahrheit dessen, was aus Sicht des Korans vom Monotheismus abweicht, beharrt. Wichtig aber ist, sich beim Lesen stets zu vergegenwärtigen, dass Bazargan seine theologische Haltung zum Christentum und zu anderen Religionen nicht als politisches Programm versteht. Er hat sich im Gegenteil als überzeugter Demokrat für die Gleichberechtigung aller Bürger eingesetzt. Den Richterspruch über das, was ihm als Unglaube erschien, behielt er Gott vor und keiner irdischen Instanz. Vielleicht ist darin ein Toleranzbegriff angelegt, der ehrlicher ist als die Ideologie der allseitigen Verständigung: die Wahrheit des anderen nicht für gültig zu erklären, sie theologisch sogar abzulehnen, sie aber gesellschaftlich und im privaten Miteinander zu akzeptieren.Dass dies politisch in letzter Instanz eben jenen islamischen Staat, den auch Bazargan in den sechziger und siebziger Jahren konzipierte, in Frage stellt und auf eine säkulare Ordnung hinausläuft, hat Bazargan in seinen letzten Lebensjahren immer klarer formuliert.“ (162)
Eine interessante Sammlung von Aussprüchen Jesu in der arabischen Literatur, die sozusagen ein muslimisches Evangelium darstellen, hat Tarif Khalidi zusammengestellt; sie ist eine Fundgrube für interreligiöses Erzählen. Zwei besonders schöne Jesusworte möchte ich zitieren:
„Es wird berichtet, dass Jesus sagte: »Oh Gott, wie kann ich dir danken, wenn mein Dank ein Geschenk ist, das ich von dir bekommen habe, und für das ich dir danken muss?« Gott antwortete: »Wenn du das weißt, dann hast du mir gedankt.« (163)
„Gott offenbarte Jesus: »Sei Menschen gegenüber so sanft wie die Erde unter ihren Füßen, sei ihnen gegenüber so großzügig wie fließendes Wasser, sei ihnen gegenüber so barmherzig wie die Sonne und der Mond, denn sie gehen über dem Guten wie dem Bösen auf.«“ (164)
Erwähnenswert finde ich auch folgende „seltsame Erzählung“; sie „wurde als Beispiel dafür in die vorliegende Sammlung aufgenommen, dass der muslimische Jesus, zumindest im Traum, die Wahrheit seiner Kreuzigung bestätigt:
„Al-‛Uris sah im Schlaf Christus Jesus, Sohn der Maria, der vom Himmel aus sein Gesicht ihm zuzuwenden schien. Al-‛Uris fragte ihn: »Ist die Kreuzigung wirklich geschehen?« Jesus sagte: »Ja, die Kreuzigung ist wirklich geschehen.« Al-‛Uris erzählte seinen Traum einem Traumdeuter, der sagte: »Der Mann, der diesen Traum hatte, wird gekreuzigt werden. Denn Jesus ist unfehlbar und kann nur die Wahrheit sagen, daher kann sich die Kreuzigung, von der er sprach, nicht auf die eigene beziehen, denn der ruhmvolle Koran sagt ausdrücklich, dass Jesus weder gekreuzigt noch getötet wurde. Daher muss es sich auf den Träumenden beziehen, und er ist es, der gekreuzigt werden wird.« Es geschah, wie der Traumdeuter gesagt hatte.“ (165)
↑ 2.4 Kopftuch: Das komplizierteste Kleidungsstück der Welt
Einen besonderen Blick möchte ich auf „das komplizierteste Kleidungsstück der Welt“ richten (166), das Heide Oestreich in ihrem Buch „Der Kopftuch-Streit. Das Abendland und ein Quadratmeter Islam“ eingehend und differenziert betrachtet hat. Denn dieser Streit hat auch uns in unserem Kirchenvorstand und in unserer Kindertagesstätte beschäftigt, seit wir die Entscheidung getroffen haben, im Blick auf den hohen Anteil muslimischer Kinder auch muslimische Erzieherinnen und Praktikantinnen einzustellen. Als einige Bewerberinnen deutlich machten, dass sie aus Glaubensgründen auch bei ihrer Arbeit nicht auf ihr Kopftuch verzichten möchten, fasste der Kirchenvorstand im Einvernehmen mit dem Kita-Team den Beschluss, das nicht zuzulassen. Auch die Frauen türkischer Herkunft im Kita-Ausschuss trugen diese Entscheidung mit, denn sie wollten nicht, dass auf die muslimischen Mädchen durch das Vorbild einer Kopftuch-tragenden Erzieherin indirekt ein Druck ausgeübt wird, es sei für eine Muslimin nicht OK, ihr Haar offen zu tragen.
↑ 2.4.1 Wie kam es zum Verschleierungsgebot in einer Religion der Gleichheit aller vor Gott?
Heide Oestreich beginnt mit ihrer Analyse des Kopftuch-Streits ganz am Anfang und stellt fest:
„Eine Religion, die die Gleichheit aller vor einem Gott propagiert, wie der Islam es tut, bedeutet zunächst einmal eine quasi demokratische Revolution. Es zählt nicht mehr das größte Opfer oder der schönste Tempel, jetzt zählt nur noch das Verhalten des Einzelnen vor Gott. Vor Gott sind alle gleich. Aber unter patriarchalen Bedingungen stellt sich bald heraus: einige sind gleicher.“ (167)
Der Islam wird also (wie zuvor die Offenbarungen der Juden und der Christen) in eine Gesellschaft hinein offenbart, in der die Männer das Sagen haben. Und zunächst bedeutet der Islam für den Status der Frau, dass sie „zum Rechtssubjekt“ erhoben wurde: „So konnte eine Frau nun nicht mehr einfach geheiratet werden wie vorher. Sie sollte nun selbst zustimmen.“ (168)
„Die patriarchale Grundordnung besagte damals, dass Frauen im Normalfall eine Art Eigentum ihrer Männer sind – es sei denn, sie waren so mächtig, beliebt oder reich, dass sie ihren Ehevertrag anders aushandeln konnten. Wenn der Ehemann starb, waren sie Teil der Erbmasse, wenn er im Krieg unterlag, waren sie Teil der Beute. Allah revolutionierte dieses Verhältnis, indem er die Frauen von einem Teil des Gutes zu einer Erbberechtigten machte. Sie sollten halb so viel bekommen wie die männlichen Erben. Letztere hatten schließlich noch ganze Familien zu versorgen und sollten deshalb stärker profitieren.“ (169)
Ähnlich wie in den Anfängen des Christentums die frauenfreundliche Haltung Jesu von seinen engsten männlichen Vertrauten nicht in gleicher Weise geteilt wurde, so dass dann doch Männer über viele Jahrhunderte die einflussreichsten Positionen in der Kirche besetzten, haben auch im Islam bald die Männer ihre Vorherrschaft über die Frauen zurückgewonnen. Unter Berufung auf Gedankengänge der marokkanischen Soziologin Fatima Mernissi schreibt Oestreich:
„Die Männer um Mohammed, allen voran sein Nachfolger Umar, wollten schon lange, dass die Frauen sich verschleiern, damit sie sich von den Sklavinnen unterschieden. Mohammed war dagegen. Er wollte, dass Muslime anständige Menschen sind, die sich zu kontrollieren wissen. »Der Hijab (der Schleier) war genau das Gegenteil dessen, was er eigentlich hatte erreichen wollen: Der Hijab verkörperte die fehlende innere Kontrolle, er verschleierte den souveränen Willen, der die Gesellschaft ordnete und regelte«, meint Mernissi und erläutert weiter: »Der Islam Mohammeds weist den Gedanken der Kontrolle (…) weit von sich. (…) In einer Umma von Gläubigen, deren Verhaltensweisen präzisen verinnerlichten Regeln folgen, hebt die Eigenverantwortlichkeit die Kontrolle durch die Geistlichkeit auf, so dass diese schließlich überflüssig wird.«… Doch was tun, wenn die Umma nicht so funktioniert, wie Mohammed es sich wünscht?“ (170)
Im Koran selbst erhält Mohammed nur drei Verse göttlicher Offenbarung (Sure 33, 59 und Sure 24, 30.32), in denen „unvoreingenommene Leserlnnen … nur entdecken können, dass man die Scham und etwaige Schlitze bedecken und nicht mit dem Schmuck klappern soll“, mit denen die späteren Rechtsschulen des Islam aber ein „Verschleierungsgebot“ begründeten. „Zur selben Zeit zieht Mohammed einen Vorhang vor die Privatgemächer seiner Frauen, weil er den Ansturm der Besucher und ihre Unverschämtheiten draußen halten will.“ (171) Das ist die Geburtsstunde des sogenannten „Harems“, womit auf arabisch der für Fremde „verbotene“ Bereich des Hauses gemeint ist und der faktisch eine Trennung der Geschlechter bedeutet. Nach Oestreich wird diese
„traditionelle Rollenverteilung aus dem islamischen Recht abgeleitet… Inwiefern dieses gottgegebene Recht aber verändert werden kann, darüber streiten die Rechtsschulen seit Jahrhunderten. Die einen nehmen alles, was Koran und Überlieferung (die »Sunna«) an Regeln hergeben, als unveränderliche Gesetze wahr. Die anderen leiten aus einem koranischen Gebot ab, dass man seinen Verstand gebrauchen muss, um zeitgemäße Auslegungen dieser Regeln zu finden. Die Gesamtheit der Lebensregeln, die Scharia, wird dementsprechend unterschiedlich interpretiert.“ (172)
↑ 2.4.2 Zwangsentschleierung und Widersprüche in der westlichen Haltung zu den Frauenrechten
Kompliziert wird die Frage des Kopftuchtragens schon dadurch, dass es in den mehrheitlich islamischen Ländern sehr unterschiedliche Entwicklungen gab.
„Fast alle muslimisch geprägten Staaten haben Modernisierungsperioden hinter sich, in denen traditionelle Elemente des Familien- und Personenstandsrechts, wie auch die Schleierpflicht abgeschafft wurden. Die Modernisierung war in vielen Ländern eine Art Ideologie. Man wollte die Moderne mit großem Nachdruck einführen. Dies geschah in manchen Ländern während oder nach der Kolonialzeit (173). Im Maghreb etwa identifizierten die Europäer den Islam mit wirtschaftlicher und sozialer Rückständigkeit, was sie selbst zugleich aufs Angenehmste aufwertete. Die Modernisierung, die diese Länder kennenlernten, ist kolonisatorisch, d. h. autoritär und ausbeuterisch. In anderen Ländern wie Persien oder die Türkei wollte man sich selbst modernisieren und dämmte den Einfluss der Religion deshalb ein. Die Modernisierung hatte einen solchen Zauber, dass die religiöse Vergangenheit in dieser Zeit stark abgewertet wurde. Viele Länder übernahmen nun westliche Rechtssysteme. Im gleichen Zug wurde die Befreiung der Frau propagiert – und ihre Sichtbarkeit. Sie wurde entschleiert, ob sie wollte oder nicht.“ (174)
Aus der Wirtschaftskrise der siebziger Jahre gingen jedoch nicht die modernisierten, sondern auf Grund ihres Ölreichtums ausgerechnet die fundamentalistischen Länder als Sieger hervor,
„und ihre Missionare brachten Geld und Sinn zu den Verarmten und Verunsicherten. Das gab den Fundamentalisten in den modernistischen Ländern Auftrieb. Diese profitierten auch davon, dass die Modernisierung einen autoritären Charakter hatte.“ (175)
Trotzdem bleibt die Sachlage kompliziert. Es gibt überall auch gegenläufige Bewegungen. Zum Beispiel:
„Das Recht auf Bildung haben sich Frauen in allen muslimischen Ländern erkämpft. Studentinnen (mit Schleier) sind im Iran sogar schon seit einigen Jahren gegenüber ihren männlichen Kommilitonen in der Mehrzahl. Die nordafrikanischen Länder haben Frauenfördergesetze. In all diesen Ländern ist damit auch die Grundlage für den weiteren Abbau von Diskriminierungen gelegt.“
Da Heide Oestreich ihr Buch vor den Aufbrüchen des sogenannten „Arabischen Frühlings“ schreibt, kann sie darauf nicht eingehen. Allerdings machen ihre Ausführungen manche der Widersprüchlichkeiten verständlich, die Arabien heute prägen:
„Die Frauenbewegung war in diesen Ländern immer schon doppelt: Säkularistinnen mit Modernisierungsideologie und ohne Schleier standen den Rita Süssmuths des Islam gegenüber, Frauen, die die islamische Tradition und die Rolle der Frau nicht prinzipiell ablehnen und die nichts gegen das sichtbare Zeichen Kopftuch haben, aber dennoch mehr Rechte wollen. Dieser islamische Feminismus hat im Iran und in Pakistan, aber auch in den fundamentalistischen Bewegungen Nordafrikas stark an Bedeutung gewonnen.“ (176)
Heide Oestreich legt nebenbei auch den Finger auf einen wunden Punkt des westlichen Selbstbewusstseins. Ist der Westen wirklich der „Hort der individuellen Menschenrechte“?
„Realitätsnäher ist es wohl zu sagen, der Westen ist der Hort des doppelten Standards: Menschenrechte ständig im Munde führen und sie in der Praxis dennoch verletzen. Dagegen sind muslimische Staaten mit ihrem Bekenntnis zur Scharia geradezu ehrlich. Dieser doppelte Standard manifestiert sich nicht nur in bekannten Missachtungen internationaler Rechtsstandards wie der Todesstrafe in den USA, ihren völkerrechtswidrigen Kriegen oder der Rechtlosigkeit von US-Gefangenen auf Kuba, er ist auch bei den Frauenrechten zu sehen.“ (177)
Ein bezeichnendes Beispiel ist die Frage der Ratifizierung der UN-Frauenkonvention CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), die bereits 1979 von der UN-Vollversammlung angenommen wurde, aber von vielen muslimischen Ländern und auch von den USA noch nicht ratifiziert wurde.
„Die erste afghanische Frauenministerin Sima Samar versuchte, die USA zu einer Ratifikation von CEDAW zu bewegen. Sie könne ihr Kabinett leichter von einer Ratifikation überzeugen, wenn die USA mit gutem Beispiel vorangingen, so ihr Argument. Ihr Ansinnen wurde abgelehnt. Seit längerem hat sich eine unheilige Allianz aus christlichen Konservativen (USA und einige lateinamerikanische Staaten), muslimischen Konservativen und dem Vatikan gebildet, die die Durchsetzung von Frauenrechten international blockiert. Die USA haben in ihrer neuen nationalen Sicherheitsdoktrin vom September 2002 bekannt gegeben, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie ihre offiziellen Ziele seien. In diesem Zusammenhang wird auch der Respekt vor Frauen (»respect for women«) erwähnt – und damit statt der »Gleichberechtigung« eine Formulierung gewählt, die auch die Taliban, die iranische und die saudische Regierung gerne benutzen: Man respektiere Frauen, lehne aber die Gleichberechtigung ab, lautet eine gängige Formulierung dieser Staaten.“ (178)
↑ 2.4.3 Islamisch-traditionelle und islamisch-feministische Kritik am westlichen Blick auf Frauen
Aber nun konkret zum Kopftuch. In der modernisierten „kemalistischen“ Türkei, in der „Mustafa Kemal Atatürk … die Gleichheit der Geschlechter … wie eine neue Schuluniform“ von oben einführte, ist die „Modernisierung“ vor allem „auf dem Land, dem Inbegriff der Rückständigkeit … nur in Bruchstücken angekommen oder wurde ganz abgelehnt“. Von dort kommen seit den siebziger Jahren immer mehr Studentinnen, die trotz des Kopftuch-Verbots in „öffentlichen Gebäuden wie Universitäten“ ihr Kopftuch tragen und damit „ihre islamische Individualität zeigen“. Gerade die Modernisierung hat es
„ihnen ermöglicht, jetzt als gebildete Studentinnen in der Universität aufzutauchen. Mit dem Kopftuch zelebrieren sie einen Kompromiss: Sie bleiben verwurzelt im Islam und transportieren ihn auf ihrem Kopf in die Moderne. Das Beharren auf Authentizität ist für die Soziologin Göle eine Bewegung der Individualisierung gegen das aufgedrängte Kollektivmodell des Kemalismus. Deshalb seien sie eine höchst moderne Erscheinung. Sie überprüfen angebotene Identifikationsmodell individuell. Auch die Religion wird in diese Prüfung einbezogen. So transformieren sie etwa das vormoderne Prinzip der unsichtbaren Frau, indem sie mit ihren Kopftüchern lautstark in die Öffentlichkeit treten, ganz im Gegensatz zu der »Unauffälligkeit«, die der Islam den Gläubigen eigentlich abverlangt.“ (179)
Für westlich geprägte Menschen ist die Einsicht wichtig, dass sich im Tragen des Kopftuchs auch eine Kritik an westlichen Sichtweisen der Frau in der Öffentlichkeit manifestiert.
„Gerade der Schleier symbolisiert aber auch, dass der Westen, dessen Obsession die Sichtbarkeit, die Präsentation des Verborgenen ist, keinen Zugriff auf diese Frauen haben soll. Sie weisen die Herrschaft des Blicks zurück. Die Frau, die einen Mantel statt ihrer Figur und ein Kopftuch statt ihrer Frisur zeigt, hat sich dem westlichen Zwang zum Zeigen und zum Bodyshaping in der Tat entzogen.
Die Kehrseite ist, dass sie damit ein Gewand wählt, das nicht nur die Differenz zur Westfrau betont, sondern auch die zum Mann. Und in diese Differenz zum Mann ist eine Hierarchie eingeschrieben, die die Islamistinnen nur schwer leugnen können und teilweise auch gar nicht leugnen wollen.“ (180)
Die Soziologin Nilüfer Göle meint dazu:
„Das Verbot der Sichtbarkeit des weiblichen Körpers verstärkt die Herrschaft des Mannes. Das Vorrecht des Blicks und der Betrachtung der Frau als Objekt sichern dem Mann sexuelle Privilegien. Was immer auch die Frau, indem sie sich verschleiert, dieser Verdinglichung gegenüber denken mag – tatsächlich zeigt sich darin wiederum das männliche Privileg des Blicks.“ (181)
Auch mit der Ablehnung des Kopftuchs kann die Kritik an westlichen Werten einhergehen. Fatima Mernissi äußert in einem Buch über den östlichen und den westlichen Harem nicht nur ihre Kritik an dem patriarchalen Muslim, der „mit Hilfe des Raums die männliche Herrschaft über die Frauen im öffentlichen Raum festschreibt“, indem er sie entweder aus der Öffentlichkeit in den als „Harem“ bezeichneten für Fremde verbotenen Bereich verbannen und durch die Schleierpflicht unsichtbar machen will. Sie findet
„die westlichen Einstellungen gefährlicher und hinterhältiger als die der Muslime, weil die Waffe gegen die Frauen im Westen die Zeit ist. Zeit ist weniger sichtbar und flüssiger als Raum. Im Westen benutzt man Bühnenlicht und Abbildungen, um weibliche Schönheit in einer idealisierten Kindheit einzufrieren und Frauen zu zwingen, dass sie im Altern, der normalen Entfaltung der Jahre, eine beschämende Entwertung sehen.“
Im Blick auf Diät- und Modezwänge fährt sie fort:
„Die Ayatollahs lenken die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Frauen, indem sie auf dem Schleier bestehen. Wer hier aber breite Hüften hat, verschwindet von der Bildfläche, wird ein Niemand. … Wir Musliminnen haben nur einen Fastenmonat, den Ramadan, aber die armen westlichen Frauen halten 12 Monate lang Diät. …
Die Macht des westlichen Mannes beruht darauf, festzusetzen, was Frauen anzuziehen und wie sie auszusehen haben. Er hat die gesamte Modeindustrie unter seiner Kontrolle, von der Kosmetik bis zur Unterwäsche. Der Westen, fiel mir auf, ist der einzige Teil der Welt, in dem die Frauenmode eine Männerdomäne ist.“ (182)
↑ 2.4.4 Das Kopftuch aus der Sicht von Verfassungsrechtlern und eines Bundespräsidenten
Zurück zum Buch über den Kopftuchstreit von Heide Oestreich. Hauptsächlich handelt es von dem Streit, ob in der Bundesrepublik Deutschland im Schuldienst ein Kopftuch getragen werden darf oder nicht. Als eine der ersten wollte dies die Lehrerin Fereshta Ludin tun und ging durch alle gerichtlichen Instanzen, um sich dieses Recht zu erkämpfen. Alle gesellschaftlichen Gruppen begannen, sich über dieses Kleidungsstück Gedanken zu machen: Wofür steht das Kopftuch?
„Einigen können sich fast alle darauf, dass das Tuch ein religiöses Symbol ist. Aber was bedeutet das? Hat das Tuch appellativen Charakter? So hatte Karlsruhe das Kreuz charakterisiert und wollte es deshalb nicht staatlich verordnet wissen. Darüberhinaus kann es ein politisches Symbol für islamischen Fundamentalismus sein oder eines für die untergeordnete Stellung der Frau. Es kann aber auch lediglich ein Kleidungsstück sein, das im Okzident als fremd empfunden wird.“
Wenn Fereshta Ludin „etwa sagt, sie trage das Tuch »für sich«, um ihre Schamgrenze zu wahren, und nicht, um etwas auszudrücken, ist diese Kommunikation in Deutschland kaum verständlich. Die Schamgrenze Haar ist hierzulande unbekannt, das Tuch ist etwas Besonderes – also muss es auch eine besondere Bedeutung haben.“ Für die gegen Frau Ludin klagende Kultusministerin Annette
„Schavan ist die Bedeutung des Tuches sonnenklar: Sie ist politisch. Sie teilt damit die Interpretation der Islamisten, für die das Tuch ein Kampfmittel ist. Nur, hat Ludin das gemeint und will es bloß nicht zugeben, wie alle Islamistlnnen? Die politische Symbolik des Tuches kann aber auch noch eine andere sein: Keine, die ein Minuszeichen vor die Rolle der Frau im Islam setzt, sondern eine, die diese positiv bestimmt. Seht her, hier ist ein Exemplar einer diskriminierten Minderheit in Deutschland. Dieses Exemplar ist nicht Putzfrau, es ist Lehrerin geworden. Ein stolzes Zeichen von Identitätspolitik sozusagen. Das aber interessiert niemanden.“ (183)
Fereshta Ludin erzielte bei ihrem Weg durch die gerichtlichen Instanzen allerdings einen Teilerfolg, indem das Bundesverfassungsgericht unter Berufung auf Aussagen der „Kopftuch-Expertin Yasemin Karakasoglu von der Universität Essen“ den Schluss zog,
„dass angesichts der Vielfalt der Motive die Deutung des Kopftuchs nicht auf ein Zeichen der gesellschaftlichen Unterdrückung der Frau verkürzt werden darf. Vielmehr kann das Kopftuch für junge muslimische Frauen auch ein frei gewähltes Mittel sein, um ohne Bruch mit der Herkunftskultur ein selbstbestimmtes Leben zu führen. (…) Auf diesem Hintergrund ist nicht belegt, dass die Beschwerdeführerin allein dadurch, dass sie ein Kopftuch trägt, etwa muslimischen Schülerinnen die Entwicklung eines den Wertvorstellungen des Grundgesetzes entsprechenden Frauenbildes oder dessen Umsetzung im eigenen Leben erschweren würde.“
Das Verfassungsgericht räumte ein, dass ein solches Symbol zwar von den Schülerinnen und Schülern ganz anders interpretiert werden kann, als von der Trägerin des Kopftuches beabsichtigt.
„Andererseits kann der religiöse Aussagegehalt eines Kleidungsstücks von der Lehrkraft den Schulkindern differenziert erläutert und damit in seiner Wirkung abgeschwächt werden.“ (184)
Eine Minderheit der Verfassungsrichter sah allerdings das Kopftuch derzeitig als provokatives politisches Symbol und stellte es unter Fundamentalismusverdacht:
„Das von der Beschwerdeführerin begehrte kompromisslose Tragen des Kopftuchs im Schulunterricht ist mit dem Mäßigungs- und Neutralitätsgebot des Beamten nicht zu vereinbaren.“ (185)
Die Mehrheit aber aber machte deutlich, dass ein Kopftuch-Verbot im Öffentlichen Dienst per Gesetz beschlossen werden müsste:
„Das Tuch ist erst einmal ein Kleidungsstück und dann Zeichen einer bestimmten Religiosität, die eine Beamtin haben darf. In seiner übergreifenden Neutralität darf der Staat diese auch zulassen. Wenn er sich das nicht traut, muss er es laut sagen: per Gesetz.“ (186)
Sehr ausführlich lässt Heide Oestreich in ihrem Buch die verschiedensten gesellschaftlichen Stimmen zum Thema zu Wort kommen. Ich zitiere einige der in meinen Augen interessantesten Stellungnahmen, die uns helfen können, auch für die Situation im Kindergarten eine angemessene Entscheidung zu treffen.
„Eine gewichtige Stimme in der Auseinandersetzung kommt von dem ehemaligen Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde.“ Er fragt im Jahr 2001, „ob der »Kopftuchstreit« denn auch »auf dem richtigen Weg« sei“ und kommt zu der Einschätzung:
„»Bietet die Persönlichkeit der Lehrerin die Gewähr, dass sie den Schülern religiös-weltanschaulich offen gegenübertritt, sie in keiner Weise zu missionieren oder indoktrinieren sucht, ist eine mögliche Suggestivwirkung des Kopftuches relativ gering«… Die Trägerin des Kopftuches könne nicht unter eine dem Tuch von außen zugeschriebene Symbolwirkung subsumiert werden. Aber sie könne zu besonderer Sorgfalt und eventueller Rücksichtnahme angehalten sein, um bestehenden Vorurteilen bei Schülern und Eltern entgegenzutreten. …
Der Lehrer sei dafür da, die Schüler zur Toleranz zu erziehen, sie seien damit gerade nicht einer »letztlich standpunktlosen – absoluten Neutralität« verpflichtet. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sei aber immer von einer offenen Neutralität der Schule ausgegangen, die verschiedenen religiösen Bekenntnissen Raum lässt. Die Grenze sei indoktrinierendes oder missionierendes Verhalten. So lange Lehrerinnen dieses nicht an den Tag legten, sollten sie mit Kopftüchern unterrichten dürfen, so das Plädoyer der Ex-Verfassungsrichters.“ (187)
Auch der damalige „Bundespräsident Johannes Rau“ sprach sich „eindeutig für ein Tolerieren des Kopftuches aus“ und
„kritisierte … die Ungleichbehandlung der Religionen in den CDU-Gesetzentwürfen. »Ich bin für Freiheitlichkeit, aber ich bin gleichzeitig für Gleichbehandlung aller Religionen. Die öffentliche Schule muss für jeden zumutbar sein, ob er Christ, Heide, Agnostiker, Muslim oder Jude ist. Und es darf nicht durch religiöse Symbole, die der Lehrer mit sich trägt, ein gewisser Vorrang oder Vormachtstellung gesucht werden.«… In seiner vielbeachteten Wolfenbütteler Rede zu Lessings 275. Geburtstag am 22. Januar 2004 rief er dann eindeutig zur Toleranz auf und untermauerte dies mit zwei Leitsätzen. »Die Debatte um das Kopftuch wäre (…) viel einfacher, wenn es ein eindeutiges Symbol wäre. Das ist es aber nicht. Deshalb muss in dieser Sache nach meiner festen Überzeugung der alte Grundsatz gelten: Der mögliche Missbrauch einer Sache darf ihren Gebrauch nicht hindern.« Rau folgert daraus: »So sehr wir jede Form von Fundamentalismus bekämpfen müssen, so wenig dürfen wir die Religionen unterschiedlich behandeln. Im demokratischen Rechtsstaat gilt das Recht auf Unterschiede, aber kein unterschiedliches Recht.« Er fügt seine persönliche Haltung zum Tuch an: Rau wolle nicht, dass alle religiösen Bezüge aus Schulen verschwinden. Den Fundamentalismus dagegen könne man anders sicher sinnvoller bekämpfen. »Pauschaler Verdacht stärkt ihn, statt ihn zu schwächen«, ist Raus Überzeugung. Er formuliert statt dessen Integrationsanforderungen an beide Seiten: Der Islam müsse sein Verhältnis zum Staat klären. Frauenrechte müssten gewahrt werden. Zur Integration gehöre auch, dass man die Sprache des Landes lerne. Deutschland habe allerdings ebenfalls versäumt, Integrationsleistungen zu erbringen, ordentlichen Islamunterricht gebe es in den Schulen immer noch nicht.“ (188)
↑ 2.4.5 Die Haltung der bundesdeutschen Großkirchen zum Kopftuch
Und wie stehen die evangelische und katholische Kirche zum Kopftuch?
„Große Teile der Kirchen sind höchst einverstanden mit der Sicht, dass Kopftücher etwas fundamental anderes seien als Kreuze, viele mögen es aber nicht so laut sagen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland verabschiedete kurz nach dem Karlsruher Urteil am 10. Oktober 2003 eine Erklärung, in der es heißt: »Wenn eine muslimische Bewerberin für eine Lehrtätigkeit (…) im Dienst ein Kopftuch tragen will, begründet ihr Verhalten angesichts der Bedeutung des Kopftuchs im Islam Zweifel an ihrer Eignung als Lehrerin an einer staatlichen Schule.«“ …
Ein dezidierter Kopftuch-Gegner ist … der Ratsvorsitzende Wolfgang Huber: »Das Kopftuch ist zwar ein religiöses Zeichen, symbolisiert aber auch eine Haltung im Verhältnis der Geschlechter, die mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist….«, erklärte er in einem Interview… Es gebe deutliche Zeichen dafür, dass das Kopftuch desintegrierend wirke, findet er. …
Es gibt aber viele evangelische Würdenträger, die eine tolerante Haltung zum Tuch einnehmen. Dazu gehören die Bischöfinnen der Nordelbischen Landeskirche, Maria Jepsen und Bärbel Wartenberg-Potter… Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, warnte davor, religiöse Symbole an den Schulen generell zu verbieten. »Wir legen Wert darauf, dass Religionslehrer ihren Glauben vermitteln und durch Zeichen verdeutlichen können«…, sagte er. Bei muslimischen Lehrerinnen, die ihr Kopftuch im Unterricht tragen wollen, müsse in jedem Einzelfall bewertet werden, was mit dem Kopftuch ausgedrückt werden solle.“ (189)
Der jetzige Papst und damals noch „Vorsitzende der vatikanischen Glaubenskongregation Kardinal Josef Ratzinger“ äußerte in seiner Silvesterpredigt 2003:
„Ich würde keiner muslimischen Frau das Kopftuch verbieten, aber noch weniger lassen wir uns das Kreuz als öffentliches Zeichen einer Kultur der Versöhnung verbieten.“
Die Deutsche Bischofskonferenz geht „in einem „Papier namens »Christen und Muslime in Deutschland«“ davon aus,
„dass der Koran ein Kopftuch keinesfalls vorschreibe… Dennoch verlangt der Text, die Gewissensentscheidung von Musliminnen zu respektieren, »die der Überzeugung sind, dass ihnen ihre Religion eine solche Pflicht auferlegt«… Einzelne Bischöfe verstärken diese Tendenz zur Ambivalenz. So erklärte Kardinal Joachim Meisner etwa, eine Minderheit habe selbstverständlich das Recht auf Religionsfreiheit, »aber sie kann in diesen Dingen nicht dasselbe erwarten wie die gewachsene Kultur«… Deshalb könnten für muslimische und christliche Kennzeichen in den Schulen auch nicht dieselben Maßstäbe gelten: »Wir sind von unserer ganzen Kultur her ein christlich geprägtes Volk, daher muss man sehr sensibel mit unseren christlichen Symbolen umgehen.« Das Kopftuch »als politisches Symbol« sei in der Schule nicht hinnehmbar. Es könne allerdings auch ein religiöses Symbol sein, gab er zu bedenken, ohne klarzustellen, ob das den Status des Tuches als »nicht hinnehmbar« ändere.“ (190)
↑ 2.4.6 Das Kopftuch als Persönlichkeitsmerkmal, als Schamgrenze oder als Gefahr?
Besonders die folgenden Gedankengänge haben mich dazu bewogen, noch einmal neu nachzudenken, ob unsere Entscheidung, muslimischen Erzieherinnen in unserem Kindergarten grundsätzlich das Tragen eines Kopftuches zu untersagen, richtig war.
Zum Beispiel weist Heide Oestreich auf das Problem hin, dass das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst „den Status des Islam als Minderheitenreligion“ weitgehend außer Acht lässt. Das „bedeutet, dass in der Einschätzung der Religion größere blinde Flecken auftauchen können als bei einer Mehrheitsreligion, die man gut kennt.“ Zum Beispiel machen religiöse Musliminnen das Kopftuch
„zu einem Teil ihrer Persönlichkeit. Zum Symbol dagegen machen es vor allem die Mehrheitsgesellschaft und alle, die es nicht mögen. Deshalb vergleichen sie es mit dem Kreuz. Doch es ist ein fundamentaler Unterschied, ob eine Christin ein Kreuz abnimmt oder eine Muslimin ihr Kopftuch. Die Christin kann ihren Schambereich auch ohne Kreuz schützen. Eine Muslimin, die meint, die Religion erweitere ihren Schambereich auf das Haar, kann das nicht ohne weiteres. Sie müsste ihre Schamgrenze während der Schulzeit verschieben – schwer vorstellbar. Was für die eine Religion kein Problem ist, stellt für die andere eines dar. Man könnte von mittelbarer Diskriminierung sprechen: Ungleiches wird gleich behandelt.“ (191)
Außerdem stellt sich die Frage:
„Inwiefern ist ein Kopftuch eine Gefahr? Eine Gefahr war es bisher für Frauen, weil ihnen das Tuch aufgezwungen wurde. Was an einer Frau, die es freiwillig trägt, für Kinder so gefährlich sein soll, ist dagegen ziemlich unklar. Wenn Eltern ihre Töchter zum Tuchtragen anhalten oder zwingen, tun sie das auch ohne eine Kopftuch tragende Lehrerin, wie man in deutschen Schulen sehen kann. Wenn es andersherum einem Mädchen attraktiv erscheint, das Tuch zu tragen, wird eine Lehrerin ohne Kopftuch sie nicht durch ihr leuchtendes Vorbild abhalten – das tut sie jetzt nämlich auch nicht. Das Bild einer Lehrerin mit Tuch ist durch die Länder, in denen es einen Kopftuchzwang gibt, äußerst negativ konnotiert. Zu Recht, wenn man an die Unfreiheit in diesen Ländern denkt. Aber vielleicht zu Unrecht, wenn es um einen freiwilligen Akt in Deutschland geht.“
Wenn man das Kopftuch als eine „Gefahr“ interpretiert,
„wird Klischees und Vorurteilen Tür und Tor geöffnet. Mit einer solchen Begründung kann nicht nur in der Schule jederzeit gegen das Tuch und damit gegen Musliminnen agitiert werden. Jetzt haben sie es amtlich: Sie sind so unterdrückt, dass sie nicht auf Schülerinnen losgelassen werden können. Sie sind so unterdrückt, dass sie gegen die Verfassung verstoßen. Die Gerichte haben zur Stigmatisierung einer Minderheit beigetragen.“
Und indirekt – so Oestreich – zugleich zu einer kräftigen Aufwertung des Islamismus, denn:
„Die Definition eines Tuches durch ein Prozent der Muslime in Deutschland schlägt alle anderen Definitionen. Oder findet die Mehrheitsgesellschaft inklusive ihrer Richter auch, dass man mit einem Kopftuch ein Mensch zweiter Klasse ist?“ (192)
↑ 2.4.7 Neo-Muslimas: nicht unsichtbar wie Zucker im Tee, sondern sichtbar wie Milch im Kaffee
Auf sehr wichtige Zusammenhänge weist auch Renate Thiersch in ihrem Aufsatz „Muslimische Kinder – Herausforderung und Chance für Kindertagesstätten“ hin:
„Natürlich teilen Muslime die Merkmale der Lebenssituation von Migranten in Deutschland – das Leben mit mehreren Sprachen bei oft geringer Sprachkompetenz im Deutschen, die Erfahrung von kulturellen Differenzen, eine offene und oft unsichere Lebensplanung. Gläubige Muslime leben darüber hinaus in unserer Gesellschaft in einer besonderen Situation. Diese wurde im Bereich der Kindergartenpädagogik – wenn überhaupt – erst in der letzten Zeit deutlicher wahrgenommen, und zwar vor allem im Kontext von interreligiösen Dialogen in kirchlichen Einrichtungen. Zu dieser Wahrnehmung trägt auch bei, dass muslimische Familien gegenwärtig ihre Bedürfnisse deutlicher als früher äußern und dass sich zunehmend junge Leute zum Islam bekennen und ihre Lebensform nach außen sichtbar machen, wie die »neuen« Muslimas, die Kopftuch und bedeckende Kleidung tragen, aber selbstverständlich am modernen Leben teilnehmen. Sie möchten wahrgenommen werden und ihren islamischen Glauben zeigen; eine junge Muslima formulierte: »Ich möchte nicht (unsichtbar) sein wie der Zucker im Tee, sondern (sichtbar) wie die Milch im Kaffee« (193).
Heide Oestreich geht ebenfalls ausführlich auf die sogenannten Neo-Muslimas ein. „Es gibt mittlerweile einige qualitative Studien von Sozialforscherlnnen, die sich mit »Kopftuch-Studentinnen«, den »Töchtern der Gastarbeiter« oder »modernen Formen islamischer Lebensführung« in Deutschland auseinandergesetzt haben.“ (194) Warum tragen diese jungen Frauen das Kopftuch? Wenn sie ihren Glauben praktizieren wollen, dann stecken sie in einer „Zwickmühle“:
„Sie wollen sowohl muslimisch als auch emanzipiert sein. Den Muslimen, auf deren Unterstützung sie setzen, müssen sie versichern, dass sie nicht »verwestlicht« sind, der Mehrheitsgesellschaft dagegen, dass sie dennoch selbstbestimmt leben wollen. Diese Gratwanderung ist kaum zu vermitteln. Diese Frauen probieren etwas Neues, das mit keiner fundamentalistischen Bewegung in einem islamischen Land zu vergleichen ist: Sie wollen als praktizierende Muslima selbstbestimmt in einer Diaspora-Situation leben. Doch das einzige Rollenmodell, das ihnen hierzulande dafür bisher zur Verfügung steht, ist das der unterdrückten Muslimin. Dieses Bild müssen sie sprengen.“ (195)
Die soziologischen Studien halten übereinstimmend fest,
„dass die jungen Frauen das Kopftuch nicht aus traditionellen Gründen tragen, sondern es neu entdeckt und für sich mit Sinn gefüllt haben. … Es gibt einige junge Frauen, deren Eltern wollten, dass sie das Tuch tragen, andere mussten es eher gegen die kemalistisch beeinflussten Eltern durchsetzen, die dem Tuch ablehnend gegenüberstehen. Von einigen heißt es, ihre Eltern seien so lax religiös, dass sie über den Islam zunächst gar nicht viel wussten. Oft gab die Schule den Anstoß, sich damit näher zu beschäftigen, weil Lehrer wollten, dass man etwas »über den Islam« erzähle.“ (196)
Normalerweise unterstellt man, dass Mädchen sich unterdrückt fühlen müssten, wenn nur sie sich einer bestimmten Kleiderordnung zu unterwerfen haben. Die Neo-Muslimas drehen diesen „Aspekt der Geschlechterungleichheit“ um:
„Sie haben – im Gegensatz zu den Männern – eine solche Ausstrahlung, dass sie diese hinter einem Tuch verbergen müssen. … Auf eine verschlungene Weise vollziehen sie die Selbstsexualisierung ihrer nichtmuslimischen Kameradinnen durchaus mit: Unter diesem Tuch steckt eine Frau, die ist so sexy, dass sie sich verbirgt. So geht sie verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität um, soll das Tuch signalisieren.“ (197)
„Das Kopftuch, so interpretiert eine Reihe von Sozialforscherinnen, ist das Zeichen der Frau dafür, dass sie ihre sexuelle Anziehungskraft anerkennt, ja, sogar zu schätzen weiß. Das Kopftuch in der Öffentlichkeit aber soll gleichzeitig signalisieren, dass sie sich trotz dieser Anziehungskraft nicht auf den Privatraum zurückziehen, sondern in der öffentlichen Sphäre mitmischen werden. Ihre Interpretation wäre: Die westliche Frau muss ihre Sexualität entweder zu Markte tragen oder sie verleugnen, wenn sie ernstgenommen werden will. Die Muslimin verleugnet sie nicht und trägt sie nicht vor sich her, sie verbirgt sie nur.“ (198)
Letzten Endes wird
„das Tragen des Kopftuchs … sogar zur Abwehr traditioneller Anforderungen an ihre weibliche Rolle genutzt. Mit der Verhüllung erwerben die Frauen »eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber den traditionellen bzw. islamistischen Männern; man könnte sagen: durch die Einsetzung einer ›höheren‹ Autorität – der des Islam bzw. der persönlichen Beziehung zu Allah (…) – verschaffen sie sich eine Instanz zum Schutz vor einer vermeintlichen Autorität muslimischer Männer.«“ (199)
Aus solchen Gründen zieht Oestreich den Schluss,
„dass die zweite Generation der Muslimlnnen in Deutschland die oft geforderte Säkularisierung des Islam vollzogen hat: Sie konzipieren ihn als individuellen Glauben und persönliche Ethik, womit ihr Glaube integrationskompatibel wird.
… Sie setzen sich ab vom Gastarbeiter-Islam als exakt verhüllte, hochislamisierte Damen. Und sie setzen sich ab vom westlichen Anspruch auf Sichtbarkeit, Enthüllung, Konsumdenken und der extremen Selbstsexualisierung, der ihre nichtmuslimischen Schulkameradinnen in diesem Alter gern verfallen.“ (200)
Aber könnte es nicht doch sein, dass die „Neo-Musliminnen“ mit Kopftuch den islamistischen Fundamentalisten näher stehen als andere?
„Aus den empirischen Erhebungen ist eine generelle Anziehungskraft der Fundamentalisten auf Jugendliche und damit auch auf Mädchen mit Tüchern nicht festzustellen. Die qualitativen Studien haben recht deutlich gezeigt warum: Der Männerort Moschee macht den Frauen kein befriedigendes Angebot. Ihren Islam müssen sie sich selbst zusammenbauen. Die Fundamentalisten versuchen, ein Geschlechterbild zu zementieren, das die Frauen bereits aufgelöst haben.“
Damit geraten aber diese jungen Frauen in eine nahezu unauflösbare Zwickmühle. Denn sie finden
„in dieser Gesellschaft keinen Ort für ihre Identität… Als praktizierende Musliminnen werden sie massiv diskriminiert, wie ihre oft vergebliche Arbeitsplatzsuche zeigt. Den säkularen TürkInnen sind sie ohnehin suspekt, denn das Tuch ist für Kemalistinnen ein Symbol, das ihre persönliche Entwicklung dementiert. Sie können nicht fassen, dass jemand es freiwillig trägt, und kämpfen dagegen. Nur die orthodoxen und fundamentalistischen Muslime sind auf der Seite der Tuchträgerinnen. Mit ihnen sind sich die jungen Damen darin einig, dass man die Religion Islam wichtiger nehmen will. Damit ist für sie aber keinesfalls die Einschränkung ihrer Freiheiten im Namen des Islam gemeint, die manche Fundamentalisten propagieren. …
Der Islam der Neo-Musliminnen ist mit dem der Fundamentalisten nicht vereinbar: Vielmehr sieht ihr Islam aus, wie die Europäer ihn gerne hätten: reflektiert, aufgeklärt, individualisiert, mit den Bedingungen der Säkularität versöhnt. Nur die Sichtbarkeit ihres Glaubens wollen sie sich nicht nehmen lassen. Übrig bleibt allein ein Symbol. Ein Quadratmeter Islam.“ (201)
„Die Neo-Muslimin ist interessiert an einer freiheitlichen Lebensweise mit tendenziell säkularisiertem Islam, ganz so wie die Gesellschaft es eigentlich wünscht. Sie besteht aber auch auf Abgrenzung mit ihrem Outing-Symbol Kopftuch, und sie hat unter Umständen ein traditionelleres Geschlechterkonzept, als es hierzulande propagiert wird. …
Wer das Identitätskonzept der Kopftuchstudentinnen ernst nimmt, muss zugeben, dass es sehr wahrscheinlich nicht diese Frauen sind, die zur weiteren Unterdrückung einzelner Mädchen beitragen. Im Gegenteil: Musliminnen mit Kopftüchern haben bei der Organisation Huda Sorgentelefone für muslimische Mädchen eingerichtet. Musliminnen mit Kopftüchern bieten beim Zentrum für islamische Frauenforschung und Frauenförderung Selbstbehauptungskurse für Frauen an. Hier stellt sich die Frage, wem genau eigentlich unterdrückte Mädchen mit Tuch am Herzen liegen – den Frauen mit oder ohne Kopftuch? Wer die Studien über Schwierigkeiten von Migrantenkindern in der Schule ernst nimmt, der kann auf die Idee kommen, dass da etwas zu tun ist, ob mit oder ohne Tuch. Man könnte sogar auf die Idee kommen, dass ein Rollenmodell diesen Mädchen gut tun könnte. Ein Vorbild, das zeigt: Man kann eine ritualtreue Muslimin sein und trotzdem etwas werden. Im öffentlichen Dienst, zum Beispiel.“ (202)
↑ 2.4.8 Einsatz für Chancengleichheit und interkulturelle Toleranz statt Kopftuchverbot
Am Ende ihres Buches kommt Heide Oestreich nach Abwägung vieler Argumente zu dem Schluss, dass die „Kopftuch-Gesetze auf den Müll“ gehören. Die Politik sollte „das Kopftuch Kopftuch sein lassen und sich um das kümmern, was wirklich im Argen liegt: die Chancengleichheit von muslimischen Mädchen und die Auseinandersetzung mit dem Islamismus.“ (203)
Aber ist und bleibt nicht letzten Endes das Kopftuch „ein Symbol der Unterdrückung der Frau“? Selbst wenn die Lehrerin oder Erzieherin, die es trägt, emanzipiert ist, zeigt nicht „das Bild, das sie vor den Kindern abgibt, … etwas anderes“? Heide Oestreich urteilt schroff über solche Gedankengänge:
„Hier wird die Auslöschung der Realität durch das Bild total: Das Kopftuch erschlägt die Person. Die Lehrerin in ihrem Verhalten soll weniger Einfluss auf die Kinder haben, als ein Bild, das es von ihrem Kleidungsstück gibt. Analog dürfte ein Lehrer mit ultrakurzen Haaren nicht beschäftigt werden, weil seine Frisur ein Symbol von Rechtsradikalen ist. Das erscheint absurd, schließlich kann man überprüfen, ob die Person zur Frisur rechtsradikal ist. Die fremden Frauen dagegen sind als Person nicht vorhanden. Eine Lehrerin, der Selbstbestimmung und innere Unabhängigkeit der Kinder am Herzen liegen, soll nicht tragbar sein, wenn sie dabei ein Tuch trägt. Realistischer wäre wohl zu sagen: Eine Lehrerin, die Kinder autoritär indoktriniert, ist nicht tragbar, egal, ob etwas auf ihrem Kopf ist oder nicht. Die katholischen Schulschwestern im bayerischen Auerbach wurden gestoppt, als bekannt wurde, dass sie Mädchen die kurzen Röcke mit Teufels- und Höllendrohungen austreiben wollten. Dasselbe muss einer orthodoxen Muslimin passieren, wenn sie Kindern vorschreiben wollte, wie sie sich zu kleiden oder zu verhalten haben. Für diese Fälle ist die Schulaufsicht zuständig. Gestoppt werden müsste dann aber nicht das Tuch, sondern die Frau.“
Dabei ist sich Heide Oestreich wohl bewusst, dass auch etwas an den Bildern vom Kopftuch richtig ist.
„Nicht alle Frauen haben das Vergnügen, superemanzipiert zu sein und in einem liberalen Umfeld zu leben. Auch nicht alle Musliminnen. Einige von ihnen müssen einen schwierigen Weg zurücklegen. Sie müssen manchmal mit autoritären Familien klarkommen, vielleicht eine arrangierte frühe Heirat umschiffen oder aushalten. Sie müssen unter Umständen Probleme mit der Ausbildung meistern, weil ihre Sprachkenntnisse nicht perfekt sind oder weil sie Bildungslücken haben. Sie beruhigen vielleicht ihre Eltern oder Ehemänner, die Angst um ihre moralische Integrität haben, damit, dass sie besonders wohlerzogen islamisch sind und ein Kopftuch tragen. Manche sagen: »Das Kopftuch gibt mir Schutz«, wie anderen die Lederjacke, der Nadelstreifen-Anzug oder das perfekt sitzende Kostüm. Diese Frauen gehen einen komplizierten, mühsam austarierten Weg, der mit dem Adjektiv »unterdrückt«, das die Gesellschaft auf sie klebt, nicht gut beschrieben ist. Aber wenn man ihr Dasein schon so schwierig findet: Was tut die Gesellschaft, um diesen jungen Frauen zu helfen? Sie macht ihnen das Leben noch schwerer. Frauen mit Kopftuch haben massive Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden. Schlecht ausgebildete Frauen aber landen tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit am Herd. Das ist nicht nur bei Musliminnen so. Wer etwas für sie tun will, fördert sie und lehnt sie nicht ab, nur weil sie ein Tuch tragen.
Wer das Tuch im öffentlichen Raum dagegen diskreditiert, setzt eine unglückselige Tradition deutscher Integrationspolitik fort: »Anpassung fordern und Diskriminierung beibehalten«, so hat Wilhelm Heitmeyer einmal das merkwürdige Verhalten der Deutschen gegenüber Migrantlnnen genannt… Man möchte keine Migranten in seinem Wohnhaus und kritisiert dann, dass sie sich alle in einem Viertel »abschotten«. Man gibt ihnen kein Wahlrecht und wundert sich dann, dass die Demokratie ihnen so wenig bedeutet. Man möchte keine Kopftücher an Schulen und findet dann, dass die Mädchen und Frauen sich selbst ausschließen.“ (204)
Anstatt Kopftuch-tragende Musliminnen kategorisch aus dem Öffentlichen Dienst auszuschließen – nach dem Motto: „Man schlägt das Tuch und trifft das Mädchen“ –, schlägt Heide Oestreich eine wirkliche Hinwendung zum interkulturellen Lernen vor:
„Man kann sich statt dessen darauf konzentrieren, was Kindern in der Schule beigebracht werden soll. Der Ausgrenzung und Abschottung von muslimischen Schülerlnnen, die neuerdings so extrem beklagt wird, hielte man getreu den alten Ideen der Kultusministerlnnen das Konzept Interkulturelles Lernen entgegen. Dabei kann man die Religion als Teil der Kultur nicht außen vor lassen. Die interkulturelle Schule hat dabei die vornehme Aufgabe, Toleranz nach beiden Seiten zu lehren.
Eine interkulturelle Schule ohne falsche Toleranz sähe dann vielleicht so aus: Die säkulare Gesellschaft disqualifiziert die Religion nicht von vornherein. Das heißt, man lässt auch das Tuch auf den Köpfen zu, sogar auf Lehrerinnenköpfen. Die Religionen akzeptieren die Schule als Diskussionsraum, in dem alles hinterfragt werden darf und soll. Der Islam muss sich im öffentlichen Raum Schule ebenso zur Debatte stellen wie das Christentum und das Judentum. Die vielen Spielarten des Islam, inklusive Reformbestrebungen und feministischen Interpretationen, finden in diesem Unterricht ihren Niederschlag.
Diese Art von Interkulturalität, die verschiedenen Wertsystemen sowohl Raum gibt, als auch ihre Grenzen definiert, kann nicht dem Verdikt »falsche Toleranz« oder »Indifferenz« anheim fallen. Sie zeigt, dass die Freiheiten der Bürgerlnnen, die der Staat respektiert und schützt, nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Frauen werden darin nicht diskriminiert, indem der Staat ihre Kleidung disqualifiziert. Aber ebenso wenig lässt dieser Staat zu, dass sie durch Freiheitsentzug, durch Zwangsheiraten, durch Zwangsbekleidung oder durch Gewalt diskriminiert werden. Wer die Frauenrechte so hoch schätzt wie die Deutschen, seit sie einen Kopftuch-Streit führen, der sollte der symbolischen Politik in Sachen Kopftuch Taten folgen lassen: Aufklärung, Beratung, Unterstützung für Frauen und Mädchen, deren Freiheit bedroht ist, damit sie sich entfalten können.“ (205)
Nachtrag zu diesem Kapitel: Der Beschluss, dass muslimische Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen bei ihrer Arbeit im Kinder- und Familienzentrum der Evangelischen Paulusgemeinde Gießen kein Kopftuch tragen dürfen, wurde vom Kirchenvorstand im Oktober 2012 nach eingehender Beratung und der Gewinnung neuer Einsichten aufgehoben.
↑ Anmerkungen
(29) Ulrich Schoen, Seminar „Der Koran“, im Wintersemester 1974/75 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Evangelische Theologie.
(30) Schmidt, Religion, S. 136f.
(31) Khoury/Hagemann/Heine, Band 1, S. 106ff.
(32) Khoury/Hagemann/Heine, Band 3, S. 718ff.
(33) Khoury/Hagemann/Heine, Band 2, S. 416ff. und 491ff.
(34) Zum Stichwort „Zufall“ vgl. meinen inneren Dialog mit Odo Marquard in Schütz, Zu-fällige Zugänge.
(35) Berger, Sieg, S. 72: „Die moslemische Apokalyptik ist zwar stark moralisierend, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie das ausschließlich sei. Immerhin ist auch von Fürsprache im Gericht … und von Gottes Barmherzigkeit die Rede“.
Ebd., S. 73: „Das Gericht ist … nicht nur ein Gericht nach moralischen Werken, sondern sehr wichtig sind darin auch die frommen Haltungen. Wenn wir hören, dass Glauben und Bekennen alles ausgleicht, so erinnert das auch an reformatorische Positionen.“
(36) Berger, Nachwort, S. 124f.: „Der neutestamentliche Judasbrief bringt eine wenig beachtete Differenz zwischen Islam und Christentum zur Sprache. Denn bei jeder Wallfahrt nach Mekka ist eine feierliche Verfluchung Satans angesetzt. Sie vollzieht sich, indem die Gläubigen auf den Teufel Steinchen werfen – also durch Steinigung. Und entsprechend betet man vor jeder Koranlektüre: ‚Ich nehme meine Zuflucht bei Gott vor dem verfluchten Satan‛ (Sure 16, 98).
Der Judasbrief [9-10] dagegen verbietet jede Verfluchung Satans… Man darf fragen: Warum ist das so? – … Sowie … der Verfluchende selbst böse ist, wird sein Fluch auf ihn zurückfallen. Und daher sollte man den Teufel nicht verfluchen, wenn die Gefahr besteht, dass man selbst Dreck am Stecken hat. Im Islam dagegen ist die Sache klar: Insbesondere aufgrund der Wallfahrt nach Mekka sind die Gläubigen frei von Schuld und können den Teufel guten Gewissens bestrafen. Keine Gelegenheit wäre günstiger.
Der Fall Judasbrief 9f zeigt symptomatisch dreierlei: 1. Die Verbundenheit zwischen Islam und Christentum reicht weit über die großen Themen hinaus. Sie äußert sich auch gerade in Feinheiten des Brauchtums. Denn ohne Zweifel steht Judas 9f auf demselben Fundament wie die moslemischen Bräuche. 2. Die neutestamentliche Lösung und ihre Voraussetzungen sind den Initiatoren und Verbreitern der genannten Bräuche schlicht unbekannt. Sonst wären sie sicher so oder so darauf eingegangen. 3. Der Islam verhält sich zum Problem des Bösen ‚holzschnittartiger‛ als das frühe und besonders das spätere Christentum. Das hat seine guten Seiten und seine Schattenseiten.“ Wer sich für diese Seiten interessiert, möge selbst im Buch nachlesen.
(38) Ebd., S. 25: „Die einzige Religionsgemeinschaft, die sich im Sinne ihres Auftrags vorbildlich in Ruanda verhalten hat, waren die Muslime.“
(41) Ebd., Schaubild S. 564 und letzte innere Umschlagseite.
(42) In diesem Abschnitt beschäftige ich mich mit einer Reihe von Aufsätzen aus dem Sammelwerk Wendepunkt.
(43) Der Philosoph Odo Marquard, Aesthetika, S. 7, hatte in den 80er Jahren die Ausrufung der „Postmoderne“ in Frage gestellt: „Was kommt nach der Postmoderne? Ich meine: die Moderne. Die Formel ‚Postmoderne‛ ist entweder eine antimodernistische oder eine pluralistische Losung. Als antimodernistische Losung ist sie eine gefährliche Illusion; denn die Abschaffung der modernen Welt ist keineswegs wünschenswert. Als pluralistische Losung bejaht sie ein altes und respektables modernistisches Motiv; denn die moderne Welt: das war und ist Rationalisierung plus Pluralisierung.“
(44) Amirpur/Ammann, S. 19.
(52) Ebd., S. 50; zitiert nach dem Text „Bildung durch Erziehung“, veröffentlicht unter www.institut-mannheim.de.
(55) Bodenstein, S. 68f.
(58) Hildebrandt, S. 127.
(65) Gerlach, Gihan al-Halafāwī, S. 184 und 187.
(70) Dieser Abschnitt bezieht sich vor allem auf Beiträge aus dem Sammelwerk Differenz, aber auch auf ein Buch über Wilhelm von Tyrus und einen Aufsatz von John M. Hull.
(71) Vgl. den Leserbrief von Prof. em. Dr. Karl-Heinz Kuhlmann im Deutschen Pfarrerblatt, in dem er zum Fall der Vikarin Carmen Häcker Stellung nimmt, die wegen ihrer Ehe mit einem Muslim in der evang.-luth. Landeskirche Württembergs nicht Pfarrerin werden darf: „sie will Verkünderin des Evangeliums von Jesus Christus werden, der nach dem Glaubensbekenntnis der Sohn Gottes ist. Der Mann, den sie liebt und geheiratet hat, gehört aber einer Religion an, welche die antichristliche schlechthin ist und alle die verdammt, die an diesen Gottessohn glauben, ja sie in die Hölle fahren lässt!“
(72) Schmid/Renz/Sperber/Terzı, S. 9.
(73) Waardenburg, S. 26.
(74) Ebd., S. 28: „Mehr als je zuvor sind wir uns des Konstruktionscharakters von Religionen in gegebenen Kontexten bewusst.“
(75) Takım, S. 49f.: „In einer globalen Welt kann die Fremdheit anregen, von anderen Kulturen und Religionen zu lernen und sie besser zu verstehen. Bei der interkulturellen Kommunikation sollte man jedoch nicht versuchen, die Fremdheit zu negieren oder sie zu bekriegen, sondern man sollte sie so akzeptieren, wie sie ist.“ Abdullah Takım schrieb dies als Wiss. Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Mainz.
(76) Görgün, S. 104. Tahsin Görgün war zur Zeit der Abfassung des Artikels Professor am „Zentrums für Islamforschung“ (İSAM) in Istanbul und Stiftungsprofessor für Islamische Religion an der Universität Frankfurt.
(77) Antes, Kreuzzüge, S. 157.
(78) Würtz, S. 168. Ebd., S. 169: „Die Beschäftigung mit den Kreuzzügen kam vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stärker in Gang, was wesentlich durch die zionistische Bewegung und die daraus resultierenden Ereignisse in Palästina gefördert wurde und sich in greifbarer Form niederschlug, als Wadī‛ Talhūq im Jahre 1948 sein Buch über die jüdische Einwanderung nun den neuen Kreuzzug nach Palästina (as-Salībīya al-ğadīda fī Filastīn) nannte.“
Ebd., S. 173: „Talhūq vergleicht den Staat Israel mit dem Königreich Jerusalem und streicht heraus, beide ähnelten sich hinsichtlich ihrer technischen Überlegenheit, der Hilfsleistung aus dem Westen, des kleinen und schmalen Staatsgebiets und des schwindenden Zuzugs von Siedlern. Das Gefühl, im Zeitalter neuerlicher Kreuzzüge zu leben, wurde dabei allerdings nicht von Historikern generiert, es existierte schon bei palästinensischen Nationalisten, die in den frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts begannen, den Tag des Sieges von Saladin über die Kreuzfahrer bei Hattīn zu feiern, und wurde sicherlich ebenso von historischen Romanen über die Zeit Saladins entfacht. Mit dem Sieg Saladins ergibt sich aber auch ein Anhaltspunkt für das tiefere Interesse von zeitgenössischen Muslimen an den Kreuzzügen. Es beruht letztendlich auf der einfachen, aber wichtigen Tatsache, dass die Muslime seinerzeit als Sieger aus dem Konflikt hervorgingen.“
(79) Bongardt, S. 182: Insofern die westliche „Überzeugung von der eigenen Überlegenheit“ nicht daran zerbrach, „dass die Kreuzzüge ihr Ziel nicht dauerhaft erreichten“, sondern „nach wie vor zum Selbstverständnis westlicher Gesellschaften – und weithin auch zur Identitätsbehauptung christlichen Glaubens“ gehört, „erscheinen die gegenwärtigen militärisch-politischen Operationen, die symbolisch mit den damaligen Geschehnissen verbunden werden, als Fortsetzung eines ehedem gescheiterten, aber bis heute legitimen und notwendigen Unternehmens. Gepaart mit dem Bewusstsein der eigenen militärischen und ökonomischen Stärke stehen, so wird insinuiert, die Chancen gut, den Kampf nun endlich zu gewinnen.“
(82) Bekim Agai schrieb seinen Artikel Abgrenzungen als Wissenschaftlicher Assistent am Orientalischen Seminar der Universität Bonn, Gritt Klinkhammer ihren Artikel Fundamentalismus als Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Bremen, und Arnulf von Scheliha seinen Beobachterbericht als Professor für Systematische Theologie an der Universität Osnabrück.
(85) Eine Frage, die sich kaum angemessen ins Deutsche übersetzen lässt, da im englischen Begriff „education“ andere Bedeutungen mitschwingen als in den deutschen Entsprechungen „Erziehung“ oder „Bildung“.
Christa Dommel, Religions-Bildung, S. 89, zitiert dazu Hartmut von Hentig: „,Education‛ zu übersetzen werde ich mich hüten. Ich gebe stattdessen den Schlüsselsatz von Robert Maynard Hutchins wieder: ‚Education is a conversation aimed at truth.‛ ,Education‛ ist ein auf Wahrheit gerichtetes Gespräch. Das Gespräch wird mit Personen, mit Texten, mit fremden Sprachen und Kulturen, mit anderen Zeiten, mit den verschiedenen Erkenntnisweisen oder -systemen geführt und solchermaßen geübt“.
Sie betont weiter (ebd., S. 90): „Es gibt im Englischen keinen Begriff, der dem deutschen individualistischen, idealistisch gefärbten Terminus ‚Bildung‛ entspricht.“ Vielmehr weiß der englische „Diskurs um ‚Education‛ … um die darin enthaltene Ambivalenz und ist geprägt vom Dilemma und der Balance zwischen den Ansprüchen des Staates und denen des Individuums.“ Ziel von „education“ ist also ein Individualismus, der sich seiner sozialen Einbettung und Prägung bewusst bleibt („social individualism“).
(86) Hull, Fanatic, S. 328: „There can be no wrinkles in the table-cloth of pure belief.“
(87) Ebd., S. 327f.: „We could consider conversion as a ritual for imparting power, and the historical experience of Christianity and Islam offers a contrast in relation to power. Christian faith was born in weakness and has been corrupted through power; Islam was born in victory but is now having to endure the presence of a dominating power.“
(88) Ebd., S. 331: „We have asked whether and in what ways education might have something to offer in a world where religious fanaticism has become increasingly common. We have seen that if this dangerous phenomenon is to be held in check, new attitudes toward religious faith must be incorporated into contemporary secular policies. In such a climate of respect, religious education whether private or public may make a meaningful contribution. – After all, if education should fail, what then?“
(89) Ebd., S. 329: „The whole history of fanatical religion proves that it flourishes under persecution and is encouraged by repression“.
(90) Ebd., S. 330f.: „inner-religious aspect… history should help young people to see that the faith tradition has been understood differently by the faithful down the centuries. …
inter-religious aspect … religious education should be conceived of as dialogue, and that topics and themes which at least some religions have in common should help pupils to see that while sometimes a religion will have clear boundaries, at other times the border is quite porous. Elements drift between traditions, and religions influence each other. This is not inconsistent with belief in the unique character of each faith. Particular attention should be given to the teachings of the principal religions on peace, and the capacity of religions to produce peace militants should be emphasised …
intra-religious aspect … religion as a general phenomenon and the specific religions should be understood not only in their own terms (that is, devotionally or theologically) but also through the perspectives of the social sciences, and of history, philosophy and the study of language.“
(91) Dieser Abschnitt geht auf eine Reihe von Aufsätzen im Sammelband Lernprozess ein.
(92) Leimgruber/Renz, S. 375.
(96) Ebd., S. 210f. Leuze fährt an dieser Stelle fort: „Die wechselseitige Anerkennung göttlicher Autorisierung besagt allerdings nicht, dass es unter dieser Voraussetzung nur ein spannungsloses Nebeneinander beider Religionen geben könnte, in dem Sinne, dass jede ihre Grenzen kennt und sich mit ihnen zufrieden gibt. Dieses Nebeneinander ist nicht das Ziel, sondern jener friedliche Wettstreit, von dem der Koran in eindrucksvoller Weise Zeugnis gibt (vgl. Sure 5, 48). Die Religionen müssen sich daraufhin befragen lassen, ob sie den von ihnen erkannten göttlichen Willen in die Tat umsetzen – dass sie angesichts dieser Frage immer wieder ihr völliges Versagen einzugestehen haben, wird an ihrer Geschichte deutlich, die wir bis zu den Ereignissen des 11. September 2001 markieren können.“
Ebd., S. 213: „So wie Gott die Individualität jedes Menschen will und aufgrund dieser Individualität eine spezifische Bestimmung für jeden Menschen vorsieht, kann er auch den Menschen, die an ihn glauben, in einer Pluralität von Bekundungen seines Willens begegnen, ohne dass die eine oder die andere den Anspruch der Ausschließlichkeit erheben könnte. Nur so ist es möglich, die Aussage zu wagen, dass Muhammad der Prophet des einen Gottes ist, der den Menschen die Kundgabe des göttlichen Willens übermittelt hat und zugleich in der christlichen oder auch jüdischen Identität daran festzuhalten, dass diese Kundgabe für uns keinen obligatorischen Charakter hat.“
(97) Zirker, Perspektive, S. 197.
(98) Bauschke, Dialog, S. 223.
(100) Balič, S. 171: „Smail Balič, der kurz nach seiner Manuskriptabgabe verstarb, war Muslim bosnischer Herkunft, viele Jahre im christlich-muslimischen Dialog engagiert und hat sich stets für einen liberalen, toleranten europäischen Islam ausgesprochen.“
(103) Ebd., S. 303, zitiert sie Lähnemann u. a. mit dem Satz: „Der Titel ‚Gottes Sohn‛ bedeutet nicht, dass Gott Söhne und Töchter hätte, wie Menschen Söhne und Töchter haben, sondern dass Gott und Jesus in einzigartiger Weise zusammengehören.“
(104) Ebd., S. 304, ebenfalls ein Lähnemann-Zitat: „ ‚Mission‛ bedeutet im eigentlichen Sinn, den Anderen die Liebe Christi vorzuleben und davon zu erzählen. Genauso ist es ja Aufgabe eines Muslim, seinen Glauben und seine Religion Anderen zu bezeugen (da‛wā) und ein vorbildliches Beispiel in seinem Leben zu geben. Sowohl ‚Mission‛ als auch ,da‛wā‛ bedeuten nicht, die Andersgläubigen mit Versprechungen und Verlockungen von ihrer Religion abspenstig zu machen.“
(105) Bielefeldt, S. 561.
(107) Ebd., S. 56. „Die sittliche Mündigkeit des Menschen, die im modernen säkularen Freiheitsrecht zur Anerkennung kommen soll, bleibt die Mündigkeit eines endlichen Wesens, das der Erfahrung von Scheitern und Schuld nicht entrinnen kann und deshalb auf göttliche Barmherzigkeit angewiesen ist. Mit dem entschiedenen Ja zur menschlichen Mündigkeit als der Art und Weise, wie die Würde des Menschen als eines Verantwortungswesens in der Moderne zur Geltung kommen soll, wird die Frage nach Gott daher gerade nicht obsolet. Im Gegenteil: Gerade der Mensch, der gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen und zu gehen, mag wissen, dass er letztlich nicht in sich selbst Ruhe finden kann.“
(109) Tworuschka, S. 353.
(113) Ebd., S. 447. Vgl. Schumann, S. 88: „Schon Luther hatte die tiefverwurzelte und vorbildliche Ethik der Muslime anerkannt.“
(116) Siehe dazu die Erwägungen von Bernhardt, Pluralistische Theologie, zum Pluralismus der Religionen und von Wrogemann über den „verborgenen Gott“.
(119) Khoury, Koran, S. 42.
(120) Das wurde mir im Zusammenhang mit der Bibel in gerechter Sprache besonders bewusst, die sich (S. 26) als „Beitrag zu einem immer neuen Verständnis der biblischen Texte, die sich auch in unser Leben eingeschrieben haben“, versteht. Ihre Gegner brandmarken die in ihren Augen übertriebene political correctness als Verfälschung des ursprünglichen Aussagewillens der Bibeltexte, während sie das offensichtliche „Unsichtbarmachen“ von Frauen in traditionellen Übersetzungen nicht als Problem wahrnehmen.
(121) Kermani, S. 403: „Dass die Verzierung und die schöne Stimme, die doch menschliches Zutun sind, die Botschaft des Koran erst zur Entfaltung bringen und seine Wirksamkeit erhöhen, widerspricht, könnte man meinen, dem Dogma seiner formalen Vollkommenheit und Unübertrefflichkeit, ist aber eher die Konsequenz aus dem muslimischen Offenbarungskonzept, das von einer ‹Mündlichkeit der Schrift› ausgeht.“
(122) Kermani, S. 9, zufolge „ist die ästhetische Dimension der Religion im muslimischen Selbstverständnis von zentraler Bedeutung, allein schon weil das größte und für viele Theologen einzige Bestätigungswunder des muslimischen Propheten die Schönheit und Vollkommenheit der koranischen Sprache ist“. Von Gegnern des Islam wurde diese Betonung der Ästhetik im Lauf der Kirchengeschichte häufig als Einwand gegen seinen Wahrheitsanspruch ins Feld geführt, zum Beispiel auch, wie Ehmann, S. 147f., schreibt, von Martin Luther, der sich 1542 in seiner „Verlegung des Alcoran“ (= Widerlegung des Korans) unter Rückgriff auf katholische Autoren unter anderem auch bemühte, die „Nichtübereinstimmung des Koran mit der Bibel in Stil und Modus zu erweisen. … Richtig erkannt ist, dass der Islam die göttliche Herkunft des Koran bestätigt sieht in der poetischen Struktur der Suren… Ebenso zutreffend ist die Polemik der Gegner (Juden, Christen) gegen Mohammed als vermeintlichen Dichter… Dennoch ist der Einwand sachlich schwach. … Am meisten überraschen muss jedoch, dass Luther Sprachrhythmik und Seriosität der Verkündigung bzw. der Gerichtsrede gegeneinander ausspielt. Denn die Bedeutung der Rhythmik ist Luther nicht nur aus der prophetischen und der Weisheitsliteratur des AT wie auch urchristlichen Traditionen im NT bekannt, sondern gehört gerade zu den Schätzen seiner eigenen Bibelübersetzung.“
(125) Ebd., S. 532 (Glossar): „i‛ğāz (wörtl. «Unfähigmachen»): die Unnachahmlichkeit oder allgemein der Wundercharakter des Koran“.
(126) Ebd., S. 252. Im Folgenden zitiert er Al-Ğurğāni.
(127) Ebd., S. 272f. (zitiert ohne Anmerkungsziffern im Text)
(131) Letzteres mit Hilfe der „Einführung in das klassische Arabisch“ von Breitinger, die sich „an Muslime und Interessierte“ wendet, „die den Koran gerne auf Arabisch lesen und verstehen möchten, aber noch kein Arabisch können“ (ebd., S. V).
(132) Das konnte ich mir als Theologe im Sommersemester 1972 immerhin so gut aneignen, dass es noch heute für exegetische Überprüfungen von Bibelübersetzungen am hebräischen Urtext reicht, zugegebenermaßen nicht ohne die Hilfe des Computerprogramms „Bibleworks, Version 8.0, 2009“ mit integrierter lexikalischer und grammatischer Unterstützung.
(133) Mit „h·“ umschreibe ich in der Tabelle das gehauchte arabische „h“; eigentlich gehört der Punkt unter das „h“, aber dieses Zeichen steht in der von mir gewählten Schrift nicht zur Verfügung. Für die anderen vier Buchstaben mit nachgestelltem Punkt gilt das entsprechend; bei ihnen handelt es sich um Laute, die es im Deutschen nicht gibt, nämlich die sogenannten emphatischen Laute t·, z·, s· und d· mit dunkler bzw. dumpfer Färbung. In Zitaten arabischer Wörter habe ich in dieser Arbeit auf den unter- bzw. nachgestellten Punkt verzichtet, wodurch die Unterscheidung zu den normalen Lauten h, t, z, s und d verlorengeht.
(134) [K] Zirker, Koran, S. 10.
(135) Erschienen im SKD Bavaria Verlag München. Laut http://auslaenderseelsorge.com/docs/Koranausgaben.html [Link mittlerweile nicht mehr verfügbar] stellen diese Bände ein „Zeugnis einer stark traditionalistischen islamischen Koranauslegung“ dar. „Initiiert [wurde das Projekt] 1973 von Fatima Grimm, damals noch im Islamischen Zentrum München (das geprägt ist von der ägyptischen Muslimbruderschaft), seit 1984 in Hamburg. Ab 1981 fortlaufender Vorabdruck in ‚Al-Islam‛, der Zeitschrift des Islamischen Zentrums München, sowie in 24 Einzelheften beim SKD Verlag. Die Übersetzung wurde zur Gemeinschaftsarbeit, zusammen mit Halima Krausen, Rascha und Ali El-Mahgary, Eva und Omar El Shabassy.“ „Theologische Ausrichtung: In diesen Fußnoten sind Kommentare von Yusuf Ali, Sayed Qutb, Muhammad Asad, Abu l-Ala Maududi zitiert: Sayyid Qutb war der führende Kopf der ägyptischen Muslimbrüder; Yusuf Ali aus Pakistan besorgte die vom Islamic Education Centre, Saudi-Arabien, initiierte englische Übersetzung; Abu l-Ala Maududi ist ebenfalls ein pakistanischer Vertreter der Islamisten; Asad (eigentlich: Leopold Weiss) ist ein konvertierter Jude aus Ungarn.“
(136) Alle folgenden Autorenangaben sind entnommen aus Schimmel, Weisheit, S. 293-298.
(137) „Da die Sprichwörter der islamischen Völker sich stark ähneln, ist auf Quellenangaben verzichtet; die Paschto-Sprichwörter finden sich in der 1961 in Kabul veröffentlichten Sammlung Pashto mathalūna.“
(138) Schimmel, Weisheit, S. 129.
(139) „‛Ali ibn Abi Talib, … erster Imam der Schia, getötet 661 in Kufa. Die ihm zugeschriebenen Sentenzen stammen aus Nahdsch al-balāgha, zsgest. von asch-Scharif ar-Radi, Beirut: al Andalus, 1963.“
(140) Schimmel, Weisheit, S. 190.
(141) „Rumi, Maulana Dschalaluddin, … schrieb in Persisch, gest. 1273 in Konya (Türkei). – Mathnawi, 8 Bde., hrsg. von Reynold A. Nicholson, London/Leiden: Brill/Luzac, 1925-40; s. Masnawi, ausgew. und übers. von Annemarie Schimmel, Basel: Sphinx, 1994.“
(142) Schimmel, Weisheit, S. 95f.
(143) „Muhammad, der Prophet des Islam, dessen Aussprüche, echte und apokryphe, im hadīth vorliegen; gest. 632 in Medina.“ „Worte, die dem Propheten Muhammad zugeschrieben werden, beruhen auf der Sammlung Ahādīth-i Mathnawī, hrsg. von Badi‛uzzaman Furuzanfar, Teheran: Universität, 1965, die auch viele nicht in den kanonischen Sammlungen vorhandene, mystisch getönte Traditionssprüche enthält.“
(144) Schimmel, Weisheit, S. 247.
(145) „Iqbal, Muhammad …, gest. 1938 in Lahore.“
(146) Schimmel, Weisheit, S. 249.
(147) „Ibn ‛Ata Allah, ägyptischer Mystiker des Schadhiliyya-Ordens, gest. 1309 in Alexandrien. – Hikam, »Weisheitssprüche«, in: Bedrängnisse sind Teppiche voller Gnaden, ausgew. und eingel. von Annemarie Schimmel, Freiburg: Herder, 1988.“
(148) Schimmel, Weisheit, S. 161f.
(150) Ebd., S. 18. Auch Antes, Islam, S. 43, widerspricht „der landläufigen Meinung, der Islam predige den Fatalismus, ‚und magische Vokabel ist das Wort ‹kismet›, das man meist vermutlich aus Karl May bezieht – in islamischen Quellen taucht es nie auf.‛“
(151) Schimmel, Weisheit, S. 276.
(157) Bauschke, Jesus, S. 54ff.
(160) Bauschke, Spiegel, S. 167.
(162) Bazargan, 18f. (Einleitung von Navid Kermani).
(163) Khalidi, S. 196, Ausspruch Nr. 263, der zuerst von Abu al-Hajjaj al-Balawi (gest. 604/1207) bezeugt wurde und der in einer Variante, die von Ibn Abi‛l Dunya stammt, David und Mose zugeschrieben wird.
(164) Ebd., S. 198, Ausspruch Nr. 267, der ursprünglich bei Abu al-Husayn Warram ibn Abi Firas (gest. 605/1208) zu finden war.
(165) Ebd., S. 204f., Ausspruch Nr. 282 von Jamal al-Din ibn Wasil (gest. 697/1298). „Die Quelle, aus der diese Erzählung stammt, ist eine bedeutende Chronik über die Aijubiden (die Familie Saladins) und deren Kriege gegen die Kreuzritter).“
(173) Vgl. ebd., S. 157f.: „Wie viel die kolonialen Entschleierungsaktionen übrigens mit Rassismus und wie wenig sie mit Frauenrechten zu tun hatten, zeigt das Beispiel des britischen Generalkonsuls in Ägypten, Lord Cromer, der vehement die Befreiung der ägyptischen Frau durch Entschleierung forderte, während er zugleich in England eine Kampagne gegen das Frauenwahlrecht lancierte… »Er wollte also nicht die Befreiung der ägyptischen Frau, sondern ihre Anpassung an das Modell der englischen Hausfrau und Mutter«, bemerkt dazu die Soziologin Birgit Rommelspacher.
Die Franzosen entschleierten beherzt die Algerierin und rekrutierten sie gleich darauf für ihre Bordelle… Schah Reza Pahlevi zwangsentschleierte die Frauen im Iran mit Hilfe der Polizei. Die deutsch-iranische Wissenschaftlerin Katajun Amirpur zitiert den Bericht eines Mannes, der zu dieser Zeit acht Jahre alt war: »Meine Tante ist 15 Jahre nicht mehr aus dem Haus gegangen. Sie wollte eben ihr Kopftuch nicht abnehmen und sie wollte gegen die Zwangsentschleierung protestieren. Eine andere Tante ging immer nur nachts, heimlich mit dem Kopftuch aus dem Haus.« Als »kolonialen Feminismus« bezeichnet Rommelspacher diese vom Westen beeinflusste Vorstellung, wie eine moderne Frau auszusehen habe. Die Frau, die sieht, aber nicht gesehen wird, frustriert den Kolonisator, interpretiert sie Frantz Fanon und zitiert: »Es gibt keine Gegenseitigkeit. Sie ergibt sich ihm nicht und bietet sich nicht an.« In fast allen islamisch geprägten Ländern hat sich der Fundamentalismus als antikoloniale Bewegung entwickelt, der der Zwangsentschleierung wieder eine Verschleierung entgegensetzte. Dieses symbolische Spiel setzen diejenigen fort, die nun wieder die Entschleierung fordern.“
(181) Ebd., wo sie Göle, S. 166, zitiert.
(182) Mernissi, S. 194-196. Zur Erklärung, warum Frauen dieses System akzeptieren, zitiert sie (S. 197) Bourdieu, S. 44 (frz. Original): „Symbolische Gewalt ist eine Form der Macht, die direkt auf den Körper gehämmert wird, scheinbar wie durch Magie, ohne jeden physischen Zwang. Aber diese Magie funktioniert nur, weil sie die Codes aktiviert, die in die tiefsten Körperschichten eingeschrieben sind.“
Mit einem Stoßgebet beendet Mernissi, S. 199, ihr Buch: „ ‚Ich danke dir, Allah, dass du mir die Tyrannei des Größe-36-Harems erspart hast… Man stelle sich nur einmal vor, die Fundamentalisten würden die Frauen nicht nur zwingen, sich zu verschleiern, sondern auch noch einen Schleier Größe 36 vorschreiben.“
(194) Oestreich, S. 137, Anm. 275, wo sie auf Studien folgender AutorInnen Bezug nimmt: Frese, Karakasoglu, Kelek, Klinkhammer, Moderne Formen und Nökel.
(199) Ebd., S. 143f., wo sie Klinkhammer, Kopftuch, S. 278, zitiert.
(204) Ebd., S. 187f., wo sie Heitmeyer/Dollase, S. 37, zitiert.
